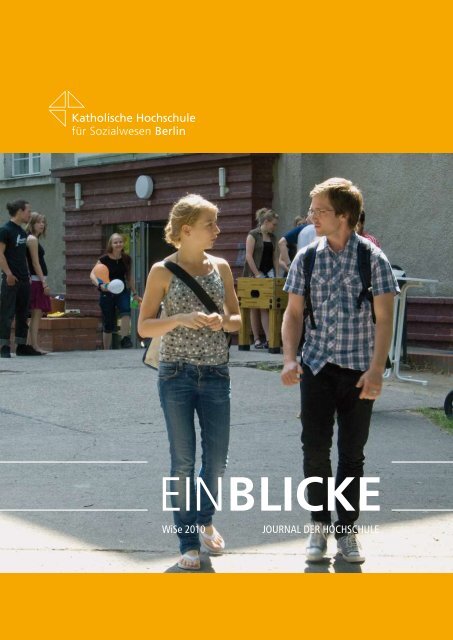Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einblickE<br />
Wise 2010<br />
Journal der HocHscHule
2<br />
Querblick<br />
eiNblick<br />
rückblick<br />
AugeNblick<br />
gott uNd die Welt<br />
FerNblick<br />
Ausblick<br />
Inhalt<br />
soziale gesundheit stärken: das verkannte Potential sozialen<br />
Wohlbefindens / sozialer unterstützung / sozialer sicherheit 4<br />
Studentische Identität und gutes Studium 10<br />
»Ach wie gut, dass niemand weiß ...« Ein Interview mit Ingrid Lutz 12<br />
Weiterbildung Pflegeberatung – ein neues Angebot 13<br />
Neue Koordinationsstelle »Männer in Kitas« 14<br />
Promotionskolleg »Soziale Professionen und Menschen rechte« 15<br />
Forschungsprojekt Ȁlter werdende Eltern und erwachsene<br />
Familienmitglieder mit Behinderung« 16<br />
Auf der Baustelle mit der Startwerkstatt 17<br />
Bachelorpreis der Hamburger Caritasstiftung geht an Studierende der <strong>KHSB</strong> 17<br />
Das Gute im Blick 18<br />
Abschlussbericht der »Kundenstudie« zum unterstützten Wohnen in Berlin 18<br />
Abschluss des europäischen Projekts UNIQ 19<br />
Start des Projektes »Potenziale und Risiken in der familialen Pflege<br />
alter Menschen« 20<br />
Alternative Lehrveranstaltungen an der <strong>KHSB</strong> 20<br />
Zusammenarbeit über Grenzen hinweg 21<br />
Fachgespräch: »Qualitätsanforderungen und Qualitätssicherung internationaler<br />
Praktika und Hospitationen« 21<br />
Religiöse Praxis – die <strong>KHSB</strong> beteiligt sich am interreligiösen Dialog 22<br />
Ehemaliger Student der <strong>KHSB</strong> erhält den Johannes-Stelling-Preis 22<br />
Prof. Dr. Leo J. Penta 23<br />
Prof. Dr. Birgit Bertram 30<br />
Reise nach Oswiecim 24<br />
Die <strong>KHSB</strong> auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München 25<br />
Wie machen es die anderen? 26<br />
Kleine Schritte, die die Welt verändern… 27<br />
Sattelt die Hühner, wir reiten nach Texas! 27<br />
Internationaler Tag an der <strong>KHSB</strong> 28<br />
Sport und Behinderung 28<br />
Gerechte Finanzierung der Pflege 29<br />
Veranstaltungen des ForumFamilie 29<br />
Case-Management in der Sozialen Arbeit 29
Vorausblick<br />
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
ich freue mich, Ihnen die vierte Ausgabe unserer Hochschulzeitung Einblicke<br />
vorzulegen. Zu Beginn des Wintersemesters 2010 / 11 geben wir Ihnen einen Einblick<br />
in neue Entwicklungen in der Hochschule und blicken auf eine Vielzahl von<br />
Projekten des Sommersemesters zurück. Vorangestellt ist der neuen Ausgabe als<br />
QUERBLICK ein Beitrag von Prof. Dr. Dieter Röh mit dem programmatischen Titel<br />
»Soziale Gesundheit stärken«. Gesundheit braucht mehr als medizinische Versorgung.<br />
Gesundheit ist abhängig von sozialen Bedingungen. Diesen Zusammenhang<br />
zu reflektieren, durch Forschung auszuleuchten und Handlungsmethoden für gesundheitsorientierte<br />
Soziale Arbeit im Studium zu vermitteln, ist das Anliegen der<br />
Instituts für Soziale Gesundheit und der katholischen Hochschule insgesamt. Soziale<br />
Gesundheit ist ein Profilelement der katholischen Hochschule. Wir ermöglichen<br />
den Studierenden bereits im Bachelorstudium, sich in einem entsprechenden Studienschwerpunkt<br />
mit Anforderungen an eine gesundheitsorientierte Soziale Arbeit<br />
zu befassen. Der Weiterbildungsmasterstudiengang »Klinische Soziale Arbeit« leistet<br />
eine Vertiefung und Ausdifferenzierung der sozialarbeiterischen Konzepte für<br />
die Bearbeitung komplexer psychosozialer Problemlagen. Ich freue mich, dass wir<br />
in den letzten Tagen die Nachricht erhielten, dass dieser Weiterbildungsstudiengang<br />
gerade erfolgreich reakkreditiert wurde. Der Beitrag von Prof. Dr. Röh steckt<br />
den Rahmen und die Aufgaben einer gesundheitsbezogenen klinischen Sozialen<br />
Arbeit ab. Wie denken Studierende über das Studium an der <strong>KHSB</strong>? Was ist gutes<br />
Studium? Einen kleinen EINBLICK gibt das Forschungsprojekt »Studentische Identität<br />
und gutes Studium«. Es verweist auf die Notwendigkeit der kontinuierlichen<br />
Arbeit an der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Lehre, Forschen<br />
und Administration im Hochschulalltag. Darauf haben sich Lehrende, Studierende<br />
und Verwaltungsmitarbeiterinnen während eines Hochschultags im Mai dieses<br />
Jahres verständigt. Eine hochschulübergreifende Konsultation zum Thema Qualität<br />
in Praktika und Hospitationen im Ausland führte in der <strong>KHSB</strong> Studierende und<br />
Lehrende der drei Berliner Fachhochschulen des Sozialwesens und Vertreterinnen<br />
der Akademie Jabok in Prag zusammen. Im RÜCKBLICK berichten wir über eine<br />
Reihe von Forschungsprojekten, die in jüngster Zeit Ihre Arbeit erfolgreich beendet<br />
oder gerade aufgenommen haben. Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfehle<br />
ich die beiden Praxisforschungsprojekte Ȁlter werdende Eltern und erwachsene<br />
Familienmitglieder mit Behinderung« und das Projekt »Potenziale und Risiken in<br />
der familialen Pflege alter Menschen«. Beide Praxisforschungsprojekte haben im<br />
Sommersemester ihre Arbeit aufgenommen. Sie greifen Fragen auf, die mit der<br />
demographischen Veränderung unserer Gesellschaft verbunden sind und Herausforderungen<br />
für die sozialen Professionen bergen.<br />
Ich empfehle die vielfältigen Einblicke in das Leben der <strong>KHSB</strong> Ihrer<br />
Aufmerksamkeit.<br />
3
4<br />
Querblick<br />
soziale gesundheit stärken: Das verkannte potential sozialen<br />
Wohlbefindens/sozialer unterstützung/sozialer sicherheit<br />
1. EInlEItung: Was macht uns EIgEntlIch krank?<br />
DIE top-tEn DEr hEalth rIsks DEr Who<br />
Soziales und Gesundheit, das scheinen auf den ersten Blick<br />
zwei verschiedene Dimensionen und Kategorien zu sein. Soziales<br />
– das hat scheinbar etwas mit Abweichung, Randgruppen,<br />
Kriminalität, Jugendhilfe, Arbeitslosigkeit, Sozialamt zu tun, also<br />
mit etwas, dass es nur bestimmte, marginalisierte, an den Rand<br />
gedrängte Bevölkerungsgruppen betrifft. Gesundheit dagegen<br />
– das hat etwas mit uns allen zu tun: Jeder und jede, ob jung<br />
oder alt, ob Frau oder Mann, ob mit oder ohne Migrationshintergrund,<br />
ob arm oder reich, wir alle hegen und pflegen unsere<br />
Gesundheit und vermeiden oder erleiden Krankheit. Doch ist der<br />
augenscheinliche Gegensatz auch ein tatsächlicher, d.h. hält er<br />
wissenschaftlichen Kriterien und Ansprüchen stand? Schon die<br />
Hinführung zur Frage lässt erkennen, dass dies gewiss nicht so<br />
ist bzw. sein kann und der genauere Blick, den ich im Folgenden<br />
einnehmen möchte, zeigt uns, dass es keineswegs so ist.<br />
Lediglich die öffentliche Meinung, die laienhafte Betrachtung<br />
und auch die medial transportieren Bilder über Gesundheit und<br />
Krankheit lassen so etwas vermuten. In diesem Beitrag soll es um<br />
die Darstellung der sozialen Grundlagen von Gesundheit ebenso<br />
wie um die Frage nach der Herstellung sozialer Gesundheit<br />
gehen. Ein prominenter Platz wird dabei der Sozialen Arbeit als<br />
Expertise für die Zusammenhänge zwischen individueller Lebensführung<br />
und externen, kollektiven Umwelten mit Risiken und<br />
Ressourcen zuerkannt. Soziale Arbeit verfügt wie keine andere<br />
Profession bzw. Disziplin über genügend Kontext- und Anwendungswissen,<br />
um soziale Gesundheit herzustellen. Dass sie dies<br />
nicht allein aus wissenschaftlicher Begründung und professioneller<br />
Tätigkeit heraus kann, werden die Hinweise auf gesellschaftliche<br />
Zusammenhänge zwischen sozialer Lage und Gesundheit<br />
zeigen. Trotzdem soll versucht werden, die Handlungsbeiträge<br />
der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit in Form von Gesundheitsförderung,<br />
Gesundheitsberichterstattung, Klinischer<br />
Sozialarbeit und Krankenhaussozialarbeit aufzuzeigen und damit<br />
das Potential eines konsequenten Einbezugs der sozialen Seite<br />
der Gesundheit zu verdeutlichen. Für einen ersten Zugriff auf<br />
das Thema lohnt sich ein Blick auf die Top-Ten der Gesundheitsrisiken,<br />
die die Weltgesundheitsorganisation (2009, 9) für die<br />
menschliche Gesundheit erkennt: »More than one third of the<br />
world’s deaths can be attributed to a small number of risk factors.<br />
The 24 risk factors described in this report are responsible<br />
for 44% of global deaths and 34% of DALYs; the 10 leading risk<br />
factors account for 33% of deaths. […] The five leading global<br />
risks for mortality in the world are high blood pressure, tobacco<br />
use, high blood glucose, physical inactivity, and overweight and<br />
obesity. […] The leading global risks for burden of disease in the<br />
world are underweight and unsafe sex, followed by alcohol use<br />
and unsafe water, sanitation and hygiene.«
Die Aufzählung verrät uns also zunächst, dass bestimmte Gesundheitsrisiken,<br />
wie z.B. Bluthochdruck, Tabakkonsum, hoher<br />
Blutzucker, Bewegungsmangel und Übergewicht, für einen<br />
Großteil tödlicher Krankheiten verantwortlich sind. Diese sind,<br />
wie sich unschwer erkennen lässt, alle mit sogenannten Zivilisationskrankheiten,<br />
wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen,<br />
Diabetes oder Krebs, verbunden und damit dem Lebensstil moderner<br />
Menschen in den industriell entwickelten Staaten dieser<br />
Welt geschuldet. Die Aufzählung zeigt uns aber auch, dass sich<br />
daneben nach wie vor auch genügend Gesundheitsrisiken im<br />
Bereich von Untergewicht, ungeschütztem Geschlechtsverkehr,<br />
Alkoholmissbrauch und unsauberem Wasser bzw. mangelnder<br />
Hygiene und dies vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern<br />
finden lassen. Zerfällt die Welt also in zwei Teile, deren<br />
Gesundheitsrisiken recht unterschiedlich sind? Die einen gefährden<br />
durch ihren Lebensstil ihre Gesundheit und die anderen leiden<br />
unter den mangelhaften Umständen im Bereich Ernährung,<br />
Versorgung und Gesundheitsverhalten? Sicherlich spricht einiges<br />
für diese Polarität im Bereich der Gesundheitsstörungen bzw.<br />
des Gesundheitsverhaltens, jedoch gibt es auch hierzulande genügend<br />
Hinweise für eine soziale Verursachung von Krankheiten<br />
bzw. eine Mitverursachung respektive Verschlechterung derselben.<br />
Denn wie Abbildung 1 zeigt, ist, weltweit gesehen, die<br />
Ausstattung und der Zugriff auf ökonomische Mittel, hier ausgedrückt<br />
durch das Einkommen der Bevölkerung, ein wesentlicher<br />
Faktor, der das Krankheitsrisiko zum Teil erheblich potenziert.<br />
Menschen mit geringem Einkommen sind beispielsweise sowohl<br />
im Bereich des Gesundheitsverhaltens (siehe hierzu die ernährungsrelevanten<br />
Faktoren, wie z.B. hoher Blutzucker oder hohes<br />
Cholesterin) als auch im Bereich der Umweltfaktoren (siehe hierzu<br />
Untergewicht bei Kindern oder unsauberes Wasser) größeren<br />
Risiken ausgesetzt.<br />
Figure 7: Percentage of disability-adjusted life years (DALYs) attributed to 19 leading risk factors,<br />
by country income level, 2004.<br />
Childhood underweight<br />
Unsafe sex<br />
Alcohol use<br />
Unsafe water, sanitation, hygiene<br />
High blood pressure<br />
Tobacco use<br />
Suboptimal breastfeeding<br />
High blood glucose<br />
Indoor smoke from solid fuels<br />
Overweight and obesity<br />
Physical inactivity<br />
High cholesterol<br />
Occupational risks<br />
Vitamin A deficiency<br />
Iron deficiency<br />
Low fruit and vegetable intake<br />
Zinc deficiency<br />
Illicit drugs<br />
Unmet contraceptive need<br />
High income<br />
Middle income<br />
Low income<br />
0 1 2 3 4 5 6 7<br />
Percent of global DALYs (total: 1.53 billion)<br />
Abb. 1: Todesfälle mit verursachenden Gesundheitsrisiken in Verbindung<br />
mit dem Einkommensniveau (WHO 2009, 104)<br />
Noch stärker schlägt diese Ungleicheit zu Buche, wenn man sich<br />
die Lebensjahre mit schlechter Gesundheit (disability-adjusted<br />
life years) anschaut, eine Maßzahl, die nicht auf die Lebensdau-<br />
er rekurriert, sondern die gesunden bzw. kranken Lebensjahre<br />
wiedergibt: In Abb. 2 ist klar zu sehen, dass sich hier die Einkommensverteilung<br />
erheblich negativer auswirkt als noch bei<br />
den Risiken selbst, d.h. die Folgen von beispielsweise schlechter<br />
Ernährung oder Alkohol- und Tabakkonsum wirken sich negativer<br />
bei geringem Einkommen aus als bei mittleren oder höheren<br />
Einkommen.<br />
Figure 6: Deaths attributed to 19 leading risk factors, by country income level, 2004.<br />
High blood pressure<br />
Tobacco use<br />
High blood glucose<br />
Physical inactivity<br />
Overweight and obesity<br />
High cholesterol<br />
Unsafe sex<br />
Alcohol use<br />
Childhood underweight<br />
Indoor smoke from solid fuels<br />
Unsafe water, sanitation, hygiene<br />
Low fruit and vegetable intake<br />
Suboptimal breastfeeding<br />
Urban outdoor air pollution<br />
Occupational risks<br />
Vitamin A deficiency<br />
Zinc deficiency<br />
Unsafe health-care injections<br />
Iron deficiency<br />
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000<br />
Mortality in thousands (total: 58.8 million)<br />
Abb. 2: Anteile an »disability-adjusted life years (DALYs)« bezüglich der<br />
19 führenden Risikofaktoren, in Verbindung mit dem Einkommensniveau<br />
(WHO 2009, 10)<br />
Liegt also in der sozialen Lage der Menschen selbst ein gesundheitliches<br />
Risiko? Die genannten sozialepidemiologischen Daten<br />
deuten darauf hin und geben somit Anlass für eine verknüpfende<br />
Betrachtung beider Dimensionen: des Sozialen und der<br />
Gesundheit. Zur Erklärung des augenfälligen Zusammenhangs<br />
bieten sich zwei Modelle an: Zum einen wird in der sog. Verursachungshypothese<br />
davon ausgegangen, dass sich ein schlechter<br />
sozio-ökonomischer Status negativ auf die Gesundheit auswirkt,<br />
zum anderen erklärt die sog. Drift-Hypothese, warum kranke<br />
Menschen (insbesondere chronisch kranke Menschen) häufiger<br />
von Armut oder einem schlechten sozio-ökonomischen Status<br />
betroffen sind als gesunde (vgl. Mielck 2000).<br />
2. Warum machen uns soziale Faktoren krank?<br />
theoretische grundlagen und Erklärungsmodelle<br />
High income<br />
Middle income<br />
Low income<br />
Die oben erwähnten Hypothesen lassen sich bislang vor allem<br />
über ein transitives Modell erklären, das annimmt, dass bestimmte<br />
soziale Ungleichheiten für ein bestimmtes Risikoniveau<br />
verantwortlich sind, das dann wiederum auf die Gesundheit<br />
Einfluss nimmt. So entstehen durch die jeweilige soziale Lage<br />
zum einen Unterschiede in den gesundheitlichen Belastungen<br />
selbst, zum anderen aber auch im Bereich der Inanspruchnahme<br />
gesundheitlicher Versorgung. Schließlich spielt auch das gesundheitsbezogene<br />
Verhalten selbst, also z. B. die Einstellung zur<br />
eigenen Gesundheit und das daraus resultierende Maß an ge-<br />
5
6<br />
Querblick<br />
sundheitsbewusstem Verhalten, eine entsprechende Rolle: Neben<br />
den oben referierten Erkenntnissen und Erklärungen stehen der<br />
Sozialen Arbeit im Bereich von Gesundheit und Krankheit weitere<br />
Theorien zur Verfügung. Mit der Sozialökologie oder ökosozialen<br />
Theorie verfügt sie über ein Grundverständnis, das das<br />
Verhalten von Menschen in einem transaktionalen Zusammenhang<br />
mit ihren Verhältnissen sieht. Menschen agieren in einer<br />
sie umgebenden natürlichen, kulturellen und sozialen Umwelt,<br />
aus der sowohl Risiken wie auch Ressourcen für die Erhaltung<br />
von Gesundheit oder die Vermeidung von Krankheit resultieren.<br />
unterschiede in den<br />
gesundheitlichen<br />
Belastungen<br />
(z. B. psychische und<br />
physische Belastung am<br />
Arbeitsplatz)<br />
soziale ungleichheit<br />
(Unterschiede in Wissen, Macht, Geld und Prestige)<br />
unterschiede in den<br />
Bewältigungsressourcen,<br />
Erholungsmöglichkeiten<br />
(z. B. soziale Unterstützung,<br />
Grünfläche in der<br />
Wohnumgebung)<br />
unterschiede im gesundheitsverhalten<br />
(z. B. Ernährung, Rauchen, Compliance)<br />
gesundheitliche ungleichheit<br />
(Unterschiede in Morbidität und Mortalität)<br />
unterschiede in der<br />
gesundheitlichen<br />
Versorgung<br />
(z. B. Zahnersatz, Arzt-<br />
Patient-Kommunikation)<br />
Abb. 3: Erklärungsmodell zur gesundheitlichen Ungleichheit,<br />
Mielck 2000, S. 173<br />
Sozialökologisch gedacht wird dabei Lebensführung als fortlaufender<br />
Bewältigungsprozess verstanden, der eine dynamische<br />
und auf eine gelingende Lebensführung abzielende, beständige<br />
Auseinandersetzung mit den individuellen Lebenszielen und<br />
–möglichkeiten sowie den in der Umwelt vorfindlichen Ressourcen<br />
und Begrenzungen der eigenen Lebensführung umfasst. In<br />
Abwandlung eines bekannten Satzes von Karl Marx (aus: »Der<br />
achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte«) könnte man sagen:<br />
Die Menschen machen ihre eigene Gesundheit, aber sie machen<br />
sie nicht nur aus freien Stücken, nicht nur unter selbstgewählten,<br />
sondern auch unter unmittelbar vorgefundenen und gegebenen<br />
Umständen. Bei dem medizinsoziologischen Stressforscher Aaron<br />
Antonovsky finden wir ein ähnliches Gesundheitsverständnis,<br />
das wiederum für den Zusammenhang von sozialer Lage und<br />
Gesundheit entscheidende Hinweise liefert. Antonovsky (1997)<br />
beschrieb in seinem Modell der »Salutogenese« das Zusammenwirken<br />
einer individuellen, psychologischen Variable, die er »Kohärenzgefühl«<br />
nannte, und sozialen Variablen, die er unter dem<br />
Terminus »Generalisierte Widerstandsressourcen« zusammenfasste.<br />
Das Kohärenzgefühl als ein Persönlichkeitsfaktor spiegelt<br />
nach Ansicht Antonovskys eine psychische Disposition wider, die<br />
allerdings durch Erfahrungen erworben wird und nach der Menschen<br />
in unterschiedlichem Maße davon überzeugt sind, dass sie<br />
etwas an ihrer Lage, auch ihrer Gesundheit, verändern können<br />
oder nicht. Das Kohärenzgefühl besteht aus drei Teilkomponenten:<br />
erstens durch die Fähigkeit zum Verstehen der jeweiligen<br />
Anforderungen (sense of comprehensibility), die mich in die Lage<br />
versetzt, Informationen in einem Bewertungsprozess als relevant,<br />
irrelevant, herausfordernd oder gefährlich und auch deren<br />
Herkunft, voraussichtlicher Dauer und Dringlichkeit einschätzen<br />
zu können. Zweitens zählt zum Kohärenzgefühl auch die Fähigkeit<br />
zum adäquaten Umgang mit diesen Erkenntnissen und der<br />
Bewältigung im engeren handlungszentrierten Sinne (sense of<br />
manageability). Diese Fähigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass<br />
ich zur Lösung einer erkannten Herausforderung bzw. eines<br />
Problems die nötigen praktischen Fähigkeiten besitzen muss, um<br />
es anzugehen. Hierzu gehören also wiederum Kenntnisse über<br />
Lösungswege und Bewältigungsressourcen wie auch Fertigkeiten<br />
zu deren Umsetzung. Drittens gehört zum Kohärenzgefühl nach<br />
Ansicht Antonovskys eine motivationale Komponente (sense of<br />
meaningfulness), die anzeigt, wie viel Energie jemand zur Bewältigung<br />
des Problems aufbringen kann. Wesentlich hierbei ist, wie<br />
viel »Sinn« in dem Problem selbst gesehen wird und vor allem,<br />
wie stark die Überzeugung ist, das durch das eigene Handeln etwas<br />
zu verändern bzw. zu bewirken ist. Neben dieser individuellen<br />
Konstitution setzt das Modell der Salutogenese auch auf die<br />
sog. »Generalisierten Widerstandsressourcen«, die Antonovsky<br />
in individuellen (z.B. körperlichen Faktoren, Intelligenz, Bewältigungsstrategien)<br />
als auch in sozialen und kulturellen Faktoren<br />
(z.B. soziale Unterstützung, finanzielle Möglichkeiten, kulturelle<br />
Stabilität) sah. Unterm Strich wird deutlich, dass sich auch mithilfe<br />
dieses Modells die Zusammenhänge zwischen individueller<br />
Konstitution (Verhalten) und sozialer Verfasstheit (Verhältnisse)<br />
verstehen lassen. Zuletzt hat die Weltgesundheitsorganisation im<br />
Jahre 2001 mit ihrer International Classification of Functioning,<br />
Disability and Health (ICF) diesem bipolaren, aber komplementären<br />
Verständnis Rechnung getragen und die Entstehung von<br />
Behinderung als negative Wechselwirkung zwischen einer Gesundheitsstörung<br />
und Umweltfaktoren sowie personenbezogenen<br />
Faktoren definiert (Deutsche Übersetzung unter www.dimdi.<br />
de). Überhaupt setzt die Weltgesundheitsorganisation schon seit<br />
ihrem Bestehen auf ein multidimensionales Gesundheitsverständnis<br />
und proklamierte schon 1948, dass Gesundheit ein Zustand<br />
vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens<br />
sei und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung.<br />
Diese biopsychosoziale Sichtweise setzte sich auch in der<br />
o.g. ICF sowie in der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung<br />
(1986) durch und sollte als unumstrittener Maßstab für jedwedes<br />
Handeln im Bereich der Gesundheitsversorgung gelten.<br />
Umgesetzt finden wir es jedoch bislang hauptsächlich in der<br />
Rehabilitation, dort vor allem in psychosomatischen, psychotherapeutischen<br />
oder psychiatrischen Einrichtungen und wesentlich<br />
seltener in rein somatischen Fächern der Medizin. Lediglich die<br />
sog. »Integrierte Medizin« (v. Uexküll/Wesiack, 2003) leitet ihr<br />
Handlungskonzept konsequent aus einem solchen biopsychosozialen<br />
Modell ab, ebenso wie die Klinische Soziale Arbeit (Pauls<br />
2004, Ortmann/Röh 2008).
3. FormEn Von gEsunDhEItsBEzogEnEr sozIalEr arBEIt<br />
Soziale Arbeit kann auf den oben beschriebenen Zusammenhang<br />
durch ihre Expertise für die Zusammenhänge zwischen<br />
Individuum und Gesellschaft oder zwischen dem »Psychosomatischen«<br />
(Leib, Geist, Handeln) und dem »Sozialen« (Beziehungen,<br />
Normen, materielle Umgebung) in vielerlei Weise Einfluss<br />
nehmen. Traditionell ist die Soziale Arbeit als Beruf schon in<br />
ihren Pionierjahren (um 1900) als Fürsorgearbeit im Gesundheitswesen<br />
bzw. Gesundheitssektor tätig gewesen. Alice Salomon<br />
(1872-1948), die 1908 die erste soziale Frauenschule mit dem<br />
Anspruch der Professionalisierung des bisherigen, häufig ehrenamtlichen<br />
Helfens aufbaute, berichtet in ihrem Werk »Sociale<br />
Diagnose« von 1926 von einer Aussage des amerikanischen Arztes<br />
Richard Cabot und schrieb hierzu: »Noch enger wurde das<br />
Zusammenwirken von Arzt und Fürsorgerin in der sozialen Krankenhausfürsorge,<br />
für die uns die ersten Anregungen aus Amerika<br />
gekommen sind. Hierbei sind die sozialen Ermittlungen oft<br />
geradezu als Unterlagen für die ärztliche Diagnose zu verwenden.<br />
Dr. Richard Cabot aus Boston, Begründer einer der ersten<br />
sozialen Krankenhausfürsorge-Stellen, wollte durch Anstellung<br />
geschulter Sozialbeamtinnen nicht eine Vermischung von ärztlicher<br />
und sozialer Arbeit, sondern eine chemische Verbindung<br />
von beiden herbeiführen. Er sagt: »Wenn wir zusammenfassend<br />
über unsere Fälle in der sozialen Krankenhausfürsorge berichten,<br />
legen wir uns vier Fragen vor: 1. Wie ist der Gesundheitszustand<br />
des Patienten? 2. Wie ist sein Charakter, sein geistig-moralischer<br />
Zustand? 3. Wie sind die äußeren Verhältnisse beschaffen, unter<br />
denen er aufgewachsen ist und lebt? 4. Wie sind die geistigseelischen<br />
Einflüsse beschaffen, unter denen er aufgewachsen ist<br />
und lebt? Der Arzt weiß in der Regel viel über den ersten Punkt,<br />
etwas über den zweiten – über die beiden anderen so gut wie<br />
nichts auszusagen.« (S. 5 f.) Das hier in Andeutungen ersichtliche<br />
hierarchische Unterstellungsverhältnis, dass nämlich die<br />
sozialen Ermittlungen als Unterlagen für die ärztliche Diagnose<br />
zu verwenden seien, finden wir auch heute häufig wieder, wenn<br />
sich beispielsweise Soziale Arbeit im Krankenhaus als sozialadministrative<br />
Tätigkeit darstellt, die sich parallel neben der medizinischen<br />
Behandlung hauptsächlich als Sozialberatung sowie Organisation<br />
von Anschlussheilbehandlungen oder Nachsorge (etwa<br />
Unterbringung in Pflegeheimen bei älteren Patienten) manifestiert.<br />
Dass aber durch die Soziale Arbeit selbst ein Behandlungseffekt<br />
erzielt werden kann, und sei es auch nur, dass die medizinischen<br />
Behandlungen dadurch besser vom Patienten angenommen<br />
oder im häuslichen Alltag umgesetzt werden können oder<br />
der behandelnde Arzt gleich auf die lebensweltlichen Zusammenhänge<br />
hingewiesen wird, liegt auf der Hand. Hierzu noch<br />
einmal Richard Cabot, zitiert nach Alice Salomon: »Die soziale<br />
Arbeit hat nicht einen besonderen Gesichtswinkel, sondern ist<br />
auf den gesamten Menschen eingestellt, und das kann der soziale<br />
Arbeiter den Ärzten nahe bringen, die durch ihre Ausbildung<br />
oft dazu verführt werden, das Blickfeld zu verengen.« (S. 6). In<br />
dieser Zeit manifestierte sich die Gesundheitsfürsorge als Tätigkeit<br />
in den Bereichen der psychiatrischen Anstalten und sonsti-<br />
gen Rehabilitationsstätten ebenso wie in der Trinkerfürsorge, in<br />
den Gesundheitsämtern (dort v.a. als Tuberkulose-Fürsorge und<br />
Hygiene-Beratung) und in der Schulgesundheitspflege. Ziel dieser<br />
Bemühungen war es, neben der Verhinderung der Ausbreitung<br />
von ansteckenden Krankheiten, wie etwa der Tuberkulose, auch<br />
die Lebens- und Wohnbedingungen der Menschen insgesamt,<br />
und zuvorderst in den Großstädten mit ihrer engen Bebauung<br />
und den dunklen, unhygienischen, stickigen Mietwohnungen,<br />
zu verbessern. Auch war mit dieser Gesundheitsfürsorge ein<br />
gewisser Erziehungsanspruch verbunden, der die Menschen in<br />
ihrem Lebensstil zu Mäßigung, Sauberkeit und Ordnung anhalten<br />
sollte. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beteiligten sich<br />
aber auch an den ersten Untersuchungen über gesundheitliche<br />
Missstände im Rahmen der sog. Sozial-Enquêten, die hauptsächlich<br />
von den gerade erst entstandenen Krankenkassen oder auch<br />
von Wohnungsbaugenossenschaften durchgeführt wurden. Soziale<br />
Arbeit hat also sehr früh einen Bezug zur gesundheitlichen<br />
Lage und Versorgung gehabt und diesen in den letzten 100<br />
Jahren auch ausbauen können. So beschreiben Ortmann/Waller<br />
(2005) immerhin elf verschiedene Handlungsfelder, in denen<br />
gesundheitsbezogene Soziale Arbeit stattfindet. Dabei kann man<br />
zwischen Tätigkeiten im Gesundheitswesen (im Krankenhaus, im<br />
Öffentlichen Gesundheitswesen, in der gesetzlichen Krankenversicherung,<br />
in der Sozialpsychiatrie, in der Suchtkrankenhilfe und<br />
in der Rehabilitation) und solchen im Sozialwesen (Kindergärten,<br />
Jugendhilfe, Schulen, Stadtteil, Wohnungslosenhilfe) unterscheiden.<br />
Sting/Zurhorst (2000) gehen von fünf großen Bereichen<br />
aus: Gesundheits-Selbsthilfe, Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit,<br />
Suchtkrankenhilfe, Klinische Sozialarbeit.<br />
4. VIEr tätIgkEItsFElDEr EInEr gEsunDhEItsBEzogEnEn<br />
sozIalEn arBEIt<br />
An dieser Stelle möchte ich vor allem vier Ansätze bzw. Tätigkeitsbereiche<br />
unterscheiden, nämlich die Gesundheitsförderung<br />
und die Gesundheitsberichterstattung als allgemeine und die<br />
Krankenhaussozialarbeit und die Klinische Sozialarbeit als besondere<br />
Formen der Sozialen Arbeit im Bereich von Gesundheit und<br />
Krankheit. Die Darstellung wird notwendigerweise auf Skizzen<br />
der jeweiligen Bereiche reduziert bleiben müssen.<br />
gesundheitsförderung<br />
Mit der Entdeckung von bakteriellen und viralen Übertragungswegen<br />
durch Robert Koch Ende des 19. Jahrhunderts erreichte<br />
die Medizin einen neuen Zugang zu Krankheiten, die sie nicht<br />
länger nur behandeln, sondern denen sie auch in weiten Teilen<br />
vorbeugen konnte. Aufklärung und Information über notwendige<br />
Hygienemaßnahmen sowie weitere Maßnahmen, wie etwa<br />
der Bau von Kanalisationen und einer Frischwasserversorgung<br />
in den Städten, führten dazu, dass Übertragungskrankheiten<br />
wie Tuberkulose oder auch Typhus erheblich zurückgingen und<br />
gleichzeitig die weiteren Fortschritte in der Behandlung (und<br />
v.a. die neuen Hygiene-Standards in der Geburtshilfe) für eine<br />
7
8<br />
Querblick<br />
steigende Lebenserwartung der Menschen sorgten. Gegenüber<br />
der Krankheitsvorbeugung, zu der man ein unbedingtes Wissen<br />
über die kausalen Zusammenhänge von Risikofaktoren und<br />
Krankheitsfolgen benötigt, geht die Gesundheitsförderung von<br />
einem anderen Prinzip aus. Sie wird als Prozess verstanden, der<br />
Menschen befähigen soll, durch individuelle und soziale Maßnahmen<br />
mehr Kontrolle über ihre Gesundheit zu erlangen. Gesundheitsförderung<br />
setzt also neben der individuellen Ansprache<br />
an das Gesundheitsverhalten unbedingt auch an den sozialen<br />
Strukturen und sozialen Faktoren an, die die gesundheitliche<br />
Lage von Menschen beeinflussen (siehe den oben beschriebenen<br />
Zusammenhang von sozialer Lage und Gesundheit). Zudem wird<br />
eine andere Philosophie mit Gesundheitsförderung verbunden,<br />
denn anders als im Bereich Prävention wo nach einem pathogenetischen<br />
Muster gedacht und gehandelt wird (»Wie entstehen<br />
Krankheiten?«), wird im Bereich der Gesundheitsförderung eine<br />
salutogenetische Perspektive eingenommen (»Wie entsteht<br />
Gesundheit?«). So werden vor allem die Ressourcen zum gesund<br />
bleiben, statt die Risiken zum krank werden in den Blick<br />
genommen. Gesundheitsförderungsmaßnahmen wirken damit<br />
zwar auf eine Art ebenfalls präventiv, fokussieren aber nicht die<br />
Verhütung einer bestimmten Krankheit, sondern wollen die Gesundheit<br />
der Menschen im Allgemeinen stärken und verbessern.<br />
Ein zentrales Dokument der Gesundheitsförderung ist die bereits<br />
erwähnte Ottawa-Charta der Vereinten Nationen, die 1986 auf<br />
einer der ersten Konferenzen zum Thema veröffentlicht wurde.<br />
Sie definiert verschiedene Handlungsfelder (Entwicklung einer<br />
gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, gesundheitsfördernde Lebenswelten<br />
schaffen, gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen,<br />
persönliche Kompetenzen entwickeln, Gesundheitsdienste<br />
neu orientieren), in denen mit den Handlungsstrategien Vernetzung,<br />
Anwaltschaft und Befähigung die gesundheitliche Lage der<br />
Bevölkerung insgesamt verbessert werden soll. Zentral ist dabei<br />
der sog. Setting-Ansatz: Maßnahmen zur Gesundheitsförderung<br />
sollen nicht künstlich angelegt sein, sondern grundlegend in die<br />
Lebenswelt der Menschen integriert werden, z.B. durch entsprechende<br />
Maßnahmen in Schulen, an Arbeitsplätzen, in Städten<br />
usw. Damit gewinnt dieser Ansatz eine deutliche Nähe zur lebensweltorientierten<br />
Sozialen Arbeit und ist deshalb gerade für<br />
viele Bereiche der Sozialen Arbeit von Bedeutung.<br />
gesundheitsberichterstattung<br />
Eine eher indirekte Maßnahme zur Stärkung der sozialen Seite<br />
der Gesundheit ist die seit den 1990'er Jahre entstandene und in<br />
vielen Bereich mittlerweile etablierte Gesundheitsberichterstattung,<br />
die neben den klassischen Berichten über die soziale Lage<br />
der Bevölkerung wesentliche Daten über die gesundheitliche<br />
Lage und die gesundheitliche Versorgung sowie die Häufigkeit<br />
von gesundheitlichen Belastungen liefern kann. Neben den eingangs<br />
zitierten Berichten der WHO werden auch in Deutschland<br />
auf Bundes- (www.gbe-bund.de) als auch auf Länderebene und<br />
vereinzelt auch in den Kommunen in regelmäßigen Abständen<br />
Reporte erstellt, die entweder allgemeine Indikatoren und Maß-<br />
nahmen beschreiben oder spezifische Schwerpunkte setzen, z.B.<br />
zur Kindergesundheit. Zielgruppe der Gesundheitsberichte sind<br />
in erster Linie jene Instanzen, die politische oder strukturelle Entscheidungen<br />
über Maßnahmen oder Veränderungen herbeiführen<br />
können, also Politiker, Arbeitgeber, Verbände, Krankenkassen<br />
und andere Organisationen.<br />
klinische sozialarbeit<br />
Neben einer pädagogischen Ausrichtung hat die Einzelfallhilfe<br />
in der Sozialen Arbeit auch eine therapeutische, behandelnde<br />
Interventionsform herausgebildet, die in Anlehnung an den<br />
anglo-amerikanischen Terminus »Clinical Socialwork« auch in<br />
Deutschland als Klinische Sozialarbeit verbreitet ist. Die »klinische«<br />
Ausrichtung ist jedoch nicht auf »krankenhausbezogen«<br />
zu reduzieren, vielmehr besteht der besondere Ansatz in der<br />
Behandlung von sozio-psycho-somatisch zu verstehenden Störungen,<br />
Erkrankungen und Behinderungen im Allgemeinen, wobei<br />
das »Klinische« weit über eine rein individuelle Betrachtung<br />
von Störungen hinausgeht und sich gerade durch den Einbezug<br />
sozialer Umweltbedingungen auszeichnet. Denn immer ist im<br />
Fall des sozialarbeiterischen Handelns das in Rechnung zu stellen,<br />
was bereits eine Pionierin der Sozialen Arbeit, Jane Addams<br />
(1860-1935) als »vortex causation« bezeichnete: das »kumulative<br />
Feld persönlicher Schwierigkeiten, verwirrenden gesetzlichen<br />
Regelungen, multiplen Krankheiten und konfliktiven Kulturen«<br />
(Addams zitiert nach: Staub-Bernasconi 1995, 49). Krankheiten,<br />
Störungen und Behinderungen entstehen in der Analyse<br />
Klinischer Sozialarbeit in einem Gefüge von bio-psycho-sozialen<br />
Einflüssen und ziehen immer auch entsprechende Folgen in diesen<br />
Bereichen nach sich. Der Wert der gesundheitsbezogenen<br />
Sozialen Arbeit, und damit auch der Klinischen Sozialarbeit als<br />
behandlungskompetenter Professionalität innerhalb der Krankenversorgung<br />
bemisst sich daher am Ziel der Verringerung von<br />
sozialen Gradienten sowohl im Zugang zu Gesundheits- und Sozialleistungen<br />
wie auch in der Bewältigung von gesundheitlichen<br />
und sozialen Problemen. Klinische Sozialarbeit findet in therapeutischen<br />
Kontexten der psychiatrischen, neurologischen aber auch<br />
in somatischen Bereichen der Krankenversorgung statt und liefert<br />
dort wertvolle Beiträge zu einer ganzheitlichen Betrachtung und<br />
Behandlung von Krankheiten. Sie bedient sich dazu moderner<br />
Methoden Sozialer Diagnostik (vgl. Pantucek 2010, Pantucek/<br />
Röh 2009, Heiner 2004) und Sozialer Therapie, um bestmögliche<br />
Interventionen zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage von<br />
Einzelnen, Familien und Gruppen leisten zu können (vgl. Schaub<br />
2008).<br />
krankenhaussozialarbeit<br />
In einer besonderen Form findet Klinische Sozialarbeit auch<br />
als Krankenhaussozialarbeit statt. Diese schon 1905 als soziale<br />
Krankenhausfürsorge vom bereits erwähnten Bostoner Arzt Richard<br />
Cabot gegründete Institution hat sich mittlerweile auch in<br />
Deutschland zur Standardversorgung entwickelt. Jedes Krankenhaus<br />
verfügt über einen Sozialdienst, der sich laut § 112, Abs. 2
Nr. 4 des Vierten Sozialgesetzbuches um die soziale Betreuung<br />
und Beratung von Versicherten kümmern soll, wobei entsprechende<br />
Landeskrankenhausgesetze die Tätigkeitsfelder mitunter<br />
näher spezifizieren. Nicht immer sind in diesen Sozialdiensten<br />
Fachkräfte der Sozialen Arbeit tätig, da mitunter auch Pflegepersonal<br />
oder andere Berufsgruppen eingesetzt werden. Zu den<br />
Aufgabenfeldern bzw. Tätigkeitsbereichen gehören neben der<br />
sozialen Beratung von Patientinnen und Patienten und deren<br />
Angehörigen auch das Case Management (häufig als Entlassungsmanagement)<br />
sowie soziale Gruppenarbeit und vereinzelt<br />
auch Sozio- oder Sozialtherapie. Die Sozialdienste arbeiten dabei<br />
eng mit dem medizinischen, pflegerischen und therapeutischen<br />
Personal des Krankenhauses zusammen. Entscheidend für den<br />
Erfolg der Krankenhaussozialarbeit ist der Zeitpunkt der Einbeziehung<br />
in die Behandlung (früh oder erst kurz vor der Entlassung),<br />
die damit verbundene Dauer und Intensität des Kontaktes<br />
zu den Patientinnen und Patienten sowie die personelle und<br />
organisatorische Ausstattung und Einbindung in die Organisationsstruktur<br />
des Krankenhauses. Klinische Sozialarbeit als Arbeit<br />
im Krankenhaussozialdienst unterstützt die Bewältigungsprozesse<br />
bei akuten, schweren oder chronischen Erkrankungen,<br />
insoweit die soziale Situation der Patienten betroffen ist. Sie<br />
diagnostiziert die die Krankheit beeinflussenden soziale Faktoren,<br />
wie beispielsweise das Vorhandensein einer ausreichenden<br />
materiellen, häuslichen Versorgung oder auch von Angehörigen,<br />
Freunden, Nachbarn, die den Patienten im Sinne sozialer<br />
Unterstützung nach Rückkehr in ihre häusliche Umgebung<br />
entsprechend helfen können. So nennen denn auch 63% der in<br />
einer Studie der Deutschen Vereinigung für den Sozialdienst im<br />
Krankenhaus (heute Deutsche Vereinigung für Sozialarbeit im<br />
Gesundheitswesen, DVSG) befragten Nutzerinnen und Nutzer<br />
eines Kranken haussozialdienstes, dass Gegenstand der Beratung<br />
die Hilfe durch die Familie war. 20% gaben an, dass es um nachbarschaftliche<br />
Hilfe in den Beratungen ging und für 37% war<br />
die Hilfe im Haushalt von entscheidender Bedeutung. Daneben<br />
sind Informationen über Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen,<br />
Sozialstationen und anderweitige Betreuung von Interesse (Layer/Mühlum<br />
2003, S. 35).<br />
Prof. Dr. Dieter Röh ist Professor für Sozialarbeitswissenschaft an der Hochschule für Angewandte<br />
Wissenschaften Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department Soziale<br />
Arbeit. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit,<br />
insb. im Bereich der Behindertenhilfe, Psychiatrie und Klinischen Sozialarbeit<br />
Die Literaturliste zum Artikel kann auf Anfrage gern zugeschickt werden.<br />
E-Mail: kaplow [at] khsb-berlin.de<br />
5. ausBlIck<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit stehen in einem engen Zusammenhang,<br />
wie oben gezeigt werden konnte. Soziale Einflüsse,<br />
wie z.B. die soziale Lage oder auch das Maß an sozialer Integration,<br />
wirken auf die Gesundheit von Menschen ein und Gesundheit<br />
selbst wiederum ist eine starke Ressource zur Bewältigung<br />
von Lebensaufgaben und alltäglichen Anforderungen. Aus<br />
diesem Grunde sollte die soziale Gesundheit der Bevölkerung<br />
viel stärker in den Blickpunkt gerückt werden, hier sind enorme<br />
Potentiale für mehr Gesundheit und auch effektivere Behandlung,<br />
insbesondere von schwerwiegenden oder chronischen<br />
Erkrankungen, zu erwarten. Statt immer mehr Geld in die Medikotherapie<br />
oder die Apparatemedizin zu stecken, sollte sich<br />
einerseits die Medizin selbst wieder zu einer »sprechenden Medizin«<br />
entwickeln und andererseits die sozialen Einflüsse auf Gesundheit<br />
ernsthaft und vollständig in die Versorgung integriert<br />
werden. Hierzu bedarf es auch entsprechender Umsteuerungen<br />
im Versorgungssystem, von denen die Integrierte Versorgung<br />
nach § 140 SGB V eine solche moderne, integrierende Versorgungsform<br />
darstellen könnte. Soll das kooperative Zusammenwirken<br />
von Ärzten, Sozialdiensten, Pflege- und Krankenkassen,<br />
stationären, wie teilstationären und ambulanten Hilfen und<br />
vieler anderer Gesundheits- und Krankheitsinstitutionen erfolgreich<br />
verlaufen, bedarf es schließlich auch einer professionell<br />
ausgeführten und anerkannten Klinischen Sozialen Arbeit bzw.<br />
gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit, die ihre Expertise für die<br />
Zusammenhänge zwischen individuell feststellbarer Krankheit<br />
und lebensweltlichen, sozialen Einflüssen in den notwendigerweise<br />
multiprofessionellen Behandlungsprozess einfließen lassen<br />
kann. Sollte dies geschehen, so ist die soziale Seite der Gesundheit<br />
berücksichtigt und sind die verkannten Potentiale sozialer<br />
Ressourcen angemessen genutzt.<br />
9
10<br />
eiNblick<br />
studentische Identität und gutes studium<br />
eiNblick iN die ergebNisse eiNes ForschuNgsProjektes<br />
Prof. Dr. Ralf Quindel<br />
Der Bolognaprozess, die Rahmenbedingungen<br />
der Hochschulbildung in Deutschland<br />
und die konkrete Gestaltung von Bachelor-<br />
und Masterstudiengänge werden<br />
vielerorts kritisch diskutiert. Studierende<br />
klagen über die Verschulung durch Anwesenheitspflicht<br />
und hohe Prüfungsbelastung,<br />
Hochschullehrer/innen über die<br />
mangelnde Motivation der Studierenden.<br />
Diese Situation war Ausgangspunkt eines<br />
Forschungsprojekts, das die Perspektive<br />
der Studierenden beschreiben und verstehen<br />
möchte. Die qualitative Studie<br />
wurde im Bachelor Soziale Arbeit an der<br />
Katholischen Hochschule für Sozialwesen<br />
Berlin im Wintersemester 2009/2010<br />
von Prof. Dr. Ralf Quindel unter Mitarbeit<br />
der Studierenden André Kremer und<br />
Daniela Stegemann durchgeführt. Nach<br />
einer Datenerhebung in Form von drei<br />
Gruppendiskussionen mit Studierenden<br />
der Sozialen Arbeit aus dem ersten und<br />
siebten Semester, wurde die Auswertung<br />
mit Hilfe eines inhaltsanalytischen Verfahrens<br />
vorgenommen. Aus den Ergebnissen<br />
der Studie werden hier exemplarisch zwei<br />
Aspekte ausgewählt und mit Zitaten aus<br />
den Gruppendiskussionen mit Studierenden<br />
aus dem siebten Semester illustriert.<br />
Die Bedeutung der noten im studium<br />
Durch die Bolognareform sind in die Organisation<br />
des Studiums der Sozialen Arbeit<br />
mit Modulen, workloads und credits<br />
quantifizierbare Steuergrößen eingeführt<br />
worden, die für die Studierenden die<br />
Benotung weit bedeutsamer machen als<br />
im Diplomstudiengang. Dies liegt unter<br />
anderem daran, dass von Beginn an alle<br />
Noten in die Endnote einfließen, sowie<br />
an der Reglementierung des Zugangs<br />
zum Masterstudium. Diese Rahmenbedingungen<br />
verstärken die Konkurrenzorientierung<br />
der Studierenden: Noten<br />
werden nicht als individuelle Bewertung<br />
der eigenen Leistung, sondern primär im<br />
Vergleich gesehen. Es entsteht ein starker<br />
Druck mit guten Noten abzuschließen,<br />
um sich nicht »abgehängt« zu fühlen.<br />
D: Aber wenn ich dann so in der Klausur sehe,<br />
da ist jetzt nicht die Mehrheit, die da jetzt kurz<br />
vorm Durchfallen ist, sondern eigentlich ist das<br />
meiste mit Eins ... Zwei. C: Aber ich find auch<br />
grade das setzt einen nochmal unter Druck.<br />
A: Ja. C: Dass man irgendwie das Gefühl hat:<br />
Man muss jetzt mit Eins abschließen. So ungefähr,<br />
weil alle schließen ja mit Eins oder Zwei<br />
ab.<br />
Es kann ein Widerspruch entstehen zwischen<br />
dem Anspruch, etwas zu lernen,<br />
und dem, eine gute Note zu erreichen:<br />
Seminare und Lehrende mit hohem<br />
Anspruch zu wählen, heißt auch, mehr<br />
leisten zu müssen und doch potentiell<br />
schlechtere Noten in Kauf zu nehmen.<br />
»Wenn du dann wirklich was lernen willst,<br />
dann dahin gehst, wo du denkst okay, von diesem<br />
Prof könnt ich wirklich profitieren, dann<br />
ist es schwer!«<br />
Für die Studierenden gilt es also, eine<br />
Balance zu finden zwischen ihren inhaltlichen<br />
Interessen auf der einen und der<br />
Orientierung an den Rahmenbedinungen<br />
im Sinne eines angepassten, ökonomisch
effizienten Studiums auf der anderen Seite.<br />
Inwiefern diese Balance gelingt, hängt<br />
unter anderem von den strukturellen Rahmenbedingungen<br />
des Studiums ab.<br />
strukturelle Bedingungen für ein aktives,<br />
interessiertes und (selbst-) kritisches<br />
studieren an der khsB<br />
Als wichtige Bedingung wird eine möglichst<br />
große inhaltliche Wahlfreiheit in der<br />
Studiumsgestaltung gesehen, die die Bildung<br />
eigener Interessen ermöglicht. Die<br />
Realität sieht jedoch momentan anders<br />
aus: Der Umfang des verpflichtend zu<br />
bearbeitenden »Stoffes« ist so groß, dass<br />
kaum Zeit bliebt, eigene Interessen und<br />
Neigungen auszubilden.<br />
»So viel … einfach so viel Stoff hat und ich<br />
finde wenig. kaum [?] herauszufinden was einen<br />
wirklich interessiert und sich da auch mehr<br />
zu spezialisieren und dazu mehr zu machen<br />
… sondern man hat halt einfach so viel zu<br />
machen.«<br />
Die mangelnde Wahlfreiheit im Studium<br />
wird kritisiert, das »Ausprobieren« von<br />
Themen und Lehrenden als studentisches<br />
Privileg ist in dem engen Korsett des BA-<br />
Systems nicht mehr möglich.<br />
»Und vielleicht liegt das tatsächlich dann an<br />
diesem Bachelorsystem, dass das da nicht, oder<br />
kaum unterstützt wird (...) Die Möglichkeit<br />
zwei Seminare parallel zu belegen und dann<br />
festzustellen, dass einem das eine schmeckt<br />
und das andere nicht.«<br />
Als gute Studienbedingungen haben die<br />
Studierenden die semesterübergreifenden<br />
und projektorientierten Lehrveranstaltungen<br />
START-Werkstatt und Studienschwerpunkt<br />
hervorgehoben. Die Eigenverantwortung<br />
und die Prozessorientierung wird<br />
hier betont, ebenso, dass in diesen Veranstaltungen<br />
Freiräume vorhanden seien<br />
zu bearbeiten, was wirklich interessiert.<br />
Es sind die längeren Phasen über zwei<br />
Semester hinweg, die auch ein anderes<br />
Erleben von Prozessen erlauben:<br />
»Startwerkstatt ist da schon ein Ansatz. Wo<br />
ein größerer Freiraum ist, wie man auch mit,<br />
auch vom zeitlichen Ablauf her mit anderen<br />
Rhythmen arbeiten kann, als jetzt so eine<br />
Seminarsitzung, die 90 Minuten dauert. Die<br />
Studienschwerpunkte genauso. Was über zwei<br />
Semester geht, was man erst langsam gären<br />
lassen kann so, bis sich Gruppen finden, bis<br />
sich Themen finden. Bis man so dran ist an der<br />
Thematik und das man das über zwei Semester<br />
entwickeln kann find ich (...) vom zeitlichen<br />
Ablauf her ein wichtiges Strukturelement.«<br />
Fazit<br />
Soweit der kurze Einblick in die Ergebnisse<br />
des Forschungsprojektes. Statt einer<br />
Zusammenfassung soll zum Abschluss<br />
eine These zur »Studentischen Identität«<br />
stehen, die beschreibt, wie sich die ge-<br />
sellschaftlichen Widersprüche im Studium<br />
der Sozialen Arbeit spiegeln: Es besteht<br />
eine starke Diskrepanz zwischen dem<br />
durch die Bolognareform etablierten<br />
neoliberalen Studiumsethos (individueller<br />
Leistungswille, Durchsetzungsvermögen,<br />
Konkurrenz, Wettbewerb) und dem von<br />
den Studierenden der Sozialen Arbeit<br />
antizipierten Berufsethos (Reflexionsfähigkeit,<br />
Mitgefühl, Gerechtigkeit, Gleichheit,<br />
Einsetzen für Schwächere, Akzeptanz von<br />
Eigensinn).<br />
Prof. Dr. Ralf Quindel ist Professor für Psychologische<br />
Grundlagen der Sozialen Arbeit und der<br />
Heilpädagogik an der <strong>KHSB</strong>. Der ausführliche<br />
Forschungsbericht ist auf der <strong>KHSB</strong>-Homepage<br />
von Prof. Dr. Ralf Quindel als pdf-Datei veröffentlicht.<br />
11
12<br />
eiNblick<br />
»ach wie gut, dass niemand weiß ...«<br />
Ein Interview mit Ingrid lutz, leiterin des nächsten Durchlaufs der Weiterbildung Drama- und theatertherapie, einem<br />
kooperationsprojekt des referats Weiterbildung mit der Deutschen gesellschaft für theatertherapie (Dgft)<br />
Das Gespräch mit Ingrid Lutz führte Mechthild Schuchert, Studienleiterin <strong>KHSB</strong>.<br />
Frau Lutz, die Hochschule hat die Kooperationsanfrage<br />
der DGfT gern aufgegriffen und<br />
wird gemeinsam mit Ihnen im nächsten Frühjahr<br />
ein zweites Mal die Weiterbildung Dramaund<br />
Theatertherapie beginnen. Für die <strong>KHSB</strong><br />
ist diese Weiterbildung ein weiteres wichtiges<br />
Element in der Qualifizierung von Professionellen<br />
in den Feldern der Sozialen Arbeit, der<br />
Heilpädagogik und der gesundheitsorientierten<br />
Berufe mit kreativen, künstlerischen Methoden.<br />
Wir haben uns auch deshalb gern für eine Zusammenarbeit<br />
mit Ihnen entschieden, weil wir<br />
wissen, dass Sie über vielfältige Erfahrungen<br />
in der dramatherapeutischen Arbeit mit Menschen,<br />
z.B. mit Suchterkrankungen, verfügen.<br />
Wie kann die Dramatherapie hier nutzbar gemacht<br />
werden?<br />
Ich muss etwas ausholen, um Ihnen ein<br />
Beispiel zu nennen, mit dem ich Ihre Frage<br />
hoffentlich anschaulich beantworten<br />
kann. Zum Ende eines dramatherapeutischen<br />
Prozesses mit alkoholabhängigen<br />
Menschen erarbeiteten wir ein Stück mit<br />
dem Titel: »Ach wie gut, dass niemand<br />
weiß…« Dieser Satz bedeutete den Menschen<br />
viel, denn er fasste wesentliche Erfahrungen<br />
mit ihrer Suchterkrankung zusammen:<br />
die Angst, erkannt zu werden,<br />
den Druck, das Suchtverhalten verstecken<br />
zu müssen, die Einsamkeit und die soziale<br />
Isolierung – aber vorrangig die Erfahrungen<br />
im Therapieprozess, wesentliche Teile<br />
der eigenen Person nicht zeigen zu dürfen<br />
oder bagatellisieren zu müssen.<br />
Eine theatertherapeutische Methode<br />
besteht darin, dass die Gruppe die Rollen<br />
entwickelt und einander zuweist. In dieser<br />
Gruppe gab es eine Frau von etwa 50<br />
Jahren, die sehr »unscheinbar« war und<br />
in ihrem Verhalten sehr unterordnend. In<br />
diesem Stück nun wurde ihr die Rolle einer<br />
Domina zugewiesen. Zu meiner größten<br />
Überraschung nahm sie diese Rolle<br />
sofort an und spielte sie mit Lust und Lei-<br />
denschaft. Nach der Aufführung erzählte<br />
sie mir lächelnd, dass ihr Mann sie nicht<br />
erkannt hatte und jetzt ganz begeistert<br />
sei. Er empfand offensichtlich zum ersten<br />
Mal Respekt vor ihr – und das war ein<br />
wichtiger Schritt für ihre Heilung.<br />
Frau Lutz, ich sehe an diesem Beispiel, dass<br />
diese Frau, die sich – wie Sie berichteten –<br />
immer unterordnen musste – gern eine Rolle<br />
nahm, in der sie dominieren darf, stärker noch<br />
ausgedrückt: in der sie über die ihr zugewiesene<br />
Rolle dominieren muss, also eine Antirolle<br />
übernimmt. Wie passt dieses Verhalten zur<br />
»Sucht« und was<br />
bedeutet es in<br />
einem heilenden<br />
Prozess, dass<br />
diese Frau sich<br />
zu einem dominanten<br />
Verhalten<br />
entscheiden kann?<br />
Sie hätte die Rolle<br />
ja auch so spielen<br />
können, dass<br />
z.B. ihr Mann sie<br />
erkennt … also<br />
mit weniger Überzeugungskraft,<br />
mit<br />
weniger Hingabe.<br />
Ihre Sucht drückt die Abhängigkeit von<br />
einem sehr engen Selbstverständnis aus.<br />
Nur über das Suchtmittel gelingt »im<br />
Rausch« kurzfristig der Ausbruch aus<br />
einem engen Korsett, gefolgt von noch<br />
größerer Selbstentwertung, wenn der<br />
Rausch vorbei ist. Und so, wie sie ihre<br />
Lebenswünsche verheimlichen muss,<br />
muss sie auch die Sucht verheimlichen. Im<br />
Schutz des Spiels und der Rolle findet sie<br />
den »Raum«, tabuisierte Verhaltensweisen<br />
und Lebenswünsche auszuprobieren.<br />
Im spielerischen Tun verliert sie die Angst<br />
vor Bedürfnissen, die sie in ihrer Lebensgeschichte<br />
gelernt hat zu verneinen. Und<br />
in diesem Spiel ging es ja nicht darum,<br />
Domina zu sein, sondern auszuprobieren,<br />
wie es sein kann, zu bestimmen und sich<br />
nicht mehr zu unterwerfen. Im dramaund<br />
theaterherapeutischen Handeln geht<br />
es darum, »Spiel-Räume« zu ermöglichen.<br />
Ein schönes Bild – passend zum Leitgedanken<br />
der künstlerischen und kreativen Verfahren, unbewussten,<br />
geheimen und ungenutzten Möglichkeiten<br />
Ausdruck zu verleihen. Wie gelingt<br />
es, diese Fähigkeit zu lehren?<br />
Man kann es nur »am eigenen Leib«<br />
erfahren und lernen. Wir lehren es, indem<br />
wir auch in der Ausbildung »Spiel-<br />
Räume« eröffnen und die Lust, sich zu<br />
entwickeln, ungenutzte Möglichkeiten<br />
zu leben. Ausbilden heißt, geschützte<br />
Räume der Bühne, geschützte Räume der<br />
Rolle und von Ritualen anzubieten und<br />
das Experimentieren zu unterstützen. Erst<br />
danach kann gelernt werden, dies weiterzugeben.<br />
Ich tue so, als ob … und ich kann ja – weil es<br />
doch nur ein Spiel ist – immer wieder zurück ...<br />
Ja, hier liegt die große Chance. Im Spiel<br />
auf der Bühne, im Theater kann ich die<br />
Angst vor einem mir fremden Verhalten
nehmen. Ich darf es probieren. Und es<br />
mir aneignen oder auch wieder verwerfen.<br />
Und weiter spielen …, alles aus noch<br />
einem anderen Blickwinkel sehen.<br />
Welche Haltungen brauchen Sie und was kann<br />
zum Gelingen dieser therapeutischen Arbeit<br />
beitragen?<br />
Ich brauche Respekt vor den Handlungen<br />
der Menschen, mit denen ich<br />
arbeite. In der Sozialen Arbeit würde<br />
man wahrscheinlich sagen, dass ich auf<br />
die Ressourcen blicke, weg von der Defizitorientierung.<br />
Als Dramatherapeutin<br />
respektiere ich das Suchtverhalten als<br />
ein Lösungshandeln aus einem tiefen<br />
Dilemma. Zwar ein destruktives – aber<br />
ein Lösungsverhalten. Meine Aufgabe ist<br />
es, Menschen dabei zu unterstützen, in<br />
einem künstlerischen Schaffensprozess<br />
diese lebensfeindlichen Formen in lebensförderliche<br />
zu verwandeln.<br />
Woran können Sie erkennen, ob Sie mit einem<br />
Menschen auf dem »richtigen Weg« sind?<br />
Aus meiner Arbeit in einer Drogeneinrichtung<br />
in Peru habe ich einen ganz einfachen<br />
Indikator mitgebracht: Als geheilt<br />
gilt dort jemand, der den eigenen Körper<br />
und das Leben in seiner Umgebung würdigen,<br />
schätzen und pflegen kann. Dieser<br />
Respekt vor dem Leben ist gleichzeitig die<br />
Voraussetzung für ein soziales und ökologisches<br />
Miteinander.<br />
Mit diesem Konzept passt die Dramatherapie<br />
sehr gut in die neuen Ansätze der Suchttherapie.<br />
Was sagen Sie zur Nachhaltigkeit der<br />
kreativen Verfahren?<br />
Wir müssen auf einen wichtigen Punkt<br />
hinweisen, der im Übrigen für die meisten<br />
therapeutischen Verfahren gilt: Die<br />
Drama- und Theatertherapie kann ihre<br />
Wirksamkeit nur entfalten, wenn der Klient/die<br />
Klientin wirklich Veränderungen<br />
möchte. Diese kreativen Verfahren setzten<br />
eine hohe Motivation voraus – dann<br />
können sie sehr nachhaltig wirken und zu<br />
einer lebendigen und lebensförderlichen<br />
Gesellschaft beitragen.<br />
Weiterbildung pflegeberatung<br />
Ein neues angebot kooperation mit dem Institut für<br />
Innovation und Beratung der EhB<br />
Mechthild Schuchert<br />
Ab dem 1. Januar 2009 haben die ca. 2,1<br />
Millionen pflegebedürftigen Menschen<br />
in Deutschland einen Rechtsanspruch auf<br />
Pflegeberatung gegenüber ihrer Pflegekasse.<br />
Pflegeberaterinnen und Pflegeberater<br />
sollen Betroffene individuell beraten<br />
und Hilfestellung bei der Inanspruchnahme<br />
von bundes- oder landesrechtlich<br />
vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen<br />
Hilfsangeboten, die auf Unterstützung<br />
von Menschen mit Pflege-, Versorgungs-<br />
oder Betreuungsbedarf ausgerichtet<br />
sind, anbieten. Das individuelle Fallmanagement<br />
reicht von der Feststellung und<br />
systematischen Erfassung des Hilfebedarfs<br />
über die Erstellung eines individuellen<br />
Versorgungsplans mit allen erforderlichen<br />
Leistungen bis hin zur Überwachung der<br />
Durchführung des Versorgungsplans.<br />
Diese Pflegeberatung erfordert von den<br />
Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern<br />
zusätzliche Qualifikationen, die abhängig<br />
von den jeweils im erlernten Beruf<br />
erforderlichen Kenntnissen und Qualifikationen<br />
sind. Das Referat Weiterbildung<br />
hat in Kooperation mit dem Institut für<br />
Innovation und Beratung der Evangelischen<br />
Hochschule Berlin (INIB) eine<br />
modularisierte Weiterbildung konzipiert.<br />
Sie entspricht den Empfehlungen des<br />
GKV-Spitzenverbandes nach § 7a Abs. 3<br />
Satz 3 SGB XI vom 29. August 2008. Die<br />
drei Module Pflege, Recht und Case Management<br />
sind getrennt belegbar, bereits<br />
erworbene Qualifikationen können nach<br />
Einzelfallprüfungen angerechnet werden.<br />
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Moduls<br />
»Case Management« sind die Qualitätsstandards<br />
der Deutschen Gesellschaft<br />
für Sozialarbeit (DGS) und des Deutschen<br />
Berufsverbandes für Soziale Arbeit (DBSH)<br />
erfüllt und die Zertifizierung als Case<br />
ManagerIn kann beantragt werden. Die<br />
wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof.<br />
Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (<strong>KHSB</strong>) und Prof.<br />
Dr. Peter Sauer (INIB).<br />
Weitere Informationen zum Beginn und zu den<br />
Kosten entnehmen Sie bitte der Homepage.<br />
www.khsb-berlin.de Referat Weiterbildung<br />
13
14<br />
eiNblick<br />
Die türen der kitas stehen männern<br />
weit offen<br />
nEuE koorDInatIonsstEllE »männEr In kItas«<br />
Anfang 2010 nahm die Koordinationsstelle<br />
»Männer in Kitas« ihre Arbeit an<br />
der Katholischen Hochschule auf. Sie<br />
verfolgt das Ziel, in den kommenden<br />
Jahren gemeinsam mit Verantwortlichen<br />
aus Politik und Praxis den Anteil männlicher<br />
Fachkräfte in Kitas zu erhöhen, und<br />
wird vom Bundesministerium für Familie,<br />
Senioren, Frauen und Jugend gefördert.<br />
Der Einrichtung einer Koordinationsstelle<br />
ging eine vom Familienministerium beauftragte<br />
Studie mit dem Titel »Männliche<br />
Fachkräfte in Kindertagesstätten« voraus,<br />
die von der Katholischen Hochschule für<br />
Sozialwesen Berlin und Sinus Sociovision<br />
GmbH erstellt wurde.<br />
nur 2,4 prozent männliche<br />
Fachkräfte in kitas<br />
Die Studie »Männliche Fachkräfte in<br />
Kindertagesstätten« kommt zu dem Ergebnis,<br />
dass derzeit lediglich 2,4 Prozent<br />
männliche Fachkräfte in Kitas arbeiten.<br />
»Zwar steigt die absolute Anzahl der<br />
männlichen Fachkräfte tendenziell, das<br />
macht sich aber vor dem Hintergrund<br />
der insgesamt zunehmenden Anzahl von<br />
Fachkräften in Kitas kaum bemerkbar«,<br />
kommentiert Jens Krabel, einer der drei<br />
Autoren der Studie die aktuelle Situation.<br />
Die wenigen in den Kitas anwesenden<br />
männlichen Fachkräfte werden von allen<br />
Befragten als für die pädagogische Arbeit<br />
bereichernd wahrgenommen und geschätzt.<br />
Die Türen der Kitas stehen Männern<br />
weit offen. Trotz positiver Bilanz gibt<br />
es zahlreiche Hürden und Barrieren, die<br />
verhindern, dass Männer den Erzieherberuf<br />
ergreifen. »Der Facettenreichtum<br />
des Berufs und der mittlerweile hohe Bildungsanspruch<br />
an die Arbeit in Kitas sind<br />
wenig bekannt«, sagt Michael Cremers,<br />
Mitautor der Studie.<br />
politische unterstützung gewünscht<br />
Mehr als 80 Prozent der Eltern sind der<br />
Meinung, dass Träger von Kitas einen<br />
wesentlichen Beitrag dazu leisten sollen,<br />
den Anteil männlicher Fachkräfte in Kitas<br />
zu erhöhen. Die Erhöhung des Männeranteils<br />
in Kitas bedarf vor allem aus Sicht<br />
der Träger-Verantwortlichen und Kita-Lei-<br />
tungen politischer Unterstützung – und<br />
die gibt es ihrer Meinung nach bislang<br />
nicht. Familienministerin Kristina Schröder<br />
(CDU) will dies ändern und reagierte<br />
Ende Juli auf das positive Klima für mehr<br />
Männer in Kitas mit der Aufforderung an<br />
die Verantwortlichen, Modellprojekte und<br />
tätigkeitsbegleitende Qualifizierungen für<br />
Erzieher zu entwickeln.<br />
Ab dem 1. Januar 2011 stehen dafür<br />
12,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit<br />
werden drei Jahre lang mindestens zehn<br />
Modellregionen, in denen mehr männliche<br />
Fachkräfte für Kindertagesstätten<br />
gewonnen werden, gefördert. Diese<br />
gleichstellungspolitischen Vorhaben hat<br />
die Koordinationsstelle mit entwickelt<br />
und ist nun für die fachliche Begleitung<br />
zuständig.<br />
Weltweit einmaliges Vorhaben<br />
»Das im Aktionsplan der Bundesregierung<br />
eingesetzte Finanzvolumen ist weltweit<br />
einmalig. Nicht einmal die skandinavischen<br />
Länder Norwegen oder Schweden<br />
haben eine solche umfassende, von der<br />
Politik unterstütze Aktion gestartet, um<br />
männliche Fachkräfte für den Erzieherberuf<br />
zu gewinnen«, begrüßte Prof. Dr.<br />
Stephan Höyng, Projektleiter der Koordinationsstelle,<br />
das Vorhaben des Bundesministeriums.<br />
Weitere Informationen zur Koordinationsstelle,<br />
zur Studie und zum Modellprojekt unter:<br />
www.koordination-maennerinkitas.de
neuerscheinung<br />
»hanD In hanD DIE WElt BEgrEIFEn«<br />
BIlDWörtErBuch DEr DEutschEn<br />
gEBärDEnsprachE Für pErsonEn<br />
aB 7 jahrEn<br />
Viel Lust auf Spaß und Spiel, ein bisschen<br />
Neugier und zwei freie Hände – mehr<br />
braucht es nicht für dieses einzigartige<br />
Mitmach-Wörterbuch der Gebärdensprache.<br />
Von A wie Angeben über K wie<br />
Klopapier bis Z wie Zuckerwatte sind hier<br />
knapp 2000 Alltagsbegriffe versammelt.<br />
Sämtliche Themen, die Menschen ab<br />
etwa sieben Jahren umtreiben, werden in<br />
wunderbar quirligen Wimmelbildern dargestellt,<br />
umrahmt von den dazugehörenden<br />
Gebärden-Zeichnungen. Schön und<br />
gut, aber ist das nicht eher nur etwas für<br />
Gehörlose? Wer das Buch mit hörenden<br />
Kindern zusammen anschaut, weiß es<br />
sofort besser: Mit Begeisterung eignen sie<br />
sich die neue „Geheimsprache“ an. Auch<br />
wir Erwachsenen haben großen Spaß<br />
daran, diese expressive Sprache auszuprobieren<br />
und im wahrsten Wortsinn zu „begreifen“,<br />
welche Ausdrucksmöglichkeiten<br />
in uns stecken. Wer dieses Buch betrachtet,<br />
kann nicht still sitzen bleiben!<br />
Hand in Hand die Welt begreifen<br />
Bildwörterbuch der deutschen Gebärdensprache<br />
für Personen ab sieben Jahren<br />
Klett Kinderbuch Verlag<br />
192 Seiten, gebunden<br />
EUR 19,90 [D] • EUR 20,50 [A] CHF 32,90<br />
ISBN 978-3-941411-26-5<br />
promotionskolleg<br />
»soziale professionen und menschenrechte«<br />
Als Förderprogramm für NachwuchswissenschaftlerInnen<br />
läuft seit Januar 2010<br />
das Promotionskolleg »Soziale Professionen<br />
und Menschenrechte« an der <strong>KHSB</strong>.<br />
Das Kolleg bietet einen Rahmen für<br />
kontinuierlichen, fachlichen Diskurs und<br />
zielt darauf, Promotionen von FachhochschulabsolventInnen<br />
zu unterstützen.<br />
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der<br />
Förderung der Chancengleichheit von<br />
Frauen. Aus zahlreichen Bewerbungen<br />
wurden neun PromovendInnen in das<br />
Kolleg aufgenommen. Davon erhalten<br />
fünf Frauen ein Promotionsstipendium.<br />
Mit ihren Promotionsvorhaben sind die<br />
KollegiatInnen an verschiedenen Universitäten<br />
deutschlandweit eingebunden.<br />
ProfessorInnen der <strong>KHSB</strong> wirken in der<br />
Regel als ZweitgutachterInnen in den<br />
Promotionsverfahren mit und begleiten<br />
die KollegiatInnen fachlich. In den monatlichen<br />
Kollegstreffen wird zum einen der<br />
Austausch über die Forschungsprojekte<br />
sichergestellt. Zum anderen werden Themen<br />
entlang des Forschungsprogramms<br />
»Soziale Professionen und Menschenrechte«<br />
erarbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei<br />
die Reflexion von Sozialer Arbeit und<br />
Heilpädagogik als Menschenrechtsprofession<br />
sowie die Grundlagen der Praxisforschung.<br />
aktuEllE ForschungsprojEktE<br />
Im kollEg<br />
»subjektive theorien von Mitarbeiterinnen<br />
in den erstanlaufstellen für<br />
Flüchtlinge und deren einfluss auf das<br />
frühe erkennen von Problemlagen<br />
von Flüchtlingen mit behinderung«<br />
von Doris Gräber (Prof. Dr. Ralf Quindel)<br />
»begegnung, bildung und beratung<br />
für Familien im stadtteil – eine exemplarisch-empirische<br />
untersuchung«<br />
von Sarah Häseler (Prof. Dr. Jens Wurtzbacher)<br />
»lerndienste und Machtspiele. der<br />
entwicklungspolitische Freiwilligendienst<br />
aus der sicht der Aufnahmeorganisationen.<br />
eine qualitativ-empirische<br />
studie und netzwerktheoretische<br />
reflexion« von Ute Elisabeth Hoffmann<br />
(Prof. Monika Treber)<br />
»schule aus sicht der Migrantenfamilien<br />
– eine systematische darstellung<br />
von handlungs- und deutungsmustern<br />
von Migrantenfamilien im Verhältnis<br />
zu bildungsmöglichkeiten und<br />
schule in deutschland« von Meryem<br />
Ucan (Prof. Dr. Gaby Straßburger)<br />
»lebenslagen und Familiengeschichten<br />
von Menschen mit so genannter<br />
geistiger behinderung« von Thomas<br />
Schmidt (Prof. Dr. Reinhard Burtscher)<br />
»beteiligungskulturen der jugendhilfe<br />
aus sicht der eltern« von Judith<br />
Schobert (Prof. Dr. Gaby Straßburger)<br />
»Zur bedeutung sozialer unterstützung<br />
für die gesundheit gewaltbetroffener<br />
Frauen in Frauenzufluchtswohnungen«<br />
von Juliane Wahren (Prof.<br />
Dr. Karlheinz Ortmann)<br />
»die gemeinnützige Arbeit als sanktion.<br />
Arbeitslose im konflikt von Norm<br />
und realität« von Frank Wilde (Prof. Dr.<br />
Jens Wurtzbacher)<br />
»ein systemischer Vergleich der<br />
Frühförderung in schweden und<br />
deutschland anhand der Zielsetzung<br />
der inklusion als Menschenrecht.<br />
Möglichkeiten und grenzen einer optimierung<br />
der deutschen Frühfördersysteme«<br />
von Anja Wohlfahrt (Prof. Dr.<br />
Monika Schumann)<br />
Weitere Informationen finden Sie im Internet<br />
unter www.khsb-berlin.de Forschung Pro-<br />
motionskolleg<br />
15
16<br />
rückblick<br />
ForschungsprojEkt ältEr WErDEnDE EltErn unD ErWachsEnE FamIlIEnmItglIE-<br />
DEr mIt BEhInDErung zu hausE – InnoVatIVE BEratungs- unD untErstützungsangEBotE<br />
Im aBlösungsprozEss an DEr khsB gEstartEt<br />
Auf Einladung von Prof. Dr. Burtscher<br />
trafen sich am 31.05.2010 an der Katholischen<br />
Hochschule für Sozialwesen die<br />
Projektpartner für das Forschungsvorhaben<br />
»ElFamBe« zu ihrem ersten Treffen.<br />
Dies war der offizielle Startschuss für das<br />
vom Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung geförderte Projekt. Ziel des<br />
ersten Treffens war es, sich gegenseitig<br />
besser kennenzulernen, erste Forschungsaufgaben<br />
vorzustellen und zu diskutieren.<br />
Im Anschluss fand im Senatsaal der Hochschule<br />
ein Empfang zusammen mit der<br />
Hochschulleitung, Projektpartnern und<br />
Hochschulmitarbeitern statt. Die Projektfinanzierung<br />
erfolgt über die Förderline<br />
»Soziale Innovationen für Lebensqualität<br />
im Alter« »SILQUA-FH«, es ist neben dem<br />
Forschungsprojekt SEVERAM das zweite<br />
Forschungsvorhaben, das an der Katholischen<br />
Hochschule für Sozialwesen Berlin,<br />
über diese Förderlinie finanziert wird.<br />
Das Projekt läuft von Mai 2010 bis April<br />
2013. Das Forschungsvorhaben stellt älter<br />
werdende Eltern, die ihre erwachsenen<br />
Söhne und Töchter mit Behinderung zu<br />
Hause betreuen, in den Mittelpunkt. Im<br />
Rahmen eines partizipativen Modells<br />
werden innovative Unterstützungsarrangements<br />
entwickelt mit dem Ziel, die<br />
Lebensqualität in den beschriebenen Familien<br />
zu verbessern.<br />
Folgende Aufgaben sind im Rahmen des<br />
Projekts vorgesehen:<br />
› Bedarfserhebung in Berlin<br />
› Familienbegleitung und Infrastrukturanalyse<br />
› Entwicklung, Erprobung und Evaluierung<br />
niedrigschwelliger Unterstützungsangebote<br />
› Multiplikatorenschulung und Erarbeitung<br />
eines Praxishandbuches<br />
› Sicherung von Nachhaltigkeit durch<br />
Netzwerkarbeit<br />
Als Kooperationspartner sind beteiligt:<br />
› Eltern beraten Eltern von Kindern mit<br />
und ohne Behinderung e.V.<br />
› Eltern für Integration e. V.<br />
› Eltern helfen Eltern e.V. in Berlin-Brandenburg<br />
› Lebenshilfe Berlin gGmbH<br />
› Spastikerhilfe Berlin eG<br />
› IN VIA Projekte Berlin gGmbH<br />
› Der Paritätische Wohlfahrtsverband<br />
Landesverband Berlin e.V.<br />
› Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Weitere Informationen finden Sie auf folgenden<br />
Seiten im Internet:<br />
www.khsb-berlin.de Reinhard Burtscher<br />
Kontakt: reinhard.burtscher[at]khsb-berlin.de<br />
oder thomas.schmidt[at]khsb-berlin.de
auF DEr BaustEllE mIt DEr startWErkstatt<br />
ulrich Binner<br />
Am 13.04.2010 fand die Startwerkstatt<br />
von Prof. Dr. Ortmann in einem besonderen<br />
Rahmen statt. Die Studierenden<br />
besuchten das Generationsübergreifende<br />
Wohnprojekt Alte Schule Karlshorst. Dies<br />
geschah aber nicht, um das Projekt zu<br />
besichtigen, sondern um tatkräftig beim<br />
Bau eines generationenübergreifenden<br />
Spielplatzes mitzuhelfen.<br />
Die Alte Schule Karlshorst steht mit der<br />
Katholischen Hochschule in einer besonderen<br />
Verbindung. Von 2006 bis 2009<br />
wurde das Vorhaben während der Projektentwicklung,<br />
der Umsetzung und des<br />
ersten Wohnjahres durch die Katholische<br />
Hochschule wissenschaftlich begleitet.<br />
In dem Generationsübergreifenden<br />
Wohnprojekt Alte Schule Karlshorst leben<br />
Menschen in allen Lebensphasen und in<br />
unterschiedlichen Lebenslagen, mehrere<br />
Bewohner sind von Schwerbehinderungen<br />
betroffen und pflegebedürftig. Das<br />
Altersspektrum der Bewohnerschaft reicht<br />
von drei bis neunzig Jahre, insgesamt<br />
leben 29 Kinder und Jugendliche in der<br />
Alten Schule. Das ehemalige Schulhaus,<br />
das innerhalb von zwei Jahren durch die<br />
SelbstBau Genossenschaft in ein barrierefreies<br />
Wohnhaus für 20 Mitparteien<br />
umgebaut wurde, beherbergt auch eine<br />
Wohngruppe des Kinderhaus Berlin -<br />
Mark Brandenburg e.V., in der zehn Kinder<br />
und Jugendliche zwischen drei und<br />
16 Jahren, deren Eltern überfordert, alkoholkrank<br />
oder obdachlos sind. Das Wohnprojekt<br />
umfasst neben dem Haupthaus<br />
auch ein ca. 5000m² großes Außengelände<br />
für dessen Ausbau bislang sowohl das<br />
Geld als auch die benötigten Fachkräfte<br />
fehlten. ZIBB und radioBerlin 88.8 haben<br />
nun mit Hilfe ihrer Zuschauer und Zuhörer<br />
innerhalb von 96 Stunden diesen Ausbau<br />
in Angriff genommen, nachdem eine<br />
Bewohnerin der Kinderhauswohngruppe<br />
mit einem Brief um Unterstützung bei der<br />
Gestaltung des Hofs bat. Durch den Umbau<br />
konnten sowohl Spielgeräte und ein<br />
Baumhaus für die Kinder auf dem Gelände<br />
aufgebaut werden, als auch ein barrierefreier<br />
Mehrgenerationentreffpunkt<br />
und Hochbeete für die Bewohner, die auf<br />
einen Rollstuhl angewiesen sind, realisiert<br />
werden. Die Studierenden der Startwerkstatt<br />
beteiligten sich am ersten Tag der<br />
Bauarbeiten im Rahmen ihrer Seminarzeit<br />
(10 - 17.30 Uhr) rege und mit vollster<br />
Tatkraft an den Bauarbeiten. Das Prinzip<br />
der SelbstBau e.G., dass sich Gruppen<br />
durch gemeinsames Arbeiten finden und<br />
verfestigen, konnte so am eigenen Leib<br />
ausprobiert werden. Mit Spaten und<br />
Spitzhacke rodeten die Studierenden die<br />
ihnen zugewiesenen Teile des Geländes.<br />
Wie viele Schubkarren mit abgetragener<br />
Deckschicht und abgeschnittenem Wildwuchs<br />
an diesem Tag zusammen kamen,<br />
hat wohl keiner gezählt, der Muskelkater<br />
am nächsten Tag zeigte aber allen Beteiligten,<br />
dass sie am Dienstag viel geschafft<br />
hatten…<br />
BachElorprEIs DEr hamBurgEr<br />
carItasstIFtung gEht an stuDIErEnDE<br />
DEr khsB<br />
Die »Caritasstiftung Hamburg – Menschen<br />
in Not« hat am 2. Juni 2010 erstmalig<br />
einen Bachelorpreis für Abschlussarbeiten<br />
in den Studiengängen Soziale<br />
Arbeit und Sozialpädagogik verliehen.<br />
Zur Verleihung in die Rathauspassage<br />
kamen u.a. die Staatsrätin der Hamburger<br />
Sozialbehörde, Frau Dr. Angelika Kempfert,<br />
Mitglieder des Stiftungsvorstandes<br />
und Stiftungsrates, Mitarbeiter des Caritasverbandes<br />
sowie weitere Kooperationspartner.<br />
Nach einer Begrüßung von<br />
Caritasdirektor Laschinski wurden die<br />
Preisträger für ihre Arbeiten mit einem<br />
Blumenstrauß, einer Urkunde und einem<br />
entsprechenden Geldbetrag ausgezeichnet<br />
und stellten ihre Abschlussarbeiten<br />
dann in zehnminütigen Vorträgen vor.<br />
Von den sieben norddeutschen Hochschulen<br />
in Hamburg, Kiel, Bremen und<br />
Berlin, mit denen die Stiftung beim Bachelorpreis<br />
kooperiert, hatten vier Hochschulen<br />
insgesamt zehn Arbeiten eingereicht.<br />
Prof. Sturzenhecker (Hamburg),<br />
Prof. Panitzsch-Wiebe (Hamburg) und<br />
Prof. Bernzen (Berlin) prüften die Arbeiten<br />
und wählten die drei Preisträger aus. Den<br />
2. Preis erhält Doreen Schrötter von der<br />
Kath. Hochschule für Sozialwesen in Berlin.<br />
Sie schrieb eine preiswürdige Arbeit<br />
über ein Patenschaftsmodell für Kinder<br />
aus suchtbelasteten Familien.<br />
17
18<br />
rückblick<br />
Das gutE Im BlIck<br />
Ralf Quindel und Kai Schmidt<br />
Im Rahmen eines Hochschultags diskutier-<br />
ten am 26. Mai 2010 Lehrende, Studierende<br />
und Verwaltungsmitarbeiterinnen<br />
Erfahrungen mit Verfahren der Qualitätssicherung<br />
und erörterten Ansätze zu deren<br />
Weiterentwicklung. Die Themen der<br />
sieben Arbeitsgruppen, die den Kern des<br />
Tages bildeten, deckten unterschiedliche<br />
Ebenen (Lehrveranstaltung, Modul, Studiengänge)<br />
der Qualitätssicherung, Kernprozesse<br />
(Studieneingangsphase, Theorie-<br />
Praxis Verknüpfung, Prüfungen) der Lehre<br />
sowie das Profil der Hochschule ab.<br />
Die Weiterentwicklung der Verfahren der<br />
Qualitätssicherung an der KSHB ist nach<br />
Einschätzung der Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer am Hochschultag insbesondere<br />
im Hinblick auf vier Bereiche sinnvoll<br />
(vgl. Bericht der Kommission für Qualitätssicherung<br />
zum Hochschultag):<br />
› Wiederholt wurde der Wunsch nach<br />
mehr Information und Transparenz der<br />
Verfahren geäußert. So wurde z. B. in AG<br />
1 ausgehend von der Einschätzung, dass<br />
das Verfahren der Lehrevaluation wenig<br />
transparent ist, einige Ideen entwickelt um<br />
die Transparenz des Verfahrens zu verbessern<br />
› Die Frage, wie sich die Qualität der<br />
Lehre durch Vernetzung unterschiedlicher<br />
Akteure und durch Etablierung von<br />
Kommunikationsräumen verbessern ließe,<br />
nahm in den Arbeitsgruppen einen breiten<br />
Raum ein.<br />
› Dass der im Qualitätskreis beschriebene<br />
idealtypische Zusammenhang von Planen,<br />
Handeln, Überprüfen und Verbessern in<br />
vielen praktizierten Verfahren der Quali-<br />
tätssicherung mehr zur Geltung gebracht<br />
werden könnte, war ein weiteres zentrales<br />
Thema des Hochschultags.<br />
› Ein viertes Thema, das sich durch mehrere<br />
Arbeitsgruppen zog, war die Perspektive<br />
auf die Verantwortlichkeit für Verfahren<br />
der Qualitätssicherung. In mehreren<br />
Zusammenhängen äußerten Hochschulmitglieder<br />
die Einschätzung, dass Verantwortlichkeiten<br />
auszudifferenzieren und zu<br />
klären seien. Am deutlichsten wurde diese<br />
Einschätzung im Hinblick auf die Rolle der<br />
Modulverantwortlichen zum Ausdruck gebracht<br />
(AG 5).<br />
Abgeleitet von den Ergebnissen des<br />
Hochschultags hat der Akademische<br />
Senat in seiner Sitzung am 14. Juli 2010<br />
eine aus den Säulen Qualitätskonzept,<br />
Prozessdokumentation und Entwicklung<br />
von Verfahren der Qualitätssicherung<br />
bestehende Qualitätsstrategie beschlossen<br />
und die KfQ mit der Umsetzung<br />
beauftragt. Dadurch soll die Transparenz<br />
und Information über Verfahren der Qualitätssicherung<br />
erhöht, die Vernetzung der<br />
Akteure verbessert, Qualitätskreisläufe<br />
geschlossen und Verantwortlichkeiten<br />
ausdifferenziert werden.<br />
DEr aBschlussBErIcht DEr »kunDEn-<br />
stuDIE« zum untErstütztEn WohnEn<br />
In BErlIn lIEgt Vor: stanDortBEstImmung<br />
unD stratEgIEVorschlag.<br />
Im April diesen Jahres hat das Forschungsprojekt<br />
»KUNDENSTUDIE« –<br />
BEDARF AN DIENSTLEISTUNGEN ZUR<br />
UNTERSTÜTZUNG DES WOHNENS VON<br />
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG« seinen<br />
Abschlussbericht vorgelegt. Gefördert<br />
von Aktion Mensch wurde das Projekt<br />
von 2007– 2009 an der Katholischen<br />
Hochschule für Sozialwesen Berlin unter<br />
Leitung von Prof. Dr. Monika Seifert und<br />
der wissenschaftlichen Mitarbeit von Dr.<br />
Birgit Steffens durchgeführt. Kooperationspartner<br />
waren der Paritätische Wohlfahrtsverband<br />
(Landesverband Berlin) und<br />
die Eberhard-Karls-Universität Tübingen<br />
(Forschungsstelle »Lebenswelten behinderter<br />
Menschen«). Schwerpunkt der<br />
Studie war eine mehrperspektivische und<br />
mehrdimensionale Analyse der wohnbezogenen<br />
Unterstützungsleistungen für<br />
Menschen mit geistiger und mehrfacher<br />
Behinderung im Land Berlin. Im Sinne<br />
partizipativer Forschung haben sich rund<br />
250 Frauen und Männer mit Behinderung<br />
an Befragungen, Interviews, Workshops<br />
und stadtteilbezogenen Praxispro-jekten<br />
beteiligt. Als weitere Experten wurden<br />
Vertreter der Behindertenhilfe und der<br />
Sozialverwaltung sowie lokale Akteure<br />
sozialer Einrichtungen und Dienste in die<br />
Untersuchungen einbezogen.<br />
Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes<br />
Bild der aktuellen Strukturen und<br />
Entwicklungen im Bereich des Wohnens<br />
sowie der Erfahrungen der behinderten<br />
Menschen mit den Unterstützungsleistungen<br />
und mit dem Zusammenleben im<br />
Wohnquartier. Ihre Veränderungswünsche<br />
zeigen, dass verlässliche soziale Beziehun-
gen und individuelle sozialraumorientierte<br />
Wohn- und Unterstützungsarrangements<br />
einen zentralen Stellenwert haben.<br />
Die Erkenntnisse der »Kundenstudie«<br />
werden zu einem Strategiekonzept verdichtet,<br />
das konkrete Maßnahmen auf<br />
dem Weg zur Inklusion benennt. Sie<br />
betreffen die Ebene des Individuums und<br />
seiner Lebenswelt sowie die Ebene des<br />
Hilfesystems und des Sozialraums, unter<br />
Einbeziehung von behinderten Menschen<br />
mit Migrationshintergrund. Durch die<br />
Vermittlung theoretischer Prämissen und<br />
Leitorientierungen der Behindertenhilfe<br />
mit den realen Versorgungsstrukturen<br />
eröffnet die Studie neue Entwicklungsperspektiven.<br />
Sie liefert einen praxisbezogenen<br />
Baustein zur Umsetzung der<br />
UN-Behindertenrechtskonvention, die die<br />
vollständige gesellschaftliche Partizipation<br />
von Menschen mit Behinderung in einem<br />
inklusiven Gemeinwesen einfordert und<br />
seit 2009 verbindliche Grundlage für das<br />
nationale Recht ist. Die Studie hat für die<br />
Weiterentwicklung der Strukturen und<br />
Prozesse nicht nur der Behindertenhilfe<br />
bundesweite Bedeutung.<br />
aBschluss DEs EuropäIschEn projEkts unIQ - usErs nEtWork to<br />
ImproVE QualIty: nutzErInnEn unD nutzEr EValuIErEn angEBotE.<br />
Monika Seifert / Janna Harms<br />
Mit dem Workshop »Qualität sicherstellen:<br />
Dienstleistungen auf der Grundlage<br />
von Rechten und Werten« fand das<br />
UNIQ-Projekt auf dem 15. Weltkongress<br />
von Inclusion International im Juni 2010<br />
in Berlin seinen Abschluss. UNIQ ist eines<br />
von acht europäischen Projekten<br />
im Programm Progress, mit denen die<br />
EU-Kommission bewährte Methoden zur<br />
Definition, Verbesserung und Messung<br />
der Qualität sozialer Dienstleistungen in<br />
den Mitgliedsländern verbreiten möchte.<br />
Koordiniert wurde das Projekt von<br />
Atempo aus Österreich. Projektpartner in<br />
Berlin waren der Paritätische Wohlfahrtsverband<br />
Berlin, die Senatsverwaltung für<br />
Integration, Arbeit und Soziales und die<br />
Katholische Hochschule für Sozialwesen<br />
Berlin. Die Hochschule wurde vertreten<br />
durch Prof. Dr. Monika Seifert und Dipl.-<br />
Heilpäd. (MA) Janna Harms.<br />
Im Zeitraum von 2009-2010 wurde in<br />
drei Ländern (Deutschland, Tschechien,<br />
Norwegen) getestet, wie das in Österreich<br />
entwickelte Evaluationsmodell Nueva auf<br />
die Bedingungen in anderen europäischen<br />
Ländern übertragen werden kann.<br />
Nueva evaluiert die Qualität von Diensten<br />
für Menschen mit Lernschwierigkeiten<br />
und Behinderung. Das Besondere: Menschen<br />
mit Lernschwierigkeiten waren an<br />
der Entwicklung der Evaluationsinstrumente<br />
beteiligt und arbeiten als Interviewer<br />
aktiv bei der Durchführung und<br />
Auswertung mit.<br />
In Berlin wurden im Rahmen des UNIQ-<br />
Projekts vier Nutzerinnen und Nutzer<br />
von Wohnangeboten für Menschen mit<br />
Lernschwierigkeiten in Grundlagen der<br />
nutzerorientierten Evaluation geschult.<br />
Als UNIQ-Peers führten sie Testinterviews<br />
in Wohneinrichtungen der Berliner Behindertenhilfe<br />
durch. In einem Seminar<br />
von Professor Dr. Monika Seifert haben<br />
sie über ihre Erfahrungen berichtet. Eine<br />
Teilnehmerin brachte nach Abschluss<br />
des Projekts zum Ausdruck, was die Mitarbeit<br />
für sie bedeutet: »Nueva ist eine<br />
neue, gute Möglichkeit für Menschen<br />
mit Lernschwierigkeiten, etwas auf die<br />
Beine zu stellen und im Vordergrund<br />
zu stehen. Hier sind wir. Hier bin ich.<br />
Wir haben unsere Rechte und unsere<br />
Fähigkeiten. Wir werden bei Nueva so<br />
akzeptiert wie wir sind und nicht als blöd<br />
dargestellt.« (Näheres zum Projekt: http://<br />
www.nueva-network.eu/cms/de/UNIQ/<br />
UNIQ_in_Deutschland/).<br />
Die Nueva-Evaluationsmethode wird in<br />
Berlin auf breiter Basis von der Fachverwaltung<br />
und von Trägern der Behindertenhilfe<br />
unterstützt. Der Beginn einer<br />
Ausbildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten<br />
zur Nueva-Evaluatoren ist<br />
zum Ende des Jahres 2010 geplant.<br />
19
20<br />
rückblick<br />
ForschungsprojEkt potEnzIalE unD rIsIkEn In DEr FamIlIalEn<br />
pFlEgE altEr mEnschEn an DEr khsB gEstartEt<br />
Am 1. September 2010 fällt der Startschuss<br />
für ein neues vom Bundesfamilienministerium<br />
finanziertes praxisbezogenes<br />
Forschungsprojekt an der <strong>KHSB</strong>. Die<br />
Mittel für das Projekt mit den Standorten<br />
Siegen und Berlin wurden von Professor<br />
Dr. Suanne Zank (Universität Siegen) und<br />
Professor Dr. Claudia Schacke (<strong>KHSB</strong>) eingeworben.<br />
Das Projekt Purfam ist mit der<br />
Früherkennung, Prävention und Intervention<br />
prekärer, von Gewalt bedrohter oder<br />
betroffener familiärer Pflegebeziehungen<br />
befasst.<br />
hintergrund und wesentliche Inhalte<br />
des projektes<br />
Cirka 70% pflegebedürftiger älterer<br />
Menschen werden zuhause von Familienangehörigen<br />
betreut. Die Betreuung<br />
insbesondere demenzkranker Angehöriger<br />
ist mit vielfältigen Anforderungen<br />
verbunden, die zu Überlastung und<br />
schwerwiegenden physischen und psychischen<br />
Beeinträchtigungen der Pflegenden<br />
führen können. Chronische Überlastung<br />
wiederum gilt als eine Hauptursache von<br />
Aggressivität und Gewalt in der Pflege.<br />
Zwar leistet die überwältigende Mehrheit<br />
der Angehörigen eine gute, engagierte<br />
und aufopferungsvolle Pflege. Zu den<br />
Risiken der familialen Pflege zählen<br />
jedoch auch körperliche und seelische<br />
Misshandlungen sowie Vernachlässigung.<br />
Bislang existieren jedoch kaum Konzepte,<br />
die die (Früh)erkennung, Prävention und<br />
Intervention von Gewalt in der häuslichen<br />
Pflege älterer Menschen in den Blick nehmen.<br />
Vor diesem Hintergrund besteht das<br />
übergeordnete Ziel von Purfam in der Op-<br />
timierung des Praxishandelns in der Angehörigenarbeit,<br />
wobei der Schwerpunkt<br />
auf Gewaltprävention durch Früherkennung<br />
und Ressourcenstärkung liegt.<br />
Im Einzelnen beinhaltet das Projekt folgende<br />
Bausteine:<br />
1. Analyse internationaler Best-Practice-<br />
Ansätze<br />
2. Tagung mit internationalen Experten<br />
3. Entwicklung von Früherkennungsmaßnahmen<br />
4. Durchführung von Workshops mit<br />
Mitarbeitern in ambulanten Pflegediensten<br />
5. Evaluation der Interventionsmaßnahme<br />
6. Bundesweite Implementierung von<br />
Screeningverfahren und Interventionsangeboten<br />
7. Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs<br />
für Entscheidungsträger aus<br />
Gesundheits- und Sozialpolitik, Erarbeitung<br />
eines Handbuchs / Manuals<br />
für die Praxis.<br />
Das Projekt hat eine geplante Laufzeit<br />
von 2 1/2 Jahren (Standort Berlin) und<br />
ein Gesamtvolumen von 604.705 EUR<br />
(199.830 EUR Standort Berlin). Durch die<br />
Kooperation mit Professor. Dr. Susanne<br />
Zank besteht für die beiden an der <strong>KHSB</strong><br />
beschäftigten Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen<br />
die Möglichkeit, im Rahmen<br />
des Projekts zu promovieren. Interessierte<br />
Studierende der <strong>KHSB</strong> sind eingeladen,<br />
das Projekt kennenzulernen und ggf. ihre<br />
Abschlussarbeit zu schreiben.<br />
altErnatIVE lEhrVEranstaltungEn<br />
an DEr khsB<br />
Ulrike Poppe, Studentin an der <strong>KHSB</strong><br />
Unter dem Motto »Rolle und Funktion<br />
der Professionellen im Sozialwesen« fanden<br />
im Sommersemester 2010 fünf alternative<br />
Lehrveranstaltungen an der <strong>KHSB</strong><br />
statt. Die Idee zur Veranstaltungsreihe<br />
stammt aus dem Bildungsstreik 2009. Das<br />
Organisationsteam aus Studierenden und<br />
Lehrenden hat es sich zum Ziel gesetzt<br />
selbstorganisierte Lehrveranstaltungen<br />
sowie ein kritisches Bewusstsein und<br />
einen Blick auf gesamtgesellschaftliche<br />
Zusammenhänge an die Hochschule zu<br />
bringen und zu entwickeln. Die Themen<br />
reichten vom Einblick in den Berufsalltag<br />
von Berufseinsteigern und »alten Hasen«<br />
im Sozialwesen über Einblicke in internationale<br />
Verhältnisse. In einer weiteren Veranstaltung<br />
ging es um die Entwicklungen<br />
in der Trägerlandschaft Berlins und deren<br />
Auswirkungen auf die Beschäftigungsverhältnisse<br />
von Bachelorabsolventen. Hierzu<br />
wurden Vertreter/Innen von Gewerkschaften<br />
und Trägern der Sozialen Arbeit<br />
und Heilpädagogik eingeladen. Es folgte<br />
ein Gastvortrag zum Thema »Kritische<br />
Theorie« von Dr. phil. Alexander Demirovic,<br />
bei dem man angeregt wurde einen<br />
Blick über den Tellerrand zu wagen und<br />
gedanklich neue Wege einzuschlagen. In<br />
der letzten alternativen Lehrveranstaltung<br />
stand der Austausch über die vollendete<br />
erste Lehrveranstaltungsreihen, sowie<br />
das Schaffen gemeinsamer Perspektiven<br />
an der <strong>KHSB</strong> für kommende Semester im<br />
Vordergrund. Resümierend ist zu sagen,<br />
dass ein großes Interesse an sozialpolitischen<br />
Themen herrschte, aber auch<br />
darüber hinaus. Besonders die Gespräche<br />
im Anschluss an die Veranstaltungen
erfreuten sich großer Beliebtheit. Alles in<br />
allem wurden die alternativen Lehrveranstaltungen<br />
im Sommersemester 2010<br />
begeistert aufgenommen und zum Anlass<br />
tiefgehender Diskussionen. Aufgrund dieser<br />
Tatsachen und der tollen neuen Ideen<br />
aus der letzten Veranstaltung wird es im<br />
Wintersemester weitergehen! Schon jetzt<br />
wird angedacht das Repertoire von Veranstaltungen<br />
um einen aktiveren Teil in<br />
Form von Workshops zu ergänzen. Natürlich<br />
sind alle eingeladen, die ihre Themen<br />
umgesetzt sehen wollen, die sich an der<br />
Organisation beteiligen möchten oder<br />
die einfach nur die Lust verspüren eine<br />
Veranstaltung zu organisieren. Informationen<br />
zu den Organisationstreffen und<br />
dem weiteren Vorgehen – oder einfach<br />
nur ein/e persönlichen Ansprechpartner/in<br />
gibt es unter folgender Adresse:<br />
internes[at]khsb.de<br />
zusammEnarBEIt üBEr grEnzEn hInWEg<br />
FachgEspräch: »QualItätsanForDErungEn unD QualItätssIchErung<br />
IntErnatIonalEr praktIka unD hospItatIonEn«<br />
Bernd Streich<br />
»Qualität« ist in aller Munde. – auch in<br />
Hochschulen und hier vielleicht in den<br />
letzten Jahren in einem besonderen Maß.<br />
Dies führte verschiedene Hochschulen mit<br />
sozialer Ausrichtung zusammen. Unter<br />
dem Thema »Qualitätsanforderungen<br />
und Qualitätssicherung internationaler<br />
Praktika und Hospitationen« fand am<br />
03./04.Mai 2010 ein interessantes Fachgespräch<br />
in Berlin statt. Tagungsort war<br />
die Evangelische Hochschule Berlin und<br />
die <strong>KHSB</strong>, also Zehlendorf und Karlshorst.<br />
Dem »Ev. Verein zur Förderung der Initiativen<br />
gegen Arbeitslosigkeit Berlin-Steglitz<br />
e. V.« – Eviga genannt – war es gelungen<br />
die Evangelischen Hochschule Berlin<br />
(EHB), die Alice-Salomon-Hochschule<br />
Berlin (ASH), die Katholischen Hochschule<br />
für Sozialwesen Berlin (<strong>KHSB</strong>) und die<br />
Akademie für Sozialpädagogik und Theologie<br />
Prag (Jabok) zusammen zu führen,<br />
um sich über internationale Praktika und<br />
Hospitationen auszutauschen und vielleicht<br />
auch Anregungen zu erarbeiten,<br />
insbesondere auch für Praktika in östlichen<br />
Nachbarländern. Ziel war es, das<br />
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu<br />
betrachten und die Erfahrungen der beteiligten<br />
Fachhochschulen und von Eviga<br />
einer Fachöffentlichkeit vorzustellen und<br />
darüber ins Gespräch zu kommen. Beteiligt<br />
waren neben vielen Vertretern aus<br />
den beteiligten Institutionen auch alle drei<br />
Rektorinnen der Hochschulen. Von besonderem<br />
Interesse waren die Erfahrungen<br />
von Studierenden und Lehrenden der<br />
Jabok aus Prag. Die Jabok – Akademie für<br />
Sozialpädagogik und Theologie in Prag -<br />
ist eine Einrichtung der Gemeinschaft der<br />
Salesianer Don Boscos, einer katholischen<br />
Ordensgemeinschaft, die sich insbesondere<br />
um Kinder und Jugendliche kümmert.<br />
Die Schule in Prag bietet eine College-<br />
Ausbildung in der der christliche und der<br />
Don-Bosco- Geist im Bereich der Sozialarbeit,<br />
Sozialpädagogik und Theologie seine<br />
Verankerung hat. Die Initiatoren wollten<br />
sich mit diesem Fachgespräch zu einem<br />
bildungspolitischen Thema an aktuellen<br />
Debatten beteiligen. Dies wurde auch<br />
in der abschließenden Podiumsdiskussion<br />
unter dem Thema: »Nachhaltigkeit<br />
und Effekte internationaler Praktika und<br />
Hospitationen für Studium und Lehre«<br />
mit den Rektorinnen Frau Prof. Dr. Borde<br />
(ASH), Frau Prof. Treber (<strong>KHSB</strong>), Herrn<br />
Prof. Dr. Hildebrand und Herrn Direktor<br />
Mgr. Martinek (Jabok) deutlich.<br />
Ein herzlichen Dank allen, die zum Gelingen<br />
dieses Fachgesprächs beigetragen<br />
haben.<br />
21
22<br />
rückblick<br />
rElIgIösE praxIs – DIE khsB BEtEIlIgt<br />
sIch am IntErrElIgIösEn DIalog<br />
Bernd Streich<br />
Interreligiösen Dialog praktisch erlebten<br />
Studierende aus dem religionspädagogischen<br />
Bachelorstudiengang im April des<br />
Jahres. Sie nahmen zusammen mit Frau<br />
Professor Dr. Christine Funk teil an einen<br />
Vortrags- und Gesprächsabend, zu dem<br />
der Sachausschuss »Ökumene und interreligiöser<br />
Dialog« des Diözesanrates der<br />
Katholiken im Erzbistum Berlin und die<br />
islamischen Organisation DITIB (Türkisch-<br />
Islamische Union der Anstalt für Religion<br />
e.V.) eingeladen hatten. Das Thema »Religiöse<br />
Praxis in Christentum und Islam«<br />
stand an diesem Abend im Mittelpunkt.<br />
Und gab viel Stoff zum Austausch. Für<br />
die religiöse Praxis im Islam spielen die<br />
fünf Grundpflichten dieser Religion,<br />
auch »Pfeiler« oder »Säulen« des Islams<br />
genannt, eine maßgebende Rolle: Glaubensbekenntnis,<br />
Gebet, Unterstützung<br />
der Bedürftigen, Fasten und Pilgerfahrt.<br />
Impulsreferate zur religiösen Praxis im<br />
Islam wurden von Andry Abbas Schulz<br />
und im Christentum von Dompropst Dr.<br />
Stefan Dybowski gehalten. Sie ließen<br />
schon etliche Parallelen deutlich werden.<br />
In kleiner Runde konnten die Teilnehmenden<br />
über die Bedeutung der religiösen<br />
Praxis für das eigene Leben miteinander<br />
ins Gespräch kommen. Im Podium- und<br />
Plenumsgespräch zeigten sich einige<br />
Entsprechungen im Christentum und im<br />
Islam. Zum Gelingen des Abends trugen<br />
viele junge Muslime durch ihr engagiertes<br />
Gespräch bei, ebenso die Beteiligung von<br />
interessierten Nicht-Christen.<br />
Weitere Kooperationveranstaltung: 25.10.2010<br />
»Sterben und Tod aus christlicher und islamischer<br />
Perspektive« (Berliner Hospizwoche)<br />
EhEmalIgEr stuDEnt DEr khsB Erhält DEn<br />
johannEs-stEllIng-prEIs gEgEn rEchtsExtrEmIsmus<br />
Der Leiter der Kreisgeschäftsstelle der Caritas<br />
in Anklam und ehemaliger Student<br />
der <strong>KHSB</strong> (damals KFB), Ulrich Höckner,<br />
erhielt am 22. Juni 2010 den mit 2.000<br />
Euro dotierten Johannes-Stelling-Preis<br />
der SPD Fraktion des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Ulrich Höckner<br />
war in der Vergangenheit in seinem Heimatort<br />
Bargischow immer wieder offen<br />
gegen rechtsextremistische Tendenzen<br />
eingetreten. Sein Engagement gegen<br />
die zeitweilige Nutzung eines dörflichen<br />
Jugendclubs durch den sogenannten Heimatbund<br />
Pommern – eine Vorfeldorganisation<br />
der militanten Neonazikameradschaften<br />
– führte zu einer beispiellosen<br />
Verleumdungs- und Schmutzkampagne<br />
gegen ihn und seine Familie. Trotz der<br />
erheblichen Anfeindungen blieb Höckner<br />
bei seiner engagierten demokratischen<br />
Grundhaltung und trat als unabhängiger<br />
Kandidat zur Kommunalwahl an. In seiner<br />
Laudatio würdigte der Ministerpräsident<br />
des Landes Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Erwin Sellering, die Leistungen von Ulrich<br />
Höckner und der weiteren Preisträgerin<br />
Jutta Bressem. Beim Kampf gegen Rechtsextremismus<br />
brauche man einen »langen<br />
Atem«, so Sellering. Wichtig sei, dass<br />
rechtsextreme Straftaten konsequent verfolgt<br />
würden. Von ganz besonderer Bedeutung<br />
sei zudem die Bekämpfung des<br />
Rechtsextremismus im gesellschaftlichen<br />
Raum: »Hier sind alle gesellschaftlichen<br />
Akteure gefragt. Das Engagement der<br />
beiden Preisträger kann dabei Vorbild für<br />
viele andere sein«, so Sellering. Der Preis,<br />
der seit 2006 verliehen wird, ist benannt<br />
nach Johannes Stelling, einem sozial-<br />
demokratischen Politiker der Weimarer<br />
Republik, der im Juni 1933 in Berlin während<br />
der sogenannten Köpenicker Blutnacht<br />
ermordet wurde. Ulrich Höckner,<br />
der neben seiner Tätigkeit für die Caritas<br />
auch Vorsitzender des Präventionsrates<br />
der Stadt Anklam ist, war von 1992 bis<br />
1996 Student der damaligen KFB. Die gesamte<br />
Hochschule gratuliert ihm von Herzen<br />
zu diesem Preis und wünscht ihm für<br />
sein Wirken alles Gute und Gottes Segen.
AugeNblick<br />
prof. Dr.<br />
leo j. penta<br />
professor für gemeinwesenarbeit und<br />
-ökonomie<br />
Warum möchten Sie ausgerechnet an einer<br />
katholischen Hochschule für Sozialwesen unterrichten?<br />
Weil ich Priester bin, könnte man einerseits<br />
meinen, dass es »natürlich« ist, dass<br />
ich hier bin. Die meisten Leute überrascht<br />
es jedoch, dass ich nicht Theologie , sondern<br />
Stadtteil- oder Gemeinwesenarbeit<br />
unterrichte. Für mich ist es dabei wichtig<br />
darauf hinzuweisen, dass es verschiedene<br />
Ausdrucksweisen des kirchlichen Auftrags<br />
geben kann.<br />
Was finden Sie an Ihrer Arbeit an der <strong>KHSB</strong><br />
besonders erfüllend, herausfordernd oder änderungsbedürftig?<br />
Ich arbeite an der <strong>KHSB</strong> seit langem und<br />
habe viele Wellen der Curriculumsreform<br />
erlebt. Das war nicht immer einfach,<br />
weil ich oft das Gefühl hatte, schon die<br />
nächste »Reform« entwerfen zu müssen,<br />
bevor die alte wirklich eingespielt<br />
war. Nach wie vor schätze ich sehr die<br />
Studienschwerpunkte, bei deren Entwicklung<br />
ich in meiner Anfangszeit an<br />
der Hochschule mitwirken durfte. Auch<br />
herausfordernd war die Tatsache, dass<br />
ich früher und lange Zeit der erste und<br />
einzige Nicht-Deutsche Professor an der<br />
<strong>KHSB</strong> war; es bedurfte ein hohes Maß an<br />
kultureller Übersetzung! Ich finde es nach<br />
wie vor schade, dass die Bologna-Reform<br />
das Beste aus den anglo-amerikanischen<br />
Traditionen der B.A. und M.A. oft liegen<br />
lässt und die Schwächen zu eigen macht.<br />
Doch die <strong>KHSB</strong> ist für mich besonders erfüllend,<br />
weil man hier Theorie und Praxis<br />
als Selbstverständlichkeit verbinden kann.<br />
Es ist eine Plattform, um Innovatives in<br />
Deutschland zu initiieren. Deshalb wollte<br />
ich an eine (Fach-)Hochschule anstatt eine<br />
Uni-Praxis zu generieren und zu reflektieren.<br />
Wenn Sie Ihren Studierenden eins vermitteln<br />
könnten, was wäre das?<br />
Die Menschen, mit denen sie arbeiten,<br />
sind nicht Kunden oder gar Klienten – wie<br />
sie leider meistens benannt werden. Sie<br />
sind Personen! »Klient« kommt aus dem<br />
Lateinischen und bedeutet »der Hörige«<br />
– der Inbegriff eines Objekts! Studierende<br />
sollten lernen, sie aber als Subjekte zu<br />
sehen und zu schätzen.<br />
Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Strömung<br />
in der Sozialen Arbeit bzw. Heilpädagogik, die<br />
mehr beachtet werden müsste?<br />
Die Sozialraumorientierung.<br />
Glauben Sie, dass es in den Sozialen Berufen<br />
Fortschritt gibt?<br />
Wessen Fortschritt? Fortschritt – aber<br />
aus welcher Sicht? In erster Linie gibt<br />
es Veränderung. Aber nicht jedwede<br />
Veränderung ist positiv, ist »Fortschritt«.<br />
Manche Änderungen sind einfach Modeerscheinungen,<br />
manche bringen keine<br />
Besserungen, manche sind gar gefährlich.<br />
In der Sozialen Arbeit liegen geschichtlich<br />
gesehen die Beispiele für einen gefährlichen<br />
»Fortschrittsglauben« auf der Hand.<br />
Haben Sie eine Person im Umfeld der Sozialen<br />
Berufe, die Sie als Vorbild sehen?<br />
Paulus und Saul Alinsky.<br />
Welche Autorin oder welchen Autor lesen Sie<br />
besonders gern?<br />
Hannah Arendt.<br />
Was würden die meisten Menschen von ihnen<br />
gar nicht erwarten?<br />
Ich fahre gern Kajak.<br />
neuerscheinung<br />
kunDEnstuDIE – BEDarF an DIEnstlEIs-<br />
tungEn zur untErstützung DEs WohnEns<br />
Von mEnschEn mIt BEhInDErung<br />
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat<br />
seit 2009 für die Behindertenpolitik in<br />
Deutschland programmatische Bedeutung.<br />
Unter der Zielperspektive Inklusion<br />
proklamiert sie die gleichberechtigte Teilhabe<br />
von Menschen mit Behinderung am<br />
Leben in der Gemeinde. Vor diesem Hintergrund<br />
hat die Berliner »Kundenstudie«<br />
eine Standortbestimmung der wohnbezogenen<br />
Unterstützungsleistungen für<br />
Menschen mit geistiger und mehrfacher<br />
Behinderung vorgenommen und den<br />
Handlungsbedarf präzisiert. Die Erkenntnisse<br />
werden in einem Strategiekonzept<br />
verdichtet, das konkrete Maßnahmen<br />
auf dem Weg zur Inklusion benennt. Sie<br />
betreffen die Ebene des Individuums und<br />
seiner Lebenswelt sowie die Ebene des<br />
Hilfesystems und des Sozialraums.<br />
Die Forschungsarbeit weitet den Blick<br />
über das System der Behindertenhilfe<br />
hinaus auf sozialraumorientierte Ansätze<br />
der Sozialen Arbeit und der Sozialen<br />
Stadtentwicklung. Dabei wird den Unterstützungsbedarfen<br />
von behinderten<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die<br />
Studie hat für die Weiterentwicklung der<br />
Strukturen und Prozesse (nicht nur) der<br />
Behindertenhilfe bundesweite Bedeutung.<br />
Taschenbuch: 420 Seiten<br />
Rhombos-Verlag; Auflage Juli 2010<br />
ISBN-10: 3941216287<br />
23
24<br />
gott uNd die Welt<br />
reise nach oswiecim<br />
Fahrt zu den gedenkstätten des konzentrationslagers auschwitz vom<br />
5. bis 9. Februar 2010<br />
Vor der reise<br />
Dem Aushang für die Fahrt nach Auschwitz<br />
im Dezember 2009 folgte eine Phase<br />
überraschend intensiver Kommunikation:<br />
Kolleginnen und Kollegen sprachen<br />
mich an: »Ja, es ist nötig, sich mit dem<br />
Ort zu konfrontieren.« Einige warnten:<br />
» Einfach so? Haben Sie sich das gut<br />
überlegt?« Es gab auch Distanzierung:<br />
»Auschwitz? Nein, das reicht jetzt doch.<br />
Es gibt wichtigere Themen für mich.«<br />
Einige Kollegen erzählten mir von Vorfahren,<br />
die in Konzentrationslagern waren.<br />
Einige überlegten, ob sie Urlaub dafür<br />
investieren sollten. Auch Studierende erwogen<br />
das Für und Wider einer Reise zu<br />
den Gedenkstätten der Vernichtungslager<br />
des Nationalsozialismus Auschwitz und<br />
Auschwitz-Birkenau. »Interesse hätte ich<br />
schon, aber ich trau mich nicht.« »Für<br />
das Geld kann ich eine Woche schönen<br />
Urlaub machen.« »Ich war schon mal da.<br />
Einmal reicht mir. Aber gut, dass es die<br />
Möglichkeit gibt, hin zu fahren.«<br />
Ohne die konkrete Anbindung an ein<br />
Seminar sollte eine persönliche Erfahrung<br />
und Auseinandersetzung ermöglicht werden,<br />
mit dem, wofür der Name »Auschwitz«<br />
in der Geschichte steht. Von der<br />
»Erziehung nach Auschwitz« über die<br />
Theologie, die sich von daher in Frage<br />
gestellt sieht, bis hin zu den Auswirkungen<br />
von Selektion, die die Arbeitsbereiche<br />
der Sozialen Arbeit und Heilpädagogik<br />
betreffen.<br />
Verlauf der reise<br />
Am 5. Februar 2010 machte sich eine<br />
Gruppe von 19 Personen mit der Bahn<br />
auf den Weg nach Oswiecim. 14 Studierende<br />
aus allen Studiengängen, 2<br />
Professoren und 3 Mitarbeitende der<br />
Verwaltung. Am Abend erreichten wir<br />
die Begegnungsstätte »Zentrum für Dialog<br />
und Gebet«, einer Einrichtung der<br />
katholischen Kirche, in der wir komfortabel<br />
untergebracht waren. Am ersten<br />
Tag besuchten wir die Lagergebäude des<br />
sogenannten »Stammlagers Auschwitz<br />
I«. Unser Begleiter, der hauptberuflich als<br />
Geschichtslehrer arbeitet und seit zwanzig<br />
Jahren nebenamtlich Besucherinnen<br />
und Besucher durch die Gedenkstätten<br />
begleitet, erschloss uns über das unmittelbar<br />
zu Sehende hinaus eine Ahnung<br />
des »Funktionierens des Lagers«, indem<br />
er uns an vielen Zeugenberichten teilhaben<br />
ließ, die er im Laufe seiner Tätigkeit<br />
vernommen und recherchiert hatte. Nach<br />
dem Besuch der Lagergedenkstätte mit<br />
der ganzen Gruppe gab es am Nachmittag<br />
Zeit, nochmal in kleineren Gruppen<br />
oder alleine das Gelände zu begehen<br />
und auch die sog. Nationalausstellungen<br />
anzusehen. Hier dokumentieren und<br />
gestalten die einzelnen von der Shoah<br />
betroffenen Länder das Gedenken an ihre<br />
Staatsangehörigen. Am Vormittag des<br />
zweiten Tages besuchten wir mit unserem<br />
Guide die Gedenkstätte des riesigen<br />
Lagers Birkenau. Am Nachmittag hatten<br />
wir die Gelegenheit, mit Archivalien des<br />
Archivs des Lagers in Kontakt zu kommen.<br />
Lagerbücher, Transportlisten, Personalakten<br />
der Aufseher u.s.w. Hier kann<br />
man komplementär zu der Qual und dem<br />
Leiden der Gefangenen, die man erahnt,<br />
den Versuch besichtigen, alles in verwaltungsmäßiger<br />
Ordnung darzustellen.<br />
Am Vormittag des nächsten Tages hatten<br />
wir eine Begegnung mit Herrn Wilhelm<br />
Brasse. Er war als politischer Häftling im<br />
Stammlager gefangen und musste als<br />
gelernter Fotograf die neu ankommenden<br />
Häftlinge für die Akten fotografieren und<br />
später auch die Menschen, mit denen<br />
Ärzte, wie Dr. Mengele und Prof. Dr.<br />
Clauberg, ihre medizinischen Versuche<br />
machten. Nach der Befreiung des Lagers<br />
wollte er natürlich seinen Beruf weiter<br />
ausüben, war dazu aber nicht mehr in<br />
der Lage, weil er - traumatisiert von dem<br />
im Lager Erlebten - immer wieder Opfer<br />
der Experimente vor Augen hatte. Am<br />
Nachmittag unseres letzten Tages besuchten<br />
wir mit dem Zivildienstleistenden<br />
des Zentrums für Dialog und Gebet das<br />
Stadtzentrum von Auschwitz und hörten<br />
etwas von der wechselvollen Geschichte<br />
der Stadt, bevor sie durch die Einrichtung<br />
dieses Vernichtungslagers zum Synonym<br />
der Shoah wurde und seitdem kaum je<br />
als eigene wahrgenommen werden kann.<br />
An den Abenden trafen wir uns in der<br />
Gruppe und versuchten, die Eindrücke<br />
des jeweiligen Tages anzuhören. Aus<br />
dem Vielen, das zur Sprache kam: die<br />
Verstörung, die die Fotos der ausgemergelten<br />
und ausgebeuteten Menschen
auslösen. Die Verzweiflung, die der Block<br />
11, der »Todesblock« hervorruft, in dem<br />
Unrechtssystem die Fiktion von rechtmäßigen<br />
Verurteilungen von Verstößen<br />
gegen Lagergesetze exekutiert wurde und<br />
Gefangene als Häftlinge zusätzlich brutal<br />
eingesperrt wurden. Die Fassungslosigkeit<br />
über Werkzeuge für die »Sonderstrafen«,<br />
denen die Häftlinge ausgesetzt waren, die<br />
der Brutalität und der Erniedrigung immer<br />
noch den Anschein von Rechtmäßigkeit<br />
geben sollten. Neben der Erschütterung<br />
über das vielfache Leiden der Häftlinge,<br />
für die es keine rechte Sprache zu geben<br />
scheint, gab es auch Reaktionen der Empörung,<br />
z.B. über die effiziente Organisation<br />
zur eigenen Bereicherung des NS-<br />
Staates. Empörung darüber, dass die Juden<br />
aus Griechenland beispielsweise ihre<br />
Fahrkarten zum Vernichtungslager selbst<br />
bezahlen mussten, darüber, wie die Habe<br />
der Deportierten säuberlich desinfiziert,<br />
gelagert und magaziniert wurde, um sie<br />
ausgebombten Bewohnern im »Reich«<br />
als Ersatzgüter anbieten zu können. Empörung<br />
und Wut, wie die Menschen mit<br />
Ankunft im Lager wie Sachen behandelt<br />
und wie sorgfältig die Sachen ihres Besitzes<br />
behandelt wurden. Und Erschrecken<br />
über den »Wert von Modernität«<br />
zeigte sich angesichts der »innovativen<br />
Technik«, mit der die Massenvernichtung<br />
organisiert wurde.<br />
nach der reise<br />
Nachdem wir am 9. Februar 2010 wieder<br />
in Berlin angekommen waren, gingen wir<br />
in die vorlesungsfreie Zeit. Bei einem Treffen<br />
zu Beginn des Semesters stellten wir<br />
fest, dass wir mit vielen Eindrücken nicht<br />
»fertig« waren. Dass sie einerseits nicht in<br />
die erlebten Alltage zu passen scheinen,<br />
andererseits hörten wir aber auch von<br />
Alltagserfahrungen und Themen, die sich<br />
als durchsichtig erweisen für das, was wir<br />
beim Besuch der Gedenkstätten erfahren<br />
haben.<br />
Die khsB auf dem 2. ökumenischen<br />
kirchentag in münchen<br />
Bernd Streich<br />
Unter dem Motto »Forschung & Lehre«<br />
präsentierten sich die 17 kirchlichen<br />
Hochschulen in Deutschland auf dem 2.<br />
Ökumenischen Kirchentag in München<br />
mit einem gemeinsamen Stand.<br />
Mit mehr als 20 Vorträgen, Filmvorführungen,<br />
Performances und Diskussionsrunden<br />
stellten die kirchlichen Fachhochschulen<br />
der Rektorenkonferenz kirchlicher<br />
Fachhochschulen (RKF) ihr breites Themenspektrum<br />
vor. Die Inhalte reichten<br />
von Religion und Religiosität über Soziale<br />
Arbeit, Bildung und Erziehung bis hin<br />
zu Pflege und Alter. Der Focus lag dabei<br />
auf Forschungsprojekte aus den einzelnen<br />
Hochschulen. Die <strong>KHSB</strong> war täglich<br />
am Stand vertreten: am Samstag durch<br />
die Rektorin, Frau Prof. Monika Treber<br />
und am Donnerstag durch Herrn Bernd<br />
Streich. Herr Prof. Dr. Stephan Höyng war<br />
im Dialogforum auf dem Stand beteiligt<br />
und stellte am Freitag unter dem Thema:<br />
»Männer in Kindertagesstätten – Bedarfe,<br />
Schwierigkeiten und Handlungsempfehlungen«<br />
sein Forschungsprojekt vor. Ziel<br />
des Projektes ist es, in den kommenden<br />
Jahren gemeinsam mit politisch und praktisch<br />
Verantwortlichen den Anteil männ-<br />
licher Fachkräfte spürbar zu steigern. Der<br />
gemeinsame Stand war einer der größten<br />
Stände in der Halle A6 und bot vielfältige<br />
Informationen, die Möglichkeit zum Gespräch<br />
mit Studierenden, Lehrenden und<br />
Mitarbeitern der Administration. Viele<br />
Interessierte informierten sich über konkrete<br />
Studienmöglichkeiten und fragten<br />
nach Besonderheiten einzelner Hochschulen.<br />
Es gab auch viele Gäste, die sich über<br />
die kirchlichen Hochschulen informieren<br />
wollten. So war Erzbischof Marx aus<br />
München sehr interessiert und ein gefragter<br />
Gesprächspartner.<br />
Studierende der Katholischen Hochschule<br />
Nordrhein-Westfalen führten ein Umfrageprojekt<br />
zum Thema »Ökumene«<br />
durch. Sie fragten Jugendliche und junge<br />
Erwachsene nach ihren Ansichten zur<br />
Ökumene. »Damit ihr Hoffnung habt«<br />
war das Motto des 2. Ökumenischen<br />
Kirchentages. Die Zusammenarbeit der 11<br />
evangelischen und 6 katholischen Hochschulen<br />
war gelungen und gibt Hoffnung<br />
zu weiterer guter ökumenischer Zusammenarbeit,<br />
nicht erst beim 3. Ökumenischen<br />
Kirchentag.<br />
25
26<br />
FerNblick<br />
Wie machen es die anderen?<br />
Deutsch-französischer Austausch zu Studium und Praxis im Nachbarland<br />
Wie machen es die anderen? Das ist die<br />
Leitfrage des deutsch-französischen Austauschs,<br />
den die <strong>KHSB</strong> in Zusammenarbeit<br />
mit dem Institut Universitaire de Technologie<br />
de Rennes, dem Interkulturellen<br />
Netzwerk e.V. und unterstützt durch das<br />
Deutsch-Französische Jugendwerk in diesem<br />
Jahr durchführt. Im Mittelpunkt des<br />
deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekts<br />
steht der professionsbezogene Austausch<br />
und der Vergleich der deutschen<br />
Studiengänge Soziale Arbeit, Heilpädagogik,<br />
Bildung und Erziehung sowie des<br />
französischen Studiengangs Animation<br />
Sociale et Socio-culturelle. Den Studierenden<br />
des jeweils anderen Landes soll gezeigt<br />
werden, welche potentiellen Berufsfelder<br />
mit der erworbenen Qualifikation<br />
angestrebt werden können. Neben diesen<br />
fachlich orientierten Zielen stehen der<br />
kulturelle Austausch und die Entdeckung<br />
der jeweils anderen Kultur im Zentrum.<br />
Die erste Austauschwoche, an der neben<br />
Professorinnen und Betreuern 8 deutsche<br />
und 10 französische Studierende teilnahmen,<br />
fand im Juni 2010 in Berlin statt. Als<br />
Highlights wurden die praxisnahen Exkursionen<br />
in die verschiedenen Einrichtungen<br />
wie z.B. Unter Druck/Kultur von der Stra-<br />
ße sowie Kontakt- und Beratungsstelle für<br />
Flüchtlinge und MigrantInnen e.V. erlebt.<br />
Da in Frankreich keine institutionell verankerte<br />
Arbeit mit Obdachlosen existiert,<br />
sondern nur eine Grundversorgung für<br />
Obdachlose geleistet wird, war insbesondere<br />
dieses Thema für die französischen<br />
Studierenden von großem Interesse. Aber<br />
auch der Unterschied zwischen den deutschen<br />
und französischen Studiengängen<br />
sowie den potentiellen Berufsfeldern<br />
erzeugte noch mehr Neugier und den<br />
Wunsch, die einzelnen Studiengangsinhalte<br />
noch besser kennen zu lernen. In<br />
binationalen Gruppen wurden verschiedene<br />
Themen so z.B. zum Thema Arbeit<br />
mit Jugendlichen, KITA und Arbeit mit<br />
Obdachlosen bearbeitet. Die binationalen<br />
Gruppen entwickelten zu diesen Themen<br />
fiktive Projekte. Trotz unterschiedlich<br />
vorhandener Fremdsprachenkenntnisse<br />
schafften es die Studierenden, gemeinsam<br />
originelle Projektideen zu entwickeln<br />
und Sprachhemmnisse sowie kulturelle<br />
Unterschiede zu überwinden. Die Gruppenmitglieder<br />
lernten hierbei gegenseitig<br />
voneinander. Die Studierenden der <strong>KHSB</strong><br />
lernten z.B. die in Frankreich verbreitete<br />
Methode des Debatten-Cafés kennen, die<br />
themenspezifisch eingesetzt wird. Es wer-<br />
den hierbei Betroffene, der Bürgermeister<br />
sowie VertreterInnen von Organisationen<br />
eingeladen, um das spezifische Thema zu<br />
diskutieren. Nach der Austauschwoche<br />
waren sich die deutschen und französischen<br />
Studierenden einig, dass es eine<br />
gelungene Austauschwoche war. Die<br />
Tränen bei der Verabschiedung zeigten,<br />
dass nicht nur ein fachlicher Austausch<br />
stattgefunden hatte, sondern dass auch<br />
grenzüberschreitend neue Freundschaften<br />
geschlossen worden waren. Aber der<br />
Abschied ist ja noch kein richtiger: Im<br />
November diesen Jahres wird die Rückbegegnung<br />
in Rennes stattfinden – hier wird<br />
es für die Studierenden der <strong>KHSB</strong> dann<br />
um die Frage gehen: Wie machen es die<br />
anderen?<br />
WEgE Ins auslanDssEmEstEr &<br />
auslanDspraktIkum<br />
…interkulturelle Erfahrungen sammeln, über<br />
den Tellerrand hinausblicken, das professionelle<br />
Spektrum erweitern, die Fremdsprachenkenntnisse<br />
verbessern, auf eigenen Beinen stehen…<br />
Es gibt gute Gründe, einen studienintegrierten<br />
Auslandsaufenthalt zu planen.<br />
Die <strong>KHSB</strong> unterstützt Studierende bei<br />
der Planung eines Auslandssemesters<br />
und Auslandspraktikums. Als anerkannte<br />
ERASMUS-Hochschule kann die <strong>KHSB</strong><br />
jährlich Stipendien an Studierende vergeben,<br />
die an einer der 17. Partnerhochschulen<br />
studieren oder ein Praktikum<br />
an einer sozialen Einrichtung in Europa<br />
absolvieren wollen.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie bei:<br />
Marion.Mueller[at]khsb-berlin.de
kleine schritte,<br />
die die Welt verändern…<br />
Mein Praktikum auf den Philippinen<br />
Paradiesische Natur und Pazifik, Palmenund<br />
Bananenwälder sowie wunderbare<br />
Natur … das sind unsere ersten Eindrücke,<br />
als wir in Davao City auf den Philippinen<br />
ankommen, um dort unser Praktikum<br />
bei der Kindernothilfe zu absolvieren.<br />
Schnell folgen allerdings auch andere<br />
Bilder von der Realität auf den Philippinien<br />
und den Problemen des Landes: Die<br />
Armut ist sehr groß, oft leben bis zu fünf<br />
Generationen in einer kleinen Holzhütte.<br />
Die Menschen haben Krankheiten aufgrund<br />
schlechter Hygiene und Ernährung.<br />
Kinderarbeit und Kinderprostitution sind<br />
Alltag. Es gibt viele Kinder, die auf der<br />
Straße leben. Die Mitglieder armer Familien<br />
sind kaum gebildet und selten über<br />
Menschenrechte aufgeklärt. Gewalt als<br />
Erziehungsmethode ist vorherrschende<br />
Realität. Unser Praktikum eröffnet uns die<br />
Möglichkeit, mit Straßenkindern in einem<br />
Slumgebiet zu arbeiten. Für diese Kinder<br />
veranstalten wir Kunst- und Tanzprojekte.<br />
Wir arbeiten mit den Bajaos. Die Bajaos<br />
gehören zu den ethnischen Minderheiten<br />
auf der Südhälfte der Insel Mindanao.<br />
Außerdem erhalten wir die Möglichkeit,<br />
zwei Wochen in einer Einrichtung zu arbeiten,<br />
die psychisch und körperlich misshandelte<br />
Mädchen betreut. Aus der Sicht<br />
von Sozialarbeitern gibt es auf den Philippinen<br />
sehr viel zu tun und Hilfe von Außen<br />
ist hier von großer Bedeutung. Wer<br />
helfen will, kann Partner von Pag-Ugmad<br />
(meine Organisation) werden. Schon mit<br />
2 oder 3 Euro kann Kindern auf den Philippinen<br />
für eine Woche geholfen werden.<br />
Es gibt viele Möglichkeiten, die Menschen<br />
zu unterstützen, sodass sie eine Chance<br />
haben in die Schule zu gehen, jeden Tag<br />
zu essen zu bekommen und einen sicheren<br />
Schlafplatz zu finden.<br />
Willst Du aktiv werden? Dann fordere weitere<br />
Informationen an: ninawahle[at]gmx.de<br />
sattelt die hühner, wir<br />
reiten nach texas!<br />
Das vierte Semester rückt näher und die Frage<br />
des passenden Praktikums wird für viele Studierende<br />
immer drängender. Benny und Rico<br />
studieren Soziale Arbeit hier an der <strong>KHSB</strong> und<br />
wagen den Fernblick nach Austin, Texas. Rico<br />
berichtet:<br />
Austin gehört mit seinen über 750 000<br />
Einwohnern zu den größten Städten in<br />
Texas. Hier gibt es zwei große und mehrere<br />
kleine Universitäten, sodass das Stadtbild<br />
von jungen Leuten und Alternativen<br />
geprägt ist, ganz nach dem Motto »Keep<br />
Austin weird«. Man merkt außerdem,<br />
dass Austin nicht zu unrecht als eine der<br />
»grünsten« Städte der USA gilt, da sich<br />
hier viele »grüne« Unternehmen angesiedelt<br />
haben und viele »Austinites« sehr<br />
umweltbewusst leben, Hybrid-Autos,<br />
Fahrräder, Busse und die Tram nutzen.<br />
Es fällt auch sofort auf, dass Austin zu<br />
Recht als die »Live Music capitol« der<br />
Welt gilt. Man kann jeden Abend in unzähligen<br />
Bars und Clubs auf der berühmten<br />
6th Street und »SoCo« live Bands<br />
erleben. Zudem veranstaltet die Stadt<br />
jedes Jahr zwei international bekannte<br />
und geschätzte Festivals: das »South by<br />
Southwest« und »Austin City Limits«.<br />
Wir hätten uns also keinen besseren Ort<br />
aussuchen können, um uns während des<br />
Praktikums auch in der Stadt wohl zufühlen.<br />
Die Unterschiede in der Sozialen<br />
Arbeit im Vergleich zum Sozialsystem in<br />
Deutschland erscheinen uns nicht all zu<br />
groß. Wir arbeiten beide in einer Non-<br />
Profit-Organisation für Menschen mit<br />
HIV / Aids. Ich selbst (Rico) bin in einem<br />
Wohnprojekt tätig und Benny arbeitet<br />
in einem Hospiz. Uns beeindruckt, wie<br />
stark die verschiedenen Einrichtungen in<br />
Austin untereinander vernetzt sind und<br />
wie offen und dennoch professionell die<br />
Kommunikationsstrukturen sind. Unsere<br />
Aufgaben sind sehr vielfältig und reichen<br />
von »Counseling« über Case Management<br />
bis hin zur Mitarbeit bei verschiedenen<br />
Projekten: Zum Beispiel einen<br />
Nachbarschaftsgarten zu organisieren,<br />
Fundraising-Aktionen wie das alljährliche<br />
Fahrradrennen der »AIDS Service Agencies«<br />
in Austin zu unterstützen oder mit<br />
einer Ressourcen Map den Dschungel an<br />
Hilfsangeboten für die Klienten verständlicher<br />
zu machen. Neben dem Praktikum<br />
haben wir zusätzlich die Chance, einen<br />
Einblick in das »Social Work«-Studium<br />
an der University of Texas in Austin zu<br />
bekommen. Wir besuchen ein Seminar zu<br />
»International Social Work« und halten<br />
dort eine Präsentation über Soziale Arbeit<br />
in Deutschland. Das Auslandspraktikum in<br />
Austin ist für uns beide ein voller Erfolg!<br />
Wir treffen hier interessante Menschen,<br />
lernen viel Neues über US-amerikanische<br />
Sozialarbeit und stellen fest, dass viele europäische<br />
Vorurteile gegenüber der USA<br />
nicht mehr sind als eben nur Vorurteile.<br />
27
28<br />
Ausblick<br />
IntErnatIonalEr tag an DEr khsB<br />
24. noVEmBEr 2010<br />
13:30 uhr – 18:00 uhr<br />
»Die <strong>KHSB</strong> ist internationaler als man<br />
denkt!« Viele Studierende bringen internationale<br />
Erfahrung mit, interessieren sich<br />
für andere Länder, wollen im Studium<br />
ins Ausland oder engagieren sich über<br />
Grenzen hinweg. Auch Lehrende sind oft<br />
international aktiver als es scheint. Es gibt<br />
hier und da an der <strong>KHSB</strong> Projekte mit internationaler<br />
Ausrichtung, von denen die<br />
wenigsten wissen. Diese Internationalität<br />
soll sichtbar gemacht werden. Am 24.<br />
November gibt es hierfür einen Internationalen<br />
Tag. Geplant sind neben Diskussionsrunden,<br />
Schnupperworkshops, Vorträgen<br />
und Ideenworkshops auch Foren für<br />
den Erfahrungsaustausch zu international<br />
ausgerichteten Themen. Für ein spannendes<br />
Programm und eine Menge Spaß<br />
ist somit gesorgt. Am besten den Termin<br />
gleich in den Kalender eintragen!<br />
… und wer sich im Vorfeld aktiv einbringen<br />
will, kann sich bei uns melden.<br />
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen!<br />
Kontakt<br />
Franziska Leers & Sara Kauer<br />
internationalertag[at]khsb-berlin.de<br />
Carolin Osterburg & Teresa Ernst<br />
ausland[at]khsb-berlin.de<br />
Marion Müller<br />
marion.mueller[at]khsb-berlin.de<br />
»sport unD BEhInDErung – DIE hErausForDErungEn<br />
DEr un-BEhInDErtEnrEchtskonVEntIon«<br />
symposIum<br />
am 22. noVEmBEr 2010 Im staDIon Von<br />
BayEr 04 lEVErkusEn (BayarEna)<br />
Das Thema »Sport und Behinderung« ist<br />
nicht neu. Neu aber sind jene Anforderungen,<br />
die die UN-Behindertenrechtskonvention<br />
an sämtliche kollektiven und<br />
individuellen Akteure des Sports stellt.<br />
Diese Konvention bedeutet für den Sport<br />
weitaus mehr als nur die Sicherstellung<br />
des Zugangs von Menschen mit Behinderungen<br />
zu Sportstätten und der Möglichkeit<br />
ihrer Teilnahme an sportlichen<br />
Aktivitäten! Welche Implikationen sie für<br />
die diversen kollektiven und individuellen<br />
Akteure des Sports mit sich bringt<br />
und wie die aus ihr hervorgehenden<br />
Grundsätze in den diversen Bereichen<br />
des Sports in konkrete Strukturen und<br />
Handlungen umgesetzt werden können,<br />
ist Gegenstand dieses Symposiums, das<br />
vom ICEP in Kooperation mit dem »Wissenschaftlichen<br />
Beirat des Arbeitskreises<br />
Kirche und Sport« und der »Arbeitsstelle<br />
Pastoral für Menschen mit Behinderung«<br />
der Deutschen Bischofskonferenz veranstaltet<br />
wird. Referent/-innen sind u.a.<br />
Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper (Deutscher<br />
Olympischer Sportbund, Vizepräsidentin<br />
für Bildung und Olympische Erziehung);<br />
Hubert Hüppe (Behindertenbeauftragter<br />
der Bundesregierung); Prof. Dr. Andreas<br />
Lob-Hüdepohl (Präsident der Katholischen<br />
Universität Eichstätt-Ingolstadt).<br />
Information und Anmeldung:<br />
Florian Kiuppis<br />
ICEP - Berliner Institut für christliche Ethik<br />
und Politik<br />
Telefon 030 – 50 10 10 913<br />
kiuppis[at]icep-berlin.de<br />
www.icep-berlin.de
»gErEchtE FInanzIErung DEr pFlEgE<br />
– WIE muss solIDarItät künFtIg organIsIErt<br />
WErDEn?« 28. oktoBEr 2010,<br />
katholIschE akaDEmIE BErlIn<br />
Die Ermöglichung einer menschenwürdigen<br />
Pflege ist eine der großen sozialpolitischen<br />
Herausforderungen der kommenden<br />
zwei Jahrzehnte. Die Erweiterung<br />
des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die<br />
Dynamisierung der Beiträge durch die<br />
Pflegereform 2008 haben die Frage nach<br />
den strukturellen und finanziellen Rahmenbedingungen<br />
der sozialen Pflegeversicherung<br />
(SPV) nur zum Teil beantwortet.<br />
Es bleibt nach wie vor unklar, ob und wie<br />
eine solidarische und paritätisch getragene<br />
Finanzierung auch langfristig zu realisieren<br />
ist. Im Rahmen dieser Fachtagung<br />
werden Zukunftsfragen der Finanzierung<br />
der SPV und den sich daran anschließenden<br />
Herausforderungen für Politik,<br />
Ökonomie und Sozialethik diskutiert.<br />
Die Fachbeiträge aus der Wissenschaft<br />
und die politische Kontroverse sollen zur<br />
Reflexion der ethischen Dimensionen der<br />
Finanzierung von Pflege und zur Entwicklung<br />
geeigneter Lösungswege in Politik<br />
und Gesellschaft beitragen.<br />
Das ICEP veranstaltet diese nichtöffentliche<br />
Fachveranstaltung in Kooperation mit dem Verband<br />
Katholische Altenhilfe Deutschland und<br />
der Katholischen Akademie Berlin.<br />
VEranstaltungEn DEs ForumFamIlIE<br />
Im WIntErsEmEstEr 2010/11<br />
4.11.2010 | Das Patenprojekt: Bereichung der<br />
eigenen Lebenswelt für Kinder, Eltern und<br />
Paten. Ein Unterstützungsmodell für Kinder, die<br />
eine Erweiterung ihres familiären Netzwerkes<br />
benötigen.<br />
Andrea Rakers, Dipl.Päd, LebenLernen e.V.<br />
Kooperationsprojekt von PiK GmbH mit<br />
LebenLernen e.V. und Aktion Mensch,<br />
das Paten sucht, schult und begleitet,<br />
damit Kinder ohne stabiles soziales Netzwerk<br />
eine dauerhafte zusätzliche verlässliche<br />
Bezugsperson haben für ihre gesunde<br />
Entwicklung.<br />
18.11.2010 | Auf der Suche nach den »neuen<br />
Vätern« – Männer zwischen Familienarbeit und<br />
Brotverdienen.<br />
Johanna Possinger, Dipl.-Kulturwirt, Referemntin<br />
für Familienpolitik beim Deutschen Verein<br />
für öffentliche und private Fürsorge, Berlin<br />
Statt um »Vätermonate« und Elternzeit<br />
geht es auch um vielfältige Vereinbarkeitsdilemmata<br />
zwischen betrieblichen<br />
Hindernissen und persönlichen familiären<br />
Ansprüchen – Ergebnisse einer empirischen<br />
Studie bei einem großen Energiekonzern.<br />
13.1.2011 | Die Begleitung von pflegenden Angehörigen<br />
demenzerkrankter Menschen durch<br />
Soziale Arbeit.<br />
Antje Doliff, cand. BA Soz.Arbeit (<strong>KHSB</strong>); Projektmitarbeiterin<br />
am Demenzzentrum Schwerin<br />
Neue Versorgungsstrukturen und niedrigschwellige<br />
Betreuungsangebote<br />
Immer donnerstags 14.00 – 15.30 Uhr in<br />
Raum 214. Jede Veranstaltung wird hochschulöffentlich<br />
angekündigt.<br />
casE-managEmEnt In DEr sozIalEn<br />
arBEIt – chancE Für DIE proFEssIon –<br />
Fluch oDEr sEgEn?<br />
Fachtagung am 27.11.2010<br />
Eine Fachtagung in Zusammenarbeit mit dem<br />
Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e.v.<br />
(DBSH)<br />
Case Management bewegt sich in der Polarität<br />
zwischen einer von Klienten beauftragten<br />
Hilfe-(dienst)-leistung und dem<br />
Anspruch hoher fachlicher Arbeit auf der<br />
einen Seite, und der Beauftragung zur<br />
kosten- und wirksamkeitsorientierten<br />
Verknüpfung gesundheitlicher, sozialer<br />
und materieller Dienste auf der anderen<br />
Seite. Chancen und Risiken des Case<br />
Management hängen daher entscheidend<br />
von den sozialpolitischen Rahmensetzungen,<br />
aber auch den Ausbildungsstandards<br />
ab. Entsprechend können Erfordernisse,<br />
Bedeutung, Reichweite, Motive, Inhalte<br />
und Wirkung des Case Managment<br />
höchst unterschiedlich sein. Das Referat<br />
Weiterbildung wird mit dem DBSH die<br />
Positionierung von Case Management in<br />
der Sozialen Arbeit bilanzieren. Eingeladen<br />
sind Prof. Dr. Matthias Müller von der<br />
Fachhochschule Neubrandenburg, Prof.<br />
Dr. Remmel-Faßbender, Katholische Fachhochschule<br />
Mainz und Friedrich Maus,<br />
DBSH<br />
Weitere Informationen bekommen Sie bei<br />
Mechthild Schuchert, Referat Weiterbildung.<br />
Telefon 030 – 50 10 10 37<br />
mechthild.schuchert[at]khsb-berlin.de<br />
29
30<br />
AugeNblick<br />
prof. Dr.<br />
Birgit Bertram<br />
professorin für mikrosoziologie<br />
Warum möchten Sie ausgerechnet an einer<br />
katholischen Hochschule für Sozialwesen unterrichten?<br />
Es entspricht meiner Vision vom Menschen,<br />
dass jeder Mensch, ob groß oder<br />
klein und egal in welchem Kontext, immer<br />
ein ganzer Mensch ist und damit ein<br />
Ebenbild Gottes.<br />
Was finden Sie an Ihrer Arbeit an der <strong>KHSB</strong><br />
besonders erfüllend, herausfordernd, oder änderungsbedürftig?<br />
Das hängt mit der ersten Frage zusammen.<br />
Ich mag es, wie menschenfreundliche<br />
und zugleich kompetente Lösungen<br />
gesucht und auch gefunden werden. In<br />
meinem Leben bin ich kreuz und quer<br />
durch die Republik gezogen und habe<br />
immer im Kontext der Caritas in der<br />
Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und<br />
dabei eine eindrückliche Kombination von<br />
Professionalität mit Herzlichkeit erlebt.<br />
Und das finde ich hier an der Hochschule<br />
fortgesetzt, nämlich eine hohe Übereinstimmung<br />
von Menschenfreundlichkeit<br />
und Herzlichkeit, gepaart mit hoher<br />
Professionalität. Das finde ich großartig.<br />
Ich bin seit 18 Jahren hier und habe viel<br />
miterlebt – Umzüge, Reformen, Änderungen,<br />
was nicht immer einfach war. Dadurch<br />
aber ist ein Ethos entstanden, das<br />
die Menschen hier zusammenhält, trotz<br />
aller Differenzen.<br />
Wenn Sie Ihren Studierenden eins vermitteln<br />
könnten, was wäre das?<br />
Die Person ihres Gegenübers ganzheitlich<br />
ernst zu nehmen, weder auf den »Kopf«<br />
zu reduzieren noch auf das »Problem«,<br />
aber auch nicht auf die Interessen der Institutionen<br />
– sonst wird schnell übersehen,<br />
was wirklich hilft. Nützlich ist das Wissen,<br />
dass die kleinen Lebenskreise Stabilität<br />
und Hilfe ermöglichen. Das Schöne an der<br />
Mikrosoziologie ist, die Wirksamkeit der<br />
sozialen Netzwerkstrukturen zu erkennen<br />
– Familien, Freundschaften, Nachbarschaften<br />
– eben den Menschen in seinen<br />
Beziehungen zu seinen Mikrosystemen.<br />
Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Strömung<br />
in der Sozialen Arbeit bzw. Heilpädagogik, die<br />
mehr beachtet werden müsste?<br />
Ich lehre in den sog. Bezugswissenschaften,<br />
aber ich würde sagen: das Studium<br />
der gelebten Familienwirklichkeit aus der<br />
Perspektive ihrer Mitglieder, und dazu die<br />
empirischen Befunde ernst nehmen.<br />
Glauben Sie, dass es in den Sozialen Berufen<br />
Fortschritt gibt?<br />
Auf jeden Fall. Wir wissen jetzt viel dezidierter<br />
über die Entwicklungspotentiale<br />
von Menschen Bescheid, und das ist ein<br />
Ergebnis der Integration von verschiedenen<br />
Disziplinen: Neurologie, Medizin, Pädagogik,<br />
Psychologie, Soziologie – all das<br />
ergibt ein Mosaik, das hilft, die menschliche<br />
Entwicklung in unterschiedlichen<br />
Kontexten besser zu verstehen. Einige<br />
Entwicklungen tragen schon Früchte.<br />
Kinder werden zunehmend ganzheitlich<br />
ernst genommen, sozusagen schon als<br />
kleiner Mensch ein ganzer Mensch. Im<br />
Mittelpunkt sollte nicht stehen, wo es erst<br />
hinkommen soll, sondern wie es jetzt sein<br />
Leben mitgestalten kann. Kinder haben<br />
das Recht, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen<br />
werden.<br />
Haben Sie eine Person im Umfeld der Sozialen<br />
Berufe, die Sie als Vorbild sehen?<br />
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.<br />
Welche Autorin oder welchen Autor lesen Sie<br />
besonders gern?<br />
Ich lese viel Belletristik und auch »gute«<br />
Krimis, und es fällt mir schwer, einzelne<br />
Namen zu nennen. Diese Lektüre brauche<br />
ich als Gegengewicht zu den wissenschaftlichen<br />
Texten. Ich habe zuerst Psychologie<br />
studiert und schwankte damals,<br />
ob ich nicht doch Kriminalistin werden<br />
könnte, denn mich fasziniert es herauszufinden,<br />
warum ein Mensch so handelt,<br />
wie er es tut. Das kann ich gut in meine<br />
Arbeit integrieren: Im Biographie-Seminar<br />
gibt es neben der wissenschaftlichen Literatur<br />
auch eine Romanliste für den »biographischen<br />
Blick«, was die Studierenden<br />
sehr schätzen.<br />
Was würden die meisten Menschen von Ihnen<br />
gar nicht erwarten?<br />
Die meisten sind völlig verblüfft – ich<br />
mache große Teppichbilder, die jeweils<br />
zwischen 3 und 5 Jahre dauern, und zwar<br />
Bilder, die ich im Kopf habe und denen<br />
ich mit Wolle und Farbe Gestalt gebe. Ich<br />
brauche etwas, was ich mit den Händen<br />
anfertige. Der letzte Teppich heißt »Californian<br />
Stranded Goods«, und gerade<br />
entsteht einer über Musik: »Hallelujah«!
IMPRESSUM<br />
Katholische Hochschule<br />
für Sozialwesen Berlin<br />
Köpenicker Alle 39-57<br />
10318 Berlin<br />
Herausgegeben von der Rektorin<br />
Prof. Monika Treber<br />
Chefredakteur<br />
Dr. Ian Kaplow, Presse<br />
kaplow[at]khsb-berlin.de<br />
Ausgabe WiSe 2010<br />
Layout & Satz<br />
Norbert Poppe | transformhaus.de<br />
Druck: Pinguindruck Berlin<br />
Auflage: 5000<br />
Gedruckt auf Papier mit FSC Umweltsiegel<br />
Bildnachweis<br />
S. 4 Dmitry Nikolaev - Fotolia.com<br />
S. 13 deanm1974 - Fotolia.com<br />
S. 20 Alexander Raths - Fotolia.com<br />
S. 21 willma... / photocase.com<br />
S. 24 istock.com<br />
S. 26 Kristin Werschnitzke<br />
Alle anderen Bilder <strong>KHSB</strong><br />
PersoNAliA<br />
Im sommersemester 2010 haben einige kolleginnen und kollegen die hochschule<br />
verlassen. Ihnen gelten unser Dank und unsere guten Wünsche für die zukunft.<br />
tombolo Mukengechay<br />
Mitarbeiter in der Verwaltung seit 01.01.1992<br />
judith schobert<br />
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt »Aktuelle Entwicklungen<br />
in der Sozialpädagogischen Familienhilfe« seit 04.09.2009<br />
neu berufen bzw. angestellt wurden:<br />
dr. ute Fischer<br />
Gastprofessorin für Heilpädagogik<br />
projektmitarbeit:<br />
Astrid homann<br />
Sachgebietsbearbeitung in der Koordinationsstelle »Männer in Kitas«<br />
thomas schmidt<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Ȁlter werdende Eltern und<br />
erwachsene Familienmitglieder mit Behinderung zu Hause«<br />
sandra schulte<br />
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Web-Site-Management und Tagungsplanung<br />
in der Koordinationsstelle »Männer in Kitas«<br />
Dienstjubiläum:<br />
Wir gratulieren Frau Annegret Schenkel zum 25-jährigen Jubiläum im kirchlichen<br />
Dienst am 01.09.2010.<br />
31