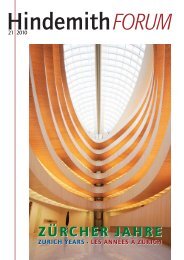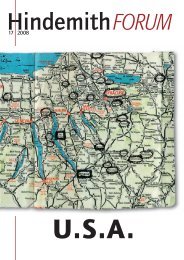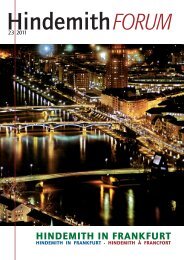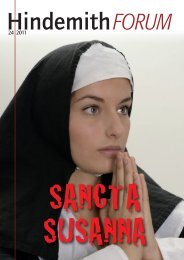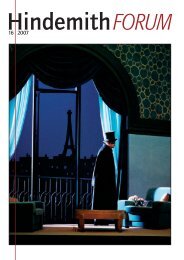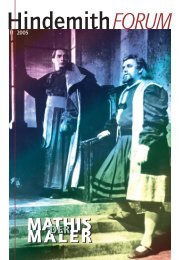DIE VIOLINKONZERTE - Paul Hindemith
DIE VIOLINKONZERTE - Paul Hindemith
DIE VIOLINKONZERTE - Paul Hindemith
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>DIE</strong> <strong>VIOLINKONZERTE</strong>DAS ÖFFENTLICHESUBJEKTZu <strong>Hindemith</strong>s ViolinkonzertenKammermusik Nr. 4 op. 36 Nr. 3 für Solo-Violine und größeres Kammerorchester (1925/51)Perkussiv geführte Holzbläser mitgleichförmigen Schlägen, eine Posaune,die nicht nur durch Klang und Tongebungein Dies irae beschwört, ein weiteresostinates Motiv von Trommeln, die in seriöserMusik bis dahin fehlten, schließlichFanfaren, deren Gestus den Titel des Satzes,„Signal“, unmittelbar verständlichmachen: Nichts, weder Faktur noch Besetzung,lässt auf den Beginn eines Violinkonzertsschließen, das <strong>Paul</strong> <strong>Hindemith</strong>1925 als Kammermusik Nr. 4 (op.36, Nr. 3) konzipierte. Verweigerungshaltung,Protest gegen eine Tradition desgroßen Solokonzerts oder mutwillige Alternative?Zunächst jedenfalls der Versuch,das Verhältnis von Solist und Begleitung,der Teilnehmer eines Konzerts,neu zu definieren. Nicht die Fähigkeiteneines einzelnen werden herausgestellt,der mit seiner Virtuosität ein großes Publikumbeeindrucken soll. Vielmehr wirdim ersten Satz ein Klanghorizont entwickelt,in den sich das Soloinstrumentintegrieren soll. Bezeichnenderweise verzichtet<strong>Hindemith</strong> in seinem zwei DutzendMusiker zählenden Ensemble aufViolinen und disponiert lediglich je vierBratschen, Celli und Bässe. Der Solistkonkurriert nicht mit Instrumenten seinesGenres, sondern ist integraler Teil einesKlangkörpers, der die tiefen Lagen derStreicher betont und auch in den Bläsernauf Stimmen, die klanglich vermittelnkönnten, verzichtet. Eine Gruppe von Individualisten,die der Sologeiger lediglichkomplettiert. Zwar wird ihm bei einemersten Auftritt selbstverständlich Gelegenheitgegeben, mit Doppelgriffen undPassagen seine Virtuosität vorzustellen.Doch die Idee des zweiten Satzes, densolche Exposition des Solisten einleitet,ist nichts weniger als der Gedanke einesKonzertierens. Vielmehr schreibt <strong>Hindemith</strong>ein weiträumiges Fugato: Polyphonieals Inbegriff von Kammermusik, derKommunikation aller Spieler. Das genaueGegenteil eines Ansatzes, individuelleKompetenz einem begleitenden Kollektivgegenüberzustellen. Diese isolierte Positioneines Einzelnen im Verhältnis zu einerGruppe sucht die Faktur zu verhindern;dem entspricht <strong>Hindemith</strong>sWunsch nach einer schlankeren, nichtder Tradition des 19. Jahrhunderts verhaftetenSpieltechnik, die er mit der Kompositionexplizit neuer Geigenetüden fördernwollte.Das veränderte Idiom, das <strong>Hindemith</strong>mit diesem Kammerkonzert zu kultivierenversuchte, fand seinen unmittelbarsinnfälligen Ausdruck im zentralen Teildes Werks, einem „Nachtstück“, das zwarder Violine einen Primat in der Präsenta-<strong>Hindemith</strong>-Forum 19/20093