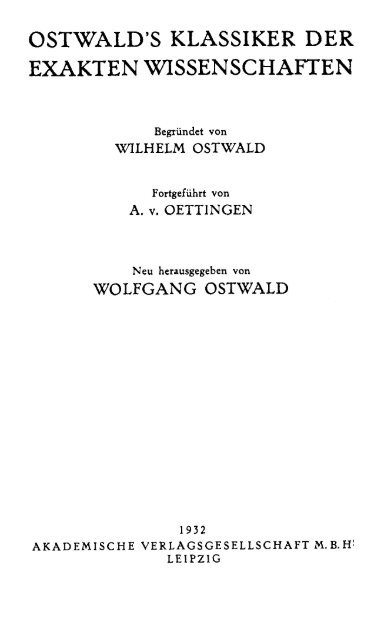wahrscheinlichkeit
wahrscheinlichkeit
wahrscheinlichkeit
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
OSTWALD'S KLASSIKER DEREXAKTEN WISSENSCHAFTENBegründet vonWILHELM OSTWALDFortgeführt vonA. V. OETTlNGENNeu herausgegeben vonWOLFGANG OSTWALD1932AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT M.B.H!LEIPZIG
P. S. DE LAPLACE(1814):PHILOSOPHISCHER VERSUCHVBER DIEWAHRSCHEINLICHKEITHerausgegebenvonR. V. MISES1932AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT M.B. H.LEIPZIG
Printed in Germany)nick von R.Wagner Sohn in Weim
Inhaltsverzeichnis I).Vorwort .......................Ober die Wahrscheinlichkeit (VI-XI) .........Allgemeine Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung (XIbis XVIII) . ...................Uber die Hoffnung (XVIII-XXI) ...........Von den analytischen Methoden der Wahrscheinlichkeiterechnung(XXI-XLIII) ..............ANWENDUKGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITS-RECHNUNG (XLIII) . . . . . . . . . . . . . . .Von den Spielen (XLIII-XLIV). ..........Von den unbekannten Ungleichheiten, die unter den fürgleich gehaltenen Chancen bestehen können (XLIV bisXLVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Von den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, die sich aus derunbeschränkten Vervielfachung der Ereignisse ergeben(XLVII-LV) ..................Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Naturphilosophie(LVI-LXXVII) ..........Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die moralischenWissenschaften (LXXVIII) . ........Von der Wahrscheinlichkeit der Zeugenaussagen (LXXIXbis XC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .uber die Wahlen und Beschlüsse der Versammlungen (XCbis XCIV) . ...................Von der Wahrscheinlichkeit der gerichtlichen Urteile(XCIV-XCIX) . . . . . . . . . . . . . . . . .Uber die Sterblichkeits-Tabellen und über die mittlereLebensdauer, über die Ehen und sonstigen gesellschaftlichenVerbindungen (XCIX-CVI) . . . . . . . .Von den Vorteilen der Anstalten, welche von der Wahr-scheinlichkeit der Ereignisse abhängen (CVI-CXI) .Von den Täuschungen bei der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit(CXII-CXXXVIII) .............Von den verschiedenen Ursachen der Täuschung.Eine große Zahl dieser Ursachen knüpft an die Gesetzeder Psychologie an, oder, was auf dasselbe hinauskommt,an die Physiologie, soweit diese über die Grenzender sichtbaren Physiologie hinaus erstreckt wird.Psychologische Gesetze.Das Prinzip der Sympathie.') Die in Klammer beigefügten Zahlen beziehen sich auf dieSeitenzahlen der „Introduction6' zur 111.Auflage der „ThBorie ..."(Oeuvres Completes, Tome VII).
V1Inhaltsverzeiohnis.SeiteDie Prinzipien der Ideenassoziatiori.Von den Modifikationen des Sensoriums und der innerenEindrücke, die ein Objekt hervorruft, durch die häufigeWiederholung des Eindrucks desselben Objektesauf verschiedene Sinne.Gegenseitiger Einfluß der gleichzeitig durch denselbenSinn, oder durch verschiedene Sinne, oder duroh daaGedächtnis wachgerufenen Eindrücke.Der Hang, welcher uns dahin bringt, den Objekten imsererEindrüoke Wirklichkeit zu verleihen, knüpft sichan einen besonderen Charakter, der diese Eindrückevon den Produkten der Einbildungskraft und den imGedächtnis zurückgelassenen Spuren unterscheidet.Dieser Hang bringt die Täuschung in den Träumenund Visionen hervor.Ober Nachtwandler und Geisterseher.Der Hang, der uns veranlaßt, an die vergangeneExistenzder durch das Gedächtnis zurückgerufenen Gegenständezu glauben, knüpft sich an einen besonderenCharakter, welcher diese Gedächtnisspuren von denProdukten der Einbildungskraft unterscheidet.Wirkungen des Gedächtnisses.Durch häufige Wiederholung werden die Operationen undBewegungen des Sensoriums leicht und gewissermaßennatürlich.Wirkungen dieser Leichtigkeit auf die Sitten und Gewohnheitender Volker.Von derubertragung der Gewohnheiten durchVererbung.Einfluß der Aufmerksamkeit auf die Tiitigkeit desmenschlichen Verstandes.Erklärung der Wirkung der Panoramen.Die Wiederholung von Handlungen, welche denen ähnlichsind, die eine besondere Disposition des Sensoriumshervorbrächte, kann diese Disposition entstehen lassen.Einfluß dieses Prinzipes auf den Glauben.Wie man die Täuschungen, die sich daraus ergebon, beseitigen kann.Die Schwingungen des Sensoriums und die Bewegungen,die aie hervorbringen, sind den Gesetzen der Dynamikunterworfen.Von d ~ nverschiedenen Mitteln, sich der Gewißheit zunähern (CXXXVIII-CXLV). ........... 155Historische Bemerkung über die Wahrscheinlichkeitsrechnung(CXLV-CLIII) ............... 162Anmerkungen. .................... 172
Dieser philosophische Versuch ist die weitere Ausführungeiner Vorlesung über Wahrscheinlichkeit, die ich im Jahre1795 an den Ecoles normales gehalten habe, an die ich mitLagrange durch ein Dekret des Nationalkonvents berufenwurde. Kürzlich veröffentlichte ich ein größeres Werk iiberdenselben Gegenstand unter dem Titel: ,,Analytische Theorieder Wahrscheinlichkeiten". Hier lege ich ohne Benutzungder Analysis die Prinzipien und die allgemeinen Ergebnissedieser Theorie dar mit Anwendungen auf die wichtigstenFragen des Lebens, bei welchen es sich in der Tat größtenteilsnur um Wahrscheinlichkeiten handelt. Ja, streng genommen,kann man sogar sagen, daß fast alle unsere Erkenntnissenur wahrscheinliche sind; und unter den wenigenDingen, die wir mit Sicherheit zu erkennen vermögen, jaselbst in den mathematischen Wissenschaften gründen sichdie vorzüglichsten Mittel zur Auffindung der Wahrheit,Induktion und Analogie, auf Wahrscheinlichkeiten, und soist das ganze System der menschlichen Kenntnisse mit derin diesem Versuch dargelegten Theorie verknüpft. Man wirdohne Zweifel mit Interesse bemerken, daß, selbst wenn manan den ewigen Prinzipien der Vernunft, Gerechtigkeit undHumanität nur die glücklichen Chancen schätzt, die sichbeständig daran knüpfen, es doch von großem Vorteile ist,diesen Prinzipien zu folgen, und von großem Nachteile, sichvon ihnen loszusagen, da die besseren Chancen, wie bei denLotterien, unter den Schwankungen des Zufalls schließlichimmer das ubergewicht gewinnen. Ich wünsche, daß die indiesem Versuche niedergelegten Betrachtungen von den Philosophender Beachtung wert befunden werden und ihreAufmerksamkeit auf einen Gegenstand lenken mögen, derihrer Bemühung so würdig ist.
Uber die Wahrscheinlichkeit.Alle Ereignisse, selbst jene, welche wegen ihrer Geringfügigkeitscheinbar nichts mit den großen Katurgesetzen zutun haben, folgen aus diesen mit derselben Notwendigkeit wiedie Umläufe der Sonne. In Unkenntnis ihres Zusammenhangsmit dem Weltganzen ließ man sie, je nachdem siemit Regelmäßigkeit oder ohne sichtbare Ordnung eintratenund aufeinanderfolgten, entweder von Endzwecken odervom Zufall abhängen; aber diese vermeintlichen Grsachenwurden in dem Maße zurückgedrängt, wie die Schrankenunserer Kenntnis sich erweiterten, und sie verschwinden völligvor der gesunden Philosophie, welche in ihnen nichts alsden Ausdruck unserer Unkenntnis der wahren Ursachensieht.Die gegenwärtigen Ereignisse sind mit den vorangehendendurch das evidente Prinzip verknüpft, daß kein Dingohne erzeugende Ursache entstehen kann. Dieses Axiom,bekannt unter dem Kamen des ,,Prinzips vom zureichendenGrunde", erstreckt sich auch auf die Handlungen, die manfür gleichgültig hält. Der freieste Rille kann sie nicht ohneein bestimmendes Motiv hervorbringen; denn wenn er untervollkommen ähnlichen Umständen das eine Mal handelteund das andere Mal sich der Handlung enthielte, dann wäreseine Wahl eine Wirkung ohne Ursache: sie wäre dann, wieLeibniz sagt, der blinde Zufall der Epikuräer. Die gegenteiligeMeinung ist eine Täuschung des Geistes, der dieflüchtigen Gründe, welche die Wahl des Willens bei gleichgültigenDingen bestimmen, aus dem Auge verliert und sicheinredet, daß der Wille sich durch sich ~elbst und ohneMotive bestimmt hat.Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Weltallsals die Wirkung seines früheren und als die Ursachedes folgenden Zustands betrachten. Eine Intelligenz, welche
für einen gegebenen Augenblick alle in der Natur wirkendenKräfte sowie die gegenseitige Lage der sie zusammensetzendenElemente kennte, und überdies umfassend genug wäre,um diese gegebenen Größen der Analysis zu unterwerfen,würde in derselben Formel die Bewegungen der größtenWeltkörper wie des leichtesten Atoms umschließen; nichtswürde ihr ungewiß sein und Zukunft wie Vergangenheitwürden ihr offen vor Augen liegen. Der menschliche Geistbietet in der Vollendung, die er der Astronomie zu gebenverstand, ein schwaches Abbild dieser Intelligenz dar.Seine Entdeckungen auf dem Gebiete der Mechanik undGeometrie, verbunden mit der Entdeckung der allgemeinenGravitation, haben ihn in Stand gesetzt, in demselben analytischenAusdruck die vergangenen und zukünftigen Zuständedes Weltsystems zu umfassen. Durch Anwendung derselbenMethode auf einige andere Gegenstände seines Wissens ister dahin gelangt, die beobachteten Erscheinungen auf allgemeineGesetze zurückzuführen und Erscheinungen vorauszusehen,die gegebene Umstände herbeiführen müssen. Allediese Bemühungen beim Aufsuchen der Wahrheit wirkendahin, ihn unablässig jener Intelligenz näher zu bringen,von der wir uns eben einen Begriff gemacht haben, der eraber immer unendlich ferne bleiben wird. Dieses dem Menscheneigentümliche Streben erhebt ihn über das Tier,und seine Fortschritte auf diesem Gebiete unterscheiden dieNationen und Jahrhunderte und machen ihren wahrenRuhm aus.Erinnern wir uns, daß einst, und zwar in einem Zeitalter,das noch nicht sehr ferne liegt, ein Wolkenbruch oderübermäßige Dürre, ein Komet mit einem sehr langen Schweif,die Sonnenfinsternisse, die Nordlichter und überhaupt alleaußergewöhnlichen Erscheinungen für ebenso viele Zeichendes himmlischen Zornes gehalten wurden. Man rief denHimmel an, daß er ihren unseligen Einfluß abwende. Aberman flehte ihn nicht an, den Lauf der Gestirne oder derSonne aufzuhalten: die Beobachtung hätte gar bald dieNutzlosigkeit solcher Bitten erkennen lassen. Da aber jeneErscheinungen, da sie in langen Intervallen auftraten undverschwanden, der Ordnung der Natur zu widersprechenschienen, so nahm man an, daß sie der Himmel, erzürntüber die Verbrechen der Erde, gesandt hätte, um seine Rache
Ober die Wahrscheinlichkeit.3anzukündigen. So verbreitete der lange Schveif des Kometenvom Jahre 1456 Schrecken in Europa, das bereite,über die raschen Erfolge der Türken und die Zerstörung desbyzantinischen Reichs bestürzt war. Dieses Gestirn hat nachseinem vierten Umlauf ein Interesse ganz verschiedener Artbei uns erweckt. Die Kenntnis der Gesetze des Weltsystems,die innerhalb dieses Zeitraumes erworben worden war, hattedie Besorgnisse zerstreut, die aus der Unkenntnis der wahrenBeziehungen des Menschen zum Weltall entstanden waren ;undHalley, der die Identität dieses Kometen mit jenen der Jahre1531, 1607 und 1682 erkannt hatte, kündigte seine baldigeWiederkehr für das Ende von 1758 oder den Anfang von1759 an. Die gelehrte Welt erwartete mit Ungeduld dieseWiederkehr, die eine der größten Entdeckungen der Wissenschaftbestätigen und die Vorhersagung des Seneca erfüllensollte, welcher, bei Erwähnung des Umlaufs der aus ungeheuererEntfernung zu uns herabkommenden Gestirne, sagte:„Der Tag wird kommen, da durch ein unausgesetztes Studiummehrerer Jahrhunderte die derzeit verborgenen Dingeklar vor Augen liegen werden; und die Nachwelt wird staunen,daß so einleuchtende Wahrheiten uns entgehen konnten."Clairaut unternahm es hierauf, die Störungen, die der Kometdurch die Wirkung der beiden größten Planeten, des Jupiterund Saturn, erfahren hatte, der Analysis zu unterwerfen:Nach unermeßlichen Rechnungen bestimmte er seinennächsten Durchgang im Perihel für Anfang April 1759, wasdie Beobachtung in Kürze bewahrheitete. Die Regelmäßigkeit,welche uns die Astronomie in der Bewegung der Kometenzeigt, ist ohne Zweifel bei allen Erscheinungen vorhanden.Die von einem einfachen Luft- oder Gasmolekülbeschriebene Kurve ist in eben so sicherer Weise geregeltwie die Planetenbahnen: es besteht zwischen beiden nur derUnterschied, der durch unsere Unwissenheit bewirkt wird.Die Wahrscheinlichkeit steht in Beziehung zum Teil zudieser Unwissenheit, zum Teil zu unseren Kenntnissen. Wirwissen, daß von drei oder mehreren Ereignissen eines eintretenmuß, doch veranlaßt uns nichts, zu glauben, da5eines eher als die anderen eintreten wird. In diesem Zustandeder Unentschiedenheit ist es una unmöglich, etwasGewisses über das Eintreffen auszusagen. Es ist indessenwahrscheinlich, daß ein aus diesen aufs Geratewohl heraus-
4 P. S. de Laplace:gegriffenes Ereignis nicht eintreffen wird, wenn wir mehreregleichmögliche Fälle erkennen, welche sein Eintreten ausschließen,während nur ein einziger dieser Fälle es begünstigt.Die Theorie des Zufalls ermittelt die gesuchte Wahrscheinlichkeiteines Ereignisses durch Zurückführung allerEreignisse derselben Art auf eine gewisse Anzahl gleichmöglicher Fälle, d. s. solcher, über deren Existenz wir ingleicher 'iiTeise unschlüssig sind, und durch Bestimmungder dem Ereignis günstigen Fälle. Das Verhältnis dieserZahl zu der aller möglichen Fälle ist das Maß dieser Wahrscheinlichkeit,die also nichts anderes als ein Bruch ist,dessen Zähler die Zahl der günstigen Fälle und dessen Nennerdie Zahl aller möglichen Fälle ist.Die vorstehende Definition der Wahrscheinlichkeit setztvoraus, dass die Wahrscheinlichkeit dieselbe bleibt, wennman die Zahl der günstigen Fälle und die aller möglichenFälle in gleichem Verhältnis wachsen lässt. Um sich davonzu überzeugen, betrachte man zwei Urnen A und B, vondenen die erste vier weiße und zwei schwarze Kugeln, diezweite nur zwei weiße und eine schwarze Kugel enthält.Man kann sich vorstellen, daß die zwei schwarzen Kugelnder ersten Urne durch einen Faden verbunden sind, der indem Momente zerreißt, wo man die eine von ihnen ergreift,um sie herauszuziehen, und daß die vier weißen Kugelnzwei ähnliche Systeme bilden. Alle Chancen für das Ergreifeneiner dem schwarzen System angehörenden Kugel werdeneine schwarze Kugel liefern. Wenn man jetzt annimmt,daß die Fäden, welche die Kugeln verbinden, nicht reißen,so ist klar, dass die Zahl aller möglichen Fälle und auch dieZahl der dem Herausziehen schwarzer Kugeln günstigenFälle sich nicht ändern wird; nur wird man aus der Urnezwei Kugeln auf einmal herausziehen; die Wahrscheinlichkeit,eine schwarze Kugel aus der Urne herauszu2,iehen, wirdalso dieselbe sein wie früher. Aber nun hat man augenscheinlichden Fall der Crne B, mit dem einzigen Unterschiede,daß die drei Kugeln dieser Urne ersetzt sind durch dreiSysteme von je zwei Kugeln, die unlösbar miteinander verbundensind.Wenn alle Fälle einem Ereignis günstig sind, dann verwandeltsich seine Wahrscheinlichkeit in Gewißheit und der
Dber die Wahrscheinlichkeit.5Quotient wird gleich Eins. Unter diesem Gesichtspunktesind Gewißheit und Wahrscheinlichkeit vergleichbar, obgleichein wesentlicher Unterschied zwischen den beidenGeistesverfassungen besteht, wenn ein Satz in aller Strengebewiesen ist, oder wenn noch eine kleine Möglichkeit des Irrtumsübrig bleibt.Bei den Dingen, welche nur wahrscheinlich sind, ist dieVerschiedenheit der Daten, die verschiedene Menschenüber sie besitzen, eine der Hauptursachen der Mannigfaltigkeitder Meinungen, die man über dieselben Gegenständeherrschen sieht. Xehmen wir z. B. an, wir hätten drei Urnen,A, B, C, von denen eine nur schwarze Kugeln enthält, währenddie zwei anderen nur weiße Kugeln einschließen; mansoll eine Kugel aus der Urne C ziehen und man fragt nach derWahrscheinlichkeit, daß diese Kugel schwarz ist. Wennman nicht weiß, welche von den drei Urnen nur schwarzeKugeln einschließt, so zwar, daß man keinen Grund hat, zuglauben, daß es eher C als B oder A sei, so scheinen diesedrei Annahmen gleich möglich; und da eine schwarze Kugelnur im Fall der ersten Annahme gezogen werden kann, soist die Wahrscheinlichkeit, sie zu ziehen, gleich +. Weißman, daß die Urne A nur weiße Kugeln enthält, dann beschränktsich die Ungewißheit nur mehr auf die Urnen Bund C, und die Wahrscheinlichkeit, daß die aus der Urne Cgezogene Kugel schwarz sein wird, ist 2. Endlich verwandeltsich diese Wahrscheinlichkeit in Gewißheit, wenn mansicher ist, daß die Urnen A und B nur weiße Kugeln enthalten.So kommt es, daß dieselbe Tatsache, die vor einerzahlreichen Versammlung erzählt wird, mit verschiedenenGraden von Glauben aufgenommen wird je nach dem Umfangeder Kenntnisse der Zuhörer. Wenn der Mann, derdavon berichtet, selbst im Innersten davon überzeugt ist,und wenn er wegen seines Standes und Charakters großesVertrauen einflößt, so wird sein Bericht, wie außerordentlicher auch sein mag, für die Zuhörer, die hierüber keineigenes Urteil haben, denselben Grad der Wahrscheinlichkeithaben, wie eine gewöhnliche Tatsache, die von demselbenManne mitgeteilt wird, und sie werden dem Berichte voll-ständigen Glauben beimessen. Wenn jedoch irgendeinervon ihnen weiß, daß dieselbe Tatsache von anderen, gleich
achtbaren Männern verworfen wurde, so wird er im Zweifelsein; und die Tatsache wird von den aufgeklärten Zuhoremals falsch betrachtet werden, die sie entweder mit wohlerwiesenenTatsachen oder mit unveränderlichen Naturgesetzenim Widerspruche finden werden.Dem Einflusse derer, die die Menge für die bestunterrichtetenhält, und denen sie ihr Vertrauen in den wichtigstenFragen des Lebens zu schenken pflegt, hat man die Verbreitungjener Irrtümer zu verdanken, die in den Zeiten derUnwissenheit das Gesicht der Welt erfüllten. Die Magieund Astrologie bieten uns hiervon zwei große Beispiele dar.Diese von Kindheit an eingeprägten Irrtümer, die ohnePrüfung angenommen wurden und nur den allgemeinenGlauben als Grundlage hatten, erhielten sich durch sehrlange Zeit, bis endlich der Fortschritt der Wissenschaften sieim Geiste der aufgeklärten Menschen zerstort hatte. DieAutorität dieser Männer hat sie sodann auch beim Volkezum Verschwinden gebracht durch die Macht der Nachahmungund der Gewohnheit, die sie so allgemein verbreitethatte. Diese Macht, die gewaltigste Triebfeder der sittlichenWelt, begründet und erhält in einer ganzen Nation Ideen,die durchaus entgegengesetzt jenen sind, welche sie enderswomit derselben Gewalt aufrecht erhält. Welche Nachsichtmüssen wir also nicht mit den von den unsrigen abweichendenMeinungen haben, da diese Verschiedenheit oft nur von verschiedenenGesichtspunkten abhängt, auf welche die Umständeuns geführt haben. Klären wir diejenigen auf, diewir für nicht genügend unterrichtet halten, aber prüfen wirvorerst strenge unsere eigenen Meinungen und wägen wirmit rjnparteilichkeit die Wahrscheinlichkeit der einen undanderen ab.Die Verschiedenheit der Meinungen hängt auch nochvon der Art und Weise ab, wie man den Einfluß des Gegebenenin Rechnung setzt. Die Theorie der Wahrscheinlichkeithat es mit so feinen uberlegungen zu tun, daß es, besondersin sehr komplizierten Fragen, nicht verwunderlichi~t,wenn zwei Personen, von denselben Gegebenhl iten ausgehend,verschiedene Resultate finden. Wir wollen jetztdie allgemeinen Piinzipien der Theorie darlegen.
Allgemeine Prinzipien der Wahrecheinlichkeitarechn~~. 7Allgemeine Prinzipien der Wahr.scheinlichkeitsrechnung.I. Prinzip.Das erste dieser Prinzipien ist die Definition selbst,nach der, wie wir gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit dasVerhältnis der Zahl der gtmstigen Fälle zu der aller möglichenFälle ist.11. Prinzip.Aber hierbei werden die verschiedenen Fälle als gleichmoglich vorauegesetzt. Wenn sie es nicht sind, so wird manvorerst ihre relativen Möglichkeiten bestimmen, derenrichtige Abschätzung einer der heikelsten Punkte der Theoriedes Zufalls ist. Dann wird die Wshrscheinlichkeit die Summeder Möglichkeiten jedes günstigen Falles sein. Erläuternwir dieses Prinzip durch ein Beispiel.Nehmen wir an, man werfe ein großes und sehr dünnesGeldstück in die Luft, dessen beide Seiten, ,,Kopfu und,,Wappenu genannt, vollkommen gleich sein sollen. Suchenwir die Wahrscheinlichkeit, unter zwei Würfen wenigstenseinmal Kopf zu werfen.Es ist klar, da% vier gleich mög-liche Fälle eintreten können, nämlich: Kopf beim erstenund zweiten Wurfe, Kopf beim ersten und Wappen beimzweiten Wurfe, Wappen beim ersten und Kopf beim zweitenWurfe, endlich Wappen in beiden Würfen. Die drei erstenFiille sind dem Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit gesuchtwird, günstig, diese ist daher gleich $, so zwar, da% dreigegen eins zu wetten ist, daß wenigstens einmal unter zweiWürfen Kopf geworfen wird.Man kann bei diesem Spiele auch nur drei verschiedeneFälle zählen, nämlich: Kopf beim ersten Wurf, so daß mannicht nötig hat, ein zweites Mal zu spielen; Wappen beimersten Wurf und Kopf beim zweiten; endlich Wappen beimersten und zweiten Wurf. Das würde die Wahrscheinlichkeitauf 3 herab~etzen, wenn man mit D'Alembert diese dreiFälle als gleich moglich betrachtete. Aber es ist offenbar,daß die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Wurfe Kopf zuwerfen, 3, die der beiden anderen Fälle aber je + ist, dader erste Fall ein einfaches Ereignis ist, welches den beideia
zusammengesetzten: Kopf beim ersten und zweiten Wurfe,und Kopf beim ersten Wurfe, Wappen beim zweiten, entspricht.Wenn man jetzt dem zweiten Prinzipe gemnßdie Möglichkeit, Kopf beim ersten Wurfe zu werfen (=
Allgemeine Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung.9lichkeit der Tatsache, so wie sie sich aus den Zeugenaussagenergibt, wird kleiner als & sein. Man kann diese Verminderungder Wahrscheinlichkeit am besten mit der Abnahmeder Deutlichkeit der Gegenstände durch Dazwischenstellenvon mehreren Glasscheiben vergleichen; eine geringe Anzahlvon Scheiben genügt, um uns den Anblick eines Gegenstandeszu verhüllen, der durch eine einzige Scheibe deutlich wahrgenommenwird. Die Historiker scheinen dieser Verminderungder Wahrscheinlichkeit von Tatsachen, wenn sie durcheine große Zahl von aufeinander folgenden Generationenhindurch gesehen werden, nicht die genügende Aufmerksamkeitzugewendet zu haben: manche historische Ereignisse,die für sicher gehalten werden, würden zumindest zweifelhafterscheinen, wenn man sie dieser Prüfung unterzöge.In den rein mathematischen Wissenschaften haben dieentferntesten Folgerungen teil an der Gewißheit des Prinzips,woraus sie abgeleitet sind. In den Anwendungen derAnalysis auf die Physik haben die Folgerungen die ganzeSicherheit der Tatsachen oder Experimente. Aber in denGeisteswissenschaften, wo jeder Schluß aus dem Vorhergehendennur mit Wahrscheinlichkeit deduziert wird, wachstdie Chance des Irrtums, wie wahrscheinlich auch dieseDeduktionen sein mögen, mit ihrer Anzahl und übertrifft beiFolgerungen, die vom Prinzip sehr weit entfernt sind, dieChance der Wahrheit.IV. Prinzip.Wenn zwei Ereignisse voneinander abhängen, so ist dieWahrscheinlichkeit des zusammengesetzten Ereignisses dasProdukt aus der Wahrscheinlichkeit des ersten Ereignissesund der Wahrscheinlichkeit, welche das zweite Ereignisnach Eintritt des ersten besitzt. So ist in dem früheren Falleder drei Urnen A, B, C, wovon zwei nur weiße Kugeln enthalten,während die dritte nur schwarze Kugeln einschließt,die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel aus der Urne Czu ziehen, 8, da von drei Urnen zwei nur Kugeln dieserFarbe enthalten. Aber sobald man eine weiße Kugel aus derUrne C gezogen hat, so betrifft die Unentschiedenheit hinsichtlichder Urnen, die bloß schwarze Kugeln enthalten,nur mehr die Urnen A und B; die Wahrscheinlichkeit, eine
weiße Kugel aus der Urne B zu ziehen, wird 4; das Produkt$ mit &, d. i. $, ist also die Wahrscheinlichkeit, jeeine weiße Kugel aus den Urnen B und C zu ziehen. In derTat ist dazu notwendig, daß die Urne A diejenige von dendrei Urnen sei, welche schwarze Kugeln enthält, und dieWahrscheinlichkeit dieses Falles ist augenscheinlich 9.Man erkennt an diesem Beispiel den Einfluß der vergangenenEreignisse auf die Wahrscheinlichkeit der künftigen.Denn die ursprünglich 4 betragende Wahrscheinlichikeit, eine weiße Kugel aus der Urne B zu ziehen, wird 5, 2sobald man eine weiße Kugel aus der Urne C gezogen hat;sie würde sich in Gewißheit verwandeln, wenn man eineschwarze Kugel aus derselben Urne gezogen hätte. Manwird diesen Einfluß mit Hilfe des folgenden Prinzipes bestimmen,das ein Korrolar des vorhergehenden ist.V. Prinzip.Renn man die Wahrscheinlichkeit des eingetretenen Ereignissesund die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisse~, dasaus diesem und einem noch erwarteten Ereignis zusammengesetztist, a priori berechnet, so wird der Quotient ausder zweiten Wahrscheinlichkeit durch die erste gleich derWahrscheinlichkeit des erwarteten Ereignisses, erschlossenaus dem beobachteten Ereignis, sein.Hier begegnen wir der von einigen Philosophen aufgeworfenenFrage über den Einfluß des Vergangenen auf dieWahrscheinlichkeit des Zukünftigen. Nehmen wir an, daßim Kopf- und Wappen-Spiele Kopf öfter fiele als Wappen:dadurch allein werden wir veranlaßt zu glauben, daß in derZusammensetzung der Münze eine konstante Ursache existiere,welche das begünstigt. So ist auch im gewöhnlichenLeben beständiges Glück ein Beweis von Geschicklichkeit,weswegen man glückliche Personen mit Vorliebe verwendet.Wenn wir aber durch die Unbeständigkeit der Umständeohne Unterlaß in einen Zustand absoluter Ungewißheit versetztwerden, wenn wir z. B. im Kopf- und Wappen-Spielbei jedem Wurfe die Münze wechseln, dann kann die Vergangenheitkein Licht über die Zukunft verbreiten und eswürde sinnlos sein, sie in Rechnung zu ziehen.
Allgemeine Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 11VI. Prinzip.Jede der Ursachen, denen ein beobachtetes Ereignis zugeschriebenwerden kann, wird um so zuverlässiger als wirksamangegeben, je größer die Wahrscheinlichkeit ist, daßunter Voraussetzung des Vorhandenseins dieser Ursache dasEreignis stattfinden wird; die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseinsirgendeiner dieser Ursachen ist also ein Bruch,dessen Zähler die aus dieser Ursache folgende Wahrscheinlichkeitdes Ereignisses, und dessen Nenner die Summe deranalogen Wahrscheinlichkeiten bezüglich aller Ursachen ist:wenn diese verschiedenen Ursachen, a priori betrachtet,ungleich wahrscheinlich sind, so muß man an Stelle der ausjeder Ursache folgenden Wahrscheinlichkeit des Ereignissesdas Produkt dieser Wahrscheinlichkeit mit der Möglichkeitder Ursache selbst verwenden. Das ist das Fundamentalprinzipin diesem Zweige der Analyse des Zufalls, der davonhandelt, wie man von den Ereignissen auf die Ursachenzurückschließt.Dieses Prinzip gibt den Grund an, warum man die regelmäßigenEreignisse einer besonderen Ursache zuschreibt.Einige Philosophen haben gemeint, daß diese Ereignisseweniger möglich seien als die anderen, und daß z. B. beimKopf- und Wappen-Spiele die Kombination, wobei Kopf20 mal nacheinander erscheint, der Natur mehr Mühe macheals jene, wo Kopf und Wappen in unregelmäßiger Weisevermengt sind. Aber diese Meinung hat zur Voraussetzung,daß die vergangenen Ereignisse auf die Möglichkeit der zukunftigenEreignisse Einfluß haben, was keineswegs zulässigist. Die regelmäßigen Kombinationen treten nur deshalbseltener auf, weil sie weniger zahlreich sind. Wennwir dort, wo wir Symmetrie bemerken, nach einer Ursacheforschen, geschieht das nicht deshalb, weil wir ein symmetrischesEreignis für weniger möglich als die anderen halten;aber vor die Wahl gestellt, ob wir dieses Ereignis als Wirkungeiner regelmäßigen Ursache oder des Zufalls ansehen sollen,erscheint uns die erste dieser Ansichten wahrscheinlicherals die zweite. Wir erblicken auf einem Tische Lettern indieser Ordnung zusammengestellt: Xonst antinopel , undwir betrachten diese Anordnung nicht als die Wirkung desZufalls, nicht, weil sie weniger möglich ist als die anderen,2*
12 P. S. de Laplace:da wir diesem Wort, falls es in keiner Sprache verwendetwürde, keine besondere Ursache zumuten würden; da aberdieses Wort bei uns in Gebrauch ist, so ist es unvergleichlichwahrscheinlicher, daß irgendeine Person jene Lettern so angeordnethat, als daß diese Anordnung nur dem Zufall zuverdanken ist.Es ist hier am Platze, das Wort außergewöhnlich zudefinieren. Wir reihen in Gedanken alle möglichen Ereignissein verschiedene Klassen ein; und wir betrachten jene Klassenals außergewöhnlich, die eine sehr kleine Zahl von Ereignissenenthalten. So erscheint uns im Kopf- und Wappen-Spiele eine hundertmalige Aufeinanderfolge von Kopf alsaußergewöhnlich, weil die Zahl der Kombinationen, die beihundert Wurfen auftreten können, fast unendlich ist und weildie darin enthaltenen unregelmäßigen Anordnungen unvergleichlichzahlreicher sind als die darin enthaltenen regelmäßigenAnordnungen oder jene, in denen wir eine leichtzu erfassende Ordnung herrschen sehen. Die Entnahmeeiner weißen Kugel aus einer Urne, die auf eine MillionKugeln nur eine einzige dieser Farbe enthält, während dieanderen schwarz sind, erscheint uns ebenfalls außerordentlich,weil wir nur zwei Klassen von Ereignissen, entsprechendden beiden Farben, unterscheiden. Aber die Entnahme derNummer 475813 aus einer Urne, die eine RIillion Nummernenthält, erscheint uns als ein gewöhnliches Ereignis, weil wir dieNummern einzeln miteinander vergleichen, ohne sie in Klassenzu teilen, und daher keinen Grund haben zu glauben, dsßdie eine von ihnen eher als die anderen herauskommen wird.Aus dem Vorangehenden müssen wir den allgemeinenSchluß ziehen, daß eine Tatsache, je außerordentlicher sieist, um so mehr einer Begründung durch starke Beweisebedarf. Denn da diejenigen, welche sie bezeugen, täuschenoder selbst getäuscht worden sein können, so werden diesebeiden Ursachen in dem Maße wahrscheinlicher sein, jegeringer die Wahrscheinlichkeit der Tatsache an sich ist.Im besonderen werden wir das noch sehen. wenn wir von derWahrsoheinlichkeit der Zeugenaussagen sprechen werden.VII. Prinzip.Die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ereignisse8ist die Summe der Produkte der Wahrscheinlichkeit jeder aus
Allgemeine Prinzipien der Wahrscheinlic&eitsrechnung. 13dem beobachteten Ereignisse erschlossenen Ursache mit derauf Grund dieser Ursache berechneten Wahrscheinlichkeitdes zukünftigen Ereignisses. Das folgende Beispiel wirddieses Prinzip erläutern.Denken wir uns eine Urne, die nur zwei Kugeln enthält,deren jede entweder weiß oder schwarz ist. Man zieht einedieser Kugeln, legt sie hierauf wieder in die Urne zurück,um einen neuen Zug zu machen. Nehmen wir an, daß manbei den zwei ersten Zügen weiße Kugeln herausgenommenhat; man fragt nach der Wahrscheinlichkeit, beim drittenZuge wieder eine weiße Kugel zu ziehen.Man kann hier nur diese beiden Hypothesen machen:entweder ist eine der Kugeln weiß und die andere schwarz,oder es sind beide weiß. Nach der ersten Hypothese ist die1Wahrscheinlichkeit des beobachteten Ereignisses -; sie ist4Eins oder Gewißheit zufolge der zweiten. Wenn man alsodiese Hypothesen als ebenso viele Ursachen betrachtet, so1 4wird man nach dem sechsten Prinzipe und - für ihre3 5bezüglichen Wahrscheinlichkeiten erhalten. Nun ist aberim Fall der ersten Hypothese die Wahrscheinlichkeit,, beimidritten Zuge eine weiße Kugel zu ziehen, gleich I; sie ist2gleich Eins im Fall der zweiten Hypothese; multipliziertman also diese letzteren TVahrscheinlichlieiten mit denWahrscheinlichkeiten der entsprechenden Hypothesen, sowird die Summe der Produkte, d. i. die Wahrscheinlich-10'keit sein, eine weiße Kugel beim dritten Zuge zu ziehen.Kenn die Sllahrscheinlichkeit. eines einfachen Ereignissesunbekannt ist, so kann man ihr in gleicher JJTeise alle Wertevon Null bis Eins beilegen. Die Wahrscheinlichkeit jederdieser, aus dem beobachteten Ereignis erschlossenen Hypothesenist nach dem sechsten Prinzipe ein Bruch, dessenZähler die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses auf Grund dieserHypothese und dessen Kenner die Summe der analogenWahrscheinlichlieiten bezuglich aller Hypothesen ist. Sonachist die Wahrscheinlichkeit, daß die Nöglichkeit desEreignissec innerhalb gegebener Grenzen enthalten ist, die
14 P. S. de Laplace:Summe der zwischen diesen Grenzen liegenden Brüche.Wenn man jetzt jeden Bruch mit der auf Grund der entsprechendenHypothese bestimmten Wahrscheinlichkeit deskünftigen Ereignisses multipliziert, so wird die Summe derauf alle Hypothesen bezogenen Produkte zufolge des siebentenPrinzipes die aus dem beobachteten Ereignisse abgeleiteteWahrscheinlichkeit des künftigen Ereignisses sein. IAuf dieseWeise ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, daß ein Ereignis,das eine beliebige Anzahl Male nacheinander eingetreten ist,noch das folgende Mal zutreffen wird, gleich dieser Zahl,vermehrt um die Einheit, und dividiert durch dieselbe Zahl,vermehrt um zwei Einheiten. Läßt man z. B. die ältesteEpoche der Geschichte auf 5000 Jahre oder auf 1826213Tage zurückreichen, und berücksichtigt man, daß die Sonnein diesem Zeitraum stets nach jeder Umdrehung von 24 Stundenaufgegangen ist, so ist 1826214 gegen eins zu wetten,daß sie auch morgen aufgehen wird. Aber diese Zahl istnoch unvergleichlich mächtiger für denjenigen, der aus demZusammenhang der Erscheinungen das regelnde Prinzip derTage und Jahreszeiten kennt und sieht, daß nichts im gegenwärtigenAugenblick ihrem Ablauf Einhalt tun kann.Buffon berechnet in seiner politischen Arithmetik dievoranstehende Wahrscheinlichkeit in verschiedener Weise.Er nimmt an, daß sie von der Einheit nur um einen Bruchabweicht, dessen Zähler gleich eins, und dessen Nennergleich zwei, erhoben zur Zahl der seit der Epoche verflossenenTage ist. Aber die richtige Art, wie man von den vergangenenEreignissen zur Wahrscheinlichkeit der Ursachenund der künftigen Ereignisse aufsteigt, war diesem berühmtenSchriftsteller unbekannt.~berdie Hoffnung.Die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse dient dazu, dieHoffnung oder Befürchtung der hieran interessierten Personenzu bestimmen. Das Wort ,,Hoffnung" hat verschiedene Bedeutungen:es drückt allgemein den Vorteil desjenigen aus,der irgendein Gut auf Grund von Voraussetzungen erwartet,die nur wahrscheinlich sind. Dieser Vorteil ist in der Theoriedes Zufalls das Produkt der erwarteten Summe mit der Wahr-
Ober die Hoffnung.15scheinlichkeit, sie zu erlangen: d. i. die Teilsumme, die einkommenmuß, wenn man betreffs des Ereignisses keine Gefahrlaufen will, und die zur Voraussetzung macht, daß die Verteilungproportional der Wahrscheinlichkeit erfolgt. DieseVerteilung ist die einzig gerechte, wenn man von allenfremden Umständen absieht, da ein gleicher Grad vonWahrscheinlichkeit ein gleiches Recht auf die erwarteteSumme gibt. Wir werden diesen Vorteil die „mathematischeHoffnung" nennen.VIII. Prinzip.Wenn der Vorteil von mehreren Ereignissen abhängt,so erhält man denselben, indem man die Summe der Produktebildet aus der Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses mit demGute, das an sein Eintreten geknüpft ist.Wenden wir dieses Prinzip auf Beispiele an. Angenommen,im Kopf- und Wappen-Spiele erhalte Paul zwei Francs,wenn er Kopf beim ersten Wurfe, und fünf Franos, wenn erKopf erst beim zweiten Wurfe wirft. Multipliziert man zweiFrancs mit der Wahrscheinlichkeit I/, des ersten Falles,und fünf Francs mit der Wahrscheinlichkeit % des zweitenFalles, so wird die Summe der Produkte, nämlich 2%Francs,Pauls Vorteil sein. Das ist die Summe, die er demjenigenim voraus geben soll, der ihm diesen Vorteil verschaffthat, denn die Billigkeit des Spieles erfordert, daß der Einsatzgleich dem Vorteile sei, den er verschafft.Wenn Paul zwei Franos erhält, falls er Kopf das ersteMal, und fünf Franos, wenn er Kopf das zweite Mal wirft,U. zw. auch in dem Falle, daß er das erste Mal Kopf geworfenhätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweitenWurfe Kopf zu werfen, 1/2, und man erhält durch Multiplikationvon zwei Francs und fünf Francs mit 1/2 und durchAddition dieser Produkte 3% Francs als Vorteil des Paulund somit auch als seinen Spieleinsatz.IX. Prinzip.Für eine Reihe von wahrscheinlichen Ereignissen, vonwelchen die einen ein Gut, die anderen einen Verlust hervorbringen,findet man den sich ergebenden Vorteil, indem mandie Summe der Produkte aus der Wahrscheinlichkeit jedesgünstigen Ereignisses mit dem Gute, das es hervorbringt,
16 P. S. de Laplace:bildet und davon die Summe der Produkte aus der Wahrscheinlichkeitjedes ungünstigen Ereignisses mit dem Verluste,der sich daran knüpft, subtrahiert. Wenn die zweiteSumme die erste überwiegt, so wird aus dem Vorteil einVerlust und es verwandelt sich die Hoffnung in Befürchtung.Man soll im gewöhnlichen Leben es immer so einrichten,daß das Produkt aus dem erwartet'en Gute und seiner Wahrscheinlichkeitdem analogen Produkt'e bezüglich des Verlustesmindestens gleichkommt. Aber um das zu erreichen,ist es notwendig, die Vorteile und Verluste und ihre bezüglichenWahrscheinlichkeiten genau abzuschätzen. Dazubedarf es großen Scharfsinns, eines feinen Taktes und einergroßen Sachkenntnis: man muß sich in acht nehmen vorden Vorurteilen, den Illusionen der Furcht und der Hoffnung,sowie vor jenen falschen Begriffen von Glück, mitdenen die meisten Menschen ihre Eigenliebe wiegen.Die Anwendung der vorangehenden Prinzipien auf diefolgende Frage hat die Mathematiker viel beschäftigt. Paulspielt Kopf und Wappen mit der Bedingung, daß er zweiFrancs erhält, wenn er Kopf beim ersten Mal wirft; daß ervier Francs erhält, wenn Kopf erst beim zweiten Wurfe fällt;acht Francs, wenn erst beim dritten Wurfe und so fort. SeinEinsatz muß dem 8. Prinzipe zufolge gleich der Anzahl derWürfe sein, so zwar, daß bei einem ins Cnendliche fortgesetztenSpiel der Einsatz unendlich groß sein müßt,e.Gleichwohl würde kein vernünftiger Mensch auf dieses Spielauch nur eine mäßige Summe, z. B. 50 Francs, wagen. Woherliommt diese Verschiedenheit zwischen dem, was dieRechnung ergibt', und dem, was uns der gesunde Menschenverstandsagt? Man erlrannt'e gar bald, daß dieser Unterschieddaher rührt, daß der moralische Vorteil, den uns einGut verschafft, nicht diesem Gute proport'ional ist, sonderndaß er von tausend, oft sehr schwer zu definierenden Umständenabhängt, von denen der allgemeinste und wichtigstedas Vermögen ist. Denn es ist klar, daß ein Frank vielmehr Wert für den hat, der nur hundert besitzt, als für einenMillionär. Man muß also bei dem erhofften Gute seinenabsoluten von seinem relativen Werte unterscheiden: dieserbestimmt sich nach den Beweggründen, die den Wunschnach jenem Gut in uns hervorbringen, während der ersteredavon unabhängig ist. Es M t sich kein allgemeiner Grund-
Dber die Hoffnung.17Satz aufstellen, um diesen relativen f ert abzuschätzen.Indes existiert hierüber der folgende Vorschlag von DanielBernoulli, der in vielen Fällen von Nutzen sein kann.X. Prinzip.Der relative Wert einer unendlich kleinen Summe istgleich ihrem absoluten Werte dividiert durch das Gesamtvermögender interessierten Person. Das setzt voraus, daßjeder Mensch irgendein Gut besitzt, dessen Wert niemalsnull angenommen werden kann. In der Tat legt auch derjenige,der nichts besitzt, dem Erträgnis seiner Arbeit undseinen Hoffnungen einen Wert bei, der zumindest dem zumLeben Allernötigsten gleich ist.Wenn man auf das eben dargelegte Prinzip die Analysisanwendet, so erhält man folgende Regel:Nimmt man als ~inheit den von Erwartungen unabhängigenTeil des Vermögens eines Individuums und bestimmtman die verschiedenen Reste. welche dieses Vermögenkraft dieser Erwartungen erlangen kann, sowie derenWahrscheinlichkeiten, so wird das Produkt jener Werte,wenn sie beziehungsweise auf die von diesen Rahrscheinlichkeitenangezeigten Potenzen erhoben werden, das ,,physischeVer rnög e n " sein, welches dem Individuum denselbenmoralischen Vorteil verschaffen würde, der ihmvon dem der Einheit gleichgesetzten Teile seines Vermögensund von seinen Erwartungen zukommt; zieht man also dieEinheit von diesem Produlite ab. so wird die Differenz denvon den Erwartungen herrührenden Zuwachs des physischenVermögens darstellen; wir werden dieeen Zuwachs die moralischeHoffnung nennen. Man sieht leicht ein, daß siemit der mathematischen Hoffnung zusammenfällt, wenn dasals Einheit angenommene Vermogen im Verhältnis zu dendurch die Ern-artungen bedingten Verändeiungen unendlichgroß wird. Tenn aber die~e Anderungen ein merklicherTeil jener Einheit sind, dann konnen die beiden Hoffnungensehr merklich voneinander abweichen.Dieee Regel führt zu tibereinstimmungen mit dem ge-sunden Menschenverstande. dessen Aneaben auf diese Art mit"einiger Genauigkeit abgeschätzt werden können. So findetman betreffend die frühere Frage, daß Paul bei einem Vermögenvon 200 Francs ~ernünfti~eiweisenicht mehr als
18 P. S. de Laplace:9 Francs beim Spiele wagen soll. Dieselbe Regel führt auchdazu, das Risiko lieber auf mehrere Teile eines erwartetenGutes zu verteilen, als das ganze Gut demselben Risikoauszusetzen. In gleicher Weise ergibt sich, daß auch beidem gerechtesten Spiele der Verlust immer verhältnismäßiggrößer ist als der Gewinn. Nehmen wir z. B. an, daß einSpieler, der ein Vermögen von 100 Francs besitzt, 50 Francsdavon auf Kopf- und Wappen-Spiele wagt, so wird sein Vermögennach seinem Spieleinsatz auf 87 Francs reduziert sein,d. h. diese letztere Summe würde dem Spieler denselben moralischenVorteil verschaffen, wie der Stand seines Vermögens,nachdem er eingesetzt hat. Das Spiel ist also selbst in demFalle unvorteilhaft, wo die Einlage gleich dem Produkteaus der erwarteten Summe mit ihrer Wahrscheinlichkeit ist.Daraus kann man einen Schluß ziehen auf die Unmoralitätder Spiele, bei denen die erwartete Summe kleiner als diesesProdukt ist. Solche Spiele bestehen nur dank der falschenSchlüsse und der durch sie genährten Begehrlichkeit, bringendas Volk dahin, sein Notwendiges trügerischen Hoffnungenzu opfern, deren Un<strong>wahrscheinlichkeit</strong> es nicht abzuschätzenversteht, und sind so die Quelle unzähliger Ubel.Daß die Spiele schädlich sind und daß man gut tut,nicht das ganze erwartete Gut derselben Gefahr auszusetzen,diese und alle analogen, vom gesunden Menschenverstanddiktierten Erkenntnisse bleiben bestehen, wie auch immerdie Funktion des physischen Vermögens, die für jedes Individuumsein moralisches Vermögen ausdrückt, beschaffensein mag. Es genügt, daß das Verhältnis des Zuwachsesdieser Funktion zum Zuwachs des physischen Vermögensmit dessen Zunahme abnimmt.Von den analytischen Methoden derWahrscheinlichkeitsrechnung.Die Anwendung der eben dargelegten Prinzipien aufdie verschiedenen Fragen der Wahrscheinlichkeit erfordertMethoden, deren Aufsuchung die Entstehung mehrererZweige der Analysis, speziell der Theorie der Kombinationenund der Rechnung mit endlichen Differenzen, veranlaßt hat.
Von den analytischen Methoden usw.19Wenn man das Produkt der Binome bildet: Eins plueeinem ersten Buchstaben, Eins plus einem zweiten Buchstaben,Eins plus einem dritten Buchstaben und so fortbis zu n. Buchstaben, und wenn man von dem entwickeltenProdukte Eins abzieht, so erhält man die Summeder Kombinationen aller dieser Buchstaben zu je einem,ZU je zweien, dreien etc., wobei jede Kombination denKoeffizienten Eins hat. Zur Berechnung der Anzahl derKombinationen dieser n Buchstaben zu je s nehme mandiese Buchstaben untereinander gleich an und beachte, daßdann das obige Produkt in die n-te Potenz des Binomes:Eins plus dem ersten Buchstaben übergeht; so wird die Zahlder Kombinationen der lz Buchstaben zu je s zum Koeffizientender s-ten Potenz des ersten Buchstaben in der Entwicklungdieses Binomes; man erhält also diese Zahl durchdie bekannte Binomialformel.Man berücksichtigt die gegenseitige Stellung der Buchstabenin jeder Kombination durch folgende Beobachtung:fügt man dem ersten Buchstaben einen zweiten hinzu, so kanndieser an die erste oder zweite Stelle gesetzt werden, waszwei Kombinationen ergibt. Wenn man diesen Kombinationeneinen dritten Buchstaben hinzufügt, so kann manihm in jeder der Kombinationen die erste, die zweite oderdie dritte Stelle zuweisen, was drei Kombinationen für jededer beiden anderen, im ganzen also sechs Kombinationenergibt. Daraus ist leicht zu folgern, daß die Anzahl derAnordnungen, die mit s Buchstaben vorgenommen werdenkönnen, gleich dem Produkt der Zahlen von Eins bis s ist;man muß also, um auf die gegenseitige Stellung der BuchstabenRücksicht zu nehmen, mit diesem Produkte die Zahlder Kombinationen der TZ Buchstaben zu je s multiplizieren,was darauf hinausläuft, daß man im Binomialkoeffizienten,der diese Anzahl der Kombinationen darstellt, den Nennerwegläßt.Denken wir uns eine Lotterie mit n Nummern, von denenY bei jedem Zuge herauskommen: man fragt nach der Wahrscheinlichkeit,daß s gegebene Nummern bei einem Zugeherauskommen. Zu diesem Zweck werden wir einen Bruchbilden, dessen Kenner die Anzahl aller möglichen Fälle,d. h. der Kombinationen von n Nummern zu je r, und dessenZähler die Anzahl aller jener Kombinationen sein wird, welche
die s gegebenen Zahlen enthalten. Diese letztgenannte Anzahlist augenscheinlich gleich der Anzahl der Kombinationen derübrigen Zahlen zu je r-s. Dieser Bruch wird die verlangteWahrscheinlichkeit sein, und man wird leicht finden, da6er sich auf einen Bruch reduziert, dessen Zähler die Anzahlder Kombinationen von r Zahlen zu je s und dessen Nennerdie Anzahl der Kombinationen der lz Zahlen gleichfalls zuje s ist. In der Lotterie von Frankreich z. B., die, wie manweiß, aus 90 Nummern besteht, wovon 5 bei jeder Ziehungherauskommen, ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine gegebene5 1Ziffer herauskomme, oder -; die Lotterie sollte dann90 18also im Interesse der Spielgleichheit den lSfachen Einsatz auszahlen.Die Gesamtzahl der Kombinationen von 90 Nummernzu je zweien ist 4005, und die der Kombinationen von5 Nummern zu je zweien ist 10. Die Wahrscheinlichkeit,daß ein gegebener Ambo herauskommt, ist also ---, und400,5die Lotterie sollte also das vierhundert- und einhalbfachedes Einsatzes auszahlen; sie sollte das 11748fache für einenTerno, das 511038fache für einen Quaterno und das 43949268-fache für einen Quinterno auszahlen. Die Lotterie biet,etaber den Spielern auch nicht entfernt diese Vort'eile.Nehmen wir an, in einer Urne wären a weiße und bschwarze Kugeln und man lege jedesmal, wenn man eineKugel herausgenommen hat, sie wieder in die Urne zurück;man fragt nach der Wahrscheinlichkeit, unter 9% Zügenm weiße und n-urt ~chwarze Kugeln zu ziehen. Es ist klar,da,ß die Zahl der Fälle, die bei jedem Zuge eintreten können,a + b ist. Da jeder Fall des zweiten Zuges sich mit allenFällen des erfiten Zuges kombinieren bann, so ist die Zahlder möglichen Fälle in zwei Bügen das Quadrat des Binoniesa + b. In der Entwicklung die~es Quadrates drückt dasQuadrat von a die Zahl der Fälle aus, in welchen man zweimaleine weiße Kugel herauszieht; das doppelt,e Produktvon a mit b drückt die Zahl der Fälle a,us, in welchen eineweiße und eine schwarze Kugel gezogen wurden; endlichdrückt das Quadrat von b die Zahl der Fälle aus, in denenman zwei schwarze Kugeln zieht. Fährt man so fort, so siehtman allgemein, daß die m-te Pot'enz des Binomes a + b1
Von den analytischen Methoden usw.21die Zahl aller möglichen Fälle bei n Zügen ausdrückt; unddaß in der Entwicklung dieser Potenz das die m-te Potenzvon a enthaltende Glied die Zahl der Fälle darstellt, in denenman m weiße und n-m schwarze Kugeln ziehen kann.Dividiert man also dieses Glied durch die gesamte Potenzdes Binomes, so erhält man die Wahrscheinlichkeit für dieZiehung von m weißen und n-m schwarzen Kugeln. Dadas Verhältnis der Zahlen a zu a + b die Wahrscheinlichkeitfür das Ziehen einer weißen Kugel, das Verhältnisder Zahlen b zu a + bdie Wahrscheinlichkeit für dasZiehen einer schwarzen Kugel ist, so wird, wenn mandiese Wahrscheinlichkeiten fi und q nennt, die Wahrscheinlichkeit,m weiße Kugeln in n Zügen zu ziehen, das diem-te Potenz von fi enthaltende Glied in der Entwicklungder n-ten Potenz des Binomes fi + q sein: man wird bemerken,daß die Summe fi + q = 1 ist. Diese merkwürdige Eigenschaftdes Binoms ist in der Theorie der Wahrscheinlichkeitvon großem E'utzen.Aber die allgemeinste und direkteste Methode zur Lösungvon Wahrscheinlichkeitsfragen besteht darin, sie aufDifferenzengleichungen zurückzuführen. Vergleicht man dieaufeinander folgenden Werte der die Wahrscheinlichkeitdarstellenden Funktion, wenn die Variabeln um ihre bezüglichenDifferenzen wachsen, so liefert die vorgelegte Aufgabeoft eine sehr einfache Beziehung zwischen diesen Werten.Diese Beziehung ist es, die man ,,gewöhnlicheu oder ,,PartielleDifferenzengleichung" nennt; „gewöhnliche", wenn esnur eine Variable gibt; „partielle", wenn es mehrere gibt.Geben wir dafür einige Beispiele.Drei Spieler, deren Geschicklichkeit als gleich angenommenwird, spielen miteinander unter folgenden Bedingungen.Derjenige der beiden ersten Spieler, der seinenGegner besiegt, spielt mit dem dritten weiter, und wenn ergewinnt, ist die Partie ZU Ende. Wenn er besiegt wird, spieltder Sieger mit dem anderen und so fort, bis daß einer derSpieler nacheinander die beiden anderen besiegt hat, wodurchdie Partie beendet ist: man fragt nach der Wahrscheinlichkeit,daß die Partie in irgendeiner Anzahl n von Spielenzu Ende sein wird. Suchen wir zunächst die Wahrscheinlich-keit, daß sie genau beim H-ten Spiele zu Ende sein wird.Zu diesem Zweck muß der Gewinner beim n-1-ten Spiele ins
2 2 P. S. de Laplace:Spiel eintreten und muß dieses, wie auch das folgende gewinnen.Wenn er aber, statt das n-1-te Spiel zu gewinnen,von seinem Gegner besiegt würde, dann wäre, da doch diesereben über den andern Spieler gewonnen hat, die Partie beidiesem Spiele zu Ende. Also ist die Wahrscheinlichkeit, daßeiner der Spieler beim .n-1-ten Spiele in dasselbe eintretenund es gewinnen wird, gleich der Wahrscheinlichkeit, daßdie Partie genau bei diesem Spiele zu Ende sein wird; undda dieser Spieler das folgende Spiel gewinnen muß, damitdie Partie beim wten Spiele ein Ende hat, so wird die Wahrscheinlichkeitdieses letzteren Falles nur die Hälfte der vorhergehendensein. Diese Wahrscheinlichkeit ist augenscheinlicheine Funktion der Zahl n; diese Funktion ist alsogleich der Hälfte derselben Funktion, wenn man darin num Eins verringert. Diese Gleichheit bildet eine jener Gleichungen,welche man gewöhnliche Differenzengleichungennennt.Mit ihrer Hilfe kann man die Wahrscheinlichkeit, daßdie Partie genau bei irgendeinem bestimmten Spiele endigt,leicht bestimmen. Augenscheinlich kann die Partie nichtvor dem zweiten Spiele zu Ende sein, und dazu ist notwendig,daß der Sieger unter den zwei ersten Spielernbeim zweiten Spiele über den dritten ~iegt; die Wahrscheinlichkeit,daß die Partie bei diesem Spiele zu Ende1sein wird, ist also -. Daraus folgt kraft der früheren Glei-2chung, daß die aufeinander folgenden Wahrscheinlichkeiteni 1betreffend das Ende der Partiefür das dritte Spiel, L'-4 81für das vierte eto. sind, und allgemein -, zur rt-1-ten2Potenz erhoben, für das n-te Spiel. Die Summe aller dieser1Potenzen von - ist aber Eins, vermindert um die letzte dieser2Potenzen; es ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Partiespätestens in lz Spielen beendet sein wird.Bet'rachten wir noch das erste, etwas schwierige Wahrscheinlichkeitsproblem,das gelöst und Fermat von Pascalzur Lösung vorgelegt wurde. Zwei Spieler A und B vongleicher Geschicklichkeit spielen miteinander unter der
Von den analytischen Methoden usw. 23Bedingung, daß derjenige, der zuerst den anderen eine gegebeneAnzahl mal besiegt hat, die Partie gewinnen und dieSumme der Spieleinsätze erhalten soll: nach einigen Spielenkommen die Spieler überein, die Partie, ohne sie beendet zuhaben, aufzugeben; man fragt, wie jene Summe unter sieverteilt werden soll. Es ist klar, daß die Teile den bezüglichenGewinn<strong>wahrscheinlichkeit</strong>en proportional seinmiissen; die Frage reduziert sich also auf die Bestimmungdieser Wahrscheinlichkeiten. Diese hängen augenscheinlichvon der Anzahl der Points ab, welche jedem der Spieler zurErreichung der gegebenen Zahl noch fehlen. Also ist die Wahrscheinlichkeitdes A eine Funktion dieser zwei Zahlen, diewir Indices nennen wollen. Wnn die beiden Spieler übereinkämen,noch ein Spiel zu machen (wodurch ihr Losnicht geändert wird, vorausgesetzt daß nach diesemneuen Spiele die Teilung wieder den neuen Gewinn<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enproportional erfolgt), dann würde entwederA dieses Spiel gewinnen, und es würde in diesem Fall die Zahlder ihm fehlenden Points um Eins vermindert werden;oder der Spieler B gewänne, und in diesem Fall würde dieZahl der diesem fehlenden Points um Eins kleiner werden.1Aber die Wahrscheinlichkeit eines jeden dieser Fälle ist -; 2die gesuchte Funktion ist also gleich der Hälfte derselbenFunktion, in welcher man den ersten Index um Eins vermindert,plus der Hälfte derselben Funktion, in welcher derzweite Index um Eins vermindert ist. Diese Gleichheit ist,eine jener Gleichungen, die man ,,partielle Differenzengleichungen"nennt.Man kann mit deren Hilfe die Wahrscheinlichkeitendes A bestimmen, indem man von den kleinsten Wertenausgeht und beachtet, daß die Wahrscheinlichkeit oder die~iedarstellende Funktion gleich Eins ist, wenn dem SpielerA kein Point fehlt, oder wenn der erste Index Null ist, unddaß diese Funktion zugleich mit dem zweiten Index Nullwird. Nimmt man also an, daß dem Spieler A nur ein Point1 3 7fehlt, so findet man seine Wahrscheinlichkeit gleich ---2' 4' 8etc., je nachdem dem B ein, zwei, drei etc. Points fehlen.Allgemein gesprochen ist sie dann gleich Eins, vermindert.
1um die ebensovielte Potenz von -, als dem B Points fehlen.2Man setzt sodann voraus, daß dem Spieler A zwei Pointsfehlen,1 1 11und wird für seine Wahrscheinlichkeiten ---etc.finden,4' 2'16je nachdem dem B ein, zwei oder drei Points etc. fehlen.Sodann wird man annehmen, daß dem Spieler A drei Pointsfehlen, U. s. f.Dieses Verfahren zur Bestimmung der aufeinanderfolgenden Terte einer Größe mittels ihrer Differenzenqleichungist lang und mühsam. Die Mathematiker habendaher nach Methoden gesucht, welche die allgemeine, dieserGleichung genugende Funktion der Indices liefern, so daBman für jeden besonderen Fall nur die entsprechenden Werteder Indices in diese Funktion einzusetzen hat. Betrachtenwir jetzt diesen Gegenstand ganz allgemein. Zu diesemBehufe denken wir uns eine Reihe von Gliedern, die auf einerhorizontalen Linie verteilt sind, so zwar, daß jedes nacheinem gegebenen Gesetze aus dem vorangehenden hervorgeht.Nehmen wir an, dieses Gesetz wäre ausgedrückt durch eineGleichung zwischen mehreren aufeinander folgenden Gliedernund ihrem Index, d. h. der Zahl, die ihre Stellung in der Reiheangibt. Eine solche Gleichung nenne ich eine ,,Differenzengleichungmit einem einzigen Index". Die ,,Ordnungu oderder ,,Gradu dieser Gleichung ist der Unterschied der Indicesihrer beiden äußersten Glieder. Man kann mittels einersolchen Gleichung sukzessive die Glieder der Reihe bestim-Umen und sie bis ins Unendliche fortsetzen; aber dazu mußman ebenso viele Glieder der Reihe kennen, als die Ordnungder Gleichung beträgt. Diese Glieder bilden die willkürlichenKonstanten in der Darstellung des allgemeinen Reihengliedsoder des Integrales der Differenzengleichung.Denken wir uns jetzt über den Gliedern der früherenReihe eine zweite Reihe von Gliedern horizontal angeordnet,darüber eine dritte Horizontalreihe und so fort ins Unendliche;und nehmen wir an, daß die Glieder aller dieser Reihen durcheine allgemeine Gleichung zwischen mehreren aufeinanderfolgenden, sowohl in horizontaler als vertikaler Richtunggenommenen Gliedern und den ihren Rang in den beidenRichtungen anzeigenden Zahlen verbunden sind. Eine
Von den analytischen Methoden usm. 25solche Gleichung nenne ich ,,partielle Differenzenglei~hun~mit zwei Indices".Denken wir uns analog über der Ebene der früherenReihen eine zweite Ebene mit ähnlichen Reihen, derenGlieder über den entsprechenden der ersten Ebene gestelltsind; denken wir uns ferner über dieser zweiten Ebene einedritte Ebene von ähnlichen Reihen und so fort bis ins Unendliche;nehmen wir an, daß alle Glieder dieser Reihendurch eine Gleichung zwischen mehreren aufeinander folgenden,nach Länge, Breite und Höhe herausgegriffenenGliedern und den drei, ihre Stellung in diesen drei Richtungenbezeichnenden, Zahlen verbunden sind. Eine solche Gleichungnenne ich eine „partielle Differenzengleichung mitdrei Indices".Um endlich die Sache abstrakt und unabhängig von denRaumdimensionen zu betrachten, denken wir uns allgemeinein System von Größen, die Funktionen einer beliebigenAnzahl von Indices sein sollen, und nehmen zwischen diesenGrößen, ihren Differenzen in bezug auf die Indices, undden Indices selber ebensoviele Gleichungen an. als Größendieser Art vorhanden sind; diese ~leich&qen werden dann,,partielle Differenzengleichungen mit einer beliebigen Anzahlvon Indices" sein.Mit ihrer Hilfe kann man sukzessive diese Größen bestimmen.Aber wie bei der Gleichung mit einem Indexhierzu erforderlich ist, daß man eine gewisse Zahl von Gliedernder Reihe kennt, ebenso erfordert die Gleichung mitzwei Indices, daß man eine oder mehrere Zeilen aus demReihensysteme kennt, als deren allgemeine Glieder jeweilseine willkürliche Funktion des Zeilenindex dargestellt werdenkönnen. In analoger Weise erfordert die Gleichung mitdrei Indices, daß man eine oder mehrere Ebenen aus demReihenkörper kennt, deren allgemeine Glieder jeweils alsdurch eine willkürliche Funktion der beiden Indices ihrerEbene darstellen lassen, und so fort. In allen diesen Fällenwird man durch sukzessive Eliminationen ein beliebigesGlied der Reihe bestimmen können. Da aber alle Gleichungen,zwischen denen man eliminiert, in einem und demselbenGleichungssysteme enthalten sind, so müssen alleAusdrücke für die Glieder, die man sukzessive durch dieseEliminationen erhält, in einem allgemeinen Ausdrucke,
26 P. S. de Laplace:einer Funktion der die Stellung des Gliedes bestimmendenIndices, enthalten sein. Dieser Ausdruck ist das Integralder vorgelegten Differenzengleichung und seine Ermittelungist Gegenstand der Integralrechnung.Taylor ist der erste, der in seinem ,,Met h o du s incr e -me n t o r u m " betitelten Werke die linearen Differenzengleichungenbetrachtet hatte. Er gibt dort die Methode an,wie man jene erster Ordnung niit einem Koeffizienten undeinem absoluten Gliede, welche beide Funktionen des Indexsind, integriert. In Wahrheit sind die Beziehungen zwischenden Gliedern der arithmetischen und geometrischen Progressionen,mit denen man sich zu allen Zeiten beschäftigthat, die einfachsten Fälle linearer Differenzengleichungen;aber man hatte sie nicht unter diesem ~esicbts~unktebetrachtet, der einer von jenen ist, die durch ihren Zusammenhangmit allgemeinen Theorien zu diesen hinführenund dadurch zu wahren Entdeckungen werden.Um dieselbe Zeit beschäftigte sich Moivre unter demNamen ,,rekurrenter Reihen" mit Differenzengleichungen beliebigerOrdnung mit konstanten Koeffizienten. Es gelangihm, dieselben auf eine sehr ~innreiche Art zu integrieren.Da es immer interessant ist, den Gedankendang der Entdeckernachzugehen, will ich den Moivres darlegen, indem ich seinVerfahren auf eine rekurrente Reihe, für welche eine Gleichungzwischen drei aufeinander folgenden Gliedern gegeben ist,anwende. Zuerst betrachtet er die Beziehung zwischen denaufeinander folgenden Gliedern einer geometrischen Progressionoder die zweigliedrige Gleichung, die jene Beziehungausdruckt. Nachdem er ~ie für die um Eins niedrigerenGlieder angesetzt hat, multipliziert er sie in dieser Formmit einem konstanten Faktor und zieht das Produkt von derursprünglichen Gleichung ab. Dadurch erhält er eine Gleichungzwischen drei aufeinander folgenden Gliedern dergeometrischen Progression. Moivre betrachtet sodann einezweite Progression, deren Quotient der soeben benutzteFaktor ist. Kun vermindert er in analo~er Weise den Index"der Glieder in der Gleichung dieser neuen Progression umeine Einheit: in dieser Form multipliziert er sie mit demQuotienten der ersten Progression und zieht das Produktvon der Gleichung der zweiten Prcgression ab; dadurch erhälter eine Beziehung zwischen drei aufeinander folgenden
Von den analytischen Afethoden usw. 27Gliedern dieser Progression, welche der für die erste Progressiongefundenen vollständig analog ist. Dann bemerkter, daß bei gliedweiser Sddition der beiden Progressionenzwischen irgend drei aufeinander folgenden Gliedern dieserdurch Summation erhaltenen Progression dieselbe Beziehungbesteht. Er vergleicht die Koeffizienten dieser Beziehungmit den Koeffizienten der Beziehung zwischen den Gliedernder vorgelegten rekuirenten Reihe und findet zur Bestimmungder Quotienten der beiden geometrischen Progressioneneine Gleichung zweiten Grades, deren Wurzeln dieseQuotienten sind. So zerlegt Rioivre die rekurrente Reihein zwei geometrische Progressionen, von denen jede miteiner millkürlichen Konstanten multipliziert ist, die er mittelsder zwei ersten Glieder der rekurrenten Reihe bestimmt.Dieses geniale Verfahren ist im Grunde dasselbe, dasD'Alembert seitdem zur Integration von linearen Differentialgleichungenmit konstanten Koeffizienten angewendetund Lagrange auf die analogen Differenzengieichungen übertragenhat.Sodann habe ich die linearen partiellen Differenzengleichungenuntersucht, zuerst unter der Bezeichnung „recurro-recurrenterReihen", und nachher unter ihrer eigentlichenBezeichnung. Die allgemeinste und einfachste Art,alle diese Gleichungen zu integrieren, scheint mir nun diezu sein, die ich auf die Betrachtung der ,,erzeugendenFunktionen'' gegiündet habe, deren Idee die folgende ist.Betrachtet man eine Funktion V einer Variabeln t, dienach Potenzen dieser Variabeln entwickelt ist, so wird derKoeffizient irgendeiner dieser Potenzen eine Funktion desExponenten oder Index x dieser Potenz sein. V nenne icherzeugende Funlit'ion dieses Koeffizient'en oder der Funktiondes Index.M~lt~ipliziertman nun die Reihenentwicklung von Vmit einer Funktion derselben Variabeln, wie z. B. mit Einsplus zweimal dieser Variabeln, so wird das Produkt eineneue erzeugende Funktion sein, worin der Koeffizient derx-ten Potenz der Veränderlichen t gleich ist dem Koeffizientenderselben Potenz in V, vermehrt um den doppeltenKoeffizienten der um Eins niedrigeren Potenz. So wird dieFunktion des Index x in dem Produkte gleich sein der Funktiondes Index x in V mehr dem Doppelten derselben Funk-3*
28 P. S. de Laplace:tion, worin der Index um Eins vermindert ist. DieseFunktion des Index X ist also eine Ableitung der Funktiondesselben Index in der Entwickelung von V, welch letztereFunktion ich ,,Primitiv-Funktion" des Index nennen will.Bezeichnen wir die abgeleitete Funktion dadurch, daß wirdas Zeichen 6 vor die Primitiv-Funktion setzen. Die durchdiesen Buchstaben 6 bezeichnete Ableitung wird von demMultiplikator von V abhängen, den wir T nennen und denwir uns wie V nach Potenzen von t entwickelt denkenwollen.Multipliziert man das Produkt V mal T neuerdings mitT, d. h. multipliziert man V mit dem Quadrate von T, soerhält man eine dritte erzeugende Funktion, worin der Koeffizientder X-ten Potenz von t eine analoge Ableitung desentsprechenden Koeffizienten des vorhergehenden Produktesist: daher wird man sie auch durch denselben Buchstaben 6,der vor die frühere Ableitung gesetzt wird, bezeichnenkönnen; dann wird dieser Buchstabe zweimal vor die Primitiv-Funktionvon x geschrieben werden müssen. Aberanstatt ihn so zweimal zu schreiben, gibt man ihm 2 alsExponenten.Wenn man so fortfährt, sieht man, daß man allgemeinbei Multiplikation von V mit der n-ten Potenz von T denKoeffizienten der X-ten Potenz von t in diesem Produkteerhält, daß den Buchstaben 6 mit n als Exponenten vordie Primitiv-Funktion setzt.Nehmen wir z. B. an, T sei gleich Eins geteilt durch t;dann wird in dem Produkte von V mit T der Koeffizient derX-ten Potenz von t gleich dem Koeffizienten der um Einshöheren Potenz in V sein; analog wird der Koeffizient derX-ten Potenz von t in dem Produkte von V mit der n-tenPotenz von T also die Primitiv-Funktion sein, bei der x umn Einheiten vermehrt ist.Betrachten wir jetzt eine neue Funktion Z von t, diewie V und T nach Potenzen von t entwickelt ist; bezeichnenwir mit dem vor die Primitiv-Funktion gesetzten Zeichen d denKoeffizienten der X-ten Potenz von t in dem Produkte vonV mit 2;es wird dann derselbe Koeffizient in dem Produktevon V mit der n-ten Potenz von Z durch den mit dem Exponentenn versehenen vor die Primitiv-Funktion von x gesetztenBuchstaben A auszudrücken sein.
Von den analytischen Methoden usw. 291Wenn z. B. Z= --1, so wird der Koeffizient dertX-ten Potenz von t in dem Produkte von V mit 2 gleichdem Koeffizienten der (X + 1)-ten Potenz von t in V minusdem Koeffizienten der X-ten Potenz sein. Er wird also dieendliche Differenz der Primitiv-Funktion des Index x sein.Dann zeigt der Buchstabe A eine endliche Differenz derPrimitiv-Funktion an, wobei der Index um eine Einheitvariiert; und die n-f,e Potenz dieses Buchstaben, vor diePrimitiv-Funktion gesetzt, wird die n-te, endliche Differenzdieser Funktion anzeigen. Setzt man T gleich Eins,geteilt durch t, so wird T gleich dem Binome Z + 1. DasProdukt von V mit der n-ten Potenz von T wird also gleichdem Produkte von V mit der n-ten Potenz des BinomesZ + 1 ein. Entwickelt man die Potenz dieses Binomes nachPotenzen vonZ, so werden die Produkte von V mit den verschiedenenGliedern dieser Entwicklung die erzeugendenFunktionen derselben Glieder sein, wenn man statt derPotenzen von Z die entsprechenden endlichen Differenzender Primitiv-Funktion des Index einsetzt.Nun gehört zum Produkt von V mit der n-ten Potenzvon T die Primitiv-Funktion, in welcher der Index x um NEinheiten vermehrt ist; geht man also von den erzeugendenFunktionen auf die Koeffizienten zurück, so wird man fürdie Primitiv-Funktion, deren Index um n Einheiten vermehrtwurde, eine Entwicklung erhalten, die gleich ist dern-ten Potenz des Binomes 2 + 1 , wenn man festsetzt, darinan Stelle der Potenzen von Z die entsprechenden Differenzender Primitiv-Funktion an Stelle des absoluten Gliedesdie Primitiv-Funktion selbst. So wird man für die Primitiv-Funktion,deren Index um irgendeine beliebige Zahl n vermehrtist, eine Entwicklung nach den Differenzen derselbenerhalten.Nimmt man für T und Z wieder die früheren Wertean, so wird Z gleich dem Binome T - 1 sein; das Produktvon V mit der n-ten Potenz von Z wird also gleich dem Produktevon V mit der Entwicklung der n-ten Potenz desBinomes T -1 sein. Geht man also von den erzeugendenFunktionen auf ihre Koeffizienten zurück, wie wir es ebengetan haben, so drückt sich die n-te Differenz der Primitiv-
30 P. 5. de Laplace:Funktion durch die Entwicklung der n-ten Potenz des BinomesT -1 aus, wenn man wieder übereinkommt, darinfür die W-te Potenzen von T die Primitiv-Funktion, derenIndex um n. vermehrt ist zu setzen; und für das von Tunabhängige Glied, das Eins ist, die Primitiv-Funktion selbst.Auf diese Weise erhält man die Differenz mi~telst der aufeinanderfolgenden Glieder dieser Primitiv-Funktion dargestellt.Da 6, vor die Primitiv-Funktion gesetzt, die Ableitungdieser Funktion ausdrückt, die in dem Produkte von V mitT mit der X-ten Potenz von t multipliziert ist, und da Adie nämliche Ableitung in dem Produkte von V mit Z ausdrückt,so wird man durch das Vorangehende zum folgendenallgemeinen Ergebnis geführt: welche Funktionen der Veriabelnt auch immer T und Z sein mögen, kann man in derEntwicklung aller identischen Gleichungen, die zwischendiesen Funktionen gebildet werden können, die Zeichen 6und A an Stelle von T und Z setzen, vorausgesetzt, daß mandie Operationen 6 und A jeweils auf die Primitiv-Funktiondes Index anwendet und die von diesen Buchstaben unabhängigenGlieder mit der Primitiv-Funktion multipliziert.Mittels dieses allgemeinen Resultates kann man irgendeinebeliebige Potenz einer Differenz der Primitiv-Funktiondes Index X, in der x um eine Einheit variiert, in eine Reihevon Differenzen derselben Funktion umformen, worin xum irgendeine beliebige Anzahl von Einheiten variiert undumgekehrt. Nehmen wir in der Tat an, es sei T = -(:Ii -1und Z wieder- 1; dann wird der Koeffizient der X-tentPotenz von t in dem Produkte V .T gleich dem Koeffizientender (X + i)-ten Potenz von t in V vermindert um den Koeffieientender X-ten Potenz von t in V sein; er wird also dieendliche Differenz der Primitiv-Funktion des Index x sein,in der man diesen Index um die Zahl i variieren läßt. Es istleicht zu sehen, daß T gleich (Z + l)i- 1, also Tn gleichder n-ten Potenz dieser Differenz ist. Wenn man nun in dieserGleichung an Stelle von T und Z die Buchstaben 6 und Aeinsetzt, und wenn man nach der Entwicklung hinter jedesb bzw. A Symbol die Primitiv-Funktion des Index x setzt, so
Von den analytischen Methoden usw. 31wird man die n-te Differenz dieser Funktion, worin x sich umi Einheiten ändert, durch eine Reihe von Differenzen derselbenFunktion, in der sich x um Eins ändert, ausgedrückterhalten. Diese Reihe ist nur eine Umformung der Differenz,die durch sie dargestellt wird und mit der sie identisch ist;aber auf solchen Umformungen beruht eben die Macht derAnalysis.Die Allgemeinheit der Analysis gestattet in dieser Darstellung,n negativ anzunehmen. Dann stellen die negativenPotenzen von 6 und A Integrale dar. In der Tat: da die erzeugendeFunktion der n-ten Differenz der Primitiv-Funktion1das Produkt von V mit der n-ten Potenz des Binomes -- 1tist, hat die Primitiv-Funktion, welche das n-te Integraldieser Differenz ist, zur erzeugenden Funktion das Produktaus der erzeugenden Funktion derselben Differenz mit dernegativen n-ten Potenz des Binomes --I; und diesertnegativen Potenz entspricht dieselbe Potenz des Buchstaben A ;diese Potenz bezeichnet also ein Integral derselben Ordnung,wobei der Index x sich um die Einheit ändert; während dienegativen Potenzen von 6 Integrale anzeigen, wobei x sichum i Einheiten ändert. Man erkennt so auf die klarste undeinfachste Weise den Grund für die beobachtete Analogiezwischen den positiven Potenzen und den Differenzen, undzwischen den negativen Potenzen und den Integralen.Wenn die Funktion, die durch den vor die Primitiv-Funktion gesetzten Buchstaben 6 bezeichnet wird, gleich Nullgesetzt wird, so hat man eine endliche Differenzengleichung,und V ist die erzeugende Funktion ihres Integrales. Um dieseerzeugende Funktion zu erhalten, bemerke man, daß in demProdukte V . T alle Potenzen von t verschwinden müssenmit Ausnahme derer, die niedriger sind als die Ordnung derDifferenzengleichung; somit ist V ein Bruch, dessen Nenner Tund dessen Zähler ein Polynom ist, worin die höchste Potenzvon t um Eins kleiner als die Ordnung der Differenzengleichungist. Die willkürlichen Koeffizienten der verschiedenen Potenzenvon t in diesem Polynom werden, einschließlich dernullten Potenz, durch ebensoviele Werte der Primitiv-Funktionbestimmt, indem man darin für x sukzessive 0, 1, 2 etc.1
32 P. S. de Laplace :setzt. Ist die Differenzengleichung gegeben, so bestimmtman T, indem man alle ihre Glieder auf die linke Seitebringt, so daß rechts Null steht, und nun im ersten Gliedefür die Primitiv-Funktion mit dem höchsten Index die Einheit,für die Primitiv-Funktion mit dem nächst niederenIndex die erste Potenz von t, für die Primitiv-Funktion mitdem um 2 verminderten Index die zweite Potenz von t U. s. f.einsetzt. Der Koeffizient der X-ten Potenz von t in der Entwicklungdes früheren Ausdruckes für V wird die gesuchtePrimitiv-Funktion von x oder das Lntegral der Differenzengleichungsein. Die Analyst liefert für die Durchführungdieser Entwicklung verschiedene Mittel, worunter man dasfür die vorgelegte Frage geeignetste wählen kann, was einVorteil dieser Integrations-Methode ist.Denken wir uns jetzt, V sei eine Funktion der zweiVariabeln t und t' und sei nach den Potenzen und Produktendieser Variabeln entwickelt; der Koeffizient irgendeines Produktesaus der X-ten Potenz von t mit der X'-ten Potenz vont' wird eine Funktion der Exponenten oder Indices x und X'dieser Potenzen sein; welche Funktion ich ,,Primitiv-Funktion"nennen werde, wahrend V ihre erzeugende Funktion ist.Multiplizieren wir V mit einer Funktion T der zweiVariabeln t und t', die wie V nach Potenzen und Produktendieser Variabeln entwickelt ist; das Produkt wird die erzeugendeFunktion einer ,,Ableitungu der Primitiv-Funktionsein. Ist T z. B. gleich t + t' -2, so wird diese Ableitunggleich sein der Primitiv-Funktion, worin der Index x umEins vermindert ist, plus derselben Primitiv-Funktion, worinder Index X' um Eins vermindert ist, weniger zweimal derPrimitiv-Funktion. Bezeichnet man durch den vor diePrimitiv-Funktion gesetzten Buchstaben 6 diese Ableitung,gleichgültig was T sein mag, so wird das Produkt von V mitder n-ten Potenz von T die erzeugende Funktion der Ableitungder Primitiv-Funktion sein, welche man durch dien-te Potenz des Buchstaben 6 bezeichnet. Es ergeben sichSätze, die denen betreffs der Funktionen einer einzigenVariabeln analog sind.Nehmen wir an, die durch den Buchstaben 6 bezeichneteFunktion sei null, so wird man eine partielle Differenzengleichunghaben: wählt man z. B. wie oben T = t + t -2,so erhält man die Gleichung: Null ist gleich der Primitiv-
Von den analytischen Methoden usw.33Funktion, worin der Index x um eins vermindert ist, plusderselben Funktion, worin X' um eins vermindert ist, minuszweimal der Primitiv-Funktion. Die erzeugende Funktio11.V dieser Primitiv-Funktion oder des Integrales dieser Gleichungmuß also so beschaffen sein, daß ihr Produkt mit Tdie Produkte von t mit t' nicht enthält; wohl aber kann VTgetrennt die Potenzen von t und t' enthalten, d. h. eine willkürlicheFunktion von t und eine willkürliche Funktion vo~kt'; V ist somit ein Bruch, dessen Zähler die Summe dieserzwei willkürlichen Funktionen und dessen' Nenner T ist.Der Koeffizient des Produktes der X-ten Potenz von t und derX'-ten Potenz von t' in der Entwicklung dieses Bruches wirdalso das Integral der betrachteten partiellen Differenzengleichungsein. Diese Integrationsmethode scheint mir fürGleichungen dieser Art wegen der Anwendbarkeit der verschiedenenVerfahren zur Entwicklung rationaler Brüche dieeinfachste und leichteste zu sein.Weitere Details über diese Sache würden ohne Hilfe derRechnung schwer verständlich sein.Betrachtet man die partiellen Differentialgleichungenwie partielle Differenzengleichungen, worin nichts vernachlässigtwurde, so kann man die dunklen Punkte des Differential-Kalküls,welche der Gegenstand großer Erörterungenunter den Mathematikern gewesen sind, aufhellen. Auf dieseWeise habe ich die Möglichkeit bewiesen, in ihren Integralendiskontinuierliche Funktionen einzuführen, sofern die Diskontinuität nur für die Differentialgrößen von der Ordnungdieser Gleichungen oder von höherer Ordnung stattfindet,Die transzendenten Resultate des Kalküls sind wie alle Abstraktionendes Verstandes allgemeine Symbole, derenwahren Umfang man nur dadurch zu erkennen vermag,daß man durch Analyse des Metaphysischen auf die elementarenIdeen, die dazu geführt haben, zurückgeht: was oftgroße Schwierigkeiten bereitet; denn der menschliche Geistfindet es weniger schwierig, vorwärtszuschreiten, als in sichselbst zurückzugehen.Der Vergleich der unendlich kleinen Differenzen mitden endlichen Differenzen kann gleichfalls viel Licht überdie Metaphysik der Infinitesimalrechnung verbreiten.Es ist leicht zu zeigen, daß der Quotient aus der .n-tenendlichen Differenz einer Funktion, worin E der Zuwachs
34 P. S. de Laplace :der Variabeln ist, und der n-ten Potenz von E, in eine nachPotenzen von E fortschreitende Reihe entwickelt, ein erstesvon E unabhängiges Glied besitzt. In dem Maße, als Eabnimmt, nähert sich die Reihe mehr und mehr diesemersten Gliede, von dem sie sich so nur um Beträge, die kleinerals jede angebbare Größe sind, unterscheiden kann. DiesesGlied ist also die Grenze der Reihe und stellt in der Differentialrechnungden Quotienten aus der unendlich kleinenn-ten Differenz der Funktion und der n-ten Potenz des unendlichkleinen Zuwachses dar.Betrachtet man die unendlich kleinen Differenzen unterdiesem Gesichtspunkte, so sieht man, daß die verschiedenenOperationen der Differentialrechnung darauf hinauslaufen,daß man in der Entwicklung identischer Ausdrücke die endlichen,d. h. von den als unendlich klein betrachteten Zuwächsender Variabeln unabhängigen Glieder einzeln vergleicht,was streng richtig ist, da diese Zuwächse unbestimmtbleiben. So besitzt die Differentialrechnung die volle Exaktheitder anderen algebraischen Operationen.Dieselbe Exaktheit ist auch bei der Anwendung derDifferentialrechnung auf die Geometrie und auf die Mechanikvorhanden. Denkt man sich eine Kurve in zwei benachbartenPunkten durch eine Sekante geschnitten undbezeichnet man mit E den Abstand der Ordinaten dieserbeiden Punkte, so wird dieses E der Zuwachs der Abszissevon der ersten bis zur zweiten Ordinate sein. Es ist leichtzu sehen, daß der entsprechende Zuwachs der Ordinategleich dem Produkte von E mit der ersten Ordinate, dividiertdurch ihre Subsekante, ist: wird also in der Gleichung derKurve die erste Ordinate um diesen Zuwachs vermehrt, soerhält man die bezügliche Gleichung für die zweite Ordinate:die Differenz beider Gleichungen gibt eine dritte, die nachPotenzen von E entwickelt und durch E dividiert ein von Eunabhängiges erstes Glied haben wird, das die Grenze dieserEntwicklung sein wird. Dieser Ausdruck wird also, gleichNull gesetzt, die Grenze der Subsekanten geben, und dieseGrenze ist augenscheinlich die Subtangente.Diese besonders glückliche Methode zur Gewinnungder Subtangente rührt von Fermat her, der sie auch aufdie transzendenten Kurven übertragen hat. Dieser großeGeometer bezeichnet mit E den Zuwachs der Abszisse; und
Von den analytischen Methoden usw.35indem er nur die erste Potenz des Zuwachses in Betrachtzieht, bestimmt er genau auf dieselbe Weise, wie es in derDifferentialrechnung gemacht wird, die Subtangenten derKurven, ihre Inflexionspunkte, die hfaxima und Minimaihrer Ordinaten und allgemein der rationalen Funktionen.Man ersieht sogar aus seiner schönen Lösung des Problemsder Lichtbrechung, in der Sammlung der Briefe von Descartesenthalten, daß er seine Methode auch auf irrationaleFunktionen auszudehnen wußte, indem er sich von denIrrationalitäten durch Potenzierung der Wurzeln freimachte.Man muß also Fermat als den eigentlichen Erfinder derDifferentialrechnung betrachten. Newton hat seitdem diesenKalkül in seiner F 1U X i o n s r e C h n u n g mehr analytischgestaltet und die Verfahren durch sein schönes Binomial-Theorem vereinfacht und verallgemeinert. Endlich hatLeibniz fast gleichzeitig die Differentialrechnung um eineBezeichnungsart bereichert, die den Übergang vom Endlichenzum unend!ich Kleinen anzeigt und mit dem Vorteile,die allgemeinen Ergebnisse dieser Rechnung zum Ausdruckzu bringen, noch den verbindet, daß sie die ersten angenähertenWerte der Differenzen und Summen der Größen gibt;eine Bezeichnungsart, die sich von selbst auch der Rechnungmit partiellen Differentialen angepaßt hat.Oft wird man auf Ausdrücke geführt, die so viele Gliederund Faktoren enthalten, daß die numerischen Substitutionenunausführbar sind. Das ist auch bei Wahrscheinlichkeitsuntersuchungender Fall, wenn man eine große Zahl vonEreignissen in Betracht zieht. Dann ist es trotzdem wichtig,daß man den aus den Formeln folgenden numerischen Wertkennt, damit man weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieResultate gelten, welche die Ereignisse durch ihre Vervielfältigungmit sich bringen. Insbesondere ist es wichtig, dasGesetz zu erhalten, nach welchem diese Wahrseinlichkeit sichunablässig der Gewißheit nähert, die sie schließlich erreichenwürde, wenn die Zahl der Ereignisse unendlich groß würde.Zu dem Zwecke überlegte ich, daß die bestimmten Integralevon Differentialen, die mit hohen Potenzen von Funktionenmultipliziert sind, bei der Integration Formeln geben, welcheaus einer großen Zahl von Gliedern und Faktoren zusammengesetztsind. Diese Bemerkung brachte mich auf den Gedanken,die komplizierten Ausdrücke der Analysis und die
36 P. S. de Laplace:Integrale von Differenzengleichungen in ähnliche Integraleumzuformen. Ich habe dies durch eine Methode erreicht,welche mit der unter dem Integralzeichen enthaltenen Funktionzugleich die Grenzen der Integration gibt. Bemerkenswertist hierbei, daß diese Funktion gerade die erzeugendeFunktion der vorgelegten Ausdrücke und Gleichungen ist,wodurch diese Methode an die Theorie der erzeugenden Funktionenanknüpft, zu der sie so eine Ergänzung bildet. Eshandelte sich sodann nur mehr um die Zurückführung - desbestimmten Integrales auf eine konvergente Reihe. Dashabe ich durch ein Verfahren erreicht, bei dem die Reiheum so rascher konvergiert, je komplizierter die Formel ist,die sie darstellt, so daß das Verfahren um so genauer ist,je notwendiger es wird. Am häufigsten hat die Reihe zumFaktor die Quadratwurzel aus dem Verhältnis des Kreisumfangeszum Durchmesser; zuweilen hängt sie von anderenTranszendenten ab, deren Anzahl unendlich groß ist.Eine wichtige Bemerkung, die mit der großen Allgemeinheitder Analysis zusammenhängt, und welche dieseMethode auf Formeln der Differenzenrechnung und Differenzengleichungen,wie sie die Wahrscheinlichkeitstheorie amhäufigsten darbietet, auszudehnen gestattet, besteht darin,daß die Reihen, auf die man geführt wird, wenn man dieGrenzen der bestimmten Integrale reell und positiv voraussetzt,ebenfalls auftreten, wenn die die Grenzen bestimmendeGleichung nur negative und imaginäre Wurzeln hat. Diesecbergänge vom Positiven zum Negativen und vom Reellenzum Imaginären, wovon ich als erster Gebrauch gemachthabe, führten mich auch noch auf die Auswertung mehrerersingulärer bestimmter Integrale, die ich sodann auch direktberechnet habe. Man kann somit diese Obergärige als einMittel der Entdeckung betrachten, ähnlich der Induktionund Analogie, die von den Geometern seit langer Zeit zuerstmit außerordentlicher Vorsicht, dann als eine große Reihevon Beispielen ihre Anwendung gerechtfertigt hatte, mitvollständigem Vertrauen verwendet wurden. Allein es istimmer notwendig, durch direkte Beweisführungen diedurch diese Mittel erhaltenen Resultate zu ~ichern.Ich habe die Gesamtheit der früher betrachteten Methoden,,Calcül mit erzeugenden Funktionen" genannt ; erdient als Grundlage dem Werk, das ich unter dem Titel „Ans-
Von den analytischen Methoden usw.37lytische Theorie der Wahrscheinlichkeiten" veröffentlichthabe. Dieser Calcül geht aus von dem einfachen Gedanken,die wiederholten Multiplikationen einer Größe mit sichselbst, d. h. ihre ganzen positiven Potenzen dadurch anzuzeigen,daß man oben an dem Buchstaben, der die Größedarstellt, die Zahlen schreibt, welche die Grade dieser Potenzenbezeichnen. Diese Bezeichnungsweise, die von Descartesin seiner Geometrie verwendet und seit Veröffentlichungdieses wichtigen Werkes allgemein angenommenwurde, ist etwas Geringfügiges, besonders wenn man sie mitder Theorie der Kurven und der variabeln Funktionen vergleicht,womit dieser große Geometer die Grundlagen dermodernen Mathematik gelegt hat. Aber wie die Sprache derAnalysis, die vollendetste von allen, durch sich selbst einmächtiges Werkzeug von Entdeckungen ist, so sind ihre Bezeichnungsweisen,sobald sie notwendig oder glücklich erdachtsind, ebensoviele Keime neuer Rechnungsarten, wieaus diesem Beispiele ersichtlich wird.Wallis hat in seiner ,,Arithmetica infinitorum", einemjener Werke, die am meisten zu den Fortschritten der Analysisbeigetragen haben, es sich besonders angelegen seinlassen, den Faden der Analogie und Induktion zu verfolgen,und erwog, daß, wenn man den Exponenten eines Buchstabendurch 2, 3 et~.dividiert, der Quotient, falls die Divisionmöglich ist, der cartesianischen Bezeichnung gemäß,gleich dem Exponenten der Quadratwurzel, Kubikwurzeletc. aus der Größe sein wird, welche der zum Dividendenerhobene Buchstabe darstellt. Indem er dieses Resultatdurch Analogie auf den Fall ausdehnt, wo die Division nichtmöglich ist, betrachtete er eine auf einen gebrochenen Exponentenerhobene Größe als die Wurzel einer Potenz, wobeider Wurzelgrad gleich dem Nenner, der Exponent gleichdem Zähler des Bruches ist. Er bemerkte dann, daß gemäßder cartesianischen Bezeichnung die Multiplikation zweierPotenzen desselben Buchstaben auf die Addition ihrer Exponentenund ihre Division auf die Subtraktion des Exponentendes Divisors von dem des Dividenden hinausläuft,sobald dieser letztere größer als der erste ist. Wallisdehnt dieses Ergebnis auf den Fall aus, daß der erste Ex-ponent gleich oder größer ist als der zweite, so daß dieDifferenz null oder negativ wird. Er nahm also an, daß ein
38 P. S. de Laplace:negativer Exponent den Bruch: Eins geteilt durch diezum selben, aber positiven Exponenten erhobene Größeanzeigt. Durch diese Beobachtungen gelangte er zur allgemeinenIntegration eingliedriger Differentialausdrücke;daraus schließt er auf die bestimmten Integrale einer besonderenArt von Differential-Binomen, deren Exponenteine ganze positive Zahl ist. Indem er sodann das Gesetzder Zahlen, durch die jene Integrale ausgedrückt werden,ins Auge faßte und eine Reihe von glücklichen Interpolationenund Induktionen durchführte, worin man den Keimder Theorie der bestimmten Integrale erblickt, welche dieGeometer so sehr beschäftigt hat und eine der Grundlagenmeiner neuen Theorie der Wahrscheinlichkeiten bildet, erhielter die Beziehung zwischen der Kreisfläche und demQuadrate des Durchmessers durch ein unendliches Produktauegedrückt, das, je später man es abbricht, dieses Verhältnisin immer engere Grenzen einschließt: eines der vortrefflichstenResultate der Analvsis. Aber merkwürdie " istes, daß MTallis, der so schöne Betrachtungen über gebrocheneExponenten angestellt hatte, fortfuhr, diese Potenzen so zubezeichnen, wie man es vor ihm getan hatte. Newton war,wenn ich nicht irre, der erste, der in seinen Briefen anOldenburg die Bezeichnung dieser Potenzen durch gebrocheneExponenten anwendete. Indem er mittels der Induktion.von der Rallis einen so schönen Gebrauch eemachthatte, die Exponenten der Binomialpotenzen mit ZenKoeffizienten der Glieder der Entwicklung für den Fallverglich, wo der Exponent des Binomes eine ganze undpositive Zahl ist, bestimmte er das Geeetz dieser Koeffizientenund dehnte es durch Analogie auch auf gebrocheneund negative Exponenten aus. Diese mannigfachen, aufdie Descartes sche Bezeichnungsweise gegründeten Resultatezeigen den Einfluß der~elben auf die Fortschritte der Analysis.Sie hat außerdem noch den Vorteil, daß sie den einfachstenund richtigsten Begriff von den Logarithmen gibt,die in der Tat nur die Expcnenten einer Größe sind, derenaufeinander folgende Potenzen, indem ~ie nur um unendlichkleine Grade zunehmen, sämtliche Zahlen darstellen können.Aber die wichtigste Erweiterung dieser Bezeichnungsweisebetrifft die variabeln Exponenten, woraus die Exponentialrechnung,einer der fruchtbarsten Zweige der Analysis,
Von den analytischen Methoden usw. 39entstanden ist. Leibniz hat als erster auf die Transzendenienmit variabeln Exponenten hingewiesen und dadurch dasSystem der Elemente, aus denen eine endliche Funktion zusammengesetztsein kann, vervollständigt; denn jede expliziteendliche Funktion einer Variabeln reduziert sich schließlichauf einfache Größen, die mittels Addition, Subtraktion,Multiplikation und Division und durch Erhebung auf konstanteoder variable Potenzen kombiniert sind. Die Wurzelnder aus diesen Elementen gebildeten Gleichungen sind impliziteFunktionen der Variabeln. So ist z. B. der Logarithmuseiner veränderlichen Größe eine implizite Funktion derselben,da er den Exponenten darstellt, zu dem man einebestimmte Zahl erheben muß, um diese veränderliche Größezu erhalten; jene bestimmte Zahl ist die, deren natürlicherLogarithmus die Einheit ist.Leibniz verfiel darauf, seinem Differentialzeichen dieselbenExponenten wie den Größen zu geben; aber dannzeigen diese Exponenten statt der wiederholten Multiplikationender nämlichen Größe die wiederholten Differentiationender nämlichen Funktion an. Diese neue Erweiterungder cartesianischen Bezeichnung führte Leibniz zur Analogieder positiven Potenzen mit den Differentialen und dernegativen Potenzen mit den Integralen. Lagrange hat dieseeigentümliche Analogie in allen ihren Entwicklungen verfolgtund gelangte durch eine Reihe von Induktionen, welcheals eine der schönsten Anwendungen, die man von der Methodeder Induktion gemacht hat, betrachtet werden kann,zu ebenso merkwürdigen als nützlichen Formeln über diegegenseitige Verwandlung der Differenzen und Integralesowohl für endliche als unendlich kleine verschiedene Zuwächseder Variabeln. Aber er hat nicht dafür die Beweisegegeben, die er für schwierig hielt. Die Theorie der erzeugendenFunktionen dehnt die cartesianische Bezeichnungauf was immer für Rechnungszeichen aus: sie zeigt mitEvidenz die Analogie der Potenzen und der durch diese Zeichenangezeigten Rechnungsarten: so zwar, daß sie auchals die Exponentialrechnung der Zeichen betrachtet werdenkann. Alles, was die Reihen und die Integration der Differenzengleichungenbetrifft, geht daraus mit außerordentlicherLeichtigkeit hervor.
Anwendungen der Wahrscheinlich.keitsrechnung.Von den Spielen.Die Kombinationen, welche die Spiele darbieten, warender Gegenstand der ersten Untersuchungen über Wahrscheinlichkeiten.In der unendlichen Mannigfaltigkeit dieser Kombinationengibt es mehrere, die sich mit Leichtigkeit derRechnung unterwerfen lassen, andere wieder erfordern schwierigereRechnungen; und da die Schwierigkeit in dem Maßewächst, als die Kombinationen verwickelter werden, so hatder Wunsch, dieselben zu überwinden, sowie die Neugierdedie Geometer angeregt, diesen Zweig der Analysis mehr undmehr zu vervollkommnen. Wir haben zuvor gesehen, daßman mit Hilfe der Kombinationslehre leicht die Gewinsteeiner Lotterie berechnen konnte. Aber schwieriger ist esschon zu ermitteln, für wieviel Züge z. B. eins gegen einszu wetten ist, daß alle Nummern herausgekommen sind.Wenn n die Zahl aller Nummern, r die Zahl der bei jedemeinzelnen Zuge herauskommenden Nummern und i die unbekannteZahl der Züge ist, so hängt der Ausdruck der Wahrscheinlichkeit,daß alle Nummern herauskommen, von dern-ten endlichen Differenz der i-ten Potenz eines Produktesvon Y aufeinander folgenden Zahlen ab. Ist die Zahl lz sehrgroß, so wird die Aufsuchung des Wertes i, für den diese1Wahrscheinlichkeit gleich - ist, unmöglich, wenn man nicht2diese Differenz in eine gut konvergierende Reihe verwandelt.Das Iäßt sich glücklicher Weise durch die oben angegebeneMethode für die Approximation der Funktionen sehr großerZahlen mit Erfolg ausführen. Auf diese Weise findet man,daß bei einer aus 10000 Nummern zusammengesetztenLotterie, wobei eine einzige Nummer bei jedem Zuge herauskommt,es unvorteilhaft ist, eins gegen eins zu wetten,daß alle Nummern in 95767 Zügen herauskommen werden,und daß es von Vorteil ist, die gleiche Wette für 95768Züge einzugehen. In der Lotterie Frankreichs ist dieseWette unvorteilhaft für 85 Züge und vorteilhaft für 86 Züge.Betrachten wir noch zwei Spieler A und B, die in derWeise miteinander Kopf und Wappen spielen, daß jedesmal,
Anwendungen der Wahrscheifichkeitsrwhnung. 41wenn Kopf geworfen wird, A dem B eine Marke gibt, undwenn Wappen geworfen wird, B dem A eine Marke zahlt:die Anzahl der Marken des B sei begrenzt, die des A unbegrenzt,und die Partie soll erst dann zu Ende sein, wennB keine Marken mehr hat. Es wird gefragt, für wievielWürfe eins gegen eins zu wetten ist, daß die Partie beendetsein wird. Der Ausdruck der Wahrscheinlichkeit, daß diePartie in einer Anzahl von i Spielen zu Ende sein wird, istdurch eine Reihe gegeben, die eine große Zahl von Gliedernund Faktoren enthält, wenn die Zahl der Marken des Beine beträchtliche ist; die Bestimmung des Wertes der Un-bekannten i, welche diese Reihe gleich - 1 macht, würde2dann also unmöglich sein, wenn es nicht gelänge, die Folgeauf eine gut konvergierende Reihe zurückzuführen. Wendetman dazu die eben besprochene Methode an, so findet maneinen sehr einfachen Ausdruck für die Unbekannte, woraussich ergibt, daß für den Fall, daß beispielsweise B 100Marken besitzt, etwas weniger als eins gegen eins zu wettenist, daß die Partie in 23780 Würfen, und ein wenig mehr alseins gegen eins, daß sie in 23 781 Spielen zu Ende sein wird.Diese zwei Beispiele in Verbindung mit den bereits gegebenengenügen, um zu zeigen, wie die Spiel-Probleme zurVervollständigung der Analysis beitragen konnten.Von den unbekannten Ungleichheiten, die unter den fürgleich gehaltenen Chancen bestehen können.Die Ungleichheiten dieser Art haben auf die Resultateder Wahrscheinlichkeitsrechnung einen merklichen Einfluß,der eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Betrachtenwir das Spiel Kopf und Wappen und nehmen an, daß esebenso leicht sei, die eine wie die andere Seite der Münze zuwerfen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Male1Kopf zu werfen, - und die, zweimal nacheinander Kopf2'1zu werfen, - Aber wenn in der Münze eine Ungleichheit4'existiert, so da8 die eine Seite öfter erscheint als die andere,aber ohne daß man weiß, welche die durch die Ungleich-
42P. S. de Laplace :heit begünstigte Seit,e ist, so wird die Wahrscheinlichkeit,beim ersten Spiel Kopf zu werfen, noch immer f- sein, weil2bei der Unkenntnis der durch die Ungleichheit begünstigtenSeite die Wahrscheinlichkeit des einfachen Ereignisses ebensosehrvermehrt wird, falls ihm diese Ungleichheit günstig ist,als sie vermindert wird, falls sie ihm entgegen ist. Abergerade in dieser Unkenntnis liegt eine Vermehrung der Wahrscheinlichkeit,zweimal nacheinander Kopf zu werfen. Dennin der Tat, diese Wahrscheinlichkeit ist gleich der Wahrscheinlichkeit,beim ersten Wurfe Kopf zu werfen, multipliziertmit der Wahrscheinlichkeit, nach seinem Erscheinenbeim ersten Wurfe auch beim zweiten Wurf Kopf zu werfen:nun ist aber das Erscheinen von Kopf beim ersten Wurfeein Grund, zu glauben, daß die Vngleichheit der Münzediese Seite begünstigt; die unbekannte Ungleichheit vermehrtalso die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Spiele Kopf zuwerfen; sie vergrößert folglich das Produkt der beidenWahrscheinlichkeiten. Um diesen Gegenstand der Berechnungzu unterwerfen, nehmen wir an, daß diese Ungleichheitdie Wahrscheinlichkeit des begünstigten einfachen Ereignisses1um - vermehre. Wenn dieses Ereignis Kopf ist, so wird201 1 11seine Wahrscheinlichkeit- plus - oder - sein, und die2 20 -. 20Wahrscheinlichkeit, es zweimal nacheinander zu werfen, wirdii 121das Quadrat von - oder -sein. Wenn das begünstigte20 400Ereignis ,,Wappenu ist, so wird die Wahrscheinlichkeit von1 1 9,,Kopfu - weniger - oder - sein, und die Wahrscheinlich-2 20 2081keit, es zweimal nacheinander zu werfen, wird -- sein.400Da man von vornherein keinen Grund hat zu glauben, daßdie Ungleichheit das eine dieser beiden Ereignisse eher begünstigtals das andere, so ist klar, daß man die Wahrscheinlichkeitdes zusammengesetzten Ereignisses „Kopf-Kopf"erhält, indem man die zwei früheren Wahrscheinlichkeiten101addiert und ihre Summe halbiert, was -- für diese Wahr-400i
Anwendungen der Wahr~heinlichkeitmechnun~. 431 1scheinlichkeit gibt, die - um -oder um das Quadrat des4 4001Zuwachses - übertrifft, welchen die Ungleichheit zur Mög-20lichkeit des von ihr begünstigten Ereignisses hinzufügt.Die Wahrscheinlichkeit, ,,Wappen-Wappen" zu werfen, ist101ebenso -- ; aber die Wahrscheinlichkeiten, ,,Kopf-Wappen"40099oder ,,Wappen-Kopf" zu werfen, sind jede nur mehr -; 400denn die Summe dieser vier Wahrscheinlichkeiten muß dieGewißheit oder gleich eins sein. Auf diese Weise findet manallgemein, daß die beständigen, aber unbekannten Ursachen,welche die einfachen, für gleich möglich gehaltenen Ereignissebegünstigen, immer die Wahrscheinlichkeit der Wiederholungdes nämlichen einfachen Ereignisees vergrößern.Bei einer geraden Anzahl von Spielen müssen ,,Kopf"und ,,Wappena entweder beide eine gerade, oder beide eineungerade Anzahl mal auftreten. Die Wahrscheinlichkeiteines jeden dieser Fälle ist 1,wenn die beiden Seiten gleich2möglich sind; existiert aber eine unbekannte Ungleichheitzwischen ihnen, dann ist diese Ungleichheit immer dem erstenFalle günstig.Zwei Spieler, deren Geschicklichkeit als gleich angenommenwird, spielen unter der Bedingung, daß bei jedemSpiele derjenige, der verliert, seinem Gegner eine Spielmarkegibt, und daß die Partie so lange dauert, bis einer der Spielerkeine Marken mehr hat. Die Wahrscheinlichkeitsrechnungzeigt uns, da6 die Gleichheit des Spieles erfordert, daßdie Einlagen der Spieler im umgekehrten Verhältnis ihrerMarken stehen. Aber wenn zwischen ihrer Geschicklichkeiteine kleine unbekannte Ungleichheit besteht, so wird diesedenjenigen Spieler begünstigen, der die kleinere AnzahlMarken hat. Seine Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen,wächst, wenn die Spieler übereinkommen, ihre Mar-1ken zu verdoppeln oder zu verdreifachen; und sie würde - 2oder gleich groß mit der Wahrscheinlichkeit des anderen4*
Spielers sein in dem Falle, wo bei immer gleichbleibendemVerhältnis die Zahl der Marken unendlich groß würde.Man kann den Einfluß dieser unbekannten Ungleichheitendadurch berichtigen, daß man sie selbst den Chancendes Zufalls unterwirft. So wird im Spiele ,,Kopf und Wappen",falls man zusammen mit der ersten Münze jedesmal einezweite wirft und übereinkommt, die jeweils durch diese zweiteMünze geworfene Fläche beständig als ,,Kopfu zu bezeichnen,die Wahrscheinlichkeit, zweimal nacheinander mit der erstenMünze ,,Kopfu zu werfen, sich weit mehr einem Viertel nähern,als in dem Falle des gewöhnlichen Spiels mit einer einzigenMünze. In diesem letzteren Falle ist der Unterschied dasQuadrat des kleinen Zuwachses der Möglichkeit, welchen dieunbekannte Ungleichheit der begünstigten Seite der erstenMünze erteilt: in dem anderen Falle ist diese Differenz dasvierfache Produkt dieses Quadrates mit dem entsprechendenQuadrate bezüglich der zweiten Münze.Wirft man in eine Urne hundert Nummern, von 1 bis100, in der natürlichen Zahlenordnung und zieht, nachdemman die Urne zwecks Mischung der Nummern geschüttelthat, eine heraus, so ist klar, daß, wenn gut gemischt wurde,die Wahrscheinlichkeiten für das Herauskommen der Nummerndie nämlichen sein werden. Befürchtet man aber, daßes unter diesen Wahrscheinlichkeiten kleine Unterschiedegebe, die von der Ordnung, in der die Nummern in die Urnegeworfen wurden, abhängen, so wird man diese Unterschiedebeträchtlich vermindern. wenn man die Nummern nach derOrdnung, in der sie aus der ersten Urne herausgekommensind, in eine zweite Urne wirft und in dieser zweiten Urnedurch neuerliches Schütteln vermischt. Eine dritte, vierteetc. Urne würde mehr und mehr diese in der zweiten Urneschon unmerklichen Unterschiede vermindern.Von den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, die sichaus der unbesohränkton Vervielfältigung derEreignisse ergeben.Inmitten der veränderlichen und unbekannten Ursachen,die wir unter dem Namen des Zufalls begreifen, undwelche den Gang der Ereignisse unsicher und unregelmäßigmachen, sieht man nach Maßgabe ihrer Vervielfdtigung
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.45eine auffällige Regelmäßigkeit entstehen, die sich an eineAbsicht zu halten scheint, und welche man als einen Beweisder Vorsehung betrachtet hat. Aber wenn man darübernachdenkt, erkennt man bald, daß diese Regelmiißigkeitnur die Entwicklung der bezüglichen Möglichkeiten der einfachenEreignisse ist, die um so öfter eintreten müssen, jewahrscheinlicher sie sind. Denken wir uns z. B. eine Urne,die weiße und schwarze Kugeln enthält, und nehmen wir an,da% man jedesmal, wenn eine Kugel herausgezogen wird,sie wieder in die Urne zurücklegt, um zu einer neuen Ziehungzu schreiten. Das Verhältnis der Anzahl der herausgezogenenweißen Kugeln zur Anzahl der herausgezogenen schwarzenKugeln wird in den ersten Zügen zumeist sehr unregelmäßigsein; aber die veränderlichen Ursachen dieser Unregelmäßigkeitbringen Wirkungen hervor, die einmal demregelmäßigen Gange der Ereignisse günstig, dann wiederentgegen sind und welche, indem sie sich gegenseitig in derGesamtheit einer großen Zahl von Zügen aufheben, mehrund mehr das Verhältnis der weißen zu den schwarzen, inder Urne enthaltenen Kugeln oder die bezüglichen Möglichkeitenfür das Herausziehen einer weißen oder schwarzenKugel bei jedem Zuge erkennen lassen. Daraus ergibt sichfolgendes Theorem.Die Wahrscheinlichkeit, daß das Verhältnis der Anzahlder herausgezogenen weißen zur Gesamtzahl aller herausgezogenenKugeln von dem Verhältnis der Anzahl der weißenzur Gesamtzahl aller in der Urne enthaltenen Kugeln nichttlber eine vorgegebene Große hinaus abweicht, niihert sichbei unbeschränkter Vervielfältigung der Ereignisse der Gewißheit,wie klein man auch jene Größe annehmen mag.Dieses Theorem, eingegeben vom gesunden Mensohenverstand,war durch die Analysis schwierig zu beweisen.Daher legte auch der berühmte Geometer Jakob Bernouilli,der sich als erster damit beschäftigt hat, dem Beweise, dener davon gab, große Wichtigkeit bei. Wendet man den Kalktilder erzeugenden Funktionen auf diesen Gegenstand an,so bewei~t man nicht nur mit Leichtigkeit dieses Theorem,sondern erhält außerdem noch die Wahrscheinlichkeit dafür,da% das Verhältnis der beobachteten Ereignisse nur innerhalbgewisser Grenzen von dem wahren Verhältnis ihrerbezüglichen Möglichkeiten abweicht.
Man kann aus dem vorhergehenden Theorem die folgendeFolgerung ziehen, die als ein allgemeines Gesetz zu betrachtenist, nämlich: daß die Beziehungen zwischen den Wirkungender Natur sehr nahe konstant sind, wenn diese Wirkungenin großer Zahl betrachtet werden. So ist trotz der Verschiedenheitder Jahre die Summe des Ertrages während einerbeträchtlichen Anzahl von Jahren merklich dieselbe; so zwar,daß der Mensch durch nützliche Vorsichtsmaßregeln sichvor der Unregelmäßigkeit der Jahreszeiten dadurch schützenkann, daß er die Güter, welche die Natur in ungleicher Weiseausteilt, auf alle Zeiten gleichmäßig verteilt. Ich nehmevon dem vorangehenden Gesetze auch die Wirkungen, dievon den moralischen Ursachen herrühren, nicht aus. DasVerhältnis der jährlichen Geburten zur Bevölkerung unddas der Ehen zu den Geburten weist nur kleine Schwankungenauf; in Paris ist die Zahl der jährlichen Geburtenannähernd dieselbe; und ich habe gehört, daß auf der Postin gewöhnlichen Zeiten die Zahl der wegen mangelhafterAdresse unbestellbaren Briefe jedes Jahr sich wenig ändert;dasselbe hat man auch in London bemerkt.Ferner folgt aus diesem Theorem, daß in einer unbegrenztfortgesetzten Reihe von Ereignissen die Wirkungder regelmäßigen und konstanten Ursachen mit der Längeder Zeit über die unregelmäßigen Ursachen die Oberhandgewinnen muß. Daher kommt es, daß der Ertrag der Lotterienebenso sicher ist wie der der Landwirtschaft, da dieChancen, welche sie sich vorbehalten, ihnen für die Gesamtheiteiner großen Zahl von Einlagen einen Gewinn sichern.Da ebenso mit der Beobachtung der ewigen Prinzipien derVernunft, Gerechtigkeit und Humanität, welche die Gesellschaftenbegründen und aufrecht erhalten, immer zahlreichegünstige Chancen verbunden sind, so bietet es großen Vorteil,sich diesen Prinzipien anzupassen, und ist mit schwerenObelständen verbunden, sie außer acht zu lassen. Man befragedie Geschichte sowie die eigene Erfahrung, so wirdman sehen, daß alle Tatsachen dieses Ergebnis der Rechnungstützen. Man bedenke, was für glückliche Erfolge dieauf die Vernunft und die natürlichen Menschenrechte begründetenInstitutionen den Völkern gebracht haben, welchedieselben ins Leben zu rufen und zu erhalten wußten. Manbetrachte ferner die Vorteile, welche ein redliches Gebaren
Anwendungen der Wahrecheinlichkeit~rechnun~. 47den Regierungen verschafft hat, die sich dasselbe zur Maximehaben, und wie sie für die Opfer entschädigt wordensind, die sie eine gewissenhafte Genauigkeit in der Einhaltungihrer Verbindlichkeiten gekostet hat. Welches ungeheureVertrauen im Innern! Welches Ubergewicht nachaußen! Man sehe im Gegenteil, in welchen Abgrund vonUnglück die Völker oft durch den Ehrgeiz und durch dieTreulosigkeit ihrer Führer gestürzt worden sind. Jedesmalwenn eine große Macht, berauscht von Eroberungssucht, nachder Weltherrschaft strebt, bringt das Unabhängigkeitsgefühlunter den bedrohten Nationen eine Koalition hervor, derjene Macht fast immer zum Opfer fällt. In gleicher Weisemüssen inmitten der wechselnden Ursachen, welche die verschiedenenStaaten vergrößern oder verkleinern, schließlichdie natürlichen Grenzen, die wie konstante Ursachen wirken,den Ausschlag geben. Es ist also für die Stabilität wie fürdas Glück der Reiche von Wichtigkeit, nicht über jeneGrenzen sich auszudehnen, in die sie durch die Wirkung dieserUrsachen immer wieder zurückgedrängt werden, geradesowie auch die Meeresfluten, wenn sie durch heftige Stürmeaufgetürmt wurden, infolge der Schwere in ihr Beckenzurücksinken. Auch das ist ein durch zahllose und verhängnisvolleErfahrungen bekräftigtes Resultat der Wahrscheinlichkeitsrechnung.Würde man die Geschichte unterdem Gesichtspunkte des Einflusses der konstanten Ursachenbehandeln, so würde sie mit dem Interesse der Kuriositätauch noch jenes verbinden, den Menschen die nützlichstenLehren darzubieten. Zuweilen schreibt man die unvermeidlichenWirkungen dieser Ursachen ganz zufälligen Umständenzu, die nur die Wirkungen ausgelöst haben. Es istz. B. unnatürlich, daß ein Volk von einem andern, von demes durch ein weites Meer oder große Entfernung getrennt ist,regiert werde. Schließlich muß diese konstante Ursache, diesich beständig mit den in demselben Sinne wirkenden undin der Folge der Zeiten sich entwickelnden veränderlichenUrsachen verbindet, stark genug werden, um dem unterworfenenVolke seine natürliche Unabhängigkeit zurückzugebenoder es mit einem mächtigen Nachbarstaate zu vereinigen.--.In einer großen Zahl von Fällen, und es sind geradedie wichtigsten in der Analysis des Zufalls, sind die Ausgangs-
48 P. S. de Laplace:<strong>wahrscheinlichkeit</strong>en unbekannt und wir sind genötigt, inden vergangenen Ereignissen Anhaltspunkte für unsere Vermutungenbetreffs der ursachen, von denen jene abhangen,zu suchen. Wendet man den Kalkül der erzeugenden Funktionenauf das oben dargelegte Prinzip über die aus beobachtetenEreignissen erschlossene Wahrscheinlichkeit derUrsachen an, so gelangt man zu folgendem Theorem.Wenn ein einfaches oder ein aus mehreren einfachen zusammengesetztesEreignis, wie z. B. eine Spielpartie, sehroft wiederholt worden ist, dann sind die Ausgangs<strong>wahrscheinlichkeit</strong>ender einfachen Ereignisse, die das Beobachtete amwahrscheinlichsten erscheinen lassen, diejenigen, welche vonder Beobachtung mit der größten Wahrscheinlichkeit angezeigtwerden: in dem Maße, als das beobachtete Ereigniswiederholt wird, wächst diese Wahrscheinlichkeit und würdeam Ende sich in Gewißheit verwandeln, wenn die Zahl derWiederholungen unendlich groß würde.Es sind hier zwei Arten von Annäherungen zu beachten:die eine von ihnen bezieht sich auf die von beidenSeiten genommenen Grenzen für die Ausgangswahrscheinkeiten,welche der Vergangenheit die meiste Wahrscheinlichkeitverleihen : die andere Annäherung betrifft dieWahrscheinlichkeit dafür, daß diese Ausgangs<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enin jene Grenzen fallen. Die Wiederholung des zusammengesetztenEreignisses vergroßert diese Wahrscheinlichkeitimmer mehr, wenn jene Grenzen dieselben bleiben,und verkleinert mehr und mehr das Intervall dieser Grenzen,wenn die Wahrscheinlichkeit dieselbe bleibt; im Unendlichenwird dieses Intervall null und die Wahrscheinlichkeit verwandeltsich in Gewißheit.Wenn man dieses Theorem auf das in verschiedenenGegenden Europas beobachtete Verhältnis der Geburtenvon Knaben und Mädchen anwendet, so findet man, daßdas Verhältnis, da es fast überall gleich 22 zu 21 ist, mitäußerster Wahrscheinlichkeit auf ein leichteres Eintreten derGeburten der Knaben hinweist. Erwägt man sodann, daßdas Verhältnis in Neapel dasselbe ist wie in Petersburg,so wird man sehen, daß in dieser Hinsicht der Einfluß desKlimas nicht merklich ist. Man konnte also der gewöhnlichenMeinung entgegen vermuten, daß auch im Orientdie männlichen Geburten überwiegen. Ich hatte daher
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.49die nach Ägypten gesandten franzosischen Gelehrten eingeladen,sich mit dieser interessanten Frage zu beschäftigen;aber bei der Schwierigkeit, genaue Auskünfte über dieGeburten zu erlangen, war es ihnen nicht möglich, die Fragezu lösen. Glücklicherweise hat Herr V. Humboldt in der ungeheurenMenge neuer Tatsachen, die er in Amerika mit soviel Scharfsinn, Mut und Ausdauer beobachtet und gesammelthat, diesen Gegenstand nicht vergessen. Er hat zwischen denWendekreisen dasselbe Vttrhältnis der Geburten der Knabenund Mädchen gefunden, des man in Paria beobachtet hat, sodaß das Oberwiegen der männlichen Geburten als ein 811-gemeines Gesetz der menschlichen Gattung angesehen werdenmuß. Die Gesetze, denen die verschiedenen Tiergattungenin dieser Hinsicht folgen, scheinen mir der Aufmerksamkeitder h'aturforscher wert.Da das Verhältnis der Geburten der Knaben zu jenender Mädchen sehr wenig von der Einheit abweicht, so könntenselbst recht große Zahlen von Geburten, die an einem Ortebeobachtet wurden, ein dem allgemeinen Gesetze entgegengesetztesResultat liefern, ohne daß man deswegen zumSchluß berechtigt wäre, daß das Gesetz hier nicht besteht.Um diese Folgerung ziehen zu können, müßte man sehr großeZahlen beobachten und sich versichern, daß ein solcher Scblußsehr große Wahrscheinlichkeit hat. Buffon führt z. B. inseiner politischen Arithmetik mehrere Gemeinden in derBourgogne an, wo die Geburten der Mädchen jene der Knabenan Zahl übertroffen haben. Unter diesen Gemeinden weist dievon Carcelle-le-Grignon auf 2009 Geburten in fünf Jahren 1026Mtidchen und 983 Knaben auf. Obgleich diese Zahlen betriichtlichsind, so zeigen sie doch nur mit der Wahrschein-9lichkeit eine größere Möglichkeit in den Geburten der10Mädchen an; und die~e Wahrscheinlichkeit, die kleiner istal0 die, im Spiele ,,Kopf Wappen" nicht viermal nacheinanderKopf zu werfen, ist nicht groß genug, um der Ursachedieser Unregelmäßigkeit nachzuforschen, die aller Wahrscheinlichkeitnach verschwinden würde, wenn man die Geburtenin dieser Gegend durch ein Jahrhundert hindurchverfolgte.Die Geburtsregister, die mit Sorgfalt geführt werden, umden Stand der Bürger festzustellen, können dazu dienen,
50 P. 8. de Laplace:die Einwohnerzahl eines großen Reiches zu ermitteln, ohneeine- Volkszählung, die ein mühsamer und schwer mit Genauigkeitausführbarer Vorgang ist, vornehmen zu müssen.Dazu muß man aber das Verhältnis der Bevölkerungszahlzu den jährlichen Geburten kennen. Das genaueste Mittel,dahin zu gelangen, besteht darin, daß man 1. im ReicheDepartements auswahlt, die ziemlich gleichmäßig über dessenFläche verteilt sind, um das allgemeine Ergebnis von lokalenUmständen unabhängig zu machen; 2. daß man zueinem gegebenen Zeitpunkt die Bewohner mehrerer Gemeindenin jedem dieser Departements sorgfältig zählt; und3. aus den Geburtslisten mehrerer Jahre, die dem gegebenenZeitpunkte vorangehen und nachfolgen, die entsprechendemittlere Zahl der jährlichen Geburten bestimmt. Diese Zahl,dividiert durch die der Bewohner, wird das Verhältnis derjährlichen Geburten zur Bevölkerung ergeben, und zwar umso sicherer, je beträchtlicher die Volkszählung ist. Oberzeugtvon dem Nutzen einer solchen Zählung, hat sich dieHegierung bereit erklärt, auf meine Bitte hin die Durchführunganzuordnen. In dreißig gleichmäßig über ganzFrankreich verteilten Departements wurden die Gemeindenausgewählt, die die genauesten Auskünfte liefern konnten.Die Zählungen haben 2037615 Individuen als Totalsummeihrer Bewohner am 23. September 1802 ergeben. Die Geburtslistedieser Gemeinden in den Jahren 1800, 1801 und1802 ergab anGeburten : Heiraten : Todesfällen :110312 Knaben 46037 103659 Männer105287 Mädchen 99443 Frauen.Das Verhältnis der Bevölkerung zu den jährlichen Ge-332 845burten ist also 28 -- es ist somit größer, als man bis-1000 000 'her geschätzt hatte. Multipliziert man mit diesem Verhältnisdie Zahl der jährlichen Geburten in Frankreich, so erhältman die Bevölkerung des Königreiches. Welche aber ist dieWahrscheinlichkeit, daß die auf diese Weise bestimmte Bevölkerungszahlvon der wirklichen nicht über eine gegebeneGrenze hinaus abweichen wird? Indem ich dieses Problemlöste und dabei die früher angegebenen Daten verwandte,fand ich, daß, wenn ich die Zahl der jährlichen Geburten in
Anwendungen der TTTahrscheinlichkeitsrechnung. 51Frankreich mit einer Million annahm, was 28352845 alsBevölkerungszahl ergibt, es fast 300000 gegen 1 zu wettenist, daß der Fehler dieses Resultates nicht eine halbe Millionbeträgt.Das Verhältnis der Geburten der Knaben zu denen derMädchen, das sich aus obiger Liste ergibt, ist das von 22zu 21, und die Ehen verhalten sich zu den Geburten wie3 zu 14.In Paris weichen die Taufen der Kinder beiden Geschlechtesein wenig von dem Verhältnis 22: 21 ab. Seit1745, zu welcher Zeit man in den Geburtsregistern zwischenbeiden Geschlechtern zu unterscheiden angefangen hatte, bisEnde 1784 wurden in dieser Hauptstadt 393386 Knaben und377555 Mädchen getauft. Das Verhältnis dieser zwei Zahlenist nahezu gleich 25 zu 24; es scheint also, daß in Paris einebesondere Ursache die Taufen beider Geschlechter derGleichheit nähert. Wendet man auf diesen Gegenstand dieWahrscheinlichkeitsrechnung an, so findet man, dass 238gegen 1 für die Existenz dieser Ursache zu wetten ist, washinreicht, um ihre Aufsuchung zu rechtfertigen. Als ichdarüber nachdachte, schien es mir, daß der beobachteteUnterschied daher rührt, daß die Eltern vom Landeoder aus den Provinzen, die irgendeinen Vorteil daranfinden, die Knaben bei sich zu behalten, im Verhältnisweniger Knaben als Mädchen in das Findelhaus von Parisgeschickt hatten, als dem Verhältnis der Geburten beiderGeschlechter entspräche. Dies haben mir die Register-listen dieser Anstalt bewiesen. Seit Beginn des Jahres1745 bis Ende von 1809 sind daselbst 163499 Knaben und159405 Mädchen abgegeben worden. Die erste dieser ZahlenList nur um - größer als die zweite, während sie wenigstens381um - größer sein sollte. Die Existenz der angegebenen24Ursache wird nun dadurch bestätigt, daß bei Außerachtlassungder Findelkinder das Verhältnis der Geburten derKnaben zu denen der Mädchen in Paris 22 zu 21 ist.Bei den vorhergehenden Ergebnissen ist vorausgesetzt,daß man die Geburten mit dem Herausziehen von Kugelnaus einer Urne vergleichen kann, die eine unendliche Anzahl
von weißen und schwarzen Kugeln enthält, welche so vermischtsind, daß bei jedem Zuge die Chancen des Herauskommen~für jede Kugel dieselben sind; aber es ist möglich,da8 die Unterschiede der gleichen Jahreszeiten in den verschiedenenJahren irgendeinen Einfluß auf das jährlicheVerhältnis der Geburten der Knaben und Mädchen haben.Das Bureau des Longitudes von Frankreich veröffentlichtjedes Jahr in seinem Jahrbuch die Tabelle der jährlichenBewegung der Bevölkerungszahl des Königsreiches. Diebereits veröffentlichten Tabellen beginnen mit 1817; in diesemund den fünf folgenden Jahren wurden geboren : 2962 36116Knaben und 2781997 Mädchen, was sehr nahe - als Ver-15hältnis der Geburten der Knaben zu denen der Mädchengibt. Die Verhältnisse jedes einzelnen Jahres entfernen sichwenig von diesem mittleren Ergebnis: das kleinste Ver-17hältnis ist das von 1822, wo es nur - betragen hat; das1615gr6ßte ist vom Jahre 1817, wo es - betrug. Diese Verhält-14nisse entfernen sich merklich von dem oben gefundenen Ver-hlltnis z2 Wendet man auf diese Abweichung die Wahr-21'scheinlichkeitsanalysis mit Zugrundelegung der hypothetischenVergleichbarkeit der Geburten mit dem Herausziehender Kugeln aus einer Urne an, so findet man, daß diese Abweichungsehr wenig wahrscheinlich sein würde. Das scheintmithin anzuzeigen, daß diese Hypothese, obgleich sehr angenähert,doch nicht streng genau ist. Unter der eben angeführtenZahl der Geburten sind an unehelichen Kindern200494 Knaben und 190698 Mädchen. Das Verhältnis dermännlichen zu den weiblichen Geburten ist also 3 somit19'16kleiner als das mittlere Verhältnis - Dieses Ergebnis15'zeigt die gleiche Abweichung wie die Geburten der Findelkinder,und es scheint zu beweisen, daß in der Klasse dernatürlichen Kinder die Geburten der beiden Geschlechtersich mehr der Gleichheit nähern als in der Klasse der legi-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 53timen Kinder. Der Unterschied des Klimas im Nordengegen den Süden von Frankreich scheint das Verhältnisder Geburten der Knaben und Mädchen nicht merklich zubeeinflussen. Die dreißig südlichsten Departements haben16für dieses Verhältnis geradeso wie für ganz Frankreich - 15ergeben.Das beständige Uberwiegen der Geburten der Knabenüber die der hlädchen in Paris und London hat, seitdemman darauf achtet, den Gelehrten als ein Beweis der Vorsehunggeschienen, ohne die, ihrer Meinung nach, die unregelmäßigenUrsachen, die den Gang der Ereignisse unaufhörlichstören, schon öfters hätten bewirken müssen, daßdie jährlichen Geburten der Mädchen jene der Knaben übertreffen.Aber dieser Beweis ist nur ein neues Beispiel des Mi%-brauches, den man so oft von den Endursachen gemachthat, die bei einer gründlichen Prüfung dieser Fragen immerverschwinden, wenn man die zu ihrer Beantwortung nötigenDaten hat. Die Konstanz, um die es sich handelt, istein Resultat der regelmäßigen Ursachen, die den Geburtender Knaben das Ubergewicht geben und die über die Unregelmäßigkeitendes Zufalls die Oberhand behalten, wenndie Zahl der jährlichen Geburten beträchtlich ist. Die Untersuchungder Wahrscheinlichkeit, daß sich diese Konstanzdurch einen langen Zeitraum hindurch behaupten wird,gehört dem Zweige der Analysis des Zufalls an, der von denvergangenen Ereignissen zur Wahrscheinlichkeit der zukünftigenEreignisse aufsteigt; daraus ergibt sich, wennman von den seit 1745 bis 1789 beobachteten Geburten ausgeht,daß man vier gegen eins wetten kann, da% in Parisdie jährlichen Geburten der Knaben während eines Jahrhundertsbeständig die Geburten der Mädchen überwiegenwerden; es ist daher kein Grund vorhanden, darüber erstauntzu sein, daß dies während eines halben Jahrhunderts stattgefundenhat.Wir wollen noch an einem Beispiel zeigen, wie sich diekonstanten Verhältnisse ausbilden, welche die Ereignisse indem Maße, als sie sich vervielfältigen, darbieten. Denkenwir uns eine Reihe von Urnen im Kreise aufgestellt, von
54 P. S. de Laplace:denen jede eine große Zahl weißer und schwarzer Kugelnenthält: die Verhältnisse der weißen Kugeln zu den schwarzenin den Urnen können ursprünglich sehr verschieden sein, sodaß z. B. eine der Urnen nur weiße, eine andere nur schwarzeKugeln enthält. Zieht man nun eine Kugel aus der erstenUrne, um sie in die zweite zu legen; und man zieht, nachdemman diese zweite Crne " geschüttelt hat. um die hinzugegebeneKugel mit den andern gut zu vermischen, wiedereine Kugel heraus, um sie in die dritte Crne zu legen, undmacht das so fort bis zur letzten Urne, aus der man eineKugel herausnimmt, um sie wieder in die erste Urne zugeben; und man wiederholt diese Reihe von Zügen ins Unbegrenzte;so zeigt uns die Analyse der Wahrscheinlichkeiten,daß die Verhältnisse der weißen zu den schwarzenKugeln in diesen Crnen schließlich die nämlichen und gleichwerden dem Verhältnis der Summe aller weißen Kugeln zurSumme aller schwarzen Kugeln, die in den Urnen enthaltensind. So verschwindet mit der Zeit durch diese regelmäßigeArt der Veränderung die ursprüngliche Cnregelmäßigkeitdieser Verhältnisse, um der einfachsten Ordnung Platz zumachen. Wenn man jetzt zwischen diese Urnen neue einschaltet,in welchen das Verhältnis der Summe der darinbefindlichen weißen Kugeln zur Summe der schwarzen Kugelnvon dem früheren verschieden ist, so wird, wenn manmit der Gesamtheit dieser Urnen die soeben angegebenenZiehungen ins Unbegrenzte fortsetzt, die einfache Ordnung,die in den alten Urnen hergestellt war, zuerst gestört, und dieVerhältnisse der weißen zu den schwarzen Kugeln werdenunregelmäßig werden; aber nach und nach wird diese Unregelmäßigkeitverschwinden, um einer neuen OrdnungPlatz zu machen, welche schließlich in der Gleichheit der Verhältnisseder weißen zu den schwarzen in der Urne enthal-tenen Kugeln bestehen wird. Man kann diese Resultateauf alle Kombinationen der Natur ausdehnen, in welchendie konstanten Kräfte, von denen ihre Elemente belebt sind,regelmäßige Wirkungsweisen hervorbringen, die geeignet sind,aus dem Schoße selbst des Chaos Svsteme hervorgehen zu "lassen, die von wunderbaren Gesetzen regiert werden.Die Erscheinungen. die am meisten vom Zufall abzu-" ,hängen scheinen, zeigen also bei ihrer Vervielfachung eineNeigung, sich unablässig festen Verhältnissen zu nähern;
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.55denkt man sich zu beiden Seiten eines jeden dieser Verhältnisseein beliebig kleines Intervall, so wird die Wahrschein.lichkeit, daß das mittlere Ergebnis der Beobachtungen indieses Intervall fällt, am Ende nur um eine unterhalb jederbeliebigen Größe liegende Zahl sich von der Gewißheitunterscheiden. Auf diese feise kann man durch Anwendungder Wahrscheinlichkeitsrechnung auf eine große Zahl vonBeobachtungen die Existenz dieser Verhaltnisse erkennen.Aber bevor man nach den Ursachen derselben sucht, ist esnotwendig, wenn man sich nicht in leere Spekulationen verlierenwill, sich zu versichern, daß sie mit einer Wahrscheinlichkeitangezeigt werden, welche nicht gestattet, sie wievom Zufall herruhrende Cnregelmäßigkeiten zu betrachten.Die Theorie der erzeugenden Funktimen gibt einen f ehr einfachenAusdruck fur diese Wahrscheinlichkeit, den man erhältdurch Integration des Produktes aus dem Differentialder Größe, um welche das aus einer grcßen Zahl von Beobachtungenabgeleitete Resultat von der Wahrheit abweicht,mit einer Konstanten, die kleiner als Eins ist und von derNatur des Probleme, abhängt, erhoben auf eine Potenz,deren Exponent das Verhältnis des Quadrates dieser Abweichungzur Zahl der Beobachtungen ist. Das Integral,genommen zwischen gegebenen Grenzen und dividiert durchdasselbe, von positiv nach negativ unendlich erstreckteIntegral, wird die Xahrscheinlichkeit ausdiucken, daß dieAbweichung von der Xahrheit zwischen jenen Grenzen enthaltenist. Dies ist das allgemeine Gesetz der Xahrscheinlichlieitder durch eine grcße Zahl von Beobachtungen angegebenenResultate.Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf dieXaturphilosophie.Die Naturerscheinungen sind meistens von so vielenfremdartigen Umständen veidecht, und von einer so grußenZahl von störenden Uisachen lieeinflußt, daß sie oft nursehr schwer zu erkennen sind. Das ]aßt sich nur dadurcherreichen, daß man die Beobachtungen oder Versuchevervielfacht, so daß die fremdaitigen Wirkungen sichgegenseitig aufheben und die Durchschnittsergebnisse jeneErscheinungen und ihre verschiedenen Elemente klar her-
56 P. S. de Laplace:vortreten lassen. Je zahlreicher die Beobachtungen sindund je weniger sie voneinander abweichen, desto mehrnähern sich ihre Ergebnisse der Wahrheit. Man erfüllt dieseletzte Bedingung durch die Wahl der Beobachtungsmethoden,durch Genauigkeit der Instrumente und durch die Sorgfalt,die man auf die richtige Beobachtung verwendet: sodannbestimmt man mittels der Wahrscheinlichkeitstheorie dievorteilhaftesten oder am wenigstens dem Fehler ausgesetztenMittelwerte. Aber das genügt noch nicht; es istweiter notwendig, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, daßdie Fehler dieser Resultate innerhalb gegebener Grenzenliegen, sonst hat man nur eine unvollständige Kenntnis vondem Grade der erlangten Genauigkeit. Geeignete Formelnhierzu sind daher eine wahre Vervollkommnune der Methodeder Wissenschaften und bilden eine wichtige Ergänzungderselben. Die Analysis, die sie erfordern, ist die feinste undschwierigste der Theorie der Wahrscheinlichkeit: sie macht,einen der Hauptgegenstande meines Werkes über diese Theorieaus, worin ich zu Formeln dieser Art gelangt bin, welcheden bemerkenswerten Vorteil haben, vom Gesetz der Wahrscheinlichkeitder Fehler unabhängig zu sein und nur Größenzu enthalten, die durch die Beobachtungen selbst und durchderen Ausdrücke gegeben sind.Jede Beobachtung findet ihren analytischen Ausdruck.indem man eine Funktion der Elemente bildet, welche manbestimmen will; und wenn diese Elemente ungefähr bekanntsind, so wird diese Funktion eine lineare Funktion ihrerKorrektionen sein. Indem man diese Funktion nun derbeobachteten Größe gleichsetzt, bildet man eine sogenannteBedingungsgleichung. Wenn man eine große Zahlsolcher Gleichungen hat, so kombiniert man sie in der Art,daß man ebensoviele Endgleichungen bildet, als (unbekannte)Elemente da sind, durch deren Auflösung bestimmt manhierauf die Korrektionen. Aber welches ist die vorteilhaftesteArt, die Bedingungsgleichungen zu kombinieren, umdie Endgleichungen zu erhalten? Welches ist das Wahrscheinlichkeitsgesetzder Fehler, womit die aus ihnen entnommenenElemente noch behaftet sein können? Darübergibt die Wahrscheinlichkeitstheorie Aufschluß. Die Bildungeiner Endgleichung mittels der Bedingungsgleichungen läuftdarauf hinaus, daß man jede dieser Gleichungen mit einem
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.57unbestimmten Faktor multipliziert und diese Produkteaddiert; man muß also das System von Faktoren wählen,welches den zu befürchtenden Fehler am kleinsten macht.Nun ist offenbar, daß bei Multiplikation der möglichenFehler eines Elementes mit ihren bezüglichen MTahrscheinlichkeitendas vorteilhafteste System dasjenige sein wird,in welchem die Summe dieser Produkte, alle positiv genommen,ein Minimum ist; denn ein positiver oder negativerFehler muß als gleichermaßen ungünstig betrachtetwerden. Bildet man also die Summe dieser Produkte, so wirddie Bedingung des Minimums das zu wählende, d. i. dasvorteilhafteste System der Faktoren bestimmen. Man findetauf diese Weise, daß dieses System das der Koeffizienten derElemente in jeder Bedingungsgleichung ist; so zwar, daß maneine erste Endgleichung bildet, indem man beziehungsweisejede Bedingungsgleichung mit dem Koeffizienten ihres erstenElementes multipliziert und alle so multiplizierten Gleichungenaddiert. Man bildet eine zweite Endgleichung, indem manebenso die Koeffizienten des zweiten Elementes verwendetund so fort. Auf diese Art enthüllen sich die Elemente undGesetze der Erscheinungen, die in der Sammlung einer großenZahl von Beobachtungen enthalten sind, mit der größtenEvidenz.Die Wahrscheinlichkeit der Fehler, die jedes Elementnoch befürchten läßt, ist proportional der Zahl, deren natürlicherLogarithmus die Einheit ist, erhoben auf eine Potenz,die gleich ist dem negativen Quadrate des Fehlers, multipliziertmit einem konstanten Koeffizienten, der als Modulder Fehler-Wahrscheinlichkeit betrachtet werden kann; dennwenn der Fehler derselbe bleibt, nimmt seine Wahrscheinlichkeitrasch ab, sobald dieser Koeffizient zunimmt; so zwar,daß das erhaltene Element, wenn ich so sagen darf, um somehr auf Seite der Wahrheit wiegt, je größer dieser Modul ist.Ich werde deshalb diesen Modul ,,Gewichtu des Elementesoder des Resultates nennen. Dieses Gewicht hat den größtenWert bei Wahl des vorteilhaftesten Systemes der Faktoren,und das eben gibt diesem Systeme den Vorrang über andere.Aus einer bemerkenswerten Analogie dieses Gewichtesmit jenem der Körper, die auf ihren gemeinsamen Schwerpunktbezogen werden, ergibt sich folgendes: wenn ein unddasselbe Element durch verschiedene Systeme gegeben ist,
P. 8. de Laplace:von denen jedes sich aus einer großen Zahl von Beobachtungenzusammensetzt, so ist das vorteilhafteste mittlere Resultatihrer Gesamtheit gleich dem Quotienten aus der Summe derProdukte jedes Teilresultates mit seinem Gewichte durchdie Summe aller Gewichte. Außerdem ist das Totalgewichtdes Resultates aus den verschiedenen Systemen gleich derdie Summe der Teilgewichte; so zwar, da6 die Wahrscheinlichkeitder Fehler des mittleren Resultates aus ihrer Gesamtheitproportional der Zahl ist, die zum natürlichen Logarithmusdie Einheit hat, erhoben auf eine Potenz, gleichdem negativen Quadrate des Fehlers und multipliziert mitder Summe aller Gewichte. Jedes Gewicht hängt in Wahrheitvon dem <strong>wahrscheinlichkeit</strong>sgesetze der Fehler jedesSystems ab, und dieses Gesetz ist fast immer unbekannt;aber es ist mir glücklicherweise gelungen, den Faktor, der esenthält, mittels der Quadratsumme aus den Abweichungender Beobachtungen des Systemes von ihrem mittleren Resultatezu eliminieren. Zur Vervollständigung unserer Kenntnisseüber die durch die Gesamtheit einer großen Zahl vonBeobachtungen erlangten Resultate wäre wünschenswert,neben jedes Resultat das ihm entsprechende Gewicht zuschreiben: die Analysis liefert hierfür allgemeine und einfacheMethoden. Wenn man auf diese Weise das Exponentialgesetzgefunden hat, daß das Wahrscheinlichkeitsgesetz derFehler darstellt, so erhält man die Wahrscheinlichkeit dafür,daß der Fehler des Resultates in gegebenen Grenzen enthaltenist, indem man das Integral über das Produkt ausdieser Exponentialfunktion mit dem Differentiale des Fehlerszwischen diesen Grenzen nimmt und es mit der Quadratwurzeldes Quotienten aus dem Gewichte des Resultatesund dem Kreisumfang vom Durchmesser 1 multipliziert.Daraus folgt, daß für ein und dieselbe Wahrscheinlichkeitdie Fehler der Resultate den Quadratwurzeln aus ihren Gewichtenumgekehrt proportional sind, was zum Vergleichihrer bezüglichen Genauigkeiten dienen kann.Um diese Methode mit Erfolg anzuwenden, muß mandie Beobachtungs- oder Versuchsbedingungen so variieren,daß man die beständigen Fehlerursachen vermeidet. DieBeobachtungen müssen zahlreich sein, und zwar um so mehr,je größer die Zahl der zu bestimmenden Elemente ist; denndas Gewicht des mittleren Resultates wächst wie der Quo-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 59tient aus der Zahl der Beobachtungen und der Zahl der Eiemente.Weiter ist notwendig, daß die Elemente bei diesenBeobachtungen in verschiedener Weise eingehen, denn wennzwei Elemente nur so eingingen, daß ihre Koirffizientenin den Bedingungsgleichungen proportional würden, dannwürden diese Elemente nur eine einzige Unbekannte darstellen,und es wäre unmöglich, sie durch diese Beobachtungenzu unterscheiden. Endlich ist es notwendig, daß dieBeobachtungen genau sind: diese Bedingung, die erste vonallen, vermehrt sehr das Gewicht des Resultates, dessen Ausdruckzum Divisor die Summe der Quadrate aus den Abweichungender Beobachtungen von diesem Resultate hat.Mit diesen Vorsichtsmaßregeln wird man von der früherenMethode Gebrauch machen und den Grad der Zuverlässigkeitbemessen können, welchen die aus einer großen Zahlvon Beobachtungen abgeleiteten Resultate verdienen.Die Regel, die wir soeben angegeben haben, um von denBedingungsgleichungen auf die Schlußgleichungen zu schließen,läuft darauf hinaus, die Summe der Quadrate der Beobachtungsfehlerzu einem Minimum zu machen; denn jedeBedingungsgleichung wird strenge, wenn man in dieselbe aufder rechten Seite die Beobachtung plus ihrem Fehler einsetzt;und zieht man davon den Ausdruck des Fehlers ab,so ist leicht einzusehen, daß die Bedingung des Minimums derQuadratsumme dieser Ausdrücke die in Rede stehende Regelgibt. Diese Regel ist um so genauer, je zahlreicher die Beobachtungensind; aber selbst in dem Falle, wo deren Anzahlklein ist, scheint es natürlich, dieselbe Regel anzuwenden, diein allen Fällen ein einfaches Mittel en die Hand gibt, ohneHerumtappen die gesuchten Korrektionen zu erlangen. Siekann aber auch noch dazu dienen, die Genauigkeit der verschiedenenastronomischen Tabellen eines und desselben Gestirneszu bestimmen. Von diesen Tabellen kann man immerannehmen, daß sie auf die gleiche Form reduziert sind, unddann unterscheiden sie sich nur durch die Zeitepochen, diemittleren Bewegungen und durch die Koeffizienten ihrerArgumente; denn wenn eine von ihnen ein Argument enthält,das sich in den anderen nicht findet, so kommt dies offenbarnur darauf hinaus, den Koeffizienten dieses Argumentes indiesen Tabellen gleich Null zu setzen. Wenn man jetztdiese Tabellen durch die Gesamtheit der guten Beobachtungen5*
60 P. S. de Laplace:richtigstellte, so würden sie der Bedingung genügen, daß dieQuadratsumme der Fehler ein Minimum sei; die Tabellennun, welche, verglichen mit einer beträchtlichen Anzahl vonBeobachtungen, am meisten sich dieser Bedingung niihern,verdienen somit den Vorzug.Die oben dargelegte Methode kann insbesondere in derAstronomie mit Vorteil angewendet werden. Die astronornischenTafeln verdanken die wahrhaft erstaunliche Genauigkeit,die sie erlangt haben, der Genauigkeit der Beobachtungenund der Theorien, sowie der Benutzung der Bedingungsgleichungen,wodurch eine große Zahl ausgezeichneter Beobachtungenzur Verbesserung eines und desselben Elementesbeiträgt. Aber es blieb noch übrig, die Wahrscheinlichkeit derFehler zu bestimmen, welche bei dieser Korrektion noch zubefürchten sind: und das ergibt die eben dargelegte Methode.Um einige interessante Anwendungen davon zu machen, habeich von der ungeheuren Arbeit Nutzen gezogen, die M. Bouvardsoeben über die Bewegungen des Jupiter und des Saturnvollendet, und worüber er sehr genaue Tabellen angefertigthat. Er hat darin mit der größten Sorgfalt die Oppositionenund die Quadraturen dieser beiden Planeten diskutiert, dievon Bradley und den ihm nachfolgenden Astronomen bis aufdiese letzten Jahre beobachtet wurden: er hat daraus aufdie Korrektionen der Elemente ihrer Bewegung und ihrerMassen relativ zur Sonne als Einheit geschlossen. Seine Berechnungenergaben ihm die Masse des Saturns als den3512-ten Seil der Sonnenmasse. Bei der Anwendung meinerWahrscheinlichkeitsformeln auf diese Berechnungen finde ich,daß elftausend gegen eins zu wetten ist, daß der Fehler diesesResultates nicht ein Hundertstel seines Wertes beträgt oder,was fast ganz auf dasselbe hinauskommt, daß nach einemJahrhunderte von neuen Beobachtungen, die zu den früherenhinzugefügt und in derselben Weise diskutiert werden, dasneue Resultat nicht um ein Hundertstel von dem des M.Bouvard verschieden sein wird. Dieser gelehrte Astronomfindet außerdem, daß die Masse des Jupiter dem 1071-tenTeil der Sonnenmasse gleich ist; und man kann, wie ausmeiner Methode der Wahrscheinlichkeit folgt, eine Milliongegen eins wetten, daß das Resultat nicht um den hundertstenTeil gefehlt ist.Diese Methode kann auch auf die geodätischen Mes-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.61Bungen mit Vorteil angewendet werden. Man bestimmtdie Länge eines großen Bogens auf der Erdoberfläche durcheine Kette von Dreiecken, die sich auf eine mit Genauigkeitgemessene Basis stützen. Aber welche Sorgfalt man auchauf die Messungen der Winkel verwenden mag, die unvermeidlichenFehler können durch ihre Häufung bewirken, daßder Wert des Bogens, den man aus einer großen Zahl vonDreiecken erschlossen hat, in merklicher Weise von der Wahrheitabweicht. Man kennt daher diesen Wert nur unvollständig,wenn man nicht die Wahrscheinlichkeit angebenkann, daß sein Fehler in gegebenen Grenzen enthalten ist.Der Fehler eines geodätischen Resultates ist eine Funktionder Fehler der Winkel jedes Dreieckes. Ich habe in dem angeführtenWerke allgemeine Formeln angegeben, um die Wahrscheinlichkeitder Werte einer oder mehrerer linearer Funktioneneiner großen Anzahl von Teilfehlern, deren Wahrscheinlichkeitsgesetzman kennt, zu bestimmen; man kann dannmittels dieser Formeln die Wahrscheinlichkeit bestimmen, daßder Fehler eines geodätischen Resultates in bezeichnetenGrenzen enthalten ist, welches auch das Wahrscheinlichkeitsgesetzder Teilfehler sein mag. Es ist um so notwendiger, sichvon diesem Gesetze unabhängig zu machen, da selbst die einfachstenGesetze immer unendlich wenig wahrscheinlich sind inAnbetracht der unendlichen Zahl derjenigen, die in der Naturexistieren können. Aber das unbekannte Gesetz der Teilfehlerführt in die Formeln eine Unbestimmtheit ein, dienicht gestatten würde, dieselben auf Zahlenwerte zurückzuführen,wenn es nicht gelänge, die Unbestimmtheit zueliminieren. Man hat gesehen, da8 in den astronomischenFragen, wo jede Beobachtung eine Bedingungsgleichungzur Bestimmung der Elemente liefert, diese Unbestimmtheitmittels der Quadratsumme der Reste eliminiert wird, wennman in jeder Gleichung die wahrscheinlichsten Werte derElemente substituiert. Da die geodätischen Fragen keinerleiähnliche Gleichungen darbieten, so muß man nach einemanderen Mittel der Elimination suchen. Der Betrag, umwelchen die Winbelsumme jedes beobachteten Dreieckes zweiRechte plus dem sphärischen Exzeß überschreitet, liefertdieses Mittel. Man setzt nämlich die Quadratsumme dieserGrößen an Stelle der Quadratsumme der Reste der Bedingungsgleichungen;und so kann man die Wahrscheinlich-
keit, daß der Fehler des Schlußresultates einer Reihe vongeodätischen Operationen eine gegebene Größe nicht überschreitet,in Zahlen ausdrücken. Aber welches ist die vorteilhaftesteArt, die beobachtete Fehlersumme auf die dreiWinkel jedes Dreieckes zu verteilen 3 Die Wahrscheinlichkeitsanalysezeigt, daß jeder Winkel um das Drittel dieserBumme vermindert werden muß, damit das Gewicht einesgeodätischen Resultates das größtmögliche ist, was denselbenFehler weniger wahrscheinlich macht. Es ist also von großemVorteile, die drei Winkel jedes Dreieckes zu beobachten undsie auf die soeben angegebene Weise zu korrigieren. Dereinfache gesunde Menschenverstand läßt diesen Vorteilahnen; aber die Wahrscheinlichkeitsrechnung allein kann ihnabschätzen und zeigen, daß er durch diese Korrektur dergrößtmögliche wird.Um ich betreffs der Genauigkeit der Größenbestimmungeines großen Bogens, der mit einem seiner äußersten Endenan eine abgemessene Basis anstößt, Gewißheit zu verschaffen,mißt man eine zweite Basis am anderen Bogenende und beberechnetaus der Messung der einen Basis die Länge deranderen. Wenn diese Länge sehr wenig von der Beobachtungabweicht, so hat man allen Grund zu glauben, daß die Ketteder Dreiecke, welche die eine und andere Basis miteinanderverbindet, ebenso wie der Wert des großen Bogens, der sichdaraus ergibt, fast ganz richtig ist. Man korrigiert sodanndiesen Wert, indem man die Dreieckswinkel in der Art abändert,daß die berechneten Basislängen mit den gemessenenübereinstimmen. Das aber läßt sich auf unendlich viele Artenbewerkstelligen, worunter die den Vorzug verdient, derengeodätisches Resultat das größte Gewicht hat, da dann derselbeFehler weniger wahrscheinlich wird. Die Wahrscheinlichkeitsrechnunggibt Formeln, die direkt die vorteilhaftesteVerbesserung liefern, die sich aus den Messungen von mehrerenBasislängen ergibt, und liefert gleichzeitig die Wahrscheinlichkeitsgesetze,die durch diese Vervielfältigung der Basisentstehen, Gesetze, die infolge dieser Vervielfältigung eineraschere Abnahme aufweisen.Im allgemeinen sind die Fehler der aus einer großenZahl von Beobachtungen abgeleiteten Resultate lineare Funktionender Teilfehler jeder Beobachtung. Die Koeffizientendieser Funktionen hängen von der Natur des Problemes und
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsmchnung. 63dem zur Erlangung der Resultate befolgten Verfahren ab.Das vorteilhafteste Verfahren ist augenscheinlich dasjenige,in welchem ein und derselbe Fehler in den Resultaten wenigerwahrscheinlich ist als zufolge jedes anderen Vorganges. DieAnwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Naturphilosophiebesteht also darin, analytisch die Wahrscheinlichkeitder Werte dieser Funktionen zu bestimmen und die auftretendenunbestimmten Koeffizienten in der Art zu wählen,daß das Gesetz dieser Wahrscheinlichkeit die schnellste Abnahmeaufweist. Eliminiert man hernach aus den Formelnmittels der gegebenen Größen den Faktor, welchen das beinaheimmer unbekannte Wahrscheinlichkeitsgesetz der Teilfehlerhereinbringt, so wird man numerisch die Wahrscheinlichkeitbestimmen können dafür, daß die Fehler der Resultateeine gegebene Größe nicht überschreiten. Auf dieseWeise erreicht man alles, was man betreffs der aus einergroßen Zahl von Beobachtungen abgeleiteten Resultate wünschenkann.Man kann auch noch durch andere Betrachtungen sehrangenäherte Resultate erlangen. Nehmen wir z. B. an,man hatte tausendundeine Beobachtung ein und derselbenGröße: das arithmetische Mittel aller dieser Beobachtungenist das Resultat, welches durch die vorteilhafteste Methodegeliefert wird. Aber man könnte z. B. das Resultat gemäß derBedingung auswählen, daß die Summe seiner Abweichungenvon jedem Beobachtungswert, alle positiv genommen, einMinimum sei. Es scheint in der Tat naturgemäß auch, dasResultat als ein sehr angenähertes zu betrachten, welchesdieser Bedingung genügt. Ordnet man die durch die Beobachtungengegebenen Werte nach ihrer Größe, so sieht man leicht,daß derjenige Wert, der in der Mitte liegt, die obige Bedingungerfüllen wird, und die Rechnung zeigt, daß derselbe indem Falle einer unendlichen Anzahl von Beobachtungen mitder Wahrheit zusammenfallen würde. Aber das durch die vorteilhaftesteMethode gegebene Resultat ist doch vorzuziehen.Man sieht aus dem Vorhergehenden, daß die Wahrscheinlichkeitstheorienichts Willkürliches in der Art der Verwertungder Beobachtungsfehler übrig Iäßt : sie gibt für dieseVerwertung die vorteilhaftesten Formeln, nämlich diejenigen,welche die betreffs der Resultate zu befürchtenden Fehlermöglichst vermindern.
Die Betrachtung der Wahrscheinlichkeiten kann dazudienen, in den Bewegungen der Himmelkörper die kleinenUnregelmäßigkeiten die in den Beobachtungsfehlern verhülltsind, herauszufinden und zur Ursache der beobachtetenAnomalien dieser Bewegungen aufzusteigen. Tychode Brahe erkannte, da er alle seine Beobachtungen miteinanderverglich, die Notwendigkeit, für den Mond eine Zeitgleichunganzuwenden, die von der für die Sonne und diePlaneten verwendeten verschieden ist. Ebenso erkannteMayer aus der Gesamtheit einer großen Zahl von Beobachtungen,daß der Koeffizient der Ijngleichheit für die Priizessiondes Mondes ein wenig vermindert werden muß. Daaber diese Verminderung, obgleich sie von Mason bestätigtund noch vermehrt wurde, nicht von der allgemeinen Schwereherzurühren schien, wurde ~ ie von den meisten Astronomenbei ihren Rechnungen vernachlässigt. Indem ich nun aufeine beträchtliche Zahl von Mondbeobachtungen, die in dieserAbsicht ausgewählt waren, und welche M. Bouvard auf meineBitte diskutierte, die Wahrscheinlichkeitsrechnung anwendete,schien mir diese Verminderung mit einer so großen Wahrscheinlichkeitangezeigt zu werden, daß ich nach der Ursachederselben forschen zu müssen glaubte. Ich sah bald, daßnur die Ellipsenform des Erdspäroides die Ursache davonsein konnte, die bis dahin in der Theorie der Mondbewegungvernachlässigt worden war, als ob sie nur ganz unmerklicheGlieder hervorbringen würde. Daraus schloß ich, daßdiese Glieder durch die aufeinanderfolgenden Integrationender Differenzialgleichungen merklich würden. Ich bestimmtealso diese Glieder durch eine besondere Analyse und entdecktezuerst die Ungleichheit der Mondbewegung nach dergeographischen Breite, die dem Sinus der geographischenLänge des Mondes proportional ist und die noch kein Astronomvermutet hatte. Sodann erkannte ich mittels dieserUngleichheit, daß eine andere in der Mondbewegung nachder geographischen Länge existiert, welche die von Mayerbeobachtete Verminderung in der auf den Mond anwendbarenGleichung der Präzession hervorbringt. Die Größe dieserVerminderung und der Koöffizient der früher erwähntenIjngleichlieit nach der geographischen Länge sind sehr geeignet,die Abplattung der Erde zu bestimmen. Ich hatteHerrn Burg, der sich damals gerade damit beschäftigte,
Anwendungen der Wahr~cheinlichkeitmhnun~. 65die Mondtabellen durch den Vergleich aller guten Beobachtungenzu vervollständigen, meine Vntersuchungen mitgeteiltund bat ihn, mit besonderer Sorgfalt diese zwei Größen zubestimmen. In einer höchst bemerkenswerten Ubereinstimmungergaben die Werte, die er gefunden hat, für die Erde1die nämliche Abplattung - und diese Abplattung weicht306'nur wenig von dem aus den Messungen der Meridiangradeund aus den Pendelmessungen gefolgerten Mittelwerte ab,erscheint mir aber in Anbetracht der Beobachtungsfehlerund der diese Messungen störenden Ursachen durch dieseMondesungleichheiten genauer bestimmt.Es gelang mir weiter, durch Wahrscheinlichkeitsbetrachtungenauch die Ursache der Säkulargleichung des Mondeseu erkennen. Die neuen Beobachtungen dieses Gestirnshatten, verglichen mit den alten Verfinsterungen, den Astronomeneine Beschleunigung in der Mondbewegung angezeigt ;aber die Geometer und namentlich Lagrange verwarfen dieselbe,nachdem sie in den Störungen, die die~e Bewegungerfährt, lange vergebens nach den Gliedern, von denen dieBeschleunigung abhängt, gesucht hatten. Eine aufmerksamePrüfung der alten und neueren Beobachtungen und der vonden Arabern in der Zwischenzeit beobachteten Verfinsterungenließ mich erkennen, daß diese Beschleunigung mit großerWahrscheinlichkeit angezeigt wurde. Ich nahm hierauf dieMondtheorie unter diesem Gesichtspunkt wieder auf underkannte, daß die Säkulargleichung des Mondes von derWirkung der Sonne auf diesen Trabanten herrührt in Verbindungmit der säkularen Veränderung in der Exzentrizitätder Erdbahn; und das führte mich zur Entdeckung derSäkulargleichungen für die Knotenbewegungen und Erdnäheder Mondbahn, Gleichungen, die von den Astronomen nichteinmal vermutet worden waren. Die höchst merkwürdigeOber~instimmun~ dieser Theorie mit allen alten und neuerenBeobachtungen hat dieselbe auf den höchsten Grad derEvidenz gebracht.Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat mich ebenfalls aufdie Ursache der großen Unregelmäßigkeiten des Jupiter undSaturn geführt. Beim Vergleiche der neuen und alten Beobachtungenhatte Halley eine Beschleunigung in der Be-
wegung des Jupiter und eine Verzögerung beim Saturn gefunden.Um nun die Beobachtungen miteinander in Einklangzu bringen, ließ er diese Bewegungen von zwei Säkulargleichungenmit entgegengesetzten Vorzeichen, die wie dieQuadrate der seit 1700 verflossenen Zeit zunehmen, abhängen.Euler und Langrange unterwarfen die Veränderungen,welche die gegenseitige Anziehung der zwei Planetenbei diesen Bewegungen hervorbringen mußte, der Analyse.Sie kamen dabei auf Säkulargleichungen, aber ihre Resultatewaren SO verschieden, daß mindestens eines davon falsch seinmußte. Icb entschloß mich daher, dieses wichtige Problemder Mechanik des Himmels wieder in Angriff zu nehmen underkannte die Unveränderlichkeit der mittleren planetarischenBewegungen, was die von Halley in die Tafeln des Jupiterund Saturn eingeführten Säkulargleichungen verschwindenließ. Somit blieben zur Erklärung der großen Unregelmäßigkeitendieser Planeten nur die Anziehungen der Kometen,zu denen mehrere Astronomen tatsächlich Zufluchtgenommen hatten, oder die Existenz einer Ungleichheit vonlanger Periode, die in den Bewegungen der beiden Planetenin Folge ihrer gegenseitigen Wirkung hervorgebracht wirdund für jede von ihnen mit entgegengesetzten Zeichen bebaftetist. Ein Theorem, das ich über die Ungleichheitendieser Art fand, machte mir diese Ungleichheit sehr wahrscheinlich.Nach diesem Theorem verzögert sich die Bewegungdes Saturn, wenn sich die des Jupiter beschleunigt,was schon mit dem übereinstimmt, was Halley beobachtethatte; überdies steht die Beschleunigung des Jupiter nachdiesem Theorem zur Verzögerung des Saturn fast ganz indem Verhältnisse der von Halley vorgeschlagenen Säkulargleichungen.Bei Betrachtung der mittleren Bewegungendes Jupiter und des Saturn war es mir leicht zu erkennen, da8die doppelte mittlere Bewegung des Jupiter sich nur um einesehr kleine Größe von der fünffachen des Saturn nnterscheidet.Die Periode einer Ungleichheit, welche diese Differenzzum Argumente hätte, wäre ungefähr neun Jahrhunderte.In Wahrheit würde ihr Koeffizient von der Ordnung derdritten Potenzen der Bahnexzentrizitäten sein; aber ichwußte, daß er vermöge der sukzessiven Integrationen zumDivisor das Quadrat des sehr kleinen Multiplikators der Zeitin dem Argumente dieser Ungleichheit erhält, was ihm einen
Anwendungen der Wahrs~heinlichkeitsreohnun~. 67großen Wert geben kann; die Existenz dieser Ungleichheitschien mir also sehr wahrscheinlich. Die folgende Bemerkungvermehrte noch ihre Wahrscheinlichkeit. Indem ichnämlich ihr Argument ungefähr zur Zeit der Beobachtungenvon Tycho de Brahe als Null annahm, sah ich, daß Halleydurch den Vergleich der neueren Beobachtungen mit denalten die Änderungen finden mußte, die er angegeben hatte;während der Vergleich der neueren Beobachtungen untereinanderentgegengesetzte Veränderungen ergeben mußte,die den von Lambert aus diesem Vergleiche gefolgertengleichen. Ich zögerte daher nicht, die lange und mühsameRechnung zu machen, die nötig war, um mich von derExistenz dieser Ungleichheit zu überzeugen. Sie fand durchdas Ergebnis dieser Rechnung ihre volle Bestätigung undich erkannte daraus noch überdies eine große Anzahl andererUngleichheiten, die insgesamt den Tabellen des Jupiter undSaturn die Genauigkeit der Beobachtungen selbst verliehenhaben.Mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung erkannte ichauch noch das merkwürdige Gesetz der mittleren Bewegungender drei ersten Trabanten des Jupiter, demzufolge die mittleregeographische Länge des ersteren, vermindert um das Dreifacheder Länge des zweiten, vermehrt um zweimal die Längedes dritten Trabanten streng gleich dem halben Umfange ist.Die Annäherung, mit der die mittleren Bewegungen dieser Gestirnediesem Gesetze seit ihrer Entdeckung genügen, deutetemit außerordentlicher Wahrscheinlichkeit auf seine Gültigkeit;daher suchte ich nach seiner Ursache in ihrer Wechselwirkung.Die eingehende Prüfung dieser Wirkung zeigtemir nun, daß es genügt, daß die Verhältnisse ihrer mittlerenBewegungen sich ursprünglich diesem Gesetze in gewissenGrenzen genähert hatten, damit ihre gegenseitige Einwirkungdasselbe geschaffen hat und in Kraft hält. Se werden sichdiese drei Weltkörper nach dem obigen Gesetz ewig imRaume das Gleichgewicht halten, sofern nicht fremde Ursachen,wie etwa die Kometen, plötzlich ihre Bewegung umden Jupiter herum verändern.Man sieht daraus, wie sehr man auf die Indikationender Natur achten muß, sobald sie das Resultat einer großenZahl von Beobachtungen sind, wenn sie auch sonst durch diebekannten Mittel sich nicht erklären lassen. Die außer-
ordentliche Schwierigkeit der das Weltsystem betreffendenProbleme hat die Geometer genötigt, zu Annäherungen ihreZuflucht zu nehmen, wobei aber immer die Sorge bleibt, da6die vernachlässigten Größen einen merklichen Einfluß haben.Wenn die Geometer durch die Beobachtungen auf diesenEinfluß aufmerksam gemacht worden waren, dann sind sieauf ihre Analyse zurückgekommen: und bei der Richtigstellunghaben sie stets die Ursache der beobachteten Unregelmäßigkeitengefunden; sie haben die Gesetze derselbenbestimmt und sind oft der Beobachtung zuvorgekommen,indem sie Vngleichheiten entdeckten, welche die Beobachtungnoch gar nicht angezeigt hatte. So kann man sagen, da6die h'atur selbst bei der analytischen Vervollkommnung derauf das Prinzip der allgemeinen Schwere gegründeten Theorienmitgeholfen hat; und das ist, meiner Meinung nach,einer der stärksten Beweise für die Wahrheit dieses bewunderungswurdigenPrinzips.In den eben betrachteten Fällen hat die analytischeLösung der Probleme die Wahrscheinlichkeit der Ursaohen inGewißheit verwandelt. Aber meistens ist diese Lösung unmöglich,und dann bleibt nur übrig, diese Wahrscheinlichkeitmehr und mehr zu vergrößern. lnmitten der zahlreichenund unberechenbaren blodifikationen, welche die Wirksamkeitder Ursachen durch fremde Umstände erfährt, bewahrendiese Ursachen mit den beobachteten Wirkungen doch stetsBeziehungen, die geeignet sind, die Ursachen erkennen zulassen und ihre Existenz zu erweisen. R7enn man dieseBeziehungen bestimmt und mit einer großen Anzahl vonBeobachtungen vergleicht und findet, daß sie denselbenständig genügen, so wird die Wahrscheinlichkeit der Crsachenbis zu dem Grad von Tatsachen anwachsen können,betreffs deren man sich keinen Zweifel erlaubt. Die Erforschungdieser Beziehungen der Crsachen zu ihren Wirkungenist in der Naturphilosophie nicht minder nützlichals die direkte Lösung der Probleme, sei es um die Wirklichkeitdieser Crsachen zu erweisen, oder um die Gesetze ihrerWirkungen zu bestimmen; da diese Methode in einer großenZahl von Fragen angewendet werden kann, wo eine direkteLösung nicht möglich ist, so ersetzt ~ ie dieselbe in der vorteilhaftestenReise. Ich gehe nun daran, die Anwendungendarzulegen, die ich hiervon auf eines der interessantesten
Anwendungen der WahrscheinLichkeitmhn~~. 69Phänomene der Natur, auf die Ebbe und Flut des Meeres,gemacht habe.Plinius, der Naturforscher, hat von diesem Phänomeneine durch ihre Genauigkeit bemerkenswerte Beschreibunggegeben, aus der man sieht, daß die Alten beobachtet hatten,daß Ebbe und Flut eines jeden Monats gegen die Syzygienam größten und gegen die Quadraturen am geringsten sind;daß sie in der Erdnähe des Mondes höher als in der Erdferneund in den Nachtgleichen größer als in der Sonnenwendesind. Sie haben daraus geschlossen, daß dieses Phänomenvon der Wirkung der Sonne und des Mondes auf das Meerherrührt. Kepler gibt in der Vorrede seines Werkes ,,DeStella Martis" zwar ein Streben der Gewässer des Meeresgegen den Mond zu; aber in Unkenntnis des Gesetzes diesesStrebens konnte er über den Gegenstand ein nur wahrscheinlichesAperqu geben. Newton verwandelte die Wahrscheinlichkeitdieses Aperqu in Gewißheit, indem er es mit seinemgroßen Prinzipe der universellen Schwere in Verbindungbrachte. Er gab den genauen Ausdruck der Anziehungskräfte,welche die Ebbe und Flut des Meeres hervorbringen, undnahm, um ihre Wirkungen zu bestimmen, an, daß das Meerin jedem Augenblick die Form des Gleichgewichtes annimmt,die diesen Kräften entspricht. Auf diese Weise erklärte erdie Haupterscheinungen der Ebbe und Flut; aber er wußtedaß nach dieser Theorie in unseren Häfen die beiden Gezeiteneines und desselben Tages sehr ungleich sein müßten, sobaldSonne und Mond eine starke Deklination hätten. In Brestz. B. wäre die abendliche Ebbe und Flut in den Syzygiender Sonnenwenden ungefähr achtmal größer als am Morgen,was den Beobachtungen ganz entgegen ist, die vielmehrdartun, daß die beiden Gezeiten sehr nahe einander gleichsind. Dieses Resultat der Newtonschen Theorie konnte vonder Annahme herrühren, daß das Meer in jedem Augenblickdie Gleichgewichtslage erreicht, eine Annahme, die nichtzulässig ist. Aber die Erforschung der wahren Gestalt derOberfläche des Meeres bot große Schwierigkeiten dar. Unterstütztdurch die Entdeckungen, welche die Geometer in derTheorie der Bewegungen der Flüssigkeiten und im Celcülmit partiellen Differenzen gemacht hatten, unternahm ichdiese Untersuchung, und leitete die partiellen Differenzialgleichungender Bewegung des Meeres unter der Annahme
ab, daß dasselbe die ganze Erde bedecke. Indem ich aufdiese Weise der Natur näher kam, hatte ich die Befriedigungzu sehen, daß sich meine Resultate den Beobachtungennhherten, namentlich betreffs des geringen Unterschieds, derin unseren Häfen zwischen den beiden Gezeiten desselbenTages zur Zeit des Neu- oder Vollmondes existiert. Ichfand, daß sie gleich wären, wenn das Meer überall dieselbeTiefe hätte; und ich fand weiter, daß durch passende Wahlder Tiefenwerte die Höhe der Ebbe und Flut in einem Hafenden Beobachtungen entsprechend vermehrt werden konnte.Aber diese Untersuchungen genügten trotz ihrer Allgemeinheitdurchaus nicht zur Erklärung der großen Unterschiede,die in dieser Hinsicht selbst sehr benachbarte Häfen darbieten,und welche den Einfluß lokaler Umstände beweisen. DieUnmöglichkeit diese Umstände und die Unregelmäßigkeit desMeeresgrundes kennen zu lernen, und ferner die Unmöglichkeit,die darauf bezüglichen partiellen Differenzialgleichungenzu integrieren, nötigten mich, in der früher angegebenenMethode dafür einen Ersatz zu suchen. Ich trachtete alsomöglichst viel Beziehungen zwischen den Kräften, welche diegesamten Moleküle des Meeres erregen, und deren Wirkungen,so weit sie sich in unseren Häfen bobachten ließen, zu bestimmen.Zu diesem Behufe machte ich von dem folgendenPrinzipe Gebrauch, das auf viele andere Phänomene angewendetwerden kann.,,Der Zustand eines Systemes von Körpern, in dem dieursprunglichen Bedingungen der Bewegung durch die Widerstände,welche diese Bewegung erfährt, verschwunden sind,ist periodisch wie die dasselbe belebenden Kräfte."Durch Kombinierung dieses Prinzipes mit dem des Zusammenbestehenssehr kleiner Oszillationen bin ich zu einemAusdrucke für die Höhe von Ebbe und Flut gelangt, dessenwillkürliche Größen die Wirkung der lokalen Umstände jedesHafens in sich schließen und auf die kleinstmögliche Zahlzurückgeführt sind: es handelt sich jetzt nur mehr darum,den Ausdruck mit einer großen Zahl von Beobachtungen zuvergleichen.Auf Einladung der Akademie der Wissenschaften stellteman zu Brest zu Beginn des letzten Jahrhunderts Beobachtungenüber Ebbe und Flut an, die durch die sechs folgendenJahre fortgesetzt wurden. Die Lage dieses Hafens ist für
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 71diese Art Beobachtungen sehr günstig: er steht mit demMeere durch einen Kanal in Verbindung, der an eine weit ausgedehntenReede stößt, in deren Hintergrunde der Hafen gebautist. Die Unregelmäßigkeiten des Meeres gelangen so nursehr geschwächt in diesen Hafen, ähnlich wie die durch unregelmäßigeBewegung eines Schiffes in dem Barometer hervorgebrachtenSchwingungen durch eine an der Rohre diesesInstrumentes angebrachte Verengung geschwächt werden. Da.überdies Ebbe und Flut in Brest beträchtlich sind, machendie zufälligen Veränderungen, die von den Winden verursachtwerden, nur einen geEngen Teil davon aus; auchbemerkt man schon bei geringer Vervielfachung der Beobachtungendieser Gezeiten eine große Regelmäßigkeit, diemich veranlaßte, der Regierung vorzuschlagen, sie möge eineneue Reihe von Beobachtungen der Gezeiten anordnen, diewährend einer Periode der Knotenbewegung der Mondbahnfortgesbtzt werden sollte. Und das geschah auch. DieseBeobachtungen datieien vom 1. Juni des Jahres 1806; undseit dieser Epoche sind sie jeden Tag ohne Unterbrechungangestellt worden. Ich verdanke dem unermüdlichen Eiferdes Herrn Bouvard in allem, was die Astronomie betrifft, dieungeheuren Rechnungen, die der Vergleich meiner Analysemit den Beobachtungen erfordert hat. Er hat hierbei nahezusechstausend Beobachtungen, die während des Jahres 1801und der fünfzehn folgenden Jahre gemacht wurden, verwendet.Es ergibt sich aus diesem Vergleiche, daß meineFormeln mit einer bemerkenswerten Genauigkeit alle Abartender Ebbe und Flut in Bezug auf die Elongation desMondes gegen die Sonne, auf die Deklination dieser Gestirne,ihre Abstände gegen die Erde und auf die Gesetze der Veränderungin der Nähe des Maximums und Minimums einesjeden dieser Elemente darstellen. Die aus dieser Oberein-Stimmung folgende Wahrscheinlichkeit, daß Ebbe und Flutvon der Anziehung der Sonne und des Mondes herrührt,nähert sioh so sehr der Gewißheit, daß sie für keinen vernünftigenZweifel Raum läßt. Sie verwandelt sich aberin Gewißheit, wenn man erwägt, daß diese Anziehung siohvon dem Gesetze der allgemeinen Schwere ableitet, das duichalle Himmelerscheinungen bestätigt ist.Die Wirkung des Mondes auf das Meer ist mehr alsdoppelt so groß als die der Sonne. Kewton und seine Nach-
folger haben bei der Entwicklung dieser mTirkung nur aufdie durch den Kubus der Distanz des Mondes von der Erdedividierten Glieder geachtet, in der Meinung, daß die Wirkungen,die von den folgenden herrühren, unmerklich seinmüßten. Aber die Wahrscheinlichkeitsrechnung zeigt, daßdie kleinsten Wirkungen der regelmäßigen Ursachen sich inden Resultaten einer sehr großen Zahl von Beobachtungenoffenbaren können, wenn diese nur in der hierfür passendstenWeise angeordnet werden. Diese Berechnung bestimmtauch noch ihre Wahrscheinlichkeit und gibt an, wie weit dieBeobachtungen vervielfacht werden müssen, damit die Wahrscheinlichkeitsehr groß wird. Bei der Anwendung auf zahlreichevon Herrn Bouvard erörterte Beobachtungen habe icherkannt, daß in Brest die Wirkung des Mondes auf das Meergrößer bei Vollmond als bei Neumond, und größer ist, wenner am südlichen Himmel, als wenn er am nördlichen Himmelsteht, Erscheinungen, die sich nur aus den Gliedern derMondwirkung ergeben, die durch die vierte Potenz der Entfernungdes Mondes von der Erde dividiert sind.Um bis zum Ozean zu gelangen, durchdringt die Wirkungder Sonne und des Mondes die Atmosphäre, die demnachihren Einfluß erfahren und ähnlichen Bewegungen wie dasMeer unterworfen sein muß. Diese Bewegungen bringenin dem Barometer periodische Schwankungen hervor, dieaber, wie mir die Analyse gezeigt hat, in unserem Klima unmerklichsind. Aber da die lokalen Umstände die Ebbeund Flut in unseren Häfen beträchtlich steigern, so habeich untersucht, ob ähnliche Umstände diese Schwankungendes Barometers merklich gemacht haben. Hierzu habeich von den meteorologischen Beobachtungen, die man seitmehreren Jahren täglich im königlichen Observatorium anstellt,Gebrauch gemacht. Die Barometer- und Thermometerständewerden daselbst um 9 Uhr morgens, mittags, um 3Uhr nachmittags und 11 Uhr nachts beobachtet. HerrBouvard war so gut, die Beobachtungen der 8 Jahre vom1. Oktober 1815 bis 1.Oktober 1823 in seine Register einzutragen.Indem ich nun die Beobachtungen in der passendstenWeise anordnete, um die vom Mond herrührende atmosphärischeFlut in Paris anzuzeigen, finde ich nur den 18tenTeil eines Millimeters für die Größe der betreffenden Barometerschwankung.Hier namentlich macht sich die Not-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.73wendigkeit einer Methode zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiteines Resultates geltend, ohne die man der Gefahrausgesetzt ist, daß man die Wirkungen unregelmäßiger Ursachenals Naturgesetz hinstellt, was in der Meteorologie oftder Fall gewesen ist. Diese Methode zeigt, auf das frühereResultat angewendet, die Unsicherheit desselben trotz dergroßen Zahl der verwendeten Beobaohtungen, die man verzehnfachenmüßte, um ein genügend wahrscheinliches Resultatzu erhalten.Das Prinzip, welches meiner Theorie der Ebbe und Flutzur Grundlage dient, kann auf alle Wirkungen des Zufalls,mit dem sich veränderliche Ursachen nach regelmäßigenGesetzen verbinden, ausgedehnt werden. Die Wirksamkeitdieser Ursachen bringt in den mittleren Resultaten einergroßen Zahl von Wirkungen Verschiedenheiten hervor, diedenselben Gesetzen folgen, und die sich durch die Wahrscheinlichkeitsanalyseerkennen lassen. Je mehr die Wirkungensich vervielfachen, mit desto größerer Wahrscheinlichkeittreten diese Verschiedenheiten zu Tage, und diese Wahrscheinlichkeitwürde in Gewißheit übergehen, wenn die Zahldieser Wirkungen unendlich würde. Dieses Theorem ist demanalog, das ich zuvor über die Wirksamkeit konstanterUrsachen entwickelt habe. Jedesmal also, wenn eine Ursachemit regelmäßigem Gang eine Gattung von Ereignissenzu beeinflussen vermag, können wir versuchen, ihren Einflußdadurch zu erkennen, daß wir die Beobachtungen vervielfachenund in der zu diesem Zwecke passendsten Weiseanordnen. Wenn dieser Einfluß sich zu offenbaren scheint,dann bestimmt die Analysis die Wahrscheinlichkeit seinerExistenz und seiner Intensität. Da die Verschiedenheit derTemperatur bei Tag und bei Nacht den Luftdruck undsomit den Barometerstand verändtirn kann, so liegt derGedanke nahe, daß vervielfachte Beobaohtungen dieser Barometerständeden Einfluß der Sonnenwärme dartun müssen.In der Tat hat man seit langer Zeit am Äquator, wo dieserEinfluß am größten zu sein scheint, eine kleine täglicheSchwankung im Barometerstande erkannt, deren Maximumgegen 9 Uhr morgens und deren Minimum gegen 3 Uhrnachmittags eintritt. Ein zweites Maximum tritt gegen 11Uhr nachts, und das zweite Minimum gegen 4 Uhr morgensein. Die Schwankungen während der Nacht sind geringer
als die während des Tages, deren Betrag ungefähr 2 Millimeterausmacht. Die Unbeständigkeit unserer klimatischenVerhältnisse hat diese Schwankung den Blicken unserer Beobachterdurchaus nicht entzogen, obgleich sie hier wenigermerklich ist als zwischen den Wendekreisen. M. Ramondhat sie erkannt und zu Clermont, dem Hauptorte des DepartementsPuy-de-DGme, durch eine Reihe genauer Beobachtungen,die durch mehrere Jahre hindurch angestelltwurden, bestimmt; er hat sogar gefunden, daß sie währendder Wintermonate kleiner ist als in den übrigen Monaten.Die zahlreichen Beobachtungen, die ich diskutiert habe,um den Einfluß der Anziehung der Sonne und des Mondesauf die Barometerstände in Paris zu erkennen, haben mirzur Feststellung ihres täglichen Ganges gedient. Beim Vergleicheder Barometerstände von 9 Lhr morgens mit denen von3 Uhr nachmittags derselben Tage gibt sich dieser Gang mitsolcher Evidenz kund, daß sein monatlicher Mittelwert fürjeden der 72 Monate, vom 1. Januar 1817 bis 1. Januar 1823,beständig positiv war und sehr nahe 0.8 Millimeter betrug,etwas kleiner als zu Clermont und viel geringer als am Äquator.Ich habe gefunden, daß der Mittelwert der täglichen Veränderungendes Barometers von 9 Uhr morgens bis 3 Uhrnachmittags in den 3 Monaten: November, Dezember undJanuar nur 0.5428 mm war, und daß es auf 1.0553 mm in dendrei folgenden Monaten gestiegen ist, was mit den Beobachtungenvon M. Ramond übereinstimmt. Die anderen Monatehaben nichts Ähnliches gezeigt.Um die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf dieses Phänomenanzuwenden, begann ich mit der Bestimmung des Wahrscheinlichkeitsgesetzesjener Unregelmäßigkeiten im täglichenGang, die dem Zufall zuzuschreiben sind. Bei seinerAnwendung auf die Beobachtungen dieses Phänomensfand ich sodann, daß mehr als 300000 gegen 1 zu wettenist, daß eine regelmäßige Crsache dasselbe hervorbringt.Ich suche keineswegs diese Ursache zu bestimmen, sondernich begnüge mich ihre Existenz festzustellen. Die Periodedes täglichen Ganges, nach dem Sonnentag geregelt, zeigtganz augenscheinlich, daß man diesen Gang der Wirkungder Sonne zuschreiben muß. Das außerordentlich geringeMaß der anziehenden Wirkung der Sonne auf die Atmosphäreist durch das geringe Maß der Wirkungen bewiesen,
Anwendungen der TVahrscheinlichkeitsiec.hilung. 75die von der vereinigten Anziehung der Sonne und des Mondeeherrühren. Die Sonne erzeugt also durch die Wirkung ihrerWarme den täglichen Gang des Barometers; aber es ist unmöglich,die Wirkung dieses Vorgangs auf den Barometerstandund auf die Rinde der Berechnung zu unterziehen.Der tägliche Gang der Magnetnadel ist sicherlich daeErgebnis der Wirkung der Sonne. Aber wirkt dieses Gestirnhier wie bei der täglichen Veränderung des Barometerstandeedurch seine Wärme oder durch den Einfluß auf die Elektrizitätund den Magnetismus, oder endlich durch die Vereinigungdieser Einflüsse? Das wird uns eine lange Reihevon Beobachtungen, die in verschiedenen Ländern anzustellensind, lehren können.Eines der merkwürdigsten Phänomene des Weltsystemsist, daß alle Rotations- und Umlaufsbewegungen der Planetenund Trabanten im Sinne der Sonnenrotation und beinahein der Ebene ihres Äquators vor sich gehen. Ein so merkwürdigesPhänomen ist keineswegs die Wirkung des Zufalls:es weist auf eine allgemeine Ursache hin, die alle diese Bewegungenbestimmt hat. Um die Wahrscheinlichkeit zuerhalten, mit der diese Ursache angezeigt wird, werden wirbeachten, daß das Planetensystem, so wie wir es heute kennen,aus 11 Planeten und 18 Trabanten besteht, sofern manwenigstens mit Herschel dem Planeten Uranus 6 Trabantenzuschreibt. Man kennt die Rotationsbewegungen der Sonne,von sechs Planeten, des Mondes, der Trabanten des Jupiter,des Saturnringes und eines seiner Trabanten. Diese Bewegungenbilden mit den Umlaufbewegungen eine Gesamtheitvon 43 in demselben Sinne gerichteten Bewegungen;nun findet man durch die Wahrscheinlichkeitsanalyse, daßmehr als 4000 Milliarden gegen 1zu wetten ist, daß diese Anordnungnicht die Wirkung des Zufalls sein kann, was einebei weitem größere Wahrscheinlichkeit ergibt, als für historischeEreignisse, denen gegenüber man sich keinerleiZweifel gestattet. Wir müssen also zum mindesten mit demnämlichen Vertrauen glauben, daß eine primitive Ursache diePlanetenbewegungen gelenkt hat, namentlich wenn man inBetracht zieht, da8 die Neigung der meisten dieser Bewegungengegen den Sonnenäquator sehr klein ist.Eine andere, in gleicher Weise bemerkenswerte Erscheinungdes Sonnensystems ist die geringe Exzentrizität der6*
Planeten- und Trabantenbahnen, während die der Kometensehr langgestreckt sind: die Bahnen dieses Systems zeigenkeinerlei mittlere Nuancen zwischen einer großen und einerkleinen Exzentrizität. Wir sind abermals genötigt, hierindie Wirkung einer regelmäßigen Ursache zu erblicken: derZufall hätte den Bahnen aller Planeten und ihrer Trabantenkeineswegs eine fast kreisförmige Gestalt gegeben. Es istalso notwendig, daß die Ursaohe, welche die Bewegungendieser Himmelkörper bestimmte, sie auch fast kreisförmiggemacht hat. Es müssen sich auch die großen Exzentrizitätender Kometenbahnen aus der Existenz dieser Ursacheergeben, ohne daß sie auf die Richtung ihrer Bewegungeneinen Einfluß ausgeübt hätte; denn man findet,daß es fast ebensoviele rücklaufende als vorlaufende Kometengibt, und daß die mittlere Neigung aller ihrer Bahnen gegendie Ekliptik sich sehr stark einem halben rechten Winkelnähert, wie es sein muß, wenn diese Körper aufs Geradewohlgeschleudert wurden.Welches auch die Natur dieser Ursaohe, um die es sichhandelt, sein mag, sie muß, da sie die Bewegungen der Planetenerzeugt oder gelenkt hat, alle diese Körper umfaßthaben, und kann in Anbetracht der sie trennenden Distanzennur ein Fluidum von ungeheuerer Ausdehnung gewesen sein:damit sie ihnen aber eine fast kreisförmige Bewegung um dieSonue geben konnte, muß das Fluidum dieses Gestirn wieeine Atmosphäre umgeben haben. Die Betrachtung der Planetenbewegungenbringt uns also auf den Gedanken, daßvermöge einer außerordentlichen Hitze die Sonnenatmosphäresich ursprünglich über alle Planetenbahnen ausgedehnt unddaß sie sich allmghlig auf ihre gegenwiirtigen Grenzen zusammengezogenhat.In dem ursprünglichen Zustande, in welchem wir unsdie Sonne denken, glich sie den Nebelmassen, die, wie uns dasTeleskop zeigt, zusammengesetzt sind aus einem mehr oderweniger leuchtenden Kern, umgeben von einem Nebel, dersich eines Tages an der Oberfläche des Kernes kondensierenund den Nebel in einen Stern verwandeln'wird. Denkt mansich in analoger Weise alle Sterne gebildet, so kann man sichvorstellen, wie ihrem früheren Nebelzustand selbst wiederandere Zustände vorangegangen sind, in welchen die Nebelmassemehr und mehrausgebreitet, der Kern dagegen immer
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.77weniger leuchtend und weniger dicht war. Geht man addiese Weise so weit als möglich zurück, so gelangt manauf einen so diffusen Nebel, daß man seine Exitenz kaumzu ahnen vermöchte.Das ist in der Tat der Urzustand der Nebelfecken, dieHerschel mit besonderer Sorgfalt mittels seiner mächtigenTeleskope beobachtet und in denen er die Fortschritteihrer Kondensation verfolgt hat, und zwar nicht an einemeinzigen, da diese Fortschritte für uns nur nach Jahrhundertenmerklich werden können, wohl aber an ihrer Gesamtheit, sowie man etwa in einem ausgedehnten Walde das Wachstumder Bäume an den darin befindlichen einzelnen Bäumen vonverschiedenem Alter verfolgen kann. Er hat zuerst die Nebelmassebeobachtet, die in unterschiedlichen Anhäufungen anverschiedenen Gegenden des Himmels ausgebreitet ist, vondem sie einen großen Teil bedeckt. Er sah in einigen dieserHaufen diese Materie schwach kondensiert um einen odermehrere wenig schimmernde Kerne. In anderen Nebelfleckenschimmern diese Kerne heller im Verhältnis zu dem umgebendenh'ebel. Indem die Atmosphären jedes Kernes sichdurch spätere Kondensation trennen, ergeben sich mehrereNebelflecken, die sich aus sehr benachbarten schimmerndenKernen, wovon jeder von einer Atmosphäre umgeben ist,zusammeneetzen: manchmal, wenn die Nebelmasse sich ingleichförmiger Weise zusammenzieht, hat sie Nebelflecke erzeugt,die man planetarische nennt. Endlich verwandeltein größerer Grad von Kondensation alle diese Nebelfleckein Sterne. Die nach diesem philosophischen Gesichtspunkteklassifizierten Nebelflecke zeigen mit einer außerordentlichenWahrscheinlichkeit ihre künftige Verwandlung in Sterne,wie den früheren Nebelzustand der existierenden Sterne an.Die folgenden Betrachtungen dienen zur Unterstützung deraus diesen Analogien abgeleiteten Beweise.Seit langer Zeit schon ist die besondere Anordnungeiniger mit bloßem Auge sichtbaren Sterne philosophischenBeobachtern aufgefallen. Mitschel hat schon die Bemerkunggemacht, wie wenig wahrscheinlich es ist, da8 z. B. dieSterne der Plejaden einzig nur durch Zufall in den engenRaum, der sie einschließt, zu~ammengedrangt worden seien;und er hat daraus den Schluß gezogen, daß diese Sterngruppeund ähnliche Gruppen, die uns der gestirnte Himmel zeigt,
die Wirkung einer primitiven Ursache oder eines allgemeinenNaturgesetzes seien. Diese Gruppen sind ein notwendigesResultat der Kondensation der Nebelmassen an mehrerenKernen; denn es ist klar, daß aus dieser Nebelmasse, dasie von diesen verschiedenen Kernen unablässig angezogenwird, mit der Zeit eine solche den Plejaden ähnliche Sterngruppeentstehen muß. Die Kondensation der Nebelfleckean zwei Kernen bildet in ähnlicher Weise einander sehr " eeniiherteSterne, von denen einer um den andern sich herumbewegt, ähnlich jenen, deren gegenseitige Bewegungen schonvon Herschel beobachtet wurde. Solcher Art sind auch der61. Stern des Schwanes und der folgende, bei denen Besselsoeben Eigenbewegungen erkannt hat, die so bedeutend undund so wenig verschieden sind, daß die geringe Entfernungdieser Gestirne voneinander und ihre Bewegung um ihrengemeinsamen Schwerpunkt nicht bezweifelt werden dürfen.So führt die fortschreidende Kondensierung der Nebelmassezur Betrachtung der einst von einer weiten Atmosphäre urngebenenSonne zurück, eine Betrachtung, zu der man auch,wie man gesehen hat, durch die Prüfung der Erscheinungendes Sonnensystems aufsteigt. Ein so merkwürdiges Zusammentreffengibt der Existenz dieses früheren Zustandesder Sonne eine Wahrscheinlichkeit, die der Gewißheit sehrnahe kommt.Wie aber hat die Sonnenatmosphäre die Rotations- undUmlaufbewegungen der Planeten und Trabanten erzeugt?Wenn diese Körper tief in die Atmosphäre eingedrungenwären, so hätten sie infolge des Widerstandes derselben aufdie Sonne fallen müssen. Man wird daher mit großer Wahrscheinlichkeitzu der Annahme geführt, daß die Planeten anden sukzessiven Grenzen der Sonnenatmosphäre gebildet wordensind, die bei ihrer Zusammenziehung infolge der Abkühlungin der Ebene ihres Aquators Dunstzonen von sichlosgetrennt haben mußte, welche die gegenseitige Anziehungihrer Moleküle in verschiedene Sphäroide verwandelt hat. DieTrabanten sind in gleicher Weise durch die Stmospherenihrer bezüglichen Planeten gebildet worden.Ich habe in meiner Exfiosition du Systt?me dzc modediese Hypothese ausführlich entwickelt, die, wie mir scheint,allen Phänomenen, die uns dieses System darbietet, Genügeleistet. Ich werde mich aber hier auf die Betrachtung be-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.79schränken, daß die Rotationsgeschwindigkeit der Sonnenund Planeten, da sie durch sukzessive Kondensation ihrerAtmosphären an deren Oberflächen sich beschleunigt hat,die Winkelgeschwindigkeit der Umläufe der nächst gelegenenHimmelkörper, die sich um dieselben herumbewegen, übertreffenmuß. In der Tat bestätigt dies die Beobachtunghinsichtlich der Planeten und der Trabanten und selbstin bezug auf den Ring des Saturn, dessen Umlaufsdauer0,438 ist, während die Rotationsdauer des Saturn 0,427eines Tages beträgt.Nach dieser Hypothese sind die Kometen dem Planetensystemfremd. Bringt man ihre Bildung mit der der Nebelfleckenin Verbindung, so kann man sie als kleine Nebelfleckemit Kernen betrachten, die von einem Sonnensystemzum andern irren und durch Kondensation der mit solchemUberfluß im Weltraume verbreiteten Nebelmasse gebildetsind. Die Kometen würden so im Verhältnisse zu unseremSystem das sein, was die Meteore bezüglich unserer Erdesind, der sie fremd scheinen. Wenn diese Gestirne für unssichtbar werden, so zeigen sie eine so vollständige Bhnlichkeitmit den Nebelmassen, daß man sie oft mit ihnen verwechselt;und nur durch ihre Bewegung oder durch die Kenntnissämtlicher Nebelmassen in jenem Teile des Himmels, wo dieKometen sich zeigen, ist man imstande, sie zu unterscheiden.Diese Annahme erklärt in einer glücklichen Weise die großeAusdehnung, welche Kopf und Schweif der Kometen annehmen,je mehr sie sich der Sonne nähern, und die außerordentlicheVerdünnung solcher Schweife, die trotz ihrer ungeheurenTiefenausdehnung den Glanz der Sterne, die mandurch sie hindurch sieht, nicht merklich abschwächen.Sobald kleine Nebelmassen in den Teil des Raumeegelangen, WO die Anziehung der Sonne überwiegt, und denwir die Wirkungssphäre dieses Gestirnes nennen wollen, sozwingt sie dieselben, elliptische oder hyperbolische Bahnen zubeschreiben. Aber da ihre Geschwindigkeit nach allen Richtungengleich möglich ist, so müssen sie sich unterschiedslosin jedem Sinne und unter allen beliebigen Neigungen zurEkliptik bewegen, was mit der Beobachtung übereinstimmt.Die große Exzentrizität der Kometenbahnen ergibt sichgleichfells aus der früheren Hypothese. Wenn nämlich dieseBahnen Ellipsen sind, so sind sie sehr langgestreckt, da ihre
80 P. S. de LapIace:großen Achsen mindestens dem Halbmesser der Wirkungsspäreder Sonne gleich sind. Aber diese Bahnen könnenhyperbolisch sein; und wenn die Achsen dieser Hyperbeln imVergleiche zur mittleren Entfernung der Sonne von der Erdenicht sehr groß sind, so wird die Bewegung der Kometenmerklich hyperbolisch erscheinen. Es scheint jedoch von den100 Kometen, deren Elemente man schon kennt, sich nochkeiner zuverlässig in einer Hyperbel bewegt zu haben; esmüssen daher die Chancen, die eine merkliche Hyperbelgeben, im Vergleich zu den entgegengesetzten Chancen außerordentlichgering sein.Die Kometen sind so klein, daß ihre Periheldistanz,damit sie sichtbar werden, nicht beträchtlich sein darf. Bisjetzt hat diese Distanz nur zweimal den Durchmesser derErdbahn übertroffen, und meist war sie geringer als derRadius dieser Bahn gewesen. Man begreift, daß für einesolche Annäherung an die Sonne ihre Geschwindigkeit imMomente ihres Eintrittes in deren Wirkungssphäre eine Größeund Richtung haben muß, die in engen Grenzen enthaltensind. Indem ich nun durch die Wahrscheinlichkeitsanalysedas Verhältnis der Chancen bestimmte, die innerhalb dieserGrenzen eine merkliche Hyperbel erzeugen, gegenüber denChancen, welche eine Bahn geben, die für eine Parabelangesehen werden könnte, fand ich, daß mindestens 6000gegen 1 zu wetten ist, daß eine Nebelmasse, die in die Wirkungssphäreder Sonne eindringt, so daß sie beobachtetwerden kann, entweder eine sehr gestreckte Ellipse oder eineHyperbel beschreiben wird, die infolge der Länge ihrer Achsein dem beobachteten Teile merklich mit einer Parabel zusammenfallenwird; es ist daher nicht zu verwundern, daßman bis jetzt noch keine hyperbolischen Bewegungen beobachtethat.Die Anziehung der Planeten und vielleicht auch derWiderstand des Äthers haben manche Kometenbahnen inEllipsen verwandeln müssen, deren große Achse kleiner alsder Radius der Wirkungssphäre der Sonne ist, was die Chancender elliptischen Bahnen noch vermehrt. Diese Umwandlungdürfte stattgefunden haben für den Kometen von 1759 undfür den Kometen, dessen Periode nur 1200 Tage beträgtund der unablässig in diesem kurzen Intervalle wieder erscheinenwird, sofern die Verdunstung, die er bei seiner jedes-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.81maligen Rückkehr am Perihel erfährt, ihn nicht am Endeunsichtbar macht.Man kann durch die Wahrscheinlichkeitsanalyse auchnoch die Existenz oder den Einfluß gewisser Ursachen verifizieren,deren Wirkung auf die organisierten Wesen man wahrzunehmenglaubte. Von allen Instrumenten, die wir anwendenkönnen, um die unmerklichen Agentien der Iiatur kennenzu lernen, sind die Nerven die empfindlichsten, namentlichwenn besondere Ursachen ihre Empfindlichkeit steigern. Mitihrer Hilfe hat man die schwache Elektrizität, die der Kontaktzweier verschiedenartiger Metalle hervorruft, entdeckt, wodurchden Physikern und Chemikern ein weites Feld derUntersuchungen eröffnet wurde. Die sonderbaren Erscheinungen,die sich aus der außerordentlichen Empfindlichkeitder Kerven bei einigen Individuen ergeben, haben zu verschiedenenMeinungen über die Existenz eines neuen Agens,welches man animalischen Magnetismus genannt hat, Veranlassunggegeben, ferner uber die Wirkung des gewöhnlichenMagnetiemus, über den Einfluß der Sonne und des Mondesbei einigen Nervenleiden, endlich über den Eindruck, den dieNähe von Metallen oder von fließendem Wasser hervorbringenkann. Es ist natürlich, zu denken, daß die Wirkung dieserGrsachen ehr schwach ist und leicht durch zufällige Umständegestört werden kann; deshalb aber darf man die Existenz,weil sich die Wirkung in einigen Fällen nicht augenscheinlichgezeigt hat, noch nicht verwerfen. Wir sindsoweit davon entfernt, alle Agentien der Iiatur und ihremannigfachen Arten der M'irk~amkeit zu kennen, daß eswenig philosophisch wäre, die Phänomene einzig deshalb zuleugnen, weil sie nach dem gegenwärtigen Zustande unsererKenntnis unerklärlich sind. Eur müeeen wir sie mit um sogewissenhafterer Aufmerksamkeit prüfen, je schwieriger esuns erscheint, sie gelten zu las~en; hier eben wird die Wahrscheinlichkeitsrechnungunerläßlich, um zu bestimmen, biszu welchem Grade die Beobachtungen oder Experimentevervielfältigt werden müe~en, damit man zugun~ten derAgentien, auf die sie hinweisen, eine Rahr~cbeinlichkeit erhält,welche die anderweitigen Grunde für deren Verwerfungüberwiegt.Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ermöglicht, dievor- undKachteile der Methcden abzuschätzen, die in jenen Wissen-
schaften, die es nur mit Mutmaßungen zu tun haben, angewandtwerden. Um beispielsweise die beste der im Gebrauchebefindlichen Behandlungsweisen bei der Heilungeiner Krankheit zu erkennen, genügt es, jede von ihnen beider gleichen Zahl von Kranken zu erproben, wobei alleUmstände vollständig ähnlich zu machen sind: Der Vorzugder vorteilhaftesten Behandlungsweise wird sich dannmehr und mehr kundgeben, je größer diese Zahl wird; unddie Rechnung wird die entsprechende Wahrscheinlichkeit ihresVorteiles sowie die des Verhältnisses, in dem das Verfahrendie anderen übertrifft, erkennen lassen.Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf diemoralischen Wissenschaften.Wir haben eben die Vorteile der Wahrscheinlichkeitsanalysebeim Aufsuchen der Gesetze der Naturerscheinungengesehen, deren Ursachen unbekannt oder zu kompliziertsind, um ihre Wirkungen der Berechnung unterwerfen zulassen. Das ist fast bei allen Gegenständen der moralischenWissenschaften der Fall. So viele unvorhergesehene, oderverborgene, oder nicht abzuschätzende Ursachen beeinflussendie menschlichen Institutionen, daß es unmöglich ist, ihreErgebnisse a priori zu beurteilen. Die Reihe der von derZeit heraufgeführten Ereignisse bringt diese Resultate zurEntwickelung und zeigt die Mittel an, um die schädlichenunter ihnen abzuwenden. Man hat in dieser Hinsicht oftweise Gesetze gemacht; aber da man versäumt hat, dieBeweggründe dafür aufzubewahren, so sind mehrere wiederals nutzlos abgeschafft worden, und es mußten erst unangenehmeErfahrungen das Bedürfnis ihrer Wiederherstellungaufs neue fühlen lassen. Es ist daher sehr wichtig, daß injedem Zweige der öffentlichen Verwaltung ein genaues Registerder Wirkungen geführt werde, welche die verschiedenenengewandten Mittel hervorgebracht haben, und welche ebenso viele von den Regierungen im großen gemachten Erfahrungensind. Wenden wir die auf Beobachtung und Berechnunggegründete Methode, die uns in den NaturwissenschaftenSO gute Dienste geleistet hat, nun auch auf die politischenund moralischen Wissenschaften an. Setzen wir den unvermeidlichenWirkungen des Fortschrittes der Aufklärung keinen
Anwendungen der WahrscheinLichkeitsmhnung. 83nutzlosen und oft gefährlichen Widerstand entgegen; aberwechseln wir nur mit außerordentlicher Behutsamkeit unsereEinrichtungen und Gebräuche, denen wir uns seit langer Zeitangepaßt haben. Wir kennen zwar aus der Erfahrung der Vergangenheitdie ubelstände, die sie mit sich bringen, aber wirkennen das Ausmaß der Ubel nicht, die eine Abänderung derselbenverursachen kann. Bei dieser Unwissenheit schreibt dieWahrscheinlichkeitstheorie vor, jede Veränderung zu unterlassen,namentlich aber plötzliche Änderungen zu vermeiden,die in der moralischen wie physischen Ordnung sich niemalsohne bedeutenden Verlust an lebendiger Kraft vollziehen.Es wurde die Wahrscheinlichkeitsrechnung bereits mitErfolg auf mehrere Gegenstände der moralischen Wissenschaftenangewandt. Ich gehe jetzt daran, die Hauptergebnissedarzulegen.Von der Wahrscheinlichkeit der Zeugenaussagen.Da der größte Teil unserer Urteile auf der Wahrscheinlichkeitvon Zeugenaussagen beruht, so ist es von großerWichtigkeit, dieselbe der Berechnung zu unterwerfen. Daswird freilich oft unmöglich wegen der Schwierigkeit, die Glaubwürdigkeitder Zeugen abzuschätzen, und wegen der großenZahl von Begleitumständen der von ihnen bezeugten Tatsachen.Aber man kann in manchen Fällen Probleme auflösen,die den vorgelegten Fragen sehr analog sind, undderen Lösungen als Annäherungen betrachtet werden können,die geeignet sind, uns zu führen und uns vor Fehlern undGefahren, denen uns ein falsches Raisonnement aussetzt, zuschützen. Eine Annäherung dieser Art ist, wenn sie gutdurchgeführt wird, immer den eingehendsten Raisonnementsvorzuziehen. Versuchen wir also einige allgemeine Regelndafar zu geben, wie man dahin gelangen kann.Man hette eine einzige Nummer aus einer Urne gezogen,die 1000 Nummern enthält. Ein Zeuge dieses Zuges berichtet,daß die Nummer 79 herausgekommen sei; man fragt nachder Wahrscheinlichkeit dieses Zuges. Nehmen wir an, dieErfahrung hätte gelehrt, daß dieser Zeuge einmal unterzehnmal falsch aussagt, so daß die Wahrscheinlichkeit seiner9Zeugenaussage - ist. Hier ist das beobachtete Ereignis die10
Aussage des Zeugen, daß die Nummer 79 herausgekommensei. Dieses Ereignis kann sich aus den zwei folgenden Hypothesenergeben, nämlich: daß der Zeuge wahr aussagt, oderda% er falsch aussagt. Nach dem von uns dargelegten Prinzipeüber die Wahrscheinlichkeit der Ursachen auf Grund der beobachtetenEreignisse, muß man zuerst a priori die Wahrscheinlichkeitdes Ereignisses auf Grund jeder Hypothese be-stimmen. Nach der ersten i~t die Wahrscheinlichkeit, daßder Zeuge die Nummer 79 ankündigen wird, die Wahrschein-1lichkeit des Herauskommens dieser Nummer, nämlich - 1000'Dieselbe muß mit der Wahrscheinlichkeit der ~1aubwiirdi~-9keit des Zeugen multipliziert werden; man wird also -- 10000als Wahrscheinlichkeit des beobachteten Ereigni~ses aufGrund dieser Hypothese haben. Kenn der Zeuge falschaussagt, so ist die Kummer 79 nicht herausgekommen, unddie Wahrscheinlichkeit dieses Falles ist -999Aber um das1000'Herauskommen dieser Kummer anzugeben, muß der Zeugesie unter den 999 nicht herauegekommenen wählen; und daangenommen wird, daß er keinen Grund hat, eine Nummerder anderen vorzuziehen, so ist die Wahrecheinlichkejt, daß1er die Nummer 79 wählen wird, -; multipliziert man nun999die~e Wahrscheinlichkeit mit der früheren, so hat man nach1der zweiten'Hypothese -als Wahraoheinlichkeit, daß der1000Zeuge die Nummer 79 ankündigen wird.Man muß diese1Wahr~cheinlichkeit noch mit der Wahr~cheinlichkeit - der101Hypothese selbst multiplizieren, was -für die Wahr-10000scheinlichkeit des Ereignisses auf Grund die~er Hypothesegibt. Bildet man nun einen Bruch, des~en Zähler die Wahrscheinlichkeitauf Grund der ersten Hypothese, und dessenNenner die Summe der Wahrscheinlichkeiten auf Grund vonbeiden Hypothesen ist, so wird man nach dem ~echsten Prinzipedie Wahrscheinlichkeit der ersten Hypothese erhalten,
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitmechn~n~. $59und diese Wahrscheinlichkeit wird - sein, d. h. gerade10die Glaubwürdigkeit des Zeugen. Zugleich ist das auchdie Wahrscheinlichkeit, daß die Nummer 79 herausgekommenist. Die Wahrscheinlichkeit der falschen Aussage des ZeugenIund des Nichtherauskommens dieser Nummer ist 2. 10Wenn der Zeuge täuschen will und irgend ein Interessehätte, die Nummer 79 unter den nicht herausgekommenenzu wählen, wenn er z. B. meinte, daß die Aussage, sie seiherausgekommen, seinen Kredit vermehren wird, da er aufdiese Nummer einen beträchtlichen Einsatz gemacht hat,dann wird die Wahrsoheinlichkeit, daß er diese Nummer1wählen wird, nicht mehr wie früher - sein, sondern sie9991 1wird dann -, - etc. sein können, je nach dem Interesse,2 3welches er an der Ankündigung ihres Herauskommens haben1 1mag. Nimmt man sie zu - an, so wird man mit diesem9999Bruche die Wahrscheinlichkeit - multiplizieren müssen,1000was man, um auf Grund der Hypothese der falschen Aussagedie Wahrscheinlichkeit des beobachteten Ereignisses zu1erhalten, noch mit - multiplizieren muß; wodurch sich10als Wahrscheinlichkeit des Ereignisses auf Grund der1mzweiten Hypothese ergibt. Dann reduziert sich die w~Fscheinlichkeitder ersten Hypothese oder des Herauskommeneder Nummer 79 nach der früheren Regel auf120'sie istalso infolge der Beriicksichtigung des Interesses, welches derZeuge an der Ankündigung der Nummer 79 haben kann,sehr abgeschwächt. Zwar vermehrt gerade dieses Interesse9die Wahrsoheinlichkeit -, daß der Zeuge die Wahrheit10sagen wird, wenn die Nummer 79 herauskommt. Aber diese
86 P. S. de Laplace:10Wahrscheinlichkeit kann über Eins oder - nicht hinaus-10gehen; so wird also die Wahrscheinlichkeit, daß die Nummer1079 herauskommt, - nicht überschreiten. Der gesunde121Menschenverstand sagt uns schon, daß dieses Interesse Mißtraueneinflößen muß; aber erst die Rechnung ermöglichteine Schätzung dieses Einflusses.Die Wahrscheinlichkeit a priori der von dem Zeugenangegebenen Nummer ist Eins, geteilt durch die Anzahlder Nummern der Urne; sie verwandelt sich auf Grundder Zeugenschaft in die Glaubwürdigkeit des Zeugen selbst;sie kann also durch diese Zeugenschaft verringert werden.1Wenn z. B. die Urne nur zwei Nummern enthält, was - 2für die Wahrscheinlichkeit a priori des Herauskommens derNummer 1gibt, und wenn die Glaubwürdigkeit eines Zeugen,4der es ankündigt, - ist, so wird das Herauskommen da-10durch weniger wahrscheinlich. In der Tat ist klar, daß,wenn der Zeuge mehr Hang zur Lüge als zur Wahrheit hat,sein Zeugnis die Wahrscheinlichkeit der bezeugten Tatsachevermindern muß, so oft diese Wahrscheinlichkeit gleich odergrößer als 1/2 ist. Aber wenn drei Nummern in der Urnesind, dann wird die Wahrscheinlichkeit a priori des Herauskommen~der Nummer 1 durch die Bestätigung einesZeugen, dessen Glaubwürdigkeit größer als i/3 ist, vermehrt.Nehmen wir jetzt an, daß die Urne 999 schwarze Kugelnund eine weiße enthält, und daß nach Ziehung einerKugel ein Zeuge des Zuges aussagt, daß diese Kugel weiß sei.Die apriorische Wahrscheinlichkeit des beobachteten Ereignissesauf Grund der ersten Hypothese wird hier, wie in der9früheren Untersuchung, gleich -sein. Aber nach der10000Hypothese, daß der Zeuge lügt, ist die weiße Kugel nichtherausgekommen, und die Wahrscheinlichkeit dieses Falles999 1ist -- Man muß sie mit der Wahrscheinlichkeit - der1000' 10
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 87Lüge multiplizieren, was -999 für die Wahrscheinlichkeit10000des beobachteten Ereignisses auf Grund der zweiten Hypothesegibt. Diese Wahrscheinlichkeit betrug in der früherenUntersuchung nur --- - Dieser große Unterschied rührt10000 'daher, daß nach Herauskommen einer schwarzen Kugelder Zeuge, der betrügen will, keine Wahl zu treffen hatunter den 999 nicht herausgenommenen Kugeln, um dasHerauskommen einer weißen Kugel anzukündigen. Bildetman jetzt zwei Brüche, deren Zähler die Wahrscheinlichkeitenauf Grund jeder Hypothese sein mögen, und deren gemeinsamerNenner die Summe dieser Wahrscheinlichkeitensei, so erhält man -- als Wahrscheinlichkeit der ersten1008Hypothese und des Herauskommens einer weißen Kugel und-??! als Wahrscheinlichkeit der zweiten Hypothese und des1008Herauskommens einer schwarzen Kugel. Diese letztereHypothese kommt der Gewißheit sehr nahe: sie würde ihr999999noch viel näher kommen und ---- werden, wenn die1000008Urne eine Million Kugeln enthalten würde, wovon eine einzigeweiß wäre, da dann das Herauskommen einer weißenKugel etwas viel Außerordentlicheres wird. Man sieht hieraus,wie die Wahrscheinlichkeit der lügenhaften Aussage um somehr wächst, je außergewöhnlicher die Tatsache wird.Wir haben bisher vorausgesetzt, daß der Zeuge sich nichtirrt; aber wenn man auch noch die Chance seines Irrtumszuläßt, so wird die außerordentliche Tatsache noch unwahrscheinlicher.Man wird dann statt zwei Hypothesen die vierfolgenden haben, nämlich: daß der Zeuge nicht Iügt undsich nicht irrt, daß der Zeuge nicht Iügt und sich irrt, daß derZeuge lügt und sich nicht irrt; endlich, daß der Zeuge lügtund sich irrt. Bestimmt man a priori nach jeder dieserHypothesen die Wahrscheinlichkeit des beobachteten Ereignisses,so findet man mittels des sechsten Prinzips die Wahrscheinlichkeit,daß die bezeugte Tatsache falsch ist, einemBruche gleich, dessen Zähler die Anzahl der schwarzen Kugelnin der Urne ist, multipliziert mit der Summe der Wahr-
88 P. S. de Laplaca:scheinlichkeiten, daß der Zeuge nicht lügt und sich irrt, unddaß er lügt und sich nicht irrt, und dessen Nenner dieserZähler ist, vermehrt um die Summe der Wahrscheinlichkeiten,daß der Zeuge nicht lügt und sich nicht irrt, und daß erlugt und sich zugleich irrt. Man sieht daraus, daß bei sehrgroßer Zahl der schwarzen Kugeln in der Urne, was dasHerauskommen der weißen Kugel zu einem außerordentlichenEreignis macht, die Wahrscheinlichkeit, daß die bezeugteTatsache nicht statthat, sich außerordentlich derGewißheit nähert.Dehnt man diese Folgerung auf alle ungewöhnlichenTatsachen aus, so ergibt sich daraus, daß die Wahrscheinlichkeiteines Irrtums oder einer Lüge des Zeugen um sogrößer wird, je ungewöhnlicher die bezeugte Tatsache ist.Einige Autoren haben das Gegenteil behauptet, indem siesich darauf stutzen, daß der Anblick einer ungewöhnlichenTatsache dem Anblick einer gewöhnlichen Tatsache durchausähnlich sei; daß also die nämlichen Beweggründe unsveranlassen, dem Zeugen gleichen Glauben beizumessen, sobalder die eine oder die andere dieser Tatsachen behauptet.Schon der einfache gesunde Menschenverstand weist jedocheine so seltsame Behauptung zurück, aber die Wahrscheinlichkeitsrechnunggibt, indem sie die Angabe des gemeinenMenschenverstandes bestätigt, auch noch eine Abschätzungder Un<strong>wahrscheinlichkeit</strong> der Zeugnisse über ungewöhnlicheTatsachen.Diese Autoren beharren auf ihrer Ansicht und nehmenan, da6 zwei Zeugen gleich glaubwürdig seien, von denender erste bezeugt, daß er ein Individuum vor 14 Sagen totgesehen habe, während der zweite Zeuge behauptet, dieselbePerson noch gestern bei voller Gesundheit gesehen zu haben.Die eine wie die andere dieser Tatsachen bietet nichts Unwahrscheinliches.Die Auferstehung des Individuums ist eineFolgerung ihres Zusammenbestehens; da aber die Zeugnissesich nicht direkt auf sie beziehen, soll das, was sie Außergewöhnlichesan sich hat, den Glauben, der jenen Zeugnissenzukommt, nicht verringern (Encyclopedie, art. Certitude).Wenn jedoch die Folgerung, die sich aus der Gesamtheitder Zeugnisse ergibt, unmöglich wäre, so müßte eines vonihnen notwendig falsch sein; nun ist aber eine unmöglicheFolgerung die Grenze der ungewöhnlichen Folgerungen, wie
--Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 89der Irrtum die Grenze des Unwahrscheinlichen ist; derWert der Zeugnisse, welcher im Falle einer unmöglichenFolgerung Null wird, muß also in dem Falle einer ungewöhnlichen~dgerung sehr verringert werden. Das wird in derTat durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung bestätigt.Um das zu zeigen, wollen wir zwei Urnen A und B betrachten,deren erste eine Million weißer Kugeln, und derenzweite eine Million schwarzer Kugeln enthält. Man ziehtaus der einen dieser Urnen eine Kugel, legt sie in die andereUrne und zieht sodann aus dieser eine ~ u~el. Zwei Zeugen,und zwar der eine für den ersten Zug, der andere für denzweiten, bezeugen, daß die Kugel, deren Ziehung sie gesehenhaben, weiß sei, ohne jedoch die Urne anzugeben, aus welchersie gezogen worden ist. Jedes Zeugnis für sich genommenhat nichts Unwahrscheinliches; und es ist leicht zu sehen,daß die Wahrscheinlichkeit der bezeugten Tatsache geradegleich der Glaubwürdigkeit des Zeugen ist. Aber es folgtaus dem Zusammenbestehen beider Zeugnisse, daß eine weißeKugel aus der Urne A beim ersten Zuge gezogen wurde unddaß sie sodann, in die Urne B gelegt, beim zweiten Zugewieder erschien, was ganz außergewöhnlich ist; denn dadiese zweite Urne dann eine weiße Kugel auf eine Millionschwarzer Kugeln enthalt, so ist die Wahrscheinlichkeit,1daraus die weiße Kugel zu ziehen,Um die Ver-1000001'ringerung zu bestimmen, welche die Wahrscheinlichkeit derdurch zwei Zeugen ausgesagten Tatsache aus diesem Umstandeerleidet, müssen wir beachten, daß das beobachteteEreignis hier die Behauptung eines jeden von ihnen ist,daß die Kugel, deren Ziehung er gesehen hat, weiß sei. Stellen9 .wir durch den Bruch die Wahrscheinlichkeit dar, daß er10die Wahrheit aussagt, was in dem gegenwärtigen Falle stattfindenkann, falls der Zeuge nicht lügt und sich nicht irrt,und falls er lügt und sich zugleich irrt. Es lassen sich nundie folgenden vier Hypothesen bilden:1. Der erste und zweite Zeuge sagen die Wahrheit aus.Dann ist zuerst eine weiße Kugel aus der Urne A gezogen1worden, und die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist -, 2
da die beim ersten Zuge herausgezogene Kugel in gleicherWeise aus der einen wie aus der anderen Urne herausgekommensein konnte. Sodann ist die herausgezogene ~ugel, nachdemsie in die Urne B gelegt wurde, beim zweiten Zugewiederaufgetaucht: die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses1ist --. die Wahrscheinlichkeit der ausgesagten Tatsache1000001 'ist also ---- Multipliziert man sie mit dem Produkte der2 000002'9 9Wahrscheinlichkeiten - und -, daß die Zeugen die Wahr-10 10heit sagen, so wird manals Wahrscheinlichkeit des200000 200beobachteten Ereignisses auf Grund der ersten Hypothesehaben.2. Der erste Zeuge sagt die R'ahrheit und der zweitenicht, sei es, daß er lügt und sich nicht irrt, oder daß ernicht lügt und sich irrt. Dann ist eine weiße Kugel beimersten Zuge aus der Urne A herausgekommen, und die Wahr-1scheinlichkeit dieses Ereignisses ist -. Nachdem hierauf2diese Kugel in die Urne B gelegt wurde, ist eine schwarzeKugel herausgezogen worden. Die Wahrscheinlichkeit dieses1000000Zuges ist -- man hat also ----- 000000 als Wahrsohein-1000001' 2000002lichkeit des zusammengesetzten Ereignisses. Multipliziert man9sie mit dem Produkte der beiden Wahrscheinlichkeiten - 101und -, daß der erste Zeuge wahr und der zweite nicht wahr10aussagt, so wird man 9000000 als Wahrscheinlichkeit des200000200beobachteten Ereignisses auf Grund der zweiten Hypothesehaben.3. Der erste Zeuge sagt nicht wahr aus und der zweitesagt wahr aus. Dann ist eine schwarze Kugel aus der UrneB beim ersten Zuge herausgekommen, und nachdem sie indie Urne A gelegt worden ist, ist eine weiße Kugel aus dieserUrne gezogen worden. Die Wahrscheinlichkeit des ersten
- -Anwendungen der Wahra~heinlichkeitmechnun~. 911 1000000dieser Ereignisse ist - und die des zweiten ist ---;2 1000001die Wahrscheinlichkeit des zusammengesetzten Ereignisses istlooooooalso --- Multipliziert man sie mit dem Produkte der2000002'1 9Wahrscheinlichkeiten - und -, daß der erste Zeuge die10 10Wahrheit nicht sagt, und daß der zweite sie sagt, so wirdman 9000000 als Wahrscheinlichkeit des beobachteten Er-200000 203eignisses auf Grund dieser Hypothese haben.4. Keiner der Zeugen sagt die Wahrheit. Dann ist eineschwarze Kugel aus der Urne B beim ersten Zug gezogenworden; nachdem sie sodann in die Urne A gelegt worden,ist sie beim zweiten Zug wieder herausgekommen. Die Wahrscheinlichkeitdieses zusammengesetzten Ereignisses istI J.-- Multipliziert man sie mit dem Produkte der2 000002'1 1Wahrscheinlichkeiten - und -, daß keiner der Zeugen die10 101Wahrheit sagt, so wird man -als Wahrscheinlichkeit200000200des beobachteten Ereignisses auf Grund dieser Hypothesehaben.Um jetzt die Wahrscheinlichkeit der durch die zweiZeugen ausgesagten Sache, nämlich, daß eine weiße Kugelbei jedem der Züge herau~gezogen worden sei, zu erhalten,muß man die der ersten Hypothese entsprechende Wahrscheinlichkeitdurch die Summe der auf die vier Hypothesenbezüglichen MTahrscheinlichkeiten dividieren ; und dann erhiiltman für diese Wahrscheinlichkeit den außerordentlich kleinen81Bruch 18000082'Wenn von den beiden Zeugen der erste behaupten würde,daß eine weiße Kugel aus einer der zwei Urnen A und Bgezogen worden sei, der andere, daß in gleicher Weise eineweiße Kugel aus einer der beiden Urnen A' und B', dieden ersten durchaus ähnlich sind, gezogen worden sei, sowürde die Wahrscheinlichkeit der durch die beiden Zeugen7 *
ausgesagten Sache das Produkt der Wahrscheinlichkeiten81ihrer Zeugenschaften oder -sein; sie wäre also mindestens100180000 Mal größer als die frühere.Man sieht daraus, wie sehr im ersten Falle das Wiedererscheinender beim ersten Zuge herausgezogenen weißenKugel beim zweiten Zuge, eine außergewöhnliche Folge derbeiden Zeugenaussagen, den Wert derselben verringert.Wir würden dem Zeugnisse eines Menschen, der uns bezeugte,daß von hundert in die Luft geworfenen Würfeln alleauf dieselbe Seite herabgefallen seien. keinen Glauben beimessen.Wenn wir selbst Zeugen dieses Ereignisses gewesenwären, so würden wir unseren eigenen Augen nicht glauben,bis wir gewissenhaft alle Umstände geprüft und andere zuAugenzeugen gemacht hätten, um sicher zu sein, daß wedereine Sinnestäuschung noch irgend ein Blendwerk stattgefundenhabe. Aber nach dieser Prüfung würden wir nichtlänger zögern, dasselbe trotz seiner außerordentlichen Un<strong>wahrscheinlichkeit</strong>zuzugeben; und niemand würde daraufverfallen, zur Erklärung deqselben einen Umsturz der Gesetzedes Sehens anzunehmen. Wir müssen daraus schließen, da5die Wahrscheinlichkeit der Beständigkeit der Naturgesetze füruns größer ist als die Wahrscheinlichkeit, daß das Ereignis,um das es sich handelt, nicht statthaben soll, eine Wahrscheinlichkeit,die selbst wieder die der meisten historischenTatsachen, die wir für unanfechtbar halten, übertrifft. Mankann sich daraus ein Urteil bilden über das ungeheuere Gewichtder Zeugenaussagen, das notwendig ist, um eine Aufhebungder Naturgesetze zuzulassen, und wie irrig es wäre,auf diesen Fall die gewöhnlichen Regeln der Kritik anzuwenden.Alle diejenigen, welche, ohne dieses ungeheuereMaß von Zeugenschaften zu bieten, das, was sie behaupten,mit Erzählungen von Ereignissen stützen, die diesen Gesetzenwidersprechen, schwächen eher den Glauben, den sie einzuflößenbemüht sind, als sie ihn vermehren; denn es machendann diese Berichte den Irrtum oder die absichtliche Irreführungvon Seiten ihrer Gewährsmänner sehr wahrscheinlich.Aber das, was den Glauben der aufgeklärten Leute verringert,vermehrt gar oft den der Menge, die stets nachWundern gierig ist.
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.93Es gibt Dinge, die so außergewöhnlich sind, da6 nichtsihre Un<strong>wahrscheinlichkeit</strong> aufwiegen kann. Aber diese kanndurch die Wirkung einer herrschenden Meinung so abgeschwächtwerden, daß sie geringer erscheint als die Wahrscheinlichkeitder Zeugenaussagen; und wenn diese Meinungwechselt, so liefert eine absurde Erzählung, die in demJahrhunderte ihrer Enstehung einstimmig geglaubt wordenwar, für die folgenden Jahrhunderte nur einen neuen Beweisvon dem außerordentlichen Einflusse, den die allgemeineMeinung selbst auf die besten Geister ausübt. Zwei großeMänner aus dem Jahrhunderte Ludwig XIV., Racine undPascal sind schlagende Beispiele hierfiir. Es ist betrübendzu sehen, mit welchem Behagen Racine, dieeer bewunderungswürdigeMaler des menschlichen Herzens und der vollendetsteDichter, den es je gegeben hat, die Genesung der jungenPerrier, Nichte Pascals und Zöglings der Abtei von Port-Royal, als ein Wunder darstellt; es macht einen peinlichenEindruck, wenn man die Beweisführung liest, durch diePascal darzutun sucht, daß dieses Wunder für die Religionnotwendig geworden war, um die Lehre der Nonnen dieserAbtei, die damals von den Jesuiten verfolgt wurden, zu rechtfertigen.Die junge Perrier litt seit 3% Jahren an einerAugenfistel: sie berührte mit ihrem kranken Auge eineReliquie, die man für einen Dorn aus der Krone des Erlösersausgab, und glaubte sich im Augenblicke geheilt. EinigeTage nachher konstatierten die Ärzte und Chirurgen dieHeilung und urteilten, daß die Natur und die Heilmittelkeinen Anteil daran gehabt hätten. Dieses Ereignis, dassich 1656 zutrug, hatte in Paris großes Aufsehen erregt,und ,,ganz Paris", wie Racine sagt, „begab sich nach Port-Royal. Die Menge wuchs von Tag zu Tag, und Gott selbstschien Wohlgefallen daran zu haben, die Andacht der Völkerdurch die Menge der Wunder, die in dieser Kirche geschahen,gut zu heißen." Zu dieser Zeit schienen Wunder und Zaubereiennoch nicht unwahrscheinlich, und man zögerte nicht,ihnen die Besonderheiten der Natur zuzuschreiben, die mananders nicht erklären konnte.Diese Art, die außerordentlichen Wirkungen zu betrachten,findet sich in den bemerkenswertesten Werken des Jahrhundertsvon Ludwig XIV., sogar in dem ,,Versuch überden menschlichen Verstand" des weisen Locke, der bei Be-
sprechung der Grade der Zustimmung sagt: ,,Obgleich dieallgemeine Erfahrung und der gewöhnliche Lauf der Dingemit Recht einen großen Einfluß auf den Geist des Menschenhaben, so daß sie einer Sache, die ihnen zu glauben vorgelegtwird, ihre Zustimmung geben oder verweigern, so gibt esdoch einen Fall, wo das Sonderbare einer Tatsache die Zustimmunggar nicht abschwächt, die wir der aufrichtigenZeugenaussage, auf die sie gegründet ist, schenken sollen.Sobald nämlich übernatürliche Ereignisse im Einklange mitden Zielen desjenigen sind, der die Macht besitzt, den Laufder Natur ZU ändern, dann und unter solchen Umständenkönnen sie um so eher in unserem Geiste Glauben finden,je höher sie über den gewöhnlichen Beobachtungen stehenoder diesen sogar entgegen sind." Da die wahren Prinzipiender Wahrscheinlichkeit der Zeugenaussagen in solcher Artvon den Philosophen, denen die Vernunft hauptsächlich ihreFortschritte verdankt, verkannt worden sind, so habe ichgeglaubt, die Ergebnisse der Rechnung über diesen wichtigenGegenstand eingehend darlegen zu müssen.Hier bietet sich naturgemäß die Gelegenheit zur Besprechungeines berühmten Argumentes von Pascal, welchesCraig, ein englischer Mathematiker, in geometrischer Formwiedergegeben hat. Zeugen sagen aus, die Gottheit selberhabe ihnen mitgeteilt, daß man durch Unterwerfung unterdiese oder jene Sache nicht ein oder zwei, sondern eine unendlicheZahl glücklicher Leben genießen werde. Wie geringauch die Wahrscheinlichkeit der Zeugnisse sein mag, wenn sienur nicht unendlich klein ist, so ist klar, da5 der Vorteiljener, die sich der vorgeschriebenen Sache unterwerfen, unendlichist, da derselbe das Produkt dieser Wahrscheinliohkeitmit einem unendlichen Gut ist; man soll als keineswegszögern, sich diesen Vorteil zu verschaffen.Dieses Argument beruht auf der unendlichen Anzahl derim Namen der Gottheit durch die Zeugen verheißenen glücklichenLeben; man müßte also das, was sie vorschreiben,gerade deshalb tun, weil sie ihre Verheißungen über alleGrenzen hinaus übertreiben, eine Folgerung, die dem gesundenMenschenverstand widerspricht. Auch lehrt uns dieRechnung, daB gerade diese ubertreibung die Wahrscheinlichkeitihrer Zeugenschaft so weit verringert, daß sie unendlichklein oder zu null gemacht wird. In der Tat kommt dieser
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung.95Fall darauf hinaus, daß ein Zeuge das Herauskommen derhöchsten Nummer aus einer Urne ankündigt, die mit einergroßen Zahl von Nummern angefüllt ist, wovon eine einzigeherausgezogen wurde und daß dieser Zeuge ein großes Interessedaran hätte, das Herauskommen dieser Nummer anzukündigen.Man hat früher gesehen, wie sehr dieses Interesseseine Zeugenaussage abschwächt. Setzt man die Wahrscheinlichkeit,daß der Zeuge, wenn er lügt, die größte Zahl1wählen wird, nur gleich --, so ergibt die Rechnung, daß die2-Wahrscheinlichkeit seiner Aussage kleiner ist als ein Bruch,dessen Zähler die Einheit, und dessen Nenner die Summeist aus der Einheit vermehrt um die Hälfte des Produktesder Zahl der Nummern mit der Wahrscheinlichkeit der falschenAussage, wenn dieselbe a priori oder unabhängig vonder Aussage betrachtet wird. Um diesen Fall dem desArgumentes von Pascal gleich zu machen, genügt es, daß mandurch die Nummern der Urne alle möglichen Zahlen derglücklichen Leben darstellte, was die Anzahl dieser Nummernunendlich groß macht, und zu beachten, daß die Zeugen,wenn sie lügen, ein großes Interesse daran haben zur Beglaubigungihrer falschen Aussage eine Ewigkeit von Glückzu versprechen. Der Ausdruck der Wahrscheinlichkeit ihrerZeugenaussage wird dann unendlich klein. Multipliziertman sie mit der unendlichen Zahl der verheißenen glücklichenLeben, so verschwindet die Unendlichkeit des Produktes,welches den aus diesem Versprechen sich ergebendenVorteil ausdrückt, was das Argument von Pascal zunichtemacht.Betrachten wir jetzt die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffensmehrerer Zeugenaussagen über eine bestimmteTatsache. Um die Gedanken zu fixieren, nehmenwir an, diese Tatsache bestehe in dem Herauskommen einerNummer aus einer Urne, welche deren hundert enthält, undwovon man eine einzige Nummer herauszieht. Zwei Zeugendieses Zuges sagen aus, daß die Nummer 2 herausgekommensei, und man fragt nach der Wahrscheinlichkeit, die sich ausdem Zusammenbestehen dieser Zeugenaussagen ergibt. Mankann die beiden folgenden Hypothesen bilden: Die Zeugensagen die Wahrheit, die Zeugen lügen. Nach der erstenRypothese ist die Nummer 2 herausgekommen, und die Wahr-
1scheinlichkeit dieses Ereignisses ist - Man muß sie mit100'dem Produkte der Glaubwürdigkeiten der Zeugen multipli-9 7zieren, die wir mit -und -voraussetzen wollen: somit wird10 10man -- 63 als Wahrscheinlichkeit des beobachteten Ereig-10000nisses auf Grund dieser Hypothese haben. Nach der zweitenHypothese ist die um&& 2 nicht herausgekommen, und99die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist -. Aber die100Oberein~timmun~ aller Zeugen verlangt sodann, daß sie allebeide, um irrezuführen, die Nummer 2 unter den 99 nichtherausgekommenen Nummern wählten: die R7ahrscheinlichkeitdieser Wahl ist, wenn die Zeugen nicht im Einverständ-nisse sind, das Produkt des Bruches - 1 mit sich selbst; man99muß sodann diese beiden Wahrscheinlichkeiten miteinander1und mit dem Produkte der Wahrscheinlichkeiten - und103- daß die Zeugen falsch aussagen, multiplizieren; so wird10'man --- I als Wahrscheinlichkeit des beobaohteten Ereig-330000 nisses auf Grund der zweiten Hypothese haben. Jetzt wirdman die Wahrscheinlichkeit der bezeugten Tatsache oderdes Herauskommens der Nummer 2 erhalten, indem man dieauf die erste Hypothese bezügliche Wahrscheinlichkeit durchdie Summe der auf beide Hypothesen bezüglichen Wahrscheinlichkeitendividiert ; diese Wahrscheinlichkeit wird also-2079 sein, und die Wahrscheinlichkeit des Nichthersuskom-2080mens dieser Nummer und die der lügenhaften Aussage der1Zeugen wird -2080 sein.Wenn die Urne nur die Nummern 1und 2 enthielte, so21wurde man auf dieselbe Weise - als Wahrscheinlichkeit des22
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitm~hnun~. 97Herauskommens der Nummer 2 finden und folglich - 1 als22 --Wahrscheinlichkeit der falschen Aussage der Zeugen, eineWahrscheinlichkeit, die wenigstens 94mal größer ist als diefrühere. Man sieht daraus, wie sehr die Wahrscheinlichkeitder lügenhaften Aussage der Zeugen abnimmt, wenn dieTatsache, die sie bezeugen, an sich weniger wahrscheinlich ist.In der Tat, man begreift, daß dann die Uberein~timrnun~der Zeugen, wenn sie lügen, viel schwieriger wird, wenigstemsofern sie sich nicht verständigen, was wir hier nicht annehmen.In dem anderen Falle, wo die Urne nur 2 Nummernenthält, ist die Wahrscheinlichkeit a priori der bezeugten1Tatsache -, die Wahrscheinlichkeit, die sich aus den Zeugen-2aussagen ergibt, ist das Produkt der Glaubwürdigkeiten derZeugen, dividiert durch die Summe aus diesem Produkteund dem der Wahrscheinlichkeiten ihrer Lügenhaftigkeit.Es bleibt uns noch übrig, den Einfluß der Zeit auf dieWahrscheinlichkeit der Tatsachen zu betrachten, die unsdurch eine durch Tradition fortgepflanzte Kette von Zeugenüberliefert wurden. Es ist klar, daß diese Wahrscheinlichkeitin dem Maße abnehmen muß, als die Kette sich verlängert.Wenn die Tatsache an sich gar keine Wahrscheinlichkeit hat,etwa wie das Herauskommen einer Nummer aus einer Urne,die eine unendliche Anzahl derselben enthält, so nimmt dieWahrscheinlichkeit, die sie durch die Zeugenaussagen erlangt,dem fortlaufenden Produkte der Glaubwürdigkeit der Zeugengemäß ab. Wenn die Tatsache an sich eine Wahrscheinlichkeitbesitzt, wenn diese Tatsache z. B. darin besteht, daßdie Nummer 2 aus einer Urne herauskommt, die eine endlicheAnzahl derselben enthält, und wovon feststeht, daß nureine einzige Nummer herau~gezogen wurde, dann nimmt das,was die Kette der uberlieferung zu dieser Wahrscheinlichkeithinzufügt, einem fortlaufenden Produkte gemäß ab, dessenerster Faktor das Verhältnis der Anzahl der Nummern derUrne weniger eins zu dieser Zahl selbst ist, während jederandere Faktor die Glaubwürdigkeit jedes Zeugen vermindertum das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit seiner Lüge zuder um eins verminderten Anzahl der Nummern in der
Urne ist; so daß in der Grenze die Wahrscheinlichkeit derTatsache in die Wahrscheinlichkeit der a priori oder unabhängigvon den Zeugenaussagen betrachteten Tatsache,nämlich in den Bruch: Eins dividiert durch die Anzahl derNummern in der Urne, übergeht.Die Wirkung der Zeit schwächt also unablässig die Wahrscheinlichkeitder historischen Tatsachen ab, so wie siedie dauerhaftesten Denkmale entstellt. Diese Wirkung kannman wohl durch Vervielfältigung und Bewahrung der Zeugenschaftenund Denkmale, die zu ihrer Stütze dienen, abschwächen.Die Buchdruckerkunst bietet für diesen Zweck eingevichtiges Mittel, das leider den Alten unbekannt war.Aber trotz der unendlichen Vorteile, die sie hervorbringt,werden doch die physischen und moralischen Umwälzungen,von denen die Oberfläche dieser Erdkugel immer erschüttertwerden wird, schließlich im Verein mit der unvermeidlichenWirkung der Zeit nach Tausenden von Jahren die historischenTatsachen, die heutzutage die zuverlässigsten sind, zweifelhaftmachen.Craig hat versucht die allmähliche Abschwächung der Beweiseder christlichen Religion der Berechnung zu unterwerfen;indem er annahm, daß die Welt dann zugrunde gehen müßte,wenn die christliche Religion aufhören werde wahrscheinlichzu sein, findet er, daß dies 1454 Jahre nach dem Zeitpunkts,da er schrieb, eintreten würde. Aber seine Analyse istebenso fehlerhaft, als seine Voraussetzung über die Dauerder Welt absonderlich ist.uber die Wahlen und Beschlüsse der Versammlungen.Die Wahrscheinlichkeit der Entscheidungen einer Versammlunghängt von der Mehrheit der Stimmen, sowie vonder Aufklärung und Unparteilichkeit der sie zusammensetzendenMitglieder ab. So viele Leidenschaften und besondereInteressen mengen so oft ihren Einfluß hinein, daß esunmöglich ist, diese Wahrscheinlichkeit der Berechnung zuunterwerfen. Es gibt jedoch einige allgemeine Ergebnisse, dieschon vom einfachen.gesunden Menschenverstand eingegebenwerden und welche die Rechnung bestätigt. Wenn z. B. dieVersammlung sehr wenig über den ihrer Entscheidung vorgelegtenGegenstand aufgeklärt ist ;wenn dieser Gegenstand feine
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 99Oberlegungen erfordert, oder wenn die Wahrheit über diesenPunkt den angenommenen Vorurteilen entgegen ist, so zwar,daß es mehr als 1gegen i zu wetten ist, daß jeder Votant davonabweichen wird; dann wird die Entscheidung der Majoritätwahrscheinlich schlecht ausfallen, und die Befürchtung indieser Hinsicht wird um so mehr begründet sein, je zahlreicherdie Versammlung ist. Es liegt daher im Interesse derallgemeinen Wohlfahrt, daß Versammlungen nur über Gegenständezu entscheiden haben, die von der Mehrzahl verstandenwerden können; es liegt im öffentlichen Interesse, daß derUnterricht allgemein verbreitet sei, und daß gute, auf Vernunftund Erfahrung gegründete Bücher diejenigen, welche über dasSchicksal ihres Gleichen zu entscheiden oder sie zu regierenberufen sind, erleuchten und sie im vorhinein gegen die falschenGesichtspunkte und Vorurteile der Unwissenheit sichern.Die Gelehrten haben häufig Gelegenheit zu bemerken, daßder erste Anschein oft täuscht und daß das Wßhre nichtimmer wahrscheinlich ist.Es ist schwierig, die Stimme einer Versemmlung inmittender Verschiedenheit der Meinungen ihrer Mitglieder zu erkennenoder auch nur zu definieren. Versuchen wir dafüreinige Regeln zu geben, indem wir die beiden gewöhnlichstenFälle betrachten, nämlich die Wahl unter mehreren Kandidatenund die Wahl, die unter mehreren Anträgen in bezugauf denselben Gegenstand zu treffen ist.Wenn eine Versammlung unter mehreren Kandidaten,die sich um eine oder mehrere Stellen derselben Art bewerben,die Wahl zu treffen hat, so scheint es am einfachsten, daßman jeden Votanten auf einen Zettel die Namen aller Kandidatennach der Reihe des Verdienstes, welches er ihnen zuteilt,schreiben läßt. Nimmt man m, daß er sie nach bestemGlauben in Klassen einteilt, so wird man aus dem Einblickin diese Zettel ersehen, in welcher Weise die Kandidatenunter sich verglichen wurden, so zwar, daß neue Wahlenin dieser Hinsicht nichts weiter lehren können. Es handeltsich jetzt darum, auf die Ordnung der Bevorzugung, welchedie Stimmzettel unter den Kandidaten aufstellen, zu schließen.Denken wir uns, daß man jedem Wähler eine Urne gibt,welche eine unendliche Anzahl von Kugeln enthält, mittelsderen er alle Grade des Verdienstes der Kandidaten abstufenkann; denken wir uns weiter, daß er aus seiner Urne
eine Anzahl Kugeln, die dem Verdienste jedes Kandidatenproportional ist, herauszieht, und nehmen wir an, daß erdiese Zahl auf einen Zettel neben den Namen des Kandidatenschreibt. Es ist klar, daß, wenn man die Summe aus allenZahlen bezüglich aller Kandidaten auf jedem Zettel bildet,derjenige von allen Kandidaten, welcher die größte Summehat, von der Versammlung als bevorzugt erscheint, unddaß im allgemeinen die Ordnung, wonach die Kandidatenvorgezogen werden, gleich der Ordnung der Summen bezüglichjedes von ihnen sein wird. Aber die Stimmzettelbezeichnen nicht die Zahl der Kugeln, die jeder Wähler denKandidaten gibt: sie zeigen bloß an, daß der erste mehrKugeln hat als der zweite, der zweite mehr als der dritte undso fort. Nimmt man also für den ersten Kandidaten aufeinem gegebenen Zettel irgend eine Zahl von Kugeln an, sosind alle Kombinationen kleinerer Zahlen, welche die früherenBedingungen erfüllen, gleich zulässig; und man wird dieAnzahl der Kugeln bezüglich jedes Kandidaten haben, indemman eine Summe bildet aus allen Zahlen, die jede Kombinationihm gibt, und sie durch die gesamte Zahl der Kombinationendividiert. Eine sehr einfache Analyse zeigt,daß die Zahlen, welche man auf jeden Zettel neben den letztenNamen, den vorletzten etc. schreiben muß, den Gliedernder arithmetischen Progression 1, 2, 3 etc. proportionalsind. Schreibt man also auf jeden Zettel die Glieder dieserProgression und addiert die Glieder bezüglich jedes Kandidaten,so werden die verschiedenen Summen durch ihreGröße die Ordnung der Bevorzugung anzeigen, die unter denKandidaten aufgestellt werden muß. Das ist die Art derWahl, welche die Wahrscheinlichkeitstheorie empfiehlt. OhneZweifel wäre es das beste, wenn jeder li7ähler auf seinemStimmzettel die Namen der Kandidaten in der Ordnung desVerdienstes, das er ihnen zuteilt, schreiben würde. Aber dieSonderinteressen und viele dem Verdienste fremdartige Oberlegungenmüssen diese Ordnung stören und zuweilen denKandidaten an den letzten Platz stellen, der dem bevorzugtenam gefährlichsten ist, was den Kandidaten von mittelmäßigemVerdienste zu viel Vorteile gibt. Auch hat die Erfahrungdazu geführt, da% man diese Art und Weise derWahl in den Anstalten, die sie angenommen hatten, wiederaufgegeben hat.
Die Wahl mit absoluter Majorität der Stimmen vereinigtmit der Sicherheit, daß kein Kandidat zugelassen wird, dendiese Majorität verwirft, noch den Vorteil, daß sie zumeistden Wunsch der Versammlung zum Ausdruck bringt. Siefiillt immer mit der früher angeführten Art zusammen, wennes nur zwei Kandidaten gibt. In Wahrheit ist sie dem Übelstandunterworfen, die Wahlen unbeendbar zu machen. Aberdie Erfahrung hat gelehrt, daß dieser Obelstand unwirksamist, und daß der Wunsch, den Wahlen ein Ziel zu setzen, balddie Mehrheit der Stimmen auf einen Kandidaten vereinigt.Die Wahl zwischen mehreren Anträgen betreffs desselbenGegenstandes scheint den nämlichen Regeln unterworfen werdenzu müssen, wie die Wahl zwischen mehreren Kandidaten.Aber es besteht zwischen diesen beiden Fällen der Unterschied,daß nämlich das Verdienst eines Kandidaten nichtdas seiner Mitbewerber ausschließt; wenn aber die Vorschläge,unter welchen man eine Wahl treffen muß, entgegengesetztsind, so schließt die Richtigkeit des einen die der anderenaus. Die Frage muß dann in folgender Weise betrachtetwerden.Geben wir jedem der Stimmenden eine Urne, die eineunendliche Anzahl von Kugeln enthält, und nehmen wir an,daß er sie auf die verschiedenen Anträge nach Maßgabe derbezüglichen Wahrscheinlichkeiten, die er ihnen zuschreibt,verteilt. Da die Totalzahl der Kugeln die Gewißheit ausdrückt,und der Votant nach der Voraussetzung überzeugtist, daß einer der Anträge richtig sein muß, so ist klar, daß erdiese Zahl ganz auf die Anträge verteilen wird. Das Problemreduziert sich also darauf, die Kombinationen zu bestimmen,in welchen die Kugeln verteilt sein werden, sozwar, daß auf den ersten Antrag des Stimmzettels mehrkommen als auf den zweiten, auf den zweiten mehr als aufden dritten usw., sodann die Summe aller Zahlen der Kugelnbezüglich jedes Vorschlags in diesen Kombinationen zu bilden,und diese Summe durch die Anzahl der Kombinationen zudividieren: Die Quotienten werden die Zahlen der Kugelnsein, welche man den Anträgen auf irgend einem Stimmzettelzuteilen muß. Man findet durch die Analyse, daß, ausgehendvom letzten Antrag und zum ersten aufsteigend, dieseQuotienten sich untereinander wie die folgenden Großenverhalten: 1. die Einheit dividiert durch die Anzahl der
Anträge, 2. die frühere Größe vermehrt um Eins, geteiltdurch die um Eins verminderte Anzahl der Anträge, 3. diesezweite Größe, vermehrt um Eins, geteilt durch die um zweiverminderte Anzahl der Anträge, und so fort. Man wirdalso auf jeden Zettel diese Größen neben den entsprechendenAnträgen schreiben, und wenn man die Größen bezüglichjedes Antrages auf den verschiedenen Zetteln addiert, sowerden die Summen durch ihre Größe den Grad des Vorrangesbezeichnen, welchen die Versammlung diesen Anträgengibt.Sagen wir noch ein Wort über die Wiederwahl vonKörperschaften, die in einer bestimmten Anzahl von Jahrenin ihrer Gesamtheit sich ändern müssen. Soll die Wiederwahlauf einmal geschehen, oder ist es besser, sie auf dieseJahre zu verteilen? Nach dieser letzten Art undwürde die Versammlung unter dem Einflusse der verschiedenen,während der Dauer ihrer Wiederwahl herrschenderMeinungen gebildet werden; die Meinung, welche hierbei zumAusdrucke käme, würde also dann gehr wahrscheinlich dasMittel aus allen diesen Meinungen sein. Die Versammlungerhielte so von der Zeit den nämlichen Vorteil, wie von derAusdehnung der Wahl ihrer Mitglieder auf alle Teile desTerritoriums, das durch sie repräsentiert wird. Wenn manjetzt beachtet, was die Erfahrung nur zu sehr erkennen läßt,daß nämlich die Wahlen immer im Sinne der extremstenunter den herrschenden Meinungen ausfallen, so wird manfühlen, wie nützlich es ist, von diesen Meinungen die einendurch die anderen auf dem Wege einer teilweisen Erneuerungzu mäßigen.Von der Wahrscheinlichkeit der gerichtlichen Urteile.Die Analyse bestätigt, was uns schon der einfachegesunde Menschenverstand sagt, daß die Richtigkeit derUrteile um so wahrscheinlicher ist, je zahlreicher und aufgeklärterdie Richter sind. Es ist daher wichtig, daß dieAppellationsgerichte diese zwei Bedingungen erfüllen. DieGerichte erster Instanz, die den Gerichtsunterwürfigen näherstehen, bieten denselben den Vorteil eines ersten bereitswahrscheinlichen Urteils, mit dem sie sich oft zufriedengeben, sei es, daß sie einen Vergleich eingehen oder daß
Anwendungen der Wahrwheinlichkeitsrechnung. 103sie auf ihre Ansprüche verzichten. Aber wenn die Ungewißheitdes Streitobjekts und seine Wichtigkeit eine Parteibestimmen, an das Appellationsgericht zu rekurrieren, somuß sie in einer größeren Wahrscheinlichkeit, ein billigesUrteil zu erlangen, mehr Sicherheit für ihr Eigentum undErsatz für die Verlegenheiten und Unkosten finden, welcheein neues Verfahren mit sich bringt. Das war bei der Einrichtungder gegenseitigen Berufung der Departementgerichtenicht der Fall, wodurch sie für die Interessen derBürger sehr nachteilig wurden. Es wäre vielleicht angemessenund in Oberein~tirnmun~mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung,wenn mindestens eine Majorität von zwei Stimmen ineinem Appellationsgerichte verlangt würde, um das Urteil desuntergebenen Gerichtes zu entkräften. Man würde das erreichen,wenn das Appellationsgericht aus einer geraden Anzahlvon Richtern zusammengesetzt wäre und das Urteilim Falle der Stimmengleichheit aufrecht erhalten bliebe.Ich will noch besonders die Urteilssprüche in Kriminal-Sachen betrachten.Ohne Zweifel müssen die Richter, um einen Angeklagtenzu verurteilen, die stärksten Beweise seines Verbrechenshaben. Aber ein moralischer Beweis ist stets nur eine Wahrscheinlichkeit,und die Erfahrung hat nur zu sehr gezeigt,deß selbst jene strafgerichtlichen Urteile, welche die gerechtestenscheinen, noch Irrtümern unterworfen sind. DieMöglichkeit diese Irrtümer wieder gut zu machen bildetdas sterkste Argument der Philosophen, welche die Todesstrafeabschaffen wollten. Wir dürften also eigentlich garkein Urteil fällen, wenn wir auf die mathematische Sicherheitwarten müßten. Aber das Urteil ist durch die Gefahrgeboten, die sich aus der Straflosigkeit des Verbrechens ergebenwürde. Diese Erwägung reduziert sich, wenn ichmich nicht irre, auf die Lösung der folgenden Frage: Hat derBeweis des Vergehens des Angeklagten den hohen Grad derWahrscheinlichkeit, der notwendig ist, damit die Bürgervon den Irrtümern der Gerichte, wenn der Angeklagte unschuldigist und verurteilt wurde, weniger zu fürchten hiitten,als von den neuen Verbrechen desselben und derjenigen Unglücklichen,die das Bei~piel seiner Straflosigkeit kühn machenwürde? Die Lösung dieser Frage hängt von mehreren Elementenab, die sehr schwierig zu erkennen sind. So bei-
spielsweise vom Bevorstehen der Gefahr, welche die Gesellschaftbedrohte, wenn der angeklagte Verbrecher straflosbliebe. Manchmal ist diese Gefahr so groß, da5 das Gerichtsich gezwungen sieht, von den zur Sicherheit der Unschuldweise errichteten Formen abzugehen. Aber das, was dieFrage, um die es sich handelt, fast immer unlösbar macht,ist die Unmöglichkeit, die Wahrscheinlichkeit des Verbrechensgenau abzuschätzen, und die zur Verurteilung des Angeklagtennotwendige Wahrscheinlichkeit zu fixieren. JederRichter ist in dieser Hinsicht gezwungen, sich auf sein eigenesGefühl zu verlassen. Er bildet sich seine Meinung, indem erdie verschiedenen Zeugenaussagen und die Umstände, vondenen das Verbrechen begleitet ist, mit den Ergebnissenseines Nachdenkens und seiner Erfahrung vergleicht; und indieser Hinsicht verleiht eine lange Gewohnheit in Verhörenund Richten der Angeklagten eine große Gewandtheit, uminmitten der sich oft widersprechenden Indizien die Wahrheitherauszufinden.Die frühere Frage hängt auch noch von der Größe derfür das Verbrechen bestimmten Strafe ab; denn man fordertnaturgemäß zur Fällung des Todesurteils viel stärkere Beweiseals zur Verhängung von einigen Monaten Gefängnisstrafe.Das ist mit ein Grund, die Strafe dem Verbrechenproportional zu machen, da eine strenge Strafe, die über einleichtes Vergehen verhängt wird, unvermeidlich bewirkenmuß, daß viele Schuldige freigesprochen werden. Ein Gesetz,welches den Richtern anheim stellt, die Strafe im Fallemildernder Umstände zu verringern, entspricht daher sowohlden Prinzipien der Humanität gegen die Schuldigen als auchdem Interesse der Gesellschaft. Da das Produkt aus derWahrscheinlichkeit des Verbrechens mit der Größe desselbendas Maß der Gefahr ist, welche bei Freisprechung des Angeklagtendie Gesellschaft bedroht, so könnte man denken,da5 die Strafe von dieser Wahrscheinlichkeit abhängen muß.Indirekt geschieht das bei den Gerichten, wo man den Angeklagten,gegen den sich sehr starke, aber zu seiner Verurteilungungenügende Beweise erheben, einige Zeit gefangenhält: in der Absicht neue Aufklärung zu sammeln, setztman ihn nicht sogleich mitten unter seine Mitbürger zurück,die ihn nicht ohne lebhafte Besorgnis wieder sehen würden.Aber die Willkür dieser Maßregel und der Mißbrauch, der
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 105damit getrieben werden kann, haben bewirkt, daß man sie inden Ländern, wo man der individuellen Freiheit den größtenWert beimißt, verworfen hat.Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, daß die Entscheidungeines Gerichtshofes, welcher nur nach einer gegebenenMajorität verurteilen kann, gerecht, d. h. im Einklangmit der wahren Lösung der oben vorgelegten Fragesein wird? Dieses wichtige Problem wird, falls man esrichtig löst, das Mittel an die Hand geben, die verschiedenenGerichte untereinander zu vergleichen. Die Mehrheit voneiner einzigen Stimme in einem Tribunal, das aus vielenMitbürgern besteht, zeigt an, daß die Angelegenheit, um diees sich handelt, völlig zweifelhaft ist; die Verurteilung desAngeklagten würde also dann den Prinzipien der Humanität,den Beschützern der Unschuld, entgegen sein. Einstimmigkeitder Richter würde mit großer Wahrscheinlichkeit einegerechte Entscheidung ergeben; aber hielte man daran fest, sowürden zu viele Schuldige freigesprochen werden. Man mußalso entweder die Zahl der Richter einschränken, wenn manwill, daß sie einstimmig sein sollen, oder die zur Verurteilungnötige Majorität vermehren, wenn das Tribunal zahlreicherwird. Ich will versuchen, auf diesen Gegenstand dieRechnung anzuwenden, in der Uberzeugung, daß sie immerdie beste Richtschnur ist, wenn man sie auf die Daten stutzt,die uns der gesunde Menschenverstand an die Hand gibt.Die Wahrscheinlichkeit, daß die Meinung eines jedenRichters richtig ist, tritt als ein Hauptelement in dieseRechnung ein. Diese Wahrscheinlichkeit ist augenscheinlichrelativ zur jeweiligen Sache. Wenn in einem Tribunal von1001 Richtern 501 einer Meinung und 500 der entgegengesetztenMeinung sind, so ist es klar, daß die Wahrschein-1.lichkeit der Meinung eines jeden Richters sehr wenig -uber-2-schreitet; denn nimmt man sie merklich größer an, so wäreeine einzige Stimme Unterschied ein unwahrscheinlichesEreignis. Aber wenn die Richter einstimmig sind, so deutetdas auf jenen Grad der Stärke in den Beweisen, der sich dieuberzeugung erzwingt; die Wahrscheinlichkeit der Meinungjedes Richters ist dann der Einheit oder der Gewißheit sehrnahe, wenigstens sofern nicht Leidenschaften oder allgemeineVorurteile alle Richter irreführen. Sieht man von diesen
Fällen ab, so soll nur das Verhältnis der Stimmen für odergegen den Angeklagten diese Wahrscheinlichkeit bestimfien.1Ich nehme somit an, daß sie von 2bis zur Einheit variieren,1aber nicht unter - liegen kann. Andernfalls würde die2Entscheidung des Tribunals ebenso wenig bedeuten wie dasLoos: sie hat nur so viel Wert, als die Meinung des Richterssich mehr zur Wahrheit als zum Irrtum neigt. Durch dasVerhältnis der für den Angeklagten günstigen und ungünstigenStimmen bestimme ich hernach die Wahrscheinlichkeitdieser Meinung.Diese Daten genügen, um den allgemeinen Ausdruck derWahrscheinlichkeit zu erhalten, daß die Entscheidung einesGerichtshofes, der nach einer gegebenen Majorität das Urteilfällt, richtig ist. In den Gerichtshöfen, wo auf acht Richterfünf Stimmen zur Verurteilung eines Angeklagten notwendigwären, würde die Wahrscheinlichkeit des Irrtums, der betreffsder Gerechtigkeit der Entscheidung zu befürchten ist,i-- überschreiten. Wenn das Tribunal auf sechs Mitglieder4beschränkt wiire, die nur mit der Mehrheit von 4 Stimmen verurteilenkönnten, würde der zu befürchtende Irrtum kleiner1als - sein; es bestände also für den Angeklagten ein Vor-4teil bei dieser Beschränkung des Tribunals. In dem einenwie in dem anderen Falle ist die geforderte Majorität dieselbeund gleich zwei. Die Wahrscheinlichkeit des Irrtumsnimmt also bei konstanter Majorität,mit der Zahl der Richterzu; das bleibt allgemein richtig, was auch die erforderlicheMajorität sein mag, ~ofern sie nur konstant bleibt. Nimmtman also die Konstanz der Differenz als Regel an, so befindetsich der Angeklagte in einer um so weniger vorteilhaftenLage, je zahlreicher das Tribunal wird. Man könnteglauben, daß bei einem Gerichtshofe, wo man eine Majoritätvon 12 Stimmen bei einer beliebigen Anzahl von Richternfordern würde, diese 12 Stimmen, da doch die Stimmen derMinorität eine gleiche Stimmenzahl der Majorität neutralisieren,der Einstimmigkeit eines Geschworenengerichtes von12 Mitgliedern gleichwertig wären, die z. B. in England
Anwendungen der Wahrecheinlichkeitsrechnung. 107zur Verurteilung ,eines Angeklagten erforderlich ist; aberman befände sich da in einem großen Irrtum. Der gesundeMenschenverstand zeigt schon, daß ein Unterschied bestehtzwischen der Entscheidung eines Tribunals von 212 Richtern,wovon 112 den Angeklagten verurteilen, während 100 ihnfreisprechen, und der eines Tribunals von 12 Richtern, diebei der Verurteilung einstimmig sind. Im ersten Falle berechtigendie 100 für den Angeklagten günstigen Stimmenzu der Meinung, daß die Beweise weit davon entfernt sind,den Grad der Kraft zu erreichen, der die f'berzeugung nachsich zieht; im zweiten Falle dagegen führt uns die Einstimmigkeitder Richter zu dem Glauben, daß die Beweise diesenGrad erlangt haben. Aber der einfache gesunde Menschenverstandgenügt nicht zur Abschätzung des ungeheuren Unterschiedesder Wahrscheinlichkeit des Irrtums in diesen beidenFällen. Man muß also zur Rechnung seine Zuflucht nehmen,und da findet man ungefähr ein Fünftel als Wahrscheinlich-Ikeit des Irrtums im ersten Falle und nur -!L für diese8192Wahrscheinlichkeit im zweiten Falle, eine Wahrscheinlich-1keit, die nicht einmal -der ersten ist. Das ist eine Be-1000stätigung des Prinzipes, daß die Konstanz der Differenz demAngeklagten ungünstig ist, wenn die Zahl der Richter zunimmt.Wird dagegen die Konstanz des Quotienten alsRegel angenommen, so nimmt die Wahrscheinlichkeit desIrrtums der Entscheidung ab, wenn die Zahl der Richterzunimmt. In den Tribunalen zum Beispiel, welche nur mitZweidrittelmajorität verurteilen können, ist die Wahrscheinilichkeit des zu befürchtenden Irrtums ungefähr L, wenn41die Zahl der Richter 6 ist, sie ist kleiner als -, wenn diese7Zahl bis zu 12 steigt. Man darf sich daher weder nach demarithmetischen, noch nach dem geometrischen Verhältnisserichten, wenn man will, daß die Wahrscheinlichkeit desIrrtums niemals oberhalb oder unterhalb eines bestimmtenBruches liegt.Aber für welchen Bruchteil soll man sich entscheiden?Bier beginnt die Willkür, und die Gerichtshöfe zeigen in dieser8*
Hinsicht große Verschiedenheiten. Bei den speziellen Tribunalen,wo fünf Stimmen auf acht zur Verurteilung des Angeklagtengenügen, ist die Wahrscheinlichkeit des Irrtums,der betreffs der Richtigkeit des Urteils zu befürchten ist,65- oder größer als -. 1 Die Größe dieses Bruches ist er-256 4schreckend, aber was ein wenig beruhigen muß, ist die Erwägung,daß der Richter, der einen Angeklagten freispricht,ihn sehr oft nicht als unschuldig betrachtet; er spricht nuraus, daß es an genugenden Beweisen zu seiner Verurteilunggemangelt hat. Man wird insbesondere beruhigt durch dasBfitleid, welches die Natur in das Herz des Menschen gelegthat und welches bewirkt, daß der Geist nur schwer in demseinem Urteilsspruche unterworfenen Angeklagten einenSchuldigen sieht. Dieses Gefühl, das bei jenen lebhafter ist,die nicht berufsmäßig Strafurteile fällen, gleicht die ubelständeaus, die mit der Unerfahrenheit der Geschworenenverbunden sind. In einem Geschworenengerichte von 12 Mitgliedern,wo die zur Verurteilung geforderte Mehrheit dievon 8 Stimmen auf 12 ist, ist die Wahrscheinlichkeit des zu1093 1befürchtenden Irrtums -oder ein wenig mehr als -; sie8192 81ist beinahe -, wenn diese Mehrheit 9 Stimmen beträgt.22In dem Falle der Einstimmigkeit ist die Wahrscheinlichkeit1des zu befürchtenden Irrtums - d. h. mehr als tausend-8192'mal geringer als bei unseren Geschworenengerichten. Dassetzt voraus, daß die Einstimmigkeit sich einzig aus den demAngeklagten günstigen oder gegenteiligen Beweisen ergibt;aber oft müssen durchaus fremde Beweggründe mitwirken,um dieselbe hervorzubringen, wenn sie den Geschworenen alsnotwendige Bedingung ihrer Urteilsfällung auferlegt ist.Dann hangen ihre Entscheidungen von Temperament, Charakterund Gewohnheiten der Geschworenen und von den Umständenab, in denen sie sich befinden; zuweilen sind sie denEntscheidungen entgegengesetzt, welche die Majorität der Geschworenengefällt haben würde, wenn sie nur auf die Beweisegehört hätte; und das scheint mir ein großer Fehler dieserArt der Urteilsftillung zu sein.
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 109DieWahrscheinlichkeit der Entscheidungen ist zu schwachbei unseren Geschworenengerichten, und ich glaube, daß man,um der Unschuld einen genügenden Schutz zu geben, wenigstensdie Mehrheit von 9 Stimmen auf 12 fordern soll.flber die Sterblichkeitstabellen und über die mittlereLebensdauer, über die Ehen und sonstigen gesellschaftlichenVerbindungen.Die Art und Reise, wie Sterblichkeitstabellen angelegtwerden, ist sehr einfach. Man entnimmt den Zivilregisterneine große Zahl von Individuen, deren Geburt und Todangegeben sind. Man bestimmt, wie viele dieser Individuenim ersten Jahre ihres Lebens gestorben sind, wie vieleim zweiten Jahre und so fort. Daraus schließt man auf dieZahl der am Beginn eines jeden Jahres lebenden Individuenund schreibt diese Zahl in die Tabelle neben die Zahl, welchedas Jahr anzeigt. So schreibt man neben die Null die Zahlder Geburten; neben das Jahr 1 die Zahl der Kinder, welcheein Jahr erreicht haben, neben das Jahr 2 die Zahl der Kinder,welchezwei Jahre alt geworden sind, und so fort. Aberda in den zwei ersten Lebensjahren die Sterblichkeit sehrstark ist, so muß man zur größeren Genauigkeit in diesemersten Alter die Zahl der tfberlebenden am Ende jedeshalben Jahres angeben.Wenn man die Summe der Lebensjahre aller in eineSterblichkeitstabelle eingetragenen Individuen durch die Anzahldieser Individuen dividiert, so wird man die dieser Tabelleentsprechende mittlere Lebensdauer erhalten. Zu demBehufe wird man die Zahl der im ersten Jahre Verstorbenen,welche Zahl dem Unterschiede der neben den Jahren 0 und1 geschriebenen Zahlen der Individuen gleich ist, mit einemhalben Jahre multiplizieren. Da nämlich ihre Sterblichkeitauf das ganze Jahr verteilt werden muß, so ist ihre mittlereLebensdauer nur ein halbes Jahr. Man wird mit 1%Jahrendie Zahl der im zweiten Jahre Verstorbenen multiplizieren,mit 2% Jahren die Zahl der Verstorbenen im dritten Jahreund so fort. Die Summe dieser Produkte dividiert durchdie Zahl der Geburten wird die mittlere Lebensdauer sein.Es ist daraus leicht der Schluß zu ziehen, daß man dieseLebensdauer erhält, indem man die Summe der in die Ta-
elle neben jedem Jahre eingetragenen Zahlen bildet, dieselbedurch die Zahl der Geburten dividiert und vom Quotienten1subtrahiert, wobei das Jahr als Einheit genommen wurde.0Die mittlere Lebensdauer, die noch zu leben übrig bleibt,wenn von irgend einem Alter ausgegangen wird, bestimmtsich nach derselben Weise, indem man mit der Zahl der Individuen,welche dieses Alter erreicht haben, ebenso verfährt,wie man es soeben mit der Zahl der Geburten gemacht hat.Nicht im Augenblick der Geburt ist die voraussichtlichemittlere Lebensdauer am größten, sondern wenn man denGefahren der ersten Kindheit entgangen ist; und dann istsie ungefähr 43 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, irgend einAlter zu ereichen, wenn man von einem gegebenen Alterausgeht, ist gleich dem Verhältnis der beiden Individuen-Anzahlen, die in der Tabelle für diese zwei Lebensalter angegebensind.Zwecks Genauigkeit dieser Resultate ist es erforderlich,daß man für die Herstellung der Tabellen eine sehr großeZahl von Geburten verwendet. Die Analysis gibt dann sehreinfache Formeln zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit,daß die in diesen Tabellen angezeigten Zahlen sich nur innerhalbenger Grenzen von der Wahrheit entfernen. Man siehtaus diesen Formeln, daß das Intervall der Grenzen in demMaße ab- und die Wahrscheinlichkeit zunimmt, je mehrGeburten in die Betrachtung einbezogen werden, so zwar,daß die Tabellen genau das wahre Gesetz der Sterblichkeitdarstellen würden, wenn die Anzahl der verwendeten Geburtenunendlich wäre.Eine Sterblichkeitstabelle ist also eine Tabelle der Wahrscheinlichkeitendes menschlichen Lebens. Das Verhältnisder neben jedem Jahre eingetragenen Individuen zur Zahlder Geburten ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Neugeborenerdieses Jahr erreichen wird. Ebenso wie man denWert der mathematischen Hoffnung bestimmt, indem maneine Summe der Produkte aus jedem erwarteten Gute mitder Wahrscheinlichkeit, es zu erlangen, bildet, so kann manin gleicher Weise die mittlere Lebensdauer erhalten. indemman die Produkte aus jedem Jahr mit dem arithmetischenMittel der Wahrscheinlichkeiten, den Anfang und das Endedesselben zu erreichen, addiert, was zu dem oben gefundenen
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 111Resultate zurückführt. Aber die eben erörterte Art, diemittlere Lebensdauer zu betrachten, hat den Vorteil, daß sieersichtlich macht, daß bei einer stationären Bevölkerung,bei welcher nämlich die Zahl der Geburten gleich der derTodesfälle ist, die mittlere Lebensdauer gerade das Verhältnisder Bevölkerung zu den jährlichen Geburten ist; dennda die Bevölkerung als gleichbleibend vorausgesetzt war, soist die Zahl der Individuen eines Alters in zwei aufeinanderfolgendenJahren der Tabelle gleich der Anzahl der jährlichenGeburten multipliziert mit der halben Summe derWahrscheinlichkeiten, diese Jahre zu erreichen; die Summealler dieser Produkte wird also die ganze Bevölkerung ergeben;nun ist leicht zu sehen, daß diese Summe geteilt durch dieZahl der jährlichen Geburten mit der mittleren Lebensdauerzusammenfällt, so wie wir sie eben definiert haben.Mittels einer Sterblichkeitstabelle kann man sich leichtdie entsprechende Tabelle der stationären Bevölkerung anfertigen.Zu dem Behufe nimmt man die arithmetischenMittel zwischen den Zahlen der Sterblichkeitstabelle, welcheden Lebensaltern 0 und 1 Jahr, 1 Jahr und 2 Jahre, 2 Jahreund 3 Jahre entsprechen usw. Die Summe aller dieserarithmetischen Mittel ist die gesamte Bevölkerung: dieseschreibt man neben das Alter Null. Zieht man von dieserSumme das erste Mittel ab, so ist der Rest die Zahl der Individuenvon einem Jahr und darüber; man schreibt sie nebendas Jahr 1. Von diesem ersten Reste zieht man jetzt daszweite Mittel ab, dieser zweite Rest ist die Zahl der Individuenvon zwei Jahren und darüber. Diese schreibt manneben das Jahr 2 und so fort.So viele veränderliche Ursachen üben ihren Einfluß aufdie Sterblichkeit aus, daß die Tabellen, die sie darstellen,nach Ort und Zeit sich ändern müssen. Die verschiedenenLebensumstände bieten in dieser Hinsicht merkliche Unterschiededer, die von den mit jedem Stande untrennbarenBeschwerden und Gefahren abhängen und welche bei den aufdie Lebensdauer begründeten Rechnungen nicht außer achtgelassen werden dürfen. Aber diese Unterschiede sind nochnicht genugsam beachtet worden. Eines Teges werden siees sein; dann wird man wissen, welche Einbuße am Lebenjeder Beruf fordert, und man wird aus diesen KenntnissenGewinn ziehen, um die Gefahren zu vermindern.
112 P. S. de Laplace:Die größere oder geringere Zuträglichkeit des Bodens,seine Höhenlage, seine Temperatur, die Sitten der Bewohnerund die Maßnahmen der Regierungen haben auf die Sterblichkeiteinen beträchtlichen Einfluß. Aber vor der Untersuchungder Lrsache der beobachteten Unterschiede muß man immerdie Wahrscheinlichkeit erforschen, mit der diese Ursache angezeigtwird. So ist das Verhältnis der Bevölkerung zu denjährlichen Geburten, das, wie man gesehen hat, sich in Frankreichbis auf 28% erhebt, im alten Herzogtum Mailand nichteinmal 26. Diese Verhältnisse, die sich beide auf eine großeZahl von Geburten gründen, lassen keinen Zweifel übrig, daßim Mailändischen eine besondere Ursache der Sterblichkeitherrscht, melche die Regierung dieser Länder aufsuchen undentfernen sollte.Das Verhältnis der Bevölkerung zu den Geburten würdeauch noch zunehmen, wenn es gelänge, einige gefährliche undsehr verbreitete Krankheiten zu vermindern oder auszurotten.Bei den Blattern ist dies glücklicherweise gelungen, zuerstdurch Einimpfung dieser Krankheit, dann in einer viel vorteilhafterenWeise durch Einimpfung des Kuhpockenstoffs,eine unschätzbare Entdeckung von Jenner, welcher dadurcheiner der größten Wohltäter der Menschheit geworden ist.Die Blattern haben das Eigentümliche, daß dasselbeIndividuum nicht zweimal davon befallen wird, oder wenigstensgeschieht das so selten, daß man bei der Rechnungdavon absehen kann. Diese Krankheit, der wenige Menschenvor der Entdeckung des Kuhpockenstoffes entgingen, ist ofttötlich und läßt ungefähr I/, derer, die davon befallen werden,umkommen. 1Ianchmal nimmt sie einen milden Charakteran, und die Erfahrung hat gelehrt, daß man ihr diesen letzterenCharakter gibt, wenn man sie gesunden Personen einimpft,die durch angemessene Diät und in einer günstigenJahreszeit dazu vorbereitet werden. Dann ist das Verhältnisder Individuen, die daran umkommen, zu den Geimpften1nicht einmal -. Dieser große Vorteil der Impfung und300der andere, daß-;ie der Schönheit keinen Abbruch tut und vorden bösen Folgen bewahrt, welche die natürlichen Blatternoft nach sich ziehen, bewirkte, daß viele Personen sich ihrunterzogen. Ihre Einführung wurde lebhaft empfohlen; aberwie es fast immer mit den Dingen geht, die Obelständen unter-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 113worfen sind, so wurde auch sie vielfach bekämpft. Mitten indiesen Streite stellte sich Daniel Bernoulli die Aufgabe, denEinfluß der Impfung auf die mittlere Lebensdauer der Rahrscheinlichkeitsberechnungzu unterziehen. Da ihm genaueDaten über die durch die Blattern in den verschiedenenLebensaltern verursachte Sterblichkeit fehlten, so machte erdie Annahme, da8 die Gefahr, diese Krankheit zu bekommen,und die Gefahr, daran zu sterben, für jedes Alter dieselbensind. Auf Grund dieser Annahmen gelang es ihm durch einesubtile Analyse, eine gewöhnliche Sterblichkeitstabelle in einesolche umzuwandeln, welche statthaben würde, wenn dieBlattern nicht existierten oder wenn nur eine sehr kleine Zahlvon Kranken daran stürbe: und daraus schloß er. daß dieImpfung die mittlere Lebensdauer wenigstens um drei Jahrevermehren würde, was ihm den Vorteil dieses Verfahrensaußer Zweifel zu setzen schien. D'Alembert griff die Analysevon Bernoulli an, und zwar erstens wegen der Unsicherheitihrer beiden Hypothesen und sodann wegen ihrer Lnzulänglichkeit,indem man hierbei keinen Vergleich zwischen dernahen, wenn auch sehr kleinen Gefahr, durch die Impfungumzukommen, mit der viel größeren, aber entfernter liegendenGefahr, den natürlichen Blattern zu unterliegen, anstellte.Diese Unterscheidung, welche verschwindet, sobald man esmit einer großen Zahl von Individuen zu tun hat, ist dadurchfür die Regierungen gleichgültig, für sie bleiben daher die Vorteileder Impfung fortbestehen; aber sie ist von großem Gewichtefür einen Familienvater, der, indem er seine Kinderimpfen läßt, fürchten muß, sein Teuerstes auf der Welt umkommenzu sehen und noch dazu selbst Schuld daran zu sein.Viele Eltern ließen sich durch diese Furcht zurückhalten, dieglücklicherweise durch die Entdeckung des Kuhpockenimpfstoffeszerstreut wurde. Durch eines jener Geheimnisse, welchedie Natur uns so häufig darbietet, ist der Kuhpockenimpfstoffein ebenso sicheres Schutzmittel gegen die Blattern wie dasBlatterngift und ist ganz ungefährlich: er setzt einen keinerKrankheit aus und erfordert nur sehr wenig Sorgfalt. Auchverbreitete sich seine praktische Verwendung rasch genug,und um sie ganz allgemein zu machen, bleibt nur noch übrig,die natürliche Trägheit des Volkes zu besiegen, gegen dieohne Cnterlaß angekämpft werden muß, sogar wenn es sichum seine teuersten Interessen handelt.
Das einfachste Mittel, den Vorteil zu berechnen, welchendie Ausrottung einer Krankheit mit sich bringen würde, bestehtdarin, daß man durch Beobachtung die Zahl der Individueneines gegebenen Alters, die jährlich von ihr hinweggerafftwerden, bestimmt und dieselbe von der Gesamtzahl derim selben Alter Gestorbenen subtrahiert. Das Verhältnis derDifferenz zur Gesamtzahl der Individuen des gegebenen Alterswäre die Wahrscheinlichkeit des Sterbens in diesem Jahreund Alter, wenn die Krankheit nicht existierte. Bildet manalso eine Summe dieser Wahrscheinlichkeiten von der Geburtbis zu irgend einem Alter und zieht diese Summe von Einsab, so stellt der Rest die Wahrscheinlichkeit dar, bis zu diesemAlter bei Ausrottung der Krankheit zu leben. Die Reihedieser Wahrscheinlichkeiten wird die Sterblichkeitstabelleauf Grund dieser Hypothese sein, und man wird nach demVorhergehenden auf die mittlere Lebensdauer schließenkönnen. Auf diese Weise hat Duvilard gefunden, daß dieZunahme der mittleren Lebensdauer, die man der Impfungmit Kuhpockenimpfstoff zu verdanken hat, mindestens dreiJahre beträgt. Ein so beträchtlicher Zuwachs würde aucheinen sehr großen Zuwachs in der Bevölkerung mit sichbringen, wenn derselben nicht andererseits durch die bezuglicheVerminderung der Subsistenzmit,tel Schranken gesetztwürden.Es geschieht hauptsächlich durch Mangel der Subsistenzmittel,daß der Bevölkerung~zunahme Einhalt getan wird.Bei allen Gattungen von Tieren und Pflanzen strebt die Naturohne Unterlaß die Zahl der Individuen so lange zu vermehren,als noch die Existenzmittel für sie ausreichen. Bei dermenschlichen Gattung üben die moralischen Ursachen einengroßen Einfluß auf die Bevölkerung aus. Wenn der Bodendurch leichte Urbarmachung neuen Generationen reichlicheNahrung liefern kann, so ermutigt die Sicherheit, eine zahlreicheFamilie ernähren zu können, zum Heiraten und bewirkt,daß die Ehen früher zustandekommen und fruchtbarersind. Auf einem Boden von solcher Art müssen Bevölkerungund Geburten zugleich nach einer geometrischenProgression zunehmen. Aber wenn das Urbarmachen schwierigerund seltener wird, dann vermindert sich der Zuwachsder Bevölkerung; sie paßt sich beständig dem veränderlichenStande der Lebensmittel an, indem sie um diesen herum
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 115oszilliert, wie etwa ein Pendel, dessen Aufhängepunkt manmit verzögerter Bewegung hin und her bewegt, infolge seinerSchwere um diesen Punkt herum schwingt. Es ist schwierig,das Maximum der Bevölkerungszunahme zu bestimmen:einigen Beobachtungen zufolge scheint es, daß unter günstigenUmständen die Zahl der menschlichen Gattung sichalle 15 Jahre verdoppeln könnte. In Nordamerika schätztman die Periode dieser Verdoppeliing auf 22 Jahre. Nachdiesem Stande der Dinge nehmen Bevölkerung, Geburten,Heiraten und Sterblichkeit alle nach der nämlichen geometrischenProgression zu, wobei das konstante Verhältnis der aufeinanderfolgendenGlieder durch die Beobachtung der jährlichenGeburten zweier Epochen bestimmt wird.Da eine Sterblichkeitstabelle die Wahrscheinlichkeitendes menschlichen Lebens darstellt, so kann man mittels derselbendie Dauer der Ehen bestimmen. Nehmen wir derEinfachheit wegen an, daß die Sterblichkeit für beide Geschlechterdieselbe sei, so wird man die Wahrscheinliohkeit,daß die Ehe ein, zwei oder drei usf. Jahre bestehen wird, erhalten,indem man eine Reihe von Brüchen bildet, deren gemeinsamerNenner das Produkt der beiden Zahlen der Tabelleentsprechend dem Alter jedes der Eheleute ist, und derenZähler die aufeinanderfolgenden Produkte der Zahlen sind,die diesen um ein, zwei, drei Jahre usf. vermehrten Lebensalternentsprechen. Die Summe dieser Brüche vermehrtum '/z wird die mittlere Dauer der Ehe sein, wenn das Jahrals Einheit genommen wird. Es ist leicht, dieselbe Regel aufdie mittlere Dauer einer Gesellschaft, die aus drei oder einergrößeren Zahl von Individuen gebildet ist, auszudehnen.Von den Vorteilen der Anstalten, welche von der Wahrscheinlichkeitder Ereignisse abhängen.Erinnern wir uns hier an das, was gesagt wurde, als wirüber die Hoffnung sprachen. Wir haben gesehen, daß manden Vorteil aus mehreren einfachen Ereignissen, wovon dieeinen ein Gut und die anderen einen Verlust mit sich bringen,erhält, indem man die Produkte der Wahrscheinliohkeitjedes günstigen Ereignisses mit dem Gute, das es mit sichbringt, addiert und von ihrer Summe die der Produkteder Wahrscheinlichkeit jedes ungünstigen Ereignisses mit dem
Verluste, der daran geknüpft ist, subtrahiert. Aber wasauch der durch die Differenz dieser Summen ausgedrückteVorteil sein mag, so schützt doch ein einziges Ereignis, dasaus diesen einfachen Ereignissen zusammengesetzt ist, nochnicht vor der Furcht, einen Verlust zu erfahren. Man begreiftaber, daß diese Furcht sich vermindern muß, wennman das zusammengesetzte Ereignis vervielfacht. Die Wahrscheinlichkeitsanalyseführt auf dieses allgemeine Theorem.Durch die Wiederholung eines vorteilhaften Ereignisses,eines einfachen oder zusammengesetzten, wird der wirklicheGewinn immer wahrscheinlicher und nimmt ohne Gnterlaßzu; er wird jedoch zur Gewißheit unter Voraussetzung einerunendlicher Anzahl von Wiederholungen; dividiert man denselbendurch die Zahl der Wiederholungen, so ist der Quotientoder der mittlere Gewinn jedes Ereignisses gerade diemathematische Hoffnung oder der auf das Ereignis bezüglicheVorteil. Gerade so ist es betreffs des Verlustes, dermit der Zeit gewiß wird, wenn das Ereignis nur irgendwieunvorteilhaft ist.Dieses Theorem über Gewinn und Verlust ist denenanalog, die wir früher über die bei unendlicher Wiederholungder einfachen oder zusammengesetzten Ereignisse stattfindendenBeziehungen gegeben haben, und beweist ebensowie jene, daß die Regelmäßigkeit sogar in den Dingen, dieam meisten dem sogenannten Zufall unterworfen sind, sichschließlich Geltung verschafft.Wenn die Ereignisse in großer Zahl auftreten, so gibt dieAnalyse auch noch einen sehr einfachen Ausdruck für dieWahrscheinlichkeit, daß der Gewinn in bestimmten Grenzenenthalten ist, und zwar einen Ausdruck, der unter das allgemeineWahrscheinlichkeitsgesetz fällt, das wir oben aufgestellthaben, als wir von den aus der unbegrenzten Wiederholungder Ereignisse sich ergebenden Wahrscheinlichkeitengesprochen haben.Von der Wahrheit des vorhergehenden Theorems hängtder Bestand der auf die Wahrscheinlichkeiten gegründetenAnstalten ab, Aber damit dasselbe auf sie angewendetwerden kann, müssen diese Anstalten durch zahlreiche Cnternehmungendie günstigen Ereignisse vervielfachen.Man hat auf die Wahrscheinlichkeit des menschlichenLebens verschiedene Einrichtungen gegründet, wie die Lebens-
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 117renten und Tantiemen. Die allgemeinste und einfachsteMethode, die Vorteile und Lasten dieser Anstalten zu berechnen,besteht nun darin, sie auf wirkliche Kapitalien zurückzuführen.Die jährlichen Interessen der Einheit nennt manden Zinsfuß. Am Ende jedes Jahres erhält ein Kapital dieum den Zinsfuß vermehrte Einheit als Faktor; es wächstdann nach einer geometrischen Progression, deren Exponentdieser Verzinsungsfaktor ist. Auf diese Weise wird es mit der1Zeit ungeheuer groß. Wenn der Zinsfuß - ist oder 5 Pro-20aent, so verdoppelt sich das Kapital in einem Zeitraum vonungefähr 14 Jahren, vervierfacht sich in 29 Jahren, und inweniger als drei Jahrhunderten wird es zwei Millionen malgrößer.Ein so außerordentlicher Zuwachs hat den Gedankenerweckt, denselben zur Tilgung der Staatsschuld zu verwenden.Man bildet zu dem Behufe eine Tilgungskasse, für dieman einen jährlichen Fond bestimmt, der zur Einlösung öffentlicherEffekten verwendet und durch die Interessen der zurückgekauftenEffekten beständig vermehrt wird. Es istklar, daß diese Kasse mit der Zeit einen großen Teil der nationalenStaatsschuld tilgen wird. Wenn man, so oft die Staatsbedürfnisseeine Anleihe zu machen nötigen, einen Teildieser Anleihe dem Zuwachs des jährlichen Amortisierungsfondszufließen läßt, so werden die Schwankungen der Staatseffektengeringer werden; das Vertrauen der Geldgebei unddie Wahrscheinlichkeit, ohne Verlust das geliehene Geld, sobaldman es wünscht, zurückzunehmen, werden dadurch vermehrtund die Bedingungen der Anleihe weniger drückendwerden. Glückliche Erfahrungen haben diese Vorteile vollkommenbestätigt. Aber das getreue Einhalten der Verpflichtungenund die Beständigkeit, die für den Erfolg solcher Anstaltenso notwendig sind, können sicher nur von einer Regierungverbürgt werden, bei welcher die gesetzgebende Macht inmehrere unabhängige Gewalten geteilt ist. Das Vertrauen,welches das notwendige Zusammenwirken dieser Gewalteneinflößt, verdoppelt die Kraft des Staates, und der Herrscherselbst gewinnt dann an gesetzlicher Macht viel mehr, als eran willkürlicher Macht verliert.Es ergibt sich aus dem Vorhergehenden, daß der Barwertdes Kapitals, das einer Summe tiquivalent ist, die erst nach
einer gewissen Anzahl von Jahren gezahlt zu werden braucht,gleich ist dem Produkte aus dieser Summe mit der Wahrscheinlichkeit,daß sie zu dieser Zeit gezahlt werden wird,dividiert durch die sovielte Potenz der um den Zinsfuß vermehrtenEinheit, als die Zahl dieser Jahre beträgt.Es ist leicht, dieses Prinzip auf die Lebensrenten für eineoder mehrere Personen und auf die Spar- und Versicherungshassenbeliebiger Art anzuwenden. Nehmen wir an, daß maneine Lebensversicherungstabelle nach einer gegebenen Sterblichkeitst'abelleanfertigen will. Eine Lebensrente, die z. B.am Ende von fünf Jahren zahlbar ist und auf das wirklicheKapital zurückgeführt werden soll, ist nach diesem Prinzipegleich dem Produkte der folgenden zwei Größen, nämlich:der Rente dividiert durch die fünfte Potenz der um den Zinsfußvermehrten Einheit, und der Wa,hrecheinlichkeit, sie zuzahlen. Diese ist das umgekehrte Verhältnisder Zahl in der Tabelle neben dem Alter dessen,der die Rente bestellt, eingetragenen Individuen zu der Zahl,die neben dem um fünf Jahre höheren Alter eingeschriebenist. Bildet man also eine Reihe von Brüchen, deren Nennerdie Produkte sind aus der Zahl der Personen, die in derSterblichkeitstabelle im Alter des Rentenbestellers als lebendangeführt erscheinen, mit den sukzessiven Potenzen derum den Zinsfuß vermehrten Einheit, und deren Zähler dieProdukte sind aus der Rente mit dcr Zahl d ~ lebenden r umein, zwei usw. Jahre älteren Personen, so wird die Summedieser Brüche das für die Lebensrente in diesem Alter gesuchteKapital sein.Xehmen wir jetzt an, daß eine Person mittels einerLebensrente ihren Erben ein Kapital zusichern wollte, dasam Ende ihres Todesjahres zahlbar ist. Cm den Wert dieserRente zu bestimmen, kann man sich denken, daß die Personeiner Kasse dieses Kapital lebenslänglich entlehnt, unddaß sie es bei dieser selben Kasee zur immerwährenden Verzinsunganlegt. Es ist klar, daß die Kasse dieses Kapitalden Erben am Ende des Todesjahres schuldig sein wird,aber sie wird nur jedes Jahr ,den cberschuß der Leibrenteüber die fortlaufenden Interessen auegezahlt haben. Die Tabelleder Lebensrenten wird also ersichtlich machen, was diePerson jährlich an die Kasse zahlen muß, um dieses Kapitalnach ihrem Tode zu versichern.
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 119Die See-Assekuranzen, die Assekuranzen gegen Brandund Gewitter und im allgemeinen alle Anst'alten dieser Artlassen sich nach denselben Prinzipien berechnen. Ein Geschäftsmannhat Schiffe auf hoher See, er will ihren JVertund den ihrer Ladung gegen die Gefahren, denen sie ausgesetztsind, versichern; zu dem Zwecke zahlt er eine Summean eine Gesellschaft, die ihm für den abgeschätzten Wertseiner Ladungen " und Schiffe haftet. Das Verhältnis diesesWertes zu der Summe, die als Versicherungsprämie gegebenwerden muß, hängt von den Gefahren ab, denen die Schiffeausgesetzt sind, und kann nur durch zahlreich angestellteBeobachtungen über das Schicksal der nach demselben Bestimmungso&eaus dem Hafen ausgelaufenen Schiffe abgeschätztwerden.Wenn die versicherten Personen der Versicherungsgesellschaftnur die durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmteSumme zahlten. so könnte diese Gesellschaft nichtdie Auslagen ihrer ~nstait bestreiten; sie müssen daher einenhöheren Preis für die Versicherung zahlen. Aber worin bestehtdann ihr Vorteil? Hier wird die Betrachtung desmoralischen Schadens nötig, der an die Ungewißheit geknüpftist. Da das ausgeglichenste Spiel, wie man gesehenhat, unvorteilhaft wird, weil der Spieler eine sichere Einlagegegen einen unsicheren Gewinn vertauscht, so begreift man,daß die Versicherung, durch die man das Unsichere gegen dasSichere vertauscht, vorteilhaft sein muß. Das ergibt sichin der Tat aus der Regel, die wie früher zur Bestimmungder moralischen Hoffnung aufgestellt haben, und aus der mannoch außerdem sieht, wie hoch sich die Summe belaufendarf, die man der Versicherungsgesellschaft zum Opfer bringenmuß, damit man noch immer einen moralischen Vorteil behält.Diese Gesellschaft kann also, indem sie diesen Vorteilverschafft, selbst noch einen großen Gewinn davontragen,wenn die Zahl der Versicherten sehr beträchtlich ist, eineBedingung, die für ihre dauerhafte Existens notwendig ist.Dann wird ihr Gewinn gewiß, und ihre mathematischen undmoralischen Hoffnungen fallen zusammen; denn die Analyseführt zu dem allgemeinen Theorem, daß, wenn die Anwartschaftensehr zahlreich sind, die beiden Hoffnungen sich unablässigeinander nähern und schließlich, im Falle einer unendlichenAnzahl von Anwartschaften, zusammenfallen.
Wir haben gesagt, als wir von der mathematischen undmoralischen Hoffnung sprachen, daß es ein moralischer Vorteilsei, das Risiko eines Gutes, das man erwartet, auf mehrereseiner Teile zu verteilen. So ist es besser, wenn maneine Summe Geldes aus einem entfernten Hafen kommenlassen will, dieselbe auf mehrere Schiffe zu verteilen, alssie einem einzigen anzuvertrauen. Das aber erreicht mandurch die wechselseitige Versicherung. Wenn zwei Personen,die jede die nämliche Summe auf zwei verschiedenen Schiffenhaben, die von demselben Hafen nach dem nämlichen Bestimmungsortabgehen, übereinkommen, das ganze Geld, dasihnen zukommen wird, in gleicher Weise zu teilen, so istklar, daß zufolge dieser tibereinkunft jede von ihnen dieSumme, die sie erwartet, auf beide Schiffe gleichmäßig verteilt.In Wahrheit läßt diese Art der Versicherung nochimmer Ungewißheit über den zu befürchtenden Verlust übrig.Aber diese Ungewißheit nimmt in dem Maße ab, als dieZahl der Teilnehmer zunimmt; der moralische Vorteil wächstimmer mehr und fällt schließlich mit dem mathematischen,seiner naturlichen Grenze, zusammen. Das macht diewechselseitige Versicherungsgesellscheft, wenn sie sehr zahlreichist. für die Versicherten vorteilhafter als die Versicherungsgesellschaften,die wegen des Gewinnes, den sie darausziehen, einen moralischen Vorteil geben, der immer kleinerals der mathematische Vorteil ist. Aber die Aufsicht überihre Verwaltung kann den Vorteil der wechselseitigen Versicherungaufwiegen. Alle diese Ergebnisse sind, wie manfrüher gesehen hat, unabhängig von dem Gesetze, das denmoralischen Vorteil ausdrückt.Man kann ein freies Volk wie eine große Gesellschaftbetrachten, deren Mitglieder sich gegenseitig ihr Eigentumgarantieren, indem sie im Verhältnis zu dieser Garantie dieLasten tragen. Das Bündnis von mehreren Völkern würdeihnen ähnliche Vorteile bringen, wie die, welche jedes Individuumvon der Gesellschaft zieht. Ein Kongreß ihrerVertreter würde die Gegenstände, die für alle von gemeinsamemNutzen sind, besprechen, und ohne Zweifel würde indiesem Kongresse das Gewichts-, Maß- und Geldsystem, dasvon den französischen Gelehrten in Vorschlag gebracht wurde,als eine der nützlichsten Sachen für die Handelsbeziehungenangenommen werden.
Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 121Unter den auf die Wahrscheinlichkeiten des menschlichenLebens gegründeten Anstalten sind diejenigen die besten, indenen man mittels eines geringen Opfers von seinem Einkommensich seine Existenz und die seiner Familie für eineZeit versichert, wo man fürchten muß, daß man diesenBedürfnissen nicht mehr gewachsen ist. So unmoralisch dasSpiel ist, ebenso vorteilhaft sind diese Anstalten für die Sitten,indem sie die süßesten Neigungen der Natur begünstigen.Die Regierung soll sie also ermutigen und sich ihrer in denWechselfällen des allgemeinen Schicksals annehmen; dennda sich die durch sie dargebotenen Hoffnungen auf eineferne Zukunft erstrecken, so können sie nur dort gedeihen,wo ihnen gegen jede Unsicherheit inbetreff ihrer DauerhaftigkeitSchutz gewährt wird. Das ist ein Vorteil, denihnen die Institution der Repräsentativ-Regierung zusichert.Sagen wir noch ein Wort über die Anleihen. Es istklar, daß man, um auf die Dauer zu entlehnen, jedes Jahrdas Produkt des Kapitals mit dem Zinsfuß zahlen muß.Aber man kann dieses Kapital in gleichen Abschlagszahlungen,die man während einer bestimmten Anzahl Jahre leistet, abtragenwollen, in Zahlungen, die man Annuitäten nennt, undderen Wert man auf folgende " Weise erhält. Jede Annuitätmuß, um auf den gegenwärtigen Zeitpunkt reduziert zu werden,durch die ebensovielte Potenz der um den Zinsfui3vermehrten Einheit dividiert werden, als die Zahl der Jahrebeträgt, nach deren Ablauf diese Annuität zu zahlen ist.Bildet man als eine geometrische Progression, deren erstesGlied die Annuität geteilt durch die um den Zinsfuß vermehrteEinheit ist, und deren letztes diese Annuität geteiltdurch dieselbe Größe, erhoben auf eine Potenz, die gleichder Anzahl der Jahre ist. während welcher die Zahlune statthabensoll, so wird die summe dieser Progression dtm entliehenenKapitale äquivalent sein, was den Wert der Annuitätbestimmt. Eine Tilgungskasse ist im Grunde nurein Mittel, eine fortlaufende Rente in Annuitäten zu verwandeln,mit dem einzigen Unterschiede, daß im Falle einerAnleihe durch Annuitäten die Interessen als konstant vorausgesetztwerden, während die Interessen der durch dieTilgungskasse erworbenen Renten veränderlich sind. M7ennsie in beiden Fällen gleich wären, so würde die den erworbenenRenten entsprechende Annuität aus diesen Renten
122 P. S. de Laplace:und aus dem gebildet sein, was der Staat jährlich an dieKasse abführt.Da die Lebensrententabellen das erforderliche Kapitalgeben, um die Lebensrente in irgend einem Alter zu bilden,so wird im Falle einer lebenslänglichen Anleihe eine einfacheProportion die Rente geben, die man dem Individuum, vondem man ein Kapital entlehnt, zahlen muß. Man kann nachdiesen Prinzipien alle möglichen Arten von Anleihen berechnen.Die Prinzipien, die wir soeben über die Vorteile undNachteile der Anstalten dargelegt haben, können dazu dienen,das Mittel aus irgend einer Anzahl bereits angestellter Beobachtungenzu bestimmen, wenn man auf die Abweichungender den verschiedene^ Beobachtungen entsprechenden ErgebnisseRücksicht nehmen will. Bezeichnen wir mit x die Kor-rektur des kleinsten Ergebnisses, und durch x + q, x + q',x + q" usw. die Korrekturen der folgenden Ergebnisse. Nennenwir E, E', E" USW. die Fehler der Beobachtungen, derenWahrscheinlichkeitsgesetz wir als bekannt annehmen wollen.Da jede Beobachtung eine Funktion des Ergebnisses ist, soist leicht zu sehen, daß, wenn man die Korrektur x diesesResultates als sehr klein annimmt, der Fehler E der erstenBeobachtung dem Produkte von x mit einem bestimmtenKoeffizienten gleich sein wird. In gleicher Weise wird derFehler E' der zweiten Beobachtung dem Produkte der Summeq plus x mit einem bestimmten Koeffizienten gleich sein undso fort. Da die Wahrscheinlichkeit des Fehlers E als eine bekannteFunktion gegeben ist, so erscheint sie als die nämlicheFunktion des ersten der früheren Produkte. Die WahrscheinlichkeitE' wird durch dieselbe Funktion des zweiten dieserProdukte ausgedrückt sein, und so fort. Die Wahrscheinlichkeitder gleichzeitigen Existenz der Fehler E, E', E" usw.wird also dem Produkte dieser verschiedenen Funktionenproportional sein, welches Produkt eine Funktion von x seinwird. Wenn man sich eine Kurve denkt, deren Abszisse xund deren entsprechende Ordinate dieses Produkt sein soll,so wird diese Kurve die Wahrscheinlichkeit der verschiedenenWerte von x darstellen, deren Grenzen durch die Grenzen derFehler E, E', E" usw. bestimmt sein werden. Bezeichnen wirjetzt mit X die Abszisse, die man wählen muß, so wird Xvermindert um x der Fehler sein, den man begehen würde,
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 123menn x die wahre Korrektur wäre. Dieser Fehler multipliziertmit der Wahrscheinlichkeit von x oder der entsprechendenOrdinate der Kurve wird das Produkt des Verlustes mitseiner Wahrscheinlichkeit sein, wenn man diesen Fehler, wiees geschehen muß, als einen Verlust betrachtet, der an dieWahl von X geknüpft ist. Multipliziert man dieses Produktmit dem Differenziale von X, so wird das Integral, genommenvon dem linken Ende der Kurve bis X, der Nachteil zufolgeder Xahl von X ein, der sich aus den Werten von x ergibt,die kleiner sind als X. Für die X7erte von X, die größer sindals X, würde x -X der Fehler von X sein, wenn x die wahreKorrektur wäre; das Integral des Produktes von x mit derentsprechenden Kurvenordinate und mit dem Differenzialevon x wird also der Nachteil von X sein, der sich aus denWerten von x ergibt, die größer sind als X, wobei dieses Integralgenommen wird von x gleich X bis zum rechten Endeder Kurve. Addiert man die~en Kachteil zu dem früheren,so wird die Summe der an die Wahl von X gekntipfte Nachteilsein. Die Wahl von X soll durch die Bedingung bestimmtwerden, daß dieser Nachteil ein Minimum sei, undeine sehr einfache Rechnung zeigt, daß zu dem Behufe X dieAbszisse sein muß, deren Ordinate die Kurve in zwei gleicheTeile teilt, so zwar, daß es ebenso wahrscheinlich ist, daß derwahre Wert von x diesseits als jenseits von X fällt.Berühmte Geometer haben für X den wahrscheinlichstenWert von X, und somit jenen gewählt, welcher der größtenOrdinate der Kurve entspricht; aber es scheint mir derfrühere Wert offenbar derjenige zu sein, den die Wahrscheinlichkeitstheorieangibt.Von den Täuschungen bei derschätzung der WahrscheinlichkDer Verstand ist ebenso Täuschungen ausgesetzt wie derGesichtssinn, und wie der Tastsinn die Täuschungen desletzteren berichtigt, ebenso berichtigen das Denken und dieRechnung die Täuschungen des ersteren. Die auf täglicheErfahrung begründete oder durch Furcht und Hoffnung übertriebeneWahrscheinlichkeit macht mehr Eindruck auf unsals eine größere, aber nur aus der Rechnung folgende Wahr-9*
scheinlichkeit. So z. B. tragen wir um geringer Vorteilewillen kein Bedenken, unser Leben Gefahren auszusetzen, dieviel weniger unwahrscheinlich sind als das Herauskommeneiner Quinte bei der Lotterie von Frankreich; und dochwürde sich niemand dieselben Vorteile verschaffen wollen mitder Gewißheit, das Leben zu verlieren, wenn diese Quinteherauskäme.Unsere Leidenschaften, unsere Vorurteile und die herrschendenMeinungen sind dadurch, daß sie die ihnen günstigenWahrscheinlichkeiten übertreiben und die entgegengesetztenvermindern, reichliche Quellen gefährlicher Täuschungen.Die gegenwärtigen Obel und die Ursache, die sie hervorbringt,machen einen viel größeren Eindruck auf uns als dieErinnerung an die tfbel, welche die entgegengesetzte Ursachehervorgebracht hat: sie hindern uns, die ubelständeder einen wie der anderen und die Wahrscheinlichkeit der geeignetenMittel zur Verhütung derselben richtig abzuschätzen.Das ist es, was die Völker abwechselnd zum Despotismus undzur Anarchie hintreibt, wenn sie einmal aus dem Zustandder Ruhe herausgetreten sind, in den sie dann immer nurnach langen und qualvollen Aufregungen zurückkehren.Dieser lebhafte Eindruck, den wir durch die Gegenwartder Ereignisse empfangen und der die Beachtung der entgegengesetztenvon anderen beobachteten Ereignisse kaumzuläßt, ist eine Hauptursache des Irrtums, vor der man sichnicht genug in acht nehmen kann.Besonders im Spiele nährt eine Menge von Täuschungendie Hoffnung und hält sie gegenüber den ungünstigen Chancenaufrecht. Die meisten Menschen, die in die Lotterie setzen,wissen nicht, wie viele Chancen zu ihrem Vorteile und wieviele zu ihrem Nachteile sind. Sie betrachten nur die Möglichkeit,bei einer geringen Einlage eine bedeutende Summezu gewinnen; und die Pläne, die ihnen die Phantasie eingibt,übertreiben in ihren Augen die Wahrscheinlichkeit,zu gewinnen: besonders der Arme, aufgestachelt von demWunsche nach einem besseren Schicksal, wagt sein Notwendigesauf dieses Spiel, indem er sich an die ÜngünstigstenKombinationen anklammert, die ihm einen großen Gewinnversprechen. Alle würden zweifellos erschrecken, wenn sievon der ungeheueren Anzahl der vergeudeten EinlagenKenntnis erhielten; aber man läßt es sich im Gegenteile
Von den Täuschungen bei der Abschätzung W.125angelegen sein, Gewinnste möglichst bekannt zu machen,was zu einer neuen Ursache der Aufstachelung zu diesemverhängnisvollen Spiele wird.Ist bei der Lotterie in Frankreich eine Kummer langeZeit nicht herausgekommen, so beeilt sich die Menge, dieselbemit Einlagen zu überhäufen. Man meint, daß die Nummer,die lange nicht gezogen wurde, beim künftigen Zuge eherals die anderen herauskommen müsse. Ein so allgemein verbreiteterIrrtum hängt, scheint mir, mit einer Täuschungzusammen, durch die man sich unwillkürlich im Geiste anden Ursprung der Ereignisse versetzt. Es ist z. B. ehr wenigwahrscheinlich, daß man im Spiele ,,Kopf und Wappen" Kopfzehnmal hintereinander werfen wird. Diese Un<strong>wahrscheinlichkeit</strong>,die uns auch noch auffällt, selbst wenn das Ereignisneunmal zugetroffen ist, veranlaßt uns zu glauben, daßbeim zehnten Wurfe doch Wappen auftreten werde. Die Vergangenheitmacht jedoch, indem sie in dem Münzstück einengrößeren Hang für Kopf als für Wappen anzeigt, das erstereEreignis wahrscheinlicher als das andere, so vergrößert sich,wie man gesehen hat, die Wahrscheinlichkeit, Kopf beim folgendenWurfe zu werfen. Eine ähnliche Täuschung bestimmtviele Leute zu glauben, daß man sicher in der Lotterie gewinnenkann, wenn man jedesmal auf ein und dieselbe Nummer,bis sie herauskommt, einen solchen Betrag setzt, daß derGewinn die Summe aller Einlagen übersteigt. Aber selbst,wenn auch häufig ähnliche Spekulationen nicht an der Unmöglichkeitsie weiterzuführen scheiterten, so würden sie denmathematischen Nachteil der Spekulanten nicht verringern,sie würde vielmehr ihren moralischen Nachteil vermehren, dasie mit jedem Zuge einen größeren Teil ihres Vermögens wagen.Ich habe gesehen, wie es Männern, die sich sehnlichsteinen Sohn zu haben wünschten, Schmerz verursachte, wennsie während des Monates, da sie Väter zu werden hofften,von Knabengeburten hörten. Indem sie sich einbildeten,daß das Verhältnis die~er Geburten zu jenen der Mädchenam Ende jedes Monates dasselbe sein müßte, dachten siesich, daß die bereits geborenen Knaben die künftigen Geburtender Mädchen wahrscheinlicher machten. So vermehrtdas Herausziehen einer weißen Kugel aus einer Urne, dieeine beschränkte Zahl weißer und schwarzer Kugeln enthält,die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel beim folgenden
Zuge herauszuziehen. Aber das findet nicht mehr statt, wenndie Zahl der Kugeln der Urne unbegrenzt ist, wie man esvoraussetzen muß, um diesen Fall dem der Geburten analogzu machen. Würden innerhalb eines Monates viel mehrKnaben als Mädchen geboren, so könnte man vermuten,daß zur der Zeit ihrer Empfängnis eine allgemeine Ursachedie männlichen Empfängnisse begünstigt hat, so daß diekünftige Geburt eines Knaben wahrscheinlicher erscheint.Die unregelmäßigen Ereignisse der Natur lassen sich nichtgenau mit dem Herauskommen der Nummern einer Lotterievergleichen, in der alle Nummern bei jedem Zuge vermischtwerden, so daß die Chancen ihres Herauskommens vollkommengleich sind. Das häufige Auftreten eines dieser Ereignissezeigt, wie es scheint, eine etwas andauernde Ursachean, die dasselbe begünstigt was die Wahrscheinlichkeit seinerkünftigen Wiederkehr vermehrt ; und seine lange anhaltendeWiederholung, wie z. B. eine lange Reihe von Regentagen,kann unbekannte Ursachen seiner Veränderung enthüllen,so zwar, daß wir bei jedem erwarteten Ereignis nicht wiebei jedem Zuge einer Lotterie in denselben Zustand der Ungewißheitdarüber, was eintreten soll, zurückversetzt werden.Aber in dem Maße, als man die Beobachtungen dieser Ereignissevervielfacht, wird der Vergleich ihrer Ergebnisse mitdenen der Lotterie genauer.Infolge einer der früheren entgegengesetzten Täuschungsucht man bei der Lotterie Frankreichs in den bereits erfolgtenZügen die am öftesten herausgekommenen Nummernaus, um mit ihnen Kombinationen zu bilden, auf die man mitVorteil seinen Einsatz machen zu können glaubt. Aber nachder Art, die die Nummern dieser Lotterie untereinander gemischtwerden, kann die Vergangenheit auf die Zukunftkeinerlei Einfluß haben. Das häufigere Herauskommen einerNummer ist nur ein Spiel des Zufalls: ich habe einige derartigeFälle der Berechnung unterworfen und beständig gefunden,daß sie in Grenzen eingeschlossen sind, die unter Voraussetzungeiner gleichen Möglichkeit für das Herauskommenaller Nummern ohne Un<strong>wahrscheinlichkeit</strong> angenommen werdenkönnen.In einer langen Reihe von Ereignissen derselben Artmüssen einzig und allein die Chancen des Zufalls manchmaljene eigentümlichen Züge des Glücks oder Unglücks mit
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw.127sich bringen, welche weitaus die meisten Spieler stets einerArt Verhängnis zuzuschreiben pflegen. Bei den Spielen, dievom Zufall und der Geschicklichkeit des Spielers zugleich abhängen,ereignet es sich oft, daß derjenige, der verliert, durchseinen Verlust in Aufregung versetzt, denselben durch gewagteSpiele, die er in einer anderen Situation vermeiden würde,wieder gut zu machen sucht; dadurch vergrößert er seineigenes Unglück und verlängert dessen Dauer. Gerade dannwird die Klugheit notwendig, und dann ist es wichtig, sich zuüberzeugen, daß sich der moralische Nachteil, der an dieungünstigen Chancen geknüpft ist, durch das Unglück selbstvergrößert.Das Gefühl, durch das der Mensch sich lange Zeit inden Mittelpunkt des Weltalls gestellt hat, indem er sich alseinen Gegenstand der besonderen Sorgfalt der Natur betrachtet,bringt jeden Einzelnen dahin, sich zum Mittelpunkteeiner mehr oder minder ausgebreiteten Sphäre zu machen, undführt ihn zu den Glauben, daß er vom Zufall bevorzugtwerde. Von dieser Meinung durchdrungen wagen die Spieleroft beträchtliche Summen auf Spiele, von denen sie wissen,daß die Chancen ihnen ungünstig sind. In der Führung desLebens kann eine ähnliche Meinung manchmal vorteilhaftsein, aber meist führt sie zu verhängnisvollen Unternehmungen.Hier wie in allen Fällen sind Täuschungen gefährlichund nur die Wahrheit ist im allgemeinen nützlich.Einer der großen Vorteile der Wahrscheinlichkeitsrechnungist der, daß man lernt, dem ersten Anschein zu mißtrauen.Da man dort, wo man ihn der Berechnung unterziehenkann, erkennt, daß er oft täuscht, so muß man darausschließen, daß man sich ihm in anderen Fällen nur mitAnwendung der äußersten Vorsicht überlassen darf. Beweisenwir das durch Beispiele.Eine Urne schließt vier Kugeln, schwarze oder weiße,ein, die aber nicht alle von derselben Farbe sind. Man hateine dieser Kugeln herausgezogen, deren Farbe weiß ist, undwieder in die Urne hineingelegt, um noch zu ähnlichenZiehungen zu schreiten. Man fragt nach der Wahrscheinlichkeit,daß in den folgenden vier Zügen nur schwarze Kugelnherausgezogen werden.Wenn die weißen und schwarzen Kugeln der Zahl nachgleich wären, so würde diese Wahrscheinlichkeit der vierten
Potenz der Wahrscheinlichkeit 2,bei jedem Zuge eine2schwarze Kugel herauszuziehen, gleich sein; sie wäre also-1 Aber das Herausziehen einer weißen Kugel beim ersten-. 16'Zuge weist auf eine fiberlegenheit in der Zahl der weißenKugeln der Urne hin; denn wenn man annimmt, daß in derUrne sich drei weiße und eine schwarze Kugel befinden, so istdie Wahrscheinlichkeit, daraus eine weiße Kugel heraus-3 2zuziehen, -; sie ist -, wenn man voraussetzt, daß zwei4 4Kugeln weiß und zwei schwarz sind; endlich wird sie sichiauf reduzieren, wenn man drei Kugeln als schwarz und4eine als weiß annimmt. Nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeitder Ursachen auf Grund der Ereignisse verhaltensich die Wahrscheinlichkeiten dieser drei Annahmen wie die3 2 1 3 2 1Es ist also4' 4 4 6' 6' 6fünf gegen eins zu wetten, daß die Zahl der schwarzen Kugelngeringer oder höchstens gleich der der weißen ist. Es scheintdaher. daß nach dem Herausziehen einer weißen Kuael beimersten' Zuge die Wahrscheinlichkeit, vier schwarzev~ugelnnacheinander herauszuziehen;geringer sein müsse als in demIFalle der Gleichheit der Farben, oder kleiner als I.Des16trifft jedoch nicht zu, und man findet durch eine sehreinfache Rechnung, daß diese Wahrscheinlichkeiten größerGrößen - -, -; sie sind gleich ---.1 1als - ist. In der Tat wäre sie die vierte Potenz von -,14 42 3von-, von - nach der ersten, der zweiten und der dritten4 4der früheren Annahmen über die Farben der Kugeln derUrne. Multipliziert man beziehungsweise jede Potenz mitder Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Annahme, d. h.3 2 1mit -- und -, so wird die Summe der Produkte die6' 6 6Wahrscheinlichkeit sein, vier schwarze Kugeln nacheinanderherauszuziehen. Man erhält so für diese Wahrscheinlich-
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 12929 1keit -, ein Bruch, der größer als -ist. Dieser Widerspmch384 14erklärt sich, wenn man erwägt, daß der Hinweis auf die oberlegenheitder weißen Kugeln über die schwarzen beim erstenZuge nicht die f'berlegenheit der schwarzen Kugeln über dieweißen ausschließt, eine Gberlegenheit, durch welche aberdie Annahme der Gleichheit der Farben ausgeschlossen wird.Nun muß diese t'berlegenheit, obgleich wenig wahrscheinlich,die Wahrscheinlichkeit, eine gegebene Anzahl mal nacheinanderschwarze Kugeln herauszuziehen, größer machen alszufolge dieser Annahme, wenn die Zahl der Kugeln bedeutendist; und man hat eben gesehen, daß dies einzutreten beginnt,wenn die gegebene Zahl gleich vier ist.Betrachten wir noch eine Crne, welche mehrere weißeund schwarze Kugeln enthält. Kehmen wir zuerst an, esgäbe nur eine weiße und eine schwarze Kugel. Man kanndann mit gleichen Chancen wetten, in einem Zuge eine weißeKugel herauszuziehen. Aber es scheint, daß man für dieseGleichheit der Chancen beim Wetten demjenigen, der daraufwettet, daß eine weiße Kugel herausgezogen wird, zwei Zügegeben muß, wenn die Urne zwei schwarze und eine weißeKugel enthält, dagegen drei Züge, wenn die Urne drei schwarzeund eine weiße Kugel enthält, und so fort; dabei ist angenommen,daß nach jedem Zuge die herausgenommene Kugelwieder in die Urne hineingelegt wird.Aber man kann sich leicht überzeugen, daß dieser ersteAnschein trügerisch iet.In der Tat ist in dem Falle, wozwei schwarze auf eine weiße Kugel kommen, die Wahrscheinlichkeit,zwei schwarze Kugeln in zwei Zügen aus2der Urne herauszuziehen, gleich der zweiten Potenz von -, 34oder -; aber diese Wahrscheinlichkeit zu der, eine weiße9Kugel in zwei Zügen herauszuziehen, hinzugefügt, gibt dieGewißheit oder Eins, da es gewiß ist, daß man zwei schwarzeKugeln oder wenigstens eine weiße Kugel herausziehen muß;5die Wahrscheinlichkeit dieses letzteren Falles ist also -, mit-9hin größer als -. J.2Der Vorteil wäre noch größer, zu wetten,
daß in fünf Zügen eine weiße Kugel herauskommt, wenn dieUrne fünf schwarze und eine weiße Kugel enthält; dieseWette ist sogar noch vorteilhaft für vier Züge: sie läuftdann darauf hinaus, in vier Würfen mit einem einzigen Würfelsechs zu werfen.Chevalier de M6r6, der Freund Pascals, der zur Entstehungder Wahrscheinlichkeitsrechnung dadurch Veranlassunggab, deß er diesen großen Geometer anregte, sich damitzu beschäftigen, erklärte diesem, ,,daß er aus folgendemGrunde eine Unrichtigkeit in den Zahlen gefunden habe.Unternimmt man es, sechs mit einem Würfel zu werfen, sobesteht, wenn man das in vier Würfen zustande bringenwill, dafür ein Vorteil wie der von 671 zu 625. Unternimmtman es aber, mit zwei Wurfeln zweimal sechs zuwerfen, so ist es von Nachteil, es in 24 Würfen tun zu wollen.Gleichwohl verhält sich 24 zu 36, der Zahl der Flächenbei zwei Würfeln, wie 4 zu 6, der Zahl der Flächen bei einemWürfel.",,Das ists, schrieb Pascal an Fermat, worüber erso viel Lärm geschlagen hat, so da5 er sich erkühnte zu behaupten,daß die Sätze nicht fest stehen, und daß die Arithmetiksich widerspreche . . . Er hat sehr viel Verstand,aber er ist kein Geometer, das ist, wie Sie wissen, ein großerMangel." Chevalier de MAr6, irregeführt durch eine falscheAnalogie, meinte, daß im Falle der Gleichheiten der Wettendie Zahl der Würfe proportional mit der Zahl aller möglichenChancen wachsen müsse, was nicht ganz richtig ist, aberwas um so mehr zutrifft, je größer die Zahl wird.Man hat die Oberlegenheit der Geburten der Knaben überdie der Mädchen durch den allgemeinen Wunsch der Väter,einen Sohn zu haben, der ihren Namen fortpflanze, zu erklärengesucht. So hat man z. B. geglaubt, daß bei einer Urne,die mit einer unendlichen Anzahl von weißen und schwarzenKugeln in gleicher Anzahl angefüllt ist, und bei einer großenZahl von Personen, von denen jede eine Kugel aus dieserUrne herausnimmt und diesen Zug mit der Absicht fortsetzt,erst dann aufzuhören, wenn sie eine weiße Kugel herausgezogenhat, diese Absicht die Zahl der herausgezogenen weißenKugeln derjenigen der schwarzen überlegen machen müßte.In Wirklichkeit ergibt sie notwendigerweise nach allen Zügeneine Anzahl weißer Kugeln, die derjenigen der Personengleich ist; und es ist möglich, da5 bei diesen Zügen keine
Von den Tiiuschungen bei der Abschatzung usw.131schwarze Kugel herauskommt. Aber es ist leicht zu erkennen,daß dieses Apercu nur eine Täuschung ist; denn wenn man sichvorstellt, daß bei einem ersten Zuge alle Personen zugleicheine Kugel aus der Urne nehmen, so ist klar, daß ihre Absichtkeinen Einfluß auf die Farbe der Kugeln haben kann, diebei diesem Zuge herauskommen müssen. Die einzige Wirkungwird die sein, daß die Personen, die beim ersten Zuge eineweiße Kugel herausgezogen haben, vom zweiten Zuge ausgeschlossensein werden. Es ist in gleicher Weise ersichtlich,daß die Absicht der an einem neuen Zuge teilnehmendenPersonen auf die Farbe der Kugeln, die herauskommenwerden, keinen Einfluß haben, und daß es sich gerade so beiden folgenden Zügen verhalten wird. Diese Absicht wird dahergar keinen Einfluß ausüben auf die Farbe der in derGesamtheit der Züge herausgezogenen Kugeln; nur wird siebewirken, daß mehr oder weniger Personen bei jedem Zugeteilnehmen. Das Verhältnis der herausgezogenen weißenzu den schwarzen Kugeln wird auf diese Weise sehr wenigvon Eins verschieden sein. Wenn also die Zahl der Personensehr groß angenommen wird, und die Beobachtung einVerhältnis unter den herausgezogenen Farben gibt, welchesmerklich von der Einheit abweicht, so ist es sehr wahrscheinlich,daß zwischen Eins und dem Verhältnis der weißen zuden schwarzen Kugeln der Urne fast genau die nämlicheDifferenz stattfindet.Ich rechne auch noch unter die Zahl der Täuschungendie Anwendung, die Leibniz und Daniel Bernoulli von derWahrscheinlichkeitsrechnung auf die Summierung der Reihengemacht haben. Wenn man den Bruch, dessen Zähler Einsund dessen Nenner Eins plus einer Variablen ist, in einenach Potenzen dieser Variabeln geordnete Reihe entwickelt,so ist leicht einzusehen, daß für die Variable Eins der1Bruch - und die Reihe plus Eins, minus Eins, plus Eins,2minus Eins, usw. wird. Faßt man die beiden ersten Gliederzusammen, die beiden folgenden und so fort, so tranciformiertman die Reihe in eine andere, deren jedes Glied null ist.Grandi, ein italienischer Jesuit, hatte daraus auf die Möglichkeitder Schöpfung geschlossen; denn da die Reihe stetsgleich I/, ist, so sah er diesen Bruch aus einer unendlichenAnzahl von Nullen oder aus dem Nichts entstehen. Ebenso
glaubte Leibniz in seiner binären Arithmetik, in der er nurdie beiden Zeichen Null und die Einheit verwendete, dasBild der Schöpfung vor sich zu haben. Da nämlich Gottdurch Eins und das Nichts durch die Null dargestellt werdenkönne, stellte er sich vor, da0 das höchste Wesen aus demNichts alle Wesen hervorgebracht hätte, gerade so wie dieEinheit mit der Null alle Zahlen in diesem arithmetischenSysteme erzeugt. Dieser Gedanke gefiel Leibniz so sehr,daß er ihn dem Jesuiten Grimaldi, dem Präsidenten des Tribunalsfür Mathematik in China, mitteilte, in der Hoffnung,daß diese Versinnbildung der Schöpfung den damaligenKaiser, der die Wissenschaften besonders liebte, zum Christentumebekehren würde. Ich führe diesen Zug nur an, um zuzeigen, bis wohin die Vorurteile der Kindheit die größtenMänner irreführen können.Leibniz, der sich immer von einer eigentümlichen undsehr ungezügelten Metaphysik leiten ließ, überlegte, daßdie Reihe plus Eins, minus Eins, plus Eins, usw. Eins oderNull wird, je nachdem man bei einer ungeraden oder geradenAnzahl von Gliedern stehen bleibt; und da man im Unendlichenkeinerlei Grund hat, die gerade oder ungerade Zahl zubevorzugen, so muß man nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitdie Hälfte der Ergebnisse bezüglich dieser beidenArten von Zahlen, d. b. von Null oder Eins, nehmen, was i/2als Wert der Reihe gibt. Daniel Bernoulli hat seitdem dieseBegründungsweise auf die Summierung der aus periodischenGliedern gebildeten Reihen ausgedehnt. Aber alle dieseReihen haben eigentlich gar keine Werte, sie erhalten nurdann einen Wert, wenn ihre Glieder mit den aufeinanderfolgendenPotenzen einer Variabeln, die kleiner als Eins ist,multipliziert werden. Dann sind diese Reihen immer konvergent,wie klein man auch den Unterschied zwischen dieserVariabeln und Eins annimmt, und es ist leicht zu zeigen,daß die von Bernoulli vermöge der Wahrscheinlichkeitsrege1angegebenen Werte gerade die Werte der erzeugendenBrüche der Reihen sind, wenn man in diesen Brüchen dieVariable gleich i annimmt. Diese Werte sind auch die Grenzen,denen die Reihen in dem Maße sich mehr und mehrnähern, als die Variable sich der Eins nähert. Aber wenndie Variable genau gleich Eins ist, dann hören die Reihen aufkonvergent zu sein; sie erhalten dann nur insofern Werte, als
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 133man sie irgendwo abbricht. Die merkwürdige Beziehung dieserAnwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu den Grenzender Werte der periodischen Reihen setzt voraus, daßdie Glieder dieser Reihen mit allen aufeinanderfolgenden Potenzender Variabeln multipliziert werden. Aber diese Reihenkönnen aus der Entwicklung einer unendlichen Anzahl verschiedenerBrüche sich ergeben, bei denen das nicht stattfindet.So kann z. B. die Reihe 1-1+ 1-. . . aus der Entwicklungeines Bruches entstehen, dessen Zähler die Einheitmehr der Variabeln, und dessen Nenner dieser Zähler vermehrtum das Quadrat der Variabeln ist. Setzt man die Variabelnder Einheit gleich, so verwandelt sich diese Entwicklung in dieAvorgelegte Reihe, und der erzeugende Bruch wird gleich -; '43die Regeln der Wahrscheinlichkeit würden also dann ein falschesResultat geben, was beweist, wie gefährlich es wäre,iihnliche Beweisführungen anzuwenden, insbesondere in denmathematischen Wissenschaften, die durch die Strenge ihresVerfahrens in hervorragender Weise ausgezeichnet sein sollen.Wir werden naturgemäß zu den Glauben gebracht, daßdie Ordnung, nach der wir die Dinge auf der Erde sich erneuernsehen, zu allen Zeiten existiert hat und immer existierenwird. In der Tat, wenn der gegenwärtige Zustand des Weltallsdem früheren, der ihn hervorgebracht hat, durchausähnlich wäre, so würde er seinerseits einen gleichen Zustandhervorbringen; die Aufeinanderfolge dieser Zustände würdedann also ewig sein. Ich habe durch Anwendung der Analyseauf das Gesetz der allgemeinen Schwere erkannt, daß dieRotations- und Umlaufsbewegungen der Planeten und Trabantenund die Lage ihrer Bahnen und ihrer Aquatoren nurperiodischen Ungleichheiten unterworfen sind. Durch einenVergleich der Theorie der Säkulargleichung des Mondes mitden alten Verfinsterungen fand ich, daß seit Hipparch sichdie Dauer des Tages nicht um ein Hundertstel einer Sekundegeändert, und die mittlere Temperatur der Erde sich nichtum ein Hundertstel eines Grades vermindert hat. So scheintdie Beständigkeit der bestehenden Ordnung durch die Theorieund durch Beobachtungen zugleich erwiesen sein. Aber dieseOrdnung wird gestört durch mannigfache Ursachen, die wohleine sufmerkseme Prüfung erkennen läßt, die man aber der Berechnungnicht unterwerfen kann.
Die Kirkungen des Ozeans, der Atmosphäre und derMeteore, die Erdbeben und Ausbrüche der Vulkane erschütternunablässig die Erdoberfläche und müesen da~elbst mitder Zeit beträchtliche Veränderungen herbeiführen. Die Temperaturder Klimate, die Au~dehnung der Atmosphäre unddas Verhältnis der sie zusammensetzenden Gase können sichin unmerklicher Weiee verändern. Da die zur Bestimmungdieser Veränderungen geeigneten Instrumente und Mittel neusind, so hat uns die Beobachtung bis jetzt in dieser Hinsichtnichts lehren können. Aber es ist sehr wenig wahrscheinlich,daß die Ursachen, welche die unsere Luft zusammensetzendenGaee absorbieren und erneuern, sie genauin den betreffenden Mengen erhalten. Eine lange Reihe vonJahrhunderten wird die Modifikationen erkennen lassen, welchealle die~e für die Erhaltung organisierter Wesen so unumgänglichnotwendigen Substanzen erfahren. Obgleich die historischenDenkmäler auf kein sehr hohes Alter zurückreichen,so zeigen sie uns doch immerhin genügend große Umwälzungen,die durch langsame und beständige Wirkung nattirlicherAgentien entstanden sind. Wenn man das Innere der Erdedurchwühlt, so entdeckt man zahlreiche Trümmer einer untergegangenenund von der jetzt bestehenden ganz verschiedenenNatur. Gbrigens, wenn die ganze Erde ursprünglich, woraufalles hinzuweisen scheint, flüssig gewesen ist, so begreift man,daß beim Obergang von diesem Zustande zu dem jetzigenihre Oberfläche ungeheure Veränderungen erfahren habenmußte. Der Himmel selbst ist trotz der Ordnung seiner Bewegungennicht unveränderlich. Der Widerstand des Lichtesund anderer ätherischer Fluida und die Anziehung der Sternemüssen nach einer sehr großen Zahl von Jahrhunderten diePlanetenbewegungen beträchtlich ändern. Die in den Sternenund in der Gestalt der Nebelmassen schon jetzt beobachtetenVeränderungen lae~en jene ahnen, welche die Zeit in demSysteme dieser großen Himmelkörper entwickeln wird. Mankann die aufeinanderfolgenden Zustände des Universumsdurch eine Kurve darstellen, durch deren Abszisse die Zeit unddurch deren Ordinaten diese verschiedenen Zustände ausgedrücktwürden. Da wir aber kaum ein Element dieserKurve kennen, so sind wir noch lange nicht imstande, aufihren Ursprung zurückzugehen; und wenn man zur Beruhigungdes Geistes, der beständig in Cnruhe darüber ist,
Von den Täuschungen bei der Abschätzung um. 135daß er die Ursache der ihn interessierenden Phänomene nichtkennt, einige Vermutungen wagt, so ist es weise, sie nurmit der äußerst'en Vorsicht auszusprechen.Es existiert in der Abschätzung der Wahrecheinlichkeiteneine Art von Täuschungen, die, weil sie besonders von denGesetzen der geistigen Organisation abhängen, eine eingehendePrüfung dieser Gesetze notwendig machen, um sich davor zuechützen. Der Wunsch in die Zukunft einzudringen und dieBeziehungen einiger merkwürdiger Ereignisse zu den Reissagungender Astrologen, der Wahrsager und der Auguren,zu den Ahnungen und Träumen, zu den Zahlen und denTagen, die für Glücks- oder Cnglückst'age gehalten werden,haben zu einer Menge noch sehr verbreiteter VorurteileVeranlassung gegeben. Man achtet nicht auf die großeZahl von Nicht-t'bereinstimmungen, die keinerlei Eindruckgemacht haben, oder von denen man nichts weiß. Unddoch ist es notwendig, dieselben kennen zu lernen, um dieWahrscheinlichkeit der Ursachen abzuschätzen, denen mandie fiberein~timmun~en zuschreibt. Diese Kenntnis würde.ohne Zweifel bestätigen, was uns die Vernunft hinsichtlichdieser Vorurteile vorschreibt. So machte der Philosoph desAltertums, dem man in dem Tempel eines Gottes zur Anpreisungvon dessen Macht die Denkbilder aller durch seineAnrufung vom Schiffbruch Geretteten zeigte, eine mit derWahrscheinlichkeitsrechnung übereinstimmende Bemerkung,als er sagte, daß er die Namen derer vermisse, die trotz dieserAnrufung zugrunde gegangen wären. Cicero hat alle diese,Vorurteile ehr scharfsinnig und beredt in seiner Abhandlungüber die Wahrsagekunst widerlegt, welche er durch eine Stelle.abschließt, die ich hier zitieren werde, denn wir lieben es,bei den Alten die Züge der ewigen Vernunft wiederzufinden,welche, durch das von ihr aufgehende Licht alle Vorurteileverscheuchend, die einzige Grundlage der menschlichenInstitutionen werden wird. ,,Man muß", sagt der römische.Redner, „die Wahrsagerei durch Träume und alle ähnlichenVorurteile verwerfen. Der überall verbreitete Aberglaube hatdie Mehrzahl der Geister unterjocht und sich der Schwächeder Menschen bemächtigt. Das haben wir in unEeren Büchernüber die Natur der Götter und speziell in die~em Werkeentwickelt in der t'berzeugung, daß wir uns selbst wie denanderen etwas Nützliches tun, wenn es uns gelingt, den Aber-
P. S. de Laplace:glauben zu zerstören. Ich bin jedoch (und ich wünsche vorallem, daß in dieser Hinsicht meine Absicht wohl verstandenwerde), weit davon entfernt, die Religion erschüttern zuwollen, indem ich den Aberglauben zerstöre. Die Weisheitgebietet uns, die Institutionen und Zeremonien unserer Vorfahren,die sich auf die Verehrung der Götter beziehen, zubewahren. Ubrigens zwingt uns die Schönheit des Weltallsund die Ordnung der Dinge am Himmel, irgend ein höheresWesen anzuerkennen, das vom Menschengeschlechte beachtetund bewundert werden soll. Aber in dem Maße, als es sichziemt, die Religion, die sich an die Kenntnis der Natur knüpft,auszubreiten, ebenso muß man an der Ausrottung des Aberglaubensarbeiten; denn er quält, bedrückt und verfolgtuns unaufhörlich und überall. Befragt ihr einen Wahrsageroder ein Wahrzeichen, bringt ihr ein Opfer dar, betrachtetihr den Flug eines Vogels, begegnet ihr einem Chaldäer oderHaruspex, blitzt oder donnert es, oder schlägt es ein, entstehtoder offenbart sich eine Art Wunder, lauter Dinge,von denen zuweilen sich eines ereignen muß, dann läßteuch der Aberglaube, der euch beherrscht, keine Ruhe. Selbstder Schlaf, die Zuflucht der Sterblichen in ihren Mühen undArbeiten, wird durch denselben vielmehr zu einem Gegenstandeder Unruhe und des Schreckens."Alle diese Vorurteile und aller Schrecken, den sie einflößen,hängen mit physiologischen Ursachen zusammen, dieoft noch mächtig zu wirken fortfahren, selbst nachdem unsdie Vernunft bereits eines Besseren belehrt hat. Aber dieWiederholung von Handlungen, die diesen Vorurteilen entgegengesetztsind, kann sie immer zerstören. Das ist es,was wir nun durch die folgenden Betrachtungen dartunwollen.An den Grenzen der Physiologie des Sichtbaren beginnteine andere Physiologie, deren Phänomene, viel mannigfaltigerals die der ersteren, wie diese Gesetzen unterworfen sind, diezu kennen von großer Wichtigkeit ist. Diese Physiologie,die wir mit dem Namen ,,Psychologie" bezeichnen werden,ist ohne Zweifel die Fortsetzung der Physiologie des Sichtbaren.Die Nerven, deren Fäserchen sich in der Marksubstanzverlieren, leiten die Eindrücke fort, die sie von denäußeren Gegenständen erhalten, und sie lassen daselbstbleibende Eindrücke zurück, die in einer unbekannten Weise
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 137das Sensorium oder den Sitz der Empfindung und des Gedankensmodifizieren1). Die äußeren Sinne können nichtsüber die Natur dieser Modifikationen lehren, die durch ihreunendliche Mannigfaltigkeit und durch die Sonderung unddie Ordnung, die sie in dem kleinen Raume, der sie einschließt,bewahren, Staunen erregen; Modifikationen, von denen unsdie so mannigfachen Erscheinungen des Lichtes und der Elektrizitäteinen Begriff geben. Aber wenn man auf die Beobachtungendes inneren Sinnes, der sie allein wahrnehmenkann, dieselbe Methode anwendet, die für die Beobachtungender äußeren Sinne angewandt wurde, so wird man in derTheorie des menschlichen Verstandes dieselbe Genauigkeitwie bei den anderen Zweigen der Naturphilosophie erreichenkönnen.Schon sind einige Prinzipien2) der Psychologie erkanntund mit Erfolg entwickelt worden. Solcher Art ist das Strebenaller iihnlichen organisierten Wesen, miteinander in Eintrachtzu lebon. Dieses Streben, welches das, was wir Sympathienennen, ausmacht, besteht sogar noch unter Tieren verlichiedenerGattungen: sie nimmt aber in dem Maße rrb, als ihreOrganisation unähnlicher wird. Unter den Wesen, die mitderselben Organisation ausgestattet sind, passen sich einigeenger aneinander an als an andere. Die unorganische Naturbietet uns ähnliche Erscheinungen dar: zwei Pendel- oderTaschenuhren, deren Gang sehr wenig voneinander verschiedenist, nehmen, auf dieselbe Unterlage gestellt, schließlichgenau denselben Gang an; und in einem Systeme von tönendenSaiten lassen die Schwingungen einer von ihnen allemit ihr harmonischen mitertönen. Diese Wirkungen, derenwohlbekannte Ursachen der Berechnung unterworfen wordensind, geben einen richtigen Begriff von der Sympathie, dieaber von weit komplizierteren Ursachen abhängt.Die sympathischen Bewegungen begleitet fast immer einangenehmes Gefühl. Bei den meisten Tiergattungen schließensich auf diese Weise die einzelnen Individuen aneinanderund vereinen sich zu Gesellschaften. Unter den Menschenl) Die folgenden Betrachtungen sind durchaus unabhiingigvon der Stelle dieses Sitzes und von der Natur desselben.8) Ich bezeichne hier mit dem Namen „Prinzipien" die aligemeinenBeziehungen der Erscheinungen.0.K. 233. 10
fühlen starke Geister ein wahres Glück darin, die schwachenGeister zu beherrschen, die ihrerseits ein ebenso großesGlück darin finden, sich jenen unterzuordnen. Die sympatischenGefühle, die in einer großen Zahl von Individuengleichzeitig erregt werden, verstärken sich durch ihre gegenseitigeRückwirkung, wie man bei einer Vorstellung im Theaterbeobachten kann. Das Vergnügen, das daraus entsteht, bringtdie Personen mit ähnlichen Meinungen einander nahe, undihre Vereinigung regt sie zuweilen bis zum Fanatismus auf.So entstehen die Sekten, sowie die Begeisterung, die sie hervorrufenund die große Schnelligkeit ihrer Verbreitung. Siebieten in der Geschichte die staunenerregendsten und verhängnisvollstenBeispiele von der Macht der Sympathie.Man hat oft Gelegenheit wahrzunehmen, mit welcher Leichtigkeitsympathische Bewegungen, wie z. B. das Lachen, sichdurch bloßen Anblick mitteilen ohne irgend einen anderenAnteil von Seiten derer, die sie empfangen. Der Einfluß derSympathie auf das Sensorium ist unvergleichlich mächtiger.Die Vibrationen, die sie daselbst erregt, bringen, wenn sieaußerordentlich stark sind, durch Rückwirkung auf dasPhysische außergewöhnliche Wirkungen hervor, die man inden Jahrhunderten des Aberglaubens übernatürlichen Agentienzugeschrieben hat, und die wegen ihrer Eigentümlichkeitdie Aufmerksamkeit der Beobachter verdienen.Der Hang zur Nachahmung besteht sogar in Hinsicht aufdie Gegenstände der Einbildung. Befinden wir uns in einemWagen, der sich gegen ein Hindernis hinzubewegen scheint, soahmen wir unwillkürlich die Bewegung nach, die er annehmenmuß, um dem Hindernis auszuweichen. Man kann sich vorstellen,daß die Vorstellung, die man sich von dieser Bewegungmacht, und der Hang zur Nachahmung derselben gewissenBewegungen des Sensoriums entsprechen, von denendie erste die zweite hervorbringt, wie etwa die Schwingungeneiner tönenden Saite ihre harmonischen mitschwingen läßt.Auf diese Weise erklärt man sich, wie die Vorstellung vomSturz in einen Abgrund, durch die Furcht mächtig eingeprägt,denjenigen, der auf einem schmalen Brette darüberhinschreitet, hinabstürzen kann, während er mit fe~temSchritte über dasselbe hinüberlaufen würde, wenn es seinerganzen Länge nach auf festen Boden gelegt wäre. Ich kennePersonen, die einen solchen Trieb haben, sich von einer
Von den Täuschungen bei der Absohiitzung usw. 139großen Höhe, auf der sie sich befinden, herabzustürzen, daßsie, um demselben widerstehen zu können, gezwungen sind,die Vorkehrungen zu verdoppeln, die getroffen wurden siezurückzuhalten und doch wohl zu ihrer Sicherung geei~etwaren.Infolge eines edlen Vorrechtes des Menschengeschlechtsentflammt uns die Erzählung großer und tugendhafter Handlungenund treibt uns an, sie nachzuahmen. Aber mancheIndividuen besitzen infolge ihrer Organisation oder infolgeverderblicher Beispiele verhängnisvolle Neigungen, welchedie Erzählung einer verbrecherischer Handlung, die zumGegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit geworden ist, in lebhafteErregung versetzt. In dieser Beziehung ist das öffentlicheBekanntmachen der Verbrechen nicht ohne Gefahr.Das Mitleid, das Wohlwollen und viele andere Empfindungenleiten sich von der Sympathie ab. Durch sie fühltman die Leiden anderer und teilt die Zufriedenheit des Unglücklichen,den man unterstützt. Aber ich will hier nurdie Prinzipien der Psychologie darlegen, ohne in die Entwicklungihrer Folgerungen einzugehen l).Das eine dieser Prinzipien, und das fruchtbarste vonallen, betrifft die Verknüpfung aller Dinge, die im Sensoriumgleichzeitig existieren oder regelmäßig aufeinander folgen;eine Verknüpfung, die durch die Rückkehr eines von ihnen dieanderen zurückruft. Die Gegenstände, die wir schon einmalgesehen haben, erwecken die Eindrücke der Dinge, die beimersten Anblick mit ihnen assoziiert waren. Diese Eindrückeerwecken in gleicher Weise die anderer Gegenstände und sofort; so zwar, daß wir, wenn eine Sache uns vor Augen liegt,eine unendliche Reihe anderer hervorrufen und unsere Aufmerksamkeitbei jenen verweilen lassen können, auf die wirunsere Betrachtung richten wollen. An dies Prinzip kniipftsich der Gebrauch der Zeichen und Sprachen, um Gefühle undGedanken wieder wach zu rufen, um eine Analyse kompli-zierter, abstrakter und allgemeiner Gedanken anzustellen undum Schlußfolgerungen zu bilden. Mehrere Philosophenl) Die Erzählung, welche Montaigne in seinen Essais von derFreundschaft gibt, die zwischen ihm und La Boetie bestand, gibtein sehr merkwürdiges Beispiel einer außerordentlich seltenenArt von Sympathie.10'
haben diesen Gegenstand, der bis jetzt den reellen Teil derMetaphysik bildet, in schöner Weise entwickelt.Vermöge dieses Prinzipes gelangt man dahin, die Distanzenmit bloßem Auge abzuschätzen. Eine oft wiederholteVergleichung des Meters mit verschiedenen Distanzen, dieeine ganze Anzahl derselben enthalten, prägt dem Gedächtnisdie Eindrücke ein, die mit der Zahl der zugehörigen Meterassoziiert sind. Der Anblick einer Distanz, die man abschätzenwill, erweckt diese Eindrücke wieder; und wenneiner von ihnen genau oder sehr nahe mit dem Eindruckevon der Distanz, die man vor Augen hat, zusammenpaßt,60 schließt man, daß diese Distanz die Zahl der Meter enthält,die in dem Gedächtnis mit dem Eindrucke, der ihr gleichscheint, assoziiert ist. Auf dieselbe Weise gelangt man auchdazu, die Gewichte der Körper abzuschätzen, indem man siemit der Hand abwägt.Man kann es als Prinzip der Psychologie aufstellen, daßdie oft wiederholten Eindrücke eines und desselben Gegenstandesauf verschiedene Sinnesorgane da3 Sensorium in derArt modifizieren, daß der innere Eindruck, der dem äußerenEindrucke des Gegenstandes auf ein einziges Sinnesorganentspricht, sehr verschieden von dem wird, der er ursprünglichwar. Entwickeln wir dies Prinzip und betrachten wir zudem Behufe einen Biindgeborenen, dem man soeben denStar gestochen hat. Das Bild des Gegenstandes, das sichauf seine Retina malt, bringt in seinem Sensorium einen Eindruckhervor, den ich das zweite Bild nennen will, ohne damitbehaupten zu wollen, daß es dem ersten gleiche, undohne daß ich damit über seine Natur etwas aussagen möchte.Dies zweite Bild ist zuerst nicht eine treue Wiedergabe desGegenstandes; aber der gewohnte Vergleich der Eindrückevon diesem Gegenstande durch den Tastsinn mit denjenigen,die er durch den Gesichtssinn hervorbringt, bringt schließlichdurch Modifikation des Sensoriums das zweite Bild in U'bereinstimmungmit der durch den Tastsinn treu wiedergegebenenNatur. Das auf die Retina gemalte Bild ändert sich nicht, aberdas innere Bild, welches dadurch entsteht, ist nicht mehr dasnämliche, wie die Erfahrungen an mehreren Blindgeborenen,denen man das Augenlicht wiedergegeben hat, gezeigt haben.Hauptsächlich in der Kindheit erlangt das Sensoriumdiese Modifikationen. Das Kind rektifiziert durch unabl&ssigen
Von den Tiuschungen bei der Abschatzung usw.141Vergleich der Eindrücke, die es durch den Gesichts- und Gefühlssinnvon ein und demselben Gegenstande empfängt, dieEindrücke des Gesichtes. Es bringt sein Sensorium dahin,den sichtbaren Gegenständen die Form zu geben, die durchden Tastsinn angezeigt wird, dessen Eindrücke sich innig mitdenen des Gesichtes, die sie immer zurückrufen, assoziieren.Dann werden die sichtbaren Gegenstände ebenso treu wiedergegeben,wie die tastbaren Gegenstände. Ein Lichtstrahlwird für das Gesicht das, was ein Stab für den Tastsinn ist.Dadurch lehnt der erste dieser Sinne die Sphäre seiner Eindrückeviel weiter aus als der zweite. Aber das Himmelsgewölbeselbst, an das wir die Gestirne heften, ist noch sehrbegrenzt; und nur durch eine lange Reihe von Beobachtungenund Berechnungen sind wir dazu gelangt, die großenDistanzen dieser Himmelkörper zu erkennen und sie unbegrenztin der Unermeßlichkeit des Raumes zu entfernen.Es scheint, als ob bei mehreren Tiergattungen die Dispositiondes Sensoriums, die uns die Distanzen abschätzenläßt, eine angeborene sei. Aber der Mensch, dem die Naturfast in allem an Stelle des Instinktes den Verstand gegeben,bedarf, um den Instinkt zu ersetzen, der Beobachtungen undVergleiche, die trefflich dazu dienen, seine intellektuellenFähigkeiten zu entwickeln und ihm dadurch die Herrschaftiiber die Erde zu sichern.Die inneren Bilder sind also nicht die Wirkungen einereinzigen Ursache: sie ergeben sich entweder aus den Eindrücken,die gleichzeitig von ein und demselben Sinne odervon verschiedenen Sinnen erhalten wurden, oder aus deninneren Eindrücken, die durch das Gedächtnis zurückgerufenworden sind. Die gegenseitige Beeinflussung dieser Eindrückeist ein an Folgerungen fruchtbares psychologisches Prinzip.Entwickeln wir einige der wiehtigsten.Sieht ein Beobachter in tiefer Finsternis in verschiedenenEntfernungen zwei leuchtende Kugeln von gleichem Durchmesser,so werden ~ie ihm ungleich groß erscheinen. Dieinneren Bilder der~elben werden den entsprechenden auf dieRetina gemalten Bildern proportional sein. Nimmt er aber,sobald die Finsternis aufgehört hat, mit den Kugeln zugleichden ganzen zwischenliegenden Raum wahr, so vergrößertdieser Anblick das innere Bild der entfernteren Kugel undmacht sie dem der anderen Kugel fast gleich. So kommt es
auch, daß ein Mensch aus den Entfernungen von zwei undvon vier Metern gesehen, von derselben Größe erscheint: dasinnere Bild ändert sich nicht, obgleich das eine der auf dieRetina gemalten Bilder doppelt so groß ist als das andere.Ebenso geschieht es durch den Eindruck der zwischenliegendenGegenstände, daß uns der Mond am Horizont größer erscheintals im Zenit. Man erblickt über einem Zweige inder Nähe des Auges einen Gegenstand, den man in die Ferneversetzt und der sehr groß erscheint. Sodann nimmt man dieVerbindung wahr, die ihn mit dem Zweige verbindet undsofort ändert die Vorstellung der Verbindung das innere Bildund führt es auf eine viel geringere Dimension zurück. Allediese Dinge sind nicht einfache Verstandesurteile, wie einigeMetaphysiker gemeint haben: sie sind physiologische Wirkungen,die von den Dispositionen abhängen, welche siohdas Sensorium durch den gewohnten Vergleich der Eindrückeeines und desselben Gegenstandes auf die Organe mehrererSinne und besonders auf die des Tastsinns und des Gesichteserworben hat.Der Einfluß der Gedächtnisspuren auf die Sinneseindrücke,welche von den äußeren Gegenstiinden erregt werden,läßt sich in einer großen Zahl von Fällen beobachten. Mansieht von Ferne Buchstaben, ohne das Wort unterscheidenzu können, das sie darstellen. Wenn irgendeiner dies Wortausspricht oder wenn irgendein Umstand die Erinnerungdaran wachruft, so schiebt sich, wenn ich so sagen darf, allsogleichdas innere Bild dieser so ins Gedächtnis zurückgerufenenBuchstaben über das unklare Bild hin, des durchden Eindruck der äußeren Zeichen hervorgebracht wurde,und macht es deutlich. Die Stimme eines Schauspielers, denihr undeutlich hört, wird deutlich, wenn ihr leset, was er vorträgt.Der Anblick der Buchstabenzeichen ruft die Eindrückeder Töne wach, die ihnen entsprechen, und diese Eindrückevermengen sioh mit den verworrenen Lauten der Stimme undlassen dieselben unterscheiden. Die Furcht verwandelt oft aufdiese Weise die Gegenstände, die eine unzureichende Beleuchtungnicht erkennen läßt, in Gegenstände des Schreckens,die mit ihnen irgendeine Ähnlichkeit haben. Das Bild dieserletzteren Gegenstände, stark wiedererweckt durch die Furcht,macht sich den Eindruck der äußeren Gegenstände eigen.Es ist wichtig, sich vor dieser Ursache der Täuschung zu
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw.143schützen bei den Folgerungen, die man aus Beobachtungenvon Dingen, die nur einen sehr schwachen Eindruck machen,ableitet. Von solcher Art sind die Beobachtungen der Abstufungdes Lichtes an der Oberfläche der Planeten und Trabanten,woraus man auf die Existenz und Intensität ihrerAtmosphären und auf ihre Rotationsbewegungen geschlossenhat. Es ist oft zu befürchten, daß sich innere Bilder mit diesenEindrücken und mit dem Hange verschmelzen, der uns veranlaßt,an die Existenz von Dingen zu glauben, die uns vonden durch die Sinne erhaltenen Eindrücken dargestellt werden.Dieser merkwürdige Hang hängt mit einem eigentümlichenZug zusammen, welcher die von außen kommendenSinneseindrücke von den durch die Einbildung hervorgebrachtenoder durch das Gedächtnis zurückgerufenen Eindrückenunterscheidet. Aber es ereignet sich manchmal durcheine Unordnung des Sensoriums oder der Organe, die aufdasselbe wirken, daß diese Eindrücke den Charakter und dieLebhaftigkeit der äußeren Eindrücke haben; dann hält manihre Gegenstände für wirklich vorhanden, und dann leidetman an Halluzinationen. Die Ruhe und die Dunkelheit derNacht begünstigen diese Täuschungen, welche im gchlafe vollständigsind und die Träume bilden, von denen man sicheinen richtigen Begriff macht, wenn man bedenkt, daß dieSpuren der Gegenstände, die sich unserer Einbildung in derDunkelheit darbieten, eine große Stärke während des Schlafeserlangen.Alles führt uns zu dem Glauben, daß bei den Nachtwandlerneinige der Sinne nicht vollständig eingeschlafen sind.Wenn der Tastsinn z. B. noch ein wenig empfindlich bleibtfür die Berührung der äußeren Gegenstände, so können dieschwachen Eindrücke, die er auf das Sensorium übertragenerhiilt, durch Kombination mit den Traumbildern eines Nachtwandlersdieselben modifizieren und seine Bewegungen lenken.Indem ich dieser Erwägung gemäß die wohlbegleubigten Berichteüber die sonderbaren Dinge prüfte, die von Nachtwandlernverrichtet wurden, schien es mir, daß sich einesehr einfache Erklärung derselben geben ließe.Zuweilen glauben Geisterseher die Personen, die sie sichvorstellen, sprechen zu hören, und sie führen mit ihnen einzusammenhängendes Gespräch; die Werke der Ärzte sindvoll von Berichten über Tatsachen dieser Art.
Charles Bonnet erzählt von seinen Großvater mütterlicherSeite, den er oft beobachtet hatte, ,,einem Greis", wie ersagt, ,,voll Gesundheit, der unabhängig von jedem äußerenEindrucke zuweilen Gestalten von Männern, Frauen, Vögeln,Wagen, Gebäuden usw. vor sich erblickt. Er sieht diese Gestaltenverschiedene Bewegungen machen, sich nähern, sichentfernen, fliehen, an Größe zu -und abnehmen, erscheinen,verschwinden und wieder erscheinen. Er sie'ht die Gebäudesich unter seinen Augen erheben U6W. Aber er nimmt seineErscheinungen nicht für Wirklichkeiten, seine Vernunft ergötztsich daran. Er weiß von einem Momente zum andernnicht, welche Erscheinung sich ihm darbieten wird. SeinGehirn ist eine Bühne, auf der Szenen aufgeführt werden,die für den Zuschauer um so überraschender sind, als ersie gar nicht vorhergesehen hat." Wenn man die Geschichteder Jeanne d'Arc liest, so ist man genötigt, in diesem wunderbarenMädchen eine Geisterseherin in gutem Glauben zu erblicken,deren mutige Begeisterung so mächtig zur BefreiungFrankreichs von seinen Feinden beigetragen hat. Esist wahrscheinlich. daß manche von denen. welche ihreLehren als ~in~ebun~ von einem übernatüilichen Wesenverkündet haben, Geisterseher waren; sie haben andere umso leichter überredet, als sie selbst von ihrer Sendung durchdrungenwaren. Die frommen Betrügereien und die gewaltsamenMittel, die sie sodann angewandt haben, erschienenihnen durch die Absicht gerechtfertigt, die ihrer .Meinungnach für die Menschen notwendigen Wahrheiten zu verbreiten.Irgend ein besonderes ~erkmal unterscheidet die durchdas Gedächtnis wieder erweckten. von den Sinneseindrückenäußerer Gegenstände herrührenden Spuren von dem Erzeugnisseder Einbildungskraft. Es bringt uns wie durch Instinktdahin, die vergangene Existenz dieser Gegenstände in derOrdnung, wie sie uns das Gedächtnis darbietet, zu erkennen.Die Erfahrungen, die wir jeden Augenblick über die Wahrheitder für unsere Handlungsweise daraus hergeleiteten Folgerungenmachen, befestigen diesen Hang. Welches ist derMechanismus, der bei diesem Vorgange des Sensoriums unserUrteil bestimmt 3 Wir wissen es nicht, und wir können nurdie Wirkungen desselben beobachten. Vermöge dieses Mechanismuslassen uns die Spuren des Gedächtnisses, obgleichechwach, ihre ursprüngliche Stärke erkennen, so da8 wir sie
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 145auf diese Reise mit den ähnlichen Eindrücken vor Augenliegender Objekte vergleichen können. So schließen wir, daßeine Farbe, die wir am Vortage gesehen haben, viel lebhafterwar als die, welche uns jetzt vor Augen liegt.Die Eindrücke, welche die im Gedächtnis zurückgelassenenSpuren begleiten, dienen dazu, uns ihre Ursachen wiederwachzurufen. So geschieht es, daß wir z. B., sobald sich mitder Erinnerung an eine uns mitgeteilte Sache die Erinnerungan das Vertrauen, das wir dem Erzähler geschenkt haben,verbindet, uns an seinen Namen wieder erinnern, wenn unsderselbe entschwunden war, indem wir uns sukzessive dieKamen der Personen zurückrufen, mit denen wir gesprochenhaben, bis wir auf den Namen kommen, der uns dieses Vertraueneingeflößt hat.Die in der Kindheit empfangenen Eindrücke erhalten sichbis ins späteste Greisenalter, und sie tauchen selbst dannwieder auf, wann tiefe Eindrücke des reifen Alters gänzlichausgelöscht sind. Es scheint, daß die ersten tief in dasSensorium eingegrabenen Eindrücke zu ihrem Wiederauftretennur die Abschwächung der folgenden Eindrücke durchdas Alter oder durch Krankheit abwarten, ungefähr wie dieGestirne, welche die Tageshelle unseren Blicken entzieht, inder Nacht oder bei Sonnenfinsternißsen wieder zum Vorscheinkommen.Die Spuren des Gedächtnisses erlangen durch die Wirkungder Zeit und ohne unser Zutun Intensität. Die Dinge,die man am Abend lernt, graben sich während des Schlafes.in das Sensoriuni ein und halten ich dadurch leicht fest.Ich habe öfters beobachtet, daß dadurch, daß ich einige Tagehindurch ausgesetzt hatte, über sehr komplizierte Dinge nachzudenken,~ie mir leicht begreiflich wurden, sobals ich sieneuerdings in Betracht zog.Wenn wir einen Gegenstand, der uns durch €eine Größeaufgefallen war, wiedersehen lange Zeit nachdem der häufigeAnblick von Gegenständen derselben Art, die viel größersind, den von ihnen erzeugten Eindruck der Größe abgeschwächthat, so sind wir erstaunt, ihn weit unter dem iaunserem Gedächtnis bewahrten Eindruck zu finden.Manche Menschen sind mit einem wunderbaren Gedächtnisbegabt. Die Genauigkeit, mit der sie lange Reden, diesie angehört haben, wiederholen, setzt uns in Erstaunen. Aber
wenn man überlegt, was alles das Gedächtnis der meistenMenschen umfaßt, so ist man wohl noch mehr erstaunt,daß so viele Dinge daselbst ohne Unordnung aufgespeichertsind. Denken wir an einen Sänger auf der Bühne: seinGedächtnis ruft ihm jedes Wort seiner Rolle, den Ton, dasTaktmaß und die begleitenden Geberden zurück. Folgteine neue Rolle auf die erste, so scheint diese wie ausgelöschtaus seinem Gedechtnisse, und dieses bringt ihm jetzt inentsprechender Ordnung alle Teile der zweiten Rolle zumBewußtsein und würde in derselben Weise die verschiedenenRollen, welche der Sänger studiert hat, wieder wachrufen.Diese Spuren, deren Zahl ungeheuer ist, oder wenigstensdie zu ihrer Erzeugung geeigneten Dispositionen existierengleichzeitig in seinem Sensorium, ohne sich zu vermengen,und der Schauspieler kann sie nach Belieben erwecken. Ichmuß hier wiederholen, daß ich durch die Worte Spuren,Bild, Schwingungen usw., nur Phänomene des Sensoriumsbeschreiben will, ohne irgend etwas über ihre Natur und ihreUrsachen behaupten zu wollen, wie man in der Mechanikdurch die Worte Kraft, Anziehung, Verwandtschaft usw. nurWirkungen ausdruckt.Die Vorgänge des Sensoriums und die Bewegungen, diees veranlaßt, gehen durch häufige Wiederholungen leichtervonstatten und werden gleichsam zu natürlichen Prozessen.Aus diesem psychologischen Prinzipe leiten sich unsere Gewohnheitenab. In Verbindung mit der Sympathie bringt esdie Gebräuche, Sitten und deren seltsame Abwechslungenhervor. Es bewirkt, daß ein Ding, das bei einem Volkeganz allgemein eingeführt ist, bei einem andern mit Schauderbetrachtet wird. Die Gladiatorenkämpfe, deren Schauspieldie Römer leidenschaftlich liebten, und die Menschenopfer,welche die Annalen der Völker beflecken, erscheinenuns schauderhaft. Wenn man die beklagenswerte Lage derSklaven, den verächtlichen Zustand der Parias in Indien unddie Absurdität so vieler der Vernunft und dem Zeugnisse allerunserer Sinne widersprechenden Meinungen betrachtet, soerfüllt es einen mit Schmerz zu sehen, bis zu welchemGrade die Gewohnheit der Sklaverei und die Vorurteile dasMenschengeschlecht erniedrigt haben.Diese Disposition, welche sich das Sensorium durch häufigeWiederholungen erwirbt, macht die Unterscheidung der
Von den Tiiuschungen bei der Abaohätzung usw. 147erworbenen Gewohnheiten von den bei den Menschen anseiner Organisation haftenden Trieben sehr schwierig; dennman kann sich wohl denken, daß der Instinkt, der bei denTieren so ausgedehnt und so mächtig ist, bei dem Menschengeschlechtnicht null ist, und daß die Anhänglichkeit einerMutter an ihr Kind sich davon herleitet. Der doppelte Einflußder Gewohnheit und der Sympathie modifiziert dieseTriebe: oft befestigt er dieselben, zuweilen verändert erihre Natur soweit, daß er entgegengesetzte Triebe an ihreStelle setzt.Mehrere in Betreff des Menschen und der Tiere angestellteBeobachtungen, deren Fortsetzung von großerWichtigkeit wäre, führen uns zu der Vermutung, daß dieModifikationen des Sensoriums, denen die Gewohnheit einegroße Festigkeit gegeben hat, sich ebenso von den Vätern aufdie Kinder im Wege der Zeugung wie manche organischeDispositionen übertragen. Eine ursprüngliche Disposition füralle äußeren und inneren Bewegungen, welche die gewohnheitsmäßigenHandlungen begleiten, erklärt in der einfachstenWeise die Herrschaft, welche die dureh Jahrhwderte eingewurzeltenGewohnheiten auf ein ganzes Volk ausüben, unddie Leichtigkeit, womit sie sich auf die Kinder überliefern,selbst wenn sie der Vernunft und den unvergänglichenMenschenrechten ganz entgegengesetzt sind.Die Leichtigkeit, die eine häufige Obung den Organengibt, ist so groß, daß sie oft von selbst die Bewegungenfortsetzen, die ihnen der Wille auferlegt. Wenn wir uns beimGehen sehr stark mit einem Gedanken beschäftigen, sowirkt die Ursache, die jeden Augenblick unsere Bewegungerneuert, ohne Beitrag von Seiten unseres Willens, und ohnedaß wir und dessen bewußt werden, fort. Man hat gesehen,wie Personen, die beim Gehen vom Schlafe überraschtwurden, ihren Weg fortsetzten und erst durch Zusammenstoßmit einem Hindernis erwachten. Es scheint, daß kraft einerDisposition, welche der Wille zu gehen dem Bewegungssystemegibt, das Gehen ebenso fortgesetzt wird wie etwadie Bewegung einer Uhr durch die Abwicklung ihrer Spiralfeder.Eine Störung in der physischen Organisation kanndiese Disposition hervorbringen. Dann erfolgt die Bewegungunwillkürlich, und ich hörte von einem aufgeklärten Arzte,daß bei einer derartigen Krankheit, die er behandelt hatte,
der Kranke nicht anders halt machen konnte, als indem ersich an einem festen Gegenstande festhielt. Die Beobachtungender Krankheiten können auf diese W eise viel Licht verbreitenüber die Psychologie, wenn die Ärzte mit der Kenntnisihrer Kunst und der Hilfswiseenschaften den Geist der Exaktheitund Kritik verbinden, den das Studium der Mathematikund besonders der Lehre von der Wahrscheinlichkeit verleiht.Das Sensorium kann Eindrücke empfangen, die, zuschwach um empfunden zu werden, doch hinreichend starksind, um Handlungen zu veranlassen, deren Ursache wirnicht kennen. Barbeu-Dubourg, der französische Obersetzerder TTerke von Franklin, berichtet in seiner Obersetzungfolgende Tatsache, die er von einem Kaufmann vonParis gehört hatte: „Eines Tages", sagte er, „als dieserehrenwerte Mann durch die Straßen von Saint-Germain ging,in Gedanken über ehr ernste Angelegenheiten ver~u~ken,konnte er nicht umhin, während er seinen Weg fortsetzte, dieWeise eines alten Liedes, das er wohl seit ~ahren vergessenhatte, ganz leise vor sich hinzusummen. Zweihundert Schritteweiter gekommen, horte er auf dem öffentlichen Platze einenBlinden diese nämliche Weiee auf eeiner Violine spielen;und er meinte, daß es eine schwache Wahrnehmung wer,eine halbe Wahrnehmung der Klänge dieses Instruments,die durch die Entfernung gesch~ächt in einer für ihn selbstunmerklichen Wei~e seine Organe auf diesen Ton gestimmthatten. Er versichert, daß er sich seit dieser Zeit oft dasVergnügen gemacht habe, nach seinen Belieben in einerWerkstätte von Arbeiterinnen denselben Lieder zu suggerieren,ohne daß er von ihnen gehört worden sein konnte.Wenn er sie einen Augenblick nicht mehr singen hörte, sotrillerte er ganz leiee die Weise, die er sie singen lassen wollte,und er verfehlte fast nie seinen Zweck bei ihnen, ohne da5sie ihn in merklicher Wei~e gehört hätten, und ohne da5irgend eine von ihnen davoneine Ahnung hatte."Kach dem, was wir über den gegenseitigen Einfluß derEindrücke des Seneoriums gesagt haben, begreift man, daßdie Musik durch häufige Wiederholungen unseren Bewegungendie Regelmäßigkeit ihres Taktmaßes mitteilen kann. Dasbeobachtet man beim Tanze und bei verschiedenen Obungen,wo uns die Genauigkeit der auf diese Weise geregelten Bewegungenaußerordentlich erscheint. Durch diese Regel-
Von den Tkusohungen bei der Abschätzung usw. 149mäßigkeit macht die Musik im allgemeinen die Bewegungenleichter, welche mehrere Personen auf einmal ausführen.Ein sehr merkwürdiges psychologisches Phänomen istder große Einfluß der Aiifmerksamkeit auf die Spuren des8ensoriums; sie gräbt dieselben tief in das Gedächtnis ein,und während sie die Lebhaftigkeit derselben vermehrt,schwächt sie gleichzeitig die begleitenden Eindrücke. Wennwir fest auf einen Gegenstand hinblicken, um an ihm einigeBesonderheiten herauszufinden, so kann uns die Aufmerksamkeitfür die Eindrücke, die andere Gegenstände zur selbenZeit auf der Retina hervorbringen, unempfindlich machen,Durch die Aufmerksamkeit erlangen die Bilder der Dinge,die wir vergleichen wollen, die notwendige Intensität, so daßihre Beziehungen allein unser Denken beschäftigen. Sieerweckt die Spuren des Gedächtnisses, die zu diesem Vergleichedienen können, und dadurch wird sie die mächtigsteTriebfeder des menschlichen Geistes.Wird die Aufmerksamkeit häufig einer besonderen Eigenschaftder Gegenstände zugewendet, so verleiht sie schließlichden Organen eine verschärfteEmpfänglichkeit, welche bewirkt,daß man diese Eigenschaft auch dann noch erkennt, wennsie für die große Menge der Menschen schon unmerklich ist.Diese Prinzipien erklären die eigentümlichen Wirkungender Panoramen. Wenn die Regeln der Perspektive dabei guteingehalten sind, so malen sich die Gegenstände so auf derRetina ab, als ob sie wirklich wären. Der Beschauer befindetsich also dann in demselben Zustande, den die Wirklichkeitder Gegenstände bei ihm hervorbringen würde. Aber diePerspektive ist niemals genügend genau, um die Identitiit vollständigzu machen. ubrigens beeintrechtigen die fremdenEindrücke, die, obgleich schwach, sich mit dem Hauptempfindungen,welche die Perspektive hervorbringt, vermengen,anfangs die Illusion. Die auf das Panorama gerichtete Aufmerksamkeitbeseitigt dieselben; aber dazu bedarf es einermehr oder minder langen Zeit, die von den Dispositionendes Sensoriums und von der Vollkommenheit des Panoramasabhängt. Bei allen, die ich gesehen habe, bedurfte ioh einesZeitraumes von mehreren Minuten, um eine vollständigeIllusion zu erlangen.Das folgende Prinzip der Psychologie erklärt eine großeZahl von Erscheinungen, die eine direkte Beziehung zu dem
Gegenstande dieses Werkes haben. ,,Wenn man oft Handlungenverrichtet, die aus einer besonderen Modifikation desSensoriums hervorgehen, so kann ihre Rückwirkung auf diesesOrgan nicht nur diese Modifikation vermehren, sondern ihreEntstehung zuweilen erst veranlassen." So z. B. setzt sichdie Bewegung der Hand, welche eine lange Kette an demeinen Ende hält, über die Länge der Kette bis an ihr unterstesEnde fort; und wenn man, nachdem die Kette zurRuhe gekommen ist, dieses Ende in Bewegung setzt, so steigtdie Schwingung bis zur Hand herauf und bringt nun ihrerseitswieder die Hand in Bewegung. Diese gegenseitigen Bewegungengehen nun infolge häufiger Wiederholungen leichtvonstatten.Bemerkenswert sind die Wirkungen dieses Prinzips aufden Glauben. Der Glaube oder die Beipflichtung, die wireiner Behauptung geben, ist gewöhnlich auf die Evidenz, aufdas Zeugnis der Sinne oder auf Wahrscheinlichkeiten gegründet;in diesem letzten Falle hängt der Grad seiner Stärkevon dem der Wahrscheinlichkeit ab, die selbst wiederum vonden Daten abhängt, die jedes Individuum über den Gegenstandseines Urteils haben kann.Wir handeln oft vermöge un~eres Glaubens, ohne uns andie Beweisgründe desselben erinnern zu müssen. Der Glaubeist also eine Modifikation des Sensoriums, die unabhängig vondiesen oft vollständig vergessenen Beweisen besteht und unsveranlaßt, Handlungen zu vollführen, die eine Folge derselbensind. Gemäß dem eben dargelegten Prinzipe kann einehäufige Wiederholung solcher Handlungen die~e Modifikationentstehen lassen, besonders wenn sie von einer großen Zahlvon Personen wiederholt werden ;denn al~dann verbindet sichmit der Gewalt ihrer Rückwirkung die Macht der Nachahmung,eine notwendige Folge der Sympathie. Wenn dieseHandlungen eine Pflicht find, die uns die Umstände auferlegen,so verleiht uns das Streben der animalischen Okonomie,den für unser Wohlsein günstig~ten Zustand zu ergreifen,eine Disposition für den Glauben, der bewirkt, daßman sie mit Vergnügen vollführt. Wenige Menschen widerstehender Wirkung aller dieser Ur~achen.Pascal hat diese Wirkungen schön entwickelt in einemKapitel seiner ,,~ensheS", der den eigentümlichen Titel trägt:,,Daß es schwierig sei, die Existenz Gottes durch die natür-
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 151liche Erkenntnis zu beweisen, aber daß es das sicherste sei,daran zu glauben." Indem er sich dabei an einen Ungläubigenwendet, drückt er sich in folgender Weise aus: ,,Duwillst zum Glauben gelangen und weißt nicht den Weg dahin;du willst von dem Unglauben geheilt werden und fragst nachdem Heilmittel. Lerne es von denen, die so wie du gewesensind und die jetzt keinen Zweifel mehr hegen. Sie kennendiesen Weg, den du einschlagen möchtest, und sie sind voneinem Obel geheilt, von dem du geheilt sein willst. Befolgedie Methode, womit sie begonnen haben. Ahme ihre äußerenHandlungen nach, wenn du dich noch nicht in ihre innerenDispositionen hineinfinden kannst; lasse ab von diesennichtigen Vergnügungen, die dich ganz in Anspruch nehmen.Ich würde bald diese Vergnügungen aufgeben, sagst du, wennich nur den Glauben hätte. Und ich, ich sage dir, daß dubald den Glauben haben würdest, wenn du dich von diesenVergnügungen lossagtest. An dir ist es also, den Anfang zumachen. Wenn ich es könnte, so würde ich dir gerne denGlauben geben: ich kann es aber nicht und kann daher auchnicht die Wahrheit dessen erproben, was du sagsc wohl aberkannst du dich von diesen Vergnügungen lossagen und prüfen,ob das, was ich dir sage, wahr ist.Wir dürfen nicht verkennen, daß wir ebensosehr Körperals Geist sind; und daher kommt es, daß das Werkzeug,durch das die ti'berzeugung sich bildet, nicht einzig der Beweisist. Wie wenig Dinge gibt es, die bewiesen sind? DieBeweise überzeugen nur den Geist: die Gewohnheit liefertunsere kraftvollsten Beweise. Sie gibt den Sinnen, dieden Geist mit sich fortreißen, eine Neigung, ohne daß ersich dessen bewußt wird. Wer hat bewiesen, daß es morgenTag werden wird, und daß wir sterben werden? und gibtes -etwas, das allgemeiner geglaubt würde? Es ist alsodie Gewohnheit, die uns davon überzeugt; sie ist es, dieso viele Menschen zu Türken und Heiden macht; sie ist es,welche die Berufsarten erzeugt, den Soldatenstand usw. Esist wahr, man soll nicht mit ihr den Anfang machen, um dieWahrheit zu finden; aber man muß seine Zuflucht zu ihrnehmen, wenn der Geist einmal bemerkt hat, wo die Wahrheitist, um uns mit diesem Glauben zu durchtränken undzu impriignieren, der uns jeden Augenblick entschwindet:denn man kann nicht verlangen, daß man die Beweise dafür
immer gegenwärtig hat. Man muß sich einen leichterenGlauben erwerben, nämlich den der Gewohnheit, die bewirkt,daß wir ohne Gewalt, ohne Kunst, ohne Argumentglauben, und die alle unsere Kräfte zu diesem Glauben hinneigt,so zwar, daß unsere Seele naturgemäß darauf verfällt.Es genügt nicht, blos kraft der Uberzeugung zu glauben,wenn die Sinne uns zu dem entgegengesetzten Glauben führen.Man muß unsere beiden Teile miteinander gehen lassen:den Geist mittels der Vernunftgründe, die man nur einmal inseinem Leben eingesehen zu haben braucht, und die Sinnemittels der Gewohnheit und indem man ihnen nicht gestattet,sich zum Gegenteile hinzuneigen."Das Mittel, welches Pascal zur Bekehrung eines Ungläubigenvorschlägt, kann mit Erfolg angewendet werden,um ein zur Zeit der Kindheit erworbenes und durch die Gewohnheiteingewurzeltes Vorurteil auszurotten. Diese ArtenVorurteile entstehen oft aus der unscheinbarsten Ursachebei einer lebhaften Einbildungskraft. Wenn eine Person, diemit dem Worte links eine Idee von Unglück verbindet,täglich mit der rechten Hand eine Sache verrichtet, die manohne Unterschied mit der einen oder anderen Hand vollführenkönnte, so kann die Gewohnheit das Widerstreben.sich der linken Hand dazu zu bedienen, soweit verstärken,daß die Vernunft gegen dieses Vorurteil machtlos wird.Man kann wohl glauben, daß Augustus, der mit einem inso mancher Hinsicht überlegenen Urteil begabt war, sichmanchmal über seine Schwäche Vorwürfe gemacht habe, da0er nicht wagte, an dem auf einen Markttag folgenden Tageine Reise anzutreten, und da6 er wünschte, sie zu überwinden.Aber in dem Momente, wo er die Reise an einemsolchen vermeintlichen Unglückstag unternehmen sollte,mochte er sich gesagt haben, daß es doch das sicherste wäre,sie zu verschieben, und auf diese Weise gab er seinem Widerstrebendurch die Gewohnheit, ihm zu willfahren, stetsneue Nahrung. Die häufige Wiederholung von Handlungen,welche diesen Vorurteilen entgegengesetzt sind, muß sie mitder Zeit schwächen und sie ganz verschwinden lassen.Die Anhänglichkeit, die man den Personen entgegenbringt,die man sich oft verpflichtet hat, geht aus dem eben'entwickelten Prinzipe hervor. Die häufige Wiederholungvon Handlungen zu ihren Gunsten vermehrt und erzeugt
Von den Täuschungen bei der Abschätzung usw. 153sogar zuweilen das Gefühl, dessen natürliche Folge sie sind;die Handlungen, die uns die Neigung für eine Sache häufigvollführen läßt, vermehren die Intensität dieser Neigung undverwandeln sie oft in eine Leidenschaft.Man sieht aus dem Vorhergehenden, wie sehr unserGlaube von unseren Gewohnheiten abhängt. Gewohnt nacheiner gewissen Art von Wahrscheinlichkeiten unser Urteil zufällen und unser Verhalten einzurichten, stimmen wir wiedurch Instinkt diesen Wahrscheinlichkeiten zu, und diese bestimmenuns mit mehr Kraft als die weit stärkeren Wahrscheinlichkeiten,die sich aus der cberlegung oder aus derBerechnung ergeben. Um diese Ursache der Täuschung soviel als möglich zu vermindern, muß man die Einbildung unddie Sinne zur Unterstützung der Vernunft heranziehen. Stelltman durch Strecken die bezüglichen Wahrscheinlichkeitendar, so wird man ihre Unterschiede viel besser merken. EineStrecke, welche die Wahrscheinlichkeit der Zeugenaussagedarstellte, auf die sich eine außerordentliche Tatsache stützt,würde, neben die Strecke gestellt, welche die Cn<strong>wahrscheinlichkeit</strong>dieser Tatsache darstellte, die Wahrscbinlichkeitdes Irrtums der Zeugenaussage sehr merklich machen, wieeine Abbildung, in der die Höhen der Gebirge sehr nahegerücktsind, einen deutlichen Begriff von den Verhältnissendieser Höhen gibt. Dieses Mittel kann in mehreren Fällenmit Erfolg angewendet werden. Um uns von der Unermeßlichkeitdes Weltraumes einen Begriff zu machen, stelle mansich durch eine fast unmerkliche Größe, etwa den zehntenTeil eines Millimeters die größte Längenerstreckung Frankreichsdar; dann wird die Distanz der Sonne von der Erde14 Meter betragen, die des nächsten Fixsternes ein und einehalbe Million Meter überschreiten, d. h. sieben- oder achtmalden Radius des größten Horizontes, den das Auge von demhöchsten Punkte aus umfassen könnte. Man wird auch so nurein sehr schwaches Bild von der Größe des Weltalls heben,das sich unendlich über die glänzendsten Sterne hinaus erstreckt,wie diese ungeheure Zahl der Gestirne beweist,die übereinander geordnet sich unserem Blicke in der unermeßlichenAusdehnung des Firmamentes entziehen. Aberwie schwach auch dieses Bild sein mag, so reicht es dochhin, um uns die Sinnlosigkeit der Ideen von dem Vorrangedes Menschen über die ganze Natur fühlen zu lassen,
Ideen, aus denen man so absonderliche Folgerungen gezogenhat.Schließlich wollen wir als ein Prinzip der Psychologiedie ubertreibung der Wahrscheinlichkeiten durch die Leidenschaftenaufstellen. Die Sache, die man lebhaft fürchtetoder lebhaft wünscht, scheint uns gerade aus diesem Grundewahrscheinlicher. Ihr Bild, das im Sensorium mächtig eingeprägtist, schwächt den Eindruck der entgegengesetztenWahrscheinlichkeiten ab und löscht sie zuweilen so weitaus, daß man glaubt, die Sache sei schon geschehen. DieUberlegung und die Zeit geben dadurch, daß sie die Lebhaftigkeitdieser Empfindungen abschwächen, dem Geiste dienötige Ruhe, um die Wahrscheinlichkeit der Dinge richtigzu schätzen.Die Schwingungen des Sensoriums müssen wie alle Bewegungenden Gesetzen der Dynamik unterworfen sein, unddas wird auch von der Erfahrung bestätigt. Die Bewegungen,die sie dem Muskelsystem einprägen, und welche diesesSystem den fremden Körpern mitteilt, sind wie bei der Wirkungder Spannkräfte von solcher Art, daß der gemeinsameSchwerpunkt unseres Körpers und der von ihm bewegtenKörper in Ruhe bleibt. Diese Schwingungen lagern sich übereinander, so wie man die Schwingungen der Flüssigkeitensich zusammensetzen sieht, ohne daß sie sich vermengen.Sie teilen sich den Individuen mit, wie die Schwingungeneines tönenden Körpers sich auf die ihn umgebenden Körperübertragen. Die zusammengesetzten Gedanken bilden sichaus den einfachen Gedanken, wie die Flut des Meeres sichaus den durch Sonne und Mond hervorgebrachten Teilfl~itenzusammensetzt. Das Schwanken zwischen entgegengesetztenBeweggründen bildet ein Gleichgewicht von gleichen Kräften.Die plötzlichen Veränderungen, die im Sensorium hervorgebrachtwerden, erfahren den Widerstand, den ein materiellesSystem ähnlichen Veränderungen entgegensetzt; und wennman die Erschtitterungen vermeiden und an lebendiger Kraftnichts verlieren will, so muß man ebenso wie bei diesemSysteme durch unmerkliche Abstufungen wirken. Eine starkeund anhaltende Aufmerksamkeit erschöpft das Sensorium,wie eine lange Reihe von Erschütterungen eine voltaischeSiiule oder das elektrische Organ bei den Fischen erschöpft.Fast alle Vergleiche, die wir den materiellen Gegenständen
Von den verschiedenen Mitteln, sich der Gewißheit zu nähern. 155entnehmen, um die intellektuellen Dinge begreiflich zumachen, sind im Grunde genommen nur Identitäten.Ich wünsche, daß die vorhergehenden Betrachtungen, wiennvollkommen sie auch sein mögen, die Aufmerksamkeit derphilosophischen Beobachter auf die Gesetze des Sensoriumsoder der intellektuellen Welt hinlenken möchten, auf Gesetze,deren Erforschung für uns ebenso wichtig ist wie die derphysischen Welt. Man hat zur Erklärung der Erscheinungendieser beiden Welten ziemlich ähnliche Hypothesen ersonnen.Aber da, die Grundlagen dieser Hypothesen sich allen Mittelnunserer Beobachtung und Berechnung entziehen, so kannman in Rücksicht auf sie mit Montaigne sagen, daß Unwissenheitund Mangel an Wißbegierde ein weiches und sanftesRuhekissen sind, um einen wohlgeratenen Kopf darauf ruhenau lassen.Von den verschiedenen Mitteln, sichder Gewißheit zu nähern.Induktion, Analogie, auf Tatsachen gegründete und unablässigdurch neue Beobachtungen berichtigte Hypothesen,ein angeborenes glückliches Taktgefühl, das durch zahlreicheVergleiche seiner Angaben mit der Erfahrung gestärkt wordenist; das sind die hauptsächlichsten Mittel, um zur Wahrheitzu gelangen.Wenn man eine Reihe gleichartiger Gegenstände mitAufmerksamkeit betrachtet, so nimmt man unter ihnen undin ihren Veränderungen Beziehungen wahr, die in dem Maße,als die Reihe sich verlängert, mehr und mehr offenbar werden,und die schließlich durch beständige Ausdehnung und Verallgemeinerungzu dem Prinzipe hinführen, von dem sie sichableiten. Aber oft sind diese Beziehungen von so viel fremdartigenUmständen verhüllt, daß es eines großen Scharfsinnesbedarf, um sie herauszufinden und zu diesem Prinzipe aufzusteigen:eben darin offenbart sich aber das wahre wissenschaftlicheGenie. Die Analysis und Naturphilosophie verdankenihre wichtigsten Entdeckungen diesem fruchtbarenMittel, das man Induktion nennt. Newton verdankte ihrsein Binomialtheorem und sein Prinzip der allgemeinenGravitation. Es ist schwierig, die Wahrscheinlichkeit der Er-ll*
gebnisse der Induktion abzuschätzen, die sich darauf gründet,daß gerade die einfachsten Beziehungen die allgemeinstensind, was durch die Formeln der Analysis bewahrheitetwird und sich in den Naturerscheinungen, in der Kristallisationund in den chemischen Verbindungen wiederfindet.Diese Einfachheit der Beziehungen wird aber gar nichtstaunenswert scheinen, wenn man erwägt, daß alle Wirkungender Natur nur die mathematischen Resultate einer kleinenZahl von unabänderlichen Gesetzen sind.Die Induktion genügt jedoch, obwohl sie zur Entdeckungder allgemeinen Prinzipien der Wissenschaften führt, nochnicht, um dieselben in aller Strenge aufzustellen. Man mußsie immer durch Beweise oder entscheidende Experimente bestätigen,denn die Geschichte der Wissenschaften zeigt uns,daß die Induktion manchmal zu ungenauen Ergebnissen geführthat. Ich will als Beispiel ein Theorem von Fermat überdie Primzahlen anführen. Dieser große Geometer, der überderen Theorie tiefe Betrachtungen angestellt hatte, suchteeine Formel, die nur Primzahlen enthielte und direkt einePrimzahl geben sollte, die größer als irgend eine angebbareZahl wäre. Die Induktion brachte ihn auf den Gedanken,daß 2, zu einer Potenz erhoben, die selbst eine Potenz von 2ist, plus Eins eine Primzahl bilde. So bildet 2 zum Quadraterhoben mehr 1 die Primzahl 5; 2 auf die zweite Potenz von 2erhoben, also 16 plus 1die Primzahl 17. Er fand, daß diesnoch zutraf für die 8. und 16. Potenz von 2 vermehrt um dieEinheit: und diese Induktion ließ ihn, gestützt auf mehrerearithmetische Betrachtungen, dieses Resultat als allgemeinansehen. Er gab jedoch zu, daß er es nicht bewiesen hatte.In der Tat hat Euler erkannt, daß dies für die 32. Potenzvon 2 zu bestehen aufhört, die um die Einheit vermehrt4294967297 gibt, eine Zahl, die durch 641 teilbar ist.Wir schließen durch Induktion, falls verschiedene Ereignisse,z. B. Bewegungen, beständig und schon seit langerZeit durch eine einfache Beziehung verbunden erscheinen,daß sie fortwährend derselben unterworfen sein werden; undwir schließen daraus vermittelst der Wahrscheinlichkeitstheorie,daß dieses Verhältnis nicht dem Zufall, sonderneiner regelmäßigen Ursache zuzuschreiben sei. Die Gleichheitder Achsendrehungs- und Umlaufsbewegung des Mondes,die der Bewegungen der Knoten der Mondbahn und des
Von den verschiedenen Mitteln, sich der Gewißheit zu nithem. 157Mondäquators, und das Zusammenfallen dieser Knoten; dieeigentümliche Beziehung zwischen den Bewegungen der dreiersten Trabanten des Jupiter, der zufolge die mittlere Längedes ersten Trabanten, weniger dreimal der des zweiten,mehr zweimal der des dritten gleich zwei rechten Winkelnist; die Gleichheit des Intervalles der Ebbe und Flut mitdem der Durchgänge des Mondes durch den Mittagskreis; dieWiederkehr der größten Ebbe und Flut mit den Syzygien,und der kleinsten mit den Quadraturen; alle diese Dinge, diesich behaupten, seit man sie beobachtet, zeigen mit eineraußerordentlichen Wahrscheinlichkeit die Existenz von konstantenUrsachen an, bezüglich deren es den Geometern glücklichgelungen ist, sie mit dem Gesetze der allgemeinen Schwerein Verbindung zu bringen, und deren Kenntnis die Fortdauerdieser Beziehungen außer Zweifel setzt.Der Kanzler Bacon, der so beredte Begründer der wahrenphilosophischen Methode, hat von der Induktion einen garseltsamen Mißbrauch gemacht, um die Unbeweglichkeit derErde zu beweisen. In folgender Weise argumentiert er in dem,,Novum organum", seinem schönsten Werke: Die Bewegungder Gestirne von Osten nach Westen ist um so rascher, jeweiter sie von der Erde entfernt sind. Diese Bewegung istam raschesten für die Fixsterne, sie verlangsamt sich einwenig für den Saturn, etwas mehr für den Jupiter und sofort bis zum Monde und den wenigst entfernten Kometen. Sieist noch merklich in der Atmosphäre, besonders zwischen denWendekreisen wegen der großen Kreise, die dort die Luftmolekülebeschreiben; sie ist endlich kaum mehr wahrnehmbar fürden Ozean, also null für die Erde." Aber diese Induktion beweistnur, daß Saturn und die näher gelegenen Gestirneeigene Bewegungen haben, die der wirklichen oder scheinbarenBewegung des ganzen Himmelsgewölbes von Osten nachWesten entgegen sind, und daß diese Bewegungen für dieentfernteren Gestirne langsamer scheinen, was den Gesetzender Optik entspricht. Es hätte Bacon doch die unbegreiflicheSchnelligkeit auffallen sollen, die man für die Gestirneannehmen muß, damit sie unter der Voraussetzung der Unbeweglichkeitder Erde ihren täglichen Umlauf um dieselbevollführen, sowie die außerordentliche Einfachheit, mit derdie Rotation der Erde erklärt, wie so weit entfernte Körperwie die Fixsterne, Sonne, Planeten und Mond alle dieser Um-
158 P. S. de Laplace:laufsbewegung unterworfen scheinen. Was den Ozean unddie Atmosphäre betrifft, so durfte er ihre Bewegung nichtmit der der Gestirne vergleichen, die mit der Erde in keinerVerbindung stehen; vielmehr müssen die Luft und das Meer,da sie einen Teil der Erdkugel ausmachen, an ihrer Bewegungoder Ruhe teilnehmen. Es ist sonderbar, daß Bacon,den sein Genie zu großen Gesichtspunkten führte, nicht vonder erhabenen Idee, welche Kopernikus' System vom Weltallgibt, fortgerissen worden ist. Er konnte doch in den EntdeckungenGalilei's, die ihm bekannt waren, starke Analogienzugunsten dieses Systems finden. Er hat zur Auffindungder Wahrheit die Vorschrift aber nicht das Beispiel gegeben.Aber dadurch, daß er mit aller Kraft der Vernunft undder Beredtsamkeit auf der Notwendigkeit bestand, sich vonallen nichtssagenden Spitzfindigkeiten der Schule loszusagen,um sich dafür den Beobachtungen und Experimenten zuzuwenden,und die richtige Methode, zu den allgemeinen Ursachender Erscheinungen aufzusteigen, angab, hat diesergroße Philosoph zu den ungeheuren Erfolgen beigetragen,die der menschliche Geist in dem schönen Jahrhundert, indem er seine Laufbahn beschloß, gemacht hat.Die Analogie gründet sich auf die Wahrscheinlichkeit,daß ähnliche Dinge auch Ursachen derselben Art haben undihrerseits wieder die nämlichen Wirkungen hervorbringen.Je vollkommener die Ähnlichkeit ist, desto mehr nimmt dieseWahrscheinlichkeit zu. So z. B. urteilen wir ohne irgendein Bedenken, daß Wesen, die mit denselben Organen versehensind, bei gleichen Verrichtungen auch die nämlichenEmpfindungen erfahren und von denselben Begierden bewegtwerden. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Tiere, diedurch ihre Organe uns nahe stehen, Empfindungen analogden unsrigen haben, ist, obwohl sie etwas geringer ist,als die, welche sich auf die Individuen unserer Art bezieht,dennnoch ungewöhnlich groß; und es bedurfte des ganzenEinflusses der religiösen Vorurteile, um einige Philosophenauf den Gedanken zu bringen, daß die Tiere reine Automatenseien. Die Wahrscheinlichkeit der Existenz des Gefühlesnimmt in dem Maße ab, als die Ähnlichkeit der Organemit den unseren sich vermindert, aber sie ist selbstin bezug auf die Insekten immer noch sehr bedeutend. Wennwir Individuen, die zu ein und derselben Gattung gehören,
Von den verschiedenen Mitteln, sich der Gewißheit zu nähern. 159sehr komplizierte Dinge genau in derselben Weise von Generationzu Generation, und ohne daß sie dieselben gelernthaben, vollführen sehen, so werden wir zu dem Glauben gebracht,daß sie infolge einer Art Affinität so handeln, diederjenigen analog ist, welche die Moleküle der Kristalleeinander nahebringt, die aber, mit der an jegliche tierischeOrganisation geknüpften Empfindungen vermengt, mit derRegelmäßigkeit von chemischen Verbindungen noch viel merkwürdigereVerbindungen hervorbringt ; man könnte vielleichtdiese Mischung der Wahlverwandtschaften mit der Empfindungdie animalische Verwandtschaft nennen. Obgleich einegroße Analogie zwischen der Organisation der Pflanzen und derTiere besteht, so scheint sie mir doch nicht genügend zu sein,um das Empfindungsvermögen auf die Pflanzen auszudehnen;aber es berechtigt auch nichts dazu, sie ihnen abzusprechen.Da die Sonne durch die wohltätige Wirkung ihres Lichtesund ihrer Wärme die Tiere und Pflanzen, welche die Erdebedecken, entstehen läßt, so schließen wir durch Analogie,daß sie ähnliche Wirkungen auf den übrigen Planeten hervorbringt;denn es ist unnatürlich, zu denken, daß die Materiederen Wirksamkeit wir in so mannigfachen Formen sichentfalten sehen, auf einem so großen Planeten, wie Jupiter,der wie der Erdball seine Tage, seine Nächte und Jahrehat, und auf dem die Beobachtungen Veränderungen anzeigen,die sehr wirksame Kräfte bedingen, unfruchtbar sein sollte. Eshieße indes die Analogie zu weit ausdehnen, wollte mandaraus auf die Ähnlichkeit der Bewohner der Planeten undder Erde schließen. Der Mensch, der für die Temperatur,in der er lebt, und für das Element, das er atmet, geschaffenist, könnte allem Anscheine nach nicht auf den anderenPlaneten leben. Aber sollte es nicht eine unendliche Mannigfaltigkeitvon Organisationen je nach der verschiedenen Konstitutionder Weltkörper geben? Wenn der bloße Unterschiedder Elemente und Klimate schon eine solche Verschiedenheitin den Produkten der Erde mit sich bringt, wieviel mehr müssen die Erzeugnisse der verschiedenen Planetenund ihrer Trabanten voneinander abweichen! Die kühnstePhantasie kann sich keinen Begriff davon machen, aber ihreExistenz ist sehr wahrscheinlich.Wir werden durch eine starke Analogie dahin geführt,die Fixsterne als ebensoviele Sonnen zu betrachten, die
wie die unsrige mit einer Anziehungskraft ausgestattet sind,welche der Masse direkt und dem Quadrate der Distanz umgekehrtproportional ist; denn da diese Kraft für alle Körperdes Sonnensystems und für die kleinsten Moleküle desselbennachgewiesen ist, so scheint sie jeglicher Materie eigen zusein. Schon die Bewegungen der kleinen Sterne, die manwegen ihrer großen Annäherung aneinander Doppelsternenennt, scheinen darauf hinzuweisen; genaue Beobachtungenvon höchstens hundert Jahren werden durch Feststellung ihrerUmlaufsbewegung um einander ihre gegenseitigen Anziehungenaußer Zweifel setzen.Die Analogie, nach der wir jeden Fixstern zum Zentrumeines Planetensystems machen, ist weit schwächer als die vorhergehende,aber sie gewinnt an Wahrscheinlichkeit durchdie Hypothese, die wir über die Bildung der Sterne und derSonne aufgestellt haben; denn da nach dieser Hypothese jederStern wie die Sonne ursprünglich von einer weit ausgedehntenAtmosphäre umgeben war, so ist es natürlich, dieser Atmosphäredieselben Wirkungen zuzuschreiben wie der Sonnenatmosuhäreund anzunehmen. daß sie durch ihre KondensationPlaneten und Trabanten hervorgebracht habe.Eine große Zahl von Entdeckungen in den Wissenschaftenverdankt man der Analogie. Ich will als eine derbemerkenswertesten die Entdeckung der atmosphärischenElektrizität anführen, zu der man durch die Analogie derelektrischen Erscheinungen mit den Wirkungen des Blitzesgeführt wurde.Die sicherste Methode, die uns bei der Aufsuchung derWahrheit leisten kann, besteht darin, durch Induktion vonden Erscheinungen zu den Gesetzen und von den Gesetzenzu den Kräften aufzusteigen. Die Gesetze sind die Beziehungen,welche die einzelnen Erscheinungen untereinander verbinden;wenn man durch sie das allgemeine Prinzip derKräfte, von denen sie sich ableiten, erkannt hat, dann prüftman dasselbe entweder durch direkte Experimente, falls dasmöglich ist, oder dadurch, daß man untersucht, ob es denbekannten Erscheinungen genügt; und wenn man sie alle aufGrund einer strengen Analyse bis in ihre kleinsten Detailsaus diesem Prinzipe hervorgehen sieht ; wenn sie überdiessehr mannigfach und sehr zahlreich sind, dann gewinntdie Wissenschaft den höchsten Grad von Gewißheit und Voll-
Von den verschiedenen Mitteln, sich der Gewißheit zu nähern. 161kommenheit, den sie erreichen kann. Diese höchste Stufehat die Astronomie durch die Entdeckung der allgemeinenSchwere erlangt. Die Geschichte der Wissenschaft zeigtaber, daß dieser langsame und mühevolle Gang der Induktionnicht immer der der Erfinder gewesen ist. Die Einbildungskraft,ungeduldig beim Aufsteigen zu den Ursachen, gefälltsich darin Hypothesen zu schaffen; und oft entstellt siedie Tatsachen, um sie ihrem eigenen Gebilde anzupassen: dannsind die Hypothesen gefährliih. Aber wenn man sie nur alsMittel betrachtet, die Erscheinungen untereinander zu verbinden,um ihre Gesetze zu entdecken, wenn man vermeidet,ihnen wirkliche Existenz zuzuschreiben und sie unablässigdurch neue Beobachtung richtig stellt, dann können sie zu denwahren Ursachen hinführen oder wenigstens uns in den Standsetzen, aus den beobachteten Erscheinungen auf diejenigen zuschließen, die unter gegebenen Umständen entstehen müssen.Wenn man sämtliche Hypothesen, die man über dieUrsache der Erscheinungen aufstellen kann, prüfte, so würdeman auf dem Wege des Ausschließens zur richtigen kommen.Dieses Mittel ist mit Erfolg angewendet worden; zuweilen istman zu mehreren Hypothesen gelangt, die alle bekanntenTatsachen gleich gut erklärten, und betreff derer die Meinungender Gelehrten auseinandergingen, bis entscheidendeBeobachtungen die wahre Hypothese erkennen ließen. Sodannist es interessant für die Geschichte des menschlichenGeistes, auf diese Hypothesen zurückzukommen und zu sehen,wie es denn kam. daß sie eine eroße Zahl von Tatsachen"erklärten, ferner die Änderungen zu untersuchen, die sie er-fahren müssen. um in die natürliche Überzugehen. So z. B. "verwandelt sich das Ptolemäische System, welches einfachdas, was uns am Himmel erscheint, als wirklich hinstellt,in die Hypothese von der Bewegung der Planeten um dieSonne, wenn man darin die Kreise und Epizyklen, die nachPtolemäus jährlich beschreiben werden, ohne daß er überihre Größe etwas aussagt, der Sonnenbahn gleich und parallelmacht. Sodann genügt es, um diese Hypothese in das wahreWeltsystem zu verwandeln, die scheinbare Bewegung derSonne im entgegengesetzten Sinne auf die Erde zu übertragen.Es ist fast immer unmöglich, die Wahrscheinlichkeit derdurch diese verschiedenen Mittel erlangten Resultate der Berechnungzu unterwerfen: und das giltin ähnlicher Weise für
die historischen Tatsachen. Aber die Gesamtheit der erklärtenErscheinungen oder der Zeugenaussagen ist manchmaleine solche, daß man, ohne ihre Wahrscheinlichkeit abschätzenzu können, sich vernünftigerweise hinsichtlich derselbenkeinen Zweifel erlauben kann. In anderen Fällen tutman gut, sie nur mit großer Vorsicht aufzunehmen.Historische Bemerkung über dieWahrscheinlichkeitsrechnung.Seit langer Zeit schon hat man bei den einfachstenSpielen die Verhältnisse der für die Spieler günstigen oderungünstigen Chancen bestimmt; die Einsätze und Wettenwurden nach diesen Verhältnissen geregelt. Aber niemandvor Pascal und Fermat hatte Prinzipien und Methoden angegeben,um diesen Gegenstand der Berechnung zu unterwerfen,und niemand hatte etwas kompliziertere Fragen dieserArt gelöst. Auf diese beiden großen Geometer gehen alsodie Anfänge der Wissenschaft von der Wahrscheinlichkeitzurück, deren Entdeckung auf gleicher Stufe mit den merkwürdigenDingen gestellt werden kann, welche das 17. Jahrhundertverherrlicht haben, das Jahrhundert, das unterallen dem menschlichen Geist die größte Ehre macht. DasHauptproblem, das sie auf verschiedenen Wegen lösten,besteht, wie man früher gesehen hat, darin, den Einsatzauf billige Weise unter die Spieler zu verteilen, deren Geschicklichkeitgleich ist und die übereinkommen, eine Partievor ihrem Ende aufzugeben, wobei nach der Spielregel manzum Gewinnen der Partie als erster eine gegebene, für jedender Spieler verschiedene Anzahl von Points erreichen muß.Es ist klar, daß die Verteilung den bezüglichen Wahrscheinlichkeitender Spieler, diese Partie zu gewinnen, proportionalsein muß, und diese Wahrscheinlichkeiten werden von derZahl der Points abhängen, die jedem von ihnen noch fehlen.Die Methode von Pascal ist sehr ingeniös und sie ist im Grundenichts anderes als die partielle Differenzengleichung diesesProblems, angewandt auf die Bestimmung der aufeinanderfolgendenWahrscheinlichkeiten der Spieler, wenn man vonden kleinsten Zahlen zu den folgenden übergeht. DieseMethode ist auf den Fall von zwei Spielern beschrgnkt,
Historische Bemerkung über d. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 163während die Methode von Fermat, die sich auf die Kombinatorikgründet, sioh auf eine beliebige Zahl von Spielernerstreckt. Pascal glaubte zuerst, da6 sie wie die seinigeauf zwei Spieler beschränkt sei, was zwischen ihnen eineDiskussion hervorrief, die damit endete, daß Pascal die Allgemeinheitder Methode von Fermat anerkannte.Huygens vereinigte die verschiedenen Probleme, die manbereits gelöst hatte, und fügte ihnen neue hinzu in einerkleinen Abhandlung, der ersten, die über diesen Gegenstanderschienen ist und den Titel trug: De ratiociniis in lud0 aleae.Mehrere Geometer beschäftigten sich hierauf damit: Hudde,der Erbst,atthalter Witt in Holland und Halley in Englandwendeten die Rechnung auf die Wahrscheinlichkeiten desmenschlichen Lebens an, und Halley veröffentlichte zu diesemZwecke die erste Sterblichkeitstabelle. Um dieselbe Zeit legteJakob Bernoulli den Geometern verschiedene Wahrscheinlichkeitsproblemevor, von denen er seitdem Lösungen gegebenhat. Endlich verfaßte er sein schönes Werk, das den Titelträgt: Ars conjectandi, das erst 7 Jahre nach seinem imJahre 1706 erfolgten Tode erschien. Die Wissenschaft derWahrscheinlichkeit wird in diesem Werke viel mehr vertieftals in dem des Huygens. Der Verfasser gibt daselbst eineallgemeine Theorie der Kombinationen und der Reihen undwendet dieselbe auf mehrere schwierige Fragen über denZufall an. Dieses Werk ist auch bemerkenswert durch dieRichtigkeit und Feinheit der Gesichtspunkte, durch die Verwendungder Binomialformel in dieser Art Untersuchungen,und durch den Beweis des Theorems, daß nämlich bei unbegrenzterWiederholung der Beobachtungen und Erfahrungendas Verhältnis verschiedenartiger Ereignisse sioh demihrer bezüglichen Möglichkeiten innerhalb von Grenzennähert, deren Intervall sich in dem Maße, als sie sich vervielfältigen,mehr und mehr zusammenzieht und kleiner wirdals irgend eine angebbare Größe. Dieses Theorem ist sehrnützlich, um aus den Beobachtungen die Gesetze und die Ursachender Erscheinungen zu erkennen. Bernoulli hat mitRecht seinem Beweise, über den er, wie er sagt, 20 Jahrenachgedacht hatte, eine große Wichtigkeit beigelegt.In der Zeit zwischen dem Tode Jakob Bernoullis undder Veröffentlichung seines Werkes ließen Montmort undMnivre zwei Abhandlungen über die Wahrscheinlichkeitsrech-
164 P. 8. de Laplace:nung erscheinen. Die von Montmort trägt den Titel: Essaisur les Jeux de hasard; sie enthält zahlreiche Anwendungendieser Rechnung auf verschiedene Spiele. Der Verfasser hatin die zweite Ausgabe einige Briefe aufgenommen, in welchenNicolas Bernoulli ingeniöse Lösungen mehrerer schwierigerProbleme gibt. Die Abhandlung von Moivre, jünger als dievon Montmort, erschien zuerst in den Philosophical Transactionsdes Jahres 1711. Hierauf veröffentlichte sie derVerfasser gesondert und hat sie nach und nach in den dreivon ihm veranstalteten Auflagen vervollkommnet. DiesesWerk gründet sich hauptsächlich auf die Binomialformel,und die Probleme, die es enthält, besitzen so wie ihre Lösungeneine große Allgemeinheit. Aber das, was es auszeichnet,ist die Theorie der rekurrenten Reihen und ihreAnwendung auf diesen Gegenstand. Diese Theorie bestehtin der Integration der linearen endlichen Differenzengleichungenmit konstanten Koeffizienten, eine Integration, zu derMoivre auf eine sehr glückliche Weise gelangt.Moivre nahm in seinem Werke das Theorem von JakobBernoulli über die Wahrscheinlichkeit der durch eine großeAnzahl von Beobachtungen bestimmten Ergebnisse wiederauf. Er begnügt sich nicht, wie Bernoulli, zu zeigen, daßdas Verhältnis der Ereignisse, die eintreffen sollen, unablässigsich dem ihrer bezüglichen Möglichkeiten n8hert; er gibtüberdies einen eleganten und einfachen Ausdruck für dieWahrscheinlichkeit, daß die Differenz dieser beiden Verhältnissein gegebenen Grenzen enthalten sei. Zu dem Behufe bestimmter das Verhältnis des größten Gliedes der Entwicklungeiner sehr hohen Potenz des Binoms zur Summe allerihrer Glieder, sowie den natürlichen Logalithmus des Oberschussesdieses Gliedes über die demselben sehr benachbartenGlieder. Da das größte Glied dann das Produkt einer beträchtlichenAnzahl von Faktoren ist, so wird die numerischeBerechnung desselben unausführbar. Um dasselbe durcheine konvergente Annäherun zu erhalten, wendet Moivreein Theorem von Stirling über das mittlere Glied des aufeine hohe Potenz erhobenen Binoms an, ein Theorem merkwürdigbesonders dadurch, daß es die Quadratwurzel ausdem Verhältnisse des Kreisumfangs zum Radius in einen Ausdruckeinführt, der dieser Transzendenten fremd sein zumüssen scheint. Auch Moivre war außerordentlich erstaunt
Historische Bemerkung über d. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 165über dieses Resultat, das Stirling aus der Pr~duktentwicklun~des Kreisumfanges abgeleitet hatte, ein Ausdruck, zu demWallis durch eine eigentümliche Analyse, die den Keim derso merkwürdigen und nützlichen Theorie bestimmten Integraleenthält, gekommen war.Mehrere Gelehrte, unter denen man Deparcieux, Kersseboom,Wargentin, DuprA de Saint-Maure, Simpson, Süßmilch,Messdne, Moheau, Price, Baily und Duvillard besondersanführen muß, haben eine große zahl von wertvollen Datenüber Bevölkerung, Geburten, Heiraten und Sterblichkeit gesammelt.Sie haben Formeln und Tabellen gegeben, die sichauf Lebensrenten, Tontinen, Assekuranzen usw. beziehen.Aber in dieser kurzen Notiz kann ich auf diese nützlichenArbeiten nur hinweisen, um mich an die originellen Ideen zuhalten. Unter deren Zahl gehört die Unterscheidung zwischenmathematischer und moralischer Hoffnung und das ingeniösePrinzip, das Daniel Bernoulli angegeben hat, um dieseder Analyse zu unterwerfen. Solcher Art ist auch noch dieglückliche Anwendung, die er von der Wahrscheinlichkeitsrechnungauf die Impfung gemacht hat. Hauptsächlich mußman aber unter die Zahl dieser originellen Ideen die direkteBetrachtung der Möglichkeiten von Ereignissen, die ausden beobachteten Ereignissen abgeleitet werden, einreihen.Jakob Bernoulli und Moivre nahmen diese Möglichkeiten alsbekannt an und suchten die Wahrscheinlichkeit, daß dasResultat der anzustellenden Untersuchungen ihnen mehrund mehr nahe kommen wird. Bayes hat in den PhilosophicalTransactions des Jahres 1763 direkt die Wahrscheinlichkeitgesucht, daß die durch schon angestellte Untersuchungenangezeigten Möglichkeiten in bestimmten Grenzenenthalten sind, und er ist auf eine subtile und sehr ingeniöse,wenn auch ein wenig schwerfällige Weise dahin gelangt.Dieser Gegenstand knüpft sich an die Theorie der Wahrscheinlichkeitder Ursachen und der künftigen Ereignisse,wie sie aus den beobachteten Ereignissen erschlossen wird;eine Theorie, deren Prinzipien ich einige Jahre nachher dargelegthabe, zugleich mit einer Bemerkung über den Einflußder Ungleichheiten, welche zwischen den als gleich angenommenenChancen bestehen können. Obwohl man nichtweiß, welches die einfachen von diesen Ungleichheiten begünstigtenEreignisse sind, so vermehrt doch gerade diese Un-
kenntnis oft die Wahrscheinlichkeit der zusammengesetztenEreignisse.Durch die Verallgemeinerung der Analyse und der Problemeder Wahrscheinlichkeit wurde ich auf den Kalkülder partiellen Differenzen geführt, welchen seither Lagrangemittels einer sehr einfachen Methode behandelte, und vondem er schöne Anwendungen auf diese Art von Problemengemacht hat. Die Theorie der erzeugenden Funktionen,die ich ungefähr um dieselbe Zeit gegeben habe, umfaßtauch diese Probleme und paßt sich von selbst und mit dergrößten Allgemeinheit den schwierigsten Wahrscheinlichkeitsproblemenan. Sie bestimmt auch durch sehr konvergenteAnnäherungen die Werte der aus einer großen Anzahl vonGliedern und Faktoren zusammengesetzten Funktionen, undindem sie ersichtlich macht, daß die Quadratwurzel aus demVerhältnisse zwischen Kreisumfang und Radius am häufigstenin diese Werte eintritt, zeigt sie, daß eine unendliche Anzahlanderer Transzendenten hier auftreten.Man hat auch die Zeugenaussagen, die Abstimmungenund Beschlüsse der wählenden und beratenden Versammlungenund die Urteilsprüche der Gerichte der Wahrscheinlichkeitsrechnungunterworfen. So viele Leidenschaften,verschiedene Interessen und Umstände komplizieren die aufdiese Gegenstände bezüglichen Untersuchungen, daß siefast immer unlösbar sind. Aber die Lösung einfacherer Probleme,die mit ihnen viel Ähnlichkeit haben, kann oft überdiese schwierigen und wichtigen Fragen viel Licht verbreiten,was bei der Sicherheit der Rechnung den eingehendstenuberlegungen noch immer vorzuziehen ist.Eine der interessantesten Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnungbezieht sich auf die Mittelwerte, die manunter den Beobachtungsresultaten wählen muß. MehrereGeometer haben sich damit befaßt und Lagrange hat in denMemoires de Turin eine schöne Methode zur Bestimmungdieser Mittelwerte veröffentlicht, wenn das Gesetz der Beobachtungsfehlerbekannt ist. Ich habe für denselben Gegenstandeine auf einem besonderen Kunstgriff beruhende Methodegegeben, die mit Vorteil auf andere Fragen der Analysisangewendet werden kann, und welche, da sie Funktionen,deren Grenzen durch die Natur des Problems gegeben seinmüssen, für den ganzen Verlauf einer langen Rechnung ins
Historische Bemerkung über d. Wahrscheinlichkeitsrechnungg 167Unendliche auszudehnen gestattet, die Modifikationen anzeigt,die jedes Glied des Schlußresultates vermöge dieserGrenzen erfihrt. Man hat früher gesehen, daß jede Beobachtungeine Bedingungsgleichung ersten Grades liefert,die stets so geschrieben werden kann, daß man alle ihreGlieder auf eine Seite bringt, während die andere null ist. DieBenützung dieser Gleichungen ist eine der Hauptursachen dergroßen Genauigkeit unserer astronomischen Tabellen, weilman so eine ungeheure Anzahl von ausgezeichneten Beobachtungenzur Feststellung ihrer Elemente verwenden konnte.Wenn nur ein Element zu bestimmen ist, so sind nach derVorschrift von Cdtes die Bedingungsgleichungen so einzurichten.daß der Koeffizient des unbekannten Elementes in iederderselben positiv ist, und hierauf alle diese Gleichungen addieren,um eine Schlußgleichung zu bilden, aus der man der^Wert dieses Elementes ermittelt. Die Regel von C6tes wurdevon allen Rechnern befolgt. Aber wenn man mehrere Elementebestimmen sollte, dann hatte man keine feste Regel,um die Bedingungsgleichungen in der Weise zu kombinieren,daß man die notwendigen Schlußgleichungen erhielt; manwählte nur für jedes Element die für seine Bestimmunggeeignetsten Beobachtungen aus. Um diesem Herumtastenvorzubeugen, kamen die Herren Legendre und Gauß aufdie Idee, die Quadrate der linken Seiten der Bedingungs-- -gleichungen zu summieren und deren Summe zu einemMinimum zu machen, wobei sie jedes unbekannte Elementsich verändern ließen: dadurch erhält man direkt ebensovieleSchlußgleichungen als es Elemente gibt. Aber verdienendie durch diese Gleichungen " bestimmten Werte einenVorzug vor allen denen, die man durch andere Mittel erhaltenkann? Das konnte einzig und allein die Wahrscheinlichkeitsrechnunglehren. Ich wandte sie also auf diesenwichtigen Gegenstand an und gelangte durch eine subtile-4nalyse zu einer Regel, welche die vorhergehende in sichschließt, und die mit dem Vorteil, durch ein nach festerRegel vorgeschriebenes Verfahren die gesuchten Elementezu geben, den andern verbindet, daß sie dieselben aus derGesamtheit der Beobachtungen mit der größten Evidenzhervorgehen läßt und ihre Werte so bestimmt, daß sie nurdie kleinstmöglichen Fehler befürchten lassen.Man hat jedoch nur eine unvollständige Kenntnis der
168 P. S. de Laplaca:erlangten Resultate, solange das Gesetz der Fehler, derensie fähig sind, nicht bekannt ist; man muß die Rahrscheinlichkeitangeben können, daß diese Fehler in gegebenenGrenzen enthalten sind, was darauf hinausläuft, das zu bestimmen,was ich das Gewicht eines Resultats genannt habe.Die Analyse führt zu allgemeinen und einfachen Formeln hierfür.Ich habe diese Analyse auf die Ergebnisse der geodätischenBeobachtungen angewandt. Das allgemeine Problembesteht darin, die Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, daßdie Werte einer oder mehrerer linearer Funktionen der Fehlereiner sehr großen Anzahl von Beobachtungen in beliebigenGrenzen eingeschlossen sind.Das Gesetz der Möglichkeit der Beobachtungsfehler führtin die Ausdrücke dieser Wahrscheinlichkeiten eine Konstanteein, deren Wert die Kenntnis dieses fest immer unbekanntenGesetzes zu fordern scheint. Glücklicherweise kann diese Konstantedurch die Beobachtungen selbst bestimmt werden. Beider Aufsuchung der astronomischen Elemente ist sie duroh dieQuadratsumme der Unterschiede zwischen jeder beobachtetenund berechneten Größe gegeben. Da die gleich wahrscheinlichenFehler der Quadratwurzel aus dieser Summe proportionalsind, so kann man durch die Vergleichung dieser Quadratedie bezügliche Genauigkeit der verschiedenen Tabellen einesund desselben Gestirnes abschätzen. Bei den geodätischenMessungen sind diese Quadrate durch die Fehlerquadrate derbeobachteten Summen der drei Winkel eines jeden Dreieckes'ersetzt. Der Vergleich dieser Fehlerquadrate wird also aufdie relative Genauigkeit der Instrumente, mit denen mandie Winkel gemessen hat, schließen lassen. Man sieht durch,diesen Vergleich den Vorteil des Repetitionskreises gegenüberden Instrumenten, die er in der Geodäsie ersetzt hat.Oft gibt es in den Beobachtungen mehrere Fehlerquellen,z. B.: da die Positionen der Gestirne mittels des Meridianinstrumentesund des Kreises bestimmt sind, die beide Fehlernunterworfen sind, deren Wahrscheinlichkeitsgesetz nicht als,das nämliche vorausgesetzt werden darf, so sind die Elemente,welche man aus diesen Positionen ableitet, mit diesenFehlern behaftet. Die Bedingungsgleichungen, welche manzur Bestimmung dieser Elemente bildet, enthalten die Fehlerjedes Instrumentes, und sie kommen darin mit verschiedenenKoeffizienten vor. Das vorteilhafteste System der
Historische Bemerkung über d. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 169Faktoren, mit denen man beziehungsweise diese Gleichungenmultiplizieren muß, um durch die Verbindung der Produkteebensoviele Schlußgleichungen zu erhalten, als es zu bestimmendeElemente gibt, ist dann nicht mehr das der Kogffizientender Elemente in jeder Bedingungsgleichung. DieAnalyse, die ich angewendet hebe, führt, was auch die Anzahlder Fehlerquellen sein mag, leicht zu einem System vonFaktoren, welches die günstigsten Resultate gibt, oder indenen ein und derselbe Fehler weniger wahrscheinlich ist alsbei jedem anderen System. Dieselbe Analyse bestimmt auchdie Wahrscheinlichkeitsgesetze der Fehler dieser Resultate.Diese Formeln schließen ebensoviele unbekannte Konstantenein, als Fehlerquellen vorhanden sind, und diese Konstantenhängen von den Wahrscheinlichkeitsgesetzen dieser Fehler ab.Man hat gesehen, daß im Falle einer einzigen Fehlerquellediese Konstante dadurch bestimmt werden kann, daß mandie Quadratsumme der Reste jeder Bedingungsgleichung bildet,worin man die für die Elemente gefundenen Werte eingesetzthat. Ein ähnliches Verfahren gibt allgemein die Wertedieser Konstanten, was auch ihre Zahl sein mag, wodurchdie Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf dieResultate der Beobachtungen vervollständigt wird.Ich muß hier eine wichtige Bemerkung machen. Diekleine Ungenauigkeit, welche die Beobachtungen, wenn sienicht sehr zahlreich sind, für die Werte der eben erwähntenKonstanten übrig lassen, macht die durch die Analyse bestimmtenWahrscheinlichkeiten ein wenig unsicher. Aber esgenügt fast immer zu wissen, ob die Wahrscheinlichkeit dafür,daß die Fehler der erlangten Resultate in engen Grenzen eingeschlossensind, der Einheit außerordentlich nahe kommt, undwenn dies nicht der Fall ist, so genügt es zu wissen, bis wieweitman die Beobachtungen vervielfachen muß, um einesolche Wahrscheinlichkeit zu erlangen, daß kein vernünftigerZweifel an der Güte der Resultate übrig bleibt. Dieanalytischen Formeln der Wahrscheinlichkeiten genügen vollkommenfür diesen Zweck, und in dieser Beziehung könnensie als eine notwendige Ergänzung der Wissenschaften angesehenwerden, die auf ein System von Beobachtungen gegründetsind, die Fehlern ausgesetzt sind. Sie sind sogarunentbehrlich zur Lösung einer großen Anzahl von Fragen inden Natur- und Moralwissenschaften. Die regelmäßigen Ur-
P. S. de Laplaca:Sachen der Erscheinungen sind zumeist entweder unbekanntoder zu kompliziert, um der Berechnung unterworfen zu werden:oft auch ist ihre Wirkung von zufälligen und unregelmäßigenUrsachen gestört, aber immer bleibt sie den vonallen diesen Ursachen hervorgebrachten Ereignissen aufgeprägtund erzeugt darin Modifikationen, die durch eine langeReihe von Beobachtungen festgestellt werden können. DieAnalyse der Wahrscheinlichkeiten entwickelt diese Modifikationen,sie gibt die Wahrscheinlichkeit ihrer Ursachen an undweirt auf die Mittel hin, um diese Wahrscheinlichkeit mehr undmehr zu vergrößern. So z. B. bringen mitten unter den unregelmäßigenUrsachen, die auf die Atmosphäre einwirken,die periodischen Veränderungen der Sonnenwärme von Tagund Nacht und von Winter und Sommer in dem Druckedieser großen flüssigen Masse und der entsprechenden Barometerhöhetägliche und jährliche Schwankungen hervor, diezahlreiche barometrische Beobachtungen mit einer Wahrscheinlichkeiterkennen ließen, die mindestens ebensogroß istals die mancher Tatsachen, die wir als gewiß betrachten. Sozeigt uns auch die Reihe der historischen Ereignisse die beständigeN7irkung der großen Prinzipien der Moral mittenunter den Leidenschaften und den verschiedenen Interessen,die die Gesellschaften nach allen Richtungen hin bewegen. Esist staunenswert, daß eine Wissenschaft, die mit der Betrachtungder Spiele begann, sich zu den wichtigsten Gegenständender menschlichen Erkenntnis erhoben hat.Ich habe alle diese Methoden in meiner ,,AnalytischenTheorie der Wahrscheinlichkeiten" gesammelt, wo ich in derallgemeinsten Weise die Prinzipien und Analyse der Wahrscheinlichkeitsrechnungsowie die Lösungen der interessantestenund schwierigsten Probleme, welche die Rechnung darbietet,darlegen wollte.Man ersieht aus diesem Essai, daß die Wahrscheinlichkeitstheorieim Grunde nur der der Berechnung unterworfenegesunde Menschenverstand ist; sie lehrt des mitGenauigkeit abschiitzen, was ein gerader Verstand mit einerArt Instinkt fühlt, ohne daß er sich oft davon Rechenschaftgeben kann. Sie läßt nichts Willkürliches in der Wahlder Meinungen und der zu ergreifenden Entschlüsse, so oftman nur mit ihrer Hilfe die vorteilhafteste Wahl bestimmenkann. Dadurch wird sie die glücklichste Ergänzung der
Historische Bemerkung über d. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 171Unwissenheit und Unzulänglichkeit des menschlichen Geistes.Betrachtet man die analytischen Methoden, die durch dieseTheorie entstanden, die Wahrheit der Prinzipien, die ihr zurGrundlage dienen, die scharfe und feine Logik, welche ihreAnwendung bei der Lösung von Problemen erfordert, diegemeinnützigen Anstalten, die sich auf sie gründen, sowiedie Ausdehnung, die sie schon erlangt hat und durch ihreAnwendung auf die wichtigsten Fragen der Naturphilosophieund der moralischen Wissenschaften noch erhalten kann;bemerkt man sodann, wie sie selbst in den Dingen, die derBerechnung nicht unterworfen werden können, die verläßlichstenWinke gibt, die uns bei unseren Urteilen leiten können,und wie sie vor irreführenden Täuschungen sich in acht zunehmen lehrt, so wird man einsehen, daß es keine Wissenschaftgibt, die unseres Naohdenkens würdiger wäre, unddie mit größerem Nutzen in das System des öffentlichenUnterrichts aufgenommen werden könnte.
Anmerkungen.Von H. Pollaczek-Geiringer.Pierre-Simon L apl ac e wurde im Geburtsjahre Goethes1749 in Beaumont (Frankreich) geboren. An der dortigenMilitärschule genoß er seine erste Ausbildung und erteilteauch zu Beginn seiner Laufbahn Unterricht daselbst.. Schondamals galt sein Interesse vorwiegend den mathematischenWissenschaften in dem weiten Sinn, den das 18. Jahrhundertdiesem Begriff gab, der in gleicher Weise Mathematik, Physik,Astronomie umfaßte.Mit 22 Jahren kam er nach Paris, wo er, von d'Al e m ber tgefördert, einen mathematischen Lehrstuhl erhielt. - Seinewissenschaftliche TiLtigkeit gipfelt in zwei Hauptwerken,,TraitB de mecanique celeste" 1798-1825l) ((Euvres completesTome I-V, 1878-1882) und der ,,Theorie analytiquedes probabilit6s" 1812 (Guvres, VII, 1886, nach der 111.Aufl.von 1820). Außerdem erschien 1796 die berühmte ,,Expositiondu systeme du monde" ((Euvres, VI, 1884, nach derVI. Aufl. 1835), ein Werk, das die sogenannte Kant-La p 1 a C e sche Kosmogonie entwickelt. Dazu kommen kleinereim engeren Sinne physikalische Arbeiten. - Seit 1816war Laplace Mitglied der Akademie. Er starb 1827 imAlter von 78 Jahren.Die Beschäftigung mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung,die ihm mehr verdankt als all seinen Vorgängern2), zieht sichI) Die im folgenden genannten Werke von Laplace sind zitiert,soweit nicht anders angegeben, nach: „CEuvres oompldtes de Laplaoe,publibes sous les auspices de l'academie des sciences, parMM.les seoretaires perpetuelfi". Paris 1878-1912. Tome I bisXIV.2) Zur Geschichte der Wahrscheinlichkeitsreohnung vor Laplaceverweisen wir u. a. auch auf die ausführliche historische Einleitungvon R. Haussner zu ,,Jakob Bernoulli, Wahrscheinlichkeitsrechnung(ars conjeotandi)", Ostwalds Klassiker 107, vor allemaber auf das letzte Kapitel des ,,Essai. .." selbst, den ,,Aperguhistorique ...'I,der späteren Historikern der Wahrscheinliohkeitsrechnungals Quelle diente.
Anmerkungen. 173durch sein ganzes wissenschaftliches Leben. Seine erstengroßeren Arbeiten dieser Richtung waren: ,,Memoire sur lessuites r6curro-rhcurrentes et sur leurs usages dans la th6oriedes hasards" 1774 ((Euvres, VIII, 1891, p. 5-24) und „MBmoiresur la probabilith des causes par les Qvhnements" 1774 (Euvrea,VIII, 1891, p. 27-65). 1812 erschien die erste Auflage der„Theorie analytique . . .", 1820 ihre dritte, noch wesentlichveränderte Auflage.Das vierte Supplement zur ,,ThBorieanalytique .. ." wurde 1825, also zwei Jahre vor seinem Tode,von ihm hinzugefügt. Es seien hier die Worte wiedergegeben,die ein so Berufener wie S. D. Po i s s o n dem <strong>wahrscheinlichkeit</strong>stheoretischenWerke von Laplace widmet : ,,Bans douteLaplace s'est montr6 un homme de ghnie dans la mecaniquecbleste; c'est lui qui a fait preuve de la sagacith la pluspenbtrante pour decouvrir les causes des phhnomhes; etc'est ainsi qu'il a trouve la cause de l'accelhration du mouvementde la Lune et celle des grandes inegaliths de Saturneet de Jupiter, qulEuler et Lagrange avaient cherchhes infructueusement.Mais on peut dire que c'est encore plutdtdans le calcul des probabilites qu'il a ht6 un grand ghomdtre;car ce sont les nombreuses applications qu'il a faitea de cecalcul qui ont donnh naissance au calcul aux diffhrencesfinies partielles, 8, sa mhthode pour la rhduction de certainesint6grales en shries, et d ce qu'il a nommh la thhorie desf onc tions ghn6ratrices." (Comptes Rendus, Paris 1836,11: ,,Note sur le calcul des probabiliths; par M. Poisson",P. 395-400.)Von den einzelnen Arbeiten zur Wahrscheinlichkeitsrechnung,die ihre zusammenfassende Darstellung in der Theorieanalytique . . . gefunden haben, sind - außer den beidengenannten - die wichtigsten: ,,Recherohes sur 11int6grationdes Qquations differentielles aux differentes finies et sur leurusage dans 1a thhorie des hasards" 1773, 17761) ((Euvrea,VIII, p. 69-197); ,,Memoire sur l'inclinaison moyenne desorbites des com8tes, sur la figure de la Terre et sur les fonctions"1773,1776 (Euvres, VIII, p. 279-321); ,,Mhmoire surI) Wo im folgenden, wie hier, zwei Jahreszahlen angeftihrtsind, bezeichnet die erste des Jahr, in dem die Arbeit der Akademieoder einer andern Körpersohaft vorgelegt worden war, die zweitedas endgültige Erscheinungsjahr.
les probabilites" 1778, 1781 (CEuvres, IX, 1893, p. 383-485);,,Memoire sur les suites" 1779, 1782 (Guvres, X, 1894,p. 1-89); ,,Memoire sur les approximations des formulesqui sont fonctions de trds grands nombres" 1782, 1785(CEuvres, X, p. 209-295);,,MQmoire sur les approximations. . . (Suite)" 1783, 1786 ((Euvres, X, p. 296-338);,,Sur les naissances, les mariages et les morts B Paris, depuis1771 jusqu'en 1784, et dans toute l'etendue de laFrance, pendantles andes 1781 et 1782" 1783,1786 (CEuvres, XI, 1895,p. 35-46). Sodann folgen nach langer Pause: ,,Memoiresur les approximations . . . nombres, et sur leur applicationeux probabilites" 1809,1810 (CEuvres, XII, 1898, p. 301-345) ;„Supplhment au Memoire sur les approximations . ..nombres"1809, 1810 (CEuvres, XII, p. 349-353) und ,,Memoire sur lesintegrales definies et leur application aux probabilites, etsphcialement A la recherche du milieu qu'il faut choisir entreles resultats des observations" 1810, 1811 (CEuvres, XII,p. 357-412). (Die letztgenannte Arbeit beginnt mit dendie Bedeutung dieser Probleme innerhalb des LebenswerksLaplace' kennzeichnenden Worten: ,,J'ai donne, il y a environtrenteans,danslesMQmoiresde1'AcadQmie dessciences,la theorie des fonctions genhratrices et celle de l'approximationdes formules qui sont fonctions de grands nombres . . .").Sodann folgen: ,,Sur l'application du calcul des probabilitesB la philosophie naturelle" 1815, 1818 (CEuvres, XIII, 1904,p. 98-116) ; „Bur le calcul des probabilites applique B la philosophienaturelle" 1815, 1818 (CEuvres, XIII, p. 117-120);,,Application du calcul des probabilites aux operations geodesiques"1818, 1820 (CEuvres, XIII, p. 143 angezeigt; dieseArbeit ist - mit Erweiterungen - abgedruckt im zweitenSupplement zur ,,Theorie analytique . . .", das den gleichenTitel trägt (Euvres, VII, p. 531-580) ; ,,Application du calculdes probabilites aux operations geodesiques de la meridienne"1820, 1822 (CEuvres, XIII, p. 188 angezeigt; diese Arbeit istreproduziert im $ 1 des dritten Supplements, CEuvres, VII,p. 581-585); ,,Memoire sur l'application du calcul des probabiliteseux observations et specialement aux operations dunivellement" 1819 (CEuvres, XIV, 1912, p. 301-304)l).l) Einige kleine Mitteilungen aus Band XIV wurden hier nichtangeführt.
Anmerkungen. 175Der Inhalt dieser Originalarbeiten ist in die ,,Theorieanalytique" und ihre Supplemente übergegangen. (In derdritten, 1820 erschienenen Auflage, kamen drei Supplementehinzu ,,qui se rapportent B l'application du Calcul desProbabilites aux sciences naturelles et aux operations gbodesiques".Ein viertes Supplement wurde 1825 von Laplacehinzugefügt und von ihm den Exemplaren, die ihm nocherreichbar waren, eingefügt. (Euvres, VII, p. 616-645.)Selbst ein noch so kurzer Bericht über die Ergebnisse diesesWerks würde den hier gebotenen Rahmen überschreiten,und er wäre auch - gerade an dieser Stelle - überflüssig:Denn Laplace selbst hat eine ,,populär wissenschaftliche"Zusammenstellung seiner Hauptresultate niedergelegt in ebendem Werke, das uns hier beschäftigt, dem ,,Essai philosophiquesur les Probabilites", zum erstenmal erschienen 1814.Dieser bildet, wie Laplace in der Einleitung mitteilt, dieAusführung einer 1795 gehaltenen Vorlesung, die sich zumTeil mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigte: ,,Leconsde Mathematiques donnkes B l'gcole Normale en 1795" (insbesondere,,dixibme seance: Sur les probabilites", (Euvres,XIV, p. 1&177 bzw. 146-177). Ihren weiteren Ausbaufand diese Vorlesung, soweit sie die Wahrscheinlichkeitsrechnungbetrifft, in der Einleitung zur 11. Auflage der ,,Theorieanalytique . . .". Diese Einleitung umfaßte 106 Quartseiten.In dem Vorwort zur 11. Auflage hebt Laplace dieUnterschiede gegen die I. Auflage hervor: ,,. . . La principaleest une Introduction fort ktendue, dans laquelle lesprincipes de la Theorie des Probabilitbs et leurs applicationsles plus interessantes sont exposes sans le secours du calcul.Cette Introduction qui sert de preface B l'ouvrage, paraitencore separement sous ce titre: Essai philosophiquesur les Probabilites.'' Im gleichen Jahre erschien dieseEinleitung auch wirklich als selbständiges Werk. Sodann erfolgte1820 die Herausgabe der 111.Auflage der ,,Theorie . . .",in der die stark vergrößerte Einleitung 142 Quartseitenbeansprucht. ,,Cette troisieme Edition differe de la prhce-dente: l0 par une nouvelle Introduction qui a paru I'anneedernibre, sous ce titre: Essai philosophique sur les Probabilites,quatribme Edition . . .", so heißt es in dem Vorwort zur111. Auflage. Die nach 1820 besorgten Auflagen des Essaienthalten natürlich alle diese Erweiterungen und Änderungen.
Der Essai stellt einen Versuch des großen Laplace dar,in einer Zeit, in der die Atomisierung des Wissens nicht soweit fortgeschritten war wie heute, die Auffassungen undResultate des Wissensgebietes, das einen wesentlichen Teilseiner Lebensarbeit ausmachte, einem weiteren Kreis Gebildeterzugänglich zu machen. Wenn man ihm auch heuteauf manche Gebiete, die er <strong>wahrscheinlichkeit</strong>stheoretisoherUntersuchung unterwirft, nicht folgen kann, so wird dochseine allgemeine Einschätzung von dem Wert und der Bedeutungdieser Betrachtungsweise um so intensiver bestätigt (mandenke vor allem an unsere Physik, aber auch an Biologie,Soziologie, Psychologie und an das auf der Wahrscheinlichkeitsrechnungbasierende Versicherungswesen, Statistik usf.).Oberall, auch an Stellen, die man heute historisch wertenwird, zeigt sich das überlegene, oft glanzvolle Werk einesumfassenden freien Geistes.Die erste deutsche Ubersetzung stammt von Tönnies :„Des Grafen Laplace Philosophischer Versuch über Wahr-scheinlichkeiten".Nach der 111. Pariser Auflage übersetztvon F. W. Tönnies. Mit erläuternden Anmerkungen herausgegebenvon K. Chr. Langsdorf f, Heidelberg 1819. - Siebasiert noch auf der 11. Auflage der ThBorie . . . Da, wieerwiihnt, nach Herauskommen der 111. Auflage dieses Werksauch der Essai wesentlich geändert erschien, war es sehr zubegrüßen, daß 1886 eine nach der VI. Auflage des Essaidurchgeführte Ubersetzung von N. S ch w aiger erschien.Diese brachte auch, im Gegensatz zu den etwas trivialenAnmerkungen von Langsdorff, 6 Seiten sehr dankenswerterAnmerkungen. Beide ubersetzungen sind vergriffen.Die Schwaigersche Ubersetzung wurde für die hier vorliegendeAusgabe benutzt; manche Mißverständnisse wurdenbeseitigt, manches tunlichst präziser ausgedrückt und derganze Text stilistisch dem heutigen Sprachgebrauch etwasmehr angepaßt. Doch bestand nicht die Absicht, den Charakterdes Essai als eines Werks der Wende des 18. Jahrhundertssprachlich zu verleugnen. Als Unterlage diente derText einer neuerdings eröffneten französischen Sammlung, diemanche Analogie mit ,,Ostwalds Klassikern" aufweist: ,,Lwmeitres de la pensBe scientifique" Collection de MBmoires etOuvrages. Publi6e par les soins de Maurice Solovine; ,,Essaiphilosophique sur les probabilites par Pierre-Simon Laplace."
Anmerkungen.Park 1921. Reproduziert ist dort der Text der V. Auflage(1825) des Essai als der ,,letzten, noch zu Lebzeiten von Laplaceerschienenen und der vollständigsten".Die Anmerkungen zu dieser deutschen Ausgabe sind vorwiegendnach zwei - naturgemäß subjektiv beeinflußten -Gesichtspunkten ausgewählt. Einerseits wurde - besonderszu den ersten Kapiteln - hervorgehoben, was vom modernenStandpunkt anfechtbar erschien, und demgegenüber dieneuere kritische Auffassung angedeutet. Bndererseits wurdenStellen erläutert, die dem Verständnis, bzw. den Kenntnisseneines mathematisch nicht unvorgebildeten Lesers (etwa einesStudierenden der Naturwissenschaften) Schwierigkeiten bereitenmochten. Dies bezieht sich auch auf die wohl alsnicht glücklich zu bezeichnenden Versuche Laplace', typischmathematische Schlüsse ohne Formeln darzustellen; die gelegentliche,,Rückübersetzung" solcher Stellen in die Spracheder Analysis dürfte Erleichterung bieten. Die Anmerkungenwerden spärlicher, wenn im Essai die Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnungauf die ,,Sciences morales" beginnenund sodann allgemeinere natur- und sozialphilosophische ErörterungenPlatz gewinnen. - Hinweise auf die dem Essaijeweils entsprechenden Partien der Theorie . . .,wie sie sichin der Schwaigerschen f'bersetzung gelegentlich finden, wurderi.nicht gegeben. Denn soweit derlei bereits aus dem Vergleichder Inhaltsverzeichnisse folgt, - was oft der Fall ist, -schienen sie überflüssig. Hingegen würde eine gründlicheDurchführung solcher Verweise, die auch das umfaßt, wasnicht auf der Hand liegt, zu weit geführt haben; denn vieleskehrt in dem einen wie dem anderen Werk jeweils in verschiedenenZusammenhängen wieder ; manches Problem wirdin den beiden Werken in etwas veränderter Form, unter etwasabweichenden Voraussetzungen behandelt usf.; schließlich istdas Studium der Theorie. . . (von der es auch keine deutscheCbersetzung gibt) so mühsam, sie ist so reich an dunklenStellen, daß ein Leser, der überhaupt so weit ist, sie alsKommentar zum Essai benutzen zu können, dazu keiner Verweisebedarf.Zu S. 1, letzter Abschn. Dieser Abschnitt enthält die berühmtenSätze vom ,,Laplaceschen Genius". Hier wird derMeinung Ausdruck gegeben, daß (ähnlich wie in der Himmels-
178 Anmerkungen.mechanik) alle Erscheinungen durch Differentialgleichungenerfaßbar seien; dann müßte bei Kenntnis der in einem bestimmtenAugenblick bestehenden Anfangsbedingungen dieDurchführung der Integration für alle Zukunft den Weltablaufliefern! Der absolute Determinismus, der hier alsphilosophisches Bekenntnis des Autors zu Worte kommt, istbezeichnend für die rationalistischen Tendenzen des 18. Jahrhunderts.Heute kommt man allmählich dazu, in der modernenPhysik die ,,statistische" Erklärung von Erscheinungenals gleichberechtigt neben dem kausalen Erklärungsprinzip anzuerkennen,so daß man sagen könnte, daß gerade die Wahrscheinlichkeitstheoriein den unbedingten Determinismus ihresbedeutendsten Vertreters eine starke Bresche geschlagen hat.Zu S. 4ff. Die Worte enthalten die klassische Wahrscheinlichkeitsdefinition,die auf dem Begriff der ,,Gleichmöglichkeit"beruht. Diese Erklärung wurde und wird oftohne viel Kritik übernommen, obgleich sich manche Autorenihrer Anfechtbarkeit durchaus bewußt sind. Demgegenüberwird in der modernen Theorie der Wahrscheinlichkeit, dieals „Häufigkeitstheorieu vorwiegend von R. V. Misesl) vertretenist, die Laplacesche Definition als Grundlage einerrationellen Theorie abgelehnt. Diese Kritik kann man vielleichtin drei Punkte zusammenfassen:Die Gleichmöglichkeitsdefinition enthält eine p e t it iopr in cipii. Denn ,,gleich mögliche" Fälle kann offenbarnichts anderes bedeuten als ,,gleich wahrscheinliche" Fälle.Um aber den Wahrscheinlichkeitsbruch, in dessen Nennerdie Anzahl aller für den Eintritt des Ereignisses in Betrachtkommenden gleich möglichen - also gleich wahrscheinlichen- Fälle steht, bilden zu können, müßte man bereits wissen,was ,,wahrscheinlich", bzw. ,,gleich wahrscheinlich" heißt.Man könnte also bestenfalls, wie dies die Fassung bei Laplaceja auch nahelegt, in seiner Definition eine Zurückführungdes allgemeinen W~ahrscheinlichkeitsbegriffsauf dender Gleich<strong>wahrscheinlichkeit</strong> erblicken.Nimmt man aber selbst diese bescheidenere Rolle derl) a) Mathem. Zs. Bd. 5, 1910, S. 52-92; b) Wahrscheinlichkeit,Statistik und Wahrheit. Berlin 1928; C) Vorlesungen ausdem Gebiete der angewandten Mathematik. 1. Bd. Wahrsoheinliohkeitsrechnung.Leipzig und Wien 1931.
Anmerkungen. 179klassischen Definition an, so erhebt sich die weitere Schwierigkeit,daß es eben sehr oft nicht gelingt - wie das zweitePrinzip es fordert -, alle Ereignisse gleicher Art aufeine bestimmte Anzahl gleich möglicher Fälle zureduzieren. Dies erläutert das Beispiel des ,,falschen"Würfels. Wenn man einen gewöhnlichen, sogenannten richtigenWürfel anfeilt, oder wenn der Würfel aus nicht homogenemMaterial besteht, so hat es keinen Sinn mehr, die sechsSeiten als von vornherein gleichwahrscheinlich anzusehen,und die Wahrscheinlichkeit für das Auffallen einer von ihnenwird erst auf andere Weise festzustellen sein. Man könntesich demgegenüber auf den Standpunkt stellen, den falschenWürfel als unwürdiges und unwichtiges Objekt aus der Wahrscheinlichkeitsrechnungauszuschließen. Aber damit ist nichtsgewonnen. Vielmehr häufen sich die Schwierigkeiten, wennman das historische Gebiet der Glücksspiele verläßt. Es wirdetwa die Sterbens<strong>wahrscheinlichkeit</strong> einer 30 Jahre altendeutschen Frau zu 0,01 angegeben. Die Anwendung derWahrscheinlichkeitsrechnung auf Probleme der Lebens<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enwird von Laplace ausführlich besprochen.Alle Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung werden von ihmund seinen Nachfolgern auf das Rechnen mit Sterbens<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enU. dgl. angewendet, obgleich diese durch dieLaplacesche Definition nicht erklärt sind. Denn hier sind diegleich wahrscheinlichen Fälle ebensowenig aufzeigbar wie diedem Ereignis günstigen. Weder ist gemeint, daß es etwa100 mögliche Lebensabläufe 30-jähriger deutscher Frauen gibt,von denen einer dem Tode, 99 dem Leben zuführen, nochauch, daß auf je 100 beobachtete Frauen notwendig einestirbt od. dgl. Vielmehr sind die Brüche für die Sterbens<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enbekanntlich Häufigkeits z ahlen, dieaus einem großen empirischen Material gewonnen werden,und sie finden ihre begriffliche Definition in der modernenHäufigkeitstheorie.Schließlich noch liegt der Laplaceschen Definition dieVorstellung zugrunde, daß man irgendwoher ohnedies mitEvidenz weiß, was „gleichwahrscheinlich" heißt und wann,,Gleich<strong>wahrscheinlichkeit</strong>" vorhanden ist ; z. B. beim richtigenWürfel wären seine 6 Seiten gleichwahrscheinlich, weilkein Grund besteht, eine von ihnen zu bevorzugen, weil siegeometrisch gleichberechtigt sind usw. Demgegenüber steht
180 Anmerkungen.die Häufigkeitstheorie auf dem Standpunkt, daß die Auffassungvon der Sonderstellung der Gleich<strong>wahrscheinlichkeit</strong> der Kritik nicht standhält. Sondern man wird zuder Auffassung geführt, daß die Ausgangs<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enals gegebene Daten in einer Aufgabe einzeln vorgegebensein müssen, ganz gleichgultig, ob es sich um Gleichverteilungoder um andere Wahrscheinlichkeitswerte handelt.Aufgabeder Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es sodann, aus diesenAusgangsdaten andere gesuchte Wahrscheinlichkeiten abzuleiten.Soll aber untersucht werden, ob eine aus irgendwelchenGründen angenommene Wahrscheinlichkeitsgrö8e einem bestimmtenkonkreten Fall entspricht - ob z. B. ein vorgelegterWürfel ein „richtigerM ist -, so ist dies festzustellendurch einen ,,statistischen Versuch", vorgenommen an demzu untersuchenden Objekt oder an einem ihm gleichen.Zu S. 7ff. Die ,,zehn Prinzipe" können nicht an einerAxiomatik im heutigen Sinne -auch nicht an einem Aufbauwie dem Euklidischen - gemessen werden. Es sind Erklärungen,die sich weitgehend an die Anschauung, an den gesundenMenschenverstand wenden. Diese Prinzipe erhebennicht den Anspruch, auf einfachste Elemente reduziert zuerscheinen, noch auch den der Unabhängigkeit und Vollständigkeit.Zu 5. 7. Das zweite Prinzip enthält das Additionsgesetzder Wahrscheinlichkeiten, die Regel von der Wahrscheinlichkeitdes ,,entweder-oder". Sie wird ,,als einer derheikelsten Punkte der Theorie des Zufalls" bezeichnet, abermit den Worten des zweiten Prinzips so gut wie gar nichterklärt, sondern nur durch ein Beispiel erläutert. Meist wirdin Lehrbüchern wenigstens die Bedingung hinzugefügt, daßdie Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeiten addiert werden,einander ausschließen sollen1). Das Unzureichende derartigerFassungen zeigen einfache Beispiele: Spielt A mit B „Kopf-Wappen", so seien seine Gewinnchancen 50%; spielt er mitC das gleiche Spiel, so hat er wieder 50% Chancen. Da ernicht gleichzeitig mit B und C spielen kann, so sind es ausschließendeEreignisse, um 12h am gleichen Tage entwederl) Vgl. etwa J. L. Coolidge ,Einführung in die Wahrsoheinliohkeitsrechnung.Deuteche Ausgabe von Urban. Leipeig undBerlin 1927. S. 19.
Anmerkungen. 181gegen B oder gegen C zu gewinnen. Aber trotzdem ist seineChance dafür keineswegs 100 %.Derartige Schwierigkeiten verschwinden nur, wenn manden in der Häufigkeitstheorie grundlegenden Begriff des Kol-1 e k tivs benutzt. So heißt eine als unbegrenzt fortsetzbargedachte Folge von Beobachtungen, ein prinzipiell beliebigreproduzierbarer, genau festgelegter Wiederholungsvor -gang, der noch bestimmten Forderungen genügen muß. EineWahrscheinlichkeit gibt es nach der Auffassung der Häufigkeitstheorienur jeweils innerhalb eines Kollektivs. ImSinne dieser Theorie kann man z. B. über die Sterbens<strong>wahrscheinlichkeit</strong>einer noch so gut bekannten Person gar nichtsaussagen, wohl aber über ihre Sterbens<strong>wahrscheinlichkeit</strong> alsMitglied einer Gemeinschaft (2. B. der 30-jährigen deutschenFrauen), von für diese Frage als gleichartig erachteten Personen.Zwecks richtiger Fassung der Additionsregel muß manhinzufügen, daß nur einander ausschließende Wahrscheinlichkeiteninnerhalb des gleichen Kollektivs addiert werdendürfen I). In unserem Gegenbeispiel handelte es sich um zweiverschiedene Kollektivs. Das eine hat zu Elementen die (imPrinzip unbegrenzt fortsetzbaren) Einzelspiele des A mit B,das andere die Einzelspiele des A mit C. Auf diese verschie -denen Kollektivs darf die Additionsregel nicht angewendetwerden. - In dem Laplaceschen Beispiel ist natürlich allesin Ordnung. Der Einzelversuch - das Element des Kollektivs-besteht aus dem zweimaligen Werfen mit einer Münze.Das Ergebnis, das Merkmal, besteht aus der Feststellung ,,Kopf,Kopf" oder ,,Kopf, Wappen" usw. Innerhalb dieses Kollektivsgibt es für jedes dieser vier Ergebnisse eine Wahrscheinlichkeit,z. B. jeweils die Wahrscheinlichkeit 4. Aus diesemersten Kollektiv bildet man ein neues durch Addition oder,,Mischung", welches die gleichen Elemente enthält (zweimaligerWurf mit einer Münze); aber das Merkmal, auf dasjetzt das Augenmerk gelenkt ist, heißt ,,mindestens einmalKopf in zwei Würfen". Es werden also jetzt drei der früherenMerkmale zu einem neuen zusammengefaßt, nämlich ,,Kopf-Kopf", ,,Kopf-Wappen", ,,Wappen-Kopf", Nach der Addi-I) Eine ähnliche Rolle wie das Kollektiv spielt der vo
182 Anmerkungen.tionsregel ist dp + 4 + + = 9 die dem neuen Merkmal zukommendeWahrscheinlichkeit innerhalb des neuen Kollektivs.Zu S. 8. Die im dritten Prinzip ausgesprochene Regelüber ,,zusammengesetzte Wahrscheinlichkeiten", das Multiplikationsgesetz,der Satz von der Wahrscheinlichkeit des,,sowohl als auch" erfordern, ebenso wie das Additionsgesetzeine genauere Fassung. Im Gegensatz zu diesem hat man eshier von Anfang an mit zwei voneinander verschiedenenKollektivs zu tun, die miteinander verbunden werden sollen.Das neue Kollektiv entsteht aus dem alten, indem mansowohl die Elemente der beiden erstgegebenen zu einemneuen Element zusammenfaßt, wie auch die Merkmale zueinem neuen Merkmal. Dann ergibt sich die Wahrscheinlich-keit innerhalb des neuen Kollektivs als Produkt der Wahrscheinlichkeitender Ausgangskollektivs. Die Schwierigkeitliegt darin, festzustellen, welche Kollektivs in dieser Art miteinanderverbunden werden dürfen. Dies führte zunächst aufdie Bedingung der Unabhängigkeit. Es gibt aber auch voneinander,,unabhängige" Kollektivs, die trotzdem nicht „verbindbar"sind, und abhängige, welche die Verbindung zulassen(vgl. auch die folgende Anmerkung). Auf diese nicht mehrganz einfachen Unterscheidungen kann hier nicht eingegangenwerden (vgl. das 1. C. b) zitierte Buch von R. V. Mises S.55ff.).Zu S. 9. Im vierten Prinzip wird die Verbindung zweierin gewisser Weise abhängiger Kollektivs erklärt. Ein einfachesBeispiel dafür besteht in dem wiederholten Ziehenaus einer Urne mit schwarzen und weißen Kugeln, ohnedaß jeweils die gezogene Kugel zurückgelegt wird. Warenetwa ursprünglich in der Urne n, weiße, n-lt, schwarzeKugeln, so ist n,/v die Wahrscheinlichkeit eines ,,Weiß-Zuges".Hat man sodann z. B. eine weiße Kugel ergriffen und legtsie nicht zurück, so ist jetzt die Wahrscheinlichkeit eines12,-1Weiß-Zuges ---. Die Wahrscheinlichkeit für das „zun-1sammengesetzte" Ereignis, nacheinander zwei weiße Kugelnn n,-1zu ziehen, ist somit 11.--- = P.12 12-1Zu S. 10. Das fünfte Prinzip erscheint als ein Korollar zumdritten und vierten. Die in diesem gegebene Divisionsregelfolgt aus der eben erklärten Multiplikationsregel. Etwa bei
Anmerkungen. 183obigem Beispiel ist das ,,eingetretene Ereignis", dessen Wahrscheinlichkeitman ,,a priori" in Rechnung stellt, das Zieheneiner weißen Kugel beim ersten Zug; dafür besteht die Wahrnscheinlichkeit 2.Die ,,Wahrscheinlichkeit, die zusammenngesetzt ist aus diesem und aus einem anderen, noch ernlnl-1warteten Ereignis", ist P. Da p = --, so ist dern 92-1n1 nl-1Quotient p :-=-, die „Wahrscheinlichkeit des ernn-1warteten Ereignisses, wie sie sich aus der Beobachtung deseingetretenen Ereignisses ergibt". Es liegt also die Vorstellungzugrunde, man kenne einerseits ,,a priori" die Wahrscheinlichkeit,bei einmaligem Zug Weiß zu ziehen, anderer:seits auch die Wahrscheinlichkeit, die dafür besteht, beizweimaligem Ziehen ohne Zurücklegen zwei weiße Kugelnzu erhalten.Dann kann man die Wahrscheinlichkeit berechnen,die für das Ziehen einer zweiten weißen Kugelbesteht, wenn man schon weiß, daß die erste gezogene weißwar. - Zu den nun folgenden Andeutungen über den ,,Einflußder Vergangenheit auf die Zukunft" vgl. auch die Anm.zu S. 13, letzter Abschn.Zu S. 11. Das sechste Prinzip bringt in eigenartigklingender Form eine bestimmte Regel, die man DivisionsoderTeilungsregel nennen kann. Hierzu zunächst ein -gegenüber dem Text - einfacheres Beispiel. Eine Urne enthältdie Nummern 1 bis 10 in irgendwelchen Mischungsverhältnissen,die durch echte Brüche, 7c„ n2,. . . 3t10 gegebensind; alle geraden Nummern sind auf weiße, alle ungeradenauf rote Täfelchen geschrieben. Man habe einenZug getan, dabei ein weißes Täfelchen ergriffen und fragt,wenn man die Farbe bereits erkannt, die Nummer abernoch nicht gelesen hat, nach der Wahrscheinlichkeit dafür,daß die gezogene Nummer gerade eine ,,Zweiu sei. Esist hier offenbar die Aufgabe gestellt, aus dem gegebenenKollektiv ein neues abzuleiten, dessen Elemente nicht mehralle Züge aus der Urne sind, sondern nur die, welche weißeTäfelchen ergeben, also nur mehr ein Teil der ursprünglich be-trachteten Elemente. Das Merkmal ist nach wie vor die Losnummer.Für die gesuchte Wahrscheinlichkeit q innerhalb
184 Anmerkungen.des neuen Kollektivs erhält man q = n, + n4 + . . . + 750'denn wenn man links und rechts mit n, + n, + .. . + nlomultipliziert, erhält man die richtige Gleichung np = q .(n,+ n, + . . . + q,),d. h. die Wahrscheinlichkeit n„ eineZwei zu ziehen, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, eine geradeZahl eu ziehen, (n2+ n, + . . . + nlO), mal der Wahrscheinlichkeitq, die dafür besteht, daß eine gezogene gerade Zahleine Zwei ist. - Wie man sieht, hat man hier zwischen zweiverschiedenen Wahrscheinlichkeiten für die ,,Zwei1' zu unterscheiden,nämlich der Wahrscheinlichkeit n„ eine Zwei zuziehen innerhalb des ursprünglichen Kollektivs, und derWahrscheinlichkeit q der Zwei innerhalb des neuen Kollektivs,die dafür besteht, eine Zwei zu ziehen, wenn man schonweiß, daß die gezogene Zahl eine gerade ist.Im Vergleich mit diesem einfachen Fall der ,,TeilungMgeht Laplace einerseits von einer heute noch vielfach üblichen,aber im Grunde fremdartigen Vorstellung oder vielleichtauch nur Terminologie aus; andererseits betrachtet er gleicheine etwas kompliziertere Aufgabe, indem er die Teilung aneinem Kollektiv erklärt, das durch Verbindung aus zweiKollektivs entstanden ist. Zunächst die Terminologie: Das,,beobachtete Ereignis", das hier in dem Ergreifen einesweißen Täfelchens - einer geraden Zahl - besteht, wirdangesehen als Folge einer von fünf verschiedenen ,,Ursachen"C„ C„ . . . C„, nämlich als Folge davon, daß dieergriffene Zahl eine ,,2", eine ,,U, . . . eine „10" war; qist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, daß es gerade dieUrsache C, war, deren Wirksamkeit man das Ereignis ,,geradeZahl" verdankt. Es wird damit eine ,,Wahrscheinlichkeitvon Ursachen" der sonst üblichen ,,Wahrscheinlichkeitder Ereignisse" gegenübergestellt.Außerdem wird von Laplace die Aufgabe gleich erweitert,indem noch weitere Wahrscheinlichkeiten fil, $„ . . . eingeführtwerden, wobei fii die Wahrscheinlichkeit dafür ist, daßsich aus der Ursache Ci auch wirklich das beobachtete Ereignisergibt. In obigem Beispiel ist $, = fi, = . . . - fi10 = 1,denn aus der Ursache ,,ZweiM folgt mit Sicherheit das Ereignis,,gerade Zahl". Im allgemeinen aber ist ni fii die Wahrscheinlichkeitdafür, daß die Ursache Ci wirksam ist und daßaus ihr das Ereignis folgt. Nimmt man an diesem durch Ver-
Anmerkungen. 185bindung entstandenen Kollektiv die eben erklärte „Teilung1'vor. so istdie Wahrscheinlichkeit dafür, daß zufolge der Wirksamkeit derUrsache Ci (i= 1,. . . n)ein bestimmtes Ereignis eintrat. Sindalle ni einander gleich, so kommt qi =I'{Pi+Pz+..-+$n(erster Teil des sechsten Prinzips). Sind die Pi alle einandergleich, so ist qi =XiXI+...+- wie in dem Urnenbeispiel,nnmit Hilfe dessen wir eben die ,,Teilungu für den einfachstennFall erltiutert haben.Man beachte, daß 2 ni = 1, wasi=1aber für die Pi im allgemeinen keineswegs gilt.Ein Beispiel zum sechsten Prinzip wird von Laplaceerst im nächsten Abschnitt gegeben: Eine Urne enthältschwarze und weiße Kugeln in unbekanntem Mischungsverhältnis.Zur Vereinfachung wird angenommen, daß nur1die drei Zahlen 0, -, 1als mögliche Mischungsverhältnisse in2Frage kommen. Es werden (unter Zurücklegung der jeweils gezogenenKugel) zwei Züge gemacht. Das Ergebnis sei „weißweiß"gewesen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit q, dafür,1daß in der Urne z. B. gerade das Mischungsverhältnis -be-2steht 7 Von dem Ergebnis des Versuchs soll bei der Bestimmungdieser Wahrscheinlichkeit Gebrauch gemacht werden.Das beobachtete Ereignis ist ,,weiß-weiß" bei zwei Zügen.1Die drei möglichen Mischungsverhältnisse 0, L,1 werden2als die drei ,,Ursachen" C„ C„ C, für das Eintreten desEreignisses betrachtet. Gefragt ist nach der Wahrscheinlichkeitdafür, daß gerade die Ursache C, (1 = 2) vorliegt. Diea priori-Wahrscheinlichkeiten n„n„ n, sind die Wahrscheinlichkeiten,die von Anfang an für das eine oder andere Mischungsverhältnisbestehen. Wir können sie z. B. als einandergleich ansehen, also nl=n, =n3- Sie könnten aber auch--3-'
186 Anmerkungen.andere Werte haben (man denke sich z. B. auf dem Tischestehend statt einer einzigen sehr viele Urnen, von denen,sagen wir, 60% das Mischungsverhältnis 1 aufweisen, 25%1das Mischungsverhältnis -, 15% das Mischungsverhältnis 0 ;2die Ziehung erfolgt aus einer der Urnen, die unter allenblindlings herausgegriffen wird; dann würde man etwa nl =0,603 1 3= -, n2 = 0,25 =-, n, = 0,15 =- annehmen).5 4 20Aus dieser Urne macht man jetzt die zwei Züge. Nun dieWahrscheinlichkeiten fl, P2, P,; diese sind hier auch keineswegseinander gleich. $, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daßbei Annahme des Misclhungsverhältnisses 0 das Ereignis,,weiß-weiß" erscheint. ist somit gleich Null, denn diesesEreignis kann nicht eintreten, wenn in der Urne gar keine1 1 1weißen Kugeln liegen; ebenso ist f2 = - - = - denn2 2 4'dies ist die Wahrscheinlichkeit für ,,weiß-weiß" bei dem1Mischungsverhältnis -, und schließlich 9, = 1. Daher ist2bei der ersten Annahme mit gleichen ni =1 1%P2 = 3 n, P, =+-1 ; das sind die Wahrscheinlichkeitendafür, daß der Zug aus der l., 2., 3. Urne erfolgt ist und dasEreignis „weiß-weiß" zur Folge gehabt hat. Daraus folgt fürdie gesuchte Wahrscheinlichkeit q, =nz P2=1+%P21-4 41- , 8-1 55+%P3- , ähnlich erhllt man p - 0 q - -. Für n - -,-3l- 5_.U1 11 34 4n2 = -, n, = 20 folgt q, = --64 1 13 17, qi=o.-._ +I*-20129, = -. In der Laplaceschen Terminologie ist q2 die Wahr-
Anmerkungen. 187scheinlichkeit der Ursache C„ erschlossen aus dem beobachtetenEreignis : ,,weiß-weiß".Jedenfalls erkennt man, da% es sich um eine Aufgabehandelt, die sich dem Wesen nach nicht von anderen Aufgabender Wahrscheinlichkeitsrechnung unterscheidet. Wenn Laplacean dieser Stelle von dem „wichtigen Teil der Wahrscheinlichkeitsrechnung"spricht, ,,der darin besteht, von den Ereignissenauf ihre Ursachen zu schließen", so ist dies vielleichtnur eine Redeweise; diese Terminologie hat aber manche Verwirrunggestiftet. Jedenfalls besteht heute kaum mehr einGrund, zwischen Aufgaben, die auf der Operation ,,TeilungMberuhen, und anderen einen Gegensatz zu konstruieren, bzw.eine ,,Wahrscheinlichkeit der Ursachen" neben der iiblichen,,Wahrscheinlichkeit der Ereignisse" zu studieren. - Auf einewichtige Erweiterung der hier besprochenen Urnen-Aufgabe,die zum sogenannten Bayesschen Prinzip führt, wird spätereingegangen.Zu S. 12. Als siebentes Prinzip wird eine noch weiterezusammengesetzte Aufgabe behandelt. Der eben betrachteteQuotient qi =ni fiistellt ja die Wahrscheinlich-n1el+ .. . +nn&keit dafür dar, daß für ein beobachtetes Ereignis die UrsacheCi maßgebend war; nun sei Pi die ~ahrsoheinlichkeitdafür, daß bei Vorhandensein der Ursache Ci ein bestimmtesweiteres ,,zukünftiges" Ereignis eintritt; dann ist qi Pr dieWahrscheinlichkeit dafür, daß die Ursache Ci maßgebendwar und ihr zufolge das zukünftige Ereignis eintritt. UndP =q, P, + q, P, + .. . + qnP,, ist die Wahrscheinlichkeitdafür, daß irgendeine der a Ursachen maßgebend ist und ihrzufolge das zukünftige Ereignis eintritt, also kurz gesagt dieWahrscheinlichkeit des zukünftigen Ereignisses. Es ist daher.--Selbstverständlich lassen sich auch derartige ~ uf~aben ohneVorstellung von ,,Ursachen1' als Ableitung eines neuen Kollektivsaus gegebenen Ausgangskollektivs formulieren. (Diegemäß der früheren Aufgabe gerechneten q, werden erst,,verbunden", dann ,,gemischt".) In dem von Laplace ge-1gebenen Beispiel ist wie früher berechnet 9, = 0, q, - -5'
188 Anmerkungen.4q, =-. P, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, auch beim dritten5Zug eine weiße Kugel zu erhalten unter der Voraussetzungdes Mischungsverh<nisses 0, also P, = 0, und ebenso-.-1 1 41 5 2 + r 1P, =- P, = 1. Es ist somit P = - -- 92 ' 1 , 4 10'5-t5wenn wir die a priori-Wahrscheinlichkeiten als einandergleich ansehen. (Die Pi sind Wahrscheinlichkeiten innerhalbverschiedener Kollektivs, ihre Summe daher nicht notwendigEins.)Zu S. 13, letzter Abschn. Die hier formulierte Aufgabeerscheint als eine Anwendung der Teilungsregel dessechsten Prinzips. Wir kommen damit in den Gedankenkreisdes sogenannten Ba ye s schen Problems, dessen wesentlichsteFörderung man Laplace verdankt. Denken wir andas folgende Urnenbeispiel: Der Versuchsvorgang bestehewieder aus dem blindlings Ergreifen einer Urne, in der dasunbekannte Mischungsverhältnis x herrscht; x ist aber jetztinicht auf die Werte 0, L,1 beschränkt, sondern soll als2stetige Veränderliche angesehen werden, die alle Werte von0 bis 1 durchlaufen darf. Aus dieser Urne werden n Zügegemacht (nicht nur zwei). Diese mögen n, weiße, n -n,schwarze Kugeln ergeben haben (früher war n = 2, n, = 2),nalso ein Verhältnis 2= a der weißen gezogenen Kugelnrtzur Gesamtzahl der gezogenen Kugeln. Gefragt ist zunächstnach der Wahrscheinlichkeit q, dafür, daß in der blindlingsherausgegriffenen Urne gerade das Mischungsverhältnisx herrsche. Die a priori-Wahrscheinlichkeit n„ die fürdas Ergreifen einer Urne mit dem Mischungsverhältnis xbesteht, muß gegeben sein. Wir brauchen außerdem dieWahrscheinlichkeit P, dafür, bei n-maligem Ziehen aus einerUrne mit dem Mischungsverhaltnis x gerade N, weiße Kugelnzu ziehen. Nach dem Newtonschen Binomialsatz (vgl. Anm.zu 5. 20) ist P, = ( X" 1 - In dem Ztihler
Anmerkungen. 189des Bruches, der die Wahrscheinlichkeit q, gibt, steht dannfix n„ im Nenner 2 fix n„ wobei über alle in Betrachtkommenden x-Werte zu summieren ist, also qz =2 fix ~ T C Zfix nx'EBezeichnet P, die Wahrscheinlichkeit eines weiteren, ,,zukunftigen"Ereignisses, so ist q, P, die Wahrscheinlichkeitdafür, daß das Mischungsverhältnis x zutrifft und das Ereigniseintritt. Die Summe aller dieser Au~drücke für siimtlichex gibt die gesuchte Wahrscheinlichkeit P dafür, da%auf das beobachtete Ziehung~ergebnis das Ereignis wirklichfolgt.Ist insbesondere n, = n, so kommt für P, der einfacheAusdruck xnl = f ix.Weiter ist die Wahrscheinlichkeit P, des,,zukünftigen" Ereignisses, aus der Urne mit dem Mischungßverhaltnisx eine weitere weiße Kugel zu ziehen: P, = x,also fix . P, = xnl+l; setzt man die a priori-<strong>wahrscheinlichkeit</strong>enn, alle einander gleich, so daß sie aus dem Bruch, der Pgibt, herausfallen und betrachtet xals kontinuierliche Variable,so entspricht dem Zähler fi, P, + ... + fi, P, das Integral1x xnl dx und dem Nenner fi, + . . . + fi, das Integral011 /" X"'L~ dxJ0xnl dx, also ist P =0 1 xnl dx=- H'+ ' Dies ist der%+2'0im Text (S. 14) angegebene Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit,noch eine weitere (n, + 1)-te weiße Kugel zu ziehen,wenn alle vorher gezogenen n, Kugeln weiße waren. -Allerdings hat es offenbar wenig Sinn, dieses richtige undintere~sante Resultat darauf anzuwenden, mit welcher Wahrscheinlichkeites zu erwarten sei, daß die Sonne, wenn sien,-mal aufgegangen ist, auch das (n, + 1)-te Mal aufgehenwerde. Denn einer solchen Anwendung liegt die Auffassungzugrunde, das Aufgehen oder Nichtaufgehen der Sonne alsMerkmal eines Kollektivs zu betrachten, was unseren wissenschaftlichenVorstellungen nicht entspricht.
190 Anmerkungen.Zu S. 15. Bezeichnet x ein Ereignis, U ( X), bzw. V (X) dxdie Wahrscheinlichkeit seines Eintretens, je nachdem manx als unstetige oder stetige Variable auffaßt, so ist2 a (X) . X, bzw.ZSumme oder Integral erstreckt über den in Frage kommendenBereich von X, die ,,mathematische Hoffnung" oder der Er-wartungswert von x (innerhalb des betrachteten Kollektivs).Zu S. 16. Das sogenannte ,,Petersburger Problem". Dievon Laplace bemerkte Schwierigkeit scheint gelöst, wenn manüberlegt, welches das maßgebende Kollektiv ist. Eine einzelnePartie, die einen wiederholbaren Vorgang darstellt, bestehteben nicht aus unendlich vielen Würfen, sondern aus einerfestgesetzten Anzahl solcher, sagen wir 20.Der Einsatz für1 1 1eine solche Partie muß dann -. 2 + -- 4 + . . . - . 220 = 202 4 220betragen, was nicht unbillig erscheint. Die an dieses Scheinproblemanknüpfende, von Bernoulli ad hoc konstruierteTheorie der ,,moralischen Hoffnung", der Laplace sein „zehntesPrinzip" widmet, bietet heute nur mehr geringes Interesse.(Zur Darstellung dieser Theorie vgl. z. B. A. Meyer, Wahrscheinlichkeitsrechnung.Deutsch von E. Czuber. Leip-zig 1879. S. 150-165.)Zu S. 19 unten. (Ein Fehler der französischen Vorlege:Die Umrechnung ist:Dort steht n - s an Stelle von r - s).-- -(n-S) (n-s- 1) . . . ( n-r + 1)-(7t-S) ...(1.2 (Y - s)n-(n - 1) . . . (n - V + 1)1.2 . . . - rn-r+l)s...( V-s+1)-1. ... (V-s) (r-s+l) ... s-, , , ,N (n-1) . . . (n-s + 1) (n-s). ..(n- Y+ 1)1.2 . . . ' S (s+1) ... ' rr (r- 1) . . . (V-s + 1)1.2 ... ' S2 --W~(n-1). . . (7t-s+l)1.2 ... ' S
Zu S. 20. Hier wird als Beispiel der Behandlung einerWahrscheinlichkeitsaufgabe nach den Methoden der Kombinatorikdie Lösung des sogenannten B er n oullischen Problemsdargestellt. Gefragt ist nach der Wahrscheinlichkeitdafür -nennen wir sie jetzt W, (m) -, aus einerUrne, die a weiße, b schwarze Kugeln enthält, in n Zügengerade m weiße zu ziehen. Die Lösung, die formal schonNewton bekannt war (und die wir 5. 188 bereits in anaderem Zusammenhang benutzt hatten), ist mit -= P,a+bwn &) = (I)pmqn-rnaMultipliziert man W,, (m) mit (U + b)n so erh< man (i) ambn-"\ Ials Anzahl der Fälle, die zum Resultat: ,,m weiße, n schwarzeKugeln" führen.Die für die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnungfolgenreiche Leistung von Laplace bestand darin, daß er indem Ausdruck für W, (W),. der für große n praktisch schwierign!auszuwerten ist, weil indie Fakultätengroßer Zahlen auftreten, ' ehen ~rebzüber@;an~ zu U n en d-lichem n ausgeführt hat. Dieser führt auf das für dieWahrscheinlichheitsrechnung fundamentale e-z'-Gesetz.Zu S. 22. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die Partiegenau beim n-ten Spiel zu gewinnen, ist eine Funktion1von ~t;nennt man sie g, (n), so ist g, (rt) = -pl (n-1). Eine2solche spezielle Funktionalgleichung heißt Differenzen -gleichung, und zwar eine gewöhnliche Differenzen-1gleichung erster Ordnung. Die Gleichungv(2) =-gibt2die eine für diese Aufgabe notwendige Anfangsbedingung.Aus Differenzengleichung plus Anfangsbedingung folgt nun q~für weitere ganzzahlige Argumente:
192 Anmerkungen.Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Partie spiitestens bein Spielen beendet sein wird, istZu 5. 22 unten ff. Es mögen bei Abbruch des Spielesdem A genau m Punkte fehlen, dem B n Punkte. Wir nennenf (W, n) die Gewinn<strong>wahrscheinlichkeit</strong> des A zu diesem Zeitpunkt.Es ist (wie im Text genau erklärt wird)1f (W, fi) =- V (W- 1, fi) + f (W, fi-2I)].Das ist eine p ar t ie1 1e Differenzengleichung erster Ordnung.Die Anfangsbedingungen lauten (vgl. den Text]) f (0, n) = 1,f (m,0) = 0.Aus Differenzengleichung plus Anfangsbedin-gungen lassen sich die Werte von f (m, n) sukzessive angeben.Es ist:1 1 1f (1, 1) =2 V (0,l) + f (1,O)I =2' 1= -3-1..........I .. . . . . . . . . .Im übrigen läßt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeitdirekt formelmäßig angeben. Nimmt man - etwas allgemeiner- an, daß die Chancen der beiden Spieler von An-1fang an nicht - und -, 1 sondern + und q sind, so kann2 2
Anmerkungen. 193man so überlegen: Der Spieler A, dem m Punkte fehlen,kann auf die folgenden einander ausschlieI3enden Arten gewinnen:1. Er kann die nächsten m Spiele gewinnen. Die Wahrscheinlichkeitdafür ist firn.2. Er kann von den nächsten m + 1 Spielen das letztegewinnen und außerdem irgendwelche m - 1 der übrigen.Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 6)pmq.3. Er kann von den nächsten m + 2 Spielen das letztegewinnen und außerdem irgendwelche m- 1 der übrigen.Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ( m+1 ) firn ~ 2 .. . . . . . . . . . . , , , . . . . . . . .Schließlich: Er kann von den nächsten m + (n- 1) Spielendas letzte gewinnen und außerdem irgendwelche m -lder hbrigen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist2)-pmqn-l,Weiter geht es nicht, denn sonst hätte B schon dieihm fehlenden n Partien erreicht. Die Gewinn<strong>wahrscheinlichkeit</strong>des A, die wir wieder f (m, n) nennen, ist somit:+ m(m+l)...(m+n-2) -p-'1.(fi -1)I1= q E- und rechnet etwa f (2, 3), soSetzt man hier2folgt das oben anders abgeleitete Ergebnis:Zn 8. 24. Das Wort ,,Gradu (degr6) ist hier in einemheute nicht gebräuchlichen Sinne gebraucht, um das zu bezeichnen,was man bei uns jetzt fitets ,,Ordnung1' nennt.Zu S. 25, 3. Abschn. Gemeint ist ein System von n partiellenDifferenzengleichungen mit n abhlingigen und einerbeliebigen Zahl vm unabhängigen Variablen (Indice~).
194 Anmerkungen.Zu S. 26ff. Das Problem der Aufstellung und Lasungvon Differenzengleichungen wird hier erklärt und geschichtlicherläutert (Taylor, Moivre, Laplace).Zu S. 26, 3. Abschn. Die folgende, von Moivre stammende,von Laplace als genial bezeichnete Behandlung derlinearen Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizientenwird von Laplace mitgeteilt (ohne irgendwelche Formel), „daes stets interessant ist, den Gedankengang der Entdecker nachzugehen".Sei etwa eine lineare Differenzengleichung zweiterOrdnung mit konstanten Koeffizienten A und B vorgelegt:rn+l - A 7, + Brn-,.= 0.(Die Verallgemeinerungsfähigkeit des Verfahrens auf Gleichungenhöherer Ordnung wird sich leicht ergeben.) Die Anfangsbedingungenseien z. B. r0 = 0, Y, = 1. Man macht denAnsatz (a) r, = an+ b, und zeigt, daß man an und bn alsGlieder je einer gewöhnlichen geometrischen Reihe auffassenkann, deren Quotienten q, bzw. s wir als Funktionen vonA und B angeben werden. Setzt man: an+, = q an unda,=qan-„ so ist sa,=sqa,-, und(1) an+,-% (q + s ) f qsan-I =Ound ganz analog gilt für die b,,, für die bn+, = s bi(2) bn+l-b,(s+q)+q~bn--l=Ound durch Addition von (1) und (2) vermöge (a)(3) ~n+l-rn(s+q)+qs~n-,=O.Aus (4) s+q=A,sq=Bfolgt, daß s und q die Wurzeln der quadratischen Gleichungx2 -A x + B = 0 sind, also aus A und--B gefunden werden:r=-+py-~,AA2 B. Die Anfangs-2 q=--p!!-bedingungen geben schließlich a, und bo, da q und s bekanntsind :(5) ro= 0 = a, + bo, Y, = 1= a, q f b, sund somit ist r, = a, qn + b, sn als Lösung der vorgegebenenDifferenzengleichung gefunden.Zu 5. 27ff. Hier und im folgenden wird von Laplaceversucht, die Grundidee seiner Theorie der erzeugenden
Anmerkungen. 195Funktionen ohne Benutzung der Analysis verständlich zumachen. Diese Darstellung zu verstehen, wird wohl nur einemLeser gelingen, der das Problem im üblichen mathematischenGewand auch - und zwar leichter -verstanden hätte.Eine Obersetzung in die gewohnte Formelsprache findet sichzum großen Teil auch als Anm. (S.194ff.) der deutschen Obersetzungvon Schwaiger. Es soll an dieser Stelle natürlichnur das im Text Stehende erläutert, nicht aber eine darüberhinausgehende Einführung in die Theorie der ,,fonctions g6n6-ratricesu geboten werden.COEs sei V (t) = 2 U, tx die Entwicklung einer Funk-%=-Wtion V (t) nach Potenzen von t. Jeder Koeffizient a, kannals Funktion seines Index x aufgefaßt werden a, = p, (X).Laplace bezeichnet die Funktion V (t) als die erzeugendeFunktion von p, (X). [Setzt man, um dies gleich an einemBeispiel zu erläutern, etwa V (t) = (q + + t)n, wo + und qirgendwelche positive Zahlen von der Summe 1 sein mögen,so ist offenbar:Dabei hat p, (X)= W, (X) = (:)pn-x dieselbe Bedeutungwie in der Anm. zu 5. 13. Hier ist also V (t) = (q + fi t)"die erzeugende Funktion zu p, (X)= W, (X).] Nun multipliziereman V (t) mit einer anderen Funktion von t, z. B. mitT (t) = 2 t + 1, so erhält manwobei ail)= U, + 2 U,-, =p,(l) (X). Die Funktion a, (X) wirdals ,,p.rimitiveU Funktion zur ,,AbleitungM@)(X) bezeichnet.Oder in Zeichen: 6 p, (X)=$1) (X). Analog stellt 6 .6 a, (X)=89,(X)=p,(2)(X) den Koeffizienten von $ im Produkt V . T"dar und ebenso bezeichnet Bnp,(X)=p,Cn) (X) den Koeffizientenvon C" in V.P.
196 Anmerkungen.1Sei jetzt weiter T = -, also V (t) T (t) =2 U,+, Ftund V (t) T" = 2 a,+, ,P, d. h. wenn wieder d die Ableitunghinsichtlich des Multiplikators T bezeichnet: 6"q ( X) =e, ( X + 4.Sei sodann Z (t) eine neue Funktion von T und fürV (t).Z (t) = 2 b, P' werde die Differentiation mit A bezeichnet: A a, = b„ und analog für V(1) 2 (L)~. Setzt man z. B.Z = L - 1, so ist V (t) Z (t) =2 b, tZ = 2 (U,,., - U,) F,talso A a, = a, + - a„ was also fiir diese Wahl von 2 (t)die übliche Bezeichnung der Differenzenrechnung ergibt.Ebenso gibt der Koeffizient von tx in V . Zn = 2 An a, . tZ dien-te Differenz An a, im Sinne der Differenzenrechnung. Ist1 1T=-undZ=--1, so ist T=Z+ 1, also V-P=tt(71V-(Z+1)"=V(Zn+ Zn-'+...+I). Hier stellen. . . lauter erzeugendedie einzelnen Glieder V . Zn, rt V Zn --'Funktionen dar, und zwar ist nach dem oben UberlegtenV .Zr die erzeugende Funktion von Ara,; dabei ist fürr = 0, AO a, F a, zu ~etzen. Es war aber andererseits U,+,der Koeffizient von tZ in der Entwicklung von V (2) T".Geht man nun von den erzeugenden Funktionen zu denKoeffizienten über, so muß der Koeffizient von tz auf beidenSeiten derselbe sein, es ist also:Wir haben somit eine Entwicklung von p, (X + n) nach sukzessivenDiffeienzen von g, (X). Man kann das symbolischdahin au~drücken, daß p, (X + lz) oder dng, (X) gleich istder Entwicklung von (Z + l)n, wenn man übereinkommt,an Stelle von Zr die r-te Differenz Ar p, (X) der primitivenFunktion zu ~etzen, wobei AO p, (X) = p, (X) ist.Andererseits ist bei Annahme der obigen Werte f.ürZ und T auchZ= T-1, also
Anmerkungen. 197und daher nach der analogen Oberlegung~,* * . &V (4.Dies ist eine Entwicklung von An? (X) nach den g, (X),g, (X + I), . . . g, (X + n). Man kann wieder sagen, daß Ang, (X)gleich ist der Entwicklung von (T - l)n, wenn man übereinkommt,an Stelle von T' die r-te Differenz drg, (X) oderQ (X + r) zu setzen.Diese uberlegungen führen zu folgendem allgemeinenResultat: 8 und A mögen die obige Bedeutung haben, wobei6 die Ableitung bezeichnet, derart, daß 6 Q (X) der Koeffizientvon Ct in der Entwicklung von V. T ist, wenn Q (X)der analoge Koeffizient in der Entwicklung von V ist; undebenso A für V.2; es mögen nun aber T und Z beliebigeFunktionen von t sein. Man darf dann bei der Entwicklungbeliebiger identischer Gleichungen, die zwischen T und Zbestehen (in obigem Beispiel war V Zn = V (T- l)n einesolche Gleichung), die Symbole 6 bzw. A an Stelle von Tbzw. Z setzen, dr bzw. AT an Stelle von T' bzw. Zr, wobeisich die Differentiationen auf die primitive Funktion Q (X)beziehen und SO bzw. AO = 1 ist.1-Nehme man z. B. T = (;)L1 und, wie oben,Z= --I, talso T + 1 = (Z+ l)i oder T = (Z + l)i - 1, dann istBezeichnet man den neuen Koeffizienten a,+, - a, mitdi Q (X), BO hat mandiQ(X) =V(%+ i)-g,(x).Eine identische Beziehung zwischen Z und T lautet:T" = [(Z + l)(- 1In oder V 2" = V [(Z + l)(- 11".
198 Anmerkungen.Geht, man hier von den erzeugenden Funktionen zu denKoeffizienten über, so darf man T durch di und Z durch Aersetzen, wobei sich S, und A auf g, (X) beziehen; das kannman symbolisch andeuten durch8; P (X) = [NA + - iinJ P (X).Dabei bedeutet 62 die %-malige Anwendung der Differenzenbildungdi. Man muß hier natürlich die i-te Potenz wie auchdie n-te Potenz wirklich entwickelt denken, z. B. für i = 2und n. = 2 steht:6; g, (X) = [(A + - 112 P) (X) = [A2 + 2 Al2 P, (X)=A4p)(4 + 4Aay(x) + 4A297(x),und es ist unter 6: die zweimalige Anwendung von 8, zuverstehen, also6; P (4 = 9) (X + 4) - 2 g, (X + 2) + (4(die Richtigkeit der Identität g, (X + 4) -2 g, (X + 2) + g, (X) =A4g, (X) + 4A8g, (X) + 4A2g, (X) läßt sich sofort verifizieren).Man erhält auf diese Art die n-te Differenz der Primitivfunktion,bei der das Argument um je i Einheiten variiert, in eineReihe von Differenzen von g, (X) entwickelt, wobei das Argumentum je eine Einheit variiert.Nimmt man n. negativ an, so stellen analog die n-tenPotenzen von 6 und A Summen bzw. Integrale dar. Denn sei1etwa wieder Z = -- 1 und ist V Zn = W die erzeugendetFunktion zu An p (X) = y (X), so ist V = W und es folgtdaraus bei Obergang zu den Koeffizienten g, (X) = A -" y (X).Es entspricht dabei der Potenz Z-n die Potenz A-", angewendetauf die Primitivfunktion von W, also auf y (X).Eine Funktion g, (X), deren n.-te Differenz gleich einer gegebenenFunktion y ( X) ist, nennt man ein ,,Integralu vony (X). Ahnlich sind die negativen Potenzen von di ,,Integrale",bei denen der Index X um i Einheiten variiert.6etzt man di g, (X) = 0, so entsteht eine Differenz engleichun g i-ter Ordnung und V ist die erzeugende Funktionihres Integrals. Um diese erzeugende Funktion zu bestimmen,beachte man, daß in dem Produkt V T alle Koeffizientenvon F, die von höherer oder gleicher Ordnung wie i sind, verschwindenmüssen, also alle mit Ausnahme derer von tO, t,
Anmerkungen. 199F . ..ti-l. Istsomit V.T=co+c,t+ ...+ci-,ti-I, sofolgtP--'V= Co + Cl t + . .. + . Die unbekannten Koeffi-zienten C„ C„ . . . ci-,bestimmt.Twerden aus den i AnfangsbedingungenDie Bestimmung von T aus der Differenzen-gleichung geschieht nach folgender Vorschrift: Man bringtzuerst alle Glieder der Gleichung auf die linke Seite [also inunserem Beispiel Bi g, (X)= 0 oder g, (X+ i)-9 (X)= 01.Hierauf schreibt man 1für das Glied mit dem größten Index,t für das nächste, . .. ti für das letzte, also 1ftir g, (X+ i),t für p (X+ i -1) ..., sehließlich fi für g, (X). [In unseremBeispiel käme so 1-ti = T.] Hat man so T bestimmt,so rnuß man schließlich den angegebenen Quotienten für Vnach Potenzen von t entwickeln und erhält p (X) als denKoeffizienten von P.Zu S. 32. Es wird hier der Begriff der erzeugendenFunktion und der der Primitivfunktion auf zwei Variableübertragen. Sei V (t, t')=2a , Pt"', ao heißt a ,.I =z, z'p (X,X') Primitivfunktion zur erzeugenden Funktion V (t,t').Man kann analoge Aufgaben untersuchen wie für eineVariable und wird hier als Spezialfall der Theorie auf dieBetrachtung partieller Differenzengleichungen geführt. -AufS. 33 oben der Ubersetzung muß - im Gegensatz zur Vorlage- offenbar VT an Stelle von V stehen. - An dieserStelle muß Laplace endlich selbst bekennen, daß ,,weitereDetails ohne Zuhilfenahme des Kalküls schwer verständlichsein dürften".Zu S. 33. Es wird mit Nachdruck auf die Analogie zwischenDifferenzen- und Differentialoperationen hingewiesen,eine Analogie, die ja auch in der modernen Analysis einegroße Rolle spielt. - Es folgen historische Bemerkungen zurEntwicklung der Infinitesimalrechnung.Zu S. 36. Diese Andeutungen beziehen sich auf dieberühmten Laplaceschen Untersuchungen über ,,Funktionengroßer Zahlen" und die Laplacesche Transformation. - Einewichtige Verallgemeinerung der Sätze über die Produkte sehrvieler Faktoren von gewisser Eigenschaft und über die Integralesolcher Ausdrücke gab V. Mises (Math. Zs., Bd. 4,1919, S. 9).
200 Anmerkungen.Zu S. 42 U. 44ff. Zunächst das Spiel mit nur einer Münze:Die Wahrscheinlichkeit dafiir, daß, zufolge der ,,unbekannten1Ursache", für Kopf die Wahrscheinlichkeit --E besteht und2für Wappen - 1 + E, ist dieselbe2scheinlichkeit dafür, daß die Wahrscheinlichkeit für Kopf1-+ E und die für Wappen - 1 - E ist. Man erhält somit für2 2die gesuchte Wahrscheinlichkeit, zweimal nacheinander Kopfzu werfen:Bei dem kombinierten Spiel mit den zwei Münzen wird diegesuchte Wahrscheinlichkeit, zweimal nacheinander ,,Kopf'< zuwerfen. nach der vorgegebenen Spielregel, derzufolge bei jedemWurf das als „Kopf6' gilt, was die zweite Münze ergeben hat,gefunden als die Wahrscheinlichkeit dafür, daß zweimal nacheinanderdie beiden Münzen jeweils die gleiche Seite ergeben;also entweder die zweite Kopf, und die erste Kopf oder diezweiten Wappen und die ersten Wappen; und dies zweimal1nacheinander. Es ist mit der Wahrscheinlichkeit - anzu-2nehmen, daß die Kopf<strong>wahrscheinlichkeit</strong> der ersten Münze1-- E ~ ,1die Wappen<strong>wahrscheinlichkeit</strong> -+ E„2 2und ebenso1mit der Wahrscheinlichkeit -, daß die Kopfwahrscheinlich-21keit dieser Münze -+ E ~ ,ihre Wappen<strong>wahrscheinlichkeit</strong>21-- ist; genau so (mit E,) für die zweite Münzel Die ge-2suchte Wahrscheinlichkeit ist demnach gleich:
Anmerkungen. 201Zu S. 43.In diesem Satz ist das ,,Theorem von Ber-noulli" ausgesprochen, das einen besonders wichtigen Spezialfalleines sehr allgemeinen Satzes bildet, den man heute alserstes Gesetz der großen Zahlen zu bezeichnen pflegt.In einer etwas mehr mathematischen Form besagt das berühmteTheorem, das wohl den wichtigsten Inhalt von JakobBernoullis ,,ars conjectandi" bildet1): Ist lz die Anzahl einerReihe gleicher Alternativversuche, so geht mit wachsendem lzim Limes die Wahrscheinlichkeit gegen Eins, die dafür besteht,daß der einfache Alternativversuch, für dessen positivenAusfall die Wahrscheinlichkeit + besteht, auch wirklichmit der relativen Häufigkeit + If- E eintritt, wobei e einebeliebig klein vorgegebene Zahl bezeichnet2).Von Laplace stammt aber darüber hinausgehend einResultat, von dem aus das Bernoullische Theorem sich unmittelbarals eine spezielle Folgerung ergibt. Er hat nämlichfür den vorliegenden Fall einer sehr großen Anzahl voneinander gleichen Alternativen die resultierende Verteilungselbst angegeben. Oder anders ausgedrückt: er hat an(n)der S. 191 angegebenen Funktion W, (X) = +xf-xeinenGrenzübergang zu unendlichem n ausgeführt und die Grenzverteilunggefunden, welche die Gestalt der ,,Glockenkurve"der e-x'-Kurve, besitzt. Das Bernoullische Theorem beschreibtdann nur eine besondere, allerdings sehr wichtigeEigenschaft dieser Grenzkurve, nämlich deren Eigenschaftder sogenannten ,,Verdichtungu mit wachsendem n in derUmgebung des Mittelpunkts.l) Vgl. Ostwnld~Klnssiker Rd. 107.2, Eine Kritik der Stellung dieses Theorems im Rahmen derauf der Lriplaoeschen Wahriicheinlichkeitsdefinition beruhendenTheorie gibt R. V. Mise8 1. C. b) S. 78ff.
202 Anmerkungen.Zu S. 46, 2. Abschn. Hier werden die merkwürdigenWorte der Einleitung wiederholt, die wohl eine für unsereBegriffe sehr rationalistische Auffassung zeigen, wie es demGeiste des 18. Jahrhunderts entspricht. So wie beim HazardspielGewinn und Verlust sich bei fortgesetztem Spiel schließlichim Sinne der vorhandenen Chancen verteilen, so ist esauch im menschlichen Leben. Auf die Dauer werden uns diegünstigen Chancen nur durch Beobachtung der ewigen Prinzipiender Gerechtigkeit und Humanität geboten. -WenigeZeilen später finden sich politische Anspielungen, offenbarauf Napoleon I. zu beziehen (Enteinungsjahr 1814!).Zu S. 48. In diesen Worten liegt ein xichtiger Spezialfalldes zweiten Gesetzes der großen Zahlen, der auchals ,,Bayessches Theorem" bezeichnet wird, obgleich der Satzvon Laplace stammt. Wie in der Anm. zu S. 13 werde eineReihe von Urnen betrachtet, die schwarze und weiße Kugelnin verschiedenen Mischungsverhältnissen enthalten. Man ergreiftblindlings eine der Urnen, macht aus ihr n Züge mitdem Ergebnis ,,n, weiße, n-n,schwarze Kugeln", oderauch man erhält weiße und schwarze Kugeln im Verhältnnis 2=a zu 1-a. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeitndafür, daß in der Urne, aus der man gezogen hat, geradedas Mischungsverhältnis x herrscht. Die Beantwortung dieserFrage für endliches n (vgl. Anm. zu S. 13) stammt vonTh. Bayes (1763) I).Dieses Bayessche Problem ist sichtlich eine Umkehrungdes Bernoullischen. Dort kennt man das MischungsverhältnisP, q in der Crne, aus der man zieht, und fragt nach derWahrscheinlichkeit dafür, in n Zügen gerade x weiße Kugelnzu erhalten. Hier weiß man, daß n Züge einen bestimmtenProzentsatz weißer Kugeln ergeben haben, und fragt nachdem Mischungsverhältnis x dir Urne, aus der gezogen wurde.Analog verhält sich das Bayessche Theorem zum Bernoullischen(vgl. auch Anm. zu S. 45). Jenes besagt, daß man -bei großem n -mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vermutenkann, daß das Mischungsverhältnis x in der Urne, die dasnResultat 2 =a geliefert hat, sehr nahe bei a liegt.12l) Ostwalds Klassiker Bd. 169, Leipzig 1008.Dabei
Anmerkungen. 203ist es von besonderem Interesse, daß dies, wie der mathematischeBeweis ergibt, auch unabhängig von der a priori-Wahrscheinlichkeit n, gilt; n, war die Wahrscheinlichkeit,die dafür besteht, bei blindem Herausgreifen einerUrne aus allen vorhandenen gerade eine mit bestimmtemMischungsverhältnis x zu erfassen. Ob nun diese Wahrscheinlichkeitn, einer Gleichverteilung der Urnen entspricht oderganz andere Werte hat, jedenfalls verliert sich ihr Einflußmit wachsendem n. Man kann somit das ,,Bayes-LaplacescheTheorem" etwa so aussprechen: Wenn in n Zügen aus einerUrne mit schwarzen und weißen Kugeln die weißen mit derrelativen Häufigkeit a erschienen sind, so geht mit wachsendemrt die Wahrscheinlichkeit gegen Eins, die dafür besteht,daß das Mischungsverhältnis x der Urne, aus der gezogenwurde, zwischen a + E und a -E liegt, unabhängig von derBeschaffenheit der a priori-Wahrscheinlichkeit (die „zweiArten von Annäherungen", von denen Laplace im Text [S. 481spricht, sind in dieser Formulierung deutlich zu ersehen).Auch hier hat Laplace das allgemeine Gesetz angegeben,von dem dieses Theorem nur eine besondere Folgerungdarstellt, indem er den Limes für große n. berechnet hat, demdie Wahrscheinlichkeit s e 1b s t zustrebt, die bei dieser Aufgabefür ein beliebiges Mischungsverhältnis x besteht. DieserLimes führt wieder auf ein e-"'-Gesetz(aber mit ganz andernKonstanten als bei dem Grenzübergang, der dem BernoullischenProblem entspricht), und das in Rede stehende Theoremspricht - mathematisch gesehen - auch hier nur einespezielle Eigenschaft dieses Grenzüberganges aus, nämlichwieder eine ,,Verdichtungs"-Eigenschaft.110 312 + 105287Zu S. 50. 2037615: = 28, 3528.3Zu S. 53 unten ff. Diese interessante Aufgabe löst Laplacein der Theorie analytique nach der Methode der Differenzengleichungen.Neuerdings findet sie eine Bearbeitung vonHos t ins ky (,,Sur les transformations iterees des variablesaleatoires", Publ. de l'universit~ de Masaryk 1928, S. 21ff.).Man kann sich vorstellen, daß ein ,,Zug" darin besteht,gleichzeitig aus jeder der k Grnen eine Kugel herauszugreifenund in die nächste Urne zu legen. Man betrachtetdann gedanklich nur eine der zwei Kugelsorten, z. B. die
204 Anmerkungen.die Anfangszahlen m„ m„ . . . mkschwarzer Kugeln.schwarzen. Dann besteht einerseits ein Ausgangszustand,eine Ausgangsverteilung in den k Urnen, gegeben etwa durchAndererseitsbestehen ubergangs<strong>wahrscheinlichkeit</strong>en b, (X, y)(X= 1, . . . k, y = 1, . . .k) dafür, daß ein Kugelindividuumaus der Urne x naoh einem Zug in die Urne y gelangt. Bei derLaplaceschen Aufgabe ist für x = 1, 2, .. . k-I, p = b, (X, X)die Wahrscheinlichkeit, daß die betrachtete Kugel in derUrne x bleibt, b, (X, X + I) = p = l-+ die Wahrscheinlichkeitfür sie, in die rechtsstehende Urne zu wandern;außerdem ist wegen der zyklischen Anordnung für die letzteder Urnen b, (k, 1)=q, vl (k, k) =P. Die Matrix der V, (X, y)hat also eine sehr spezielle Gestalt, da in jeder Zeile (undjeder Spalte) nur zwei von Null verschiedene Glieder stehen,z. B. für k = 4:iP 4 0 0 'O P P OO O P q4 0 0 P ,Aus dieser Matrix folgt durch ,,Multiplikation" die der b, (x, y),das ist die für ein Individuum bestehende Wahrscheinlichkeitdafür, in zwei Zügen aus der Urne x in die Urne y zukgelangen. b, (X, y) = 2 b, (X,I) b, (r,y); denn um.h zweiz= 1Zügen von x nach y zu gelangen, muß das betrachtete Individuumbeim ersten Zug von x nach z, beim zweiten vonz naoh y kommen. Analog definiert und berechnet man dieb, (X, y). Die Aussage von Laplace ist in dieser Ausdrucksweisegleichbedeutend damit, daß im Limes für sehr große ndie Matrix der b, (X, y) in die aus lauter gleichen Gliedern bestehendeMatrix'1 - 1 -1'k'k'"' k1 1 1 - -, k' X"" k ,übergeht. Dies liißt sich - mit modernen Hilfsmitteln ohnegroße Schwierigkeit - einsehen, und nicht nur für die indieser Aufgabe betrachtete spezielle Ausgangsmatrix, son-
Anmerkungen. 205dern für sehr allgemeine ,,~bergangs<strong>wahrscheinlichkeit</strong>en",wie V. Mises gezeigt hat (I. C. S. 178, C) 5 16).Zu S. 56ff. Hier wird die heute ja hinlänglich bekannteAusgleichung von Beobachtungen nach der Methode der kleinstenQuadrate erläutert (vgl. auch S. 59ff.). Es schien nichttunlich, in diesen Anmerkungen näher auf alle Details der,,FehlertheorieU einzugehen.Zu S. 57. Die Wahrscheinlichkeitsdichte eines ,,Fehlersuz = X- a einer Messung X, wobei a den sogenannten ,,wahrenh 1Wert" bezeichnet, ist -e-hSz'; dabei ist h2 = ū2, wenni/n19die ,,Streuungu oder das ,,mittlere Fehlerquadrat" derBeobachtungen ist; h selbst heißt ,,Präzisionsmaß", denneine Beobachtung ist um so präziser, je kleiner ihre Streuungist.Die Größe h2 bezeichnet Laplace als ,,Gewichtu.Zu S. 58 oben. Hat man m Beobachtungen X„ X„. . . X,derselben Größe (desselben ,,wahren Wertes" U), so ist derdurch diese Beobachtungen gegebene wahrscheinlichste WertgleichhS X, + h,2 x2 + .. . + t%hxnhi+h2+ ...+h&und dieser Wert besitzt dasGewicht h: + hg + . . . + h2„ (die h: sind die Gewichte dereinzelnen Messungen).Zu 9. 58. Ist die Wahrscheinlichkeitsdichte W (z) gehgeben durch - e-h' 2' (mit z = x -U), so ist die Wahrschein-I;lichkeit dafür, ein zwischen X, und X,zu erhalten, gleichZrgelegenes Meßergebnis21Zu S. 60. Auch heute sind es vorwiegend die Astronomenund Geodäten, die nach dieser Methode rechnen.Zu S. 61, Z. 13 oben. Befolgen n Größen X„ x2, . ..X, dasGaußsche Gesetz mit den Priizisionen h„ h2,. ..hn, so folgt dielineare Kombination a, X, + a2 X, + ...+ anX,1 aa a2Gesetz mit dem Gewicht - = + 2+ . .. + a2dem gleichenH2 h12 h;Zu S. 63. Das arithmetische Mittel kann dadurchcharakterisiert werden, daß es die Quadrstsumme der „Ab-
206 Anmerkungen.weichungen" (der Beobachtungen zum ,,wahren Wert") zueinem Minimum macht. Der ,,Medianwert" macht die Summeaus den absoluten Beträgen der Abweichungen zum Minimum.Ordnet man alle Beobachtungen der Größe nach, so ist er derWert, der in der Mitte liegt.Zu S. 76ff. Die ausführliche Darstellung dieser ,,Kant-Laplaceschen Theorie" findet sich in Exposition du systbmedu monde 1796 (muvres, VI, 1884).Zu S. 83ff. Die Anwendung des Bayesschen Prinzipsauf die ,,Wahrscheinlichkeit von Zeugenaussagen und gerichtlichenUrteilen", die Poisson zum Titelproblem seinesberühmten Werkes gemacht hat (S. D. Poisson: ,,Recherohessur la probabilite des jugements en matibre criminelle et enmatiere civile", 1837), steht - nach V. Mises - ,,ungefähran der Grenze dessen, was noch in das Gebiet der rationellenWahrscheinlichkeitstheorie, die auf dem Kollektivbegriffberuht, einbezogen werden darf". Ähnlich steht esmit der ,,Wahrscheinlichkeit der Eignung eines Kandidatenzu einem Amt, erschlossen aus dem Prozentsatz der aufihn entfallenden Stimmen", mit der ,,Wahrscheinlichkeitder Zweckmäßigkeit eines Antrags" und mit den meisten derim folgenden behandelten Probleme der ,,sciences morales".Die Berechnungsmethode selbst bedarf in diesem Teil an denmeisten Stellen keines Kommentars, da sie ausführlich undklar im Text dargestellt ist.Zu S. 106ff. Es wird nach der Bayesschen Regel dieWahrscheinlichkeit dafür gerechnet, daß die Entscheidungeines Gerichtshofs, der nach einer bestimmten Majoritäturteilt, auch wirklich richtig ist. Die Rechnung ist wohldie folgende: Ist .n = 8 die Anzahl der Richter, TC,= 5 diezur Verurteilung erforderliche Majorität, so kann man dieWahrscheinlichkeit W, (X) rechnen, daß in einer ,,Urneu,in der sich bei acht Zügen fünf schwarze Kugeln ergaben,tdas Mischungsverhältnis X herrscht, und kann W,, (X) di1als ,,Wahrscheinlichkeit eines Irrtums'', sowie wn (X) dx =0
8I - /W,Anmerkungen. 207(X) dz als ,,Wahrscheinlichkeit der Wahrheit1' auf-0fassen. Nun ist nach der Bayesschen Regel (abgesehen vonder ,,a priori-Wahrscheinlichkeit")8Die analoge Rechnung, für n = 6, n, = 4 ausgeführt, gibt1einen Bruch, der unter - liegt.4zu s. 108.JO7X" dx= (+) l3 ; 1 1= p usf.\ ,0Zu 5. 110. Die mittlere Lebensdauer ist seit der Zeit,von der Laplace spricht, sehr stark gewachsen; sie liegtheute für die meisten europäischen Länder zwischen 55 und58 Jahren.Zu 5. 117. Bekannte einfache Zinseszinsaufgaben.Zu S. 118. Gesucht ist das Kapital K, das eine Personim Alter von m Jahren einer Gesellschaft zu bezahlen hat,damit ihr die Anstalt nach b = 5 Jahren eine durch c Jahrelaufende, am Ende jeden Jahres fiillige Rente e sichert.Die Einnahme K der Anstalt muß gleich ihrer Ausgabesein (wobei man von Verwaltungskosten usf. hier absieht).Bezeichnet nun z, die Zahl der noch Lebenden imAlter von m Jahren (bezogen auf irgendeine feste Zahl,
208 Anmerkungen.sagen wir eine Million Geborene), wie sie in der ,,Absterbe-ordnung" notiert sind, so ist zm+i - die Wahrscheinlichkeitzmdafür, daß eine m Jahre alte Person das Alter m + 1 er-lebt, und Zm+n -die Wahrscheinlichkeit dafür, daß sie nochzmZm+b+ln Jahre am Leben ist, somit -- ihre Wahrscheinlichzmkeit, am Ende des b-ten Jahres noch zu leben, und wennZm+b+lsehr viele Leute versichert sind, so ist dann Q ----zmdie durchschnittlich zu bezahlende Rente für das Ende desb-ten Jahres.Ist nun Y = 1+ - P (P = Zinsfuß) der ,,Ver-100e Zm+b+lzinsungsfaktor", so ist -.-- der gegenwärtige Wertdieser Rente.rb+ 1 Z,Ebenso ist der gegenwärtige Wert der amEnde des (b + 1)-ten Jahres fälligen Rente gleich ym.eZrn + b + 2usf. durch C Jahre.Da wahrend der ersten b Jahrezmdie Gesellschaft nichts zahlt, so folgt durch Addition dereben berechneten Produkte und Gleichsetzung mit K:Zu S. 122ff. Das ,,Fehlergesetz" wird als bekannt angesehenund die Bestimmung der unbekannten Größe X, des,,wahren Werts", folgendermaßen erklärt (die Bezeichnungensind hier -demTexte folgend -andere als üblich, als z. B. inder Anm. zu 5.58. Der dort mit a bezeichnete ,,wahre Wert"heißt jetzt X, was dort z hieß, heißt hier x usf.) : Heißen al,a, + q = a„ a, + q' = %, a, + q" = a„ . . . die der Größenach geordneten Beobachtungsergebnisse, so ist X -a, = xdie ,,Verbesserung" von a,, ebenso X-a, = x + q dieVerbesserung von a, usf. Irgendeine Beobachtung f wirdals Funktion des Beobachtungsergebnisses angesehen, undder Unterschied zwischen der Beobachtung, die den wahrenWert a, + x = X liefert, und der Beobachtung, die al liefert,
Anmerkungen. 209heißt ,,Irrtum" der Beobachtung: = f (al + X)-f (U,)= X. f' (5);somit ist proportional x und analog für a„ 4,. . .Die Wahrscheinliohkeit eines bestimmten Irrtums E, der erstenBeobachtung heiße yr, (&J und ist somit eine Funktion vonx also yl (q) =q1 (X) (darin liegt ein Plausibelmachen derüblichen Annahme, daß die ,,FehlerfunktionM q nur vonX = X-q, . . ., also nur von dem Unterschied der Beobachtungund des wahren Werts abhängt). Ebenso gibt ese$ .p, (E,) = q, (X), . . . Die Wahrscheinlichkeit der gleich-zeitigen Existenz aller Fehler ist das Produkt fi (X) allerdieser Fehlerfunktionen. Dies alles sind bis auf die Bezeichnungenheute üblich gewordene Oberlegungen. Es folgt dieFestlegung von X. Diese kann so geschehen, 1. daß X alsder wahrscheinlichste Wert erscheint, d. h. als der, für dendas Produkt fi (X) sein Maximum hat. Man kann aber auch2. nach der folgenden Vorschrift vorgehen: X sei die Abszisse,von der aus der Flächeninhalt der fi (X)-Kurve nach rechtsund links der gleiche ist. Diese Vorschrift kommt daraufihinaus X so zu wählen, daß das (X- X) fi (X) dx ein Mini--Wmum wird. - Ist die Kurve z. B. eine Gaußsche, so fallenbeide Vorschriften zusammen, im Allgemeinen ist dies nichtder Fall.Zu S. 124.1(S. 20) 43 949 268'Für diese Wahrscheinliohkeit fanden wirZu S. 125 unten ff. Hier werden Gedanken ausgesprochen,die dem in der modernen Wahrscheinlichkeitstheoriean der Spitze stehenden ,,Prinzip vom ausgeschlossenenSpielsystem" nahe stehen. - Wenn man weiß, daß die1Wahrscheinlichkeit für ,,Kopfu bei einer Münze -ist, so hat2es keinerlei Sinn, nach zehnmaligem Auffallen von ,,Wappenufür den elften Wurf besonders stark auf ,,Kopfu zu hoffen.- Wenn man nichts Sicheres über die Wahrscheinlichkeitder Münze weiß, so kann man höchstens - nach derBayesschen Regel - schließen, daß die Wahrscheinliohkeitfür „Wappenu eine größere ist, wenn zehnmal ,,Wappen"gefallen ist.
210 Anmerkungen.4Zu S. 130. (:) ist die Wahrscheinlichkeit, in vier Zügen. ,kein einziges Mal ,,6" zu werfen, und 1- (+)
Anmerkungen. 211Zu S. 165. Hier findet sich die verhältnismäßig deutlicheGegenüberstellung der Bernoullischen und BayesschenFragestellung.Zu S. 166ff. Es folgt nochmalige Besprechung derMethode der kleinsten Quadrate. Was hier (8. 168) als allgemeinesProblem bezeichnet ist, ist wohl ungefähr nachheute üblicher Ausdrucksweise die Frage der Fehlerfortpflanzung.Zu S. 167. Bei Laplace wird immer wieder mit Entschiedenheitdie Fehlertheorie mit Recht als ein Teil derWahrscheinlichkeitsrechnung angesehen, der seine Begründungaus seiner Stellung im Rahmen des Ganzen empfängt;nicht wie in manchen Lehrbüchern als eine Sammlung vonRechenregeln.Zu S. 169. Hinweis auf die Bayessche Fragestellung.Die Obersetzung ist von Herrn Dr. Heinrich L ö W y- unter Verwendung der älteren ubertragung durch X.Sch W aiger - nach dem Neudruck der fünften Auflage.des Originals (von 1825), Paris, Gauthier-Villars 1921, besorgtworden.R. V. Mises.