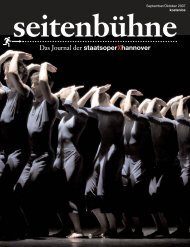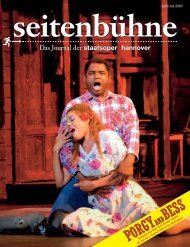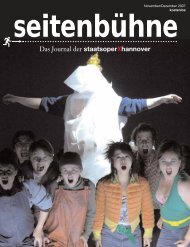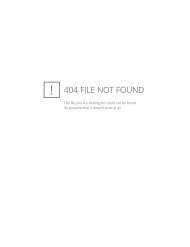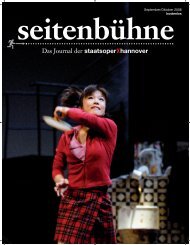seitenbühne Nr. 21 - Staatsoper Hannover
seitenbühne Nr. 21 - Staatsoper Hannover
seitenbühne Nr. 21 - Staatsoper Hannover
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
operwie Bataille es in seinem Zitat beschreibt –hat sich mit dem Gelächter eine neue Weltfür den Prinzen geöffnet.Anarchie der CommediaEine verrückte, bizarre Welt ist es, durch dieder Prinz bei seiner Suche nach den Zitrusfrüchtengeht. Nichts ist dort mehr an seinemPlatz. Die Dinge führen ein eigenes Lebenjenseits der Logik,Nebensächliches ist bedeutsam,Wichtiges istunwichtig: Ein Suppenlöffelwird zur existenziellenBedrohung, einunscheinbares Seidenbändchenrettet Leben,aus Orangen steigenschöne Frauen, kurz: Anarchieherrscht in des Prinzen neuerWelt. Anarchie ist auch ein zentrales Mittelder Commedia dell’arte, die Prokofjews19<strong>21</strong> uraufgeführter Oper zugrunde liegt.Zwar existiert in den Stücken der Commediaeine vorgegebene Dramaturgie, ein groberHandlungsfaden – doch von diesem Gerüstabgesehen, entsteht das Stück im Wesentlichenaus der Improvisation, die Schauspielergestalten es aus dem Moment herausund erfinden das Werk somit immer wiederneu.Diese Bedeutungsverschiebung vom Autorauf die Darsteller, diese Verlagerung auf diespontane theatrale Inspiration war es, dieden russischen Theatermacher WladimirMeyerhold faszinierte, als er sein 1914 indie Welt gerufenes Theatermagazin nacheinem Werk der Commedia dell’arte taufteund Die Liebe zu den drei Orangen oderDoktor Dapertuttos Magazin nannte. In derersten Ausgabe veröffentlichte erden Nachdruck jenes Stückes, dasdem Journal seinen Namen gab:Carlo Gozzis L’amore delle tre melarance ausdem Jahre 1761, ein Entwurf, von dem – derTradition der Commedia dell’arte entsprechend– lediglich ein Gerüst überliefert ist,eine 32-seitige »Analisi riflessiva«, welcheMeyerhold ausarbeitete. Sein Interesse andem Stück hatte einen klaren Hintergrund:Hatte Gozzi mit seinen drei Apfelsinen im18. Jahrhundert eine Kampfansage an dasmoralische Theater Goldonis formuliert, wares für Meyerhold zu Beginn des 20. Jahrhundertsein willkommener Anlass, die eigeneAblehnung des bürgerlichen Illusionstheaterskonzeptionell und historisch zuunterfüttern.Gegenentwurf zur LiteraturoperAuch Prokofjew scheinen ähnliche Fragenbeschäftigt zu haben, als er sich 1918 – anlässlicheines Auftrags der Oper in Chicago– auf Meyerholds Journal und den Orangen-Stoff besann. »Das Stück Gozzis reizte michsehr wegen seiner Mischung aus Märchen,Scherz und Satire und, was die Hauptsacheist, wegen seiner szenischen Wirksamkeit.Man hat festzustellen versucht, über wenich lache, über das Publikum, über Gozzi,über die Opernform oder über diejenigen,die nicht zu lachen verstehen. Ich verfassteeinfach ein fröhliches Schauspiel«, erinnertesich der Komponist später in seiner Autobiographie.Doch so sehr er auch seinen künstlerischenImpetus nachträglich zu neutralisierensuchte, die Polemik seines Werkesgegen Pathos und Geniekult ist unübersehbar,der Angriff gegen die Opernästhetikseiner Zeit mehr als deutlich: »An die Stellelangwieriger lyrischer Ergüsse und Betrachtungentritt hier das dreist schreiende Plakat,an die Stelle komplizierter dramatischerKollisionen treten Improvisationenvon Masken, an die Stelle vonRomantik und Mystik gutherzigeTheatermagie, die niemanden zu täuschenversucht«, umschrieb es die MusikwissenschaftlerinSigrid Neef.Tatsächlich verbirgt sich hinter dem scheinbarharmlosen Märchenstoff eine eigeneKunstkonzeption. Eine Identifikation mit denFiguren ist nur zu einem geringen Gradmöglich, ähnlich wie in der Commedia sindsie nur Typen, Holzschnitte, die sich permanentverändern. Fortwährend bricht Prokofjewdie Handlung auf, offenbart ihre theatralischeHerkunft und verwehrt somit dieFlucht in die Illusion. Ähnlich scheint auchdie Musik die Maskerade des Improvisationstheatersnachzuspielen: Aus unzähligenkleinen Mosaiken zusammengesetzt,verweigert sie die große emotionale Linie,flickt sich aus Fetzen zusammen, die die Traditionparodieren und auslachen. Die Sängertragen keine elegischen Melodien vor, sondernparlieren, die Instrumente malen nicht,sondern charakterisieren. Rasante Schnittewie im Film lassen es nicht zu, sich auszuruhen,das Kaleidoskop, das Prokofjew schuf,dreht sich fortwährend – wie ein einzigesgroßes, nicht greifbares Gelächter kommtdiese Partitur daher.Eskapismus und virtuelleWelten»Immer wenn wir lachen überschreiten wirdas Reich des Bekannten ...« – auch der ungarischeRegisseur Balázs Kovalik thematisiertmit seinem Blick auf Prokofjews Musiktheatereine Grenzüberschreitung, eine, diesich bei Jugendlichen im Umgang mit virtuellenWelten vollzieht. Anhand des Prinzenerzählt er die Geschichte eines jungen Menschen,der Angst vor dem Leben, Angst vordem Erwachsenwerden hat und sich in dieWelt seiner Computerspiele flüchtet. Indieser Welt gibt es Zauberer, die einanderbekriegen, Superhelden, die in