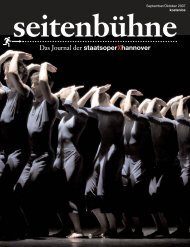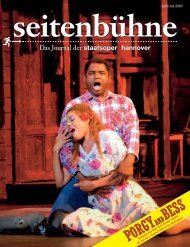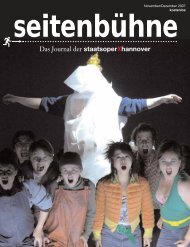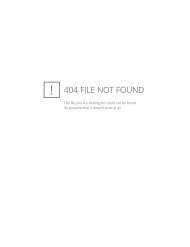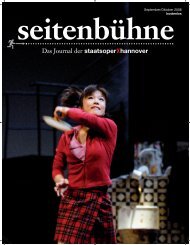16. 17 konzertAnna VogtKollegen im GeisteSchönberg und Brahms im 4. Sinfoniekonzert»Ich lege nicht so sehr Gewicht darauf, einmusikalischer Bauernschreck zu sein, alsvielmehr ein natürlicher Fortsetzer richtigverstandener, guter, alter Tradition«, schriebArnold Schönberg am 9. Juli 1923 an denMusikmäzen Werner Reinhart. Schönberg,der in der Rezeption vor allem als der »Fortschrittliche«,der »radikale Erneuerer« gesehenwurde, bezog seine künstlerische Energieschon immer auch aus der Vergangenheit,aus den Werken von Bach und Mozart, aberauch von Beethoven, Brahms und Wagner.Schönberg hatte seit seiner Jugend seinsatztechnisches und formales Verständnisan den großen Vorbildern geschult, indemer ihre Werke bearbeitete und instrumentierte.Für den jungen Komponisten war dieszunächst auch eine willkommene Einnahmequelle:Mit Arrangements von Operetten unddem Ausschreiben von Klavierauszügenkonnte er so sein Überleben als Künstler sichern.Vor allem in den 1920er und 1930erJahren entstanden mehrere Bearbeitungenvon Kammermusikwerken für großes Orchester,in denen er, trotz aller Verehrungfür die Originalwerke, auch seine ganz eigenenKlangvorstellungen realisierte.Otto Klemperer war es, der Arnold Schönbergim Frühjahr 1937 in Los Angeles, wobeide einer Künstler-Gemeinde aus Gegnernund Opfern des Nationalsozialismus angehörten,zur Bearbeitung von Brahms’berühmtem Klavierquartett g-Moll op. 25anregte. Schönberg, schon immer ein»Brahmsianer«, wie er gerne bekannte, warschnell überzeugt und erklärte seine Motivationfür die Bearbeitung in einem Brief anden Kritiker Alfred Frankenstein am 18.März 1939 mit der lapidaren Aufzählung: »1.Ich mag das Stück. 2. Es wird selten gespielt.3. Es wird immer sehr schlecht gespielt, weilder Pianist, je besser er ist, desto lauterspielt, und man nichts von den Streichernhört. Ich wollte einmal alles hören, und dashabe ich erreicht.« Das Arrangement entstandin nur wenigen Monaten, zwischendem 2. Mai und dem 19. September 1937,obwohl es in seinen Dimensionen einergroßen spätromantischen Sinfonie gleicht –nicht ohne Grund nannte Schönberg es imRückblick stolz »Brahms´ Fünfte Sinfonie«.Otto Klemperer, der die Uraufführung am 7.Mai 1940 dirigierte, war begeistert: »Manmag das Originalquartett gar nicht mehr hören,so schön klingt die Bearbeitung«.Schönberg hielt sich zwar streng an die Instrumentationsregelnseines älteren KollegenBrahms und übernahm natürlich auch dieviersätzige Form mit einem beschwingtenersten Satz, einem Intermezzo, einem lyrischenAndante und einem feurigen Rondoalla zingarese als Schlusssatz. Die wohl gravierendsteÄnderung in Schönbergs Fassungist jedoch das Fehlen des Klaviers, das inBrahms` Quartett eine dominante Rolle eingenommenhatte. So entsteht eine völligneue Klangwirkung, und die kammermusikalischenFeinheiten der Originalvorlagetreten zugunsten einer klanglichen Tiefenwirkungdurch die große Besetzung in denHintergrund. Es ist Brahms durch die Brillevon Arnold Schönberg, und dadurch einWerk, das Grenzen überschreitet: Grenzenzwischen Epochen und Grenzen der Form.So wird aus dem intimen kammermusikalischenWerk ein großes spätromantischesOrchesterwerk, quasi eine Zusammenarbeitzweier Kollegen im Geiste.Auch Brahms´ 1. Klavierkonzert könnte manfast als eine weitere seiner Sinfonien bezeichnen,so dominant und selbstbewusstgibt sich das Orchester in diesem groß angelegtendreisätzigen Werk. Das Konzert entstandim Jahr 1854, nur wenige Jahre nachBrahms´ 1. Klavierquartett und kurz nachdem Selbstmordversuch seines FreundesJohannes BrahmsArnold Schönberg
konzertRobert Schumann. Zu dessen Frau, der großartigenPianistin und Komponistin ClaraSchumann, hatte Brahms eine innige freundschaftlicheBeziehung, vielleicht auch eineheimliche Leidenschaft. In jedem Falle wares Clara, die ihn in dieser großen Aufgabeermutigte und unterstützte. Lange kämpfteBrahms mit der Form: Zunächst konzipierteer eine Sonate für zwei Klaviere, versuchtedann, diese in eine Sinfonie umzuarbeiten,scheiterte aber an seiner, wie er meinte, unzulänglichenOrchestrierungskunst. 1855schließlich kam ihm die Idee zu einem Klavierkonzert,wie er Clara enthusiastisch mitteilte:»Denken Sie, was ich die Nacht träumte.Ich hätte meine verunglückte Symphoniezu meinem Klavierkonzert benutzt undspielte dieses. Vom ersten Satz und Scherzound einem Finale furchtbar schwer undgroß. Ich war ganz begeistert.« An seinenRatgeber für Instrumentations-Fragen, denGeiger Joseph Joachim, schickte er schonbald eine erste Version, und am 22. Januar1859 konnte das Konzert im KöniglichenHoftheater zu <strong>Hannover</strong> unter der Leitungvon Joseph Joachim uraufgeführt werden.Den Solopart übernahm Johannes Brahmsselbst. Doch die Kritiken waren vernichtend.Brahms schrieb an Clara in ironischem Ton,der aber kaum seine Betroffenheit überspielenkonnte: »Ich zwinge diese spitze undharte Sahrsche Stahlfeder, Dir zu beschreiben,wie es sich begab und glücklich zuEnde geführt ward, dass mein Konzert hierglänzend und entschieden – durchfiel.« Erstspät konnte sich das Konzert im Konzertbetriebdurchsetzen. Dies liegt sicherlich zumTeil in seiner Modernität begründet – Brahmssetzte sich über einige traditionelle Konzert-Muster ganz einfach hinweg –, in der ungewöhnlichdominanten Rolle des Orchestersund in den besonderen Anforderungen desSoloparts, einem virtuosen Kraftakt.3. SinfoniekonzertManfred Trojahn Herbstmusik. Sinfonischer Satz(2010, UA) Auftragswerk der <strong>Staatsoper</strong> <strong>Hannover</strong>Robert Schumann Konzertstück F-Dur für vierHörner und Orchester op. 86 (1849/50)Sinfonie <strong>Nr</strong>. 2 C-Dur op. 61 (1845/46)Solisten Hornquartett des NiedersächsischenStaatsorchesters <strong>Hannover</strong>Dirigent Wolfgang BozicSonntag, <strong>21</strong>. November 2010, 17 UhrMontag, 22. November 2010, 19.30 UhrKurzeinführung jeweils 30 Minuten vor dem KonzertMit freundl. Unterstützung der Stiftung Niedersachsen4. SinfoniekonzertAnton WebernSechs Stücke für Orchester op. 6 (1909/1928)Johannes Brahms Konzert für Klavier undOrchester <strong>Nr</strong>. 1 d-Moll op. 15 (1854–59)Johannes Brahms/Arnold SchönbergKlavierquartett g-Moll op. 25 (1861), für großesOrchester gesetzt (1937)Solistin Olga Scheps (Klavier)Dirigent Lothar KoenigsSonntag, 19. Dezember 2010, 17 UhrMontag, 20. Dezember 2010, 19.30 UhrKurzeinführung jeweils 30 Minuten vor dem KonzertZweite Uraufführung der konzertsaisonWerke von Robert Schumann und Manfred Trojahn stehen beim 3. Sinfoniekonzert aufdem Programm. Besonders gespannt sein darf man auf die 2. Uraufführung dieser Saison,den sinfonischen Satz Herbstmusik von Manfred Trojahn, ein Auftragswerk desNiedersächsischen Staatsorchester <strong>Hannover</strong> anlässlich seines 375. Geburtstags. Trojahn,Schüler von Diether de la Motte und György Ligeti, gehört derzeit zu den renommiertestenzeitgenössischen Komponisten in Deutschland. Sein Œuvre umfasst zahlreicheEnsemble- und Orchesterwerke, Kammermusikwerke für verschiedenste Besetzungen,Vokalkompositionen und Opern.Die Tastenkünstlerin Olga SchepsDie junge Pianistin Olga Scheps konnte im 4. Sinfoniekonzert für den anspruchsvollenSolopart in Brahms’ 1. Klavierkonzert gewonnen werden. Olga Scheps, 1986 in Moskaugeboren, kam mit sechs Jahren nach Deutschland und studiert derzeit an der KölnerMusikhochschule bei Pavel Gililov. Seit ihrem Debüt beim Klavierfestival Ruhr imJahr 2007 ist sie als Solistin überaus gefragt und war bereits in der Philharmonie inMünchen, in der Hamburger Laeiszhalle und der Berliner Philharmonie zu erleben.Daneben ist sie regelmäßig zu Gast beim Schleswig-Holstein Musik-Festival, den FestspielenMecklenburg-Vorpommern, dem Kissinger Sommer und dem HeidelbergerFrühling. Als Kammermusikpartnerin arbeitete sie u.a. mit Daniel Hope, Adrian Brendel,Alban Gerhardt, Jan Vogler und Nils Mönkemeyer zusammen. Mit ihrer ersten CD »Chopin«gewann sie im Oktober 2010 einen ECHO Klassik als »Nachwuchskünstlerin desJahres«.