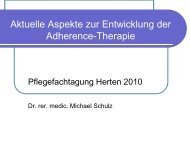ZENTRUM
ZENTRUM
ZENTRUM
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4<br />
DAS THEMA<br />
Schlafmedizin und Psychiatrie: Eine wichtige Liaison<br />
Oberärztin Dr. Christine Norra über den Zusammenhang zwischen Schlaf und Psyche<br />
Die heutige Menschheit bewegt sich auf eine Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft zu. Sie ist jederzeit und auf unterschiedlichsten<br />
Kommunikationswegen erreichbar, Zeitzonen lassen sich mittels modernster Transportmittel schnell überwinden<br />
und Stimulantien wie Kaffee, Cola oder Nikotin tun ihr übriges, wenn die Müdigkeit dann doch überhand zu nehmen<br />
scheint. Stört der Schlaf nicht gar am Ende, lautet eine provokante Frage. Fest steht: Der Mensch benötigt gegenwärtig<br />
etwa sieben Stunden Nachtschlaf, will er nicht langfristig körperlich, z.B. an Herz-Kreislaufstörungen erkranken. Und:<br />
Der Zusammenhang zwischen Schlaf, Schlafstörungen und psychischen Erkrankungen ist nach aktuellen Erkenntnissen<br />
nicht zu unterschätzen.<br />
Die noch recht junge Disziplin der Schlafmedizin und Schlafforschung<br />
gewinnt nicht nur in den Grundlagenwissenschaften,<br />
sondern auch in der klinischen Versorgung und der Gesundheitsökonomie<br />
zunehmend an Bedeutung. Auch das im<br />
Februar 2008 in der LWL-Universitätsklinik Bochum veranstaltete<br />
Symposium zu aktuellen neurowissenschaftlichen und klinischen<br />
Aspekten der Schlafmedizin wies auf den engen<br />
Zusammenhang zwischen Schlaf, Schlafstörungen und psychischen<br />
Zustandsbildern hin.<br />
Heutzutage ist weniger von „gesundem“ oder „gestörtem“<br />
Schlaf die Rede, sondern von „nicht-erholsamem“ Schlaf. Im<br />
Vordergrund steht bei Ein-/Durchschlafstörungen sowie<br />
Tagesschläfrigkeit das subjektive Erleben des Patienten am<br />
Tag, denn Schlaf-Wach-Störungen oder Schlafmangel beeinträchtigen<br />
nicht nur die nächtlichen Erholungs- und<br />
Gedächtnisbildungsfunktionen, sondern gleichzeitig die psychophysische<br />
Leistungsfähigkeit, Stimmung und Lebensqualität<br />
tagsüber.<br />
In einer bundesdeutschen Stichprobe in über 500 Allgemeinarztpraxen<br />
berichteten mehr als 42 Prozent der Patienten über<br />
Schlafstörungen. Bei mindestens einem Drittel aller chronischen<br />
Insomniker kann eine psychiatrische Ursache nachgewiesen<br />
werden. Schlafstörungen treten insbesondere bei<br />
affektiven, schizophrenen und dementiellen Bildern, traumatisch<br />
bedingten und anderen Anpassungsstörungen auf.<br />
Daher muss bei Klagen oder Auftreten von Schlafstörungen<br />
differentialdiagnostisch immer auch an eine psychiatrische<br />
Erkrankung gedacht und gezielt nachgefragt werden.<br />
Umgekehrt klagen 70 Prozent der psychiatrischen Patienten<br />
über Schlafstörungen, so etwa bis zu 90 Prozent der depressiven<br />
Patienten.<br />
Pharmakologisch stehen für die Insomnie-Behandlung mit<br />
den neueren Benzodiazepin-Rezeptoragonisten Substanzen<br />
zur Verfügung, die ein nur relativ geringes Abhängigkeitsrisiko<br />
aufweisen und bei kurzer Wirkdauer meist ohne morgendlichen<br />
Überhang bleiben. Hypnotisch wirksame Antidepressiva<br />
sind insbesondere bei depressiven Störungen Mittel der<br />
ersten Wahl. Phytopharmaka sind allenfalls bei leichten<br />
Insomnien als hilfreich anzusehen. Melatonin oder Rezeptoragonisten<br />
werden bei Rhythmusstörungen, Jetlag, chronischer<br />
Insomnie und zunehmend im Zusammenhang mit<br />
depressiven Störungen als wirksam diskutiert.<br />
Hingegen spielen kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen<br />
trotz einer recht guten Evidenzlage bislang kaum<br />
eine Rolle in der Therapie der chronischen Insomnien. Oft<br />
aber sind schon einfache schlafhygienische Empfehlungen<br />
von hohem Wert für die Verbesserung der individuellen Schlafqualität.<br />
Aber auch die übermäßige Tagesschläfrigkeit (Hypersomnie;<br />
Stichwort: „der müde Patient“) kann zum Problem werden,<br />
wenn etwa kognitive Defizite im Rahmen eines Schlafapnoe-<br />
Syndroms das intellektuelle und handlungspraktische Leistungsvermögen<br />
reduzieren und es dann oft zu einer Intoleranz<br />
gegenüber monotonen Situationen kommt (z.B. häufiges<br />
Einnicken im Straßenverkehr oder vor dem Fernseher).<br />
Die Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atemstörungen<br />
macht ein wesentliches Aufgabengebiet der Schlafmedizin<br />
aus, auch im Zusammenhang mit komorbiden medizinischen<br />
und psychiatrischen Störungen. Gleiches gilt für Bewegungsstörungen<br />
im Schlaf wie etwa dem Restless-Legs-Syndrom.<br />
Insgesamt hat sich die Durchschnittsschlafdauer verkürzt: im<br />
letzten Jahrhundert um über zwei Stunden und innerhalb der<br />
letzten zehn Jahre um eine weitere halbe Stunde; sieben<br />
Stunden werden aktuell empfohlen. Auch wenn die Gefahren<br />
einer unausgeschlafenen Gesellschaft sich vielleicht in<br />
Grenzen halten werden, geht es doch bei der Vermeidung von<br />
Übermüdung am Arbeitsplatz auch um die Minimierung sozialer<br />
und ökonomischer Folgekosten. Verkehrsunfälle infolge<br />
Übermüdung (schätzungsweise die Hälfte aller tödlichen<br />
Autounfälle) sowie Unfälle als Übermüdungsfolgen von<br />
Schichtarbeit stellen vermutlich nur die Spitze eines Eisbergs<br />
dar. Welche Rolle hierbei der therapeutische Einsatz von<br />
psychopharmakologischen Stimulantien spielen wird, bleibt<br />
abzuwarten.<br />
In jedem Fall werden klinisch tätige Psychiater sich in Zukunft<br />
mit den vielfältigen Ansatzpunkten auf dem Gebiet der<br />
Schlafmedizin auseinandersetzen müssen.