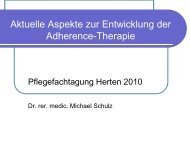ZENTRUM
ZENTRUM
ZENTRUM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr. Christina Norra<br />
Von Hirnphysik und Psyche<br />
Wer es mit dieser Frau zu tun bekommt, der steht nicht<br />
selten unter Strom — natürlich nur in übertragenem Sinne,<br />
wenn es darum geht, die minimalen elektrischen<br />
Aktivitäten des Gehirns mit Hilfe der Elektroenzephalographie<br />
(EEG) abzuleiten. Dr. Christine Norra, die seit dem<br />
Sommer 2007 als Oberärztin in der LWL-Universitätsklinik<br />
Bochum für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik<br />
und Präventivmedizin beschäftigt ist, wechselte nun mit<br />
einem Stipendium der Ruhr-Universität Bochum in die<br />
Forschung und untersucht seitdem gemeinsam mit ihrem<br />
Team hirnelektrische Potenziale.<br />
Genau genommen betreibt Dr. Christine Norra reine<br />
Grundlagenforschung, die von Bedeutung für alle psychiatrischen<br />
Erkrankungen ist und damit Patienten mit verschiedenen<br />
psychiatrischen Störungsbildern betrifft. Zu ihren wissenschaftlichen<br />
Tätigkeiten zählen Untersuchungen im Bereich<br />
der klinischen Neurophysiologie und Schlafforschung, v.a. mit<br />
Hilfe von elektrophysiologischen Methoden (EEG, evozierte<br />
Potenziale, Schlafpolygraphie). Mit ihrer Forschungsarbeit<br />
möchte sie so dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen<br />
psychischen Störungen und Veränderungen zentralnervöser<br />
Botenstoffe im Gehirn (sog. Neurotransmitter wie Serotonin<br />
oder Dopamin) aufzudecken. „Ich möchte einfache elektrophysiologische<br />
Marker für die Diagnostik und Therapie psychischer<br />
Störungen finden“, bringt Dr. Norra das Ziel ihrer wissenschaftlichen<br />
Arbeit auf den Punkt.<br />
Affektive Spektrumserkrankungen, Persönlichkeitsstörungen,<br />
aber auch komorbide somatische Erkrankungen – z.B. leiden<br />
Patienten mit Schlafapnoe oder Herzinsuffizienz oft an einer<br />
Depression, die bei der Behandlung nicht übersehen werden<br />
sollte – stehen dabei im Mittelpunkt ihrer klinisch-wissenschaftlichen<br />
Schwerpunkte. Darüber hinaus leitet Dr. Norra<br />
verschiedene wissenschaftliche Projekte und nimmt an Multicenterstudien<br />
teil, u.a. innerhalb des Kompetenznetzes „Depression/Suizidalität“<br />
oder in dem EU-Projekt „My Heart“.<br />
Gemeinsam mit ihrem Team, zu dem neben einer EEG-Assis-<br />
LWL-Universitätsklinik Bochum<br />
Von der Forschung in die Praxis<br />
Die LWL-Universitätsklinik Bochum ist seit ihrer Gründung vor<br />
nahezu 25 Jahren Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der<br />
Ruhr-Universität Bochum (RUB) und damit gleichzeitig für die<br />
Ausbildung von Medizinstudenten, aber auch Psychologiestudenten<br />
auf diesem Fachgebiet zuständig. Ihren guten Ruf verdankt<br />
sie dem großen Engagement bei der Betreuung und<br />
Ausbildung ihrer Studenten.<br />
Zu den originären Aufgaben einer Universitätsklinik gehört die<br />
Forschung. Mit Übernahme des Lehrstuhls durch Prof. Dr. Georg<br />
Juckel, Ärztlicher Direktor der LWL-Universitätsklinik Bochum, hat<br />
sich die Klinik neu ausgerichtet und forscht im Rahmen zahlreicher<br />
verschiedener wissenschaftlicher Kooperationen an der<br />
RUB, national wie international. Im Vordergrund stehen zahlreiche<br />
empirische Studien hinsichtlich psychobiosozialer Bedingungen<br />
psychischer Störungen.<br />
„Wir gehen von der Tatsache aus, dass bei der Entstehung psychiatrischer<br />
Erkrankungen das Zusammenspiel von neurobiologischen<br />
und psychosozialen Faktoren von zentraler Bedeutung ist –<br />
sowohl hinsichtlich des Verlaufs als auch der Behandlung“, erläutert<br />
Prof. Dr. Martin Brüne, Forschungsleitender Oberarzt an der<br />
Klinik, die Grundannahme der Forschungsarbeit. „Auf dieser Basis<br />
versuchen die wissenschaftlichen Gruppen der Klinik phänomenologische<br />
und sozialpsychiatrische mit neurobiologischen<br />
Aspekten zu verbinden.“<br />
Die Wissenschaftler wenden in ihren Forschungsprojekten primär<br />
Methoden der Bildgebung, Neurophysiologie, Neurochemie und<br />
Genetik an, mit deren Hilfe vorzugsweise die Frühverläufe von<br />
tentin wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden gehören,<br />
befasst sie sich zur Zeit hauptsächlich damit, wie sich<br />
spezifische Komponenten evozierter Potenziale durch pharmakologische<br />
und nicht-pharmakologische Einflussnahmen<br />
(beispielsweise unter Schlafentzug) verändern. Für den Laien<br />
erklärt sie dies an einem Beispiel: „Wir untersuchen mittels<br />
EEG und modernen Auswerteverfahren u.a. die Auswirkungen<br />
von Medikamenten auf bestimmte Hirntätigkeiten.“<br />
Erfahrungen als Oberärztin und Wissenschaftlerin bringt die<br />
Medizinerin im übrigen aus ihren vorangegangenen Tätigkeiten<br />
mit, v.a. am Universitätsklinikum Aachen sowie zuletzt am<br />
Max-Planck-Institut Göttingen für Experimentelle Medizin, wo<br />
sie als Senior Researcher (übers. Forscherin) tätig war.<br />
Bis Mitte 2009 reichen vorerst ihre Forschungsverpflichtungen.<br />
Weiterhin geplant ist der Aufbau einer Schlafmedizinischen<br />
Sprechstunde an der Klinik.<br />
Oberärztin Dr. Christine Norra (rechts) arbeitet bei ihren Untersuchungen sowohl<br />
mit gesunden Probanden als auch mit Patienten, hier mit EEG-Assistentin Elke<br />
Köhler und Doktorand Gerrit Fischer<br />
psychotischen und affektiven Erkrankungen nachvollziehbar<br />
gemacht werden sollen. „Wir möchten damit so nah wie möglich<br />
am pathophysiologischen Geschehen psychiatrischer Erkrankungen<br />
„dran“ sein, wenn eine pharmakologische Behandlung noch<br />
nicht erfolgt ist“, macht Prof. Martin Brüne deutlich. Denn ein diagnostisches<br />
und neurobiologisches Verständnis des Frühverlaufes<br />
beeinflusst die Behandlungsmethoden. Mit frühzeitig einsetzenden<br />
Therapien und Interventionen lassen sich oftmals chronische<br />
Verläufe psychiatrischer Erkrankungen abmildern oder gar verhindern.<br />
Weitere wissenschaftliche Schwerpunkte der LWL-Universitätsklinik<br />
sind Klinik und Neurobiologie für Persönlichkeitsstörungen,<br />
hier insbesondere das ADHS-Syndrom im Erwachsenenalter, die<br />
Suizid- und Suizidpräventionsforschung, Projekte im Bereich der<br />
Altersmedizin und Gerontopsychiatrie sowie suchtmedizinische<br />
Fragestellungen. Wissenschaft und Forschung in der Klinik haben<br />
sich in den vergangenen drei Jahren ausgesprochen günstig entwickelt.<br />
Die sog. Impact-Punkte für wissenschaftliche Veröffentlichungen,<br />
ein Maß für wissenschaftliche Exzellenz, haben sich in<br />
dieser Zeit verdreifacht. Darüber hinaus konnten gegenüber dem<br />
Vorjahr 2007 mehr als doppelt so viele Drittmittel eingeworben<br />
werden.<br />
Neben den für Forschung freigestellten Ärztinnen und Ärzten,<br />
Psychologinnen und Psychologen arbeiten viele der akademischen<br />
Mitarbeiter der Klinik – mit Unterstützung aller Berufsgruppen<br />
im Hause – derzeit an über 20 Forschungsprojekten.<br />
5