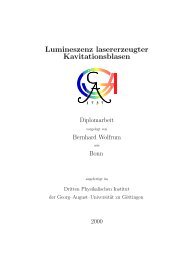deutscher - DPI - Georg-August-Universität Göttingen
deutscher - DPI - Georg-August-Universität Göttingen
deutscher - DPI - Georg-August-Universität Göttingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tallmembran, die durch Wirbelstromabstoßung nach Kondensatorentladung durch die<br />
Flachspule einen Druckimpuls in Flüssigkeiten bis zu 200 atm erzeugt [513]. Er habilitierte<br />
sich 1963 mit der Bestimmung von Stoßfrontdicken in Flüssigkeiten [514]. Beide,<br />
Kuttruff und Eisenmenger, verließen das Institut im September 1969, um Berufungen<br />
nach Stuttgart (Eisenmenger) bzw. Darmstadt – später Aachen – (Kuttruff) anzunehmen.<br />
Eisenmenger griff die Stoßwellenerzeugung mit dem Flachspulprinzip später<br />
wieder auf, um Nierensteine zu zertrümmern [536].<br />
Länger noch als Kuttruff und Eisenmenger, nämlich seit September 1952, war Meyers<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter H.-W. Helberg am Institut tätig. Er hatte zunächst über<br />
Akustik gearbeitet [166, 394, 419, 420, 508], dann über Mikrowellenabsorber [183, 285,<br />
287, 288, 290] und wandte sich später mehr der Festkörperphysik zu [291, 292, 293].<br />
Meyer hatte schon früh erkannt, dass Helberg sehr gewissenhaft, zuverlässig und verantwortungsvoll<br />
arbeitete; er berief ihn zunächst auf eine Assistentenstelle und ab April<br />
1964 auf die unbefristete Stelle als Kustos, später Akademischer Rat/Oberrat/Direktor.<br />
In dieser Funktion war Helberg bis zu seiner Pensionierung 1993 für die Instituts-<br />
Geschäftsführung verantwortlich, d. h. für die Mittelbewirtschaftung und das Personalwesen.<br />
Er führte aber während der ganzen Zeit seine Forschungsarbeiten vor allem<br />
über organische Leiter und Supraleiter fort.<br />
4.3. Vorlesungen<br />
Wenn auch die physikalische (vor allem akustische) Forschung den Hauptteil von Erwin<br />
Meyers (Berufs-)Leben ausmachte, so widmete er doch viel Zeit seinem ” Kolleg“,<br />
einem viersemestrigen Zyklus zweistündiger Experimentalvorlesungen, die er immer<br />
aktualisierte. Die Grundlagen der Schwingungsphysik vermittelte er in der ” Schwingungs-<br />
und Wellenlehre“, es folgten ” Physikalische und Technische Akustik“, ” Elektronische<br />
Messtechnik“ und schließlich ” Physikalische Grundlagen der Hochfrequenztechnik“.<br />
Meyer sprach immer sehr lebhaft und anschaulich, und vor allem legte er<br />
Wert auf díe vielen Demonstrationsexperimente, die seine Vorlesungen zu unvergesslichen<br />
Erlebnissen machten. Meyers Vorlesungen waren deshalb sehr beliebt und immer<br />
gut besucht. Kennzeichnend für das Göttinger Institut war, wie schon mehrfach betont,<br />
die Vielseitigkeit der behandelten Probleme. Beeinflusst von der Gründungsidee<br />
des HHI hatte Meyer schon immer die Analogien zwischen elektrischen und mechanischen<br />
bzw. akustischen Schwingungen bei seinen Forschungen benutzt. Diese schon<br />
auf S. 8 erwähnte Zweigleisigkeit – Akustik und Hochfrequenztechnik – führte zu vielen<br />
wechselseitigen Anregungen, z. B. bei der Absorberentwicklung und bei Relaxationsuntersuchungen.<br />
Auch seine Vorlesungen und Vorträge profitierten hiervon. Einem<br />
mechanisch-akustischen Versuch folgte meist ein analoger elektrischer oder umgekehrt.<br />
Im Bestreben, aktuelle Entwicklungen durch Vorlesungsexperimente zu veranschaulichen,<br />
ließ Meyer viele neue Demonstrationsversuche entwickeln. Einige wurden publiziert:<br />
zur parametrischen (oder rheolinearen) Verstärkung und Anregung [161], beides<br />
Verfahren, die erst kurz zuvor praktische Bedeutung erlangt hatten und deshalb<br />
ins Vorlesungsprogramm aufgenommen wurden [210], zur Wanderwellenverstärkung<br />
[504], zur Impulskompression [505], zum Schallstrahlungsdruck [506] und zu Stoßwellen<br />
[507]. Meyers Vorlesungstermin war immer der Freitag, von 9 15 bis 10 45 Uhr. Die<br />
Versuche wurden von H. Henze (siehe Seite 8 unten) und wenn nötig seinen Werkstatt-<br />
Mitarbeitern vorher aufgebaut. Am Donnerstag vormittag besprach Meyer mit Herrn<br />
Henze alle Versuche für den nächsten Tag eingehend, eine Art Generalprobe. Ein Foto<br />
zeigt Abbildung 14.<br />
Meyer, der manuell nicht sehr geschickt war, ließ Herrn Henze alle Versuche selbst<br />
vorführen. Dass ein Versuch nicht gelang, kam äußerst selten vor. Abbildung 15 zeigt<br />
Meyer während seiner Vorlesung und Abbildung 16 nach der Vorlesung beim ” Testieren“.<br />
Einmal im Semester mussten damals die Studenten das Studienbuch ihren Professoren<br />
vorlegen, die durch ihre Unterschrift bestätigten, dass die belegte Vorlesung auch<br />
25