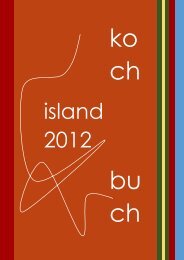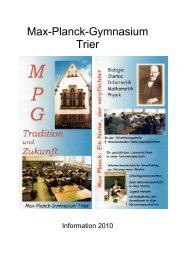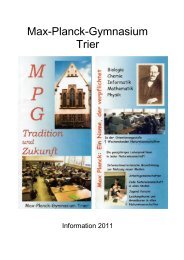Kriegsende und Nachkriegsjahre
Kriegsende und Nachkriegsjahre
Kriegsende und Nachkriegsjahre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
INHALT<br />
Einführung (R. Krings)<br />
Der Krieg ist aus<br />
Die Ereignisse in Ruwer zum Ende des 2. Weltkriegs (T. Busch) .........................02<br />
Wie meine Oma den Krieg erlebte (D. Regnery) ...................................................09<br />
Das Ende des Krieges (P. Naumann)....................................................................14<br />
Nachkriegszeit (J. Weins)......................................................................................16<br />
Evakuierung <strong>und</strong> die ersten Wochen nach dem Krieg (H. Speicher).....................17<br />
Das Leben geht weiter<br />
Mein Leben im Krieg <strong>und</strong> danach (B. Busch) ........................................................20<br />
Erzählung aus den Jahren 1945 – 1950 (P. Mohr)................................................22<br />
Erinnerungen meiner Großmutter (P. Schad)........................................................24<br />
Mein Vater (V. Winden) .........................................................................................25<br />
Hochzeitsvorbereitungen im Jahre 1946 (F. Mertes).............................................28<br />
Erlebnisse in der Nachkriegszeit (S. Schmidt)........................................................29<br />
Die Not ist groß<br />
Das Leben im verminten Deutschland (S. Justen) ................................................33<br />
Die Situation im Dorf meiner Großmutter (J. Gorges)............................................34<br />
Vom Krieg verschont <strong>und</strong> dennoch arm (T. Hank) ................................................37<br />
Unmittelbare Nachkriegszeit aus der Sicht meiner Oma (N. Maier) ......................38<br />
Langsur in den <strong>Nachkriegsjahre</strong>n von 1945 – 1948 (J. Bauer)..............................40<br />
Not macht erfinderisch<br />
Nachkriegszeit an der Obermosel (D. Kohn) .........................................................45<br />
Eine besondere Hamsterfahrt (T. Prenzel) ............................................................46<br />
Die erste Zeit nach dem Krieg (M. Dellwing) .........................................................47<br />
Erzählungen meines Großvaters (B. Meyer) .........................................................50<br />
Die Versorgung nach dem 2. Weltkrieg (D. Kees).................................................51<br />
Neuanfang<br />
Wiederaufnahme des Schieferbergbaus (J. Gorges) ............................................54<br />
Das Leben als Schreiner nach dem Krieg (M. Stark) ............................................56<br />
Leben <strong>und</strong> Arbeiten in einer Bäckerei nach dem <strong>Kriegsende</strong> (J. Kebig) ...............59<br />
Währungsreform in der Sparkasse Trier (F. Zonker).............................................61<br />
Mein Großvater als Gastarbeiter (A. Mansuri) ......................................................63<br />
2
Es ist mir wie heute bewusst:<br />
Mein Großvater wollte mir vom Krieg erzählen, dem 1. Weltkrieg, <strong>und</strong> ich<br />
verdrehte die Augen, fühlte mich „genervt“ <strong>und</strong> freute mich, wenn das Thema<br />
wechselte. Ich stellte kaum Fragen – es sei denn aus Höflichkeit – der Ge-<br />
sprächsgegenstand fand nicht mein Interesse. Später, als ich Geschichte<br />
studierte <strong>und</strong> viele Fragen hatte, konnte ich sie ihm nicht mehr stellen.<br />
Welche Erfahrung, welche Quelle authentischer Geschichtsbegegnung ist mir<br />
dadurch verloren gegangen!<br />
Das Interesse an Geschichte beginnt für viele Menschen erst, wenn sie<br />
selbst Geschichte haben, also älter geworden sind. Dem schulischen Ge-<br />
schichtsunterricht konnten viele – so erfahre ich immer wieder in Gesprächen<br />
– kaum etwas abgewinnen.<br />
Wir interessieren uns zu wenig für die Geschichte der älteren Generation,<br />
die doch unser Schulwissen so sehr bereichern könnte. Unser Projekt sollte<br />
allen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern der Klasse eine solche Erfahrung erschlie-<br />
ßen helfen: „oral history“ wie man so etwas in modernem Deutsch nennt.<br />
Ich habe viele Arbeiten mit großem Vergnügen gelesen <strong>und</strong> hoffe, dass<br />
auch Sie diese mit Freude <strong>und</strong> Interesse aufnehmen. Am meisten hoffe ich<br />
allerdings, dass die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler aus dem Projekt einen Gewinn<br />
für ihr Interesse an Geschichte ziehen <strong>und</strong> Ihnen künftig mehr Fragen stellen.<br />
Das kleine Buch ist zugleich ein Stück Erinnerung an die gemeinsame Unter-<br />
richtsarbeit der letzten Jahre.<br />
Richard Krings<br />
PS.: Für Inhalt, Stil <strong>und</strong> Rechtschreibung sind die Autoren verantwortlich<br />
3
Der Krieg ist aus<br />
Die Ereignisse in Ruwer zum Ende des 2. Weltkriegs<br />
<strong>und</strong> die unmittelbar folgende Zeit<br />
von Tobias Busch<br />
Dieser Bericht beruht auf Tatsachen, die mir mein Großvater erzählt hat. Teils<br />
sind es seine eigenen Erlebnisse, teils hat er sie selbst erzählt bekommen.<br />
Mein Großvater wurde 1933, als letztes von neun Kindern geboren. Er erlebte<br />
vom Krieg nur die Luftangriffe auf Trier <strong>und</strong> Umgebung sowie den Einmarsch<br />
der amerikanischen Streitkräfte in Ruwer.<br />
1945 lebten nur noch drei seiner vier Brüder, zwei kamen aus der Kriegsge-<br />
fangenschaft.<br />
Der Krieg kam im Herbst 1944 über das Trierer Land, die ersten Kriegserleb-<br />
nisse für meinen Opa waren die schweren Luftangriffe auf den Ehranger<br />
Bahnhof das Bahnausbesserungswerk in Trier-Euren <strong>und</strong> die Brandbomben<br />
auf Trier.<br />
An der Mosel entlang führte der Bahndamm der sog. „Kleinbahn“.<br />
Damals hatte mein Uropa an besagtem Bahndamm einen Gemüsegarten.<br />
Mein Opa erinnerte sich, mit seiner Schwester dort gewesen zu sein, als es<br />
über Ehrang Bomben hagelte. Trotz des hohen Bahndamms wurden beiden<br />
durch eine Druckwelle zu Boden gerissen <strong>und</strong> quer über eine Fallobstwiese<br />
geschleudert.<br />
Lebensgefährlich wurde es als mein Opa, bei der Weinlese auf Maximin-<br />
Grünhaus half. Als alliierte Flugverbände von Angriffen über Städten weiter<br />
im inneren des dt. Reiches zurückkamen eröffnete eine dt. Flakbatterie auf<br />
dem Grüneberg das Feuer. Auf Geheiß eines Wehrmachtsoffiziers sollten die<br />
Leute im Weinberg die Traubeneimer ausleeren <strong>und</strong> sie sich über den Kopf<br />
stülpen während sie sich auf den Boden warfen. Die Eimer waren aus dün-<br />
4
nem Blech, aber die Granatensplitter der Flak waren sechs bis sieben Zenti-<br />
meter lang, die Eimer hätten ihnen niemals stand halten können.<br />
Ein anderes Mal war mein Opa mit seinen Fre<strong>und</strong>en mit einem Bauer aufs<br />
Feld gegangen, um Kartoffeln auszumachen. Plötzlich tauchte ein Kampfge-<br />
schwader am. „Jabos“ auf <strong>und</strong> schoss mit seinen Bordwaffen auf die Ernten-<br />
den. Da man sich auf freiem Feld befand, konnte man sich nirgendwo richtig<br />
verstecken, in ihrer Panik rannten sie zu einem Gehöft in der Nähe, wenn es<br />
den Fliegern gefallen hätte, wäre es ein leichtes gewesen alle zu erschießen<br />
oder den Bauernhof zu bombardieren, so ist es reiner Zufall dass sich bei<br />
diesem Manöver niemand verletzte oder umkam.<br />
Diese Arbeit bei Bauern <strong>und</strong> Winzern wurde, nachdem die Schulen im dt.<br />
Reich geschlossen wurden, bis zu ihrer Wiedereröffnung nach dem Krieg<br />
beibehalten.<br />
An Heiligabend 1944 erfolgte ein Bombenangriff auf den Ruwerer Bahnhof<br />
<strong>und</strong> die Mühlen die sich mitten im Ort befanden, diese mahlten für die Wehr-<br />
macht.<br />
Als sich die typischen Anzeichen eines Fliegerangriffs einstellten, dachten die<br />
Ruwerer zuerst der Ehranger Bahnhof würde wieder bombardiert werden.<br />
Deshalb verließen nur wenige ihre Häuser um sich in die, zu Luftschutzbun-<br />
kern erklärten, Weinkeller im Berg zu begeben. So fanden an diesem Heilig-<br />
abend 50 Mann des Volkssturms, mehrere Einzelopfer <strong>und</strong> eine 18-köpfige<br />
Familie den Tod.<br />
Mein Opa <strong>und</strong> seine Familie hatten Glück im Unglück. Sie gehörten zu den<br />
wenigen Leuten, die in einem Luftschutzkeller waren, da aber das Haus direkt<br />
neben einer Mühle stand (heute RWZ Lager Trier-Ruwer / Fischweg) wurde<br />
es völlig ausgebombt <strong>und</strong> es blieb nichts bis auf die F<strong>und</strong>amente übrig. Ne-<br />
ben diesem Haus wurden weitere 30 bis 40 Häuser vernichtet oder schwer<br />
beschädigt. Für das damals kleine Dorf war das sehr viel, zumal der Bahnhof<br />
<strong>und</strong> die Mühlen heute noch alle stehen.<br />
5
Vor dem Einmarsch der Amerikaner war es bei meinem Opa <strong>und</strong> seinen<br />
Fre<strong>und</strong>en beliebt in den leerstehenden Bunkern des Westwalls zu spielen(in<br />
der Region Trier sind alle Bunker gesprengt worden). Meistens spielten sie<br />
Luftangriff. Heute sagt, dass er das nicht verstehe, da er ja vom Ernstfall ge-<br />
troffen worden war, aber als Kind hätte es ihn nicht gestört.<br />
Eine andere Episode war: Im Bahnhof von Ruwer stand zu Zeiten als die<br />
Wehrmacht schon fast weg war <strong>und</strong> die Amerikaner noch nicht ganz da wa-<br />
ren ein Wagon mit vornehmlich Armeeunterwäsche. Im Dorf wusste jeder der<br />
Wagon würde stehen bleiben <strong>und</strong> man könne die Wäsche bestimmt gut brau-<br />
chen. Genau zu dem Zeitpunkt als die Leute den Wagon geöffnet, hatten kam<br />
ein dt. Feldwebel mit vorgehaltener Pistole um die Leute davon abzuhalten,<br />
sich Dinge zu nehmen, welche die Wehrmacht dringend bräuchte. Man ver-<br />
suchte ihm zu erklären, was auf der Hand lag. Nach Trier konnte der Wagon<br />
nicht, denn da waren die Amerikaner; Richtung Hermeskeil waren alle Eisen-<br />
bahnbrücken gesprengt. Als der Feldwebel nicht nachgab, kam es wie es<br />
kommen musste, man entwendete ihm die Pistole <strong>und</strong> er bezog schwer Prü-<br />
gel.<br />
Der heutige Stadtteil Ruwer war damals ein zweigeteilter Ort, es gab Ruwer-<br />
Maximin, links der Ruwer <strong>und</strong> Ruwer-Paulin, rechts der Ruwer; beides ehe-<br />
malige Herrschaftsbereiche des Klosters St. Paulin <strong>und</strong> der Reichsabtei St.<br />
Maximin.<br />
Auf der Flucht vor den Amerikanern, hatte die Wehrmacht die Ruwerbrücke<br />
gesprengt. Die „feindlichen Truppen“ kamen am 1.3.45 aus Richtung Trier<br />
nach Ruwer-Maximin, sie brauchten drei ganze Tage um eine Pontonbrücke<br />
über den Bach zu schlagen. Am Morgen des 3. 3. 45 war für ganz Ruwer der<br />
Krieg aus. Die Amerikaner rückten aus dem eher kleinen R.-Maximin in das<br />
große R.-Paulin mit Panzern ein, Infanterie folgte mit aufgepflanzten Bajo-<br />
netts. Da der Teil des Volksturms, der nicht vorher geflohen war, sich wieder<br />
zivil kleidete <strong>und</strong> sich ruhig verhielt, wurde von den Amerikanern kein Zivilist<br />
6
auch nur irgend wie behelligt. „De Amis woaren anständisch Leut, dat muss<br />
ma soan. Die woaren nit so bekloppt wie die Franzosen speter“<br />
Ein anderer Teil des Volksturms hatte sich nach Eitelsbach zurückgezogen,<br />
unter ihnen mein Uropa. Der dt. Artillerie war bekannt, wo der Feind stand<br />
<strong>und</strong> so schoss sie aus Thomm mit schweren Geschützen nach Ruwer. Sowie<br />
die Amerikaner ihrerseits geortet hatten wo die Wehrmacht stand, erwiderte<br />
sie sechs St<strong>und</strong>en lang das Feuer in Richtung Thomm <strong>und</strong> Herl. Den einzi-<br />
gen nennenswerten Schaden, den die dt. Geschütze verursachten, war dass<br />
sie den Kirchturm total zerschossen.<br />
Mein Opa war mit seiner Mutter <strong>und</strong> zwei Schwestern bei einer verwandten<br />
Schreinerfamilie untergekommen (heute Schreinerei <strong>und</strong> Bestattungsinstitut<br />
Koster). Zum Mittagessen waren alle die im Haus lebten in der Schreiner-<br />
werkstatt zugegen, als plötzlich eine Granate in das Haus einschlug, einige<br />
Zimmer verwüstete <strong>und</strong> durch den Luftdruck sämtliche Fenster im Haus platz-<br />
ten, was ein Weiteressen unmöglich machte. Wäre die Granate zwei oder<br />
drei Meter weiter rechts eingeschlagen, so sagte mein Opa,<br />
„Mir wären Hackfleisch an da Wand gewes“.<br />
In weiser Voraussicht veranlasste der Pastor dass die leeren Messingkartu-<br />
schen der am. Granaten von den Kindern eingesammelt wurden, später wur-<br />
den sie an Schrotthändler verkauft, damit wurde der Kirchturm wieder aufge-<br />
baut <strong>und</strong> das Geld reichte sogar aus, um ein neues Geläut anfertigen zu las-<br />
sen.<br />
Wie schon gesagt war das Geschehen in Ruwer eigentlich ruhig, hätte die dt.<br />
Artillerie nur nicht geschossen.<br />
In Ruwer selbst blieben nur ganz wenige GIs. Die meisten zogen weiter über<br />
die alte Hermeskeiler Straße, verläuft. (heute als Feldweg parallel zur B<br />
52,oberhalb von Eitelsbach)<br />
Dort hatten sich ein paar Männer des Volkssturms aufgehalten <strong>und</strong> als nun<br />
eine Abordnung GIs dort erschien flüchteten fast alle über die Ruwer in den<br />
Grünhäuser Wald; fanatisiert versuchte ein einziger mit einem alten Karabiner<br />
7
gegen die Amerikaner mit Maschinengewehren den Ort zu verteidigen. Eine<br />
einzige Garbe aus dem MG reichte um den Soldaten auf dem Misthaufen des<br />
Bauern Herres (heute Weinstube Morgen-Herres, „Schepper“) sterben zu<br />
lassen.<br />
Unter den geflohenen Volksstürmern war mein Uropa. Er gelangte mit seinen<br />
Kameraden sicher in den Wald ,dort mussten sie aber feststellen, dass auch<br />
dort schon Amerikaner waren. Um nicht entdeckt zu werden versteckten sie<br />
sich im Moor bis man sicher sein konnte die Amerikaner waren nicht mehr im<br />
Wald. Daraufhin schlug sich mein Uropa durch den Timperter Wald nach Ka-<br />
sel wo er sich bei seinem Bruder Zivilkleidung besorgte <strong>und</strong> dann nach über<br />
einer Woche endlich wieder nach Ruwer kam.<br />
In Ruwer war nach dem Abzug der Wehrmacht der Nachschub zusammen<br />
gebrochen <strong>und</strong> dass am Anfang des Frühjahrs wo man doch nichts im Garten<br />
hatte was man hätte essen können. Es gab ein paar Bauern die vielleicht ei-<br />
ne Kuh hatten retten können, aber Kühe gaben Milch <strong>und</strong> deswegen wurden<br />
sie nicht geschlachtet. Not macht ja bekanntlich erfinderisch, es gab überall<br />
noch Reste von Vorräten der Amerikaner das berühmte „Corned Beef“, Kek-<br />
se <strong>und</strong> jede Menge Kaugummis. Eine andere Möglichkeit war man schoss mit<br />
eine Panzerfaust in die Mosel die Fische starben <strong>und</strong> kamen an die Oberflä-<br />
che. Man durfte sich nur nicht erwischen lassen den Schusswaffenbesitz war<br />
verboten.<br />
Eines Tages kam der Metzger zu meinem Opa <strong>und</strong> sagte ihm er brauche ei-<br />
nen starken Jungen. Im Hinterhof der Metzgerei war ein Pferd mein Opa klet-<br />
terte auf einen Tisch <strong>und</strong> erschlug das Pferd mit einem Holzhammer, da wie<br />
gesagt Schusswaffen untersagt waren. Wenn man zu so etwas fähig ist kann<br />
man sich in etwa vorstellen wie groß der Hunger war.<br />
Die Amerikaner verhängten eine Ausgangssperre von täglich 16 Uhr bis<br />
15Uhr des nächsten Tages.<br />
Die Arbeitsfähigen Männer wurden morgens abgeholt <strong>und</strong> nach Trier ge-<br />
bracht um dort den Schutt zu beseitigen <strong>und</strong> aufzuräumen. Auch hier war<br />
8
mein Uropa dabei; als er eines Tages im späten Frühling nachhause kam,<br />
erzählte er mit dem Hunger in Ruwer sei es halb so wild, er hätte beim Auf-<br />
räumen am Kornmarkt gesehen auf der OPD (heute Telekom) würde die<br />
Hungerfahne wehen <strong>und</strong> man könne von Glück sagen nicht in der Stadt zu<br />
wohnen.<br />
Die schwere Arbeit in der Stadt <strong>und</strong> eine verschleppte Grippe aus dem Sumpf<br />
ließen meinen Uropa schwer krank werden. Im August 1945 starb er.<br />
Kurz vor dem Abzug der Amerikaner nahm ein GI meinen Opa mit zu sich ins<br />
Lager <strong>und</strong> gab ihm eine Konservendose in der Größe XXXXL. Alle Leute die<br />
ihn damit sahen dachten es wäre Fleisch oder Kartoffeln darin aber als meine<br />
Uroma sie öffnete waren es lediglich rote Beete, es war aber eigentlich egal<br />
man war ja froh wenn man überhaupt etwas hatte.<br />
Nach den Amerikanern kamen die Belgier sie gaben aber nur ein kurzes<br />
Gastspiel bis die Franzosen anrückten.<br />
Das Erste was die Franzosen taten war eine Fahnenmast auf zu stellen <strong>und</strong><br />
die „Tricoloure“ zu hissen. Jeder der an der Fahne vorbei ging musste sie<br />
grüßen. Wer es nicht tat kam bei Wasser Brot <strong>und</strong> Schlägen in eine Art Kel-<br />
lerverlies. Mein Opa erzahlte, als Kinder hätten sie sich einen Spaß daraus<br />
gemacht immer wieder daran vorbei zu gehen <strong>und</strong> zu grüßen aber es gab<br />
auch ein paar unverbesserliche Hitleranhänger die sich strickt weigerten die<br />
Fahne zu grüßen <strong>und</strong> es gab dann auch die angedrohte Strafe, bis 46 ein<br />
neuer Kommandant in die „Surrité“ einzog <strong>und</strong> mit ihm Neue Sitten.<br />
46/47 kamen die beiden Brüder aus der Gefangenschaft zurück. Der eine war<br />
in Sibirien im Bergwerk gewesen <strong>und</strong> der andere war Koch im Offizierskasino<br />
eine am. Gefangenenlagers in Ägypten. Dieser hat bevor er frei gelassen<br />
wurde jede menge Konserven „requiriert“.<br />
In den Jahren 1946 bis 1947 hatte mein Opa <strong>und</strong> seine Familie mehr oder<br />
weniger vor sich hin gelebt aber 1948 ging es „Kraft des dt. Arbeiters“ wieder<br />
bergauf nicht nur dass die DM kam sondern man wohnte wieder in einem ei-<br />
genen Heim, eine Schwester heiratete <strong>und</strong> ein Schwager meines Opas kam<br />
9
als der letzte in der Familie aus der Gefangenschaft in Amerika, Offiziere<br />
blieben länger, zurück.<br />
Wie meine Oma den Krieg erlebte<br />
von Daniel Regnery<br />
Meine Oma ist am 12.04.1932 in Mehring an der Mosel geboren. Bei Kriegs-<br />
ausbruch war sie demzufolge 7 Jahre alt.<br />
� Im Unterricht haben wir gelernt, dass es in den letzten Kriegsjahren zu<br />
vielen Evakuierungen bzw. sogenannten „Landverschickungen“ kam, die<br />
aufgr<strong>und</strong> des Bombenterrors auf die deutschen Städte praktiziert wurden.<br />
Kannst du mir etwas Genaueres dazu erzählen?<br />
Direkt hatten wir mit den Landverschickungen nichts zu tun gehabt, aber wir<br />
mussten als Evakuierte eine sechsköpfige Familie aus Oberbillig aufnehmen,<br />
die ihr Dorf aufgr<strong>und</strong> der heftigen „Westwall-Kämpfe“ verlassen musste. Ich<br />
weiß noch ganz genau als sie im September 1944 zu uns nach Lörsch bei<br />
Mehring kamen. Sie hatten in aller Eile das Nötigste auf ihre „Karre“ gepackt<br />
<strong>und</strong> hatten sogar noch Zeit gehabt, ihre Kühe mitzubringen.<br />
10
� Was kannst du mir zu der Beziehung zu dieser Familie sagen <strong>und</strong> wie<br />
lange musstet ihr sie aufnehmen?<br />
Wir Kinder hatten uns damals sehr gefreut, weil wir neue Spielkameraden ge-<br />
f<strong>und</strong>en hatten, die sogar noch bei uns wohnten. Später als die Front näher<br />
kam, hat man zusammengehalten <strong>und</strong> sich gegenseitig aufgeheitert in dieser<br />
schweren Zeit. Ich habe sogar heute noch sehr guten Kontakt zur jüngsten<br />
Tochter dieser Familie.<br />
Am Ostermontag 1945 ist diese Familie als erste wieder zurück nach Oberbil-<br />
lig, da sie noch alle ihre Weinberge zu „schneiden“ hatten, um wenigstens in<br />
diesem Jahr ihre Trauben ernten zu können.<br />
� Du hast schon eben die Kämpfe in der Umgebung angesprochen. Was<br />
hast du vom Kampfgeschehen mitbekommen <strong>und</strong> wie habt ihr euch ver-<br />
halten?<br />
Man konnte schon 2 Jahre<br />
vor <strong>Kriegsende</strong> fast täglich<br />
die alliierten Bomber-<br />
geschwader (siehe Bild) am<br />
Himmel sehen, ja sogar<br />
hören. Das war immer so ein<br />
dumpfes Dröhnen, wenn<br />
H<strong>und</strong>erte von Bombern<br />
vorbeizogen. Die Jungs in<br />
meinem Alter hatten am Heiligen Abend des Jahres 1944 sogar einen Luft-<br />
kampf beobachtet, der sich hoch über dem Moseltal abspielte. Aus Berichten<br />
(siehe Zeitungsausschnitt) habe ich später erfahren, dass über ein halbes<br />
Dutzend Flugzeuge in diesem Kampf abgestürzt sind.<br />
Ich selber habe die ersten Artillerieeinschläge zwei Wochen vor unserer „Be-<br />
freiung“ im Raum Schweich vernommen. Diese zwei Wochen vor der „Befrei-<br />
ung“ spielten sich für uns hauptsächlich im Keller der Nachbarn ab, da wir<br />
den Artilleriebeschuss fürchteten. Ich weiß noch genau, als meine Tante ei-<br />
11
nes Abends nach oben in den Kuhstall ging, um die Kuh zu melken, dass auf<br />
einmal ein schwerer Dauerbeschuss einsetzte. Was hatten wir eine Angst um<br />
meine Tante! Aber Gott sei Dank ist ihr nichts passiert. Wir Kinder hatten<br />
nämlich mal beobachtet, wie der Rioler Kirchturm einen Volltreffer erhielt. Als<br />
die Front dann bei Trier stand, wurden viele französische Kriegsgefangenen<br />
an unserem Haus vorbei moselabwärts geführt.<br />
Unmittelbar vor unserer Befreiung wurde die Hauptstraße (heute B 53) an<br />
vielen Stellen durch das eigene Heer schwer beschädigt, um dem „Ami“ den<br />
Vorstoß zu erschweren. Wir amüsierten uns später darüber, weil die Ameri-<br />
kaner die einfachen Weinbergswege mit ihren Fahrzeugen befuhren.<br />
� Und wie hast du eure „Befreiung“ erlebt?<br />
Unsere „Befreiung“ wurde durch einen britischen Tiefflieger angekündigt, der<br />
über unserem Dorf zunächst kreiste. Als dieser wieder hinter dem Berg ver-<br />
schw<strong>und</strong>en war, hörten wir von Longen her ( vom Westen her ) Motorenge-<br />
räusche. Für uns war es ganz klar:“ Die Amis kommen!“ Wir „bewaffneten“<br />
uns mit weißen Fahnen <strong>und</strong> stürmten ihnen entgegen. Ehe sich unsere Eltern<br />
versahen, saßen wir schon in den amerikanischen Jeeps <strong>und</strong> aßen Schoko-<br />
lade <strong>und</strong> Kaugummis.<br />
Die Amis waren jedoch gezwungen, noch ein wenig bei uns zu bleiben, weil<br />
sich auf der Rioler Höhe noch Hitlerjungen verschanzt hatten <strong>und</strong> versuchten,<br />
die vorrückenden amerikanischen Truppen zurück zu schlagen. Doch diese<br />
hatte wenig Sinn, da der Feind in der Überzahl war. Nachdem sie unsere<br />
Häuser, Keller <strong>und</strong> Scheunen nach deutschen Soldaten kontrolliert hatten<br />
<strong>und</strong> die jungen „Kämpfer“ vertrieben waren, rückten sie weiter vor in Richtung<br />
Mehring.<br />
� Warst du schon mal in der Situation, in der du oder andere in Lebensge-<br />
fahr waren?<br />
Ja, einmal war ich im Herbst 1944 mit meiner Großmutter Äpfel pflücken, als<br />
plötzlich aus den Wolken über uns zwei Tiefflieger stürzten <strong>und</strong> einen LKW<br />
unter Beschuß nahmen, der nur wenige Meter von uns entfernt stand. Meine<br />
12
Oma <strong>und</strong> ich schmissen uns sofort auf die Erde <strong>und</strong> ich hörte ein dumpfes<br />
Prasseln. Als die Tiefflieger wieder weg waren, fand ich überall um mich her-<br />
um Messinghülsen, die vor den Angreifern stammten. Aber dieses heulende<br />
Geräusch der im Sturzflug befindlichen Flugzeuge werde ich wohl nie mehr<br />
vergessen.<br />
Des weiteren bestand durch herumliegende Munition eine große Gefahr für<br />
uns Kinder. Ich weiß noch wo ältere Jungen einfach so aus Jux mit Handgra-<br />
naten rumgespielt haben; wenige Meter von unserem Haus lag eine Panzer-<br />
faust herum <strong>und</strong> so weiter. Man hat später noch viel Arbeit gehabt, diese<br />
ganzen Waffen einzusammeln, damit sie für spielende Kinder keine Gefahr<br />
mehr darstellen konnten.<br />
Im Nachhinein war diese Zeit sehr schlimm für uns, <strong>und</strong> wir brauchten ziem-<br />
lich viel Zeit, um unsere schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten z. B. hatte mei-<br />
ne Schwester noch Jahre später Angst gehabt, einen Keller zu betreten. Ich<br />
denke, dass es noch viele Leute gibt, die immer noch mit bleibenden, psychi-<br />
schen Problemen leben müssen. Aber ich glaube, dass ihr das noch nicht so<br />
ganz verstehen könnt, weil ihr (Gott sei Dank) selbst noch nie so etwas<br />
durchgemacht habt.<br />
13
Das Ende des Krieges<br />
Von Peter Naumann<br />
Der folgende Text soll die Flucht meines Großvaters vor der Alliierten Front<br />
nach Bayern <strong>und</strong> die baldige Heimkehr dokumentieren.<br />
Ende des 2. Weltkrieges rückte die Front der Alliierten immer näher nach Hü-<br />
ckelhoven, das ca. dreißig Kilometer südwestlich von Aachen liegt. Dort lebte<br />
mein Großvater Peter Schnitzler, der zu diesem Zeitpunkt siebzehn Jahre alt<br />
war. Aus Angst vor der drohenden Invasion der Alliierten flüchtete er mit drei<br />
Fre<strong>und</strong>en, einem Esel, einem Karren <strong>und</strong> gefälschten Papieren in den Süden<br />
Deutschlands nach Bayern. Nach einer einwöchigen Reise erreichten die vier<br />
einen Bauernhof nahe München. Sie finanzierten die Übernachtungen dort<br />
mit geschmuggelten Zigaretten, die sie gegen Schuhe eingetauscht hatten.<br />
Am 8. Mai 1945 war es dann soweit. Nach einem drei monatigem Aufenthalt<br />
in Bayern erfuhren sie, dass der Krieg zu Ende sei. Mein Großvater berichte-<br />
te mir, dass seine Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> er zunächst unsicher waren wie es weiter ge-<br />
hen sollte. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie sie ohne Tauschwirtschaft<br />
<strong>und</strong> den Schwarzmarkt überleben sollten.<br />
Ende Mai machten sich die Fre<strong>und</strong>e wieder auf den Rückweg Richtung Hei-<br />
mat. Mit ca. 2000 Zigaretten im Gepäck erhofften sie eine gewisse Absiche-<br />
rung zu haben. Ihre Route sollte von Bayern über Koblenz nach Aachen bzw.<br />
Hückelhoven führen. Bis zur Rheinüberquerung lief auch alles wie geplant,<br />
doch am Rheinufer begegneten sie einer französischem Patrouille. Jegliche<br />
Bestechungsversuche um nicht in Gefangenschaft zu geraten schlugen fehl,<br />
da sich keiner der Franzosen für das Rauchen begeistern ließ. Die vier<br />
Fre<strong>und</strong>e wurden mit anderen Deutschen auf Lastwagen verteilt. Mein Groß-<br />
vater befürchtete, dass sie nach Andernach ins Kriegsgefangenenlager ver-<br />
schleppt werden würden. Deshalb entschieden die vier vom Laster abzu-<br />
springen, was auch gelang. Daraufhin folgte jedoch das nächste Problem.<br />
Um wieder auf die geplante Heimroute zu gelangen, mussten sie die Mosel<br />
überqueren. Dazu benutzte mein Großvater einen Großteil seiner letzten Zi-<br />
15
garetten. Sie erkauften sich die Flussüberquerung bei einem Angler, der sie<br />
mit einem Boot zum anderen Ufer brachte. Dort angekommen entschieden<br />
sie sich für einen mehrstündigen Fußmarsch, der sie zu einem Bahnüber-<br />
gang bringen sollte. Der nächste von Norden kommende Zug wurde genutzt,<br />
da dieser an einem Bahnübergang abstoppen musste <strong>und</strong> sich somit die Ge-<br />
legenheit bot aufzuspringen, um in die Nähe von Hückelhoven/Aachen zu ge-<br />
langen. Glücklicherweise durchquerte dieser die Landschaft nahe Aachen. In<br />
Stollberg sprangen dann mein Großvater <strong>und</strong> die Fre<strong>und</strong>e vom Zug. Da es<br />
schon spät in der Nacht war <strong>und</strong> um 22 Uhr Sperrst<strong>und</strong>e herrschte, entschie-<br />
den sie sich in einem Bauernhof zu übernachten. Wiederum wurde dies mit<br />
Zigaretten finanziert. Am nächsten Morgen begaben sich die vier Fre<strong>und</strong>e auf<br />
den Weg nach Hückelhoven, das sie mittags erreichten. Verw<strong>und</strong>ert über die<br />
intakte Kleinstadt versuchte jeder der jungen Männer wieder ein normales<br />
Leben zu führen. Mein Großvater berichtete mir, dass Hückelhoven von den<br />
Bombardements verschont geblieben sei, da die Zeche in Hückelhoven in<br />
holländischem Besitz war.<br />
Mit seiner Lehre als Schuhmacher arbeitete mein Großvater die nächsten<br />
Jahre im Schuhbetrieb seines Vaters. Die Nähe zur Zeche ermöglichte relativ<br />
gute Arbeitsbedingungen. So war die Stromversorgung, die von ihr ausging,<br />
gewährleistet. Jedoch konnte man einen Betrieb nur äußerst schwer legal<br />
führen. Deshalb wurden von ca. 20 angefertigten Schuhen 10 legal verkauft,<br />
5 gegen neues Material wie Leder, Kleber etc. eingetauscht <strong>und</strong> 5 wurden zur<br />
Beschaffung von Lebensmitteln benötigt. Nicht nur mein Großvater sondern<br />
zwei Drittel der deutschen Bevölkerung war vom Schwarzmarkt abhängig<br />
bzw. konnte damals nur mit Tauschgeschäften überleben.<br />
16
Nachkriegszeit<br />
von Johanna Weins<br />
Am 17. März 1945 marschierten die Amerikaner in Thomm ein.<br />
Ca. 3 Wochen vorher hatte ein deutscher Funker, der auf dem Kirchturm saß,<br />
den amerikanischen Funk abgehört. Dabei hörte er den Spruch: „ Am nächs-<br />
ten klaren Tag wird Thomm dem Erdboden gleichgemacht.“<br />
Die Bevölkerung wurde alarmiert <strong>und</strong> man zog geschlossen in die Stollen, die<br />
Schiefergruben, r<strong>und</strong> um das Dorf. Dort lebte man <strong>und</strong> beim Angriff der Ame-<br />
rikaner wurden nur zwei Dorfbewohner getötet. Als die Amerikaner abzogen<br />
<strong>und</strong> die Bewohner ins Dorf zurückkehrten, war Thomm zu 80 % zerstört. Der<br />
Wiederaufbau begann, jeder half jedem, im Dorf herrschte ein großer Ge-<br />
meinschaftssinn. Diejenigen die Vieh oder ein bisschen Land, auf dem ange-<br />
baut werden konnte, besaßen, tauschten Gemüse, Eier, usw. gegen Baustof-<br />
fe wie Zement. Diejenigen, die eine Arbeit in Trier hatten, mussten zu Fuß<br />
nach Waldrach gehen, denn von dort aus fuhr ein Zug nach Trier. Die meis-<br />
ten Männer arbeiteten in den Schiefergruben zwischen Thomm <strong>und</strong> Fell. Das<br />
Leben fing an sich wieder zu normalisieren, Vereine wurden wieder eröffnet<br />
oder neu gegründet. Als 1948 die Deutsche Mark eingeführt wurde, hatte<br />
sich das Leben wieder normalisiert.<br />
Nun fehlte noch eins: Die Männer aus der Gefangenschaft. Einige waren<br />
schon zurückgekehrt. Allerdings kamen noch viele der Männer mit den letzten<br />
Schiffen <strong>und</strong> Transporten. All diese Männer schämten sich sehr. Sie zogen<br />
sich zurück, redeten kaum mehr <strong>und</strong> gingen auch nicht durchs Dorf sondern<br />
außen herum. Der Gr<strong>und</strong> war, dass die anderen Leute sie hätten sehen kön-<br />
nen mit ihren zerlumpten Kleidern <strong>und</strong> Schuhen. Mit der Rückkehr dieser<br />
Männer kehrte der Alltag wieder ein.<br />
17
Evakuierung <strong>und</strong> die ersten Wochen nach dem Krieg<br />
von Hannah Speicher<br />
Meine Oma war 16 Jahre alt, als der Krieg vorbei<br />
war. Sie lebte während des Krieges in der Stadt<br />
Trier, am Deimelberg. Sie hatte 5 Geschwister. Ihr<br />
Vater war Volksschullehrer von Beruf. Die beiden<br />
älteren Brüder meiner Oma waren im Krieg, einer<br />
war Luftwaffenhelfer, der andere war in Russland.<br />
Wann <strong>und</strong> wohin wurdest du evakuiert?<br />
Ich wurde zweimal evakuiert. Das erste Mal wurde<br />
ich nach dem 1. Granatbeschuss der Amerikaner im<br />
Herbst 1944 evakuiert, zusammen mit meinen<br />
beiden Schwestern, meinem jüngsten Bruder <strong>und</strong> meiner Mutter. Mein Vater<br />
war abkommandiert zum Volkssturm um Panzersperren an der Obermosel zu<br />
errichten. Wir fünf wurden mit der Kleinbahn nach Neumagen gebracht. Nach<br />
einiger Zeit konnten wir uns wieder mit unserem Vater in Trier treffen. Er be-<br />
reitete die Evakuierung nach Dhron vor. Nun fuhren wir gemeinsam mit mei-<br />
nem Großvater, meiner Tante <strong>und</strong> meiner Großtante nach Papiermühle bei<br />
Dhron.<br />
In welchem Gebäude wurdet ihr untergebracht?<br />
Wir lebten zu neunt in dem ausgeräumten Klassenraum der Dorfschule.<br />
Habt Ihr aus Trier Einrichtungsgegenstände mitnehmen können?<br />
Ja, ein paar. Mein Vater hatte einen Lkw organisiert. So hatten wir die Mög-<br />
lichkeit 3 Betten, einen Schrank <strong>und</strong> einen Herd mit zunehmen.<br />
Wovon habt ihr Euch ernährt?<br />
Es gab damals noch Lebensmittelkarten, für die man einige wenige Lebens-<br />
mittel bekam. Zum Einlösen dieser Karten mussten wir in das 6 km entfernte<br />
Neumagen. Diese Lebensmittel reichten aber bei weitem nicht aus, so waren<br />
wir gezwungen auf den Feldern nach Korn zu suchen <strong>und</strong> es zu mahlen um<br />
18
Mehlsuppe zu kochen. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, schick-<br />
ten mich meine Eltern zum Einlösen der Karten. Ich war ganz alleine auf dem<br />
Rückweg, als mir ein amerikanischer Tiefflieger entgegen kam. Die Amerika-<br />
ner schossen <strong>und</strong> ich musste im nächsten Straßengraben Schutz suchen.<br />
Hast du während der Evakuierung andere Angriffe miterlebt?<br />
Nein, eigentlich nicht. Wir hörten jedoch die Flieger der Engländer <strong>und</strong> Ame-<br />
rikaner. Und später das immer näher kommende Artillerie- Feuer.<br />
Hast du dich in Papiermühle vor dem Kriegsgeschehen sicher gefühlt?<br />
Wir hatten keine Angst mehr vor weiteren Angriffen. Aber natürlich war das<br />
Leben dort sehr hart. Allerdings bangten wir sehr um unser Trier <strong>und</strong> um un-<br />
sere Wohnung dort. Wir hörten, dass einige Bombenangriffe die Stadt sehr<br />
zerstört hatten.<br />
Hast du während der Evakuierungszeit Fre<strong>und</strong>schaften geschlossen?<br />
Ich lernte einen Jungen aus Drohn kennen. Oskar war 18 <strong>und</strong> hatte eine Be-<br />
hinderung am Fuß, deshalb wurde er nicht eingezogen. Ich half ihm <strong>und</strong> sei-<br />
ner Familie oft in den Weinbergen <strong>und</strong> auf den Feldern. So bekam ich noch<br />
ein wenig zusätzliches Essen.<br />
Wie hast du vom <strong>Kriegsende</strong> erfahren?<br />
Unser Radio war kaputt, deshalb erfuhren wir alles vom Hörensagen. Das<br />
<strong>Kriegsende</strong> lag im Frühling. Es war eine warmer Tag <strong>und</strong> meine Familie <strong>und</strong><br />
ich hofften auf einen Neuanfang <strong>und</strong> bessere Zeiten. Leider waren die fol-<br />
genden 3 Jahre sehr hart für alle. Sie waren von Hunger, Wohnungsnot <strong>und</strong><br />
sehr kalten Wintern geprägt.<br />
Seid ihr daraufhin direkt nach Trier zurückgekehrt? Konntet ihr eure Wohnung<br />
noch bewohnen?<br />
Wir kehrten nicht sofort heim, sondern erst nachdem mein Vater unsere<br />
Heimfahrt organisiert hatte. Nach einigen Tagen hatte er aus den umliegen-<br />
den Dörfern ein Fuhrwerk mit 2 Kühen besorgen können <strong>und</strong> so waren wir<br />
innerhalb eines Tages in Trier. Unsere Wohnung war so stark zerstört, dass<br />
19
wir in die fremde Nachbarswohnung ziehen mussten. Hier lebten wir dann<br />
später, als meine älteren Brüder heimkamen, mit 10 Personen.<br />
Welche Erfahrungen hast du mit den Besatzungsmächten gemacht? Hattest<br />
du Angst vor ihnen? Vielleicht sogar vor Racheakten?<br />
Ganz am Anfang hatte ich schon Angst, schließlich waren sie fremd. Das leg-<br />
te sich aber schnell. In der kurzen Zeit der amerikanischen Besatzung beka-<br />
men wir Kinder oft Schokolade <strong>und</strong> Kaugummi. Ich kannte sogar einen ame-<br />
rikanischen Soldaten, der uns ein paar Mal Kaugummi, Schokolade, Zucker<br />
<strong>und</strong> Mehl vorbei brachte.<br />
Die französischen Besatzer waren weniger großzügig. Sie hatten selber nicht<br />
so viel Lebensmittel <strong>und</strong> einen relativ großen Hass auf die Deutschen.<br />
20
Das Leben geht weiter<br />
Mein Leben im Krieg <strong>und</strong> danach<br />
von Benjamin Busch<br />
1940 wurde ich geboren. Noch während dem Krieg als ich noch ein Kleinkind<br />
war, ich kann mich noch gut daran erinnern, wurden wir nach Badem in der<br />
Eifel evakuiert. Dort waren wir vom Krieg recht abgeschottet. Erst gegen En-<br />
de des Krieges bekamen wir dort was mit, nämlich als die Amerikaner vor-<br />
rückten. Doch ein schlimmes Ereignis werde ich nicht vergessen: Als die A-<br />
merikaner kamen, standen wir vor der Tür des Bauernhofes, auf dem wir wa-<br />
ren <strong>und</strong> eine verirrte Gewehrkugel traf ein Mädchen an der Halsschlagader.<br />
Es war sofort tot.<br />
1946 wurde ich eingeschult. Wir waren nur vier oder fünf Schüler. Die Schule<br />
war vom Krieg noch demoliert. Jedesmal wenn es regnete gab es Schulfrei,<br />
da das Dach nur notdürftig abgedeckt war <strong>und</strong> es ständig hereinregnete.<br />
1948 sind wir dann nach Wasserliesch umgezogen. Dort besuchte ich bis<br />
1950 die Gr<strong>und</strong>schule wo Jungen <strong>und</strong> Mädchen noch gemeinsamen Unter-<br />
richt hatten. Später in der Volksschule (meine Eltern hatten nicht genug Geld<br />
für die Realschulbücher sonst wär ich nach Konz in die Schule gegangen)<br />
war der Unterricht von Jungen <strong>und</strong> Mädchen getrennt. Der Tag war sehr an-<br />
strengend: Morgens um fünf Uhr war Aufstehen angesagt, denn um sechs<br />
Uhr musste man in der Kirche die Morgenandacht dienen. Wenn jemand ge-<br />
storben ist, durfte man morgens vor der Schule noch mit zur Totensalbung.<br />
Danach ging es ab in die Schule. Nach der Salbung hat man nach Weihrauch<br />
<strong>und</strong> den ganzen Salben <strong>und</strong> Kräutern gestunken.<br />
In der Schule herrschte Disziplin. Man konnte als der Lehrer reinkam schon<br />
sehen ob er gut oder schlecht gelaunt war. Standen die Haare am Hinterkopf<br />
nach oben, gab es bei ihm meistens kein Frühstück zu Hause oder er hatte<br />
Stress mit seiner Frau. Auf jeden Fall musste man dann ruhig sein, denn<br />
21
sonst gab es Schläge vom Lehrer. Und wenn er richtig mies drauf war, hat es<br />
sogar richtig weh getan. Doch nach der Schule war alles vergessen. Da ging<br />
es zügig nach Hause, denn es war viel zu erledigen. Nach den Hausaufga-<br />
ben war zweimal in der Woche Holz sammeln angesagt. Da es noch keine<br />
Heizung gab, brauchten wir irgendwo her Brennstoff für unseren Ofen. Wir<br />
konnten uns auch kein Holz kaufen, da wir nie viel Geld hatten, aber den Leu-<br />
ten war es gestattet, im Wald das durch Stürme heruntergefallene Holz zu<br />
sammeln. Damals war der Wald so sauber, dass man es heute kaum glauben<br />
kann. Wenn wir kein Holz sammeln mussten, waren wir unterwegs. Meistens<br />
ging es Richtung Mosel, um dort Fußball zu spielen. Es hat immer viel Spaß<br />
gemacht Fußball mit den ganzen Fre<strong>und</strong>en zu spielen. Wenn wir mal nicht<br />
Fußball spielten waren wir an der Mosel die früher noch nicht begradigt <strong>und</strong><br />
lange nicht so tief war, wie sie heutzutage ist. In die Mosel führten kleine We-<br />
ge, auf denen man gut spielen oder angeln konnte, <strong>und</strong> wenn man ein Rot-<br />
auge gefangen hatte, wurde es sofort ausgenommen <strong>und</strong> abends gab es<br />
Fisch. Oft bin ich auch mit dem Fährmann zwischen Igel <strong>und</strong> Wasserliesch<br />
unterwegs gewesen. Dieser hat meistens in der anlegernahen Wirtshaft ge-<br />
sessen <strong>und</strong> Viez getrunken. Wenn die Leute nach Wasserliesch, wollten<br />
musste ihn immer erst einer rufen <strong>und</strong> die Leute hatten öfter Wartezeiten von<br />
bis zu 30 Minuten in Kauf zu nehmen. Wenn ich mit dem Fährmann unter-<br />
wegs war, hab ich immer gekurbelt (die Fähre war an einem Seil befestigt<br />
das an einer Kurbel war, da die Fähre keinen Motor hatte). Mich hat es immer<br />
ans Wasser gezogen <strong>und</strong> so bin ich nach meiner Ausbildung zur Marine ge-<br />
gangen <strong>und</strong> zur See gefahren.<br />
Wir freuten uns früher immer auf die Kirmes, die wie das Feuerwehrfest <strong>und</strong><br />
das Fest vom Männergesangsverein ein riesen Spektakel für die Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendlichen war. Ich sparte das ganze Jahr über nur für diese Feste. Ich<br />
arbeite in den Dorfkneipen auf der Kegelbahn. Dort stellte ich die Kegel auf<br />
<strong>und</strong> verdiente mir zwei bis dreimal die Woche was für die Feste.<br />
22
Ansonsten war unser Leben ganz normal <strong>und</strong> schön. Wir hatten zwar nicht<br />
viel aber wir wussten damit auszukommen <strong>und</strong> so verbrachte ich meine<br />
Kindheit <strong>und</strong> Jugend. (Ich - Erzähler: Manfred Bambach)<br />
Erzählung aus den Jahren 1945 - 1950<br />
von Patrick Mohr<br />
Da ich gerne etwas mehr über die Nachkriegszeit von 1945-1950 wissen<br />
wollte <strong>und</strong> ich keine eigenen Großeltern mehr habe, machte ich mich auf den<br />
Weg zu einem alten Ehepaar in meinem Heimatdorf Herl. Herr <strong>und</strong> Frau Ju-<br />
chems wohnen in einem alten Bauernhaus. Als ich sie gefragt habe, ob sie<br />
mir etwas von der Nachkriegszeit berichten könnten, fing Herr Juchems sofort<br />
begeistert an zu erzählen.<br />
Er sprach das Thema Geld in den Jahren 1945 - 48 an. Er berichtete, dass<br />
viele Deutsche meinten, dass die Reichsmark nach der Niederlage nichts<br />
mehr wert sei <strong>und</strong> dass viele Soldaten im Gefangenenlager die Geldscheine<br />
als Toilettenpapier benutzt hätten. Er sprach davon, dass die Amerikaner sich<br />
kaum um Fragen des Geldes kümmerten <strong>und</strong> dass die Franzosen das glei-<br />
che gemacht haben, was die Deutschen in Frankreich taten: sie beschlag-<br />
nahmten für ihre Zwecke ungeheure Mengen an Lebensmitteln <strong>und</strong> Gegens-<br />
tände des täglichen Bedarfs. Frau Juchems, die uns inzwischen einen Tee<br />
gemacht hat erinnert sich, dass das Essen sehr knapp war <strong>und</strong> dass sie nur<br />
ca. 800 Kalorien täglich zu sich nehmen konnte. Mit einer traurigen Stimmla-<br />
ge erwähnt sie, dass im Jahre 1946 auf der Basilika eine Fahne mit einem<br />
Totenkopf gehisst wurde; die Fahne bedeutete, dass in Trier Hungersnot<br />
herrschte. Umso glücklicher wirkte sie, als sie von den Care Paketen aus den<br />
USA <strong>und</strong> Spenden aus der Schweiz erzählte, die das Überleben sicherten.<br />
Als ich das Thema Hamsterfahrten ansprach, meldete sich erneut Herr Ju-<br />
chems zu Wort. Er machte mir klar, dass Stadtbewohner, die keine Bezie-<br />
hungen hatten oder von den Sammelaktionen aus irgendwelchen Gründen<br />
23
ausgeschlossen blieben, “hamstern” gingen. Dieses Hamstern geschah meist<br />
auf dem Lande durch Tausch. So wanderten manche Gegenstände wie sil-<br />
berne Besteckgarnituren, Vasen, Teppiche <strong>und</strong> Porzellanservices von der<br />
Stadt aufs Land. Es gab jedoch auch einen offiziell zugelassenen Tausch-<br />
handel. Frau Juchems ergänzte, dass nicht nur die Zeitungen laufend<br />
Tauschangebote veröffentlichten sondern es gab auch Geschäfte, die sich<br />
gegen eine kleine Gebühr in den Dienst des Tausches stellten. Getauscht<br />
wurde alles wie zum Beispiel Schuhe, Kleider, Geschirr, Zigaretten <strong>und</strong> Wein.<br />
Sie erwähnte ebenfalls einen schwarzen Geldmarkt, auf dem man Gegens-<br />
tände gegen überhöhte Preise erwerben konnte. Diese Form des Handels<br />
war verboten, aber selbst Razzien der Polizei vermochten diese Form der<br />
Geschäftemacherei nicht zu stoppen.<br />
Als am 19. Juni 1948 die Zeitung die Nachricht veröffentlichte, dass am<br />
nächsten Tag die Währungsumstellung erfolgen sollte, war man froh die geld-<br />
lose Zeit überstanden zu haben <strong>und</strong> man war erleichtert, “als man am nächs-<br />
ten Tag 40 DM anstatt 40 RM in den Fingern hatte”. Auch wenn der Lohn ei-<br />
nes Arbeiters nur 1 DM die St<strong>und</strong>e betrug, war man froh wieder sein eigenes<br />
Geld zu haben; Geld das die Freiheit bedeutete. Während Frau Juchems die<br />
damalige Situation schilderte, kramte Herr Juchems ein sehr altes Buch mit<br />
Fotos aus. Wir sahen uns die Fotos gemeinsam an, als Herr Juchems einige<br />
Geldscheine herausschnitt <strong>und</strong> mir überreichte. Ich bedankte mich vielmals<br />
24
<strong>und</strong> macht mich auf den Heimweg. Durch diese Erzählungen wurde mir klar,<br />
dass die Nachkriegszeit eine sehr schwere Zeit war <strong>und</strong> das man solche Er-<br />
fahrungen nicht einfach aus Geschichtsbüchern lernen kann.<br />
Erinnerungen meiner Großmutter<br />
Von Philipp Schad<br />
Meine Oma wurde 1916 in Beuthen/Oberschlesien geboren. Sie lebte dort bis<br />
zu ihrer Hochzeit im Jahre 1937. Danach lebte sie mit ihrem Mann zwölfein-<br />
halb Jahre in Baustert/Eifel <strong>und</strong> zwölfeinhalb Jahre in Messerich/Eifel. Seit<br />
1962 lebt sie in Trier.<br />
Als Hitler an die Macht kam, hatte meine Oma mit ihren 17 Jahren recht we-<br />
nig Interesse an Politik. Sie erinnert sich aber, dass man zu Beginn der NS-<br />
Zeit sehr oft uniformierte Männer der SA beziehungsweise der SS sehen<br />
konnte.<br />
Die Leute wurden sehr stark überwacht <strong>und</strong> so kam es, dass meine Urgroß-<br />
mutter einmal von einem Bekannten gewarnt wurde, dass sie angezeigt wor-<br />
den sei, weil sie über den Führer hergezogen sei <strong>und</strong> dass sie im Wiederho-<br />
lungsfall nach Auschwitz gebracht werden würde. Meine Oma wusste gar<br />
nicht was Auschwitz war, erfuhr aber dann von dem Bekannten dass es sich<br />
dabei um ein Arbeitslager handelte.<br />
Jüdische Geschäfte wurden boykottiert deshalb wurden z.B. in einem jüdi-<br />
schen Geschäft gefälschte Quittungen ausgestellt <strong>und</strong> K<strong>und</strong>en wurden zur<br />
Hintertür rausgelassen.<br />
Zu Beginn des Krieges wohnte meine Oma bereits in der Eifel, wo mein Opa<br />
Lehrer war. Er wurde sehr früh eingezogen. Weil meine Oma 1942 ihr erstes<br />
Kind erwartete, ging sie zurück nach zu ihren Eltern nach Beuthen. Nach ei-<br />
nigen Wochen kehrte sie aber in die Eifel zurück. Meine Oma konnte sich<br />
auch noch daran erinnern, dass man unter Druck gesetzt wurde in die Partei<br />
25
einzutreten, was sie allerdings nicht tat. Als der Krieg dann näher kam <strong>und</strong><br />
die Grenzdörfer bei Leixen ins Hinterland evakuiert wurden zwang mein Opa<br />
sie zu ihren Eltern nach Beuthen zu gehen weil dort die Russen noch weit<br />
weg waren. Als dann im Winter 1945 die Russen sehr schnell näher kamen<br />
floh sie dann zusammen mit ihre Mutter, ihrer Schwester <strong>und</strong> ihrem Kind<br />
nach Fulda wo ihre Schwiegereltern wohnten. Es war keine leichte Zeit, bis<br />
zum <strong>Kriegsende</strong> wohnten sie bei den Schwiegereltern. Als im Sommer der<br />
Krieg zu Ende war freuten sich die Menschen. Die Amerikaner fuhren durch<br />
den Ort <strong>und</strong> gaben den Kindern Süßigkeiten jedoch kann sich meine Oma<br />
noch daran erinnern dass auch jemand von einem Berg aus auf die Amerika-<br />
ner schoss, also das es nach <strong>Kriegsende</strong> immer noch durchaus gefährlich für<br />
die Amerikaner war. Dann ging meine Oma wieder in die Eifel zurück weil<br />
mein Opa dort eine Stelle als Lehrer hatte. Es war nicht leicht zu reisen da-<br />
mals weil die ganze Infrastruktur zerstört war, deswegen musste man oft per<br />
Anhalter fahren. In einem Ort an der Mosel wollte meine Oma übernachten<br />
deshalb fragte sie den Bürgermeister wo man übernachten könne dieser gab<br />
ihr zwar eine Adresse allerdings ging das doch nicht <strong>und</strong> sie musste mit mei-<br />
ner Tante in einem abgestellten Eisenbahnwaggon übernachten. Am nächs-<br />
ten Tag wurde die Fahrt per Anhalter mit einem Laster fortgesetzt.<br />
In Baustert freute sich der Schulrat über die Ankunft des Lehrers mit seiner<br />
Familie, weil die Lehrerwohnung sonst für Flüchtlinge hätte freigegeben hätte<br />
werden müssen.<br />
Mein Vater<br />
von Vera Winden<br />
Mein Vater, Heinz Winden, erzählte mir diese Nachkriegserinnerung:<br />
„Im Februar des Jahres 1942, ca. neun Monate vor meiner Geburt, wurde die<br />
Armee meines Vaters von Frankreich an die Ostfront verlegt. Etwa zwei Jah-<br />
26
e später, ohne zwischenzeitlichen Heimaturlaub, geriet er dort in der Nähe<br />
der russischen Stadt Saporosche in Kriegsgefangenschaft.<br />
Zu dieser Zeit wohnte ich mit meiner Mutter <strong>und</strong> meinen beiden älteren Ge-<br />
schwistern in Weibern, einem kleinen Eifeldorf bei Mayen. Über den Verbleib<br />
meines Vaters, ob er überhaupt noch lebte, war nichts bekannt. Damals war<br />
mir nur vom Erzählen meiner Mutter, meiner Geschwister <strong>und</strong> der Leute im<br />
Dorf bewußt, dass ich einen Vater haben musste. Ich versuchte mir oft vorzu-<br />
stellen, wie er aussehen könnte <strong>und</strong> wie er lebte, doch dass ich ihn jemals<br />
sehen <strong>und</strong> mit ihm leben würde, konnte ich mir nicht vorstellen.<br />
1946 erhielt meine Mutter endlich die Nachricht, dass Vater lebte. Später kam<br />
alle 5 Monate ein zensierter Brief von ihm, den uns Mutter immer andächtig<br />
vorlas. Ich werde nie vergessen, in jedem Brief stand die Ermahnung an uns<br />
Kinder: “ Zuerst die Arbeit, dann das Spiel!“<br />
1948 hatte mein Bruder Kinderkommunion. Mutter weinte in diesen Tagen<br />
des öfteren, wenn sie sich unbeobachtet glaubte. Sonntagsmorgen auf dem<br />
Weg zur Kirche habe ich sie dann gefragt, warum sie Tränen in den Augen<br />
habe, worauf sie antwortete: „Weil Vater jetzt nicht bei uns sein kann." Dies<br />
habe ich damals nicht so richtig verstanden, weil Vater mir eben unbekannt<br />
war <strong>und</strong> der Begriff „Vater“ mir deshalb wenig bedeutete.<br />
Ein Jahr später, 1949, kamen Leute aus dem Dorf ziemlich aufgeregt zu mei-<br />
ner Mutter <strong>und</strong> berichteten, im Radio sei eine Liste von deutschen Kriegsge-<br />
fangenen in Russland vorgelesen worden, die demnächst freigelassen wür-<br />
den, <strong>und</strong> der Name meines Vaters sei auch genannt worden.<br />
Wir besaßen damals kein Radio, doch in unserem Haus wohnte eine Fami-<br />
lie zur Miete, die einen alten Volksempfänger aus Vorkriegszeiten bewahrt<br />
hatte. An den folgenden Tagen waren immer alle Zimmertüren im ganzen<br />
Haus geöffnet <strong>und</strong> das Radio unaufhörlich so laut gestellt, dass die Nachrich-<br />
ten sogar auf der Straße zu hören waren. Etwa vier Wochen später war es<br />
soweit. Die Leute sprachen mich immer wieder an <strong>und</strong> meinten: „In den<br />
27
nächsten Tagen kommt dein Vater! Übermorgen, morgen siehst du zum ers-<br />
tenmal deinen Vater!"<br />
Ich hatte jedoch immer dieses unwohle Gefühl, weil ich mir unter "Vater" <strong>und</strong><br />
seiner Person kaum etwas vorstellen konnte. Ich wusste nur, dass er, bevor<br />
er in den Krieg gezogen war, im Dorf ein geschätzter Mann gewesen sein<br />
musste, so respektvoll wie die Leute von ihm sprachen.<br />
Am nächsten Morgen, gegen 8.30 Uhr, kam dann der Linienbus von Brohl am<br />
Rhein, in dem Vater saß. Er hatte einen Stoppelbart <strong>und</strong> trug eine seltsam<br />
aussehende, gesteppte Wamsjacke - wie ich später erfuhr: eine typisch rus-<br />
sische Jacke.<br />
Ich hatte richtige Angst vor diesem unbekannten <strong>und</strong> fremd aussehenden<br />
Mann. Er umarmte Mutter stumm, nahm mich gleichzeitig auf seinen Arm <strong>und</strong><br />
drückte <strong>und</strong> küsste uns unablässig. Doch umso mehr steigerten sich in mir<br />
Unbehagen <strong>und</strong> Angst.<br />
Dann kamen meine älteren Geschwister aus der Schule gelaufen. Meine<br />
Großeltern, Verwandte <strong>und</strong> viele Leute aus dem Dorf stellten sich ein, um Va-<br />
ter zu begrüßen. An den folgenden Tagen war in unserem Haus ein Kommen<br />
<strong>und</strong> Gehen. Wir Kinder wurden häufiger aus der guten Stube auf die Straße<br />
zum Spielen geschickt. Ich habe erst später erfahren, dass Vater dann<br />
Schlimmes erzählte, was wir Kinder nicht hören sollten, wie sie beispielswei-<br />
se als Gefangene gequält <strong>und</strong> geschlagen worden sind.<br />
Von St<strong>und</strong>e zu St<strong>und</strong>e wurde mein Vater mir vertrauter. Nach einigen Tagen<br />
bin ich mit ihm, seine Hand nicht mehr loslassend, durch das ganze Dorf,<br />
durch alle Straßen <strong>und</strong> in viele Häuser gegangen, voller Stolz nun auch wie<br />
andere Kinder einen Vater zu haben."<br />
28
Hochzeitsvorbereitungen im Jahre 1946<br />
von Friederike Mertes<br />
Meine Oma erzählt:<br />
Wir kamen beide 1945 in unsere Heimatorte aus dem Krieg zurück. Ich, Ma-<br />
ria Schmitt, damals 21 Jahre alt, wohnhaft in Ruwer, kam zu Fuß von Nürn-<br />
berg aus dem Arbeitsdienst nach Hause. Mein spätere Mann, Heinrich Schol-<br />
tes kehrte etwa zur gleichen Zeit als Soldat der Westfront über das Ruhrge-<br />
biet in seinen Heimatort Kasel zurück.<br />
Wie das Leben so spielt lernten wir uns beim Tanz in Ruwer kennen <strong>und</strong> lie-<br />
ben. Wir beschlossen schließlich Ende 1946 zu heiraten. Unsere Hochzeit<br />
sollte trotz den eingeschränkten Möglichkeiten der Nachkriegszeit ein richti-<br />
ges Fest werden. Für mich wurde das Brautkleid meiner Mutter umgenäht,<br />
was kein großes Problem darstellte, denn meine Tante konnte gut nähen.<br />
Aber wie sollte mein Zukünftiger eingekleidet werden? Von irgend jemand<br />
erfuhren wir, dass eine Kriegswitwe bereit war, den Hochzeitsanzug ihres ge-<br />
fallenen Mannes zu verkaufen. Nach Rücksprache mit ihr, vereinbarten wir<br />
Folgendes: Für 10 Liter Rapsöl sollte der Anzug uns gehören. Nun musste<br />
mein Verlobter irgendwie das Rapsöl besorgen. Er arbeitete als Dachdecker<br />
im Betrieb seines Vaters. So schloss er mit einem Bauern aus Kenn folgen-<br />
den Handel: Er deckte das Dach von dessen Haus <strong>und</strong> erhielt als Gegenleis-<br />
tung einen halben Zentner ( 25 kg ) Raps. In Kasel lieh er sich bei einem an-<br />
deren Bauern eine Ölmühle aus, dieser verlangte wiederum für das Ausleihen<br />
einen Liter Öl. Schließlich blieben ihm noch 7 Liter Rest. Die Frau gab ihm<br />
Gott sei Dank auch dafür den Anzug. Jetzt fehlten ihm nur noch die Schuhe.<br />
Meine Nachbarin in Ruwer reiste regelmäßig nach Pirmasens <strong>und</strong> versprach,<br />
ihm ein Paar Lederschuhe zu besorgen. Tatsächlich brachte sie ihm Schuhe<br />
mit - jedoch für einen Preis von sage <strong>und</strong> schreibe 1000 RM. Geld besaß<br />
Heinrich durch seine Arbeit ja genug, obwohl er sich in dieser Zeit lieber in<br />
Naturalien bezahlen ließ. Nun war die Kleiderfrage gelöst.<br />
29
Ich wollte natürlich auch Kuchen, Wein <strong>und</strong> ein gutes Essen für die Gäste.<br />
Mein Zukünftiger konnte sich seine Arbeit mit Wein, Kartoffeln <strong>und</strong> bei einem<br />
Bauern sogar mit einem großen Stück Rindfleisch entlohnen lassen. Zum gu-<br />
ten Kuchen fehlte nur noch Weizenmehl. Da bot sich mir die Gelegenheit bei<br />
einem Bauern im Ort bei der Ernte mitzuhelfen. 14 Tage arbeitete ich von<br />
morgens in der Frühe bis spät am Abend auf den Feldern <strong>und</strong> erhielt schließ-<br />
lich einen halben Zentner Weizen. Ich war überglücklich. Ganz in unserer<br />
Nähe war eine Mühle. Dorthin brachte ich auch direkt das Getreide zum Mah-<br />
len. Zu meiner Überraschung erhielt ich für den Weizen wieder genau einen<br />
halben Zentner Mehl. Der Müller verlangte keines als Mahllohn für sich, es<br />
war sein Hochzeitsgeschenk an uns. Darüber waren wir überaus erfreut,<br />
denn so hatten wir noch Mehlreserven über die Hochzeit hinaus, obwohl für<br />
alle genügend Kuchen gebacken werden konnte. Schließlich konnten wir am<br />
16. November 1946 in angemessener Kleidung vor den Priester treten <strong>und</strong><br />
anschließend mit unseren Familien <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en ein w<strong>und</strong>ervolles Fest fei-<br />
ern, an dem alle genügend zu essen <strong>und</strong> Wein zu trinken hatten.<br />
Erlebnisse in der Nachkriegszeit<br />
von Simon Schmidt<br />
Kriegsausbruch, Gefangennahme, Freilassung, Schwarzmarkt <strong>und</strong> Wäh-<br />
rungsreform – „Das Beste war die Gefangenschaft“ sagt Karl Kaiser (80).<br />
Bei der Währungsreform im Julie 1948 waren sie Mitte 20. Zu welchem Stand<br />
gehörte ihre Familie <strong>und</strong> hatten Sie Probleme mit der Entnazifizierung <strong>und</strong><br />
der Erschaffung eines Persilscheins?<br />
Herr Kaiser: Wir waren Landwirte, nicht reich <strong>und</strong> nicht arm. In meiner Familie<br />
gab es keine Probleme so ein Schein zu bekommen. Sie waren gegen die<br />
30
Nazis. Ein Bruder von mir war Soldat, aber er ist gefallen <strong>und</strong> ich war fast<br />
während des ganzen Krieges in Gefangenschaft.<br />
Wie kamen sie in die Gefangenschaft <strong>und</strong> wie lange waren sie gefangen?<br />
Herr Kaiser: 1941 wurde ich in Afrika von Franzosen gefangengenommen.<br />
Ich war beim Nachrichtendienst . Ich wurde gerade einer Abhörpatrouille zu-<br />
geteilt. Mehrere Kollegen mussten den Franzosen Koordinaten deutscher<br />
Schiffe sagen, die sie dann abgeschossen haben. Zum Glück wurde ich 1947<br />
erst wieder entlassen.<br />
Sie sagen zum Glück. War die Gefangenschaft nicht schlimm?<br />
Herr Kaiser: Nein, ganz im Gegenteil. Nach den Genfer Konfessionen durften<br />
die Gefangenen ja nicht arbeiten. So gab es immer gutes Essen <strong>und</strong> wir<br />
spielten den ganzen Tag nur Fußball. Das ist wohl auch der Gr<strong>und</strong> warum<br />
Deutschland 1954 Weltmeister wurde. Na ja, das war aber auch nur in Ame-<br />
rika in Texas so. Wir wurden ja von den Franzosen gefangen genommen,<br />
dann kamen wir nach England <strong>und</strong> dort wurde uns erst mal alles wegge-<br />
nommen. Ringe, Uhren <strong>und</strong> auch meine Mütze. Erst danach kamen wir nach<br />
Amerika. Später dann nach Frankreich <strong>und</strong> wurden dann aus der Haft entlas-<br />
sen.<br />
Hatten Sie Probleme ihre Familie wiederzufinden?<br />
Herr Kaiser: Nein. Meine Familie lebte ja auf dem Land <strong>und</strong> musste nicht<br />
flüchten.<br />
Haben sie viel vom Schwarzmarkt mitbekommen oder haben sie auch selber<br />
gehandelt?<br />
Herr Kaiser: Wir hatten kaum etwas zum tauschen <strong>und</strong> wir konnten uns ja<br />
fast selbst versorgen, aber da die Franzosen uns viel abgenommen haben<br />
mussten wir natürlich auch handeln. Ein Lehrer den ich gut kannte hat uns<br />
mal gewarnt das es am nächsten Tag eine Razzia geben wird, deshalb habe<br />
31
ich in der Nacht schnell zwei Kartoffelsäcke in der Scheune im Heu versteckt<br />
die wir im Keller hatten, damit die uns die nicht abgeholt werden.<br />
Hatten sie viel Geld <strong>und</strong> eine Arbeit? Es war bestimmt schwer eine zu finden<br />
da man erst nachweisen musste das man Entnazifiziert ist <strong>und</strong> mehrere<br />
Nachweise vorlegen musste wie einen amtsärztlichen Artest u.a.?<br />
Herr Kaiser: Es hat ziemlich lange gedauert bis ich eine Arbeit bekommen<br />
hatte. Als wir frei gekommen waren wurden wir zur Bernkastler Brücke ge-<br />
schickt um sie wieder aufzubauen, doch mein Chef meinte das er mich nicht<br />
gebrauchen könnte. Ich habe ja eine Ausbildung als Kaufmann gemacht <strong>und</strong><br />
später hatte ich eine Stelle in der Bezirksregierung, also damals hieß sie<br />
noch Versorgungszentrale, wieder durch die Hilfe des Lehrers bekommen.<br />
Das war aber schon 1950. 130 DM habe ich dort verdient, aber später gab es<br />
dann 7% <strong>und</strong> dann 11% Gehaltserhöhung.<br />
Sie sprechen schon die DM an. Waren Sie bei der Reform ´48 dafür oder da-<br />
gegen?<br />
Herr Kaiser: Also, ich war nicht dafür <strong>und</strong> nicht dagegen. Ich nahm es halt wie<br />
es kam.<br />
Wie wurde die neue Währung eingeführt? Gab es Probleme? Konnte man<br />
sich schnell daran gewöhnen?<br />
Herr Kaiser: Ich denke man hatte weniger Probleme als mit der Einführung<br />
des Euros. Man hat 40 DM bekommen <strong>und</strong> davon habe ich mir erst einmal<br />
einen Anzug gekauft. Vorher hatte ich immer meistens meinen früheren Ge-<br />
fangenenanzug an, auf dem noch AP (American Prisoner) auf dem Rücken<br />
stand.<br />
Die noch altes Geld auf dem Konto hatten, bei denen wurde es noch 1 zu 10<br />
(eine DM zu 10 RM) umgetauscht, aber ich hatte ja nichts. Ich hatte noch et-<br />
was Amerikanisches Geld, das ich während meiner Gefangenschaft für 8<br />
Cent pro Tag erarbeitet hatte.<br />
32
Das musste ich aber bei der Landeszentralbank wechseln. Das war ein weiter<br />
Fußmarsch. Ich musste öfters lange gehen. Als ich geheiratet hatte musste<br />
ich eine Wohnung suchen. Da bin ich von Trier bis nach Longuich immer den<br />
Eisenbahnschienen nach gegangen <strong>und</strong> in jedem Dorf nach einer Mietwoh-<br />
nung gefragt, aber die meisten sagten: „So was kenne ich nicht“.<br />
Hat sich der Wohlstand schnell bei ihnen eingeführt? Oder insgesamt bei der<br />
Bevölkerung?<br />
Herr Kaiser: Nein. Das ging alles ganz langsam. Nachdem die Währung ein-<br />
geführt wurde war ich in einer Wirtschaft in Trier essen <strong>und</strong> ich muss sagen<br />
das Essen war ganz schlecht. Wir nannten das immer das motorisierte Es-<br />
sen. Da die Maden immer die Bohnen bewegten. Wir haben deshalb immer<br />
ein großes r<strong>und</strong>es Bauernbrot gekauft <strong>und</strong> das reichte dann eine ganze Wo-<br />
che, auch wenn es ziemlich hart wurde, es war immer noch besser als das<br />
Essen in der Wirtschaft. Aber die Geschäfte waren auf einmal wieder voll mit<br />
vielen verschiedenen Sachen. Die Besitzer haben wohl das ganze Zeug ge-<br />
hamstert <strong>und</strong> versteckt <strong>und</strong> jetzt wieder hervorgeholt.<br />
Gab es nach der Einführung der neuen Währung noch den Schwarzmarkt?<br />
Herr Kaiser: Nein. Jeder konnte sich jetzt das kaufen, was er wollte.<br />
Was war für Sie die schlimmste Zeit oder was war für Sie die schönste?<br />
Herr Kaiser: Ich habe es sicherlich verhältnismäßig sehr gut gehabt. Von den<br />
ganz schlimmen Zeiten habe ich nichts mitgekriegt <strong>und</strong> meine Familie hat es<br />
auch nicht sehr getroffen. Da ging es denen in der Stadt viel schlechter. Als<br />
ich frei gelassen wurde war es wohl am Schlimmsten <strong>und</strong> das Beste war die<br />
Gefangenschaft.<br />
33
Die Not ist groß<br />
Das Leben im verminten Deutschland nach dem Krieg<br />
von Severin Justen<br />
Auf der Naumeter Kupp bei Waldrach steht ein Kreuz. Was hat es damit auf<br />
sich?<br />
Als nach dem Krieg die Straßen <strong>und</strong> Brücken zerstört waren, wurden diese<br />
lange Zeit nicht wieder aufgebaut.<br />
Die meisten Häuser waren zerstört <strong>und</strong> provisorisch wieder aufgebaut, die<br />
Nahrung war knapp <strong>und</strong> schwer zu beschaffen.<br />
Daher mussten Menschen, die von Dorf zu Dorf, oder etwa nach Trier woll-<br />
ten, querfeldein, kilometerweit über Berge <strong>und</strong> Felder oder durch den Wald<br />
gehen. So geschah es, dass am 20. März 1950 drei Jungen im Alter von etwa<br />
12-14 Jahren ihr Vieh, welches den Krieg überlebt hatte, bzw. neu hinzuge-<br />
boren wurde über die Naumeter Kupp führte, um es dort weiden zu lassen.<br />
Dort entdeckten sie eine große Menge an Munition <strong>und</strong> Geschützen aus den<br />
Kriegsjahren. Natürlich wurden die Jungs sehr neugierig, <strong>und</strong> sahen sich dies<br />
einmal genauer an. Doch beim Spielen mit den Waffen entzündete sich etwas<br />
<strong>und</strong> mit all den Munitionsrückständen sprengte sich das Gelände durch den<br />
Ablauf einer Kettenreaktion fast völlig in die Luft.<br />
Alle drei Kinder kamen bei diesem Unglück ums Leben. Dort wo sich all das<br />
abspielte, erinnert nun ein Kreuz als Mahnmal an den Krieg <strong>und</strong> das schreck-<br />
liche Unglück.<br />
Nach dem Krieg, in der Besatzungszeit, war die Erde übersät mit nicht explo-<br />
dierten Minen <strong>und</strong> Granaten <strong>und</strong> hinterlassenen, scharfen Waffen. Außer in<br />
Ortschaften wurde sonst fast nirgendwo richtig geräumt.<br />
Deshalb war dies keineswegs ein Einzelfall, sondern eher ein Vorfall, der<br />
trauriger Weise schon beinahe zum alltäglichen Geschehen gehörte.<br />
34
Tausende Menschen wurden noch nach dem Krieg Opfer von Unmengen an<br />
Minen <strong>und</strong> Blindgängern. Unzählige Kinder fanden durch das Spielen mit<br />
Granaten <strong>und</strong> Handfeuerwaffen im Gelände den Tod, denn oft hantierten sie<br />
damit herum, ohne zu ahnen, was für ein Schicksal sie meist erwartete.<br />
Nach einer Erzählung von Elfriede <strong>und</strong> Josef<br />
Marx, ehemaliger Ortsbürgermeister von Korlin-<br />
gen, die sich an das Leben als Kinder mit ihren<br />
Fre<strong>und</strong>en im zerstörten Deutschland nach 1945<br />
erinnern.<br />
Die Situation im Dorf meiner Großmutter<br />
von Johannes Gorges<br />
Kurz vor Ende des Krieges rückten die Amerikaner auf ihrem Vormarsch in<br />
Osann ein. Kinder lagen auf der Straße <strong>und</strong> hielten ein Ohr auf den Boden,<br />
um dem immer näherkommenden grollenden Getöse der Panzerketten zu<br />
lauschen. Als die Panzer <strong>und</strong> Transporter im Dorf eintrafen, zogen die Kinder<br />
sich ängstlich in die Hausnischen zurück. Zum erstenmal erblickte man farbi-<br />
ge Männer („Schwarze“). Dies vergrößerte ihre Angst noch mehr.<br />
35
Es begann ein neues Leben für die Bevölkerung. Zunächst wurde die Zivilbe-<br />
völkerung aus der noch umkämpften Frontlinie zurück gezogen. Alle waren<br />
glücklich über das Ende des Krieges, man hatte jedoch große Angst vor Ver-<br />
geltung. Dies war unter anderem damit begründet, dass viele Juden in dem<br />
Dorf wohnten <strong>und</strong> man wusste was ihnen zugefügt wurde. Große Angst vor<br />
der Reaktion der Amerikaner kam auf. Diese waren jedoch eher fre<strong>und</strong>lich<br />
<strong>und</strong> schenkten zum Beispiel Kindern Kaugummi <strong>und</strong> Erwachsenen Zigaret-<br />
ten.<br />
Die Bevölkerung musste sich aber auch an neue Dinge gewöhnen, wie eine<br />
Sperrst<strong>und</strong>e, bei der ab 18 Uhr bis 6 Uhr niemand mehr auf die Straßen durf-<br />
te.<br />
Bald begannen die Amerikaner mit der Entnazifizierung. Dabei kam es zu ei-<br />
ner Verhaftungswelle, bei der alle, die etwas mit der NSDAP zu tun hatten,<br />
verhaftet wurden.<br />
Jedes Haus wurde von acht bewaffneten Amerikanern nach versteckten Sol-<br />
daten oder Parteimitgliedern durchsucht. Die Verständigung erfolgte über ei-<br />
nen Offizier, der deutsch sprach oder sie fragten die Frauen immer: „Wo ist<br />
dein Mann?“<br />
Verdächtige wurden gefangen genommen <strong>und</strong> nach Trier auf den Petrisberg<br />
gebracht, von dort kamen sie nach Idar-Oberstein <strong>und</strong> letztendlich nach Diez<br />
an der Lahn, wo sie in Tongruben arbeiten mussten (Internierung). Angehöri-<br />
ge wussten nicht, wohin die Verhafteten gebracht worden waren <strong>und</strong> durften<br />
sie auch nicht besuchen. Kontakt war nur durch das Schmuggeln von Briefen<br />
aus <strong>und</strong> in das Lager möglich.<br />
Während der Gefangenschaft wurden die Daten der Inhaftierten überprüft<br />
<strong>und</strong> wer nichts Auffälliges aufwies, wurde nur als „Mitläufer“ eingestuft <strong>und</strong><br />
musste ein Sühnegeld bezahlen. Sie wurden dann auch bald aus der Gefan-<br />
genschaft entlassen. Andere wurden nach England <strong>und</strong> Amerika in Haft ge-<br />
nommen.<br />
36
Die Angehörigen der Parteimitglieder hatten derweilen mit der Beschlagnah-<br />
mung ihrer Möbel zu tun. Dabei musste man belegen, dass die Dinge<br />
rechtsmäßig erworben worden waren. Nur so war es möglich, dass die Möbel<br />
bald wieder zurückgegeben wurden. Bei einigen Bauern wurde das Vieh aus<br />
den Ställen getrieben <strong>und</strong> abtransportiert.<br />
Andere mussten mit der Versorgung ihrer täglichen Lebensunterhalte kämp-<br />
fen. Dabei machte man Hamsterfahrten in die Stadt, bei denen Dinge wie<br />
Butter, Milch oder Fleisch gegen Kleidung <strong>und</strong> Schuhe getauscht wurden. Um<br />
den Lebensunterhalt zu sichern, mussten viele in den „Frondienst“ gehen, bei<br />
dem sie für wenig Geld hart arbeiteten.<br />
Zu den großen materiellen Problemen kam bei vielen Frauen die Ungewiss-<br />
heit über den Verbleib ihrer Männer hinzu. Man wusste nicht, ob sie im Krieg<br />
gefallen oder als Kriegsgefangene inhaftiert waren. Dies führte neben dem<br />
Kampf ums tägliche Überleben zu großem seelischem Leid. Auch sammelten<br />
viele Jungen im Dorf zurückgebliebene scharfe Munition <strong>und</strong> spielten damit.<br />
Dabei kam es zu tragischen Unfällen, bei denen die Kinder schwere Verlet-<br />
zungen erlitten.<br />
Durch die Aufteilung der Siegermächte wurde der Ort der französischen Be-<br />
satzungszone zugeteilt. Die französischen Soldaten mussten mit ernährt<br />
37
werden. Sie kontrollierten die Lebensmittelversorgung <strong>und</strong> den Viehbestand.<br />
Dies führte dazu, dass z.B. heimlich („schwarz“) Schweine unter primitiven<br />
Bedingungen im Keller geschlachtet wurden.<br />
Vom Krieg verschont <strong>und</strong> dennoch arm<br />
von Thomas Hank<br />
Meine Oma Martha, die in der Nachkriegszeit fast so alt war, wie ich es heute<br />
bin, erinnert sich an diese Zeit so:<br />
Glücklicherweise waren unser Haus <strong>und</strong> Hof weitgehend verschont geblie-<br />
ben. Armut <strong>und</strong> Not waren zwar groß aber den Leuten, die keine Verbindung<br />
zur Landwirtschaft hatten, - meine Urgroßeltern hatten einen großen Bauern-<br />
hof, betrieben Weinbau <strong>und</strong> eine Schnapsbrennerei - erging es noch schlech-<br />
ter.<br />
Tagtäglich seien Menschen aus Trier <strong>und</strong> Umgebung mit einem leeren Kin-<br />
derwagen oder Handkarren gekommen <strong>und</strong> baten um Nahrung. Meine Ur-<br />
großeltern versorgten alle mit Mehl, Brot, Eiern, Kartoffeln <strong>und</strong> Gemüse aus<br />
dem Garten ohne Gegenleistungen zu verlangen. Einen Hamstertausch gab<br />
es also nicht.<br />
Folgende Erlebnisse aus dieser Zeit sind ihr besonders in Erinnerung geblie-<br />
ben. Im Nachbardorf Osburg wurde das Dach von einem Haus abgedeckt.<br />
Mein Uropa tauschte für Schnaps, den er während dem Krieg schwarz ge-<br />
brannt <strong>und</strong> hinter dem Haus vergraben hatte, Ziegel ein, <strong>und</strong> half so das<br />
Dach neu zu decken.<br />
In Morscheid, ein anderer Nachbarort, starben viele Menschen durch Bom-<br />
benangriffe. Sie wurden oft nur im Garten vergraben. Nach dem Krieg wurden<br />
sie wieder ausgegraben, um auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe zu finden.<br />
Holz <strong>und</strong> Bretter waren Mangelware. Uropa handelte einen Wagen mit Bret-<br />
tern zusammen <strong>und</strong> fuhr diesen nach Morscheid, um Särge zu zimmern.<br />
38
Es sei eine schwierige Zeit gewesen, fasst meine Oma, ihre Erinnerungen<br />
zusammen. Bis heute kann sie nicht verstehen, dass es damals auch Leute<br />
gab, die die Not ihrer Mitmenschen ausgenutzt haben <strong>und</strong> sich mit Möbeln,<br />
Schmuck <strong>und</strong> Wäsche haben bezahlen lassen. In dieser Zeit entstanden<br />
Kontakte <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>schaften zu Leuten aus Trier <strong>und</strong> Umgebung, die bis<br />
heute bestehen, obwohl schon einige Generationen dazwischen liegen.<br />
Unmittelbare Nachkriegszeit aus der Sicht meiner Oma<br />
von Nina Maier<br />
Bei <strong>Kriegsende</strong> war meine Oma elf Jahre alt. Sie lebte mit ihren Eltern <strong>und</strong><br />
ihren acht Geschwistern in Ruwer. Die fünf Brüder meiner Oma waren im<br />
Krieg. Zwei davon waren in russischer Gefangenschaft <strong>und</strong> ihr ältester Bru-<br />
der, der bei der Marine war, ist gefallen.<br />
Musstet ihr evakuiert werden?<br />
Nein, nicht direkt. Aber nachdem unser Haus am 24. Dezember 1944 durch<br />
einen Bombenangriff zerstört wurde, mussten wir zu der Cousine meiner Mut-<br />
ter umziehen.<br />
War in dem neuen Haus denn überhaupt genug Platz für euch alle?<br />
Obwohl meine fünf Brüder noch im Krieg waren, war es sehr eng, weil unse-<br />
rer Familie nur ein Schlafzimmer zustand. Die Küche mussten sich unsere<br />
Familien teilen, ebenso wie das Klo außerhalb des Hauses.<br />
Du bist doch damals noch zur Schule gegangen. Hast du auch etwas von den<br />
Schulspeisungen mitbekommen?<br />
Ja, natürlich. Meistens gab es Suppen, zum Beispiel Kartoffel- oder Erbsen-<br />
suppe. Manchmal gab es auch nur Butterbrote mit Wasser <strong>und</strong> Kakaopulver.<br />
Das alles gab es natürlich nur in kleinen Rationen, weil wir sehr viele Kinder<br />
in einer Klasse waren.<br />
Damals war ja alles sehr knapp, sogar das Papier. Hattet ihr denn genügend<br />
Schreibutensilien?<br />
39
Meine drei Geschwister <strong>und</strong> ich hatten noch nicht einmal einen Schulranzen.<br />
Wir mussten unsere Schulbücher mit einer Schnur zusammenbinden. Ich hat-<br />
te dann noch eine kleine Tafel mit Griffel. Das war aber auch alles. Später<br />
haben mein jüngerer Bruder <strong>und</strong> ich jeweils eine Schere bekommen.<br />
Hast du auch an Hamsterfahrten teilgenommen?<br />
Nicht so direkt. Als mein Bruder aus der Gefangenschaft zurückkehrte, brach-<br />
te er einen Fre<strong>und</strong> mit, der dann für ein paar Tage bei uns übernachtete. Mit<br />
diesem jungen Mann, dessen Eltern einen Bauernhof hatten, waren wir<br />
„hamstern“. Meine Geschwister <strong>und</strong> ich sind damals durch Wald <strong>und</strong> Felder<br />
zu ihrem Haus marschiert. Dort haben wir dann Kleidung gegen einen Sack<br />
Kartoffeln eingetauscht. Abends sind wir dann wieder zurück gegangen. So<br />
richtige Hamsterfahrten gab es eher in den Städten.<br />
Hast du auch noch Erinnerungen an den Schwarzmarkt?<br />
Ja, aber sehr wenige. Ich war ja damals noch sehr jung. Mein Vater hat dort<br />
oft Kaffee, den wir aus Eicheln geröstet hatten, gegen Butter, Eier, Schinken<br />
oder sonstige Sachen eingetauscht. Da mein Vater auch rauchte, hatte er<br />
manchmal, einen Teil der getauschten Sachen wieder gegen Zigaretten ein-<br />
getauscht, weil diese damals sehr rar waren.<br />
Die Lebensmittelmarken waren die offiziellen Tauschmittel. Haben diese<br />
denn nicht ausgereicht?<br />
Nein, nicht so richtig. Die Rationen waren sehr klein. Aber da mein Vater ein<br />
Schwerstarbeiter war, bekamen wir ja eine zusätzliche Ration. Auch Bekann-<br />
te von uns hatten einen Bauernhof. In der Not haben sie uns, wenn auch<br />
nicht viel, ausgeholfen.<br />
40
Langsur in den <strong>Nachkriegsjahre</strong>n von 1945-1948<br />
von Johannes Bauer<br />
Etwa zwei Drittel des Landbesitzes der Langsurer Einwohner stehen unter<br />
der Sequester, d.h. sie werden von einigen Luxemburger Männern im Auftrag<br />
ihrer Regierung als sog. „Feindvermögen“ vorläufig verwaltet, wie es heißt bis<br />
zu einem endgültigen Friedensschluß. Was diese „Verwaltung“ für die Ein-<br />
wohner bedeutet, sollten sie bald erfahren, als Weinberge <strong>und</strong> Ländereien,<br />
die außerhalb des geschlossenen Bannes auf der anderen Seite lagen, also<br />
vor allem von Wasserbillig nach Mertert zu, öffentlich versteigert wurden. An<br />
eine Vergütung an die eigentlichen Besitzer in Langsur war natürlich gar<br />
nicht erst zu denken.<br />
Der geschlossene Bann gegenüber Langsur sollte vorerst nicht versteigert<br />
werden, denn es schien bei den „Siegern“ noch einige Bedenken zu beste-<br />
hen. Das Land jedoch durfte auch nicht von den Bauern bebaut werden, da-<br />
für war das Gefangenengut Givenich bei Mompach zuständig. Daraufhin ver-<br />
suchte der damalige Pfarrer der Gemeinde Langsur mit einigen Männern bei<br />
der Gemeindevertretung von Wasserbillig die ersten Besprechungen über<br />
den verbleib der Felder in gang zu bringen. Es ist das erste Mal das die klei-<br />
41
ne Truppe einen Teil des Schadens erblickt welcher von den sinnlosen<br />
Sprengungen der Deutschen angerichtet wurde. Das gesamte Kanalnetz war<br />
durch die Hauptstraße gesprengt <strong>und</strong> auch alle Häuser waren von der ver-<br />
heerenden Explosion in Mitleidenschaft gezogen worden. Alle Eisenbahn-<br />
übergänge <strong>und</strong> ein teil der Fabrik waren gesprengt <strong>und</strong> größtenteils zerstört.<br />
Doch Luxemburg begann sich schon wieder zu erholen, die Menschen dort<br />
lebten um einiges besser als die besiegten Deutschen. Die vielen Waren <strong>und</strong><br />
so lange schmerzlich vermissten Sachen wie Kaffee <strong>und</strong> Zigaretten gab es<br />
hier, zwar zu unbezahlbaren Preisen, aber dennoch erweckte der bloße An-<br />
blick Erinnerungen an längst vergessene Zeiten des Friedens.<br />
Trotz des angerichteten<br />
Schadens wurde man<br />
als Langsurer fre<strong>und</strong>-<br />
lich aufgenommen <strong>und</strong><br />
in der Gemeindever-<br />
tretung zeigte man<br />
Verständnis für die<br />
verheerende Lage in<br />
der sich die Bauern <strong>und</strong><br />
das ganze Dorf befand, deshalb wurde versichert die Bitte der Langsurer bei<br />
der Luxemburgischen Regierung „günstig“ vorzutragen. Doch leider konnte<br />
trotz aller Bemühungen nur erreicht werden das Politisch „unbelastete Leute“<br />
die Weinberge auf der anderen Seite pachtweise zurückerhielten <strong>und</strong> bebau-<br />
en durften. An das eigentliche Land welches wegen der mangelnden Nah-<br />
rung so wichtig gewesen wäre war in diesem Augenblick noch nicht zu den-<br />
ken. Nach <strong>und</strong> nach wollten immer mehr Ortsbewohner diese begehrten<br />
Pachtausweise, doch da nur wenige sie erhielten gab es böses Blut unter den<br />
Bewohnern <strong>und</strong> doch war von der Ortsleitung alles getan worden um die Sa-<br />
che gerecht <strong>und</strong> zum Wohle aller zu klären. Die entscheidenden Männer je-<br />
doch saßen in Luxemburg was die „Besiegten“ zu Mittellosen Zuschauern<br />
42
machte. So war es fast selbstverständlich das die glücklichen die an den<br />
Kontrollen vorbei rüber nach Luxemburg kamen die Möglichkeit nutzten <strong>und</strong><br />
so genannte Mangelware besorgten <strong>und</strong> hinter der Grenze Verkauften. Das<br />
war keine Schwierigkeit, denn es fehlte an allem: Schuhriemen, Kleider, Kaf-<br />
fee bis zum Kragenkopf. Doch nicht jeder Schmuggler blieb unentdeckt, <strong>und</strong><br />
so landete so mancher hinter Gittern.<br />
Ende 1946 <strong>und</strong> Anfang 1947 bekamen fast alle ehemaligen Weinbergbesitzer<br />
ihre Pässe <strong>und</strong> größte Zufriedenheit trat ein. Doch leider wurde immer noch<br />
ein Großteil des für den Wiederaufbau benötigten Geldes mit schmuggeln<br />
verdient <strong>und</strong> manche ließen sogar ihr neues Land brachliegen um sich ganz<br />
auf den Schmuggel zu spezialisieren.<br />
Mitte 1947 war sie Ernährungssituation sehr ernst, da jedem Dorf zu Beginn<br />
des Jahres Ablieferungslasten auferlegt wurden. Da die Einwohner die Vieh-<br />
abgabe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erreichen konnten erschien<br />
eines Tages einfach die Viehkontrolle <strong>und</strong> holte 15 Kühe aus den Ställen, bei<br />
einigen die einzige Kuh, bei anderen Leuten wurde das Gespann völlig aus-<br />
einandergerissen, wieder bei anderen wurde einfach die frische Kuh mit dem<br />
Kalb geholt. Trotz dieser Abgabe <strong>und</strong> der Getreideabgabe nach der letzten<br />
Ernte kam jedoch schon wieder ein dringender Aufruf des Landrats zur Not-<br />
abgabe. Aber langsam fragten sich die Leute was sie noch abgeben sollten,<br />
denn es war kaum noch etwas da.<br />
Dem Brot wurde Maismehl in größerem Prozentsatz beigemischt, die Mühlen<br />
wurden geschlossen, Gerste, Korn <strong>und</strong> Weizen werden in bestimmten Sätzen<br />
dem Brot beigebacken.<br />
Die Not in den Städten, auch schon in Trier, ist erheblich angestiegen aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> nahm das Hamstern so zu das es in den Dörfern kaum zu er-<br />
tragen war. Die Langsurer können sich nur noch wegen ihrer Grenznähe ei-<br />
nigermaßen helfen <strong>und</strong> das auch nur weil die Grenzbeamten verständnisvoll<br />
das eine oder andere „übersehen“. Da Haupttauschmittel ist der Kaffee der<br />
sich in der Stadt zu utopischen Preisen verkaufen lässt. Für 2 bis 3 Pf<strong>und</strong><br />
43
Kaffee kann man ein paar Schuhe bekommen, oder Stoffe <strong>und</strong> andere Man-<br />
gelware einlösen. Durch den Schmuggel ganz gut über die R<strong>und</strong>en gekom-<br />
men konnte man sich jetzt auch wieder dem Weinanbau zuwenden, einer<br />
nicht unrentabeln Knochenarbeit.<br />
Doch der Traubenherbst fällt gut aus <strong>und</strong> nachdem das Seqesteramt eine<br />
bestimmte Menge lesen ließ, konnte man das Fuder für ungefähr 840, -RM<br />
verkaufen. Was aber nur die wenigsten taten, denn wie lange hatten die<br />
meisten schon keinen Wein mehr getrunken.<br />
So kam es nicht gerade zur Freude des Pastors zu so manchen Exessen.<br />
Die Währungsreform von 1948 mochte für so manchen einen tiefen Einschnitt<br />
bedeutet haben aber das Wirtschaftsleben einen unglaublichen Aufschwung.<br />
Die Geschäfte zeigten auf einmal – über Nacht – Auslagen wie man sie wäh-<br />
rend wer ganzen Kriegszeit nicht mehr kannte. Es gab wieder Waren zu kau-<br />
fen, die bisher nur denen vorbehalten waren, die kompensieren konnten.<br />
Gewiss, das Geld war rar, aber man konnte kaufen. Die Weinpreise erstiegen<br />
in diesem Jahr die unglaubliche Höhe von 2000 RM pro Fuder.<br />
Der Jahrgang 1948 war zwar nicht der Beste, aber von einer Quantität das<br />
sich die Leute wieder einiges Leisten konnten was bisher unerschwinglich<br />
war.<br />
44
Not macht erfinderisch<br />
Nachkriegszeit an der Obermosel<br />
von Daniel Kohn<br />
Nicht nur die Großstädte, sondern auch die Grenzregionen waren hart vom<br />
Krieg betroffen. Durch die Evakuierung der Menschen von der Obermosel im<br />
September 1944 an die Mittelmosel <strong>und</strong> in den Hunsrück bestand keine Mög-<br />
lichkeit, Lebensmittelrücklagen für spätere Zeiten zu schaffen. Dies hatte zur<br />
Folge, dass die Menschen nach ihrer Rückkehr im Mai 1945 völlig von der<br />
Landwirtschaft abhängig waren. Da es aber in Folge des Krieges an allem<br />
Lebensnotwendigen wie Fett <strong>und</strong> Zucker mangelte, wurden zusätzlich von<br />
den dortigen Behörden (Amtsverwaltungen) Lebensmittelkarten bis 1948<br />
ausgegeben, welche die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten sollten.<br />
Hierfür wurde eine sogenannte Zwangsbewirtschaftung eingeführt. Sie ver-<br />
pflichtete die Abgabe von Fleisch, Gemüse etc. abhängig von der Anzahl der<br />
Personen im Haushalt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> des Wertverlustes des Geldes florierte der Tauschhandel. Um z.<br />
Bsp. an Brot zu gelangen, waren Hamsterfahrten von der Obermosel bis in<br />
den Hunsrück nötig, welche 3 bis 4 Tage dauerten. Auch Schuhe waren rar.<br />
Ein bekannter Handelsplatz hierfür war Pirmasens. Als Tauschmittel war vor<br />
allen Dingen Alkohol (Schnaps, Wein) allseits gern gesehen. Durch die Nähe<br />
zu Luxemburg wurde auch die Mosel zu einem Schmuggelweg vor allem für<br />
Kaffee <strong>und</strong> Tabak umfunktioniert. Dem Einfallsreichtum beim Schmuggeln<br />
wurde dabei keine Grenzen gesetzt. Damals gab es an bestimmten Stellen<br />
der Mosel Furten, die eine komplette Überquerung zu Fuß möglich machten.<br />
Beim Passieren der Grenzen wurden die Schmuggelwaren in der Unterwä-<br />
sche vor den Grenzwärtern versteckt. Ebenso wurde der Vieherwerb zum<br />
Abenteuer. Leute zogen manchmal durch das ganze Rheinland, sogar bis<br />
nach Westfalen <strong>und</strong> Hannover, um Rindvieh <strong>und</strong> Schweine zu kaufen. Durch<br />
45
die vielen Zerstörungen an den Eisenbahnen mussten sie die Strecken zu<br />
Fuß oder per Rad zurücklegen. Laut den Erzählungen meiner Oma musste<br />
sie um an ein Ferkel zu gelangen mit dem Fahrrad von Temmels bis nach<br />
Kell fahren. Als Gegenleistung forderte der Bauer ein Paar Schuhe <strong>und</strong> zwei<br />
Liter Schnaps.<br />
Auch die zerstörten Häuser wurden durch den Tauschhandel (Baumaterialien<br />
gegen Naturalien) hauptsächlich von Frauen <strong>und</strong> Kinder wieder aufgebaut.<br />
Da aber nur wenige Dachziegeln heil geblieben waren, bedeckte man die<br />
Dächer gezwungener Maßen mit Blech jeglicher Art. Auch Glas war Mangel-<br />
ware. Um nicht ganz im Kalten zu sitzen, vernagelte man die Fenster mit<br />
Brettern, Sperrholz, Pappe etc. . Kleider hingegen wurden aus den Militäruni-<br />
formen notdürftig umgeändert.<br />
Diesem Schwarzmarkt wollten die jeweiligen Besatzungsmächte entgegen-<br />
wirken. So wurde z. Bsp. die französische Besatzungszone in einzelne Be-<br />
zirke eingeteilt. Jeder, der von einem Bezirk in den anderen wechseln wollte,<br />
wurde auf Tauschartikel kontrolliert. Falls welche vorhanden waren, wurden<br />
diese beschlagnahmt. Das Passieren der Grenzen zwischen den einzelnen<br />
Besatzungsgrenzen entpuppte sich zu einem weiteren Problem. Zudem gab<br />
es in jedem Dorf an der Obermosel einen „Hilfssheriff“, zumeist ein ehemali-<br />
ger französischer Fremdenlegionär, der auf Recht <strong>und</strong> Ordnung achtete. Sie<br />
waren in ihrem Vorgehen sehr radikal . Bei Missachten der von ihnen aufge-<br />
stellten Regeln, beispielsweise des Sperrverbotes nach 20.00 Uhr oder des<br />
Ziehens von Hut <strong>und</strong> Mütze beim Vorübergehen, drohten harte Sanktionen.<br />
Mit der Einführung der Deutschen Mark (DM) 1948 endete der Tauschhandel.<br />
Zugleich verbesserte sich die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung <strong>und</strong> die<br />
Gr<strong>und</strong>lage für das deutsche Wirtschaftsw<strong>und</strong>er wurde geschaffen.<br />
46
Eine besondere Hamsterfahrt<br />
von Tim Prenzel<br />
Die folgende Geschichte hat mir mein 80jähriger Großvater erzählt, als ich<br />
ihn nach einem Nachkriegserlebnis fragte, das ihm besonders viel bedeutet.<br />
Um sie zu verstehen, muss man wissen, dass die Lebensmittel nach Kriegs-<br />
ende knapp waren <strong>und</strong> die Lebensmittelmarken oft nicht für eine große Fami-<br />
lie wie die meines Großvaters ausreichten. Deshalb musste er häufig mit dem<br />
Fahrrad aufs Land fahren, um Geschirr, Kleidung oder andere nützliche Din-<br />
ge gegen Nahrung einzutauschen. Jedoch war dieses sogenannte „Hams-<br />
tern“ ausdrücklich verboten <strong>und</strong> man musste aufpassen, dass man nicht in<br />
eine Kontrolle geriet, bei der die „erhamsterte“ Ware eingezogen wurde.<br />
An eine dieser Hamsterfahrten erinnert sich mein Großvater ganz besonders:<br />
„Nachdem ich 30 km mit dem Fahrrad gefahren war <strong>und</strong> in mehreren Dörfern<br />
vergeblich versucht hatte, Lebensmittel zu ertauschen, erreichte ich schließ-<br />
lich den kleinen Ort Dierscheid. Auch hier wollte ich probieren, den Schmuck<br />
meiner Mutter <strong>und</strong> die Hefe, die ich von Bekannten erhalten hatte, bei einer<br />
Bauernfamilie gegen Nahrungsmittel <strong>und</strong> ein wenig Milch einzutauschen.<br />
Während meiner Suche nach einem Bauernhof, in dem noch Licht brannte,<br />
wurde ich jedoch zunächst nur als Bettler beschimpft. Ich gab nicht auf <strong>und</strong><br />
kam letztendlich zu einem großen Bauernhaus vor dem ich eine Bäuerin sah.<br />
Ich war mir nicht sicher, ob auch sie mich wegschicken würde, deshalb fragte<br />
ich die Frau vorsichtig, ob sie bereit wäre mir zu helfen <strong>und</strong> meine Waren im<br />
Tausch gegen etwas zu essen annehmen würde. Zu meiner großen Überra-<br />
schung <strong>und</strong> Freude lud sie mich ohne zu zögern in ihr Haus ein <strong>und</strong> rief ihren<br />
Mann. Auch dieser begrüßte mich sehr fre<strong>und</strong>lich <strong>und</strong> bot mir Butter zum<br />
Tausch an <strong>und</strong> sagte zugleich, dass er erst am nächsten Morgen wieder<br />
Milch habe. Da ich aufgr<strong>und</strong> der Dunkelheit nicht mehr am gleichen Abend<br />
zurück nach Trier fahren konnte, bot mir der Bauer an, auf dem Bauernhof zu<br />
übernachten. Und damit nicht genug: Die Bäuerin gab mir sogar einen Teller<br />
47
Suppe zum Abendessen. Die beiden erklärten mir, dass sie dies alles des-<br />
halb für mich taten, weil sie nicht so sehr vom Krieg betroffen waren <strong>und</strong> sie<br />
sähen, dass es anderen viel schlechter ginge.<br />
Am nächsten Tag wurde ich gegen sechs Uhr geweckt <strong>und</strong> die Milch stand<br />
schon bereit. Im Gegenzug gab ich ihnen meine Hefe <strong>und</strong> den Schmuck. Ich<br />
bedankte mich bei ihnen <strong>und</strong> sie wünschten mir eine gute Heimreise <strong>und</strong> al-<br />
les Gute. Ich machte mich schnell auf den Heimweg, da ich die ‚gehamster-<br />
ten’ Dinge schnell nach Hause bringen wollte. Ich habe die Fre<strong>und</strong>lichkeit die-<br />
ser Menschen bis heute nicht vergessen.“<br />
Da der Krieg viele Opfer forderte, war es wichtig einander zu helfen. So hal-<br />
fen wie in dieser Geschichte die Menschen, die weniger betroffen waren,<br />
denjenigen, die stärker im Krieg gelitten hatten. Diese Hilfe bestand nicht nur<br />
aus dem wichtigen Tausch von Ware gegen Nahrung, sondern auch manch-<br />
mal daraus, dass Familien andere Leute aufnahmen, um ihnen ein Dach über<br />
dem Kopf zu bieten. Ohne diesen Zusammenhalt wäre der Wiederaufbau<br />
noch schwieriger gewesen.<br />
Die erste Zeit nach dem Krieg<br />
von Matthias Dellwing<br />
Mai 1945 - Ende des 2. Weltkrieges.<br />
Knapp 6 Jahre dauerte der Krieg. Nach Jahren in Angst mit Bombenangriffen,<br />
Armut, Hunger <strong>und</strong> Elend endlich ein Aufatmen. Unzählige Dörfer <strong>und</strong> Städte<br />
lagen in Schutt <strong>und</strong> Asche. Die Versorgung war zusammengebrochen,<br />
Transportwege <strong>und</strong> Häuser zerstört, aber der Krieg war aus.<br />
Hier bei uns auf den Dörfern litten die Menschen weniger an Hunger, da sie<br />
durch die Landwirtschaft immer genug zu essen hatten. Sie lebten<br />
hauptsächlich von ihren eigenen Produkten, wie Kartoffeln, Milch, Obst,<br />
Gemüse <strong>und</strong> Fleisch.<br />
48
In der Stadt sah dies meist anders aus. Aus Trier kamen täglich Leute nach<br />
Osburg <strong>und</strong> boten Sachen zum Tausch für Lebensmittel an (z.B. Stoffe,<br />
Tischwäsche, Porzellan, Bilder, Glas).<br />
Die Familie meiner Großmutter hatte damals 3 Zentner Kartoffeln gegen eine<br />
große Zinkwanne eingetauscht. Diese diente zum Baden <strong>und</strong> zum Waschen<br />
der Wäsche. Außerdem war das Elternhaus meiner Oma auch schwer be-<br />
schädigt. 2 Bomben waren in unmittelbarer Nähe des Hauses eingeschlagen<br />
<strong>und</strong> hatten das Dach total beschädigt. Um das Dach für den Winter wieder<br />
einigermaßen dicht zu bekommen, bestand die Gelegenheit, in Trier Blechta-<br />
feln im Tausch gegen Lebensmittel (Kartoffeln <strong>und</strong> Fleisch) zu bekommen.<br />
Diese Blechtafeln wurden dann von einem Bekannten mit dem Pferdefuhr-<br />
werk von Trier nach Osburg transportiert.<br />
Dies nahm dann einen ganzen Tag in Anspruch.<br />
Kleinere Mengen an Materialien wurden von Trier zu Fuß mit einem Ruck-<br />
sack nach Hause getragen. Später fuhr die Bahn bis Waldrach. Der Rest des<br />
Weges musste dann zu Fuß zurückgelegt werden.<br />
Da die Reichsmark keinen Wert mehr hatte, konnte kaum noch etwas einge-<br />
kauft werden.<br />
49
Im Juni 1948 kam dann die DM (neue Währung). Pro Person wurde ein Start-<br />
geld von 40,-- DM ausgezahlt.<br />
Nach <strong>und</strong> nach bekamen die kleinen Geschäfte wieder Waren.<br />
Da das Geld trotzdem sehr knapp war, konnte man hier in den kleinen Ge-<br />
schäften noch lange Zeit eigene Produkte gegen Waren eintauschen (z. B.<br />
Eier gegen Zucker oder Butter gegen Fisch).<br />
Nach <strong>und</strong> nach wurden die beschädigten Häuser wieder renoviert oder gar<br />
neu aufgebaut.<br />
Insbesondere für die Frauen hatte eine schwere Zeit begonnen. Oft waren<br />
Familienväter oder Söhne nicht aus dem Krieg heimgekehrt. Viele waren<br />
noch in Gefangenschaft, vermisst oder gar gefallen. Immer wieder gingen<br />
auch jetzt noch Todes- <strong>und</strong> Vermisstenmeldungen ein.<br />
Sowohl für die Arbeiten in der Landwirtschaft als auch für die Bauarbeiten<br />
gab es keine Maschinen. Alle Arbeiten mussten von Hand verrichtet werden,<br />
was natürlich auch viel Zeit beansprucht hat <strong>und</strong> körperliche Schwerstarbeit<br />
war. Die Leute haben sich gegenseitig geholfen. Anders wäre dies nicht mög-<br />
lich gewesen.<br />
arbeiteten bei Nur wenige Bürger aus Osburg hatten eine Arbeitsstelle. Eini-<br />
ge, auch mein Urgroßvater, der Fa. Romika in Gusterath-Tal. Den Weg zur<br />
Arbeit legten sie in der ersten Zeit nach dem Krieg zu Fuß durch Wald <strong>und</strong><br />
Feld zurück. Später fuhren sie ab Waldrach mit der Bahn.<br />
Auch diejenigen, die in Trier eine Arbeitsstelle hatten, mussten anfangs zu<br />
Fuß gehen oder sie versuchten per Anhalter mitzufahren.<br />
Auf dem Osburger Friedhof erinnert heute noch ein Gräberfeld an die gefalle-<br />
nen Soldaten aus ganz Deutschland <strong>und</strong> auch Einheimischen, die im Krieg in<br />
Osburg ums Leben kamen.<br />
Außerdem wurde zum Gedenken an die Opfer (beider Weltkriege) aus Os-<br />
burg neben der Kirche ein Kriegerdenkmal errichtet. An dieser Stelle wird<br />
jährlich den Toten gedacht.<br />
Erzählerin: Marga Neufing<br />
50
Bericht meines Vaters anhand von Erzählungen meines<br />
Großvaters über die Nachkriegszeit<br />
von Benjamin Meyer<br />
Die Zeit nach dem 8.5.1945 war grauenvoll. Der Krieg war zwar zu Ende,<br />
doch der Schock bzw. Schrecken saß sehr tief. Keiner konnte sich erklären<br />
wie es so weit kommen konnte, keiner wusste, wer aus dem Fre<strong>und</strong>eskreis<br />
etwas mit den Nazis zu tun gehabt hatte. Allgemeine Ungewissheit herrschte<br />
in allen Köpfen.<br />
Mein Großvater besaß einen Bauernhof in Norddeutschland (Raum Olden-<br />
burg), das bekanntlich durch die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszo-<br />
nen von den Briten kontrolliert wurde. Alle Höfe in Norddeutschland wurden<br />
von den Briten nach Waffen durchsucht, jedem kleinsten Hinweis auf Besitz<br />
von Waffen jeglicher Art wurde nachgegangen. Auch der Bauernhof meines<br />
Großvaters wurde regelrecht durchforstet <strong>und</strong> umgegraben um irgendwelche<br />
Waffen zu finden. Die Briten aber fanden nichts. Aufgr<strong>und</strong> dieser Durchsu-<br />
chungen wurden alle Besitzer von Bauernhöfen geradezu denuziert. Direkt<br />
nach <strong>Kriegsende</strong> herrschte außerdem große Hungersnot in ganz Deutsch-<br />
land. Viele Leute aus der Stadt „hamsterten“ über die Dörfer um nur irgend-<br />
etwas zu essen zu bekommen, tauschten gegen Essen auch sehr wertvolle<br />
Gegenstände wie Perserteppiche oder Gold ein. Da meine Großeltern einen<br />
Bauernhof besaßen, wurden sie (nur meine Großmutter; mein Großvater war<br />
von 1945-47 in russischer Gefangenschaft) von vielen Leuten aus der Stadt<br />
besucht die Hunger hatten <strong>und</strong> um Essen baten. Lebensmittel, die nicht für<br />
den eigenen Bedarf benötigt wurden gaben meine Großeltern unentgeltlich<br />
ab. So wie die Stadtbewohner über die Dörfer „hamsterten“, so kehrten auch<br />
Väter <strong>und</strong> Söhne vom Dorf aus der Kriegsgefangenschaft zurück, wie auch<br />
mein Großvater. Seine Rückkehr wurde im Dorf ganz besonders gefeiert, da<br />
er der letzte aus dem Dorf war der aus der Kriegsgefangenschaft entlassen<br />
wurde -1947. Ein Ereignis ist meinem Vater durch viele Erzählungen beson-<br />
ders im Kopf geblieben: Noch am Abend seiner Rückkehr fragte mein Groß-<br />
51
vater seine eigene Frau ob er noch etwas essen dürfe- eine zuvor unvorstell-<br />
bare Frage- in der Kriegsgefangenschaft hatte er stark hungern müssen.<br />
Genau zu dieser Zeit (1947) feierten meine Urgroßeltern Goldene Hochzeit.<br />
Statt schöner Geschenke, wie es heute üblich ist, bekamen sie Lebensmittel,<br />
die in dieser Zeit dringend benötigt wurden. Allgemein wurde alles an Le-<br />
bensmitteln getauscht was es zu tauschen gab- Geld war wertlos; Natural-<br />
Tauschwirtschaft war angesagt bis zur Einführung der DM 1948. Mit Freude<br />
wurde dann die Einführung der DM gefeiert; jeder bekam 40 DM, von nun<br />
konnte wieder gekauft <strong>und</strong> verkauft werden <strong>und</strong> das deutsche Wirtschafts-<br />
w<strong>und</strong>er nahm seinen Lauf.<br />
Die Versorgung nach dem 2. Weltkrieg<br />
von David Kees<br />
Mein Opa, Heinrich Kees, berichtet mir von seiner Zeit nach dem 2. Welt-<br />
krieg, als er in der Nähe von Düsseldorf lebte:<br />
„Kurz nach dem <strong>Kriegsende</strong> wurden die Vorräte so knapp, dass jeder für sich<br />
selbst Wege zur besseren Versorgung finden musste. Überall musste gespart<br />
werden. Wer diese Zeit miterlebt hat, der ist dadurch geprägt worden <strong>und</strong> lebt<br />
auch heute noch sparsamer. Wir waren damals so eingeschränkt, dass wir<br />
heutzutage wohl auch einfachere Dinge zu schätzen wissen,“ erzählt mir<br />
mein Opa.<br />
„Wir bekamen Monats- <strong>und</strong> Wochenkarten. Erst durch<br />
diese Karten war es uns erlaubt, überhaupt Lebens-<br />
mittel zu kaufen <strong>und</strong> dieses nur in geringen Mengen.<br />
Auf diesen Karten war genau angegeben, wie groß<br />
die Rationen sein durften <strong>und</strong> diese mussten wir teuer<br />
bezahlen. Vor den Lebensmittelgeschäften standen<br />
oft sehr lange Schlangen von wartenden Leuten. Ähn-<br />
52
liche Karten gab es auch für Bekleidung <strong>und</strong> Tabakwaren. Wer ein starker<br />
Raucher war, hatte es schwer, denn natürlich waren die Tabakrationen knapp<br />
bemessen <strong>und</strong> teuer außerdem. Die einzige Chance, zusätzliche Waren zu<br />
erhalten, war, gegen andere Waren zu tauschen oder zu verkaufen. Die Be-<br />
kleidung war alt. Einmal musste ich ein Hemd mit durchgetragenem Kragen<br />
unten abschneiden, um den Kragen oben zu reparieren. Auf Gr<strong>und</strong> der fett-<br />
armen Nahrung waren wir ständig auf der Suche danach unseren Fettbedarf<br />
zu decken, aber trotz der Bemühungen sahen wir sehr mager aus. Der Hun-<br />
ger war wirklich groß. Ich kannte einen Bauer auf dem Lande, bei dem ich<br />
Sachen tauschen konnte, die nicht auf den Lebensmittelkarten standen.<br />
Wir schafften uns dann Hühner an, da diese erstens Eier legen <strong>und</strong> man<br />
zweitens deren Fleisch essen kann“, erzählt mir mein Opa weiter. „Aber na-<br />
türlich gab es kein Hühnerfutter zu kaufen <strong>und</strong> so hatten wir ein erneutes<br />
Problem. Ich konnte das Futter aber auf freigegebenen Feldern <strong>und</strong> Äckern<br />
sammeln. Das machten wir so: Der Bauer mähte <strong>und</strong> harkte mit einer großen<br />
Maschine, von einem Pferd gezogen, die Felder ab. Wenn beinahe nichts<br />
mehr zu holen war, dann ließ er das Feld freigeben. Es war zwar eine müh-<br />
same Arbeit, das Feld abzusammeln <strong>und</strong> meistens kam auch nicht viel dabei<br />
raus, aber wenn ich doch noch ein Bündel zusammenbekam, konnte ich die-<br />
ses entweder zu größeren Fabriken bringen <strong>und</strong> gegen Haferflocken eintau-<br />
schen, oder ich nahm die gesammelten Ähren nach Hause <strong>und</strong> bearbeitete<br />
sie selbst mit einem Dreschflegel.<br />
In einem besonders kalten Winter, kam es dazu, dass in unserem Haus die<br />
Wasserleitungen einfroren. Das Feuerholz war knapp, um jedes Grad Wärme<br />
wurde gekämpft. Die Engländer ließen zu dieser Zeit die umliegenden Wälder<br />
abholzen <strong>und</strong> das aufgestapelte Holz war sehr begehrt, <strong>und</strong> überlebensnot-<br />
wendig für uns.“<br />
Mein Opa konnte mir von so einem persönlichen Erlebnis berichten:<br />
„Ich war damals ein Student <strong>und</strong> abends, wenn es dunkel wurde, sind mein<br />
Bruder <strong>und</strong> ich in den Wald geschlichen, um etwas von dem Klobenholz zu<br />
53
klauen. Hatten wir etwas ergattert, so brachten wir es zu Fre<strong>und</strong>en, welche<br />
am Waldrand wohnten. Später, oder an einem der nächsten Tage haben wir<br />
es dann abgeholt; es wäre einfach zu gefährlich gewesen es nachts ganz bis<br />
nach Hause zu transportieren. Einmal haben sie uns bemerkt, da wir unser<br />
Holz aber nicht verlieren wollten, sind wir schwer bepackt davon gelaufen.<br />
Die Last wurde jedoch bald zu groß <strong>und</strong> so blieb uns nichts anderes übrig, als<br />
das Holz abzuwerfen <strong>und</strong> in den eiskalten Fluss zu springen, um nicht er-<br />
wischt zu werden. Denn es gab natürlich eine hohe Strafe auf so ein Verge-<br />
hen.<br />
54
Neuanfang<br />
Wiederaufnahme des Schieferbergbaus nach dem Krieg<br />
von Johannes Gorges<br />
In meinem Heimatort Fell, der ja für<br />
den Schieferbergbau bekannt ist, war<br />
es in der Zeit unmittelbar nach<br />
<strong>Kriegsende</strong> so, dass viele ehemalige<br />
Bergleute glaubten, ihre Existenz-<br />
sicherung im Schieferbergbau zu fin-<br />
den. Die zu Kriegsbeginn stillgelegten<br />
Gruben versuchte man wieder in<br />
Betrieb zu nehmen. Dies war jedoch<br />
nicht so einfach möglich, da die Wie-<br />
derinbetriebnahme für den Feller<br />
Bereich von der zuständigen<br />
französischen Militärregierung ge-<br />
nehmigt werden musste. Jeder<br />
Grubenpächter musste nachweisen,<br />
dass er nicht zur NSDAP gehört hatte<br />
<strong>und</strong> in keiner nationalsozialistischen Sondereinheit wie etwa der „SS” gedient<br />
hatte. Der Pächter musste anhand von vier Fragebögen in deutscher <strong>und</strong><br />
französischer Sprache dies nachweisen. Außerdem wurde noch sein weiteres<br />
Umfeld von den französischen Besatzern überprüft. Erst wenn die französi-<br />
sche Militärregierung übereinstimmende Antworten von allen möglichen Sei-<br />
ten bekommen hatte, wurde die Genehmigung zur Wiederinbetriebnahme der<br />
Gruben erteilt. Besonders problematisch war es eine „Sprenggenehmigung”<br />
für das absprengen zur Gewinnung des Schiefers zu bekommen.<br />
55
So wurde neben vielen anderen auch die Genehmigung für die Grube „Bar-<br />
bara” <strong>und</strong> die Grube „Hoffnung”, die heute das Besucherbergwerk Fell dar-<br />
stellen, erteilt. Die Pachtverträge wurden für die Pächter aber mit Bedingun-<br />
gen versehen, die die französische Militärregierung diktierte.<br />
Diese waren wie folgt:<br />
„Mit dem Betrieb des Schieferbruchs darf erst nach Vorliegen der von dem<br />
Pächter zu beantragenden Genehmigung der Militärregierung begonnen wer-<br />
den. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt auf Anordnung der Militärregierung we-<br />
gen Nichteinhaltung der von ihr dem Pächter auferlegten Verpflichtungen der<br />
Grubenbetrieb geschlossen werden, so steht dem Pächter ein Entschädi-<br />
gungsanspruch nicht zu. Sollte die Grube von der Militärregierung als Ü-<br />
bungsplatz, Schießstand usw. benutzt werden, so verliert der Vertrag ohne<br />
weitere Umstände seine Gültigkeit <strong>und</strong> gilt als aufgelöst. Hiermit ist der Päch-<br />
ter ausdrücklich einverstanden. Im übrigen kann der Vertrag jederzeit von der<br />
Militärregierung ohne Entschädigung der beiden Vertragsparteien gekündigt<br />
werden.”<br />
56
Das Leben als Schreiner nach dem Krieg<br />
von Marco Stark<br />
Als der Krieg zu Ende war, war das Geld wertlos. Für das Geld konnte man<br />
keine Waren mehr erhalten. So ging man wieder über zur Naturaltauschwirt-<br />
schaft. Als Schreiner war es schwierig an Holz <strong>und</strong> Maschinen zu kommen.<br />
Mein Vater <strong>und</strong> ich waren gerade einen Tisch mit der Kreissäge am Schnei-<br />
den, als französische Beamte uns unterbrachen. Sie wollten die Kreissäge<br />
als Kriegsentschädigung pfänden. So mussten wir unsere Kreissäge abgeben<br />
<strong>und</strong> bekamen dafür einen Reparationsschein, der jedoch eigentlich wertlos<br />
war. So versuchten die Franzosen in allen Werkstätten im Dorf Maschinen zu<br />
pfänden. In der Werkstatt von einer Bekannten bauten mein Vater <strong>und</strong> ich die<br />
Antriebswelle aus einer Kreissäge aus. Bevor die Franzosen kamen, mussten<br />
wir die Maschinen wieder mit Staub <strong>und</strong> Spänen bedecken, da in der Werk-<br />
statt schon lange nicht mehr gearbeitet wurde, weil der Mann der Frau im<br />
Krieg gestorben war. Als die französischen Beamten die Maschinen abholen<br />
wollten, merkten sie beim Test der Kreissäge, dass diese „kaputt“ war. So<br />
nahmen sie sie nicht mit <strong>und</strong> wir konnten die Säge, nachdem wir die An-<br />
triebswelle wieder eingebaut hatten, weiter nutzen.<br />
57
Auch die Beschaffung von Holz war für uns sehr schwierig. Einmal fuhren<br />
mein Vater, mein Bruder Jupp <strong>und</strong> ich früh morgens in den Wald. Wir wollten<br />
Holz beschaffen, um weiterarbeiten zu können. Das ging jedoch nur durch<br />
das Stehlen von Holz. Wir sägten eine große Eiche <strong>und</strong> eine große Lärche ab<br />
<strong>und</strong> luden sie danach auf den Wagen. Danach brachten wir die Bäume mit<br />
einem Pferdewagen, der von meinem Bruder gefahren wurde, zu einem Sä-<br />
gewerk. Das Unternehmen wurde noch weiter erschwert, weil mein Bruder<br />
von einem Polterabend am Tag zuvor noch leicht angetrunken war. Bevor wir<br />
den „Tatort“ verließen, vertuschten wir noch alle Spuren. Wir brachten die Ar-<br />
beiter im Sägewerk dazu, uns die Bäume in Bretter zu zerschneiden, indem<br />
wir ihnen etwas Schnaps <strong>und</strong> ein wenig Butter gaben. Nun brachten wir die<br />
Bretter nach Hause. Schließlich transportierten wir sie sofort auf den Holz-<br />
speicher. Am nächsten Tag kam der Förster zu uns in die Werkstatt. Er er-<br />
zählte meinem Vater, dass zwei Bäume spurlos aus dem Wald gestohlen<br />
worden waren <strong>und</strong> ärgerte sich sehr darüber. Zum Glück hatten wir die Bäu-<br />
me schon in Bretter zersägt <strong>und</strong> auf den Speicher gebracht.<br />
58
Für unsere Arbeiten wurden wir auch hauptsächlich mit Gütern bezahlt. In<br />
Eisenach erhielten wir eine Kuh für unsere Arbeit. Wir mussten sie jedoch al-<br />
leine von der Weide nach Hause bringen. Das war aber nicht so einfach, weil<br />
die französischen Beamten regelmäßig die Viehstückzahlen kontrollierten. So<br />
mussten wir die Kuh nachts durch Wälder von der Weide nach Orenhofen<br />
bringen. Kurz vor Wellkyll wollte die Kuh nicht mehr weiter. Wir mussten sie<br />
bei Bekannten in Wellkyll für die Nacht abstellen <strong>und</strong> sie am nächsten Abend<br />
wieder abholen kommen.<br />
Als wir in Gransdorf arbeiteten, erhielten wir für unsere Arbeit ein Schwein.<br />
Jedoch kurz nachdem mein Vater <strong>und</strong> ich es nach Orenhofen in unseren Stall<br />
gebracht hatten, wurden die Stückzahlen durch französische Beamte kontrol-<br />
liert. Der Beamte merkte zwar, dass ein Schwein zu viel im Stall war, aber er<br />
war bereit für ein Pf<strong>und</strong> Butter <strong>und</strong> ein paar Pf<strong>und</strong> Fleisch beide Augen zuzu-<br />
drücken, unter der Bedingung, dass die Stückzahl bei der nächsten Kontrolle<br />
wieder stimmen würde. So mussten wir den benachbarten Metzger möglichst<br />
schnell überreden, uns ein Schwein illegal zu schlachten. Bei der nächsten<br />
Kontrolle am nächsten Tag stimmte die Stückzahl wieder.<br />
Mit der Währungsreform 1948 endete die Naturaltauschwirtschaft <strong>und</strong> es<br />
wurde wieder mit Geld gehandelt. Anfangs war es für Handwerker schwer an<br />
Geld zu kommen, weil sie auf Aufträge anderer angewiesen waren, während<br />
Beamte sofort wieder ein festes Einkommen hatten. Aber auch das pendelte<br />
sich mit der Zeit wieder ein.<br />
Erzähler: Willi Monzel<br />
59
Leben <strong>und</strong> Arbeiten in einer Bäckerei nach <strong>Kriegsende</strong><br />
Von Johannes Kebig<br />
Zerf war in den ersten Wochen nach dem Krieg, wie überall hier in unserer<br />
Gegend, ohne Licht, ohne Brennstoffe, ohne Autos, ohne Post, ohne Bahn<br />
<strong>und</strong> ohne Telefon, teilweise auch ohne Wasser. Die Leute waren auf die Le-<br />
bensmittel angewiesen, die noch im Dorf aufgef<strong>und</strong>en wurden.<br />
In unserem Hause, einer Bäckerei, die von<br />
Granaten <strong>und</strong> Bomben schwer beschädigt worden<br />
war, blieben, wie durch ein W<strong>und</strong>er, der große<br />
Dampfbackofen <strong>und</strong> die Maschinen <strong>und</strong> Geräte<br />
noch gebrauchsfähig. Ein Zwei-Zentnersack voll<br />
Roggenmehl fand sich auch noch unter Trümmern.<br />
So wurde das erste Brot gebacken. Von der<br />
hungernden Bevölkerung, welche wochenlang in<br />
Kellern <strong>und</strong> Bergstollen gehaust hatte, wurde es mit<br />
Freuden begrüßt. Wenn es auch noch vom eingerieselten Sand <strong>und</strong> Mörtel<br />
etwas unter den Zähnen knirschte.<br />
Holz zum Heizen der Backöfen war noch vorhanden, Kohle gab es vorerst<br />
keine. Das Wasser zum Backen holten wir aus dem nahen Bach.<br />
Der Teig musste mit den Händen verarbeitet werden, weil kein Strom vor-<br />
handen war <strong>und</strong> das war Schwerstarbeit. Mein Vater, der Bäckermeister,<br />
konnte das noch aus seiner Jugendzeit.<br />
In unserem Umfeld gab es vier Getreidemühlen.<br />
Diese mahlten für die Bauersleute das Korn zu Mehl<br />
<strong>und</strong> auch wir bekamen unsere Mehlzuteilungen,<br />
wenn auch längst nicht genug, für die vielen<br />
hungrigen Leute, die bald auch aus den Städten<br />
aufs Land kamen <strong>und</strong> um Brot baten.<br />
Meine Eltern schickten niemanden mit leeren<br />
60
daraus eine Art Kaffee zu kochen.<br />
Händen fort, wenn es auch oft nur ein<br />
paar Scheiben Brot waren.<br />
Als die Bauersleute ihr Vieh wieder zum<br />
Teil eingefangen hatten, ging es schon<br />
besser. Sie brachten Milch, Eier, Butter<br />
<strong>und</strong> Weizenmehl. Wir wurden mit<br />
Naturalien bezahlt. Das Geld hatte ja<br />
damals keinen Wert mehr. So gab es<br />
dann auch wieder Kuchen <strong>und</strong> Gebäck<br />
zu Festlichkeiten, Hochzeiten <strong>und</strong><br />
Beerdigungen usw.<br />
Viele Leute bezahlten auch mit Korn, das<br />
in unserem Backofen geröstet wurde, um<br />
Als wir wieder ein provisorisches Bürgermeisteramt hatten, es war in Saar-<br />
burg (15 km entfernt) - wo wir zu Fuß oder wenn vorhanden, mit dem Fahrrad<br />
hinmussten - konnten wir dort unsere Lebensmittelkarten bzw. Brotkartenab-<br />
schnitte abrechnen. Diese wurden vorher in st<strong>und</strong>enlanger Arbeit mit Mehl-<br />
kleister auf alte Zeitungen geklebt. Dafür gab es dann wieder eine bestimmte<br />
Mehlzuteilung.<br />
Einige Monate nach <strong>Kriegsende</strong> kam die erste Hilfe aus Amerika in Form von<br />
gelbem Maismehl. Es ließ sich schlecht verarbeiten, blieb glitschig im Gebäck<br />
<strong>und</strong> schmeckte nicht gut.<br />
Etwas später gab es dann das ganz feine amerikanische Weizenmehl <strong>und</strong> als<br />
große Kostbarkeit ab <strong>und</strong> zu schon mal einen Sack Zucker.<br />
Diese Herrlichkeiten waren in schönen weißen Leinensäcken, woraus wir<br />
Handtücher <strong>und</strong> Backschürzen nähen konnten.<br />
Im Juni 1948 gab es dann die Deutsche Mark <strong>und</strong> alles normalisierte sich.<br />
Erzählt von Elisabeth Kebig<br />
61
Währungsreform in der Sparkasse Trier<br />
von Florian Zonker<br />
Mein Opa wurde 1929 in Tarforst, heute Stadtteil von Trier geboren. Er lebte<br />
auf einem Bauernhof so das er <strong>und</strong> seine Familie während <strong>und</strong> nach des<br />
Krieges in Sachen Lebensmittel keine Not zu Leiden hatten. Am 1.4.1943 be-<br />
gann er ein Lehre bei der Kreissparkasse Trier. Nach dem die Alliierten in der<br />
Normandie gelandet <strong>und</strong> den Widerstand an der deutsch-französischen<br />
Grenze durchbrochen hatten, wurde am 20. Dezember 1944 die komplette<br />
Evakuierung Triers abgeschlossen, auch die Sparkasse musste die Stadt ver-<br />
lassen, sie fand ihr neues Domizil in einer Gaststätte in Longuich an der Mo-<br />
sel. Mein Opa wohnte von nun an in Longuich, den Weg jeden Tag zurück zu<br />
legen war zu viel. Am 28.2/1.3. 1945 besetzten die Amerikaner über den<br />
Hunsrück kommend Trier, zuvor war die Ardennenoffensive der Wehrmacht<br />
gescheitert. Unmittelbar nach der Besetzung verhängten die Amerikaner eine<br />
absolute Ausgangssperre <strong>und</strong> das Leben in Trier <strong>und</strong> Umgebung war so gut<br />
wie Tod. In Taforst, in dass mein Großvater erst nach der Besetzung, von der<br />
Sparkasse in Longuich zurückkehrte, wurden alle Menschen an zwei Plätzen<br />
im Dorf, der Schule <strong>und</strong> der Gaststätte Wollscheid gesammelt <strong>und</strong> die ameri-<br />
kanischen Soldaten quartierten sich in ihren Häusern ein. Dies dauerte 2 Wo-<br />
chen an, mein Großvater konnte jedoch mit seinen Eltern <strong>und</strong> dem Rest sei-<br />
ner Familie bereits nach 8 Tagen auf ihren Hof zurückkehren da es in der<br />
Schule zu eng war (dort hielten sich zwischenzeitlich bis zu 150 Personen<br />
auf). Ca. 3 Wochen nach der Besetzung zogen die Soldaten ab, es wurden<br />
nur noch Streifen durch Taforst gefahren. Inzwischen hatten die Amerikaner<br />
knapp zehntausend russische Kriegsgefangene in ein Lager auf dem Petris-<br />
berg transportiert, diese wurden zur Gefahr für die Bevölkerung, da sie<br />
nachts in aggressiven Gruppen in die Dörfer kamen. Die Amerikaner gingen<br />
jedoch massiv gegen diese Gruppen vor <strong>und</strong> beschützten die Bevölkerung.<br />
Nach 2-3 Monaten wurden die Gefangen wieder in ihre Heimat zurückgeführt.<br />
62
Anfang April wurde mein Opa wieder zur Arbeit in die Sparkasse gerufen, die<br />
bis dahin geruht hatte. Im Hauptgebäude war jedoch die alliierte Stadtko-<br />
mandatur untergebracht, so mußte man in eine Sparkassenimobilie in der<br />
Petrusstrasse ausweichen. Der damalige Direktor Hoffmann hatte klugerwei-<br />
se schon beim Umzug nach Longuich große Mengen Bargeld mitgenommen<br />
<strong>und</strong> so konnten die Geschäfte sofort wieder aufgenommen werden. Hoffmann<br />
wurde dabei vom zuständigen amerikanischen Wirtschaftsoffizier Capt. Po-<br />
wers tatkräftig unterstützt, dieser war von der cleveren Voraussicht Hoffmans<br />
derart begeistert, dass sich zwischen den beiden eine regelrechte Fre<strong>und</strong>-<br />
schaft entwickelte. Die Amerikaner waren sowieso daran interessiert die Wirt-<br />
schaft so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu bringen, die Waren die<br />
für das täglich Leben notwendig waren wie Lebensmittel, Kleidung <strong>und</strong> Woh-<br />
nungen wurden von den Amerikanern sofort bewirtschaftet <strong>und</strong> so gerecht an<br />
den Mann gebracht. Durch das schnelle Handeln Hoffmanns gab es nach<br />
wenigen Tagen wieder Geld für die K<strong>und</strong>en der Sparkasse, auch die Wäh-<br />
rung funktioniert sofort reibungslos. In dieser Zeit verabschiedete der Alliierte<br />
Kontrollrat zwei Gesetze die für die Sparkasse von Bedeutung waren. Die<br />
Gesetze 52 <strong>und</strong> 53. Gesetz 52 regelte die allgemeine Geldwirtschaft <strong>und</strong> Ge-<br />
setz 53 regelt den Umgang mit Geld von Nazis, dieses Gesetz sagte aus,<br />
dass alle Konten von Personen die aufgr<strong>und</strong> ihres Amtes oder ihres Verhal-<br />
tens als Nazis aufgefallen waren gesperrt werden mußten. Ihnen durfte nur<br />
das nötigste Geld zum Überleben ausgezahlt werden.<br />
Im Herbst 1945 zogen die Amerikaner ab <strong>und</strong> die Franzosen rückten gemäß<br />
der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz in Trier ein. Sofort brach die Zu-<br />
sammenarbeit zwischen Besatzern <strong>und</strong> der Sparkasse fast komplett zusam-<br />
men, mein Opa sagt dazu: „Die Amerikaner waren kooperativ <strong>und</strong> die Fran-<br />
zosen administrativ.“ Aufgr<strong>und</strong> eines Zwischenfalls an dem der Sohn des<br />
Bankdirektors beteiligt war, er sollte angeblich einen franz. Offizier beleidigt<br />
haben, der vor dem Haus in der Petrusstrasse statt fand, musste die Spar-<br />
kasse das Haus sofort räumen, die Maßnahme richtete sich jedoch in erster<br />
63
Linie gegen den Bankdirektor <strong>und</strong> seine Familie die genauso wie das Institut<br />
das Haus verlassen mussten. Die Sparkasse zog in das Haus der heutigen<br />
AOK in die Paulinstrasse wo sie bis zur Gründung der BRD 1949 auch blieb<br />
<strong>und</strong> danach wieder in ihre Hauptgeschäftsstelle konnte.<br />
Am 20.6.1948, einem Sonntag wurde die Währungsreform eingeleitet <strong>und</strong> die<br />
ersten 60 DM zum Kurs 1:1 von der Verwaltung an die Bevölkerung abgege-<br />
ben. Ab dem 21.6. mussten dann alle Guthaben bei den jeweiligen Instituten<br />
angemeldet werden. Das Geld wurde zum Kurs 10:1 von Reichsmark auf<br />
Deutschmark umgestellt, von diesem Guthaben wurden dann 50% auf ein<br />
Sperrkonto überwiesen auf das der K<strong>und</strong>e keinen Zugriff hatte, um zu ver-<br />
meiden das die Kaufkraft für die vorhandenen Waren zu groß wird. Später<br />
wurden von den 50% noch einmal 70% abgezogen was einer weiteren Auf-<br />
wertung zum Kurs von 10:0,65 entsprach. Mit diesem Punkt, der Währungs-<br />
reform begann das Deutsche Wirtschaftsw<strong>und</strong>er. Die Sparkasse konnte ihren<br />
K<strong>und</strong>en die Guthaben die vor 1.1.1940 bestanden haben später noch einmal<br />
um 13,5% aufwerten.<br />
Die Situation meines Großvaters als Gastarbeiter<br />
von Anastasios Mansuri<br />
Im folgenden Text, beschreibe ich u.a. die Situation wie sie für meinen Groß-<br />
vater war, als er Anfang der 60er Jahre nach Deutschland kam.<br />
- Warum ist mein Großvater „geflohen“ ?<br />
Ausgangslage in Griechenland nach 1945 :<br />
Nach dem 2.Weltkrieg,<br />
Von 1945 – 1959 Bürgerkrieg in Griechenland. „Rechte“ kämpften gegen<br />
„Linke“. Daraus resultierte eine jahrelange wirtschaftliche Notlage für das<br />
Land <strong>und</strong> seine Bevölkerung, d.h. Inflation, Arbeitslosigkeit, Korruption, politi-<br />
64
sche Verfolgungen <strong>und</strong> damit wirtschaftliche bzw. soziale Isolation der Ver-<br />
folgten.<br />
Mein Großvater gehörte zu den Widerstandskämpfern, Partisanen, dem E-<br />
LAS. So wird klar, warum mein Großvater das Land verlassen wollte: sein<br />
Ziel <strong>und</strong> Wunsch war es, als Gastarbeiter in Deutschland einen gesicherten<br />
Arbeitsplatz zu haben, um seine Familie ernähren <strong>und</strong> ihre Bedürfnisse de-<br />
cken zu können, sowie ein gesichertes Leben für seine Familie zu finden.<br />
- Wann <strong>und</strong> Wie kam er nach Deutschland ?<br />
1963 kam mein Großvater durch die Einladung seines Vetters nach Deutsch-<br />
land (Rüsselsheim), im Alter von 39 Jahren. Sein Vetter vermittelte ihm einen<br />
Arbeitsplatz in der gleichen Fabrik in der auch er arbeitete, bei Opel in Rüs-<br />
selsheim.<br />
- Wo lebte er ?<br />
Mein Großvater wohnte zunächst in Arbeiterbaracken unter schlechten Le-<br />
bensbedingungen, mit andern Ausländern (Gastarbeitern), hauptsächlich aus<br />
Südeuropa, in der Nähe der Fabrik.<br />
Der Lohn war damals sehr niedrig <strong>und</strong> es konnte sich keiner der Gastarbeiter<br />
in Deutschland den „Luxus“ einer modernen Wohnung leisten.<br />
- War der Arbeitsplatz sicher?<br />
Ein Gastarbeiter war froh, überhaupt einen Arbeitsplatz ergattert zu haben<br />
<strong>und</strong> so willigte mein Großvater auch ein, auch einen im Vergleich zu seinen<br />
deutschen Kollegen schlechter bezahlten <strong>und</strong> unges<strong>und</strong>en Arbeitsplatz zu<br />
bekommen.<br />
Mein Großvater musste oft seinen Arbeitsplatz zwischen den regionalen Fab-<br />
riken wechsele, wie viele seiner ausländischen Kollegen, mit Hilfsarbeitern<br />
konnte die deutsche Industrie ohne Skrupel so umgehen.<br />
Die längste Zeit jedoch arbeitete mein Großvater bis zu seiner Rente bei O-<br />
pel. Mein Großvater war bis zuletzt aktives Mitglied der IGMetall.<br />
- Welche Hilfen gab es für Gastarbeiter?<br />
65
Es bestanden keine Aufstiegsmöglichkeiten für diese Leute in ihrer Arbeit <strong>und</strong><br />
keine Förderungsmöglichkeiten, weder staatliche noch betriebliche.<br />
Es gab keine Hilfe zur Erlernung der Sprache, sowie keine Hilfe bei der Woh-<br />
nungssuche für Familien <strong>und</strong> keine Ausbildung der Kinder.<br />
Bei den Steuerabgaben <strong>und</strong> Sozialabgaben wurden jedoch keine Unterschie-<br />
de gemacht.<br />
- Welche Unterschiede wurden gemacht zwischen Ausländern <strong>und</strong> Deut-<br />
schen?<br />
Bis vor kurzem gab es kein Wahlrecht, auch nicht auf kommunaler Ebene<br />
<strong>und</strong> selbst für EG–Bürger.<br />
Jedes Gr<strong>und</strong>recht musste sich die Gastarbeiterschaft <strong>und</strong> ihre Familien jahr-<br />
zehntelang erkämpfen, neben dem Kampf der allgemeinen Arbeiterschaft<br />
durch die Gewerkschaften.<br />
Ausländer waren oft die ersten an der Front der Arbeitskämpfe, so auch mein<br />
Großvater.<br />
- Wie änderte sich die Bevölkerungsanzahl der Griechen in diesem<br />
Gebiet (Rüsselsheim)?<br />
Von 1960 – 1980 wuchs die Anzahl der griechischen Bevölkerung auf ca. 4<br />
Tausend Menschen, meist Familien an.<br />
Mein Großvater war Vorkämpfer <strong>und</strong> Gründer der Griechischen Gemeinde in<br />
Rüsselsheim, die er als Vorsitzender jahrelang leitete zum Vizepräsident der<br />
Vereinigung aller griechischen Gemeinden in Deutschland. Aktiv wirkte er mit<br />
in der Friedensbewegung <strong>und</strong> in seiner Funktion als Gemeindevorsitzender<br />
half er bei der Gründung einer 6-klassigen griechischen Schule in Rüssels-<br />
heim im Jahre 1967.<br />
- Wann kam die Familie meines Großvaters nach Deutschland (Rüssels-<br />
heim)?<br />
1965 kam die Familie nach, seine Frau <strong>und</strong> zwei Kleinkinder.<br />
- Wie sah die Situation aus nachdem seine Familie kam?<br />
66
Bis 1969 kamen weitere vier Kinder auf die Welt, somit musste auch die<br />
Großmutter zusätzlich arbeiten, um die Ausgaben der Familie zu decken.<br />
Meine Großmutter hatte somit neben ihrem „Hauptberuf“ als Hausfrau zusätz-<br />
lich Arbeit in Fabriken, wie z.B. Opel.<br />
Mein Großvater lebte quasi ghettoisiert zusammen mit seiner Familie zu acht<br />
Personen in einer kleinen Zweizimmerwohnung zehn Jahre lang, direkt an<br />
einem offenen Bahngleis <strong>und</strong> einem Hof mit ca. acht anderen griechischen<br />
Familien.<br />
Erst 1971 wechselte in Rüsselsheim der Wohnort der Familie, sie wohnten<br />
von da an in einer Vier-Zimmer-Sozialwohnung.<br />
Hier konnten sich die Kinder besser entwickeln <strong>und</strong> besuchten nach der<br />
deutschen Gr<strong>und</strong>schule alle das in der Nähe der neuen Wohnung befindliche<br />
Immanuel-Kant-Gymnasium bis zum Abitur, wo sie später in verschiedenen<br />
Städten zum Studium „auswanderten“.<br />
Mein Großvater wurde im Jahre 1988 berentet, die Großmutter erst 1998.<br />
Leider verstarb mein Großvater im Oktober 2000 nach schwerer Krankheit.<br />
Die Wohnung, wo die Großmutter noch lebt, ist immer noch der Mittelpunkt<br />
unserer Großfamilie.<br />
67