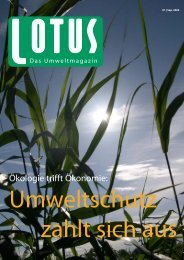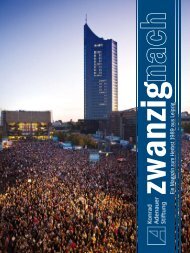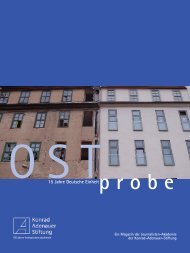Azur Grau - Journalisten Akademie
Azur Grau - Journalisten Akademie
Azur Grau - Journalisten Akademie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
azurgrauLEBEN AM WATT
GUMMISTIEFEL: Besser<br />
sind Surferfüßlinge, die<br />
Füße werden zwar nass,<br />
bleiben aber warm.<br />
WATTWURM: Wussten<br />
Sie's? Wattwürmer bluten<br />
rot, wenn man reinsticht.<br />
KUNI KUMMER: Wahlweise<br />
heißen die Ostfriesen auch<br />
Jansen, Janssen oder Janßen<br />
mit Nachnamen.<br />
FLUT: Vorsicht bei Wattwanderungen:<br />
Der Flutstrom kann in<br />
den Prielen des Wattenmeers<br />
hohe Geschwindigkeiten<br />
erreichen (bis zu 20 km/h).<br />
P.S. Die Jungs vorne und hinten<br />
auf dem Cover sind Vater<br />
und Sohn – auch die Punk-<br />
Tradition ist am Watt noch lebendig.<br />
Fotografiert hat die<br />
beiden Anna Kuhn-Osius.<br />
2 A Z U R G R A U<br />
Moin!<br />
Bis zu den Knöcheln stecken wir im Watt. Denjenigen, die<br />
nicht in letzter Minute noch GUMMISTIEFEL besorgt haben,<br />
kriecht die Kälte die Beine hoch. Echte Touristen eben – nur<br />
waten sie im Winter durchs Watt. Immer in Bewegung bleiben,<br />
auf der Suche nach dem, was wir mit dem Wattenmeer<br />
verbinden. Nach drei Stunden die Erlösung: etwas Dunkles,<br />
Haariges liegt in unseren Händen. Hässlich, dick und träge –<br />
der WATTWURM.<br />
Doch wir begreifen: Das reicht noch nicht. Wir müssen<br />
viel tiefer als bis zu den Knöcheln eintauchen, um diesen<br />
Lebensraum zu begreifen. Das Leben im Watt. Hier werden<br />
Kräfte gemessen: Der Mensch versucht die Natur zu beherrschen,<br />
aber die Natur hat ihre eigenen Spielregeln.<br />
Die Menschen hier oben heißen KUNI KUMMER, Fredi<br />
Fitter oder Hans-Jürgen Jürgens. Sie sind Naturschützer oder<br />
Wirtschaftsinvestoren, Insulaner oder Festländer und manchmal<br />
auch beides. Denn das Leben hier ist geprägt von Gegensätzen:<br />
Umwelt erhalten und dennoch Arbeitsplätze schaffen,<br />
Traditionen leben und gleichzeitig Neuerungen auf den Weg<br />
bringen.<br />
Wenn die FLUT langsam über den Wattboden kriecht,<br />
das Wasser zuerst die Knöchel, dann die Beine umspielt; erst<br />
dann begreift man, wie viel Meer es hier gibt. Manchmal ist<br />
es da, manchmal nicht. Und das macht diese Region einzigartig.<br />
So einzigartig, dass das Wattenmeer bald UNESCO-Weltnaturerbe<br />
werden soll und sich somit eingliedert in die Reihe<br />
erhabener Naturschätze wie der Grand Canyon in den USA<br />
und das Great Barrier Reef in Australien.<br />
Mit dem Bild des blauen Himmels und des Meeres auf<br />
den typischen Urlaubspostkarten im Kopf reisten wir an –<br />
15 Stipendiaten aus der <strong>Journalisten</strong>-<strong>Akademie</strong> der Konrad-<br />
Adenauer-Stiftung. Was wir fanden, war die graue Küstenregion<br />
des Winters. Trotzdem haben wir in zehn Tagen<br />
spannende Geschichten aus dem Schlick gezogen: von Insulanern,<br />
die keine Lust auf Touristen haben, von den Gefahren<br />
eines Krabbenbrötchens und den Abgründen der ostfriesischen<br />
Seele. <strong>Azur</strong>grau eben – das ist das Leben am Watt.<br />
Viel Spaß beim Lesen!<br />
Die Redaktion
FOTO: ANNA KUHN-OSIUS<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
18<br />
20<br />
22<br />
24<br />
26<br />
30<br />
32<br />
34<br />
36<br />
38<br />
40<br />
42<br />
Inhalt<br />
Lebensgefühl<br />
INSULANER UNTER SICH<br />
Endlich sind die Touristen weg: Sturmfrei auf Wangerooge!<br />
KRABBENLIEBE<br />
Ein Mann und das Meer: Fischen wie vor hundert Jahren<br />
FRIESENFITNESS<br />
Nichts für Frischlufthasser: Ertüchtigung für Nordlichter<br />
SO SCHMECKT FRIESLAND<br />
Tee satt: Alles über das Kultgetränk am Watt<br />
STURMFLUTWARNUNG<br />
Was, wenn der Deich bricht? Erinnerungen an die Sturmflut von 1962<br />
Lebensraum<br />
MITGEHANGEN, MITGEFANGEN<br />
Fischer und ihre Netze: Warum Krabbenbrötchen die Umwelt zerstören<br />
DER DREI-LÄNDER-MANN<br />
Er will das Wattenmeer zum Weltnaturerbe machen: Jens Enemark<br />
GEFAHR FÜR DAS WATTENMEER<br />
Weltnaturerbe klingt gut: Aber hilft es auch?<br />
KOMMT DER WANDEL, BLEIBT DAS MEER<br />
Der Klimawandel bedroht die Salzwiesen: Kann man noch etwas tun?<br />
DER ALPTRAUM JEDES UMWELTSCHÜTZERS<br />
Allein gegen Schornsteine: Warum Aktivisten in Wilhelmshaven wenig ausrichten<br />
Lebenswandel<br />
TATORT WATT<br />
Mord im Ferienort: Regine Kölpin macht die Idylle zum Krimischauplatz<br />
STATT STRAND<br />
Ferien auf der Großbaustelle: Wie der Tiefseehafen zur Touristenattraktion werden soll<br />
WILHELMSHAVENER ROYAL<br />
Die Entdeckung der Auster: Ein Gourmetkoch und ein Juwelier machen den Test<br />
FRIESLAND MAL ANDERS<br />
Ein Bürgermeister, ein fliegender Holländer und eine Idee: Baggersee all inclusive<br />
RÖMER IN SICHT<br />
Schon die Römer waren da: Archäologen erkunden, was sie in Friesland antrafen<br />
MIT EINEM KILO SCHLICK WÜRDE ICH ...<br />
... fünfzehn Stipendiaten, zehn Tage, ein Magazin<br />
A Z U R G R A U 3
FOTOS: ANNA KUHN-OSIUS
Lebensgefühl
ES IST WINTER AN DER NORDSEE, AUF<br />
EINER INSEL, DIE EIGENTLICH GESCHLOS-<br />
SEN HAT. DIE HAUPTSTRASSE IST<br />
VERLASSEN, CAFÉS UND RESTAURANTS<br />
HABEN ZU. DOCH WER DENKT,<br />
WANGEROOGE LÄGE IM WINTERSCHLAF,<br />
DER TÄUSCHT SICH. ENDLICH SIND DIE<br />
INSULANER<br />
UNTER SICH<br />
6 A Z U R G R A U
FOTOS: ANDREA HOYMANN (4) / CHARLOTTE POTTS (3)<br />
KUNI KUMMER, 56, LETZTES MAL<br />
AUF DEM FESTLAND VOR ZWEI<br />
WOCHEN, GRUND:<br />
ORTHOPÄDEN-BESUCH<br />
Kuni Kummers Werkstatt ist gerade<br />
einmal fünf mal fünf Meter groß.<br />
Zwei Strandkörbe füllen den Raum.<br />
Beengt ist es jedoch nicht. Hinter den<br />
Fenstern breitet sich die Nordsee aus – Kummer liebt seine<br />
Werkstatt mit Meerblick. Er repariert in den Wintermonaten<br />
die Strandkörbe, die unter den Touristen im Sommer gelitten<br />
haben, hämmert und schraubt so lange, bis die Körbe wieder<br />
bereit für die Saison sind. Kuni Kummer ist froh, wenn die<br />
Insulaner im Winter endlich mal unter sich sind: „Man kennt<br />
dann jeden und kann sich richtig erholen, man kann alleine am<br />
Strand spazieren gehen, Bernstein suchen. Da ist keiner vorher<br />
da gewesen. Das ist eben der Winter hier“, sagt er. „Ich kriege<br />
keinen Inselkoller, sondern einen Festlandkoller.“ Feierabend<br />
bei Kuni Kummer heißt Boßeln mit Freunden. Auch das macht<br />
für ihn den Reiz des Wangerooger Winters aus. Boßeln, das ist<br />
ein friesischer Nationalsport, eine Art Kugelstoßen auf der<br />
Landstraße. Es regnet in Strömen. Kuni Kummer schwingt die<br />
Kugel und schleudert sie auf der menschenleeren Landstraße<br />
in die Ferne. Er lächelt. Das ist der Winter auf Wangerooge.<br />
ELITA MKRTSCHJAN, 16, LETZTES<br />
MAL AUF DEM FESTLAND VOR<br />
VIER WOCHEN, GRUND:<br />
SHOPPEN<br />
Seit Weihnachten ist Elita mit ihrem<br />
Freund Simon Klys zusammen. Übers<br />
Internet hat die Schülerin den<br />
Oldenburger kennen gelernt. Jetzt macht<br />
er eine Ausbildung als Hotelfachmann auf der Insel. Hand in<br />
Hand schlendern die beiden über die Hauptstraße; vom Strand<br />
bis zum Watt, einmal quer über die Insel, brauchen sie zehn<br />
Minuten. Elita ist auf Wangerooge geboren, aber sie weiß, dass<br />
sie die Insel verlassen will. „Manchmal fühlt man sich hier einfach<br />
eingesperrt. Es kam schon vor, dass keine Schiffe fuhren<br />
und auch keine Flugzeuge mehr flogen, das ist dann schon beklemmend“,<br />
sagt die 16-Jährige. Als Elita von ihrem einjährigen<br />
USA-Aufenthalt wiederkam, wirkte die Insel erstmal klein.<br />
„Aber es ist einfach schön, hier aufzuwachsen“, sagt sie. Dieser<br />
Winter ist sowieso schön: Sie hat nun Simon, und der hat im<br />
Winter weniger zu tun, weil weniger Touristen im Hotel sind.<br />
Und sie hilft ihrem Vater, einem armenischen Zuwanderer, im<br />
Café „Krabbe“ aus. Für das Abitur müsste sie im Sommer auf<br />
das Internat am Festland, Simon will dann mitkommen.<br />
Lebensgefühl<br />
HANS-JÜRGEN JÜRGENS, 83, LETZ-<br />
TES MAL AUF DEM FESTLAND IM<br />
JULI 2008, GRUND:<br />
ZAHNARZTBESUCH<br />
„Ich war immer froh, wenn Nebel<br />
war, dann konnte keiner kommen“,<br />
brummelt Hans-Jürgen Jürgens bei einer<br />
Tasse Tee. Er ist auf der Insel geboren,<br />
wie schon sein Vater. Glaubt man seinen Erzählungen, dann hat<br />
er 20.000 Bäume auf Wangerooge gepflanzt, einen Sohn gezeugt<br />
und ein Haus gebaut: die „Teestube“, Pension und<br />
Restaurant. Mit den Touristen konnte er sich trotzdem nie anfreunden,<br />
lobt die Winter, in denen Wangerooge vier Wochen<br />
durch Packeis vom Festland getrennt war. „Die Welt da draußen<br />
interessierte uns doch nicht“, sagt er und macht den<br />
Eindruck, als sei ihm die Welt da draußen auch heute ziemlich<br />
egal. Mit seinen 83 Jahren hat er noch nie ein Fußballspiel geschaut.<br />
Hans-Jürgen Jürgens hat eine recht eigene Sicht auf die<br />
Welt: So habe doch der Kommunist Adorno die Volkslieder zerstört,<br />
am 11. September sei kein Flugzeug in das Pentagon gestürzt,<br />
und ohnehin verfälschten Historiker ständig alles. Deshalb<br />
schreibt der Inselchronist die Geschichte der Insel Wangerooge<br />
auch nochmal neu, ganz gleich, was die anderen Insulaner von<br />
ihm denken: „Ich bin eben Einzelkämpfer.“<br />
RALF BÖSLING ALIAS BOUNTY, 58,<br />
LETZTES MAL AUF DEM FESTLAND<br />
IM JANUAR 2009, GRUND:<br />
URLAUB<br />
„Die Insulaner sind einfach verrückt.<br />
Auf der Insel leben ist ja sowieso immer<br />
etwas anders. Das merkt man auch<br />
an den Charakteren der Leute. Viele trinken<br />
richtig gerne mal einen“, sagt Bounty. Er darf das sagen. Er<br />
ist der Barkeeper in der Kneipe „Kogge“, dem Insulanertreff.<br />
Barbusige Meerjungfrauen, Seemannsfiguren und eine Nymphe<br />
mit einem Geldschein im Slip hängen in seiner Kneipe. Im Regal<br />
stapeln sich Küstennebel, Pernot und Rum. Rauchschwaden<br />
wabern durch die Kneipe, die nicht größer ist als ein durchschnittliches<br />
Wohnzimmer – ein Gemeinschaftswohnzimmer<br />
für die Insulaner. „Im Winter ist alles intensiver. Wir sehen uns<br />
bis zu viermal am Tag, das ist wie eine große Familie.“ Bounty<br />
kennt jeden der 985 Insulaner, weiß zumindest, zu welcher<br />
Familie wer gehört: Aber auch die beste Familie braucht mal<br />
Pause, und so fährt er einmal im Jahr von der Urlaubsinsel<br />
Wangerooge zum Urlaub auf dem Festland, meist nach Bremen<br />
oder Hamburg. Nach vier Wochen Hamburg aber ist er wieder<br />
froh, zurück auf die Insel zu kommen. Charlotte Potts<br />
A Z U R G R A U 7
Lebensgefühl<br />
KRABBENLIEBE<br />
rhard Djurens Bauernhof liegt am Ende einer kleinen<br />
Landstraße in Wremen, kurz vorm Deich. Windböen<br />
zerren an den kahlen Ästen der Bäume, die Luft riecht<br />
nach Salz. Im Schuppen des Fischers scheint die Zeit<br />
stehengeblieben. Im alten Bollerofen knistert ein Feuer.<br />
Drei seiner Hunde haben sich davor zusammengerollt.<br />
Erhard Djuren sitzt auf einem alten Holzstuhl<br />
und webt Weidenzweige um dickere Äste. Reihe um Reihe biegt<br />
er die zarten Zweige wie Draht zurecht, bis ein länglicher Korb<br />
entsteht: eine Reuse. Die braucht er für die kommende Krabbensaison.<br />
Denn Erhard Djuren ist Reusenfischer. In den Sommermonaten<br />
stellt er 20 bis 30 dieser Weidenkörbe im Watt auf. Bei<br />
der nächsten Ebbe verfangen sich darin mehrere Kilogramm<br />
Krabben, Stint und Butt. Wie schon die Fischer vor 200 Jahren<br />
fährt der Wremer von April bis November jeden Tag mit dem<br />
Hundeschlitten ins Watt heraus, um seinen Fang an Land zu<br />
bringen. Er ist der letzte Fischer an der niedersächsischen<br />
Nordseeküste, der diese alte Tradition aufrechterhält.<br />
Als kleiner Junge stand er oft auf dem Deich hinter seinem<br />
Elternhaus. Das Watt erstreckt sich vor ihm bis zum Horizont.<br />
Es ist Mitte der 50er Jahre. Gleich hinter der Grasnarbe des Deichs<br />
fahren die Reusenfischer über einen eingefahrenen Patt mit ih-<br />
8 A Z U R G R A U<br />
rem Hundeschlitten ins Watt. An der Wremer Küste arbeiten<br />
noch 15 Berufsfischer, die ihren Fang wie ihre Vorfahren Anfang<br />
des 19. Jahrhunderts an Land bringen. Ab und zu nehmen sie<br />
den achtjährigen Erhard im Hundeschlitten mit. Dann sitzt er<br />
vorne in der Holzkiste, in der die Fischer ihren Fang transportieren.<br />
Bellend laufen die Hunde über den weichen Wattboden.<br />
Je weiter es rausgeht, desto tiefer sinkt der Schlitten ein. Der<br />
Schlick spritzt dem Jungen bis ins Gesicht. Für die Kinder der<br />
Fischer war so eine Fahrt mit dem Schlitten alltäglich. Für den<br />
kleinen Erhard, der aus einer Familie von Landwirten kommt,<br />
ist sie etwas Besonderes. „Ich war schon als Kind mit Leidenschaft<br />
dabei“, sagt der heute 62-Jährige über das Reusenfischen.<br />
Im März 2009 sitzt Erhard Djuren in der Küche seines<br />
Bauernhauses und blättert in einem vergilbten Fotoalbum. Die<br />
Kacheln hinter der Anrichte haben ein weiß-blaues Friesenmuster.<br />
An der Wand hängt eine Stickerei – blaue Kreuzstiche<br />
auf weißem Leinen. Die Seidenblätter des Albums rascheln beim<br />
Umblättern. Fotos des zugefrorenen Hafens, Kinder laufen über<br />
das Eis. Eine Seite weiter posiert der junge Erhard vor der<br />
Kamera. Stolz präsentiert er eine selbstgeflochtene Reuse. Bereits<br />
als junger Mann sitzt er im Winter im Schuppen und flicht Weidenkörbe.<br />
Im Sommer zieht er zum Fischen mit dem Schlitten<br />
FOTOS: CARLA NEUHAUS
ins Watt. Doch er ist der einzige Fischer in seiner Familie. Auf<br />
Wunsch seiner Mutter lernt er Tischler – seine Schlitten baut<br />
er von da an selbst. Kurz darauf übernimmt er von seinem<br />
Großvater den Bauernhof und wird Landwirt. Während er das<br />
Vieh im Stall versorgt, träumt er vom Leben auf dem Meer. So<br />
oft wie möglich zieht er ins Watt, um seine Reusen zu leeren.<br />
Seine Schweine füttert er mit selbstgefangenen Krabben. „Das<br />
Fleisch schmeckte dann stark nach Fisch“, sagt er und schüttelt<br />
lachend den Kopf. „Heute wäre das unvorstellbar.“<br />
1983 gibt Erhard Djuren die Landwirtschaft auf. Er verpachtet<br />
sein Land und kauft sich einen Kutter. Ihm ist klar, dass er von<br />
der Reusenfischerei allein nicht leben kann. Der Kutter kommt<br />
seinem Traum vom Fischen am nächsten. Bei Hochwasser steuert<br />
er das Boot Richtung Fahrrinne. Weit draußen wirft er die<br />
Netze aus. Möwen umkreisen den Kutter, Gischt spritzt über<br />
die Rehling. Noch heute erinnert eine alte Kapitänskabine in<br />
seinem Vorgarten an seine Zeit auf See. Nach 20 Jahren auf dem<br />
Meer steuert er sein Schiff mit den rot-weißen Planken ein letztes<br />
Mal in den Wremer Hafen. Doch ohne das Fischen kann er<br />
nicht leben, es zieht ihn wieder raus ins Watt. Zu dieser Zeit gibt<br />
es an der Nordseeküste keinen einzigen Reusenfischer mehr,<br />
der mit dem Hundeschlitten rausfährt. Erhard Djuren denkt an<br />
Erhard Djuren hält als Reusenfischer eine alte Tradition<br />
aufrecht. Im Winter flicht er Fangkörbe aus Weidenästen, im<br />
Sommer fängt er mit ihnen im Watt Krabben<br />
WIE DIE FISCHER VOR 200 JAHREN FÄHRT ERHARD DJUREN ZUM<br />
KRABBENFANGEN MIT DEM HUNDESCHLITTEN INS WATT<br />
seine Kindheit und die vielen Fahrten ins Watt. Er will die liebgewonnene<br />
Tradition weiterführen.<br />
Heute kennt ihn in dem kleinen Ort Wremen jeder. Wenn<br />
er im Sommer mit seinem Schlitten zurück an Land kommt,<br />
stehen die Touristen am Deich und werfen neugierige Blicke in<br />
seine Körbe. Die Krabben sind dann noch grau – für viele ein<br />
unbekannter Anblick. Denn ihre rosa Farbe bekommen die Tiere<br />
erst beim Kochen. Oft nimmt Erhard Djuren die Gäste mit auf<br />
seinen Hof. Dort wirft er seinen Fang in einen großen Holzbottich,<br />
in dem er die Krabben kocht.<br />
Jetzt im Winter lagert er in diesem Bottich Anmachholz für<br />
den Bollerofen. Stundenlang sitzt er im Schuppen und flicht<br />
Reuse für Reuse. Bevor Erhard Djuren einen Weidenzweig verarbeitet,<br />
testet er dessen Biegsamkeit. Das Holz darf beim Flechten<br />
nicht brechen. Es ist ein mühseliges Handwerk. Jeder Griff<br />
muss sitzen, damit der Weidenkorb seine runde Form bekommt.<br />
Das will Erhard Djuren seinem fünfjährigen Enkel Loyd in den<br />
nächsten Jahren beibringen. In den Sommermonaten nimmt<br />
er ihn bereits jetzt im Hundeschlitten mit, um ihm ein Gefühl<br />
für die Natur zu vermitteln. Der Großvater hofft: „Wenn er bereits<br />
als kleiner Junge mitfährt, kommt die Lust aufs Reusenfischen<br />
ja vielleicht ganz von alleine“. Carla Neuhaus<br />
A Z U R G R A U 9
FRIESEN-<br />
FITNESS<br />
SPORTSTUDIO KANN JEDER. DIE EINGEBORENEN<br />
HIER IM NORDEN HABEN TRADITIONELL IHRE<br />
EIGENE ART DER KÖRPERERTÜCHTIGUNG. AN DER<br />
FRISCHEN LUFT, NATÜRLICH ...<br />
Statt Wattwandern:<br />
Schlickrutschen<br />
„Blopp“. Dumpf schmatzend lässt das Watt den Gummistiefel<br />
wieder los. Schwarzer Schlick spritzt hoch. Wilhelm Tapken stößt<br />
sich ab. Er kniet auf einem Holzgestell und gleitet damit durch den<br />
Schlamm. Hinter ihm zieht sich eine tiefe Spur durch den Schlick.<br />
Eine Möwe schreit. Gleichmäßig quaatschen die Gummistiefel.<br />
Wilhelm Tapken macht Schlickrutschen<br />
schon seit 55 Jahren, seit er ein kleiner<br />
Junge ist. „Joo“, sagt er. „Das<br />
gehört einfach dazu, zum Jadebusen,<br />
zum Watt.“ Er schiebt<br />
sich seine Matrosen-Wollmütze<br />
aus der Stirn. Dann steigt er wieder<br />
auf seinen Schlickschlitten,<br />
gibt mit einem Bein Schwung,<br />
der Gummistiefel versinkt bis<br />
zum Knöchel im Schlamm. Den<br />
Schlickschlitten hat er selber gebaut. Das ist Tradition so in Dangast,<br />
seinem Heimatort. Einst nutzten die Krabbenfischer die<br />
Schlickschlitten, um zu ihren Reusen rauszufahren. Jetzt gibt es<br />
Kutter und die Schlitten braucht keiner mehr. Außer Wilhelm Tapken.<br />
Der hütet sie und im Sommer kommen die Touristen und bezahlen,<br />
um dreckig werden zu dürfen. Dann gibt es Schlickschlittenrennen,<br />
bei denen das halbe Dorf gegeneinander antritt. „Das ist das Leben<br />
am Watt in Dangast“, sagt Wilhelm Tapken. Er schiebt sich wieder<br />
die Wollmütze aus der Stirn. „Das ist Heimat“, sagt er und es klingt<br />
ein bisschen stolz. Eigentlich sagt er nicht viel.<br />
SCHLICKSCHLITTENRENNEN – DIE REGELN<br />
Wer schafft es als erstes mit seinem Schlitten durch den Matsch ins<br />
Ziel? Das ist die Idee des Schlickschlittenrennens. Mannschaften oder<br />
Einzelkämpfer treten gegeneinander an, oft bunt kostümiert oder ganz<br />
in Weiß gekleidet – damit man den Dreck auch richtig schön sieht.<br />
1 0 A Z U R G R A U<br />
Ganz schön sportlich! Den<br />
Schlickschlitten hat<br />
Wilhelm Tapken selbst gebaut<br />
STATT FANGENSPIELEN:<br />
KLOOTSCHIESSEN<br />
Früher haben die Friesen mit gebrannten Lehmkugeln,<br />
den Klooten, die Römer vertrieben – heute werfen sie mit<br />
bleigefüllten Holzkugeln Rekorde. Nach einem kurzen<br />
Anlauf wird die schwere Kugel mit einer blitzschnellen<br />
Armbewegung von einem Absprungbrett aus hoch in die<br />
Luft geschleudert. Ursprünglich wurden die Wettkämpfe<br />
im Winter auf den gefrorenen Feldern ausgetragen, die<br />
Kämpfer durften nur lange Unterhosen und -hemden tragen.<br />
Warm hielt man sich mit Schnaps, so mancher<br />
Sportler starb an Unterkühlung. Bis heute geblieben sind<br />
wie beim Boßeln die „Käkler“ und „Mäkler“: Zuschauer<br />
und Fans, die die Würfe lautstark kommentieren.
FOTOS: ANNA KUHN-OSIUS<br />
Achtung, Schikanen!<br />
Franz trifft das Hindernis<br />
mit seinem Besen<br />
genau. Heinz (rechts)<br />
ist Spezialist für Hochwürfe;<br />
mehrere seiner<br />
Besen liegen schon<br />
auf den benachbarten<br />
Dächern<br />
STATT STABHOCHSPRUNG:<br />
PULTSTOCKSPRINGEN<br />
Ob Pultstock, Paddstock oder Polsstok<br />
– selten hat es für eine Stange so viele<br />
Namen gegeben wie in Friesland. Drei<br />
bis fünf Meter lang ist sie, mit einer<br />
Scheibe am unteren Ende, damit man<br />
nicht einsinkt im Schlamm. Mit dem<br />
Pultstock hüpften einst die friesischen<br />
Bauern über Wassergräben. Daraus<br />
wurde ein Sport: Ziel des Pultstockspringens<br />
ist es, möglichst breite Gräben<br />
zu überwinden – eine Art<br />
Stabweitsprung.<br />
STATT SPAZIERENGEHEN:<br />
BOSSELN<br />
Boßeln ist der Volkssport der Friesen.<br />
Mittlerweile boßeln aber auch schon die<br />
Iren, Italiener, Amerikaner und Niederländer.<br />
Bei dem Spiel wird eine schwere<br />
Holz- oder Gummikugel auf einem langen,<br />
zuvor festgelegten Straßenabschnitt<br />
so weit wie möglich geworfen.<br />
Wenn sie nicht mehr rollt, ist der nächste<br />
Spieler dran und wirft. Die Idee ist,<br />
die Kugel mit möglichst wenig Würfen<br />
ins Ziel zu bringen – ein Ziel, das oft<br />
zehn oder noch mehr Kilometer weit<br />
entfernt liegt. Für diesen Sport sollte<br />
man also vor allem eines sein: Gut zu<br />
Fuß!<br />
Statt Hausputzen:<br />
Besenwerfen<br />
Franz zieht sich die rote Pudelmütze mit dem gelben<br />
Bommel über die Glatze. Er bückt sich zu dem<br />
Reisigbesen vor seinen Füßen, wiegt ihn kurz in seiner<br />
massigen Hand. Dann holt er aus, schwingt den<br />
Besen vor und zurück. Der Bommel an seiner Mütze<br />
hüpft. „Hol uttt, hol uttt, hol uttt …“ Uwe,Willi, Heinz<br />
und Werner feuern an. Auch sie tragen leuchtend<br />
rote Pudelmützen. Kampfkleidung. Franz schwingt ein<br />
letztes Mal und lässt los. Der Besen saust durch die Luft und<br />
landet klatschend neben dem Weg. „Pudel“, ruft Willi frustriert.<br />
Das ist so ähnlich wie das Aus beim Fußball. Franz<br />
lässt die Schultern hängen. Jetzt ist Heinz dran. Er ist der<br />
Spezialist für hohe Würfe. Drei seiner Besen liegen schon<br />
auf dem Dach der angrenzenden Sporthalle. Der Besen<br />
fliegt, schießt durch den großen Metallring, der auf dem<br />
Parcours steht. „Schikane überwunden“, notiert Willi. Er<br />
ist der Streckenwart, kontrolliert die Würfe. Jeden Sonntag<br />
trainiert die Mannschaft, regelmäßig kämpfen Männer<br />
und Frauen auf Turnieren gegen die Nachbargemeinden.<br />
Auch die werfen Besen. Sogar der Oberbürgermeister<br />
ist dabei und macht bei den Wettkämpfen den Anwurf.<br />
Im Winter werfen sie manchmal Gummistiefel, einfach<br />
zur Abwechslung. „Aber Besen sind besser“, sagt<br />
Franz. Er mag besonders Reisigbesen, „die liegen so gut in der Hand“. Ursprünglich waren<br />
es die friesischen Bauern, die sich Reisigbesen banden und damit ihren Hof kehrten.<br />
Nach dem Putzen wurden die Besen weitergereicht, auf den nächsten Hof geworfen,<br />
damit auch dort geputzt werden konnte. Die Besen wurden reihum geworfen, von<br />
Hof zu Hof – und irgendwann wurde aus dem Werfen ein Sport. Kein ganz ungefährlicher:<br />
Willi sorgt immer dafür, dass alle Teilnehmer hinter dem Werfer bleiben, bis sie<br />
dran sind. Damit keiner getroffen wird. Werner hat mal eine Beule in ein Auto geworfen.<br />
Und Heinz seine Frau erwischt. Aber die war nicht böse, die macht auch Besenwerfen.<br />
Nur zu Hause – „da lässt mich meine Frau nicht ran“, sagt Heinz. „Sie hat Angst, was<br />
ich mit dem Besen anstelle.“ Anna Kuhn-Osius<br />
BESENWERFEN – DIE REGELN<br />
Lebensgefühl<br />
Der genormte Wettkampfbesen ist für Männer 90, für Frauen 80 cm lang und aus Reisig<br />
gebunden. Er wird einen Tag vor dem Turnier in Wasser gelegt, damit er schwerer ist. Ziel<br />
des Wettkampfes ist es, einen abgesteckten Parcours in möglichst wenigen Würfen zu<br />
überwinden. Immer zwei Mannschaften treten gegeneinander an, die Mannschaftsmitglieder<br />
werfen abwechselnd. Auf der Wurfstrecke gilt es, sogenannte Schikanen zu überwinden:<br />
Der Besen muss durch Ringe geworfen werden, über Ecken oder in eine Tonne. Die<br />
Siegermannschaft erwartet nicht nur eine feierliche Zeremonie und Pokalverleihung, sondern<br />
vor allem eine ordentliche Runde Schnaps.<br />
A Z U R G R A U 1 1
THEDA BAKKER-LANGER IST<br />
TEEHÄNDLERIN IN<br />
WILHELMSHAVEN. SCHON<br />
SEIT 245 JAHREN TESTET,<br />
KAUFT UND VERKAUFT IHRE<br />
FAMILIE TEE<br />
„Früher war die Wasserqualität in<br />
Friesland nicht so gut wie heute. Es<br />
gab hauptsächlich Brackwasser. Für<br />
dieses Wasser eigneten sich besonders<br />
die kräftigen, malzigen<br />
Teesorten. Deshalb haben die Leute<br />
Assam-Tees verwendet. Heute hat<br />
unser ostfriesisches Wasser einen<br />
sehr geringen Kalkgehalt und ist<br />
deshalb für Tees perfekt geeignet.“
FOTOS: EVA ZIMMERMANN<br />
DIE MENSCHEN<br />
UND IHR TEE<br />
„Wenn mein Mann und ich campen fahren, haben wir immer 15-Liter-Kanister<br />
mit ostfriesischem Wasser dabei. So sind wir erst einmal eine Woche lang<br />
mit Tee versorgt. Mit dem harten Wasser außerhalb von Friesland schmeckt<br />
der Ostfriesentee einfach nicht.“ Christel Thoss, 63 Jahre<br />
„Wenn es früher bei uns Tee gab, dann stellte meine Mutter alle Tassen nebeneinander<br />
auf den Tisch und goss nacheinander Tee ein. Die erste Tasse<br />
bekam die Hausfrau, weil der Tee am leichtesten war. In der letzten Tasse<br />
war der stärkste Tee. Die bekam der Gast.“ Gertrude Fademrecht, 79 Jahre<br />
„Ich habe durch meine Eltern mit dem Teetrinken angefangen. Die haben<br />
sich häufig Ostfriesentee gemacht. Am schönsten ist es eigentlich, wenn wir<br />
uns nachmittags gemütlich zusammensetzen. Dann gibt es Tee, Kekse und<br />
Kuchen.“ Jens, 16 Jahre<br />
„Als ich geboren wurde und gerade eine Stunde alt war, habe ich schon Tee<br />
bekommen. Man war eben der Meinung, Tee sei ein Allheilmittel.“<br />
Ingeborg Stümpel, 86 Jahre<br />
„Ich hatte mal Nachbarn, die waren echte Ostfriesen. Von denen habe ich<br />
auch das Teetrinken gelernt. Die haben das Teeservice rausgeholt, mit<br />
Stövchen und allem Drum und Dran. Und dann gab es eine Tasse nach der<br />
anderen. Aber so ganz alleine mache ich mir den Tee nicht. Der schmeckt in<br />
Gesellschaft besser.“ Cäcilia Sauer, 24 Jahre<br />
DER TEE UND SEINE GESCHICHTE:<br />
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich ein reger<br />
Teehandel zwischen Ems und Weser. Niederländer<br />
brachten auf ihren Schiffen erste Teesorten<br />
aus Asien nach Europa. Die Ostfriesen begeisterten<br />
sich schnell für den Tee. Weil das<br />
Wasser in ganz Friesland sehr weich ist, kann der<br />
Geschmack der Teeblätter sich besonders gut entfalten.<br />
Ein echter Ostfriesentee besteht zu etwa<br />
Lebensgefühl<br />
SO SCHMECKT FRIESLAND<br />
Hier trinkt man Tee nicht nur, hier lebt man ihn<br />
DIE OSTFRIESISCHE<br />
TEEZEREMONIE<br />
AUFSETZEN<br />
Gießen Sie das nicht mehr kochendeWasser<br />
auf die Teeblätter in der Kanne – drei Teelöffel<br />
pro Liter ergeben den besten Geschmack.<br />
Damit sich das Teearoma besonders gut entwickelt,<br />
gießen Sie den Tee erst nur an, lassen<br />
ihn drei Minuten ziehen und füllen dann das<br />
restliche Wasser ein. Die Teeblätter bleiben auf<br />
dem Kannen-Boden. So kann immer wieder<br />
Wasser nachgegossen werden.<br />
VORSETZEN<br />
Geben Sie weißen Kluntje-Zucker in die<br />
Teetassen. Nach dem Einschenken kommt<br />
Teesahne hinzu. Wichtig: Der Friese rührt seinen<br />
Tee nicht um! Genießen Sie die einzelnen<br />
Schichten des Tees.<br />
AUSSETZEN<br />
Wenn Ihr Teedurst gestillt ist, stellen Sie<br />
einfach Ihren Löffel in die Tasse. Der Friese<br />
weiß dann, dass Sie vorerst genug haben.<br />
90 Prozent aus Schwarzteesorten, die aus der indischen Region Assam<br />
stammen. Damit der Tee das besondere Prädikat „Ostfriesentee“ tragen<br />
darf, müssen die Teeblätter allerdings auch tatsächlich in Ostfriesland gemischt<br />
werden. Für die typisch ostfriesische Teezeremonie holen die<br />
Friesen ein entsprechendes Service hervor. Am besten schmeckt ihnen der<br />
schwarze Tee nämlich aus kleinen Porzellantassen, die mit der typischen<br />
Teerose verziert sind. Mindestens drei Mal am Tag treffen sich viele<br />
Friesen zur sogenannten Teetied (Teezeit). Eva Zimmermann<br />
A Z U R G R A U 1 3
Lebensgefühl<br />
Sonst ist das Watt anders. Am Nachmittag<br />
des 16. Februars 1962 steht Walter Iken<br />
auf dem Maadedeich und sieht, dass die<br />
Ebbe den Grund nicht freigibt. Eigentlich<br />
müsste der Sandboden zu sehen sein, aber<br />
Iken schaut auf eine Wasserfläche, auf der<br />
Wind die Wellen in kleinen Fetzen hoch<br />
weht. Sturmwarnung – für die gesamte<br />
Nordseeküste. Iken muss die Boote in der<br />
Werft seines Vaters sichern. Sie liegt am Hafen des Maadeflusses<br />
in Rüstersiel, zwei Kilometer entfernt vom Deich. Er baut die<br />
Motoren aus den Schiffsbäuchen, zieht die Taue an den Schiffen<br />
straff, bis sie knarzen. Die Boote sollen beim Orkan nicht gegeneinander<br />
schlagen.<br />
Es wird dunkel. Der Wind nimmt zu. Die kahlen Äste der<br />
Bäume peitschen gegen die Scheiben des Lokals „Schröder“ auf<br />
der anderen Seite des kleinen Hafens. Zehn Uhr abends: Iken<br />
sitzt am Stammtisch, prostet seinen Freunden zu, ist froh, dass<br />
er Feierabend hat. Schlammkartoffeln, Cornedbeef und Rote<br />
Beete dampfen auf den Tellern. Der grüne Kachelofen wärmt<br />
den kleinen Saal mit den großen Fenstern. Im Hintergrund klingelt<br />
leise das Telefon. Das hören die Gäste nicht. Sekunden später<br />
rennt der Kellner ins Lokal: „Raus! Alle Mann raus hier!“ –<br />
1 4 A Z U R G R A U<br />
STURMFLUT<br />
WARNUNG<br />
KLIMAFORSCHER WARNEN: BIS ZU EINEM METER<br />
WIRD DER WASSERSPIEGEL BIS ZUM JAHR 2100<br />
ANSTEIGEN. STURMFLUTEN WERDEN HÄUFIGER.<br />
DIE LETZTE JAHRHUNDERTFLUT AN DER NORDSEE-<br />
KÜSTE IST NOCH NICHT EINMAL 50 JAHRE HER<br />
„Da war's kurz still. Da hat keine Gabel mehr geklappert“, erinnert<br />
sich Iken. Der Kellner redet hastig: Schleusenwärter Jansen<br />
habe angerufen. „Der Deich bricht jeden Moment, seht zu, dass<br />
ihr wegkommt“.<br />
Zur gleichen Zeit reißt Jansen die Schleusen auf. Zu spät.<br />
Die Wassermassen stürzen durch den gebrochenen Deich, die<br />
Maade schwillt an. Das Schleusenwärterhaus wird überschwemmt.<br />
„Schröders“ Gäste laufen aus dem Lokal, springen<br />
in die Autos und rasen landeinwärts. Zur gleichen Zeit brechen<br />
in Hamburg die Elbdeiche. Es ist die Jahrhundertflut.<br />
Iken rennt mit den Vereinskollegen auf den kleinen Steg<br />
mit der Vereinskajüte. Die Frauen der Männer essen hier zu<br />
Abend. „,Raus, auf 'n Deich, weg', haben wir gesagt, und da merkte<br />
man schon, dass das Wasser im Fluss stieg“.<br />
Iken sagt heute, dass keiner genau wusste, woher das Wasser<br />
kam. Die Wellen hatten sich am Deich schon totgelaufen. Man<br />
hörte nur den Wind, und auf einmal waren die Hosenbeine nass.<br />
Das Wasser steigt weiter. Der Fluss wird Trichter, leitet die Flut<br />
direkt in den Hafen. Der füllt sich wie eine Badewanne, tritt über<br />
die Ufer. Die Frauen laufen landeinwärts. Die Männer wollen<br />
ihre Boote retten.<br />
Iken steht mit den Kollegen auf der kleinen Erhöhung am<br />
Flussufer. Das Wasser steigt ihm bis zu den Knien. „Wo is'<br />
FOTO: PRIVAT
Vadder?“, fragt Iken einen seiner Freunde. „Der is' in die<br />
Werkstatt gelaufen“, sagt einer der Männer neben ihm. Die<br />
Werkstatt liegt an der anderen Seite des Flusses, etwas tiefer als<br />
das Deichufer, auf dem Iken steht. Er schaut hinüber. Alles ist<br />
überschwemmt. Nur ein paar Dezimeter Wand und das<br />
Flachdach gucken aus der schwarzen, glänzenden Wasserfläche.<br />
Iken schwimmt, klettert auf ein Boot, fährt bis an den Bau heran,<br />
greift nach der Dachrinne, zieht sich hoch, steigt hinauf und<br />
rennt zur Dachluke.<br />
Unter ihm knirscht das Gebälk. Das Schiff in der Werkstatt<br />
treibt vom Wasser auf, drückt gegen die Latten. Er brüllt gegen<br />
den Sturm an. „Papa, wo bist du?“ Der kann die Türen, als das<br />
Wasser steigt, nicht mehr öffnen.<br />
„Ich hab' Schiss gehabt. Der hätte zerquetscht werden können,<br />
ich sah ja fast nichts. Und dann – das war so ein seltsamer<br />
Moment – seh' ich auf einmal in der Dunkelheit, wie sich langsam<br />
das Glas aus der Luke hebt. Ganz langsam. So vorsichtig.<br />
Da hat mein Vater in aller Seelenruhe mit dem Taschenmesser<br />
das Glas vom Rahmen gelöst, damit der Scheibe nichts passiert.“<br />
Iken, noch in Panik, nimmt die Scheibe, will sie wegschmeißen<br />
und den Vater rausziehen. Der Vater stoppt ihn: „Das<br />
Ding war teuer, leg es vorsichtig weg“, ruft er. „Da war ich sauer,<br />
aber naja, so war mein Vater, der hat immer die Ruhe bewahrt.“<br />
Iken greift seinen Vater an den Armen und zieht ihn<br />
aus dem schwarzen Loch. In der Dunkelheit stehen die Männer<br />
auf dem Dach, sehen sich um.<br />
Die Segelschute, das kleine Restaurant am Steg, in dem die<br />
Frauen gesessen hatten, treibt hell erleuchtet auf dem Wasser.<br />
Eine starke Windböe – die Lichter flackern kurz –, Dunkelheit.<br />
„Ich dachte, ich hab alles verloren. Die Werft, die Kindheit<br />
und die Zukunft. Die Krabbenfischer haben immer erst gezahlt,<br />
wenn sie den Fang wieder nach Hause gebracht haben. Da konnten<br />
wir drauf warten. Mein Vater hat die Werft nach dem Krieg<br />
so mühsam aufgebaut, und dann steckte alles im Schlick.“<br />
Der alte Bootsbauer bricht heute – 47 Jahre später – bei dieser<br />
Erinnerung seine Erzählung ab. Seine Hand schnellt zur<br />
blauen Mütze, er zieht sie vom Kopf und wischt sich mit der<br />
gleichen Bewegung über die Augen. Er weint. Gegen Sturmfluten<br />
war damals keiner versichert. Er räuspert sich laut, setzt die<br />
Mütze wieder auf, streicht mit der kräftigen Hand über seine<br />
verstaubte Hobelbank. „Wir haben monatelang Schlick geschaufelt.<br />
Jede Schraube musste davon befreit werden.“ Etwas<br />
keuchend beugt er sich zu einer Klappe unter der Hobelbank,<br />
öffnet sie. „Hier“, sagt er, „da hinten in den Ecken, das ist noch<br />
der Schlick von damals. Wir haben gar nicht alles sauber gekriegt.“<br />
Aber so sei das Leben der Küstenbewohner, erklärt er.<br />
„Das Meer kommt, nimmt sich Vieles, aber wir kehren wieder<br />
zurück und fangen von vorne an. Das haben die Alten auch<br />
schon so gemacht. Is' ja Heimat.“<br />
Wie viele Rüstersieler glaubt Iken, dass die Deiche heute sicher<br />
sind. „Seit ‘62 hat sich ja viel getan“, sagt er. Wenn es nur<br />
um den Deichbau geht und die Arbeit der Ingenieure und<br />
Deichwarte, dann spricht er, wie die meisten Leute, lobend und<br />
anerkennend. In solchen Momenten wirkt er ganz sicher, da<br />
scheint die Sturmflut weit weg, fast unmöglich.<br />
„Aber das Meer“, sagt er, „der blanke Hans“, er nimmt wieder<br />
seine Mütze ab, schaut mit seinen blauen Augen durch die<br />
gelblichen Scheiben des Schuppens hinaus. „Der blanke Hans<br />
– ich weiß nicht; man kann versuchen, die Zeichen zu deuten,<br />
wenn die Möwen ins Land fliegen und die Tiere unruhig werden.<br />
Das kann man deuten. Aber damals in der Nacht, da hat<br />
doch keiner damit gerechnet, dass diese Sturmflut kommt.“<br />
Die Urgewalt der Wassermassen am eigenen Leib zu spüren,<br />
das flößt, sagt der 63-Jährige, tiefen Respekt ein – lebenslang.<br />
Angst, meint er, während er das Schloss wieder an die<br />
Türkette des Schuppens hängt, Angst darf man nicht haben,<br />
aber den Respekt vor dem Wasser, den kennt wohl jeder<br />
Küstenbewohner. „Wenn man die Bilder im Fernsehen gesehen<br />
hat, beim Tsunami, als die Welle kam, da haben die Leute doch<br />
am Strand gestanden und gestaunt und gesagt: ,Och, was kommt<br />
da denn?'“ Er schüttelt leicht den Kopf: „Ich glaube, wir werden<br />
das Wasser nie ganz verstehen.“ Esther Stallmann<br />
UND HEUTE – HALTEN DIE DEICHE TROTZ KLIMAWANDEL?<br />
FRAGEN AN FRÜSMER ORTGIES,<br />
EHRENAMTLICHER VERBANDSVORSTEHER DES<br />
DRITTEN OLDENBURGISCHEN DEICHBANDS<br />
Neuesten Prognosen zufolge steigt der Meeresspiegel<br />
bis 2100 um bis zu einem Meter an. Wie reagieren Sie?<br />
Neue Theorien über den Meeresspiegel gibt es immer wieder.<br />
Wir haben uns entschlossen, unsere Arbeiten an den Deichen<br />
auf die Prognosen des Weltklimarates auszurichten – die sagen<br />
einen weniger drastischen Anstieg voraus. Wir erhöhen die<br />
Deiche nach den wissenschaftlichen Angaben, auf die wir uns<br />
in den letzten Jahren verlassen haben. Ansonsten könnte man<br />
jeden Monat seine Pläne umschmeißen.<br />
Könnte man auf die neuen Ergebnisse der<br />
Klimaforscher denn überhaupt reagieren?<br />
Wir müssten es schaffen, die Deiche anzupassen. Das würde<br />
teuer werden. Deichbau ist immer eine extrem teure<br />
Angelegenheit: Ein Kilometer Deich kostet bis zu fünf Millionen<br />
Euro. Das schreckt erst mal ab. Der Sachwert in den<br />
Küstenregionen ist allerdings um ein Vielfaches höher als das,<br />
was investiert werden müsste.<br />
Können die Deiche denn noch erhöht werden?<br />
Dabei ist nicht nur Geld das Problem, sondern auch das<br />
Material: Wird ein Deich um einen Meter erhöht, muss der Fuß<br />
zehn Meter breiter werden. Um Kosten zu sparen, will man die<br />
Deichlinie natürlich so kurz wie möglich halten. Ideal wäre es<br />
deshalb, wenn es gar keine Buchten gäbe, die die Deichlinie verlängern.<br />
Das widerspricht aber den Interessen des Naturschutzes,<br />
der die natürliche Form der Buchten erhalten will.<br />
Viele Küstenbewohner sagen, dass sich das Meer nun<br />
zurückholt, was ihm der Mensch vor Jahren genommen<br />
hat. Was sagen sie?<br />
Ich sage, dass wir uns das zurückholen, was sich das Meer<br />
genommen hat. Es geht hier um die Menschen, nicht um das<br />
Meer. Wenn man es einfach lassen würde, dann läge Oldenburg<br />
bald an der Küste.<br />
A Z U R G R A U 1 5
FOTOS: ANDREA HOYMANN
Lebensraum
Lebensraum<br />
MITGEHANGEN,<br />
MITGEFANGEN<br />
DAS KRABBENBRÖTCHEN IST EIN<br />
MARKENZEICHEN DER REGION.<br />
DOCH DER PREIS IST HOCH:<br />
FÜR EIN KILO KRABBEN STERBEN<br />
BIS ZU NEUN KILO FISCHE UND<br />
KREBSE ALS BEIFANG<br />
Es zischt und brodelt. Bläschen steigen auf, sprudeln nach<br />
oben, weißer Schaum bildet sich an den Rändern.<br />
Manchmal knackt es leise, platzt, blubbert und kracht.<br />
Stück für Stück färbt sich rosa, was eben noch glasig und farblos<br />
war. Die kleinen Krabben werden weich und zart. Dann vom<br />
Heißen ins Kalte – in die Kühltruhe unter Deck. Irgendwann,<br />
gesäubert und gepult, zwischen zwei Brötchenhälften. Vielleicht<br />
mit Cocktailsoße ... Krabbenbrötchen bekommt man überall in<br />
Deutschland, aber wer in den Norden kommt, nach Kiel, Sylt,<br />
Husum, der muss einfach eins essen. Am besten direkt am Hafen,<br />
vor sich das Wasser, die bunten Boote, den fernen Horizont.<br />
Hinter sich den Deich. Moin, moin sagen die Leute hier, der<br />
Geruch von Fisch und Algen zieht herüber, Möwen zetern in<br />
der Luft. Ein knallblauer Kutter mit weißen Masten tuckert aus<br />
dem Hafenbecken von Fedderwardersiel aufs offene Meer hinaus,<br />
die Wellen schlagen sanft gegen die Hafenmauer.<br />
Söhnke Thaden – blaue Mütze, Seemannspulli, große schwielige<br />
Hände – fährt auf seiner „Christine“ zum Fischen raus, so<br />
wie es schon sein Vater, sein Großvater und dessen Vater und<br />
Großvater getan haben. Thaden ist Krabbenfischer in der fünften<br />
Generation. Ein harter Job, den er liebt – genau wie die frischen<br />
Krabben, die er mit „Christine“ aus dem Meer zieht und<br />
noch an Bord rosa und weich kocht.<br />
Einem anderen allerdings würden die Krabben im Hals stecken<br />
bleiben: Umweltschützer Hans-Ulrich Rösner hat mit der<br />
Umweltstiftung WWF gerade die Studie „Nicht nur Krabben<br />
im Netz“ herausgebracht – und die Krabbenfischer mächtig verärgert.<br />
Bis zu neun Kilo kleine Krabben, Babyschollen oder junge<br />
Seezungen und Kabeljaus sterben der Studie zufolge, damit<br />
am Ende ein Kilo Krabben in der Kühltruhe landet. An so ge-<br />
NIE WIEDER KRABBENBRÖTCHEN?<br />
Ein Kompromiss zwischen Umweltschützern und<br />
Krabbenfischern könnte das Siegel des Marine<br />
Stewardship Councils (MSC) sein, das ein Teil der<br />
Krabbenfischer derzeit anstrebt. Es wird an Fischereien<br />
vergeben, die geprüft nachhaltig wirtschaften.<br />
Unter anderem werden ökologische Verträglichkeit<br />
der Fischerei und Qualität des Managements bewertet.<br />
Auch das Beifangproblem zählt zu den Kriterien.<br />
Das MSC soll u.a. für eine bessere Akzeptanz der<br />
Produkte bei kritischen Verbrauchern sorgen.<br />
nannten Baumkurren ziehen Krabbenkutter ihre Netze auf<br />
Kufen über den Meeresboden. Die am Boden lebenden Krabben<br />
werden aufgescheucht, aufgewirbelt und vom hinterhergezogenen<br />
Netz eingefangen. Engmaschig müssen die Netze sein:<br />
Die kleinste befischte Garnelenart, Crangon crangon, wird maximal<br />
neun Zentimeter lang. Und nicht nur Krabben werden<br />
aufgewühlt. Alles, was größer ist, bleibt erstmal mit hängen,<br />
wird nach mehreren Stunden tropfend aus dem Wasser gezogen,<br />
in glänzenden Stahltrommeln an Deck durchgesiebt. Der<br />
unerwünschte Beifang geht zurück ins Meer – mal tot, mal lebendig.<br />
Unverhältnismäßig, unnötig und verschwenderisch, sagen<br />
Umweltschützer wie Rösner. Über 30 Millionen Tonnen,<br />
ein Drittel des weltweit gefangenen Fisches, werden so jedes<br />
Jahr als Beifang aus dem Wasser gezogen, dann zurückgeworfen.<br />
Delphine, die sich in Thunfischnetzen verfangen, Schollen,<br />
die in Krabbennetzen hängen bleiben, Jungfische, die noch zu<br />
klein für den Markt sind. Die Liste der Forderungen von<br />
Umweltschützern ist lang. Eine davon: fischfreundliche Netze<br />
– besonders für die Krabbenfischerei.<br />
Das Ziel: die knapp 250 Krabbenkutter, die an der deutschen<br />
Nordseeküste liegen, konsequent mit modernen Sieb- oder<br />
Trichternetzen auszustatten. Ein Großteil der unerwünschten<br />
Fische kann sich dann noch unter Wasser aus dem zunächst<br />
großmaschigen Trichternetz befreien. Nur die Krabben werden<br />
in die engen Maschen weitergeleitet und am Ende an Deck gezogen,<br />
sortiert und gekocht. Siebnetze sind zwar laut EU-Gesetz<br />
seit 2003 Pflicht, nationale Ausnahmeregelungen sorgen aber<br />
dafür, dass viele Fischer in Deutschland immer noch ohne sie<br />
fahren.<br />
Thaden und seine „Christine“ fischen längst mit Trichternetzen,<br />
vor allem, weil das viel Sortierarbeit an Deck erspart.<br />
Ihm reicht das – den Umweltschützern nicht. Studien der letzten<br />
Jahre zeigen: Gerade im Wattenmeer sind die Beifangquoten<br />
besonders hoch. „Die Krabbenfischer plündern mit ihren<br />
Baumkurren die Kinderstube der Nordsee, das Wattenmeer“,<br />
klagt Rösner. „Viele Fische wachsen hier im flachen Wasser und<br />
in den Prielen heran. Genau da, wo dann die Krabbenkutter<br />
ihre Netze durchziehen. Das müssen wir stoppen“.<br />
Fischer wie Söhnke Thaden sehen dafür keinen Grund. Seit<br />
Jahrhunderten fischen er und andere in genau den Gewässern,<br />
FOTOS: LUISE SAMMANN (4) / HANS -ULRICH RÖSNER/WWF (1)
Fischer Thaden<br />
hat seinen Kutter<br />
„Christine“<br />
längst mit fischfreundlichen<br />
Trichternetzen<br />
ausgerüstet und<br />
erspart sich so<br />
viel Sortierarbeit<br />
an Deck. Vor<br />
allem aber verschonen<br />
die<br />
modernen Netze<br />
Fische und andere<br />
Meerestiere,<br />
die in herkömmlichenKrabbennetzen<br />
zu<br />
Tausenden als<br />
unerwünschter<br />
Beifang sterben<br />
aus denen sie die Naturschützer nun am liebsten vertreiben wollen.<br />
„Ich bin doch selbst Naturschützer!“, sagt Thaden, schüttelt<br />
den Kopf. „Wir Krabbenfischer wollen die Natur erhalten, wir<br />
leben mit ihr, nicht gegen sie – genau, wie vor uns unsere Väter.“<br />
Die Bedingungen allerdings haben sich verändert. Große moderne<br />
Fangflotten ziehen ihre Netze durchs Wattenmeer, die<br />
Fangquoten sind gestiegen. Vor allem sie sind es, die die Umwelt<br />
belasten, den Krabbenbestand gefährden, anderen Fischarten<br />
schaden. Rösner und andere Naturschützer fordern deswegen:<br />
Im Wattenmeer, vor allem im Nationalparkgebiet, sollte die<br />
Krabbenfischerei verboten oder stark eingegrenzt werden.<br />
Zumindest hier müssten die Fische sich vermehren und aufwachsen<br />
können, ohne von engmaschigen Netzen bedroht zu<br />
werden.<br />
„Krabbenfischerei extrem umweltschädlich“ oder „Krabbenfischerei<br />
belastet andere Fischarten“ titelten die Zeitungen nach<br />
dem Erscheinen der WWF-Studie zum Beifang. Fischer Thaden<br />
ärgert sich über die lauten Umweltschützer: „Da werden irgendwelche<br />
Sachen in die Medien gesetzt, aus reiner Willkür,<br />
völlig aus der Luft gegriffen. Die stehen dann da erstmal. Und<br />
so'n trauriger Seehund oder 'ne verstorbene Scholle kann den<br />
Leser oder Hörer natürlich mehr sensibilisieren, als wenn da 'n<br />
Fischer steht und sagt, das stimmt nicht.“<br />
Die Landespolitiker aber beeindrucken traurige Seehunde<br />
nicht. Politische Auswirkungen wird es nicht geben, selbst die<br />
Grünen unterstützen die Krabbenfischer. Es gebe keinen Politiker<br />
in der Umgebung, der es wagen würde, sie laut in Frage zu stellen,<br />
kritisiert Umweltschützer Rösner. Der Imagefaktor der kleinen<br />
Krabbe ist zu groß. „Für das Bild der Küstenregion ist das<br />
ein kleiner, aber wesentlicher Aspekt. Die bunten Kutter, die<br />
Seemänner, der frische Fisch am Hafen ... All diese Dinge, die<br />
gehören einfach dazu“, sagt Jürgen Janssen vom Referat für<br />
Wirtschaft und Regionalmanagement. Und auch Arbeitsplätze<br />
hängen an der Küstenfischerei. Vom Fischer über den Bootsbauer<br />
bis hin zum verarbeitenden Gewerbe. Fischer Thaden ist nur<br />
einer von Tausenden, der mit Krabben sein Geld verdient – in<br />
einer Region, die fast ausschließlich vom Tourismus abhängt.<br />
Thaden steht im Führerhaus seiner „Christine“, hat den Motor<br />
angelassen. Ein Mitarbeiter holt die Taue ein. Fünf Tage werden<br />
sie auf See bleiben, bei guten Bedingungen mit etwa 1.000<br />
Kilo Krabben zurückkommen, rosa und weich, frisch gegart. So<br />
wie es schon sein Ur-Urgroßvater vor ihm gemacht hat. Doch<br />
solange die Krabben aus der „Kinderstube der Nordsee“ kommen,<br />
werden Umweltschützer wie Hans-Ulrich Rösner weiterkämpfen:<br />
„Wir wollen die Krabbenfischerei nicht abschaffen,<br />
aber wir wollen sie verändern“. Luise Sammann<br />
A Z U R G R A U 1 9
Lebensraum<br />
Einmal in der Woche fährt er ans Watt, um das Gefühl<br />
wieder zu erwecken, das der Blick einst in ihm ausgelöst<br />
hat. Vor 34 Jahren, auf Schiermonnikoog, der kleinsten<br />
Wattenmeerinsel in den Niederlanden. Breite Strände, haushohe<br />
Dünen. Sommerurlaub mit seiner Frau. Sie: Holländerin.<br />
Er: Däne. Sie sagte: Das Wattenmeer ist holländisch. Nein, dänisch,<br />
dachte er. Und dann, als die Vögel über ihnen kreisten,<br />
Möwen kreischten, streckte er die Arme aus, den einen gen Osten<br />
und den anderen gen Westen, er schmeckte das Salz auf der<br />
Zunge, spürte den Wind im Gesicht und begriff, dass dieses Watt<br />
das gleiche war, wie das, an dem er als Kind in Dänemark jedes<br />
zweite Wochenende Sandburgen baute. Das gleiche, für das er<br />
nun auf den Ehrentitel hofft.<br />
Im Juni soll das Wattenmeer der Nordsee Weltnaturerbe<br />
werden. Jens Enemark, 59, koordinierte die Bewerbung, kommunizierte<br />
mit den Anrainerstaaten. Man könnte auch sagen:<br />
Er ist einer der Väter der Bewerbung für das Weltnaturerbe.<br />
Aber von ihm hört man solche Worte nicht. Seine Rolle würde<br />
er nie so beschreiben. Er sagt: „Es gibt hunderte Väter, hunderte<br />
Mütter, die auf dieses Kind Weltnaturerbe warten.“ Klaus<br />
Koßmagk-Stephan von der Nationalparkverwaltung in Schleswig-Holstein<br />
korrigiert: „Es gibt zwei Handvoll verlesener Leute,<br />
die schon früh für den Naturschutz eingetreten sind. Jens<br />
Enemark ist einer davon. Seine Leidenschaft ist zu spüren. Er<br />
macht das mit ganzer Seele.“<br />
Das trilaterale Leben, also das der drei Anrainerstaaten des<br />
Wattenmeers, verkörpere er wie kein anderer, hieß es in einer<br />
Laudatio, als Enemark vor drei Jahren die „goldene Ringelgansfeder“<br />
verliehen bekam, eine Auszeichnung für die internationale<br />
Zusammenarbeit. Enemark ist das trilaterale Gesicht,<br />
1987Das trilateraleWattenmeersekretariat<br />
wird gegründet.<br />
Die Aufgabe: der Schutz<br />
des Wattenmeeres. Geleitet<br />
wird es von Jens<br />
Enemark.<br />
PRO WELTNATURERBE<br />
DER DREI-<br />
LÄNDER-<br />
DIE UNESCO IM SOMMER<br />
ÜBER DEN NATURRAUM IM<br />
NORDEN URTEILT, HOFFT VOR<br />
MANNWENN<br />
ALLEM EINER AUF DEN TITEL:<br />
JENS ENEMARK, LEITER DES<br />
WATTENMEERSEKRETARIATS,<br />
IST DER VATER DER BEWERBUNG<br />
1991 Die Niederlande,<br />
Deutschland und<br />
Dänemark beschließen,<br />
das Wattenmeer für<br />
eine Nominierung zum<br />
Weltnaturerbe vorzuschlagen.<br />
2000Eine<br />
Machbarkeitsstudie,<br />
der so genannte Burbridge-Report<br />
zeigt:<br />
Das Wattenmeer<br />
verdient den Weltnaturerbestatus.<br />
das trilaterale Gemüt. Das erwähnt jeder seiner Kollegen, und<br />
es scheint, als sei diese eine der wenigen Wahrheiten, die er<br />
schnell offen legt: Verheiratet mit einer Niederländerin, arbeite<br />
er in Deutschland, spreche vor allem Englisch und träume<br />
nur auf Dänisch.<br />
Ein freundlicher, unprätentiöser Mensch sitzt da in seinem<br />
Büro, zweiter Stock, Sekretariat in Wilhelmshaven. Ein helles<br />
Zimmer, an den Wänden Rahmen mit Küstenumrissen, datiert<br />
auf das 16. und 17. Jahrhundert. Daneben spätere Stücke der<br />
Romantik. Der Kreidefelsen auf Rügen, der Mondaufgang am<br />
Meer, Caspar David Friedrichs Stimmungsbilder von der Ostsee.<br />
Enemark mag die vorgelagerten Inseln in Ostfriesland lieber,<br />
vor allem die zweite von rechts, Spiekeroog. Lieber noch: die<br />
Halligen. Wegen der Ruhe, Sanftmut, Unberührtheit. Und wegen<br />
des Mittendrin-Seins. Mittendrin in der Einsamkeit, einer<br />
Enklave in der dicht besiedelten Industriegesellschaft.<br />
Enemark spricht ruhig, als scanne er jeden persönlichen<br />
Satz, bevor er ihn intoniert. Er weiß einen Moment nicht, wohin<br />
mit seinen Händen, seine rechte Augenbraue zuckt aufgeregt<br />
hin und her, dann verfängt er sich im Netz der Rationalität.<br />
Enemark, der Funktionär. Ein Mann, dem nicht viele Sätze zu<br />
entlocken sind, bei dem selbst seine Frau bohren muss, woran<br />
er arbeitet, welche Hürden auf dem Weg zum Weltnaturerbe<br />
schon genommen sind. Diese Umrisse sind bekannt, Details<br />
kommen nach und nach hinzu. So skizziert sich seine zweite<br />
Seite. Enemark, der Wattenmeerfreund, der den Wechsel von<br />
Ebbe und Flut mag.<br />
1967, ein Gymnasium in einer Kleinstadt nahe Ribe. Biologieunterricht.<br />
Der Lehrer fuchtelt mit den Händen, untermalt<br />
seine Sätze mit großen Gesten. Sie erzählen von der Mystik der<br />
2001 Hamburg macht im September<br />
den ersten Schritt: Als erstes der drei beteiligten<br />
Bundesländer spricht es sich für die Nominierung<br />
aus. Im Oktober tagt im dänischen<br />
Esbjerg die Wattenmeerkonferenz. Eine<br />
zweite Studie unterstreicht die Relevanz des<br />
Wattenmeeres als „Naturgut“.<br />
FOTO: ANNA KUHN-OSIUS<br />
2002 Niedersachsen<br />
stimmt<br />
der Anmeldung zu.<br />
Mit der örtlichen<br />
Bevölkerung soll<br />
die Anmeldung vorbereitet<br />
werden.
„DEN WATTVIRUS WERDE<br />
ICH NIE WIEDER LOS –<br />
WILL ICH AUCH GAR NICHT“<br />
Natur und der Notwendigkeit ihres<br />
Schutzes. Sie schrillen dem 17 Jahre alten Schüler wie Sirenen<br />
in den Ohren. Er speichert die Sätze ab, um sie Jahrzehnte später<br />
wieder abzurufen, sie sich anzueignen. Diese Liebe zwischen<br />
Mann und Watt war keine auf den ersten Blick, sagt seine Frau<br />
Gineke, er hat sie sich erarbeitet. Und die Vögel, die zwölf<br />
Millionen Zugvögel, die am Watt rasten, die er Tag für Tag beobachtet,<br />
von deren Vielfältigkeit er schwärmt, was ist damit?<br />
„Er weiß da nicht viel drüber, gut, inzwischen ja, aber er hat es<br />
nur nach und nach lieben gelernt.“ Wattvirus nennt Jens<br />
Enemark es selbst.<br />
Infiziert seit Mitte der Siebziger. Das Schlüsselerlebnis: der<br />
Sommerurlaub auf Schiermonnikoog. Der weitere Verlauf entwickelt<br />
sich aus dem Zufall. Nach dem Politikstudium arbeitet<br />
er erst als Lehrer, sucht einen Job in Holland. Er landet bei der<br />
Raumplanung für Provinzen, Abteilung: Wattenmeer. 1987 wurde<br />
das Wattenmeersekretariat gegründet, Enemark wurde Chef.<br />
Mehrmals ist er seitdem in Konsensentscheidungen von allen<br />
drei Ländern bestätigt worden. Weil er in die Köpfe der Dänen,<br />
Niederländer und Deutschen gucken kann, weil er weiß, wie die<br />
Uhren in allen Ländern ticken, sagt Hubertus Hebbelmann von<br />
der deutschen Delegation. Codewort: Trilaterale Figur. 1991<br />
dann das trilaterale Projekt. Seitdem hat Enemark sein Herz an<br />
diesen Landstrich verloren. Seitdem arbeiten die Regierungen<br />
auf die Auszeichnung hin, eine Art Gütesiegel, das extraordinäre,<br />
besonders erhaltenswerte Landstriche bekommen.<br />
Sie schreiben Dokumente und Briefe, studieren Gutachten,<br />
sprechen mit Schiffern, Fischern, Landwirten, Naturschützern,<br />
vor allem mit all denen, die das Projekt von Anfang an in der<br />
Luft zerrissen haben. „Ein zäher Kampf“, „ein langer Weg der<br />
Überzeugungsarbeit“, bilanzieren Mitarbeiter aus den Nationalparkverwaltungen<br />
und Umweltministerien, all jene, die Enemark<br />
2005Wattenmeerkonferenz im niederländischen<br />
Schiermoonikoog: Dänemark<br />
klinkt sich aus, erst soll geprüft<br />
werden, ob das Wattenmeer Nationalpark<br />
wird. Die Niederlande und Deutschland<br />
gründen eine Arbeitsgruppe, die vom<br />
Wattenmeersekretariat koordiniert wird.<br />
2007Der<br />
Landtag von<br />
Schleswig-Holstein<br />
stimmt für das<br />
Welterbe. Damit<br />
stehen überall die<br />
Zeichen auf Grün.<br />
18 Jahre lang auf dem Laufenden hielten. „Nur weil wir<br />
alle an einem Strang zogen, hatte dieses Projekt eine<br />
Chance“, resümiert Enemark. Er versöhnte nicht, er vermittelte.<br />
Eine privilegierte Rolle, wie er sagt. Eine, die<br />
ihn nur selten zum Volk brachte, wenn aber doch, vergaß<br />
er die Situationen, die Stimmung nicht. Zum<br />
Beispiel diese: Bürgerdiskussion in Husum, 2001.<br />
Schwarze Letter auf einem weißen Plakat: „Ein Erbe<br />
muss man nicht annehmen.“ Heute, sagt er, ist diese<br />
Skepsis der Menschen mehr dem Stolz gewichen.<br />
Dänemark hält sich bislang aus der Bewerbung<br />
heraus, das Land kann dem Naturerbe-Projekt aber<br />
später noch beitreten. So haben nur die Niederlande<br />
und Deutschland unter Vorsitz des Bundesumweltministeriums<br />
den Nominierungsantrag ausgearbeitet<br />
und im Januar 2008 die Aufnahme beantragt.<br />
Enemark hielt im Wattenmeersekretariat in<br />
Wilhelmshaven die Fäden zusammen. „Hätte es diese<br />
Zusammenarbeit nicht schon gegeben, dann wäre<br />
die Anerkennung nicht so schnell verlaufen, dann<br />
hätte erst ein gemeinsames Management geschaffen<br />
werden müssen“, sagt Hubertus Hebbelmann vom Umweltministerium<br />
in Niedersachsen.<br />
Ein paar Monate vor der Entscheidung sind die Befürworter<br />
optimistisch. Jens Enemark, der Ehrgeizige. Man sieht ihm diese<br />
Liebe, diese Leidenschaft nicht an, wenn er in seinem Büro<br />
am Konferenztisch sitzt. Aber man spürt, wie er nach und nach<br />
in sie eintaucht, wenn er, eingehüllt in eine blaue, dicke<br />
Daunenjacke, am Deich entlanggeht. Nein, er geht nicht, er hastet,<br />
stoppt, hastet, stoppt. Es ist der Enemark-Expeditionsgang.<br />
Die Kälte flirrt, der Himmel ist fast bis zur Erde getaucht, verschwimmt<br />
mit Dunst und Watt in grauen Tönen. Dangast, eine<br />
700-Seelen-Gemeinde am Jadebusen, an einem Regentag im<br />
März.<br />
Es ist ein halbes Jahr her, dass er hier war, im September, zusammen<br />
mit Pedro Manuel Rosabal, einem Vertreter der Internationalen<br />
Naturschutzunion. Im Sommer, wenn das Unesco-<br />
Komitee in Sevilla entscheidet, ob es den Titel verleiht, orientiert<br />
es sich vor allem an dessen Votum. Eine Reise an mehr als<br />
30 Orte an elf Tagen. Spiekeroog, Neuharlingersiel, Groningen,<br />
Ameland, Lauwersoog, Terschelling, Texel, Tönning, Halligen<br />
bis nach Dagebüll, das an die Grenze zum Süden von Skandinavien<br />
kratzt, dann nach Dangast.<br />
„Da“, flüstert Enemark, „die ersten Vögel aus Afrika.“ Erst ist<br />
es Euphorie, Erklär-Ton folgt: Das Watt ist ihr Lebenselixier. Der<br />
Knutt zum Beispiel. 140 Gramm wiegt er, wenn er die Nordsee<br />
erreicht, dann frisst er sich die Hälfte seines Gewichts im Laufe<br />
von vier Wochen an, fliegt gestärkt weiter. Unglaublich, einmalig.<br />
Enemark schaut durch sein Fernglas. In Dangast gibt es<br />
keine Dünen, es ist einer der wenigen Orte am Festland, an dem<br />
es keinen Schutzdeich gibt. Und einer der vielen, an denen die<br />
Erinnerung kommt. An die kleinste Wattenmeerinsel der<br />
Niederlande, an den Sommerurlaub vor 34 Jahren. Leise spricht<br />
der Däne: Sie werden beitreten, ganz gewiss. Sonja Hartwig<br />
2008 Die Niederlande und<br />
Deutschland beantragen im Januar<br />
die Aufnahme in die Unesco-Liste.<br />
Hamburg springt in letzter Minute<br />
ab. Der Grund: Die Elbvertiefung ist<br />
noch nicht abgesichert. Der Senat<br />
befürchtet Verzögerungen.<br />
2009Mehr als 35 Experten prüfen<br />
die Bewerbung. Im Juni entscheidet<br />
die Kommission in Sevilla. Im Fall<br />
einer Anerkennung wäre das Wattenmeer<br />
das zweite Weltnaturerbe in<br />
Deutschland. Weiterer Titelträger: die<br />
Grube Messel bei Darmstadt.
Reiner Schopf hat 30 Jahre lang als Ranger<br />
auf der knapp 5 Quadratkilometer großen Vogelinsel<br />
Memmert gelebt. Dort setzte er sich besonders für ein<br />
Verbot der Jagd im Naturschutzgebiet ein. Heute engagiert<br />
sich der Naturschützer im Wattenrat, einem<br />
verbandsunabhängigen Zusammenschluss von Umweltaktivisten.<br />
Herr Schopf, Sie sind Naturschützer und sprechen sich<br />
trotzdem gegen die Ernennung des Nationalparks<br />
Niedersächsisches Wattenmeer zum Unesco-Weltnaturerbe<br />
aus. Warum?<br />
Weil es keinen Schutz für die Natur bringt, sondern nur als<br />
Label für den Fremdenverkehr dienen soll. Das ist ja auch die<br />
klar formulierte Absicht der Landesregierung. An der Wattenmeerküste<br />
gibt es 30 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Das<br />
ist bereits jetzt absoluter Massentourismus. Den zu steigern bedeutet,<br />
dass der Naturschutz noch mehr als bisher ins Abseits<br />
gerät. Den Tourismus mit dem Label Weltnaturerbe zu fördern<br />
kann deshalb nicht im Sinne des Naturschutzes sein.<br />
Seit 1986 ist das Wattenmeer Nationalpark – mit positiven<br />
Folgen: Die Kegelrobbe ist wieder häufiger anzutreffen,<br />
der Löffler- und Kranichbestand erholt sich.<br />
Was ist daran schlecht?<br />
Den positiven Entwicklungen stehen viele negative gegenüber.<br />
Dass der Löffler wieder hier brütet, ist keine Folge des<br />
2 2 A Z U R G R A U<br />
Schutzes. Die niederländische Population hat sich in unserer<br />
Region ausgebreitet. Der Robbenbestand hat sich erholt, weil<br />
die Jagd verboten wurde.<br />
Es ist natürlich richtig, dass einige Ecken im Nationalpark<br />
weitestgehend ungestört sind. Aber es kann ja nicht die Aufgabe<br />
des Nationalparks sein, nur ein paar Gebiete in Ruhe zu lassen,<br />
die für den Touristen besonders interessant sind. Was mich besonders<br />
stört, ist, dass es kein richtiges Konzept oder gar einen<br />
Entwicklungsplan für den Park gibt. Das führt dazu, dass in all<br />
den Jahren in Sachen Naturschutz nicht viel erreicht wurde. Im<br />
Grunde genommen wird von Wilhelmshaven aus nur ein<br />
Mangelzustand verwaltet.<br />
Wird eine Stätte zum Weltnaturerbe erklärt, muss das<br />
betreffende Land regelmäßig bei der Unesco über die<br />
Entwicklungen in der Region Bericht erstatten. Hilft die<br />
Überwachung?<br />
Nein, das glaube ich nicht. Bevor die Diskussion zum<br />
Weltnaturerbe überhaupt in die heiße Phase ging, haben einige<br />
Naturschützer unter der Federführung des Wattenrats eine<br />
sehr umfangreiche Mängelliste eingereicht. Bis dahin wurde<br />
der Nationalpark bei der International Union Conservation of<br />
Nature (IUCN) in der Kategorie V geführt, war also gerade mal<br />
ein Landschaftsschutzgebiet. Um die Kriterien des Weltnaturerbes<br />
zu erfüllen, wurde er jetzt auf die Stufe II hochgesetzt,<br />
ohne dass sich überhaupt etwas verbessert hat. Man tut einfach<br />
so, als seien die Kriterien erfüllt. FOTOS:<br />
ANDREA HOYMANN
Ein Gutachter der Unesco hat Ende 2008 zehn Tage in<br />
der Region verbracht. Denken Sie nicht, dass ihm die<br />
Probleme aufgefallen sind?<br />
Der Gutachter kam aus Kuba und ist von Behördenleuten<br />
zehn Tage durch die Region geführt worden. Die haben ihm natürlich<br />
die intakten Ecken gezeigt und die Missstände vorenthalten.<br />
Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Däne und werden ein<br />
paar Tage durch die Schweizer Alpen geführt. Man zeigt Ihnen<br />
ein paar Berggipfel – und dann sollen Sie die Schweizer Alpen<br />
beurteilen.<br />
Auf dem Programm standen aber auch ein Besuch von<br />
niederländischen Öl- und Gasfirmen sowie ein Treffen<br />
mit einem Repräsentanten des WWF.<br />
Es ist gut, dass er das gesehen hat. Ich glaube aber trotzdem<br />
nicht, dass es etwas ändert. Auch Umweltverbände werden irgendwie<br />
finanziert, was zum Verwässern ihrer Standpunkte<br />
führt.<br />
Kann man den Tieren und Pflanzen wirklich noch mehr<br />
Schutz einräumen, ohne den Menschen ganz aus der<br />
Region zu verbannen?<br />
Die Fragestellung müsste lauten, ob die Tiere nicht vom<br />
Menschen aus der Region verbannt werden. Der wirtschaftliche<br />
Druck wird immer größer. Der Tourismus, die Schifffahrt,<br />
die Fischerei und die energieverarbeitenden Firmen – alles befindet<br />
sich direkt an der Grenze zum Nationalpark. Eigentlich<br />
müsste die Wirtschaft um den Park herum stark eingeschränkt<br />
werden. Aber dicht hinter den Deichen stehen Windkraftanlagen,<br />
die eine enorme Gefahr für die Vögel sind. Es wird geschätzt,<br />
dass jede dieser Anlagen im Jahr 50 Tiere tötet. Die Vögel werden<br />
von ihnen regelrecht zerschreddert.<br />
Wie müsste ein gutes Nationalparkkonzept denn aussehen?<br />
Laut IUCN-Nutzungsbestimmungen muss es eine Kernzone<br />
geben, in der es keinerlei wirtschaftliche Nutzung gibt, was im<br />
Fall des niedersächsischen Wattenmeers heißt: kein Fremdenverkehr,<br />
kein Wassersport und keine Fischerei. Außerdem müssen<br />
die wirklich massiven menschlichen Einflüsse in gewisser<br />
Distanz gehalten werden. Wenn man eine Landschaft wirklich<br />
für besonders schützenswert hält, dann muss man Kompromisse<br />
schließen. Es geht aber nicht, dass diese Kompromisse immer<br />
zu Lasten der Tiere entschieden werden.<br />
Eines der erklärten Ziele der Unesco ist es, die<br />
Einzigartigkeit einer Stätte stärker ins öffentliche<br />
Bewusstsein zu rufen. Warum sollte das nicht funktionieren?<br />
Da glaube ich nicht dran. Ich habe in meinen 30 Jahren auf<br />
der Vogelinsel Memmert eine andere Erfahrung gemacht. Wenn<br />
man nur mit erhobenem Zeigefinger dasteht und ermahnt, ändert<br />
sich nichts. Es muss Regelungen geben, und wer die nicht<br />
einhält, muss angemessen bestraft werden. So etwas gibt es am<br />
Wattenmeer nicht. Die viel zu wenigen Ranger haben keinerlei<br />
Lebensraum<br />
Kompetenzen. Sie dürfen weder einen Platzverweis aussprechen<br />
noch ein Bußgeld auferlegen. Gerade Wassersportler sind<br />
oft besonders uneinsichtig. Wenn Übertretungen nicht geahndet<br />
werden, erreicht man nie, dass sie sich an ihre zugewiesenen<br />
Zonen halten. Da steht man dann als Einzelner unter<br />
Umständen einer sehr aggressiven Gruppe gegenüber, die ihre<br />
vermeintlichen Rechte einfordert.<br />
Welchen Stellenwert hat Naturschutz in der Landespolitik?<br />
Einen ganz geringen. Es geht immer nur um wirtschaftliche<br />
Interessen, ganz egal, ob es um den Tourismus oder Energie<br />
geht. Die Kommunen bemühen sich natürlich um ein grünes<br />
Image, sonst laufen ihnen die Touristen weg. In Wirklichkeit<br />
steht aber immer nur eine Steigerung des Profits im Vordergrund.<br />
Sehen Sie eine Lösung für den Konflikt zwischen den<br />
wirtschaftlichen Interessen der Bewohner der Region<br />
und den Interessen der Natur?<br />
Nur darin, dass die Landesregierung der Natur einen höheren<br />
Stellenwert einräumt. Erst durch eine Kombination aus gesetzlichen<br />
Regelungen und Verständnis kann auch in der<br />
Bevölkerung ein anderes Bewusstsein entstehen. Im Naturschutz<br />
muss man eben langfristig denken und nicht nur an das, was<br />
mich jetzt gerade betrifft.<br />
Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Sie die<br />
Ernennung zum Weltnaturerbe befürworten würden?<br />
Kann ich mir vorstellen, wenn die Mindestbestimmungen<br />
eingehalten werden und es mehr Ranger gibt, die auch<br />
Kompetenzen haben. Man muss einen Schritt nach dem anderen<br />
gehen. Erst wenn es ein vernünftiges Nationalparkkonzept<br />
gibt, kann man auch über den Titel Weltnaturerbe reden.<br />
Ansonsten bleibt es ein Label für Pseudo-Naturschutz.<br />
Interview: Andrea Hoymann<br />
A Z U R G R A U 2 3
Lebensraum<br />
Kommt der Wandel,<br />
bleibt das Meer<br />
Wo das Watt auf das Festland trifft, liegen die Salzwiesen. Bei<br />
Flut werden sie vom Meer überschwemmt, bei Ebbe rasten dort<br />
seltene Vögel. Ein einzigartiger Lebensraum. Doch was, wenn<br />
das Meer eines Tages nicht mehr zurückweicht?<br />
2 4 A Z U R G R A U<br />
Der Austernfischer,<br />
einer der typischen<br />
Vögel des Wattenmeers,<br />
brütet in den<br />
Salzwiesen.<br />
Im Sommer blüht<br />
der Strandflieder<br />
zwischen Queller –<br />
einem anderen Salzwiesengewächs.<br />
Für den Salzwiesenfan<br />
Ulrich Appel<br />
ist der Säbelschnäbler<br />
der eleganteste<br />
Wattvogel.
FOTOS: SABASTIAN QUILLMANN (1) / GROSSMANN/NATIONALPARK (2) / BARKOWSKI/NATIONALPARK (1)<br />
Der Himmel ist grau verhangen. Regen<br />
zieht einen Schleier feiner Tropfen<br />
über die Salzwiesen, die sich vor einem<br />
Deich bei Jever erstrecken. Ulrich Appel<br />
geht in kleinen, erstaunlich sicheren Schritten<br />
auf dem seifig-nassen Grund. Der Vogelkundler<br />
bleibt stehen, legt den Finger auf die Lippen,<br />
dreht den Kopf nach links. Neben ihm, irgendwoher<br />
aus den knöchelhohen Gräsern,<br />
tönt kurz und melodisch eine Vogelstimme.<br />
„Das war die Uferschnepfe. Wir nennen sie<br />
auch Greta, weil sie so ruft – ‘Greta, Greta,<br />
Greta!’“ Der Rentner kichert.<br />
Was treibt den 74-Jährigen, bei Regen über<br />
den Deich und in die Wiesen zu steigen? „Die<br />
Freude an der Natur“, sagt Appel. „Wenn man<br />
hier länger gewesen ist, dann kann man sagen:<br />
Sie bewegen sich in derselben Landschaft, aber<br />
die Stimmung der Farben, der<br />
Wolken variiert so. Wenn man<br />
schönes Wetter hat, ist das keine<br />
Plage, sondern es macht einfach<br />
Spaß.“ Seit fast 40 Jahren zählt<br />
und beobachtet er Vögel. Seltene<br />
Arten brüten in den Salzwiesen.<br />
Außerdem erholen sich Zugvögel dort von ihren<br />
Flügen, die den halben Globus umspannen.<br />
Doch wo Ulrich Appel seit Jahrzehnten<br />
Vögel beobachtet, kann schon in 50 Jahren das<br />
Meer direkt an den Deich schwappen. Der<br />
Klimawandel wird kommen. Der Meeresspiegel<br />
wird steigen – und die Salzwiesen sind in<br />
Gefahr, von den Wellen gefressen zu werden.<br />
Dabei leben die Salzwiesen eigentlich vom<br />
Meer, das kommt und geht. Sie werden regelmäßig<br />
vom Meerwasser überflutet. Deshalb<br />
können dort nur besondere Pflanzen überleben,<br />
die den hohen Salzgehalt vertragen. Viele<br />
Insekten hängen wiederum von diesen Pflanzen<br />
ab. Die Pflanzen halten Sand und Schlick,<br />
die das Meer in die Wiesen schwemmt, mit ihren<br />
Wurzeln fest. Wenn der Meeresspiegel<br />
langsam und stetig steigt wie bisher, wachsen<br />
die Salzwiesen mit. Sie sammeln neuen Sand<br />
und Schlick an und verlagern sich landeinwärts<br />
in die flachen Buchten des Meeres.<br />
Doch solche Buchten gibt es gerade an der<br />
Küste Niedersachsens nur noch wenige. Deshalb<br />
sieht die Zukunft der Salzwiesen dort besonders<br />
bedrohlich aus. Der Mensch hat die<br />
flachen, vom Meer überfluteten Bereiche seit<br />
Jahrhunderten trockengelegt. Deiche sperren<br />
das Meer aus. Die heutigen Salzwiesen liegen<br />
vor einer geraden Deichlinie und haben nicht<br />
mehr die Möglichkeit, sich landeinwärts zu verlagern.<br />
Sie werden deshalb von Menschenhand<br />
erhalten: Mit Barrieren, so genannten Lahnungen,<br />
wird etwa die Strömung des Meeres gebremst,<br />
damit sich Sand und Schlick absetzen<br />
können und nicht weggespült werden. Der<br />
Mensch ist auf das Land vor den Deichen an-<br />
gewiesen: Es bremst die Energie der Wellen bei Fluten, schützt die Deiche und<br />
damit die bewohnte Küste.<br />
Eine solches, vom Menschen stark beeinflusstes und erhaltenes Salzwiesen-<br />
Gebiet ist auch der Elisabeth-Außengroden, wo Vogelschützer Ulrich Appel die<br />
Tiere beobachtet. Ein kleiner Naturschutzverein aus Jever hat bereits 1973 erreicht,<br />
dass diese Wiesen unter Schutz gestellt wurden. Appel, der damals schon<br />
dabei war, ist heute Vorsitzender des Vereins. Die Watten und Salzwiesen zu<br />
schützen – „ein Traum“, so sagt er, den sich die Naturschützer erfüllten. Inzwischen<br />
ist das Schutzgebiet im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer aufgegangen,<br />
der 1986 gegründet wurde. Alles schien gut – bis zum Klimawandel.<br />
Der Biologe Hubert Farke von der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven<br />
befürchtet, dass die Folgen des Klimawandels den Elisabeth-Außengroden und<br />
die anderen Salzwiesen an der Küste Niedersachsens zerstören werden. Einen<br />
Anstieg des Meeresspiegels von etwa 50 Zentimetern pro Jahrhundert könnten<br />
die Salzwiesen verkraften. Doch Farke ist pessimistisch: Er geht von einem schnelleren<br />
Anstieg des Meeresspiegels aus – bis zu 70 und mehr Zentimeter in den<br />
nächsten hundert Jahren. „Ich sehe die starken Veränderungen in der Arktis, den<br />
starken Rückgang des Meereseises und den starken Rückgang der Gletscher. Das<br />
führt dazu, dass wir mit dem<br />
„... die Stimmung der Farben,<br />
der Wolken variiert so.<br />
Es macht einfach Spaß.“<br />
Worst Case rechnen müssen.“<br />
Dieser „schlimmste Fall“<br />
würde bedeuten, dass das<br />
Meer schneller steigt, als die<br />
Salzwiesen wachsen. Die<br />
Deichlinie verhindert, dass<br />
sich die Wiesen verlagern. Häufigere und stärkere Stürme wühlen das Wasser<br />
auf, Sand und Schlick können sich nicht mehr absetzen. Das Meer frisst die<br />
Salzwiesen an den Kanten ab, Stück für Stück. Farke befürchtet einen „Rückgang<br />
der Salzwiesen bis an den Deichfuß“. Unter diesen Bedingungen „werden die<br />
Salzwiesen im Küstenbereich nicht zu halten sein“.<br />
„Das Problem ist zu vermitteln, dass man jetzt etwas machen muss und nicht<br />
abwarten darf. Es hilft nicht, fünf Minuten vor Zwölf zu planen“, sagt Holger<br />
Freund. Auch der Geo-Ökologe, der am Standort Wilhelmshaven des Instituts<br />
für die Chemie und Biologie des Meeres forscht, sieht die Gefahr für die Salzwiesen<br />
an der Küste Niedersachsens. Er sucht nach Möglichkeiten, wie sich „Ersatz-<br />
Salzwiesen“ schaffen lassen, wenn die Wiesen an der heutigen Küstenlinie zerstört<br />
werden. Holger Freund erforscht auf der Insel Langeoog, wie sich neue<br />
Salzwiesen entwickeln, wenn man ein Stück Land wieder dem Meer öffnet. Im<br />
Jahr 2004 wurde der Sommerpolder auf Langeoog, eine weitgehend trockengelegte<br />
frühere Salzwiese, wieder geöffnet. Der niedrige Sommerdeich, der die 200<br />
Hektar Fläche vom Meer trennte, wurde abgetragen. Schon 2006 hatte das Gebiet<br />
wieder eine naturnahe Struktur und war von vielen salzverträglichen Pflanzen<br />
besiedelt. „Wir waren erstaunt, wie schnell das geht.“ Nun will er weiterforschen<br />
und ein Stück bewirtschaftetes Grünland fluten, damit dort Salzwiesen entstehen.<br />
So möchte Holger Freund testen, wie schnell sich Salzwiesen entwickeln,<br />
wenn man den Hauptdeich ins Landesinnere verlegt. Das wäre natürlich nur an<br />
unbewohnten Küstenabschnitten möglich. „Man muss sich jetzt die Expertise<br />
aneignen. Solche Maßnahmen sind langfristig und kosten viel Geld.“ Noch besteht<br />
die Chance, sich diese Zeit zu nehmen, bevor der Meeresspiegel stark ansteigt.<br />
Dass er steigen wird, daran besteht auch für Holger Freund kein Zweifel.<br />
Am Elisabeth-Außengroden sieht es schon jetzt ein wenig nach Sintflut aus:<br />
Es regnet unaufhörlich. „Es gibt Wetterlagen, da fragt man sich wirklich: Was<br />
mache ich hier draußen?“ Ulrich Appel geht alle zwei Wochen mit dem Fernglas<br />
in die Salzwiesen und zählt die Vögel. Den pessimistischen Vorhersagen möchte<br />
er nicht recht glauben. „Ich bin noch nicht sicher, ob es wirklich so schlimm<br />
wird, wie manche das darstellen.“ Er zieht die Schultern hoch und atmet tief ein.<br />
„Zum anderen wird die Menschheit irgendwie darauf reagieren müssen.“ Er gehe<br />
davon aus, dass die Salzwiesen erhalten werden können. „Und wenn es ganz<br />
schlimm kommt, dann müssen wir überlegen, vielleicht die Deiche zurückzuverlegen.<br />
Sie zu öffnen? Möglicherweise.“ Er hält inne. „Ich meine, es gibt immer<br />
noch Möglichkeiten, hier rettend einzugreifen.“ Sebastian Quillmann<br />
A Z U R G R A U 2 5
Lebensraum<br />
WILHELMSHAVEN IST DER<br />
ALPTRAUM<br />
JEDES UMWELTSCHÜTZERS.<br />
AM RANDE DES NATIONALPARKS<br />
WATTENMEER<br />
QUALMEN<br />
DIE SCHORNSTEINE<br />
VON CHEMIEFABRIK,<br />
KOHLEKRAFT-<br />
WERK UND EINER<br />
ÖLRAFFINERIE.<br />
JETZT KOMMT NOCH EIN RIESIGER<br />
HAFEN DAZU. ABER<br />
NIEMAND<br />
SCHREIT AUF<br />
2 6 A Z U R G R A U<br />
Wie ein Fremdkörper:<br />
Eine Fotomontage des<br />
Kohlekraftwerks, das<br />
gerade gebaut wird –<br />
zwischen Vogelschutzgebiet<br />
und Watt
Angebrochene Backsteine, zerborstenes Holz – nichts<br />
ist ganz geblieben, als damals der Bagger kam. Was<br />
noch brauchbar war, wurde mitgenommen. Der ungewöhnliche<br />
Baumbewuchs um das frühere Hofgebäude herum<br />
lässt erahnen, wie groß alles gewesen sein muss. Der Mann, dem<br />
der Haufen aus Bauschrott, Brombeersträuchern und Erde einmal<br />
gehörte, ist jetzt über 70 und im Ruhestand. Er wohnt in<br />
Sengwarden, zwei Kilometer entfernt vom Trümmerhaufen seines<br />
früheren Lebens in einem Einfamilienhaus. Der Haufen war<br />
einst sein landwirtschaftlicher Betrieb. Allein das Sprechen über<br />
das, was vor über 30 Jahren im Norden von Wilhelmshaven passiert<br />
ist, fällt ihm schwer. Er möchte nicht mit Namen genannt<br />
werden und schon gar nicht die Überreste seines alten Hauses<br />
sehen. Es musste weichen, weil an dieser Stelle eine Raffinerie<br />
entstehen sollte.<br />
Der Landwirt steht nicht allein da mit seinem Schicksal. Mal<br />
muss der Mensch, mal die Natur weichen. In Wilhelmshaven<br />
hat die Großindustrie Vorrang. Selbst die Naturschützer tun sich<br />
schwer mit dem Naturschutz. Man schielt hier auf Arbeitsplätze,<br />
denn die sind rar. „Wir brauchen die Industrie. Wilhelmshaven<br />
hat etwa 14 Prozent Arbeitslose, die jungen Leute wandern ab.<br />
Und da sind 2.000 neue Stellen durch den Jade-Weser-Port wichtig“,<br />
sagt Peter Sokolowski von den Grünen in Wilhelmshaven.<br />
Sokolowski kandidiert im hiesigen Wahlkreis zum ersten Mal.<br />
Er fügt noch an: „Wissen Sie, hier ist einfach kein grünes<br />
Fleckchen.“<br />
Alles andere wäre gelogen: Die Skyline von Wilhelmshaven<br />
ist gezeichnet von zwei Raffinerieschornsteinen und einem<br />
Kohlekraftwerk der Firma Eon. Derzeit baut die Firma GDF Suez<br />
ein zweites, Eon würde gerne erweitern. Außerdem reiht sich<br />
noch die Chemiefabrik Ineos in die Küstenlinie der Stadt ein.<br />
Es sollen in den nächsten Jahren noch mehr Schornsteine, große<br />
Frachtschiffe und Betonbauten hinzukommen, wenn es nach<br />
dem Oberbürgermeister und den Wirtschaftsverbänden vor Ort<br />
geht. Die schmalen Betonschornsteine der Raffinerie von Conoco<br />
Philips ragen wie Leuchttürme in den Himmel, nur schmaler<br />
und farbloser. Blau-gelb leuchtet immer wieder die Fackel an<br />
der Spitze einer der Betonsäulen auf, wo Gas verbrannt wird.<br />
„WISSEN SIE,<br />
WILHELMSHAVEN<br />
IST EINFACH KEIN<br />
GRÜNES<br />
FLECKCHEN“<br />
Vor den dunklen, dicken Regenwolken ist die Flamme der einzige<br />
Farbfleck im <strong>Grau</strong> des Horizonts. Industrieromantik zwischen<br />
Marschland, Wattenmeer und Strand.<br />
Neben dem Kraftwerk entsteht der Jade-Weser-Port, geplant<br />
als der drittgrößte Hafen Europas. Ende 2011 soll das erste<br />
Schiff festmachen. Durch die besonders tiefe Fahrrinne in<br />
Wilhelmshaven können hier auch die größten Frachtschiffe anlegen.<br />
Damit wird der Jade-Weser-Port Deutschlands einziger<br />
Tiefseehafen. Der Preis dafür ist hoch. Durch den Bau werden<br />
Brutstätten bedrohter Vogelarten zerstört, dem Wattenmeer<br />
wird weitere Fläche genommen, und die Ausbaggerungen am<br />
Meeresgrund greifen ständig in den Lebensraum der Tiere und<br />
Pflanzen ein. Nicht nur der Jade-Weser-Port ist in Wilhelmshaven<br />
ein Großprojekt, das die Umwelt bedroht. Die Schornsteine und<br />
Baustellen sind Zeugen von verlorenen Kämpfen und<br />
Kompromissen zwischen Industrie und Natur. „Wilhelmshaven<br />
ist der Mülleimer der Nation, hier werden all die Dreckschleudern<br />
gebaut, die sonst keine Region haben will“, sagt Peter Hopp vom<br />
BUND.<br />
Dabei will man doch im Sommer den Titel „UNESCO-<br />
Weltnaturerbe“ erhalten. Denn das Wattenmeer vor der Küste<br />
von Wilhelmshaven ist weltweit in dieser Ausdehnung einzigartig.<br />
Das Watt ist eines der größten Feuchtgebiete der Welt, das<br />
viele Zugvögel anzieht und vielen bedrohten Tier- und<br />
Pflanzenarten einen einmaligen Lebensraum bietet. Der<br />
UNESCO-Titel könnte die Autorität sein, die den Spagat zwischen<br />
Industrie und Naturschutz beendet und einen<br />
Schlusspunkt unter Kompromisse und Ausnahmen setzt.<br />
Die Ausnahmen kennt Ralf Kohlwes zu Genüge. „Wenn ich<br />
das Gesetz für Naturschutz durchlese, sehe ich genau, warum<br />
ich hier nichts wirklich schützen kann“, sagt Kohlwes, bei der<br />
Stadt Wilhelmshaven zuständig für Landschaftsplanung und<br />
Wer in Schillig durchs Watt wandert, kann an der Industrie-Skyline von Wilhelmshaven nicht vorbeischauen. Weitere Schornsteine folgen<br />
A Z U R G R A U 2 7
Lebensraum<br />
„EINE RICHTIGE<br />
DRECK-<br />
SCHLEUDER<br />
WÜRDE ICH IN<br />
WILHELMSHAVEN<br />
BAUEN“<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung. Er liest aus dem Gesetzbuch<br />
vor: „Paragraph 34 … Ausnahmen dann, wenn es aus zwingenden<br />
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich<br />
sozialer oder wirtschaftlicher Gründe, notwendig<br />
ist.“ Damit könne quasi alles zur Ausnahme gemacht werden,<br />
erklärt er. „Im Allgemeinen geht es nicht darum, Wirtschaftsentwicklungen<br />
zu verhindern, sondern gute Lösungen zu finden“,<br />
sagt Kohlwes und zeigt an, dass auch er für Kompromisse<br />
steht.<br />
Die Natur kommt nach dem Menschen und der Mensch nach<br />
der Wirtschaft. Das hat auch Ehnste Lauts erlebt. Er ist Jäger<br />
und Landwirt und schwärmt von dem tollen Jagdgebiet, das es<br />
auf dem Rüstersieler Groden bis zum letzten Jahr noch gegeben<br />
hat. „Es gab Rehe dort, was für unsere Region sehr ungewöhnlich<br />
ist. Das Rebhuhn, Enten und Füchse hat man oft beobachten<br />
können.“ Jetzt sieht man dort schwarze Kohleberge, braune<br />
Erdhaufen, Bagger und Stahlkräne. Sekunde für Sekunde<br />
zerstört das Klopfen einer Ramme die Ruhe: Kling, Kling, Kling,<br />
Kling ... Das vertreibt auch die letzten Tiere aus dem verbliebenen<br />
Waldstückchen auf dem Rüstersieler Groden. Mit viel Geld<br />
und Aufwand hat man damals in den fünfziger Jahren diese<br />
Fläche aufgespült und dem Wattenmeer abgewonnen. Der Plan<br />
war es, dort Industrie anzusiedeln. Diese kam aber nicht, und<br />
so eroberte sich die Natur ihr Gebiet zurück. Jetzt will die<br />
Industrie doch. „Für mich als Jäger ist es traurig, wenn Natur<br />
verschwinden muss. Aber ich will auch, dass die Region vorankommt,<br />
darum müssen wir die Kraftwerke und die Industrie<br />
akzeptieren und sogar unterstützen. Ich möchte, dass auch meine<br />
Enkel ein ausreichendes Einkommen haben und hier leben<br />
können.“<br />
Leben und arbeiten müssen auch die Naturschützer in<br />
Wilhelmshaven. Vielleicht erschwert das ihr Engagement.<br />
Gewöhnlich macht jede der kleinen Initiativen ihre eigenen<br />
Aktionen, es gibt wenig Austausch. Im März 2009 haben sie sich<br />
das erste Mal gemeinsam an einen Tisch gesetzt. Eine E-Mail<br />
soll herumgeschickt werden, jede Initiative soll eine geplante<br />
Resolution überarbeiten. Die 48-jährige Imke Zwoch, Mitglied<br />
beim BUND und mit ihrer hellbraunen Haarpracht mit Abstand<br />
die Jüngste in der Runde, fragt: „Kennen Sie die Überarbeitungsfunktion<br />
bei Word?“ Unwissende Gesichter, ein Scherz,<br />
und dann weiß man: Naturschutz ist in Wilhelmshaven eine<br />
zähe, langwierige Sache und kann nicht mit dem Tempo der<br />
Großprojekte von Stadt und Industrie mithalten. Sie sind noch<br />
im Schreibmaschinen-Zeitalter der Olympia-Werke geblieben<br />
2 8 A Z U R G R A U<br />
und versuchen doch in die Gegenwart vorzudringen und die<br />
Menschen in Wilhelmshaven für Naturschutz zu gewinnen. Der<br />
Schreibmaschinenhersteller Olympia, einst Arbeitgeber in<br />
Wilhelmshaven für mehr als 10.000 Menschen, hat die Tore<br />
längst geschlossen, hat nicht umgerüstet und die Zukunft ignoriert.<br />
Der Bankrott war die Konsequenz, die Pleite riss die Stadt<br />
mit in den Abgrund. Nun hoffen auch die Naturschützer auf einige<br />
tausend Arbeitsplätze durch den Jade-Weser-Port und das<br />
neue Kraftwerk.<br />
„Die Initiativen kochen alle ihr eigenes Süppchen“, sagt<br />
Joachim Tjaden. Er ist Mitglied im Stadtrat und gehört der<br />
Wählergruppe Bildung Arbeit Soziales Umwelt (BASU) an. Sein<br />
Gesicht ist zerfurcht wie das Watt bei Ebbe. Und jeder Kompromiss,<br />
der Wilhelmshaven einen neuen Schornstein bringt, ist<br />
für ihn eine Niederlage. „Leider sind die Initiativen hier zu klein,<br />
da macht man sich schnell lächerlich, wenn man sich zu zehnt<br />
vor die Rathaustür stellt und demonstriert und deutlich macht:<br />
,Wir sind dagegen!'“. Ralf Kohlwes von der Stadt sieht das ähnlich:<br />
„Der Widerstand hier vor Ort ist relativ gering und die<br />
Investoren haben nicht allzu viel zu fürchten.“ Tjaden fügt noch<br />
an: „Wenn ich irgendwo eine richtige Dreckschleuder bauen<br />
wollen würde, würde ich nach Wilhelmshaven kommen!“<br />
Was er Dreckschleuder nennt, wird gerade gebaut. Für ein<br />
Kohlekraftwerk rodet man den Rüstersieler Groden, und als<br />
nächstes möchte die Stadt den Voslapper Groden für Industrie<br />
frei machen. Dieses Mal muss kein Haus niedergewalzt, sondern<br />
nur Natur vernichtet werden. Der ehemalige Landwirt, dessen<br />
Hof vor 30 Jahren eingeebnet wurde, hatte damals eine<br />
Entschädigung erhalten und einen Job in der Raffinerie, die auf<br />
seinem Grund bauen wollte. Sein neues Haus ist geräumig, er<br />
hat sich ein großes Stück Garten geleistet. Selbst im März sieht<br />
man da noch ein paar Winterpflanzen. Die Krokusse beginnen<br />
schon zu blühen. Auf den Feldern seines früheren Hofes blüht<br />
nichts mehr. Dort ist heute eine Mülldeponie. Denn die<br />
Investoren der Raffinerie hatten es sich doch anders überlegt:<br />
Die Industriezone wurde um einige Meter verschoben, die Fabrik<br />
an einer anderen Stelle gebaut. Heidi Beha<br />
Der Protest ist still – Postkarten hört man nicht<br />
FOTOS: ANDREA HOYMANN (1) / GRUPPO 635.COM/HUFENBACH (1) / GDF SUEZ (1)
FOTOS: ANNA KUHN-OSIUS
Lebenswandel
Lebenswandel<br />
TATORT<br />
WATT<br />
DIE AUTORIN REGINE<br />
KÖLPIN LEBT UND<br />
SCHREIBT IN FRIESLAND.<br />
DORT BLICKT SIE HINTER<br />
DIE BESCHAULICHEN<br />
FASSADEN. UND STÖSST AUF<br />
MÖRDERISCHE ABGRÜNDE<br />
Dicht an dicht stehen die Häuser an der schmalen Straße.<br />
Die Gardinen vor den Fensterscheiben schützen kaum<br />
vor den Blicken, die man ganz automatisch in die<br />
Häuser wirft. Die Menschen sitzen am Esstisch, trinken Tee,<br />
schauen fern. Es nieselt. Dünne Regenfäden hängen wie ein<br />
Vorhang vor der Straßenzeile. Aus den Häusergiebeln ragen historische<br />
Schilder, die zeigen, wer früher in den Häusern wohnte<br />
und arbeitete. Damals, als der Ort noch eine reiche Stadt mit<br />
Meerzugang war. Der Stolz von damals ist geblieben. Die Häuser<br />
sind gepflegt. Die Eingänge liebevoll dekoriert.<br />
Kein Mensch ist auf der Straße. Dennoch ist man hier nicht<br />
allein. Hier passiert nicht viel. Aber das, was passiert, wird ganz<br />
genau wahrgenommen.<br />
HIER IN NEUSTADTGÖDENS<br />
KOMMT KEINER WEG.<br />
HIER KENNT<br />
JEDER<br />
JEDEN.<br />
WENN DU AUS DEM<br />
ERKERFENSTER IM<br />
WOHNZIMMER<br />
SIEHST, KANNST DU ÜBRIGENS<br />
3 2 A Z U R G R A U<br />
Regine Kölpin setzt Tee auf. Eine Ostfriesenmischung. Die<br />
ersten fünf Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Oberhausen –<br />
für eine Ruhrpott-Identität viel zu kurz. Danach zog sie in die<br />
friesische Idylle, zunächst nach Jever, dann nach Neustadtgödens.<br />
Seit 20 Jahren lebt sie hier. Für die Einheimischen bleibt sie eine<br />
Zugezogene.<br />
Kölpin setzt sich an den Tisch und lässt zwei Stück Kluntje<br />
in ihre Teetasse fallen. Ihr Haar umrandet akkurat geföhnt ihr<br />
Gesicht, ihre Stimme ist klar nordisch gefärbt, ihr Blick wachsam<br />
und neugierig. Sie beobachtet ihr Gegenüber genau. Kölpin<br />
ist Krimiautorin. „Spinnentanz“, ihr zweiter Roman, ist gerade<br />
im Leda-Verlag erschienen. Ihre Geschichten spielen in<br />
Ostfriesland, ihre Protagonisten sind die Einheimischen.<br />
„Ich glaube, dass die meisten schon sehr viel voneinander<br />
wissen, man lebt hier in einem sehr beschaulichen Raum sehr<br />
intim miteinander“, sagt Kölpin und nimmt einen Schluck Tee.<br />
Genau diese Nähe der Menschen greift sie in ihren Büchern auf,<br />
stets auf der Suche nach Geheimnissen, die hinter der Häuserfassade<br />
versteckt liegen. „Die Abgründe der menschlichen Seele<br />
machen vor den Toren Frieslands nicht halt, und so macht es<br />
mir Spaß zu gucken, was man hinter der heilen Welt hier finden<br />
kann“, sagt Kölpin. Die Handlungen ihrer Mordgeschichten<br />
sind eigentlich undenkbar in der ostfriesischen Idylle, in der<br />
laut Verbrechensstatistik Morde sehr selten passieren. Kölpin<br />
erzählt von einem Mord im Altersheim, von dem Tod einer<br />
Pflegerin und Leichen im Meer. Gerade die Enge der<br />
Dorfgemeinschaft greift sie auf und entwirft die Charaktere so<br />
detailgenau, dass sie erschreckend realistisch wirken.<br />
Der Regen prasselt leicht gegen die Fenster. Beim Blick nach<br />
draußen bekommt man eine Ahnung von den unendlichen<br />
Weiten des Meeres. Der frische Seewind verrät, dass der Deich<br />
bereits im Nachbarort beginnt.<br />
IN EURE KÜCHE GUCKEN. FOTO:<br />
ANNE-KATHRIN KELLER
DIE STILLE ÜBER DEM<br />
DEICHVORLAND<br />
HATTE MIT EINEM MAL<br />
NICHT MEHR DEN<br />
BERUHIGENDEN<br />
CHARAKTER,<br />
DIE SIE SONST WIEDER UND<br />
WIEDER HIERHER ZOG. KEIN<br />
SCHAF<br />
DURCHSCHNITT DIE ABENDLUFT MIT<br />
SEINEM BLÖKEN,<br />
DER DEICH<br />
ENDETE<br />
VERWAIST IM WEISSEN NICHTS.<br />
Seit Generationen ranken sich Mythen und Legenden um<br />
Küste und Meer. Sie erzählen von verunglückten Seeleuten, vermissten<br />
Personen und Geistern. Regine Kölpin gehört einer neuen<br />
Generation von Sagenerzählern an. Die Bilder, die sie verarbeitet,<br />
sind die gleichen wie damals. Nebel, Wind und die unendliche<br />
Weite der Region kreieren eine geheimnisvolle, gespenstische<br />
Stimmung.<br />
HARM NÄHERTE SICH DEM PRIEL<br />
VORSICHTIG.<br />
IM WIND FLATTERTE DER ZIPFEL<br />
EINES ROTEN TUCHES. EIN<br />
GUMMISTIEFEL LAG ABSEITS<br />
IM GRAS<br />
UND ZWISCHEN DEN<br />
GRASHALMEN LEUCHTETE<br />
EIN GELBER SCHAL.<br />
ER TRAT EINEN<br />
SCHRITT<br />
NÄHER.<br />
Der tote Körper einer Frau liegt in den Salzwiesen. Sie wurde<br />
brutal ermordet – jedenfalls in Kölpins Phantasie. „Wenn ich<br />
hier sitze, lasse ich die Geschichten vor meinem Auge abspielen“,<br />
sagt Kölpin mit Blick auf das Meer. „Natur und Handlung<br />
gehören da zusammen, die Landschaft lädt dazu ein, schaurige<br />
Handlungen zu entwerfen.“<br />
Die Helden sind nicht mehr Störtebeker und Geister, sondern<br />
die Ostfriesen selbst. Die Psychologie der Personen ist das<br />
eine wichtige Element der Ostfriesenkrimis, das andere ist die<br />
Natur. Kölpin erzählt Geschichten, die nur hier in Ostfriesland<br />
spielen können. „Wir haben hier eine raue Landschaft und häufig<br />
auch ein raues Klima. Das typische Badeklischee haben wir<br />
wirklich nur im Sommer.“ Kölpin wählt bewusst Orte, die es<br />
nur in Friesland gibt, wie die Salzwiese, der Tatort einer ihrer<br />
Geschichten. „Mit dieser einmaligen Landschaft kann man spielen.<br />
Wenn hier der Nebel rüberzieht, ist es sehr einsam hier, und<br />
da kann man dann wunderbar morden“, sagt Kölpin.<br />
Ihre Schritte schmatzen über den durchweichten Boden der<br />
Salzwiesen. Die Sonne ist herausgekommen und lässt die<br />
Stimmung zur Sommerzeit erahnen. Dann, wenn hier alles blüht<br />
und Schafe auf den Deichen weiden. Bei Sonnenschein wirkt<br />
alles ganz anders. Vorbeikommende Menschen grüßen. Man<br />
blickt in freundliche Gesichter.<br />
DAS ROT DER SONNE WAR<br />
VON DER DÄMMERUNG<br />
ABGELÖST WORDEN.<br />
DIESES DORF<br />
SCHIEN MIT DER SONNE<br />
SCHLAFEN ZU GEHEN. ES<br />
WAR NOCH NICHT MAL<br />
RICHTIG DUNKEL<br />
UND DOCH HATTE DIE<br />
NÄCHTLICHE<br />
SCHWERMUT<br />
SICH ÜBER DIE HÄUSER<br />
GELEGT UND DAS LEISE<br />
SUMMEN DER NICHT WEIT<br />
ENTFERNTEN BUNDES-<br />
STRASSE WIRKTE WIE EIN<br />
SCHLAFGESANG.<br />
Als er am Dorfausgangsschild vorbeifährt, erzählt ein<br />
Taxifahrer vom Leben an der Küste. „Hier ist nichts los, gar<br />
nichts. Es bekäme ja eh jeder mit, wenn man etwas Verbotenes<br />
macht.“ Die Aussage soll beruhigen. Hier ist man nicht allein.<br />
Sicherheit strahlen seine Worte dennoch nicht aus.<br />
Anne-Kathrin Keller<br />
A Z U R G R A U 3 3
Südstrand, Deichbrücke, Leuchtturmstraße.<br />
Busfahrer Jürgen Altmann kennt sie alle, die<br />
Haltestellen in der Nordseestadt Wilhelmshaven.<br />
Seit Kurzem hat er einen neuen Halt:<br />
„JadeWeserPort“. Eine Großbaustelle am Meer,<br />
die zum größten Tiefseewasserhafen Deutschlands<br />
wird. Vor ein paar Monaten wurde die Linie 6 um eine<br />
Haltestelle verlängert. Stündlich fahren Busfahrer Altmann und<br />
seine Kollegen aus der Stadt in die Industriezone an der Küste.<br />
Nach den Haltestellen an Rathaus und Börsenplatz kommen die<br />
Wohnsiedlungen, irgendwann nur noch Straßen und Wiesen,<br />
und dann sind schon in der Ferne gelbe Baukräne und Schornsteine<br />
zu sehen. Hier soll Wilhelmshavens neue Touristenattraktion,<br />
ein riesiger Containerhafen, entstehen. Schon die<br />
Baustelle ist ein Ausflugsziel.<br />
3 4 A Z U R G R A U<br />
Statt Strand<br />
In Wilhelmshaven entsteht der einzige Tiefwasserhafen<br />
Deutschlands. Wo früher Strand war, stehen jetzt Bagger, Kräne und<br />
Bauzaun. Die Großbaustelle und der Containerhafen sollen<br />
Touristen begeistern. Natur ist woanders<br />
Ferien auf der Großbaustelle! Der neue Hafen wird als Touristenattraktion vermarktet – obwohl er noch nicht einmal fertig ist<br />
„Am Wochenende ist hier sehr viel los am JadeWeserPort,<br />
er ist ein Anziehungspunkt“, sagt Busfahrer Altmann, der schon<br />
seit 21 Jahren hinter dem großen Lenkrad in den Stadtbussen<br />
sitzt. Wer am JadeWeserPort aussteigt, steht auf einem großen<br />
Parkplatz, rings herum ein weites Nichts. Eine Treppe führt zu<br />
einem grauen Kasten, der Jade-Weser-Infobox. Über dem<br />
Eingang steht: „Container verbinden Menschen“. Direkt hinter<br />
der Infobox beginnt der Bauzaun, weiter geht es nicht. Hinter<br />
dem Zaun ist die riesige Baustelle – Sand, Bagger, Kräne und<br />
Wasser, soweit das Auge reicht. In zwei Jahren sollen an dieser<br />
Stelle riesige Containerschiffe liegen, die so groß sind, dass sie<br />
sonst nirgendwo in Deutschland anlegen können.<br />
Ein rot-weißer Leuchtturm steht einsam vor der Baustelle.<br />
Er ist das Einzige, was an dieser Nordseeküste noch an Strandkörbe,<br />
Möwengeschrei und frische Luft erinnert. Die Natur er-<br />
FOTO: HEIDI BEHA / ROLF VAN MELIS / PIXELIO
leben müssen Touristen woanders. Wilhelmshaven<br />
setzt auf das Großprojekt<br />
JadeWeserPort. Gunda Ufkes, Leiterin der<br />
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit, hofft<br />
durch den Mega-Hafen auf mehr<br />
Touristen: „Industrietourismus hat in den<br />
letzten Jahren sehr zugenommen und<br />
viele Städte setzen darauf“, sagt sie. Die<br />
Gäste seien auf große Dimensionen fixiert,<br />
große Häfen und die riesigen Containerschiffe<br />
würden sicher faszinieren.<br />
Auch die Bauarbeiten locken schon viele<br />
Menschen an. Dort sehen sie hinter<br />
dem Bauzaun gerade die Aufspülarbeiten.<br />
Dabei befördern Schneidkopfsaugbagger<br />
Sand von sogenannten Entnahmebereichen<br />
auf die zukünftige Ha-<br />
HAFEN IN ZAHLEN<br />
fenfläche. Außerdem sind vier Rammeinheiten im Einsatz, die<br />
Tragbohlen in das Wattenmeer rammen. Zu hören ist ein rhythmisches,<br />
metallisch dumpfes Knallen. Zu sehen gibt es wenig.<br />
Ufkes erzählt, dass nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische<br />
die Baustelle besuchen, um zu beobachten, „wie sich<br />
das Gebiet vom Naherholungsgebiet zum größten Tiefseewasserhafen<br />
entwickelt.“ Naherholungsgebiet, das war der<br />
Sandstrand Geniusbank, der dem Hafenbau zum Opfer fiel. Wo<br />
früher Sandburgen mit Kinderschaufeln gebaut wurden, stehen<br />
jetzt die Infobox und Bagger, die nicht aus Plastik sind.<br />
Busfahrer Altmann findet es zwar schade, dass Wilhelmshaven<br />
jetzt keinen Sandstrand mehr hat, schlimm sei das aber nicht.<br />
Dafür gebe es in den umliegenden Ortschaften noch schöne<br />
Strände. Die meisten sind hier froh über den neuen Hafen oder<br />
haben zumindest nicht protestiert – bei rund 82.000 Einwohnern<br />
hat die Bürgerinitiative Antiport nur etwa 300 Mitglieder.<br />
Hans Freese, Ur-Wilhelmshavener, ist einer der Mitbegründer<br />
der kleinen Gegner-Gruppe und trauert um den Geniusstrand.<br />
Der neue Hafen sei unnötig, es gebe bereits große Häfen in Hamburg<br />
und Bremerhaven. Der Strand sei somit ohne Grund zerstört<br />
worden und war vorher ein wichtiger Ort für Touristen<br />
und Einheimische. Die Camper, die vorher auf dem Campingplatz<br />
neben dem Geniusstrand Urlaub machten, sind für die<br />
Region für immer verloren. „Außerdem hatte der Strand auch<br />
noch einen erheblichen Wert für die Menschen aus den umliegenden<br />
Vierteln.“ Er war mit dem Fahrrad erreichbar, kostenlos<br />
und schön zum Baden. Axel Kluth, Geschäftsführer der<br />
JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft, sieht das anders: „Wir<br />
hatten einen Strand, der mitten in der Industriefläche lag. Da<br />
kann man überlegen, ob man das als Tourismusattraktion verkaufen<br />
kann.“<br />
Der Strand ist jetzt dem Hafen gewichen, und der jedenfalls<br />
soll ein Touristenmagnet werden. Wilhelmshaven setze sowieso<br />
nicht auf Naturtourismus, sagt Gunda Ufkes von der Touristik-<br />
Gesellschaft. „Wilhelmshaven ist ein rein städtetouristisches<br />
Ziel und für Touristen aus der ostfriesischen Halbinsel als<br />
Tagesausflugsziel interessant, weil es Gegensätze zum Strand-<br />
Der JadeWeserPort wird Deutschlands<br />
einziger Tiefwasserhafen für die größten<br />
Schiffe der Welt. Diese sind bis zu<br />
430 Metern lang und reichen bis zu<br />
16,50 Metern ins Wasser. Auf so ein<br />
Schiff passen 8.000 Container.<br />
KOSTEN: ca. 950 Mio. Euro<br />
FINANZIERUNG: JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft<br />
(Betreiber Eurogate), Land<br />
Niedersachsen, freie Hansestadt Bremen,<br />
Fremdkapital<br />
BAUBEGINN: 2008<br />
INBETRIEBNAHME: Oktober 2011<br />
FERTIGSTELLUNG: Dezember 2012<br />
FLÄCHE: 290 Hektar<br />
WASSERTIEFE IM TERMINAL: 18 Meter<br />
KAJENLÄNGE: 1.725 Meter<br />
LIEGEPLÄTZE: 4<br />
CONTAINERBRÜCKEN: 16<br />
JAHRESUMSCHLAGSKAPAZITÄT:<br />
2,7 Millionen Container<br />
Lebenswandel<br />
urlaub bietet.“ Der Ausflug zur Baustelle<br />
und zum späteren Hafen wird integriert<br />
ins Touristen-Tages-Programm zwischen<br />
Shopping in der Nordsee-Passage und<br />
dem Besuch im Küstenmuseum. Die<br />
Touristik-Gesellschaft wirbt auf ihrer<br />
Homepage mit dem „Freizeitangebot einer<br />
Metropole“. Wer die Nordseepassage<br />
am Bahnhof besucht, der nur von Regionalzügen<br />
angefahren wird, findet dort<br />
zum Beispiel einen C&A, die Billigkette<br />
Schuhpark und ein Fisch-Bistro. Zwei<br />
Mädchen in Röhrenjeans und Chucks,<br />
die sonntags am Oceanis-Museum vorbeilaufen,<br />
fällt als Highlight der Stadt<br />
die Theaterbar und der Spaziergang am<br />
Strand ein. Den Sand unter den Füßen<br />
gibt es aber nur noch woanders: „Naturtourismus findet man<br />
direkt im umliegenden Friesland“, sagt Ufkes.<br />
Doch auch im Umland kann der ruhesuchende Naturtourist<br />
dem neuen Mega-Port nicht entgehen: „Man wird den Hafen,<br />
wenn er in Betrieb ist, bis Wangerooge runter sehen, drüben in<br />
Budjadingen“, sagt Hafen-Gegner Hans Freese. Der Himmel<br />
hell erleuchtet von den großen Strahlern, die Luft erfüllt von<br />
Abgasen, die Abendstille durchdrungen von Maschinengeräuschen,<br />
das ist sein Szenario. Seine Bürgerinitiative hat gegen<br />
den Hafen geklagt, ihn zwar nicht verhindert, aber einige Kompromisse<br />
für den Naturschutz ausgehandelt. Freese, früher<br />
Marine-Berufssoldat und heute Rentner, glaubt, dass die Stadt<br />
auf das falsche Pferd gesetzt hat: „Man hat den Tourismus sträflich<br />
vernachlässigt.“ Industrie sei immer als die einzige Perspektive<br />
hingestellt worden, laut Freese „eine völlig einseitige Betrachtungsweise<br />
der Gegend und der Möglichkeiten.“ Kurzfristig gedacht,<br />
sagt er. Das Kapital der Landschaft Nordseeküste verspielt.<br />
Unwiderruflich.<br />
Eine große Mehrheit der Bevölkerung sieht im Hafen aber<br />
tatsächlich eine große Chance für die Region. Die versprochenen<br />
Arbeitsplätze sind fast ein Totschlag-Argument bei einer<br />
Arbeitslosenquote von fast 14 Prozent und der ständigen<br />
Abwanderung von jungen Leuten. Hafenbauer Axel Kluth<br />
spricht von circa 1.000 Arbeitsplätzen direkt an der Kaje und<br />
weiteren 1.000 hafenabhängigen Jobs. Hafengegner Hans Freese<br />
glaubt, dass an der Kaje, wo die Schiffe be- und entladen werden,<br />
höchstens 100 bis 200 neue Arbeitsplätze entstehen.<br />
Busfahrer Jürgen Altmann denkt, dass vielleicht auch ein<br />
Arbeitsplatz für seine 19-jährige Tochter dabei ist. Sie macht gerade<br />
eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Vielleicht ist sie<br />
dann auch mit Linie 6 zum Arbeitsplatz unterwegs. Erstmal<br />
fährt Altmann weiter die Neugierigen zur Baustelle. Auch die<br />
Touristik-Gesellschaft bietet schon jetzt Bustouren zu den<br />
Hafenanlagen an. Auf dem Flyer ist ein älteres Ehepaar zu sehen,<br />
das mit Windjacken, Fernrohr und einem kleinen Körbchen<br />
auf roten Backsteinen am Ufer sitzt und ein voll beladenes<br />
Containerschiff vorbeiziehen sieht. Sandra Petersen<br />
A Z U R G R A U 3 5
Lebenswandel<br />
Das Messer rutscht zwischen den Austernschalen<br />
hin und her, mit einem Klack bricht André<br />
Stolle die beiden Muschelhälften auseinander.<br />
Der Gourmet-Koch ist überrascht von der Größe der wilden<br />
Austern, die aus dem Tidenbereich des Wattenmeers stammen.<br />
Stolle riecht an der Auster, tastet das Austernfleisch ab.<br />
Seine Augen leuchten, er freut sich: „Die kann man servieren!“<br />
Die Pazifische Auster auf dem Tisch des Gourmet-Kochs gehört,<br />
wie der Name sagt, eigentlich nicht ins niedersächsische<br />
Wattenmeer, sondern in den Pazifik. An die Nordsee kam sie<br />
mit Hilfe des Menschen: Auf der Suche nach einem Ersatz für<br />
die durch Überfischung im Wattenmeer kaum mehr anzutreffende<br />
Europäische Auster begann man an der niederländischen<br />
Nordseeküste, die Pazifische Auster zu züchten. Mit der Strömung<br />
kamen die Austernlarven aus den Niederlanden in den<br />
Jadebusen – und entwickelten sich<br />
dort prächtig. Im Watt gibt es keine<br />
Nahrungsfeinde für sie, sie ste-<br />
hen nur in Konkurrenz zu den Miesmuscheln,<br />
die wie die Austern das<br />
Plankton aus dem Wasser filtern.<br />
Sehr zum Missfallen der Miesmuschel-Fischer,<br />
die die Austern für<br />
das Verschwinden der Miesmuschelbänke<br />
verantwortlich machen.<br />
Doch längst nicht alle Wilhelmshavener<br />
schimpfen über die Auster.<br />
Für Feinschmecker ist sie eine alte<br />
3 6 A Z U R G R A U<br />
DIE ENTDECKUNG DER AUSTER<br />
WILHELMSHAVENER<br />
ROYAL<br />
VOM PAZIFIK INS WATT – DIE PAZIFISCHE<br />
AUSTER HAT SICH PRÄCHTIG EIN-<br />
GELEBT. EIN GOURMET-KOCH UND EIN<br />
JUWELIER AUS<br />
WILHELMSHAVEN<br />
SIND DEN REIZEN DES<br />
TIERISCHEN<br />
EINWANDERERS<br />
ERLEGEN<br />
Juwelier Clemens Stuke mag Austern – am liebesten mit Perlen und Gold<br />
Bekannte aus der französischen Küche, die jetzt eben auch<br />
vor der Tür gedeiht. Und ein Gourmet-Koch und ein<br />
Juwelier wollen mit der Pazifischen Auster in Wilhelmshaven<br />
jetzt auch Geld verdienen.<br />
Wie die Pazifische Auster ist auch André Stolle neu hier.<br />
Ein Reeder machte ihn zum Küchenchef seines Hotels, das er<br />
für 28 Millionen Euro in die Stadt am Jadebusen setzte. Der 33jährige<br />
Koch gehört zu den aufstrebenden jungen Spitzenköchen,<br />
er wurde schon zweimal mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet,<br />
dem Oscar für Köche. Das soll ihm hier jetzt wieder gelingen.<br />
Stolles Erfolgsrezept ist eine Kombination aus regionaler<br />
und französischer Küche – „neue norddeutsche Küche légère“<br />
nennt er sie. Die Pazifische Auster, die vor allem in Frankreich<br />
als Delikatesse gilt, passt gut in sein Konzept: „Ich würde meinen<br />
Gästen gerne Austern aus Wilhelmshaven anbieten.“<br />
SO GEHT’S: AUSTERN ERNTEN<br />
„Die Austern wachsen eigentlich überall im Tidenbereich an der Steinpackung<br />
des Deichs, doch ein echter Austern-Hotspot ist die Mündung des Maadesiels<br />
beim Kraftwerk. Für die Ernte braucht man nicht mehr als feste Gummistiefel,<br />
Niedrigwasser, einen großen Schraubendreher und einen Eimer – dann kann`s<br />
losgehen. Für den kleinen Imbiss zwischendurch sollte man ein kleines feststellbares<br />
Taschenmesser zum Öffnen der Austern nicht vergessen! Von Größe<br />
5 bis Größe 1 ist hier alles zu finden.“ Markus Nolte, Freizeit-Gourmet<br />
FOTOS: JANOS BURGHARDT
Sternekoch André Stolle probiert wilde Austern aus Wilhelmshaven. Bisher kannte er nur die Verwandten aus Sylt<br />
Doch noch kann er die regionale Auster nicht auf die Karte<br />
setzen, denn die wilden Austernvorkommen klumpen betonfest<br />
zusammen. „Die Austern müssten mir in ausreichender<br />
Menge, guter Qualität und zu einem vernünftigen Preis angeboten<br />
werden“, sagt Stolle. Das ist nur möglich, wenn man sie,<br />
wie auf Sylt, anbaut. Dort werden seit 1986 die „Sylter Royal“<br />
von Dittmeyer vertrieben. Die „Austern Compagnie“ der für ihren<br />
Orangensaft bekannten Firma Dittmeyer fängt die<br />
Austernlarven auf und zieht sie in Gittersäcken in der Nordsee<br />
groß, so wachsen gastronomiegerecht einzelne Austern auf.<br />
Doch die Sylter Austern sind zu teuer, um sie als regionales<br />
Produkt an der Nordsee zu etablieren. In Wilhelmshaven stehen<br />
Austern daher auf keiner Speisekarte, es gibt sie nur auf<br />
Vorbestellung. Das könnte sich ändern, wenn es eine günstigere<br />
„Wilhelmshavener Royal“ gäbe.<br />
Nicht angewiesen auf die Küchen-Auster ist der Wilhelmshavener<br />
Juwelier Clemens Stuke, der auch mit den wilden<br />
Austern etwas anfangen kann. „Wie ein Maler sich durch seine<br />
Umgebung inspirieren lässt, greife ich gerne Materialien aus<br />
der Region auf,“ sagt Stuke. Wo sonst Edelsteine und Gold liegen,<br />
steht eine Schale mit frischen Austern auf dem Verkaufstresen.<br />
Der gelernte Goldschmied will die Meerestiere zu<br />
Schmuck verarbeiten.<br />
Stuke hält eine Auster in der Hand, die noch nass vom<br />
Meerwasser ist. „Mir gefällt die unregelmäßige Struktur der<br />
weiß-violetten Schalen“, sagt er und trocknet die Austern. Er<br />
wählt eine kleine Auster aus, die eine besonders poröse<br />
Oberfläche hat, und geht zu seiner Werkbank. Stuke legt einen<br />
grünen und roten Stein auf die Auster, entscheidet sich aber für<br />
eine Perle, die er auf die Austernschale setzen möchte. Stuke<br />
sägt die Auster rund aus, bohrt ein Loch hinein, erkundet das<br />
Material. „Die Schalenstruktur ist sehr unterschiedlich, aber<br />
man kann sie gut verarbeiten.“ Um die runden Austernstücke<br />
in seiner Hand legt der Juwelier eine Goldfassung. Es entstehen<br />
goldene Ohrringe mit Perlen auf den Austernschalen aus der<br />
Region. Ein echter Hingucker in der Vitrine des Juweliers.<br />
Die Feinschmecker in der Stadt schauen die Delikatesse in<br />
der Nordsee schon längst nicht mehr nur an. Früher fischte<br />
Markus Nolte, Kapitän bei der Marine, gerne Garnelen und sammelte<br />
Miesmuscheln und Herzmuscheln – jetzt erntet er eben<br />
auch Austern. Mit einem Eimer und einem Schraubenzieher<br />
ausgerüstet geht er so auf die Feinschmecker-Tour ins Watt. Am<br />
Kraftwerk findet er immer besonders viele Austern, was wohl<br />
am warmen Abwasser liegt. Doch an den Durchmarsch in die<br />
Küchen der Region glaubt Nolte, der mit einer Französin verheiratet<br />
ist, noch nicht: „Die Deutschen sind eben eher ein Volk<br />
der Fischstäbchenesser statt Austerngenießer.“<br />
Damit sich die Austern im Wattenmeer wirtschaftlich nutzen<br />
lassen, müssten sie durch die Aufzucht erschlossen werden.<br />
Solange sich in Wilhelmshaven niemand der Austernzucht annimmt,<br />
bleibt den Feinschmeckern, Köchen und Juwelieren<br />
nichts anderes, als mit einem Schraubenzieher loszuziehen und<br />
wilde Watt-Austern zu ernten. Belohnt werden sie mit einem<br />
salzigen Schluck aus der Schale. Janos Burghardt<br />
DREI FRAGEN AN<br />
DR. ACHIM WEHRMANN, WISSENSCHAFTLER<br />
AM SENCKENBERG-INSTITUT IN WILHELMSHAVEN<br />
WARUM GIBT ES DIE PAZIFISCHE AUSTER IM WATT?<br />
Die Pazifische Auster ist auf natürlichem Weg eingewandert.<br />
Sie wurde in Oosterschelde in den Niederlanden für die<br />
Austernzucht in Aquakulturen eingeführt, hat sich dort aber<br />
unkontrolliert vermehrt. In der Umgebung der Aquakulturen<br />
hat die Pazifische Auster Wildpopulationen aufgebaut, die<br />
sich über die Meeresströmung verbreitet haben.<br />
WELCHE PROBLEME BRINGT DIE AUSTER?<br />
Es bestand zunächst die Befürchtung, dass die Miesmuscheln<br />
möglicherweise durch die Pazifische Auster verdrängt<br />
werden, da sich die Austern auf den Miesmuschelbänken<br />
festgesetzt haben. Doch ganz im Gegenteil: Die<br />
Austernbänke sind sogar nützlich für die Miesmuscheln, da<br />
sie ihnen Schutz vor den Vögeln bieten.<br />
KANN MAN DIE WILDEN AUSTERN DENN ESSEN?<br />
Eine Gefahr kann das Plankton sein, die Nahrung der<br />
Austern, da diese Algen zum Teil giftig sind. Die darin enthaltene<br />
Toxine werden von allen Organismen aufgenommen,<br />
die das Wasser zur Nahrungsaufnahme filtrieren – zum<br />
Beispiel Herzmuscheln, Miesmuscheln und eben Austern, die<br />
das Gift im Fleisch anlagern können. Während Miesmuscheln<br />
entsprechend überwacht werden, gibt es ein eigenes lebensmitteltechnisches<br />
Monitoring bei den Austern noch nicht.<br />
A Z U R G R A U 3 7
Lebenswandel<br />
Friesland mal anders. Statt<br />
Teezeit, Meer und Ferienhäusern<br />
hat Hohenkirchen Kaffeeautomaten,<br />
einen künstlichen<br />
See und Einheitshotels<br />
1.600EINWOHNER<br />
19.000TOURISTEN<br />
70.000GEPLANTE ÜBERNACHTUNGEN 2009<br />
Das „Dorf Wangerland“ von oben: Auch die graue Fläche wird noch zum See
FOTOS: GEMEINDE WANGERLAND (1) / DORF WANGERLAND (4)<br />
Dick knallen einem die weißen Buchstaben auf rotem<br />
Grund entgegen: „KiK“ steht auf mehreren Fahnen an<br />
der Straße. Daneben der Lebensmitteldiscounter „Aldi“,<br />
eine kleine Verbindungsstraße trennt den Markt von „Lidl“. Es<br />
sieht aus wie in vielen Orten. Die Märkte liegen etwas außerhalb<br />
des Dorfkerns, doch hier in Hohenkirchen in der Gemeinde<br />
Wangerland ist genau dieses Gebiet außerhalb des Dorfkerns<br />
ein Ferienparadies. Gegenüber den Discountern liegt das „Dorf<br />
Wangerland“ – eine Clubwelt, die vor allem junge Familien anlocken<br />
will.<br />
Hier sind Billigläden nicht nötig. In der Anlage wird man<br />
rundum versorgt. Das Zentrum bildet ein Restaurant. An der<br />
Wand hängen Sockel, auf denen glitzernde Porzellanelefanten<br />
thronen. Überall stehen Automaten für Kaffee oder Cola, und<br />
es ist reichlich Platz fürs Buffet. Hier heißt es zuschlagen,<br />
vorausgesetzt, man hat ein Bändchen am Arm und<br />
kann sich so als „Clubmitglied“ ausweisen.<br />
Urlaub in Friesland, das sind: Krabbenbrötchen,<br />
Leuchttürme und Meer. In Hohenkirchen ist das anders.<br />
Hier gibt es Kasernengebäude, ein Fonduerestaurant<br />
und statt des offenen Meeres einen See. Das<br />
Konzept des Clubs ist einfach: ein Preis, alles drin.<br />
Bereits in der ersten Saison gab es 45.000 Übernachtungen.<br />
Dass es soweit kam, ist vor allem einem zu verdanken:<br />
„Niemand sah die enorme Chance“, sagt<br />
Altbürgermeister Joachim Gramberger aus der Gemeinde<br />
Wangerland. Niemand, außer ihm. „Was hier entstanden<br />
ist, ist etwas Einmaliges zwischen Ems und<br />
Weser“, sagt er über das Projekt.<br />
Kegeln, Billard oder Kino, wann immer man will.<br />
Der Park biete alles, was man sich vorstellen kann, meint<br />
Gramberger, als sei es sein Konzept, das er verkaufen<br />
muss. Auch den Einfallsreichtum des niederländischen<br />
Betreibers verteidigt er. Neben der Kneipe gibt es eine<br />
Ruhezone, entstanden aus einem ausgedienten<br />
Orientexpress. Ein Raum weiter ein Pub, wie man ihn<br />
in London sieht, in einer anderen Ecke eine Bibliothek<br />
mit zugestaubten Büchern. Der Club hat Mitarbeiter,<br />
die weltweit genau nach solchen Stücken suchen, um<br />
sie im Park wieder zu neuem Leben zu erwecken. „Man<br />
muss es ja nicht alles direkt lieben, aber es ist einfach<br />
interessant“, meint Gramberger.<br />
Die Hotelgebäude stehen in einer Reihe am Wasser, eine<br />
Halle mit einer überdachten Kirmes liegt gegenüber. Vor dem<br />
Fonduerestaurant, das etwas abseits ist, stehen nachgebildete<br />
alte Fässer und große Blumenkrüge. Der ganze Club wirkt wie<br />
eine Kulisse, die für einen Hollywoodfilm dienen könnte. Was<br />
für ein Film das wäre, ist aber nicht klar. Links sieht es aus wie<br />
für einen Western gemacht, weiter hinten könnte es auch ein<br />
Kinderfilm werden.<br />
Was heute Hotel ist, war früher Kaserne: 2003 sind hier die<br />
letzten Soldaten abgezogen. Über 30 Jahre waren sie Teil der<br />
Gemeinde, waren Mitglieder in Ortsvereinen, sie gehörten dazu:<br />
„Nach 16 Uhr war hier im Ort die Hölle los“, erinnert sich der<br />
heutige Bürgermeister Harald Hinrichs. Wenn in der Kaserne<br />
Dienstschluss war, gingen die Soldaten einkaufen, bereicherten<br />
durch ihre Anwesenheit das Dorfbild und brachten auch das<br />
Geld in die Kassen.<br />
„Es galt, die Wirtschaftskraft, die zuvor von der Kaserne ausging,<br />
schnellstmöglich wieder herzustellen, um Hohenkirchen<br />
zukunftssicher zu machen“, sagt Gramberger. Viele Ideen waren<br />
schon gescheitert: ein Wohnpark, ein Industriegebiet. Für<br />
Gramberger war klar, es würde schwierig werden, aber unter<br />
keinen Umständen sollte das Gelände einfach verwildern.<br />
Zeitgleich wurde für einen neuen Deich in der Nähe Klei gesucht,<br />
der Boden, aus dem sie hier in Friesland seit Jahrhunderten<br />
Deiche bauen – genau hinter der Kaserne gab es reichlich davon.<br />
Es würde allerdings ein riesiges Loch geben. Ein Baggersee?<br />
Das wär’s. Die ehemalige Kaserne würde enorm aufgewertet,<br />
war Gramberger überzeugt.<br />
Aus der Bevölkerung bekam er Gegenwind. Niemand mochte<br />
so recht verstehen, wieso man nach hunderten Jahren, in denen<br />
man versucht hatte, das Wasser vor den Deichen zu halten,<br />
nun freiwillig das Wasser zu sich holen wollte.<br />
Die Lösung für das Problem wurde eingeflogen:<br />
Im Sommer 2003 landete der<br />
Niederländer Hennie van de Most mit seinem<br />
Hubschrauber auf dem Sportplatz von<br />
Hohenkirchen. Er hatte bereits 18 Parks und<br />
Clubanlagen in den Niederlanden und<br />
Deutschland und konnte sich auch in Hohenkirchen<br />
eine Anlage vorstellen. Ein spannender<br />
Augenblick für Gramberger. Er wusste:<br />
Van de Most ist entweder begeistert, oder<br />
man hat eh keine Chance. Gramberger erinnert<br />
sich, dass der Niederländer mit hängenden<br />
Schultern ausstieg und irgendetwas<br />
murmelte. Gramberger sah seine Chancen<br />
schwinden. Doch auf einmal änderte sich<br />
die Stimmung. Wie wild malte van de Most<br />
auf dem Boden und demonstrierte mit<br />
Steinen, was er vorhat. Gramberger hatte es<br />
also geschafft. Trotzdem war man im Ort zurückhaltend.<br />
Anbieter von Fremdenzimmern<br />
sahen Konkurrenz, und auch die<br />
Handwerker fühlten sich bedroht.<br />
Hört man sich heute im Dorf um, trifft<br />
man auf Zustimmung. Kurz hinter der<br />
Kirche, rund 800 Meter vom „Dorf Wangerland“<br />
entfernt, gibt es einen Bäcker. Er hat<br />
vor Kurzem sein Geschäft saniert und erweitert.<br />
Wo zuvor nur eine Theke war, gibt es nun auch Sitzplätze<br />
für Gäste, und auch hier scheint man vom „Dorf Wangerland“<br />
zu profitieren: „Wenn die Leute aus ihrem Ferien-Ghetto herauskommen,<br />
dann wollen sie auch das richtige Friesland kennen<br />
lernen“, sagt eine Bedienung. Die Inhaberin des Blumengeschäfts<br />
meint: „Mein Urlaub wäre es nicht, aber ich finde es<br />
schön, dass es das Dorf Wangerland jetzt gibt, auch wir selbst<br />
gehen dort öfter mit unseren Kindern hin.“ Ganz nebenbei hat<br />
der Park auch 45 feste Arbeitsplätze geschaffen. So gut wie jeder<br />
im Ort war schon mal dort. Schließlich gibt es da eine große<br />
Halle zum Feiern, so etwas hatte man vorher nicht.<br />
In Hohenkirchen selbst bröckelt an vielen Häusern der Putz,<br />
die Fensterläden sind heruntergelassen. Eine breite Straße führt<br />
mitten durch den Ort. Das soll sich ändern. Die Gemeinde gibt<br />
Geld für Arbeiten am eigenen Haus. Vielleicht wird es bald auch<br />
eine idyllische Postkarte aus Hohenkirchen geben. Die breite<br />
Straße, bisher den Autos vorbehalten, bekommt jetzt einen<br />
Gehweg. Ein Teil davon ist schon fertig – der vom echten Dorf<br />
ins „Dorf Wangerland“. Daniel Krawinkel<br />
„Man muss<br />
es ja nicht<br />
alles direkt<br />
lieben, aber<br />
es ist einfachinteressant“,<br />
sagt<br />
Gramberger.<br />
A Z U R G R A U 3 9
RÖMER IN<br />
SICHT<br />
Lebenswandel<br />
ARCHÄOLOGEN ERFORSCHEN<br />
DAS LEBEN DER GERMANEN<br />
IN FRIESLAND. DABEI HABEN<br />
SIE BEWEISE DAFÜR ENT-<br />
DECKT, DASS AUCH DIE RÖMER<br />
DAS LAND DURCHQUERTEN<br />
4 0 A Z U R G R A U<br />
Vorsichtig schabt ein Archäologe mit einem Spachtel die Erde<br />
zur Seite. Dann stockt er. Was auf den ersten Blick aussieht<br />
wie ein Stein, ist das Stück einer Jahrtausende alten Keramik.<br />
Sorgsam packt er die Scherbe in eine kleine Plastiktüte. Diese Szene<br />
könnte in Trier, Köln oder am Limes spielen, aber die Archäologen<br />
graben in Ostfriesland: Sie legen gerade die Überreste einer antiken<br />
Stadt frei. Der beschauliche Ferienort Sievern in Niedersachsen, sechs<br />
Kilometer im Hinterland der Nordsee, ist ein wichtiger Punkt auf der<br />
archäologischen Landkarte. Denn hier, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, befand sich vor zweitausend<br />
Jahren eine der wichtigsten Städte im Elbe-Weser-Dreieck. „Hier saß die Obrigkeit, von hier<br />
wurde das Leben in der Umgebung organisiert“, sagt der Archäologe Hauke Jöns,<br />
wissenschaftlicher Direktor des Niedersächsischen Instituts für historische<br />
Küstenforschung in Wilhelmshaven.<br />
Dort, wo früher einmal Germanen lebten, sind heute Felder, Windräder und<br />
einige Bauernhöfe. Ein Stück weiter, wo sich ein Feldweg durch die Landschaft<br />
zieht, rollten die Wellen der Nordsee auf das Land. Man hätte mit dem Boot herfahren<br />
können. In der Antike haben Meer und Flüsse hier einen fruchtbaren<br />
Küstenstreifen geschaffen: die Marsch. Ein natürlicher Deich aus Geröll und<br />
Erde schützt sie vor dem<br />
Wasser, doch in Prielen<br />
dringt das Meer auch bis<br />
hier vor. Die Marsch ist<br />
ein Eldorado für Archäologen.<br />
Denn der Boden enthält keinen Sauerstoff und<br />
konserviert so die Überreste. Ein Glücksfall für die<br />
Forscher, der erstaunliche Entdeckungen ermöglicht.<br />
„Ich denke immer gerne zurück an Forschungen, die<br />
zu einem völligen Verändern eines Weltbilds geführt<br />
haben. Das ist mir schon mehrmals gelungen“, sagt<br />
Hauke Jöns.<br />
Der Archäologe<br />
übertreibt nicht: Er<br />
und sein Team fanden bei Grabungen in Bentumersiel in der Nähe von Leer<br />
im vergangenen Jahr römische Münzen und Teile von Militärausrüstungen.<br />
Bis dahin zeugten nur römische Historiker vom Besuch der Römer in<br />
Ostfriesland. Es war im Jahr 12 vor Christus, als Drusus, der Stiefsohn des<br />
römischen Kaisers Augustus, mit seinen Schiffen erstmals in die Ems vordrang,<br />
schreibt Tacitus. Er erzählt von tausend Schiffen und etwa siebzigtausend<br />
Soldaten, die sich in den kleinen Fluss Ems zwängten. Etwa 40<br />
Kilometer lang könnte der Tross zu Land und zu Wasser gewesen sein.
Auch wenn bekannt ist, dass römische Geschichtsschreiber gerne<br />
übertreiben – die logistische Leistung der Römer muss beeindruckend<br />
gewesen sein.<br />
Und die Nieten, Schnallen und Schwertteile, die die Archäologen<br />
gefunden haben, beweisen nun auch wissenschaftlich, dass die<br />
Römer in diese Gebiete vordrangen.<br />
Erfolgreich waren die Römer mit ihren Feldzügen nicht. Und<br />
besonders reizvoll erschien ihnen das Land an der Nordsee nie. Der<br />
Geschichtsschreiber Plinius war selbst Soldat und hat das Land<br />
wahrscheinlich mit eigenen Augen gesehen. Für die Bewohner hat<br />
er nicht viel übrig und beschreibt mit römischer Arroganz „ein beklagenswertes<br />
Volk“: „Indem sie den mit den Händen gesammelten<br />
Schlamm mehr durch den Wind als durch die Sonne trocknen, machen sie mit<br />
Hilfe [dieser] Erdart ihre Speisen und ihre vom<br />
Nordwind erstarrten Eingeweide warm.“<br />
Was sich bei Plinius nach einem unterentwickelten<br />
Volk anhört, deckt sich nicht mit dem,<br />
was die Wissenschaftler nun finden. Aus den<br />
Ausgrabungen lässt sich auf eine entwickelte<br />
Gesellschaft schließen, die Vieh hielt, Ackerbau<br />
betrieb und auch Eisen verarbeitete.<br />
Die neue Ausgrabung in Sievern soll das Bild,<br />
das an vielen Stellen noch unklar ist, schärfer<br />
zeichnen. „Dieses Ensemble aus zwei Burgen,<br />
Landeplätzen, Bauerngehöften und Friedhöfen in<br />
einer Konzentration, wie wir es in Norddeutschland<br />
an keiner anderen Stelle haben, das ist eine besondere Forschungssituation,<br />
die wir ausnutzen wollen“, sagt Jöns.<br />
Der Archäologe steht in einer etwa einen halben Meter tiefen Grube.<br />
In dem Erdloch unter dem Mutterboden zeichnen sich dunkle<br />
Messen, graben, sieben:<br />
Verfärbungen auf dem Boden ab. Ein klarer Fall für Jöns: An dieser Stelle<br />
Im friesischen Sievern su-<br />
stand ein Haus. Die kräftigen Pfosten in der Mitte haben ein Dach gechen<br />
Archäologen um<br />
Hauke Jöns nach Spuren<br />
tragen, es gab genug Platz für Tiere und Menschen. Diese Gehöfte sind<br />
einer mehr als 2000 Jahre<br />
typisch für die germanischen Stämme, die hier gelebt haben.<br />
alten germanischen Stadt<br />
In einem Wald ganz in der Nähe sind noch heute runde Erdwälle von<br />
zwei Burganlagen zu sehen. Dort<br />
wurden bereits germanische Amulette<br />
aus Gold gefunden. Solche<br />
spektakulären Funde erwarten die<br />
Archäologen bei dieser Grabung<br />
nicht. Aber sie soll Antworten geben<br />
auf die vielen Fragen, die noch offen sind. Wie viele Menschen haben hier<br />
gelebt? Waren es mehr Bauern oder Händler und Handwerker? Es wurden bereits<br />
Ofenanlagen gefunden, die zeigen, dass hier Töpfer und Schmiede arbeiteten.<br />
Doch wie passen die Puzzelteile zusammen, fragt sich Hauke Jöns.<br />
Metallfunde haben er und seine Helfer noch nicht ans Tageslicht gefördert. Aber<br />
einige Keramikfunde lassen zumindest<br />
eine Datierung zu: Im<br />
ersten, zweiten und dritten Jahrhundert<br />
nach Christus gab es hier eine Siedlung.<br />
Wie viele Menschen in der Siedlung im heutigen Sievern lebten,<br />
ist ebenfalls noch unklar. Die Archäologen haben ein Zelt aus weißer<br />
Plane aufgebaut. Unter der Oberfläche des Ackers gibt es noch viel zu<br />
entdecken. Nachdem es während der ersten Tage fast ununterbrochen<br />
geregnet hat und die Erdgrube auf dem Feld in ein Schlammloch verwandelt<br />
hatte, hoffen die Forscher nun auf weitere Funde. Drei Wochen<br />
haben sie noch Zeit, dann wird hier der ostfriesische Bauer wieder<br />
Getreide pflanzen. Hauke Jöns ist optimistisch. C. Gregor Landwehr<br />
A Z U R G R A U 4 1<br />
FOTOS: JANOS BURGHARDT (6) / NIEDERSÄCHSISCHES INSTITUT FÜR HISTORISCHE KÜSTENFORSCHUNG (3)
MIT EINEM KILO SCHLICK<br />
4 2 A Z U R G R A U<br />
2 ANNE-KATHRIN KELLER, 24 JAHRE:<br />
… meine eigene Wattwurmfarm anlegen. Eine<br />
gute Investitionsidee für Süddeutschland.<br />
8 DANIEL KRAWINKEL, 23 JAHRE:<br />
… mir ein kleines Schlickschloss bauen – man<br />
soll ja klein anfangen.<br />
5 C. GREGOR LANDWEHR, 25 JAHRE:<br />
… eine Schlammschlacht machen.<br />
1 SANDRA PETERSEN, 22 JAHRE:<br />
… um die Welt reisen. Damit der Schlick<br />
auch mal was anders sieht.<br />
6 CARLA NEUHAUS, 23 JAHRE:<br />
… das Wattenmeer ins Münsterland holen.<br />
11 ESTHER STALLMANN, 28 JAHRE:<br />
… meine Altersangabe hier begraben.<br />
1<br />
ANDREA HOYMANN, 26 JAHRE:<br />
… es als dubioses Schönheitsprodukt<br />
teuer verkaufen.<br />
1 SONJA HARTWIG, 23 JAHRE:<br />
… an die Ostsee fahren.<br />
1 EVA ZIMMERMANN, 23 JAHRE:<br />
… einem Wattwurm ein luxuriöses und vor<br />
allem stipendiatensicheres Watt-Haus bauen.
WÜRDE ICH ...<br />
10 HEIDI BEHA, 23 JAHRE:<br />
… den Schornstein des Wilhelmshavener<br />
Kohlekraftwerks zustopfen.<br />
WANGEROOGE<br />
7<br />
HOHENKIRCHEN 8<br />
SENGWARDEN 10<br />
JEVER 9 RÜSTERSIEL 11<br />
WILHELMSHAVEN 1<br />
NEUSTADTGÖDENS 2<br />
3 ANNA KUHN-OSIUS, 25 JAHRE:<br />
… nochmal eine Rutschpartie machen.<br />
1 JANOS BURGHARDT, 23 JAHRE:<br />
… eine Schlamm-Catch-Arena für Wattwürmer<br />
bauen.<br />
DANGAST 3<br />
7 CHARLOTTE POTTS,<br />
22 JAHRE: … Schlick-BHs für<br />
die barbusigen Meerjungfraustatuen<br />
dieser Welt basteln.<br />
4<br />
FEDDER-<br />
WARDERSIEL<br />
1 JOCHEN MARKETT, 29<br />
MICHAEL HANDEL, 27:<br />
… ein großflächiges Kunstwerk<br />
malen und es „Schlick 1“ nennen.<br />
6<br />
WREMEN<br />
5<br />
SIEVERN<br />
9 SEBASTIAN QUILLMANN,<br />
26 JAHRE: … meine Förmchen<br />
vorholen und Backe-Backe-Kuchen<br />
spielen, bis die Sonne über dem<br />
Watt versinkt.<br />
IMPRESSUM<br />
Lebenswandel<br />
4 LUISE SAMMANN,<br />
23 JAHRE: … die Augenringe<br />
nach dem Seminar abdecken.<br />
HERAUSGEBER:<br />
<strong>Journalisten</strong>-<strong>Akademie</strong> der<br />
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.<br />
Hauptabteilung Begabtenförderung<br />
und Kultur<br />
Rathausallee 12<br />
53757 Sankt Augustin<br />
Tel.: 02241/246-2289<br />
E-Mail: journalisten-akademie@kas.de<br />
www.journalisten-akademie.com<br />
CHEFREDAKTION:<br />
Eva-Maria Schnurr, www.plan17.de<br />
Jochen Markett (V.i.S.d.P.)<br />
GESTALTUNG:<br />
Angela Dobrick, www.angela-dobrick.de<br />
DRUCK:<br />
Bonifatius GmbH, Druck – Buch – Verlag<br />
33042 Paderborn<br />
„azurgrau – Leben am Watt“ ist während<br />
eines Seminars der <strong>Journalisten</strong>-<strong>Akademie</strong><br />
der Konrad-Adenauer-Stiftung im<br />
März 2009 entstanden. „azurgrau“ gibt<br />
es auch im Hörfunk- und Fernsehformat.<br />
© 2009 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
A Z U R G R A U 4 3