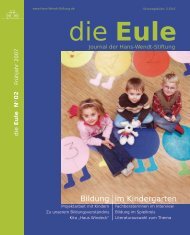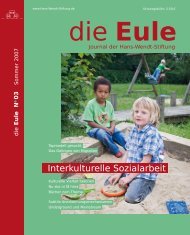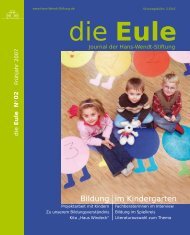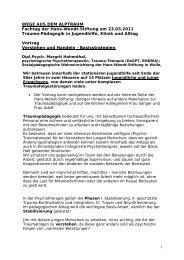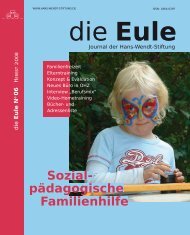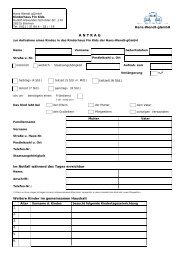Eule - Hans-Wendt-Stiftung Bremen
Eule - Hans-Wendt-Stiftung Bremen
Eule - Hans-Wendt-Stiftung Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PRAXISUnser Auftrag als MitarbeiterInnen der <strong>Hans</strong>-<strong>Wendt</strong>-<strong>Stiftung</strong> und derKindertagesstätten beginnt dort, wo Kinder und Familien Begleitung undUnterstützung brauchen. Eltern -in der Regel allein erziehende MütterbeantragenHilfe für sich und ihre Kinder, damit vertrauen sie uns ihr Kindan. Sie sehen uns häufig als „Experten“ bei der Bewältigung vorhandenerSchwierigkeiten und dem Finden von Lösungen.An dieser Stelle wird uns meines Erachtens eine große Fähigkeit abverlangt,die wir nicht an Aus-, Fort- und Weiterbildungsinstituten lernen:eine personale Kompetenz. Im Unterschied zur Fachkompetenz, diewir verhältnismäßig leicht erlernen und trainieren können, erfordert diepersonale Kompetenz eine große persönliche Souveränität, die einen respektvollenUmgang mit unseren Kunden (Familien und anderen KooperationspartnerInnen)erst ermöglicht. Dazu gehört auch, die Bedeutungder Alltagskompetenzen von Eltern und Familien anzuerkennen. Prof. UtaMeier-Gräwe 1 , die an der Universität Gießen mit so genannten haushaltswissenschaftlich-ganzheitlichenArmutsstudien befasst ist, weist daraufhin, dass die Alltagskompetenzen von Familien vom Helfersystem gemeinhinunterschätzt werden. Zum Helfen (Retten? Heilen?) sozialisiertund professionalisiert, lassen wir uns mitunter hinreißen, Lösungen anzubieten,die aus unserer Perspektive für Familien sinnvoll erscheinen. Undnicht selten sind wir geneigt, stellvertretend für elterliche VerantwortungAufgaben zu übernehmen, die eine (schnelle) Verbesserung der familiärenLage in Aussicht stellen - letzteres ist schließlich unser Auftrag.Die Grenzen jedoch sind fließend zwischen dem Aktivieren von Hilfezur Selbsthilfe und einer überbehütenden, im übertragenden Sinne „fütternden“Haltung. Eine solche Haltung wird der elterlichen Verantwortungund den manchmal wenig sichtbaren, doch nichtsdestotrotz vorhandenenKompetenzen der Familien nicht gerecht und führt die HelferInnen nichtselten -früher oder später- in ein Burn-Out-Syndrom, vor allem wenn diese(oft unbewusste) Haltung nicht reflektiert und überwunden wird.Meier-Gräwe hat in ihrer wissenschaftlichen Forschung herausgestellt,dass die Eigeninitiative von Bedürftigen zu einem Rückzug der professionellenHelfersysteme führt. Dies ist umso kritischer, als dass geradedann viele Eltern Unterstützung brauchen, wenn sie etwas Neues für sichund ihre Kinder versuchen und Schritte in ein selbstständiges -von staatlichorganisierter Hilfe- unabhängigeres Leben erproben. Das Problem jedochist, dass der Fokus unserer Sozialpolitik auf der Armutsinterventionliegt, statt auf einer Armutsprävention!Ein anderer „Stolperstein“ auf dem Weg der Verbesserung von Lebenslagenfür Kinder und Familien im Quartier ist die noch immer verbreitetefeste Annahme vieler HelferInnen, Kinder seien bis an ihr Lebensende inihren Möglichkeiten beeinträchtigt. Gemeint ist dieses quasi als deterministischerZusammenhang, wenn Kinder z.B. durch frühe Trennung vonwichtigen Bezugspersonen traumatisiert sind.Als 1999 die deutschsprachige Ausgabe des Buches „Es ist nie zu spät,eine glückliche Kindheit zu haben“ von Ben Furman 2 erschien, war ichpersönlich hoch erfreut, da er diese Sichtweise als Mythos entlarvt undin seinem Buch sehr eindrucksvoll berichtet (und berichten lässt): Kinderwachsen unter bestimmten Bedingungen -ganz im Gegensatz zu weitläufigenAnnahmen und Behauptungen- an ihren Herausforderungen undstellen ihre Fähigkeiten „unter Beweis“ im Sinne des Leitsatzes: „WoGefahr ist, wächst das Rettende auch!“ 3 Ein Phänomen, das die so genannteResilienzforschung 4 inzwischen gut beschrieben hat. Ohne dieseErkenntnisse ist für mich sinnvolle und erfolgreiche psychosoziale Arbeitundenkbar. Sie regen an, die eigene Rolle bei der Bewältigung von kindlichenund/oder familiären Herausforderungen neu in den Blick zu nehmenund uns auf das viel beschworene und doch häufig vernachlässigtePrinzip der Hilfe zur Selbsthilfe zu besinnen und zu beschränken! Dies istkeine leichte Aufgabe, vor allem da wir gleichzeitig herausgefordert sind,die persönliche Bedeutung, die wir in unserer Arbeit für einzelne Kinderund deren Eltern gewinnen, anzuerkennen und anzunehmen.Nach langjähriger Erfahrung in interprofessionellen Teams wird dieseBedeutung nach meiner Auffassung von pädagogischen KollegInnen,auch und gerade im Leben der Kinder unterschätzt! Wir kennen Kinder,die nach einer akuten familiären Krise in Obhut genommen wurden unddabei deutlich zeigten, dass sie in ihre Familie und damit auch gegebenenfallszu einem schlagenden Elternteil zurück wollten - allem zum Trotz.Dies wird meines Erachtens immer wieder von Helfern als subjektive Niederlage,als Misserfolg in Bezug auf die eigene Wirksamkeit der „helfenden“Aktivitäten bewertet. Das Kind wird bedauert und nicht selten gehtmit einer mitleidenden Haltung die Anerkennung darüber verloren, dassdas betroffene Kind deshalb noch lange nicht „den Bach `runter geht“,sondern auch darin - mit Einschränkung versehen - Entwicklungschancenliegen.1 Meier Gräwe forscht am Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbraucherforschungan der Justus-Liebig-Universität Gießen2 Ben Furman: Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, BorgmannVerlag, 19993 Zitiert nach Hölderlin4 Der Begriff Resilienz wird im allgemeinen als psychische Widerstandsfähigkeitvon Menschen gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialenEntwicklungsrisiken definiert und umfasst zugleich seine Fähigkeiten, mitBelastungen und Stressoren erfolgreich umzugehen.Zudem wird die Bedeutung der persönlichen Erfahrung des Kindes,dass es Menschen in ihrer Lebenswelt gibt, z. B. in der Kindertagesstätte,die ihre Verletzungen und ihr Leid wahrnehmen, meines Erachtens improfessionellen Kontext nicht genügend gewürdigt. Für diese Kinder istes sehr wichtig zu erleben, dass es Menschen gibt, die ihre Verletzungensehen, als ungerecht bewerten und die Partei für sie ergreifen. Das heißtnicht zwangsläufig, dass sie sich gegen ihren Vater oder gegen ihre Mutterstellen - auch dann nicht, wenn er oder sie das „Kindeswohl“ gefährdet.Diese Kinder brauchen von uns in solchen Situationen unser vorbehaltlosesVerständnis ihrer ungebrochenen Loyalität gegenüber ihrer Familie.Wir haben nicht das Recht, uns bewusst oder unbewusst als die„besseren“ Eltern (oder Elternfiguren) mit dem „besseren“ Lebens- undZukunftsentwurf vorzustellen. Wenn uns dies gelingt, Einfühlung inVerletzungen und Anerkennung der persönlichen Bindungen und Entscheidungenanderer zu zeigen, erfüllen wir eine wichtige Aufgabe imLeben von Menschen, die Begleitung, Unterstützung und Orientierungbrauchen. Denn schützende Faktoren im Sinne einer Resilienz finden wirdie <strong>Eule</strong> . Frühjahr 20085