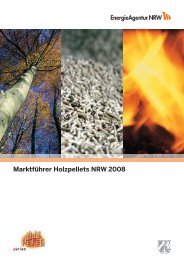Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen und Pelletöfen - DEPV
Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen und Pelletöfen - DEPV
Marktübersicht Pellet-Zentralheizungen und Pelletöfen - DEPV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Tabelle 4-3: Praxiswerte für die Kesselbrenndauer<br />
Kesselnennleistung<br />
Füllschachtvolumen<br />
- Die Reduktion des Füllraumvolumens durch<br />
einen Schichtmaß-Umrechnungsfaktor (analog<br />
der Umrechnung von Raummeter in Festmeter<br />
in der Forstwirtschaft) ist erforderlich, weil das<br />
Holz nie so exakt eingefüllt werden kann, dass<br />
keine Luftspalten mehr zwischen den Holzscheiten<br />
vorhanden sind. Darüber hinaus kann<br />
die max. Länge des Füllraumes ebenfalls nicht<br />
ausgereizt werden, damit keine Probleme mit<br />
dem Verschließen der Fülltüre auftreten. Außerdem<br />
sollte das Holz immer „luftumspült“ sein,<br />
um einen ausreichenden Luftüberschuß für die<br />
Vergasung zu gewährleisten.<br />
- Die praktische Brenndauer bei 50 % Teillast ist<br />
nicht immer doppelt so hoch wie im Volllastbetrieb.<br />
Das gilt vor allem für einen Kaltstart,<br />
bei dem erst alle feuerungsbeaufschlagten Teile<br />
die Betriebstemperatur erreicht haben müssen.<br />
Erst wenn die Vergasung stabil – d. h. voll regelbar<br />
– abläuft (i. d. R. nach 10 bis 30 Minuten je<br />
nach Kesseltyp <strong>und</strong> Anheizqualität), kann auf<br />
Teillastbetrieb umgeschaltet werden. Dies sollte<br />
von der Regelungselektronik erkannt werden.<br />
Ein 25 bis 30 kW-Kessel mit einem Füllschachtvolumen<br />
kleiner als 100 l kann deshalb im Vollastbereich<br />
auch bei der Verbrennung von Buchenholz unmöglich<br />
5 Std. lang brennen. Dazu ist ganz einfach zu wenig<br />
Brennstoff vorhanden.<br />
Es wird deshalb empfohlen, beim Kauf auf ein<br />
Modell mit ausreichend dimensioniertem Füllschachtvolumen<br />
zu achten.<br />
4.7 Kesselwirkungsgrad<br />
Brennstoff<br />
Scheitholzvergaserkessel besitzen konstruktionsbedingt<br />
Kesselwirkungsgrade von mindestens 80 bis<br />
über 90 Prozent <strong>und</strong> haben damit eine Spitzenposition<br />
im Vergleich verschiedener Scheitholzverbrennungssysteme<br />
(Kamine, Kaminöfen, etc.). Für eine<br />
Förderung entsprechend des neuen B<strong>und</strong>esprogramms<br />
(siehe Punkt 3) ist – neben anderen Krite-<br />
Kesselwirkungsgrad<br />
Empfehlungen zur technischen Bewertung der Kesselsysteme<br />
Betriebszustand<br />
30 kW 140 l Laubholz 89 % Volllast<br />
50 % Teillast<br />
26 kW 150 l Laubholz 86 % Volllast<br />
50 % Teillast<br />
Brenndauer<br />
ca. 5 Std.<br />
ca. 10,75 Std.<br />
ca. 5 Std.<br />
ca. 10 Std.<br />
Herkunft der<br />
Information<br />
Prüfbericht<br />
persönl.<br />
Erfahrung<br />
rien – ein Kesselwirkungsgrad von mindestens 90 %<br />
erforderlich. In diesem Zusammenhang ist die Stärke<br />
der Kesselisolierung wichtig, um die Abstrahlung zu<br />
minimieren <strong>und</strong> die erzeugte Wärme mit möglichst<br />
geringem Verlust in den Heizkreislauf einzubringen.<br />
Die bisher höchsten geprüften Kesselwirkungsgrade<br />
bei Modellen im Nennleistungsbereich bis 50 kW liegen<br />
bei 92 bis 94 %. Es sind stolze 35 Kesselmodelle<br />
von 15 Herstellern mit diesen hohen Kesselwirkungsgraden<br />
verfügbar.<br />
Im Zusammenhang mit der Wirkungsgraddiskussion<br />
wird von einigen Herstellern im Prospekt mit<br />
dem feuerungstechnischen Wirkungsgrad argumentiert,<br />
um die Überlegenheit des eigenen Produktes<br />
hervorzuheben. Das ist irreführend, da dieser Wert<br />
lediglich den Ausnutzungsgrad der im Kessel freigesetzten<br />
Wärmemenge im Verhältnis zum Wärmeinhalt<br />
des eingesetzten Brennstoffs angibt.<br />
Der Kesselwirkungsgrad dagegen gibt das Verhältnis<br />
der nutzbaren Wärmemenge (Vorlaufleitung<br />
des Kessels) zum Wärmeinhalt des eingesetzten<br />
Brennstoffs an. Da hier alle Verlustquellen an der<br />
Wärmeerzeugungsanlage einbezogen werden<br />
(Abstrahlungsverluste, Abgasverluste etc.) ist er für<br />
einen Kesselvergleich wesentlich objektiver (aber<br />
dadurch auch niedriger als der feuerungstechnische<br />
Wirkungsgrad).<br />
Der technisch erreichbare Kesselwirkungsgrad am<br />
Aufstellungsort ist auch von den Schornsteinverhältnissen<br />
abhängig. Viele Scheitholzvergaserkessel<br />
gestatten eine Regulation der Abgastemperatur durch<br />
Veränderungen der Rauchgasführung im Wärmetauscher.<br />
Je mehr Schikanen (Turbulatoren) das Rauchgas<br />
nach dem Verlassen der heißen Brennkammer im<br />
Wärmetauscher überwinden muss, desto mehr<br />
Wärme kann es abgeben, desto niedriger ist die<br />
Abgastemperatur <strong>und</strong> desto höher ist folglich der<br />
Kesselwirkungsgrad.<br />
Je „kälter“ das Abgas, desto höher ist jedoch auch<br />
die Gefahr der Schornsteinversottung durch Unterschreitung<br />
der Taupunkttemperatur. Um hier ein<br />
19