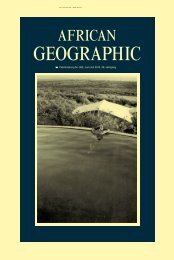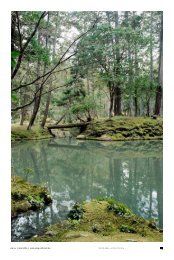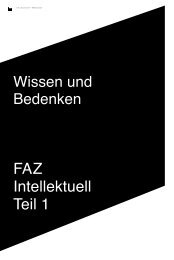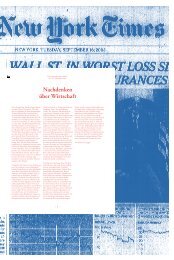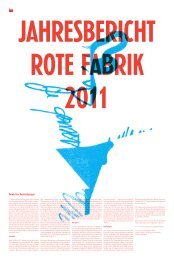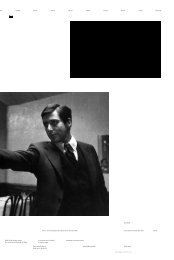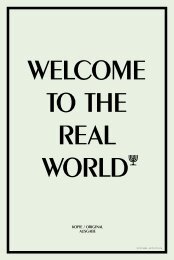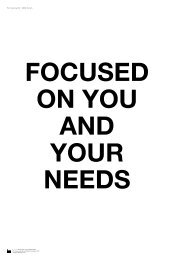Art of Destruction — Fabrikzeitung Nr. 277, Dezember ... - Rote Fabrik
Art of Destruction — Fabrikzeitung Nr. 277, Dezember ... - Rote Fabrik
Art of Destruction — Fabrikzeitung Nr. 277, Dezember ... - Rote Fabrik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Political Correctness<br />
Destroyed<br />
«Destroy» hat als geflügeltes Wort eine ganze Generation durch<br />
ihre Jugend begleitet, und in meinem Fall trotz der Tatsache, dass ich<br />
natürlich nicht Skateboarden konnte. Teils aus der der Skateboardnaheliegenden-<br />
Snowboardszene entliehen, ferner auch an die Lebens-<br />
einstellung der Grunge-Bewegung anknüpfend, war oder eigentlich ist<br />
sich eine ganze Generation von Jugendlichen in den 1980er und frühen<br />
90er Jahren einig unausgesprochen aber dennoch dezidiert einig ge-<br />
wesen, dass Zerstörung als effizienter kreativer Prozess bzw. Mittel ein-<br />
zusetzen sei, um Neues überhaupt erst nach dem gewaltsamen Ab-<br />
streifen historisch verinnerlichter Altlasten zu ermöglichen. In der Kultur,<br />
vor allem aber in der Jugendkultur war diese Strategie besonders<br />
sichtbar. Paradigmatische Figuren dafür sind für mich die Musikband<br />
Einstürzende Neubauten, der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder<br />
(Deutschland im Herbst, 1978), oder Punk- und New-Wave-Bands wie<br />
DAF, Male, Mittagspause, Fehlbarben, Abwärts, die Tödliche Doris oder<br />
Minus Delta t: «Das Konzept von denen [Minus Delta t] war die absolute<br />
Antimusik. Die haben Leute beschmissen mit Fischkadavern, Einge-<br />
weiden von geschlateten Viechern, Mehl, Beton, mit allem, was man sich<br />
vorstellen kann. Der Sound war archaischer Krach. Unvorstellbar. Zur<br />
Mitte des Auftritts war der Ratinger H<strong>of</strong> leer. Da war kein Mensch mehr.<br />
Das haben die geschafft.» 1 Nicht zufällig nenne ich hier deutsche<br />
Kulturschaffende, denn letztendlich war und ist das historische Erbe in<br />
den geografischen Breitengraden bekanntlich besonders schwer. Der<br />
Besuch der Performa 11, dem angesagtesten Performance-Anlass der<br />
letzten 5 Jahre, der im November 2011 zum vierten Mal in New York<br />
stattfand, hat mir einmal mehr vor Augen geführt, dass zum einen<br />
gewisse Themen noch lange nicht abgehakt sein werden, zum anderen<br />
aber auch der sich als global wähnende Kunst- und Kulturzirkus eben<br />
doch seine lokalen Färbungen, Sensibilitäten und Tabus und dies be-<br />
sonders auf Ebene der Rezeption hat. Konkret geht es um eine Perfor-<br />
mance des deutschen Künstlers Jonathan Meese, die in der New Yorker<br />
Kunstszene auf sehr gemischte, kontrovers gestimmte Resonanz<br />
stiess. Ich möchte im Folgenden einige Überlegungen anstellen, warum<br />
das möglicherweise so war, vor allem aber auch, warum solche<br />
Performances mehr denn je nötig sind.<br />
Das 2004 von Rose Lee Goldberg gegründete Performance-<br />
Festival ist das wichtigste Performance-Festival Nordamerikas, und<br />
avancierte in den letzten Jahren zu einer der weltweit wichtigsten Veran-<br />
staltungen ihrer <strong>Art</strong> im Bereich der zeitgenössichen Kunst. Über 50<br />
Kuratoren und ebensoviele Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt<br />
sind daran beteiligt. Das Festival ist logistisch so angelegt, dass die<br />
Metropole New York sich als geographischer Inbegriff der Verschmelzung<br />
von Transdisziplinarität, Trans-, Multi- und Interkulturalität mit<br />
dem von Performance sehr gut eignet. So berühmte wie überraschende<br />
(weil nicht unbedingt mit Performance assoziierte) Namen wie<br />
Elmgreen & Dragset, Lili Reynaud-Dewar, Shirin Neshat, Gerhard Byrne,<br />
Dennis Oppenheim, Spartacus Chetwynd, Rainer Ganahl, Mai-Thu<br />
Perret oder Alison Knowles finden sich hier wieder. Und so bin ich also<br />
auf Jonathan Meese aufmerksam geworden, weil mir seine Performance<br />
wenig vertraut waren und mich interessierte, wie diese tenden-<br />
ziell doch eher auf eine europäische oder zumindest deutsche Ge-<br />
schichte und deren auf eine stark vorbelastetete Ikonografie rekurrie-<br />
rende Kunst „live“ in der vermeintlich welt<strong>of</strong>fensten Stadt rezipiert<br />
werden würde. Ein weitereres, den Filmfestival vergleichbares Merkmal<br />
von Performa ist, dass es zwar eine <strong>Art</strong> Hub, d. h. organisatorisches<br />
Zentrum gibt, die Veranstaltungen ansonsten aber auf unzählige Partner-<br />
institutionen und ihren Lokalitäten verteilt werden.<br />
Jonathan Meeses Beitrag war mit War ‘Saint Just (First Flash)’<br />
angekündigt, und fand in der Bortolami Gallery, einer jüngeren Galerie<br />
1. Meikel Clauss, «Diktator-Kinder», in: Jürgen Teipel, Verschwende Deine Jugend –<br />
Ein Doku-Roman über den deutschen Punk und New Wave,<br />
Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2001, S. 127.<br />
2. Klaus Theweleit, Männerphantasien, Bd. 2, Frankfurt am Main<br />
(Verlag <strong>Rote</strong>r Stern) 1978, S. 461.<br />
3. In Referenz an den legendären Besteller des Psychologen Joachim Maaz:<br />
Der Gefühlsstau – Ein Psychogramm der DDR, Berlin (Argon Verlag) 1990.<br />
4. Jonathan Meese, Totale Neutralität, Kunstraum Innsbruck 2008, unpaginiert.<br />
Impressum<br />
Die Zeitung der <strong>Rote</strong>n <strong>Fabrik</strong><br />
<strong>Dezember</strong> 2011<br />
Modes <strong>of</strong> Practice: <strong>Art</strong> <strong>of</strong> <strong>Destruction</strong><br />
Konzept & Design:<br />
Gregor Huber & Ivan Sterzinger<br />
www.glashaus.ch<br />
Redaktion:<br />
Etrit Hasler<br />
Mit Beiträgen von:<br />
Justin H<strong>of</strong>fmann, Richard Galpin, Roger Behrens,<br />
Mike Davis, Thomas Brandstetter und Cathérine Hug<br />
Auflage:<br />
3500<br />
im angesagten und von Jahr zu Jahr merklich <strong>of</strong>fenkundiger gentrifi-<br />
zierten Chelsea statt. Der Perfomancetitel war so mehr oder weniger<br />
das Einzige mit Ausnahme eines kurzen Statements, die vorab Auskunft<br />
über den Inhalt der Performance gaben: «TOTAL ART = TOTAL META-<br />
BOLISM <strong>Art</strong> is total play. All performances and speeches are based on<br />
Metabolism, instinct, breathing, sweating and shouting. All action is<br />
animalism. Babymeese screams, sleeps, plays and fights. Play, Play,<br />
Play… obey, obey, obey…» Das diese Zeilen begleitende Ankündigungsbild<br />
zeigt einen in einem speckigen grauen Mantel undefinierbarer<br />
Herkunft eingeschnürten Meese, der mit Sonnenbrille und inmitten<br />
seiner Bilder militaristisch salutiert. Pickantes Detail ist der rote Gurt,<br />
der umbequem eng und weit über den Hüften bzw. eher um den<br />
Brustkorb geschnürt ist und auch farblich so gar nicht zur restlichen<br />
«Komposition» des Bildes passen will. Die statische stolze Positur des<br />
Künstlers steht in einem scharfen Kontrast mit den dynamisch wilden<br />
Pinselstrichen seiner ihm umgebenden Bilder. Das grotesk anmutende<br />
Selbstporträt lässt die schizophrene Haltung Meeses erhahnen, die<br />
er generell gegenüber dem Kunstsystem hat und im Veranstaltungsprogramm<br />
mit den Begriffen «Kasperletheater» und «Dictatorship <strong>of</strong> <strong>Art</strong>»<br />
beschrieben wird.<br />
Am Abend der eigentlichen Performance finden wir dieses<br />
Szenario in grossen Zügen zwar wieder, einige wesentliche Details<br />
weichen jedoch von der fotografischen Vorlage ab: Meeses Oberköper<br />
ist nun nackt aber derselbe bedrohlich rote Gürtel schnürt sich um<br />
den Brustkorb des Künstlers, und verstärkt somit noch deutlich seine<br />
eher unvorteilhafte Figur. Der im Titel War ‘Saint Just (First Flash)’<br />
angekündigte Kreuzzug ist eine lauthalse Hasstirade auf das anwe-<br />
sende Publikum. Die Mehrheit der ZuschauerInnen, über 500 eng<br />
im Galerieraum eingepferchten und mehrheitlich KunstkennerInnen,<br />
sind über die Haltung Meeses konsterniert. Die Analogieherstellung<br />
zwischen dem dritten Reich und dem Kunstsystem wirkt für viele<br />
schmerzhaft absurd, für eine Mehrheit im Raum jedoch schlichtwegs<br />
inakzeptabel. Der Schockeffekt, den Meese zwar sicherlich ohnehin<br />
anstrebte, sitzt tief und scheint einen besonders wunden Punkt ge-<br />
tr<strong>of</strong>fen zu haben. Am Ausgang der Galerie, wo auch ich selbst mich<br />
irgendwann bald mal zurückziehen musste, stehen eine ganze Reihe<br />
mehrheitlich entnervte junger Frauen. Eine unter ihnen ist so fassungs-<br />
los, dass sie mit uns in ein zwanghaftes Gespräch kommt, um ihren<br />
Mitteilungsdrang freien Lauf zu lassen und meint bzw. befragt uns zum<br />
Geschehen, ob wir es nicht auch unzulässig fänden würde, die an-<br />
wesenden BesucherInnen mit einem cholerischen, an den deutschen<br />
Diktator und Demagogen erinnernden Ton zu beschimpfen. Ich selbst<br />
bin über die Reaktion dieser jungen Frau ziemlich überrascht, weil sie<br />
die selbstkritische, ironisch scharfe Selbstdemontage Meeses nicht<br />
erkennt. Obschon Meese hier, und wie er es im übrigen auch generell in<br />
seiner Kunst macht, auf eine absolut fragwürdige symbolkräftige<br />
Ikonografie zurückgreift, tut er dies ja keineswegs mit einer affirmativen<br />
sondern vielmehr in einer krass agonisierenden Haltung. Im Falle von<br />
War ‘Saint Just (First Flash)’ fiel mir zum Beispiel besonders die<br />
schmerzhaft drastische Demontage des Körpers, und insbesondere des<br />
männlichen Körpers auf. Meeses Performance steht in einem deutlich-<br />
en Bezug zu seiner Kindheit in einem Land, das mit seiner Geschichte<br />
noch lange nicht fertig sein wird, und wo trotz Aufarbeitung sich braune<br />
Spuren der Vergangenheit hartnäckig halten. Kein anderer hat dies<br />
besser beschrieben und analysiert als Klaus Theweleit in seinem zwei-<br />
bändigen, über tausend Seiten umfassenden Meisterwerk Männerphantasien<br />
– Zur Psychoanalyse des Weissen Terrors (1978) geäussert,<br />
und passend zur gespaltenen, frustrierten Geisteshaltung, welche<br />
Meese uns hier provokativ vorspielt, könnte man folgende Passage<br />
<strong><strong>Fabrik</strong>zeitung</strong><br />
Seestrasse 395<br />
Postfach 1073<br />
8038 Zürich<br />
zeitung@rotefabrik.ch<br />
Tel. +41/ 44 485 58 08<br />
Herausgeberin:<br />
IG <strong>Rote</strong> <strong>Fabrik</strong><br />
Seestrasse 395,<br />
8038 Zürich<br />
www.rotefabrik.ch<br />
Druck:<br />
Ropress Genossenschaft<br />
Baslerstrasse 106<br />
8048 Zürich<br />
zitieren: «Alles erobern, alles besitzen, Herr sein, weiter ziehen, weiter<br />
erobern und für den Kaiser schliesslich sterben. Herrlich, dass wäre es<br />
gewesen. [...] Und was bekam man die ganze Zeit wirklich? Man war<br />
gegängelter Schüler, gequälter Kadett, Geschliffener auf dem Kaser-<br />
nenh<strong>of</strong>, dann im Schlamm der Gräben im Krieg; und dann war man<br />
geschlagener Soldat, mehrfach verwundet. Es dauerte ein wenig lange<br />
mit den Festen. Schliesslich Angestellter in Grau, einer, den die Fett-<br />
säcke überhaupt nicht sahen, dem sie zu Weihnachten eine Zigarre<br />
spendieren liessen.» 2 Wenn ich mir die Arbeiten und diese konkrete<br />
Performance von Meese anschaue, ergreift mich plötzlicher Ekel und<br />
ich frage mich, was in diesem Typen vorgeht. Vermutlich so wie es<br />
gerade mir selbst bei der Betrachtung seiner Performance erging, nur,<br />
dass es bei Meese manchmal einen Dauerzustand zu sein scheint.<br />
Mir kommt es so vor, als müsste er den so verhassten Gegenstand<br />
seiner Analyse regelrecht einverleiben, und ihn in einer <strong>Art</strong> konvulsorischen<br />
Haltung zu «verdauen» und wieder auszukotzen. In Analogie zur<br />
Passage aus Theweleits Analyse der Frustration einfacher Soldaten<br />
nach dem Weltkrieg könnte man mit einer „gefühlgestauten“ 3 und nun<br />
an die Oberfläche des Unbewussteins heraufschiessenden Äusserung<br />
Meeses anschliessen: «Wir leben in der Zeit des Massenindividualismus,<br />
nichts wird höher bewertet als Selbstverwirklichung um jeden Preis.<br />
Nur der eigene Popo wird als Massstab betrachtet und befragt, dieser<br />
mickrige Meinungsfanatismus erzeugt stinkende Ohnmacht, überall.» 4<br />
Es erweckt den Anschein, als stiesse die Diskussion, welche Meese<br />
hier anregen möchte, nicht auf besonderen Nährboden in Nordamerika.<br />
Die Thematik des von totalitären Systemen zuerst konstruierten und<br />
dann instrumentalisierten Körpers als Sinnbild einer autoritären Macht-<br />
ausübung, die latent immer noch bruchstückartig in unserer gegenwärtigen<br />
Gesellschaft vorhanden ist, wird an der Performa in New York<br />
von vielen als Affirmation missverstanden. «Political Correctness»<br />
besagt, dass man gewisse Gesten, Wörter, Zeichen oder Symbole gar<br />
nicht erst in den Mund nehmen oder abbilden darf, um Konfliktherde<br />
zu meiden. Und in der Tat: In Immigrationsländern wie den USA oder<br />
Kanada würden ohne den Konsens der Political Correctness der<br />
zwischenmenschliche Umgang kaum möglich sein und das friedliche<br />
Zusammenleben massgeblich erschwert. Nun sind aber mal Konflikte<br />
auf dem virtuellen Niveau des Intellekts auch notwendig, um gewisse<br />
Themen zu verarbeiten. Worüber Meese spricht, sind Fragen nach<br />
dem individuellen Umgang mit der Kollektivschuld, ob es eine solche<br />
gibt, und wenn ja, wieviel nachfolgende Generationen davon zu tragen<br />
haben, um eine, wenn auch noch partielle Wiederholung der Geschichte<br />
zu vermeiden. Was wollte Meese mit War ‘Saint Just (First Flash)’ über<br />
den Schockeffekt hinaus bei den BesucherInnen bewirken? Gleichzeitig<br />
stellt sich die Frage, wie Meeses zwar provokative aber meines Er-<br />
achtens doch deutliche Dekonstruktion Deutscher Nazi-Ikonografie<br />
derart falsch und zwar nicht als ihr affirmatives Gegenteil missverstanden<br />
werden? Aber vielleicht ist es aber auch einfach wie mit dem<br />
Punk: Auch er hat nicht überall auf der Welt gut funktioniert.<br />
von Cathérine Hug<br />
16