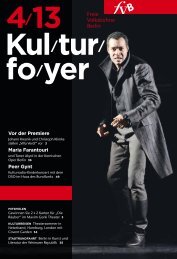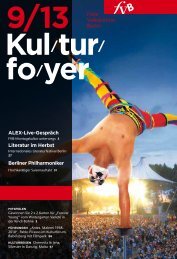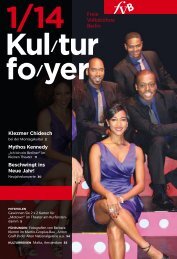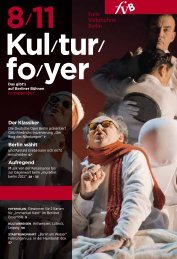Volksbühnen-Spiegel 1/2008 - Freie Volksbühne Berlin
Volksbühnen-Spiegel 1/2008 - Freie Volksbühne Berlin
Volksbühnen-Spiegel 1/2008 - Freie Volksbühne Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
flikt zwischen den Vorstands-Mitgliedern Bruno Wille<br />
und Julius Türk zur Spaltung des jungen Vereins. Bruno<br />
Wille verlässt die <strong>Freie</strong> <strong>Volksbühne</strong> und gründet noch<br />
am selben Tag die Neue <strong>Freie</strong> <strong>Volksbühne</strong>. Zum neuen<br />
Vorsitzenden der <strong>Freie</strong>n <strong>Volksbühne</strong> wird Franz Mehring<br />
gewählt, der damalige führende Kopf der deutschen<br />
Arbeiterbewegung. Fortan existieren in <strong>Berlin</strong><br />
zwei <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Vereine, die sich auf getrennten<br />
Bahnen entwickeln. Erst 1913 vereinigen sich die beiden<br />
<strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong> zu einem Kartell mit dem gemeinsamen<br />
Ziel, ein eigenes Theater zu bauen.<br />
Bau des eigenen „Volkskunsthauses”<br />
Die Schwierigkeit, von den bestehenden Privattheatern<br />
die notwendigen Vorstellungen zu erhalten, das rapide<br />
Wachstum an Mitgliedern, das die Schaffung immer<br />
neuer Vorstellungen nötig macht und nicht zuletzt das<br />
Bestreben, sich künstlerischen Aufgaben unmittelbar<br />
verantwortlich zu fühlen, lassen bei der Neuen <strong>Freie</strong>n<br />
<strong>Volksbühne</strong> den Gedanken an die Errichtung eines<br />
eigenen Hauses gedeihen. Der Vorstand beschließt<br />
1909 die Gründung eines Baufonds und ruft den Mitgliedern<br />
zu, dass es „nicht darauf allein ankommt, dass<br />
das Volkskunsthaus gebaut wird, sondern das es von<br />
uns aus eigener Kraft erbaut wird, als das erste große<br />
Kunstinstitut, das weder Fürstenwille, noch Kapitalsmacht<br />
ins Leben ruft, sondern das Zusammenwirken<br />
vieler Tausende aus unseren arbeitenden Bevölkerungsklassen.”<br />
Die Selbstbeteiligung der Mitglieder an der Errichtung<br />
des eigenen Theaters erfolgt durch einen Zehn-<br />
Pfennig-Beitrag zu jeder Theaterkarte. Diese Beiträge<br />
und die freiwilligen Spenden werden zu 5% verzinst, ein<br />
höherer Zinssatz als in jeder Sparkasse. Insgesamt<br />
bringen die Mitglieder und Freunde des Vereins über 1<br />
Mio. Mark auf, die Stadt <strong>Berlin</strong> stellt eine Hypothek von<br />
2 Mio. Mark für den Theaterbau zur Verfügung. Im Zuge<br />
dieses Projektes kommt es zu Verhandlungen zwischen<br />
den beiden <strong>Berlin</strong>er <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong> mit dem Ziel eines<br />
Zusammenschlusses. Beide Vereine behalten zunächst<br />
ihre Selbstständigkeit, sind aber durch einen Kartellvertrag<br />
zur gemeinsamen Stützung des neuen Theaterhauses<br />
verbunden und zählen gemeinsam Ende 1913<br />
fast 70.000 Mitglieder.<br />
Am 30.12.1914 wird das Haus am Bülowplatz feierlich<br />
eröffnet, das mit fast 2.000 Plätzen nun das größte<br />
Theater <strong>Berlin</strong>s, aber auch das modernste ist. Der Architekt<br />
Oskar Kaufmann hat entsprechend der demokratischen<br />
Idee des Vereins ein Rangtheater ohne Logen<br />
entworfen. Die Bühnenanlage ist mit allen technischen<br />
Errungenschaften der damaligen Zeit ausgestattet<br />
(versenkbare und hebbare Drehbühne, versenkbares<br />
Orchester, etc.). „Was sie hier als Ergebnis der 25jährigen<br />
Arbeit unseres Vereins vor sich sehen”, so<br />
Julius Bab in seiner Eröffnungsrede, „das soll kein Ende,<br />
sondern ein Anfang sein, der Anfang einer freien<br />
und starken Arbeit, für die wir nun erst den rechten, den<br />
eigenen Boden erreicht haben. Und es soll über uns<br />
selbst hinaus der Anfang einer Bewegung sein, die auf<br />
allen Gebieten das Volk wieder zur Kunst, die Kunst<br />
wieder zum Volke führt.”<br />
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte die bis<br />
dahin stetige Aufwärtsbewegung der <strong>Berlin</strong>er <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Bewegung<br />
stagnieren lassen. Im September<br />
1914 ist der Mitgliederstand auf 30.0000 gesunken, was<br />
den Fortbestand des Vereins erheblich gefährdet. Um<br />
das neue Haus allabendlich füllen zu können, hätte es<br />
die doppelte Mitgliederzahl gebraucht, hinzu kamen die<br />
Schulden, die auf dem Neubau lasten. Nur in der Vergrößerung<br />
der Mitgliederzahl sieht man eine Lösung,<br />
den finanziellen Schwierigkeiten zu entkommen. Max<br />
Reinhardt gilt als Garantie dafür - bereits 1905 hatte der<br />
Verein einen unerwarteten Zulauf an Mitgliedern erfahren,<br />
als man die Aufführungen der Reinhardt-Bühnen in<br />
das Vorstellungs-Angebot einbezog. „Seit der Verpachtung<br />
des Volkstheaters an Reinhardt im Sommer 1915<br />
habe eine fortlaufender Mitgliederzuzug eingesetzt”, so<br />
der Vorwärts im November 1917 und tatsächlich hat<br />
sich bis zum November 1917 die Mitgliederzahl wieder<br />
verdoppelt. Nachdem sich die äußeren Verhältnisse ein<br />
wenig beruhigt hatten, nehmen 1918 die <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-<br />
Vereine das Haus wieder in die eigene Hand, und es<br />
folgt ein steiler Aufstieg der <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Bewegung.<br />
Die <strong>Volksbühne</strong> in der Weimarer Republik<br />
Im April 1920 vereinigen sich die <strong>Freie</strong> <strong>Volksbühne</strong> und<br />
die Neue <strong>Freie</strong> <strong>Volksbühne</strong> zur <strong>Volksbühne</strong> e.V.. Siegfried<br />
Nestriepke, der dem Vorstand der <strong>Freie</strong>n <strong>Volksbühne</strong><br />
seit 1918 angehörte, wird zum Generalsekretär<br />
gewählt und übernimmt auch die Redaktion der „<strong>Volksbühne</strong>”,<br />
einer Zeitschrift für soziale Kunstpflege, die<br />
neben dem Nachrichtenblatt ab Herbst 1920 erscheint.<br />
Ein zweites <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-Theater zu bauen, ist nun<br />
das erklärte Ziel. Es sollte so großräumig sein, dass es<br />
neben Schauspiel- auch Opernvorstellungen bieten<br />
konnte. Die ehemalige Krolloper am Platz der Republik,<br />
im Inneren fast eine Ruine, sollte durch einen umfassenden<br />
Umbau spielfähig gemacht werden. Der preußische<br />
Staat überlässt der <strong>Volksbühne</strong> e.V. das Haus für<br />
25 Jahre pachtfrei, dafür muss der Verein für den Umbau<br />
selbst aufkommen. Die Finanzierung erfolgt, wie<br />
bei dem Bau des Theaters am Bülowplatz, durch einen<br />
Baukostenzuschlag zu den Vorstellungs-Beiträgen und<br />
durch den Erwerb von verzinsten Teilschuld-Verschreibungen.<br />
Im Frühsommer 1921 beginnen die Bauarbeiten.<br />
Witterungsverhältnisse, Schwierigkeiten in der Materialanlieferung<br />
und vor allem die Inflation machen<br />
jedoch alle Berechnungen zunichte, und so muss die<br />
<strong>Volksbühne</strong> e.V. 1924 von dem Vertrag zurücktreten<br />
und die Vollendung des Umbaus dem Staat überlassen.<br />
In den Jahren 1925/26 erreicht die <strong>Volksbühne</strong> mit<br />
fast 160.000 Mitgliedern den Höchststand in ihrer bisherigen<br />
Geschichte. Der Verein war zu einer riesigen Besucherorganisation<br />
geworden, die im <strong>Berlin</strong>er Theaterleben<br />
einen gewaltigen Machtfaktor darstellt. Neben<br />
Theateraufführungen finden regelmäßig auch Konzertund<br />
Chorveranstaltungen statt. Liederabende, Aufführungen<br />
von Oratorien und Tanzmatineen sind in den<br />
zwanziger Jahren fester Bestandteil der <strong><strong>Volksbühne</strong>n</strong>-<br />
Arbeit. Alljährlich stattfindende Sommer- und Herbstfeste,<br />
sowie die Darbietung von Beethovens „Neunter” an<br />
jedem Silvesterabend im Theater am Bülowplatz werden<br />
für die Mitglieder zu einer liebgewonnenen Tradition.<br />
Der Schauspieler Friedrich Kayßler leitet das Haus<br />
am Bülowplatz von 1918 bis 1923. Ihm folgt Fritz Holl,<br />
der 1924 Erwin Piscator als Spielleiter an die <strong>Volksbühne</strong><br />
holt. Dessen Aufsehen erregenden Inszenierungen,<br />
die das Althergebrachte völlig umstülpen und politisch<br />
engagiertes Zeittheater zeigen, sorgen für stürmische<br />
Debatten in der gesamten Öffentlichkeit der Weimarer<br />
Republik. Auch innerhalb der <strong>Volksbühne</strong> kommt es zu<br />
heftigen Auseinandersetzungen, die darin gipfeln, dass<br />
sich der Vorstand von der Piscator-Inszenierung des<br />
Stückes „Gewiter über Gotland” von Ehm Welk distanziert<br />
und das Stück kurz nach der Premiere am 23.<br />
März 1927 absetzt. In einer Erklärung heißt es, „diese<br />
Art der Inszenierung stehe im Widerspruch mit der<br />
grundsätzlichen politischen Neutralität der <strong>Volksbühne</strong>,<br />
die zu wahren der Vorstand verpflichtet ist“.Der Vorgang<br />
löste einen Theaterskandal aus. In weiten Kreisen<br />
3