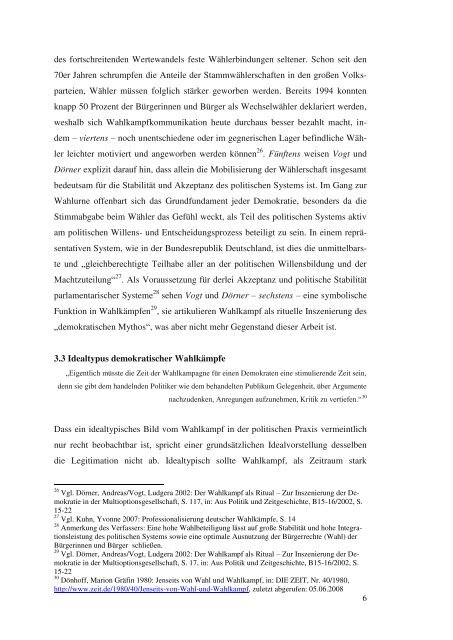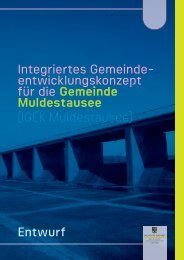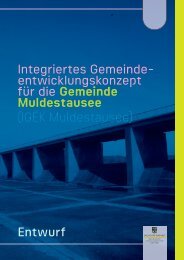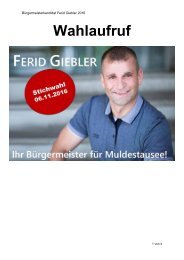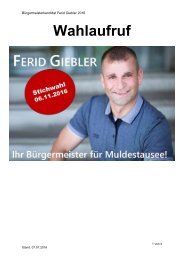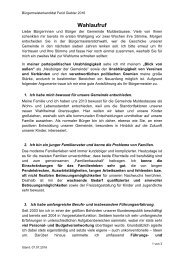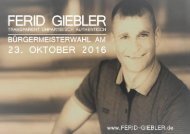2008_Funktionen_von_Wahlkämpfen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
des fortschreitenden Wertewandels feste Wählerbindungen seltener. Schon seit den<br />
70er Jahren schrumpfen die Anteile der Stammwählerschaften in den großen Volksparteien,<br />
Wähler müssen folglich stärker geworben werden. Bereits 1994 konnten<br />
knapp 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger als Wechselwähler deklariert werden,<br />
weshalb sich Wahlkampfkommunikation heute durchaus besser bezahlt macht, indem<br />
– viertens – noch unentschiedene oder im gegnerischen Lager befindliche Wähler<br />
leichter motiviert und angeworben werden können 26 . Fünftens weisen Vogt und<br />
Dörner explizit darauf hin, dass allein die Mobilisierung der Wählerschaft insgesamt<br />
bedeutsam für die Stabilität und Akzeptanz des politischen Systems ist. Im Gang zur<br />
Wahlurne offenbart sich das Grundfundament jeder Demokratie, besonders da die<br />
Stimmabgabe beim Wähler das Gefühl weckt, als Teil des politischen Systems aktiv<br />
am politischen Willens- und Entscheidungsprozess beteiligt zu sein. In einem repräsentativen<br />
System, wie in der Bundesrepublik Deutschland, ist dies die unmittelbarste<br />
und „gleichberechtigte Teilhabe aller an der politischen Willensbildung und der<br />
Machtzuteilung“ 27 . Als Voraussetzung für derlei Akzeptanz und politische Stabilität<br />
parlamentarischer Systeme 28 sehen Vogt und Dörner – sechstens – eine symbolische<br />
Funktion in <strong>Wahlkämpfen</strong> 29 , sie artikulieren Wahlkampf als rituelle Inszenierung des<br />
„demokratischen Mythos“, was aber nicht mehr Gegenstand dieser Arbeit ist.<br />
3.3 Idealtypus demokratischer Wahlkämpfe<br />
„Eigentlich müsste die Zeit der Wahlkampagne für einen Demokraten eine stimulierende Zeit sein,<br />
denn sie gibt dem handelnden Politiker wie dem behandelten Publikum Gelegenheit, über Argumente<br />
nachzudenken, Anregungen aufzunehmen, Kritik zu vertiefen.“ 30<br />
Dass ein idealtypisches Bild vom Wahlkampf in der politischen Praxis vermeintlich<br />
nur recht beobachtbar ist, spricht einer grundsätzlichen Idealvorstellung desselben<br />
die Legitimation nicht ab. Idealtypisch sollte Wahlkampf, als Zeitraum stark<br />
26 Vgl. Dörner, Andreas/Vogt, Ludgera 2002: Der Wahlkampf als Ritual – Zur Inszenierung der Demokratie<br />
in der Multioptionsgesellschaft, S. 117, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B15-16/2002, S.<br />
15-22<br />
27 Vgl. Kuhn, Y<strong>von</strong>ne 2007: Professionalisierung deutscher Wahlkämpfe, S. 14<br />
28 Anmerkung des Verfassers: Eine hohe Wahlbeteiligung lässt auf große Stabilität und hohe Integrationsleistung<br />
des politischen Systems sowie eine optimale Ausnutzung der Bürgerrechte (Wahl) der<br />
Bürgerinnen und Bürger schließen.<br />
29 Vgl. Dörner, Andreas/Vogt, Ludgera 2002: Der Wahlkampf als Ritual – Zur Inszenierung der Demokratie<br />
in der Multioptionsgesellschaft, S. 17, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B15-16/2002, S.<br />
15-22<br />
30 Dönhoff, Marion Gräfin 1980: Jenseits <strong>von</strong> Wahl und Wahlkampf, in: DIE ZEIT, Nr. 40/1980,<br />
http://www.zeit.de/1980/40/Jenseits-<strong>von</strong>-Wahl-und-Wahlkampf, zuletzt abgerufen: 05.06.<strong>2008</strong><br />
6