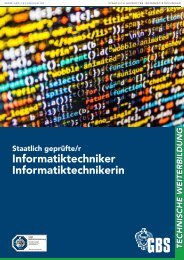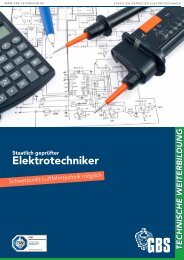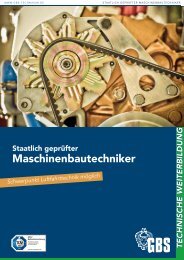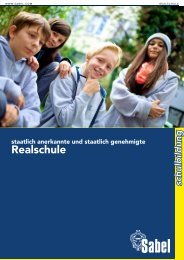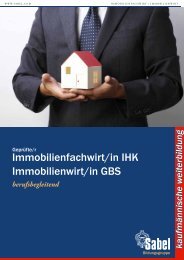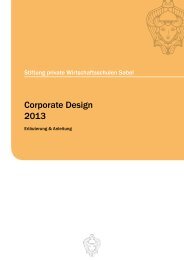Jahresbericht Auszug
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sabel GBS<br />
Sabel GBS<br />
„Elektrisch betriebener Sternmotor mit berührungsloser Steuerung“<br />
von Josef Heinrizi, M4D<br />
Was vereint Mechanik, Elektrik und elektronische<br />
Steuerung in einer Projektarbeit? Ein elektrisch<br />
betriebener Sternmotor mit berührungsloser<br />
Steuerung, der im Rahmen der Projektarbeit<br />
konstruiert und umgesetzt wurde.<br />
Sieben kreisförmig angeordnete Spulen mit<br />
Kolben aus Eisen bilden den mechanischen Teil<br />
des Sternmotors. Bestromt man die Spulen,<br />
so bewegen sich die Kolben axial, was in<br />
eine Drehbewegung umgewandelt wird. Die<br />
Ansteuerung der Spulen übernehmen sieben in<br />
einer Reihe angebrachte optische Sensoren, die<br />
mittels einer Spiegelfolie auf der Steuerwalze<br />
geschaltet werden. Durch die Möglichkeit, die<br />
Position der Sensoren zu verändern, kann die<br />
Drehzahl variiert werden.<br />
Sternmotor in CAD<br />
Bereits vor Beginn der Projektarbeit<br />
interessierte ich mich für Elektrik, Magnetismus<br />
und Hubkolbenmotoren. Hieraus entstand die<br />
Überlegung, diese Interessengebiete in einem<br />
Projekt zu vereinen – die Idee des berührungslos<br />
gesteuerten Sternmotors war geboren. Neben<br />
meinem Interesse motivierte mich auch die<br />
Chance, meine in der Berufsausbildung,<br />
Weiterbildung gesammelten Erfahrungen hier<br />
praktisch einbringen zu können, von der Idee<br />
über die Berechnung und die Konstruktion bis<br />
hin zur praktischen Umsetzung.<br />
„Stern“ mit Spulen, Kolben und Pleuelstangen<br />
Der Stern besteht aus sieben selbst berechneten<br />
und gewickelten Spulen die kreisförmig an<br />
einem Rohr angebracht sind. Die Kolben sind<br />
über Pleuelstangen mit der Kurbelwelle und<br />
dem berechneten Gegengewicht verbunden.<br />
Bestromt man die Spulen, so werden die Kolben<br />
durch das entstehende elektromagnetische<br />
Feld in diese gezogen. Diese Kraft wird<br />
von der Kurbelwelle in eine Drehbewegung<br />
umgewandelt.<br />
Die Ansteuerung der Spulen in der richtigen<br />
Reihenfolge, zum richtigen Zeitpunkt und<br />
mit der korrekten Dauer übernimmt die<br />
Steuerwalze, indem sie auf der Sensorleiste<br />
montierte optische Sensoren schaltet. Durch<br />
eine dreieckige Form der Spiegelfolie lässt sich<br />
die Ansteuerdauer durch axiales verschieben<br />
der Sensorleiste während des Betriebs stufenlos<br />
einstellen. Der Ansteuerbeginn kann ebenfalls<br />
durch radiales Verstellen der Steuerleiste<br />
stufenlos variiert werden.<br />
Steuerwalze und Sensorleiste<br />
Der Schaltstrom der optischen Sensoren ist<br />
zu gering, um den Spulenstrom zu schalten.<br />
Aus diesem Grund wurde eine Schaltung zur<br />
Verstärkung des Stroms konstruiert. Hierbei<br />
wurde bereits bei der Planung auf eine<br />
übersichtliche und einheitliche Platzierung auf<br />
der Platine geachtet. Zur Messung von Strom,<br />
Spannung und Drehzahl wurden zusätzlich<br />
Messgeräte angebracht, um während des<br />
Betriebs die wichtigsten Parameter ständig<br />
überprüfen zu können.<br />
Platine mit Kühlkörper und Messeinheit<br />
Ursprünglich war zur Ansteuerung der Spulen<br />
die Verwendung von Magnetfolie und Reed<br />
Kontakten angedacht. Da die Polarität dieser<br />
Folie wechselt, stellte sich diese Form der<br />
Ansteuerung im vorliegenden Fall als nicht<br />
praktikabel heraus. Aus diesem Grund fiel<br />
die Wahl schließlich auf die nun verwendete,<br />
optische Ansteuerung mittels Spiegelfolie und<br />
optischer Sensoren.<br />
Um herauszufinden,<br />
welches Material es bei<br />
den Spulengrundkörpern<br />
zu verwenden galt, wurde<br />
ein Experiment durchgeführt.<br />
Drei Rohre, eines<br />
aus Aluminium, eines aus<br />
Messing und eines aus<br />
Kunststoff, wurden in einer<br />
Halterung verbaut. Diese<br />
ermöglichte es, Dauermagneten<br />
gleichzeitig in<br />
Wirbelstromexperiment<br />
die Rohre fallen zu lassen<br />
und die Fallgeschwindigkeit zu ermitteln. Die<br />
Magneten im Aluminium- und im Messingrohr<br />
wurden deutlich abgebremst. Aus dem<br />
Experiment wurde ersichtlich, dass in leitenden<br />
Materialien Wirbelströme entstehen, die den<br />
Kolben abbremsen würden. Aus diesem Grund<br />
fiel der Entschluss, ein Kunststoffrohr zu<br />
verwenden.<br />
Nach der Themenfindung wurde mit der<br />
Aufstellung eines Zeitplans für das Projekt<br />
begonnen. Hiernach folgten die groben<br />
Überlegungen zur Funktionsweise und zur<br />
Umsetzung sowie die ersten Handskizzen<br />
und CAD Zeichnungen. Auch mit der<br />
Spulenwicklung wurde begonnen. Die<br />
Dokumentation des Projekts erfolgte stets<br />
parallel zur Konstruktionsarbeit in CAD und der<br />
praktischen Umsetzung. Um die Funktionalität<br />
des Sternmotors jederzeit gewährleisten<br />
zu können, wurden die CAD-Entwürfe<br />
laufend auf Umsetzbarkeit, Festigkeit und<br />
Funktionsweise hin überprüft. Dies geschah<br />
sowohl durch Computersimulationen als auch<br />
durch praktische Funktionstests. Nachdem die<br />
Maße der Konstruktion in CAD definiert waren,<br />
wurden Berechnungen zum Drehmoment, zur<br />
Kolbengeschwindigkeit, zur Leistung und zum<br />
Massenausgleich vorgenommen. Zum Schluss<br />
wurde das Projekt in Form einer Präsentation<br />
in der Schule vorgetragen und der fertige<br />
Sternmotor zur Veranschaulichung vorgestellt.<br />
An dem fertigen, funktionsfähigen Modell<br />
konnten die Kommilitonen alle Einstellungen<br />
am laufenden Motor austesten.<br />
Fertiges Modell des Sternmotors<br />
Mir selbst hat das Projekt gezeigt, dass ein<br />
solches Vorhaben nur durch eine Verknüpfung<br />
der einzelnen Fächer (Technische Mechanik,<br />
Maschinenelemente, Steuerungstechnik,<br />
Elektrotechnik, Konstruktion, Mechatronik), der<br />
Technikerschule sowie meiner vorhergehenden<br />
Berufsausbildung und -praxis möglich ist.<br />
Gerade diese interdisziplinären Erfahrungen<br />
werden mir in meiner beruflichen Zukunft<br />
sicherlich bei der Erkennung und Behandlung<br />
von Problemen zu Gute kommen.<br />
Für das Projekt waren insgesamt 22 Wochen<br />
veranschlagt, es zog sich jedoch tatsächlich<br />
auf 28 Wochen. Die Spulen bestehen aus<br />
1000 Windungen mit 0,4 mm lackisoliertem<br />
48<br />
49