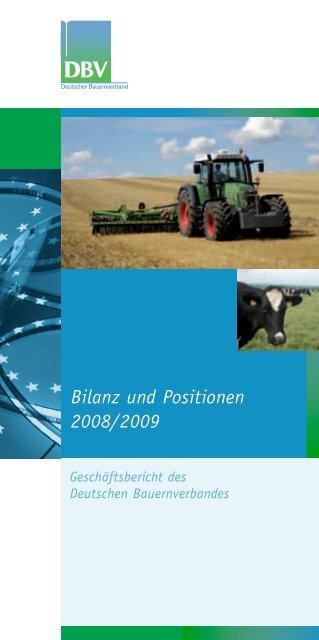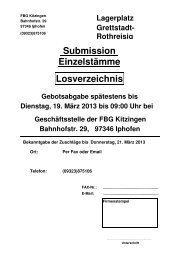Bilanz und Positionen 2008/2009
Bilanz und Positionen 2008/2009
Bilanz und Positionen 2008/2009
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Bilanz</strong> <strong>und</strong> <strong>Positionen</strong><br />
<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong><br />
Geschäftsbericht des<br />
Deutschen Bauernverbandes
Vorwort<br />
Bei aller Freude über die gestiegenen<br />
Imagewerte der Landwirtschaft,<br />
die die Wertschätzung der<br />
Leistungen unserer Bauernfamilien<br />
verdeutlichen, überwogen im Jahr<br />
<strong>2008</strong> <strong>und</strong> weit ins Jahr <strong>2009</strong> hinein<br />
die Belastungen einer weltweiten<br />
Finanz- <strong>und</strong> Konjunkturkrise,<br />
mit denen auch die deutschen<br />
Landwirte konfrontiert waren.<br />
Eindrücklich verdeutlicht hat dies<br />
das Absacken unseres bewährten<br />
Konjunkturbarometers Agrar. In<br />
der Mitte des vergangenen Jahres<br />
waren landwirtschaftliche Betriebsmittel<br />
im Durchschnitt um<br />
22 Prozent teurer als im Vorjahr.<br />
Vor allem Düngemittel haben sich<br />
im Preis aufgr<strong>und</strong> der weltweit stark gestiegenen Nachfrage<br />
mehr als verdoppelt, Energie <strong>und</strong> Futtermittel verteuerten<br />
sich um fast ein Drittel. Die Erzeugerpreise blieben – je nach<br />
Produkt – anfangs noch stabil, gerieten ab Jahresmitte <strong>2008</strong><br />
jedoch ins Rutschen. An der daraus entstandenen Einkommensmisere<br />
konnten auch die erfreulichen Ernteergebnisse<br />
nichts mehr ändern.<br />
Diesem für unsere Bauern wirtschaftlich dramatischen<br />
Sommer folgte ein stürmischer Herbst mit einer bis dato<br />
nicht erwarteten Rezession, die mit voller Wucht im Frühjahr<br />
<strong>2009</strong> durchschlug. Dass davon auch das unmittelbare Umfeld<br />
unserer Bauern nicht verschont bleiben würde, wurde schnell<br />
deutlich. Alle Landwirte, ganz gleich ob Milcherzeuger,<br />
Ackerbauern, Schweine- oder Geflügelhalter, waren auf der<br />
Absatzseite mit verunsicherten Verbrauchern auf dem Binnenmarkt<br />
<strong>und</strong> zurückhaltenden Käufern auf dem Weltmarkt<br />
konfrontiert. Besonders war der Milchmarkt betroffen. Hinzu<br />
kam, dass marktbeherrschende Discounter ihre Verhandlungsmacht<br />
schamlos ausnutzten <strong>und</strong> wettbewerbsfeindliche<br />
Kostenbelastungen die Bauern überforderten. Der Deutsche<br />
Bauernverband hat deshalb die Politik in die Pflicht genommen<br />
<strong>und</strong> auf eine Beteiligung an Konjunkturprogrammen gedrängt.<br />
Drei Ansatzpunkte wurden immer wieder betont:<br />
• A wie Absatz fördern <strong>und</strong> Märkte beleben!<br />
• B wie Belastungen <strong>und</strong> Kosten senken!<br />
• C wie Cash <strong>und</strong> Liquidität in den Betrieben sichern!<br />
1<br />
Vorwort
2<br />
Damit hat der Deutsche Bauernverband nichts Unmögliches<br />
gefordert, sondern unmissverständlich verdeutlicht,<br />
dass auch die Landwirtschaft eine „systemrelevante“ Branche<br />
ist, der in einer extremen Krisensituation über die R<strong>und</strong>en<br />
geholfen werden muss.<br />
Beim Health Check der EU-Agrarpolitik wurde im November<br />
<strong>2008</strong> nach langjähriger Debatte kein glänzendes Ergebnis<br />
erzielt. Äußerst schmerzhaft fielen für die deutschen Bauern<br />
die Modulation <strong>und</strong> die Progression aus. Marktwidrig ist<br />
auch die völlig überflüssige fünfprozentige Erhöhung der<br />
Milchquote. Dennoch muss auch gesehen werden, dass etwa<br />
die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten sogar eine noch größere<br />
Quotenerhöhung wollte. Ein echter Erfolg indes war die europäische<br />
Verankerung eines Begleitprogramms Milch bis<br />
2015, in das die Mittel aus der erhöhten Modulation wieder<br />
zurückfließen. Ernüchternd war die Entscheidung zu Cross<br />
Compliance. Statt dem erklärten Ziel zu folgen, dieses äußerst<br />
komplizierte Dokumentations- <strong>und</strong> Kontrollverfahren<br />
zu entbürokratisieren, wurde es faktisch um den Gewässerschutz<br />
erweitert.<br />
Nach dem Health Check kommt es für Deutschland <strong>und</strong> alle<br />
anderen Mitgliedstaaten jetzt darauf an, die richtigen politischen<br />
Leitplanken für eine Gemeinsame Agrarpolitik nach<br />
2013 zu definieren. Dabei muss eindeutig geklärt werden,<br />
• ob die Agrarpolitik ein Gr<strong>und</strong>pfeiler der Europapolitik<br />
bleibt,<br />
• ob es auch künftig gute Gründe für eine Gemeinschaftspräferenz<br />
in der Nahrungsmittelproduktion gibt, <strong>und</strong><br />
• ob die Finanzierung dieser EU-Agrarpolitik in europäischer<br />
Hand bleibt oder ob diese auf die Nationalstaaten rückver-<br />
lagert wird.<br />
Der Deutsche Bauernverband wird sich gemeinsam mit seinen<br />
Landesbauernverbänden <strong>und</strong> mit COPA in dieser Diskussion<br />
für die Interessen der heimischen Bauern hartnäckig einsetzen.<br />
Nach allen Erfahrungen sind die deutschen Landwirte<br />
durch die europäische Verankerung der Agrarpolitik besser<br />
gefahren als mit einer alleinigen nationalen Verantwortung.<br />
Ein unerwarteter Rückschlag für die deutschen Bauern<br />
war das Urteil des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichtes Anfang des<br />
Jahres <strong>2009</strong>, demzufolge die CMA <strong>und</strong> die ZMP liquidiert<br />
werden mussten. Damit entfallen künftig die Absatzfördermaßnahmen<br />
der CMA ebenso wie die bewährten Markt- <strong>und</strong><br />
Preisinformationen, die stets neutral <strong>und</strong> verlässlich für die
unverzichtbare Transparenz auf den Märkten gesorgt haben.<br />
Vielen – selbst denjenigen, die sich im B<strong>und</strong>esverfassungsgerichtsurteil<br />
bestätigt sahen – ist schnell bewusst geworden,<br />
dass hier eine stufenübergreifende Plattform geopfert<br />
wurde, ganz abgesehen von den zahlreichen Mitarbeitern,<br />
deren langjähriges Knowhow möglicherweise endgültig verloren<br />
gehen wird. Mit der raschen Gründung der Agrarmarkt<br />
Informations-Gesellschaft mbH, für die der Deutsche Bauernverband<br />
die entscheidende Initialzündung gab, ist es gelungen,<br />
das Marktinformationsbedürfnis der Agrarwirtschaft<br />
übergangslos zu bedienen. Ebenso dringend brauchen unsere<br />
deutschen Bauern eine Folgelösung für eine schlagkräftige<br />
Absatzförderung. Hier ist weiterhin die Ernährungswirtschaft<br />
gefordert, eine Initiative aus der Taufe zu heben, die den positiven<br />
Trend des Agrarstandortes fortschreiben kann.<br />
Der Deutsche Bauernverband hat sich neben den öffentlichkeitswirksamen<br />
Kampagnen in zahlreichen parlamentarischen<br />
Entscheidungen für die Bauern <strong>und</strong> Bauernfamilien<br />
eingesetzt. Die dadurch gemeinsam mit unseren Landesbauernverbänden<br />
für unsere Mitglieder erzielten Erfolge haben<br />
wir parallel zum vorliegenden Geschäftsbericht erstmals in<br />
einer gesonderten <strong>und</strong> gleichzeitig erscheinenden „Erfolgsbilanz<br />
<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong>“ zusammengestellt.<br />
Allen ehren- <strong>und</strong> hauptamtlichen Mitstreitern im Deutschen<br />
Bauernverband, in den Landes-, Kreis- <strong>und</strong> Ortsbauernverbänden<br />
danken wir für ihre engagierte Unterstützung<br />
im Jahr <strong>2008</strong>. Allen Gesprächspartnern in Regierung, Parlament,<br />
EU-Kommission <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esrat, in Verbänden, Gewerkschaften,<br />
wissenschaftlichen Einrichtungen <strong>und</strong> Kirchen, besonders<br />
aber auch in den Medien danken wir für den offenen<br />
Gedankenaustausch. Wir werden uns auch <strong>2009</strong> nachdrücklich<br />
für die Interessen der deutschen Landwirtschaft, der Bauernfamilien<br />
<strong>und</strong> der Menschen in den ländlichen Regionen einsetzen.<br />
Unumstößlich ist aber auch, dass sich der Erfolg für<br />
jeden Einzelnen nur dann einstellen kann, wenn die Bauern<br />
weiterhin geschlossen in dieser Gesellschaft auftreten.<br />
Gerd Sonnleitner<br />
Präsident des<br />
Deutschen Bauernverbandes<br />
Dr. Helmut Born<br />
Generalsekretär des<br />
Deutschen Bauernverbandes<br />
3<br />
Vorwort
4<br />
Inhalt<br />
Agrarpolitische Zeittafel 6<br />
Agrarpolitik 18<br />
Internationale Agrarpolitik 19<br />
Europäische Agrarpolitik 20<br />
Nationale Agrarpolitik 24<br />
Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit 26<br />
Tierproduktion 32<br />
Schweinefleischmarkt 33<br />
Rindfleischmarkt 33<br />
Geflügelfleisch <strong>und</strong> Eier 37<br />
Futtermittel 40<br />
Tierschutz 44<br />
Schafe, Ziegen, landwirtschaftliche<br />
Wildhaltung <strong>und</strong> Pferde 47<br />
Imkerei 49<br />
Milch 50<br />
Tierges<strong>und</strong>heit 55<br />
Tierzuchtrecht 57<br />
Pflanzenproduktion 58<br />
Getreide 59<br />
Saatgut 61<br />
Kartoffeln 62<br />
Zucker 65<br />
Öl- <strong>und</strong> Eiweißpflanzen 66<br />
Obst <strong>und</strong> Gemüse 68<br />
Nachwachsende<br />
Rohstoffe <strong>und</strong> Energie 72<br />
Forst- <strong>und</strong> Waldwirtschaft 78<br />
Wein 79<br />
Alkohol 81<br />
Hopfen 82<br />
Tabak 83<br />
Arznei- <strong>und</strong> Gewürzpflanzen 85<br />
Grüne Gentechnik 85<br />
Lebensmittelsicherheit/-recht 88<br />
Ökologischer Landbau 94
Marktpolitik/Absatzförderung 96<br />
Zusätzliche Einkommen 98<br />
Direktvermarktung 98<br />
Urlaub auf dem Bauernhof 98<br />
Überbetrieblicher<br />
Maschineneinsatz 100<br />
Lohnunternehmen 100<br />
Maschinenringe 101<br />
Recht 102<br />
Allgemeine Rechtsfragen 103<br />
Steuerpolitik <strong>und</strong> Steuerrecht 105<br />
Umweltpolitik <strong>und</strong> Umweltrecht 111<br />
Landtechnik <strong>und</strong> Verkehrsrecht 121<br />
Kriterien-Kompendium<br />
Landwirtschaft 123<br />
Agrarsozialpolitik 124<br />
Agrarsoziale Sicherung 124<br />
Arbeitsmarktpolitik 126<br />
Bildung 128<br />
Bildungspolitik 129<br />
Andreas Hermes Akademie 133<br />
Internationaler<br />
Praktikantenaustausch 135<br />
Agrarforschung 138<br />
Initiativkreis Agrar- <strong>und</strong> Ernährungsforschung 138<br />
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend 140<br />
DBV-Service GmbH 146<br />
Intranet 146<br />
Haus der Land- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft 148<br />
Fachausschüsse des Deutschen Bauernverbandes 150<br />
5<br />
Inhalt
Agrarpolitische Zeittafel <strong>2008</strong>
Januar<br />
19.01.<br />
Stellungnahme des DBV-Präsidiums zum Gesetzesvorschlag<br />
der B<strong>und</strong>esregierung, mit dem der Klimaschutz<br />
vorangebracht <strong>und</strong> die Verwendung erneuerbarer<br />
Energien ausgebaut werden soll. Ebenso verlangt das Präsidium<br />
gemeinsam mit den Verbänden der Rinder-, Schaf-<br />
<strong>und</strong> Ziegenzucht, die Impfvorbereitungen gegen die<br />
Blauzunge voranzubringen. Zu Gast ist Prof. Dr. Franz Josef<br />
Radermacher, der sein Engagement in der Global Marshall<br />
Plan Initiative vorstellt, die sich für eine gerechtere<br />
Globalisierung einsetzt.<br />
25.01.<br />
Verabschiedung der Novelle des Gentechnikgesetzes:<br />
Zustimmung des B<strong>und</strong>esrates am 15.02.<strong>2008</strong>; Gr<strong>und</strong>sätze<br />
der guten fachlichen Praxis werden auf den Weg gebracht,<br />
wie vom DBV gefordert. Allerdings bleibt es bei einer verschuldensunabhängigen<br />
Haftung für die Landwirte.<br />
Personalie<br />
Werner Schwarz wird zum neuen Präsidenten des<br />
Bauernverbandes Schleswig-Holstein gewählt.<br />
Ehrung<br />
Dr. Jürgen Fröhling erhält die Ehrenplakette des DBV<br />
für seine Verdienste um die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen<br />
Land-, Agrar- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft.<br />
Februar<br />
12.02.<br />
DBV-Präsidium: Das Präsidium formuliert ein langfristig<br />
angelegtes Begleitprogramm Milch zur Diskussion in<br />
Regionalkonferenzen. Zu Gast ist der Hauptgeschäftsführer<br />
der BVE, Prof. Dr. Matthias Horst, der die Arbeit der<br />
Europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA) darstellt.<br />
14.02.<br />
Erosionsgefährdungskataster: DBV-Präsident Sonnleitner<br />
wendet sich in einem Schreiben an B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsminister<br />
Seehofer gegen neue <strong>und</strong> EU-rechtlich<br />
nicht geforderte Auflagen bei Cross Compliance. Die<br />
Bauern stünden für den Schutz ihrer Böden. Die Schaffung<br />
eines gesonderten Bodenerosionsgefährdungskatasters<br />
sei deshalb falsch.<br />
21.02.<br />
Nachbesserungen bei Erbschaftsteuerreform angemahnt:<br />
7<br />
Agrarpolitische Zeittafel
8<br />
Der B<strong>und</strong>esrat greift mit der Forderung, die Verpachtung<br />
landwirtschaftlicher Betriebe <strong>und</strong> Flächen in die vorgesehene<br />
Verschonung einzubeziehen, ein wesentliches Anliegen<br />
des Berufsstandes auf. Der DBV unterstützt besonders<br />
die Auffassung des B<strong>und</strong>esrates, dass nicht nur die an den<br />
Hofnachfolger verpachteten Flächen in die Verschonung<br />
einbezogen werden müssen.<br />
Personalie<br />
Heinz-Hinrich Behrmann wird zum neuen Präsidenten<br />
des Bauernverbandes Hamburg gewählt.<br />
März<br />
11.03.<br />
DBV-Präsidium: Nach 10 Regionalkonferenzen mit intensiven<br />
Diskussionen beschließt das Präsidium ein umfassendes<br />
Zukunftskonzept für die Milchbauern als<br />
Begleitprogramm zum Health Check. Gast im Präsidium ist<br />
der Präsident des B<strong>und</strong>esverbandes der Lohnunternehmer,<br />
Klaus Pentzlin.<br />
19.03.<br />
Berufliche Aus- <strong>und</strong> Fortbildung ist unverzichtbare Gr<strong>und</strong>lage<br />
für eine erfolgreiche Zukunft der gesamten Land-,<br />
Agrar- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft in Deutschland <strong>und</strong> für<br />
die Stärkung des ländlichen Raums. Zu dieser Schlussfolgerung<br />
kommen der DBV-Bildungsbeauftragte Hans-<br />
Benno Wichert <strong>und</strong> die Parlamentarische Staatssekretärin<br />
im B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium, Ursula<br />
Heinen, bei einem Gespräch zur landwirtschaftlichen Berufsbildung.<br />
27.03.<br />
Der DBV verfolgt mit großer Sorge die Diskussion zur Änderung<br />
der EU-Verordnung über neuartige Lebensmittel,<br />
der Novel-Food-Verordnung. So ist nach Einschätzung<br />
von DBV-Generalsekretär Dr. Born durch diesen Verordnungsvorschlag<br />
eine Zulassung für Fleisch von geklonten<br />
Tieren als Lebensmittel für den menschlichen Verzehr<br />
möglich. Dies müsse verhindert werden, schrieb Dr. Born<br />
an Staatssekretär Lindemann im BMELV.<br />
Ende März<br />
In Argentinien kommt es zwischen den Bauernorganisationen<br />
<strong>und</strong> der Regierung zu einem monatelangen Streit über<br />
die Erhöhung der Agrarexportsteuer. Bauern blockieren<br />
die Nahrungsmittelversorgung von Buenos Aires.
April<br />
02.04.<br />
B<strong>und</strong>esumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) zieht den<br />
Gesetzesvorschlag zur Erhöhung des Bioethanol-Anteils<br />
auf 10 Prozent nach Protesten des ADAC (wegen „unverträglicher<br />
Altautos“) zurück.<br />
03.04.<br />
DBV-Präsident Sonnleitner kündigt Aktionen gegen Preisdruck<br />
bei Milch an. Mit größter Sorge verfolgen die<br />
Milchbauern die bisherigen Ergebnisse der Gespräche zwischen<br />
Molkereien <strong>und</strong> Lebensmitteleinzelhandel für Milchprodukte.<br />
Entsprechend kritisch schreibt DBV-Präsident<br />
Sonnleitner an den Präsidenten des Hauptverbandes des<br />
Deutschen Einzelhandels, Josef Sanktjohanser, sowie an<br />
die Vorstände der größten Lebensmittelhändler. Sonnleitner<br />
kündigt Proteste vor den Zentralen des Lebensmitteleinzelhandels<br />
gegen einen Preisdruck bei den Listungsgesprächen<br />
an.<br />
15.04.<br />
DBV-Präsidium: Angesichts der öffentlichen Debatte<br />
um Nahrungsmittelpreise betont das Präsidium die<br />
Priorität der Nahrungsmittelproduktion. Erneut berät das<br />
Präsidium die äußerst schwierige Marktlage der Schweinehalter.<br />
17.04.<br />
Zentraler Aktionstag Milch vor dem Brandenburger Tor<br />
in Berlin: Zuvor gibt es in den Ländern bereits Aktionen<br />
<strong>und</strong> Demonstrationen, um auf die Notwendigkeit stabiler<br />
Milchpreise aufmerksam zu machen.<br />
Mai<br />
Hungeraufstände in Haiti <strong>und</strong> anderen Entwicklungsländern<br />
tragen das Thema Nahrungsmittel <strong>und</strong> Bioenergie<br />
auf die Topagenda von Medien <strong>und</strong> Politik.<br />
05.05.<br />
Der DBV, der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft<br />
<strong>und</strong> die Verbraucherzentrale B<strong>und</strong>esverband haben<br />
in einem gemeinsamen Brief an B<strong>und</strong>eskanzlerin Angela<br />
Merkel auf die fatalen Folgen der geplanten Importzulassung<br />
von chlorbehandeltem Geflügelfleisch aus den<br />
USA hingewiesen.<br />
9<br />
Agrarpolitische Zeittafel
06.05.<br />
DBV-Präsident Sonnleitner <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esminister Seehofer<br />
treten gemeinsam vor die B<strong>und</strong>espressekonferenz,<br />
um eine Versachlichung der Diskussion um steigende<br />
Nahrungsmittelpreise zu erreichen. Sie betonen die<br />
Wichtigkeit der Forderung einer starken Landwirtschaft in<br />
Industrie- <strong>und</strong> Entwicklungsländern.<br />
19. bis 30.05.<br />
9. UN-Naturschutzkonferenz in Bonn: Ein DBV-Gemeinschaftsstand<br />
dokumentiert die vielfältigen Beispiele<br />
praktizierten Artenschutzes durch die Landwirtschaft.<br />
20.05.<br />
DBV-Präsidium: Gast ist Prof. Dr. Volkhard Isermeyer.<br />
Das Präsidium fordert: „Keine weiteren Kürzungen bei Direktzahlungen!“<br />
20.05.<br />
Die EU-Kommission legt die Verordnungsvorschläge zum<br />
Health Check der EU-Agrarpolitik vor.<br />
26.05.<br />
Beginn des „Milchstreiks”: DBV-Präsident Sonnleitner<br />
erzwingt gegen Ende des Streiks die Einlenkung des Lebensmitteleinzelhandels.<br />
Innerhalb der Landwirtschaft<br />
bleibt der Streik äußerst umstritten.<br />
Juni<br />
04.06.<br />
Der DBV bekräftigt in einer Sachverständigenanhörung<br />
im Deutschen B<strong>und</strong>estag seine Ablehnung zum obligatorischen<br />
Prüf- <strong>und</strong> Zulassungsverfahren für Stalleinrichtungen.<br />
Dem Tierschutz werde mit der Einführung eines<br />
sogenannten Tierschutz-TÜV, der bürokratisch <strong>und</strong><br />
kostenintensiv sei, ein Bärendienst erwiesen. Rasche Innovationen<br />
würden durch das bürokratische Verfahren gehemmt.<br />
06.06.<br />
Der Deutsche B<strong>und</strong>estag verabschiedet die Novelle des<br />
Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG). Im Bereich<br />
Biogas wird der Schwerpunkt der Förderung stärker auf die<br />
Nutzung landwirtschaftlicher Reststoffe <strong>und</strong> Nebenprodukte<br />
gelegt.<br />
10.06.<br />
Der B<strong>und</strong>esverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP)<br />
drängt auf striktere Regeln bei der Erfassung des Nachbaus<br />
<strong>und</strong> auf ein höheres Volumen der Nachbaugebüh-<br />
10
en. Das lehnt der DBV unter Hinweis auf die entlastenden<br />
Vereinbarungen der bestehenden Rahmenregelung ab.<br />
Daraufhin kündigt der BDP-Vorstand die gemeinsam von<br />
beiden Organisationen getragene Rahmenregelung zum<br />
Nachbau mit Wirkung zum 30. Juni <strong>2008</strong> einseitig auf.<br />
18.06.<br />
Der Entwurf zum Umweltgesetzbuch (UGB) verfehlt<br />
die selbst gesteckten Ziele der B<strong>und</strong>esregierung, das bestehende<br />
Umweltrecht bei gleichbleibenden Standards<br />
zusammenzufassen. Der DBV kritisiert dies zusammen mit<br />
dem BDI <strong>und</strong> anderen Verbänden bei der dreitägigen Verbändeanhörung<br />
heftig. Der Entwurf schränke Eigentumsrechte<br />
ein <strong>und</strong> sehe entgegen den politischen Zusagen<br />
umfangreiche Verschärfungen bestehender gesetzlicher<br />
Standards vor.<br />
30.06.<br />
DBV-Mitgliederversammlung in Berlin <strong>und</strong> Feier des<br />
60-jährigen Bestehens des Deutschen Bauernverbandes im<br />
Beisein von B<strong>und</strong>eskanzlerin Dr. Angela Merkel.<br />
30.06.<br />
DBV-Präsidium: Gast ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion<br />
im Europäischen Parlament, Martin Schulz. Das Präsidium<br />
fordert von der B<strong>und</strong>esregierung ein konsequentes<br />
Kostenentlastungsprogramm.<br />
Ehrung<br />
Otto-Dietrich Steensen, ehemaliger Präsident des Bauernverbandes<br />
Schleswig-Holstein, erhält die Andreas-Hermes-Medaille<br />
in Gold.<br />
Juli<br />
10.07.<br />
Der B<strong>und</strong>esfinanzminister plant mit den Ländern eine vorfristige<br />
Besteuerung der Direktzahlungen. Den deutschen<br />
Landwirten droht durch eine faktische Doppelbesteuerung<br />
damit eine Steuermehrbelastung von insgesamt<br />
r<strong>und</strong> 700 Millionen Euro. Durch eine gezielte Kampagne<br />
gegenüber der Politik gelingt es, die Rücknahme dieses<br />
Vorhabens durchzusetzen.<br />
16.07.<br />
Zum dritten Mal fand ein Spitzengespräch zwischen dem<br />
DBV <strong>und</strong> allen großen Umweltverbänden in Berlin statt.<br />
Neben zahlreichen strittigen Punkten gab es lediglich bei<br />
der Bioenergie Einigkeit über die Notwendigkeit deren<br />
Ausbau. Strittig blieb aber auch dort die Höhe der festzu-<br />
11<br />
Agrarpolitische Zeittafel
setzenden Nachhaltigkeitsanforderungen beim Anbau von<br />
Biomasse.<br />
17.07.<br />
Der DBV begrüßt, dass das B<strong>und</strong>esamt für Verbraucherschutz<br />
<strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit in kürzester Zeit die<br />
Ursachen des Bienensterbens in Südwestdeutschland geklärt<br />
hat. Das ermöglicht die Fortführung der Zulassung<br />
für insektizide Beizmittel zur Saatgutbehandlung von<br />
Raps rechtzeitig vor der anstehenden Aussaat. Gleichzeitig<br />
fordert der DBV die Pflanzenschutzindustrie, Pflanzenzüchter<br />
<strong>und</strong> Landtechnikhersteller auf, das bisher noch<br />
ungelöste Problem bei Maissaatgut rasch zu lösen.<br />
29.07.<br />
Milchgipfel im B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium:<br />
Der DBV übergibt im Vorfeld 21.000 Unterschriften, die im<br />
Rahmen der Aktion „Mein Herz schlägt für Milchbauern“<br />
gesammelt wurden. Zahlreiche Prüfaufträge zur einseitigen<br />
Mengenreduktion in Deutschland wurden später sämtlich von<br />
den B<strong>und</strong>esländern <strong>und</strong> dem DBV als untauglich zurückgewiesen.<br />
Ende Juli<br />
Der Versuch, die Doha-R<strong>und</strong>e zum Abschluss zu bringen,<br />
scheitert am Streit zwischen den USA <strong>und</strong> Indien.<br />
12
August<br />
21.08.<br />
Die Risiken für die landwirtschaftlichen Betriebe seien<br />
durch veränderte Klimabedingungen, erhöhtes Tierseuchenrisiko,<br />
wachsende Spezialisierung in den Betrieben<br />
<strong>und</strong> durch immer volatilere globale Märkte erheblich angewachsen.<br />
Daher müsse den Landwirten die Möglichkeit<br />
eröffnet werden, in ihrer <strong>Bilanz</strong> eine Risikoausgleichsrücklage<br />
zu bilden, betonte DBV-Generalsekretär<br />
Dr. Born.<br />
21.08.<br />
Nach langwierigen Verhandlungen zwischen DBV, Gesetzgeber<br />
<strong>und</strong> dem B<strong>und</strong>esverband Praktizierender Tierärzte<br />
gelang es, für die tierhaltenden Betriebe die Dokumentationspflichten<br />
beim Einsatz von Tierarzneimitteln durch<br />
Kombibelege spürbar zu vereinfachen. Um den verschiedenen<br />
Dokumentationsverfahren in der Praxis gerecht zu<br />
werden, entwickelte der DBV zwei Varianten von Kombibelegen,<br />
die der Tierarzt künftig nutzt, wenn er Tierarzneimittel<br />
an den Landwirt abgibt.<br />
13<br />
Agrarpolitische Zeittafel
September<br />
02.09.<br />
DBV-Präsidium: Zu Gast ist B<strong>und</strong>esminister Seehofer.<br />
Die Verhandlungslinien beim Health Check, Fragen<br />
der Milchpolitik <strong>und</strong> die Erbschaftsteuerreform stehen<br />
im Mittelpunkt der Aussprache. Im Präsidium wird B<strong>und</strong>esminister<br />
Seehofer zudem aufgefordert, eine eigene<br />
Kennzeichnungsnummer für Eier aus Kleingruppenhaltung<br />
einzuführen.<br />
11.09.<br />
In einem Schreiben an die deutschen EU-Abgeordneten<br />
setzt sich DBV-Präsident Sonnleitner für eine Fortführung<br />
der bestehenden Abgrenzung benachteiligter Gebiete<br />
nach dem bewährten System ein. Mit großer Sorge<br />
verfolgt der DBV deshalb die Diskussion auf europäischer<br />
Ebene, die benachteiligten Gebiete nicht mehr nach der<br />
natürlichen Ertragsfähigkeit, sondern nach neuen Maßstäben<br />
zu definieren.<br />
12.09.<br />
Die Finanzministerien von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern korrigieren<br />
ihre Auffassung zur Besteuerung der Betriebsprämie<br />
der Landwirte.<br />
15.09.<br />
In China wird ein von der Regierung lange vertuschter<br />
Milchskandal bekannt, mit verheerenden Folgen für den<br />
Milchabsatz.<br />
15.09.<br />
Der Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank<br />
Lehman Brothers führt zu weiteren Bankenzusammenbrüchen<br />
in Amerika, aber auch in Europa <strong>und</strong> zu einem dramatischen<br />
weltweiten Verfall der Aktienkurse.<br />
20.09. bis 01.10.<br />
Der COPA-COGECA-Kongress begeht das 50-jährige Bestehen<br />
von COPA <strong>und</strong> COGECA.<br />
14<br />
Oktober<br />
02.10.<br />
Der DBV, der Verband der Fleischwirtschaft <strong>und</strong> der Hauptverband<br />
des Deutschen Einzelhandels verfassen eine gemeinsame<br />
Erklärung zur Ferkelkastration. Ziel der<br />
Erklärung ist es, dass die beteiligten Branchen gemeinsam<br />
einen Weg einschlagen, der die Ansprüche des Verbrau-
chers sowohl hinsichtlich des Tierschutzes als auch der<br />
Fleischqualität in den Fokus stellt. Bereits in Kürze soll der<br />
Einsatz von schmerzstillenden Mitteln bei der Kastration<br />
in Deutschland Anwendung finden.<br />
06.10./07.10.<br />
Das DBV-Präsidium diskutiert auf seiner jährlichen Klausurtagung<br />
die aktuelle nationale <strong>und</strong> europäische Agrarpolitik<br />
<strong>und</strong> die verbandsorganisatorische Entwicklung. Im<br />
rheinland-pfälzischen St. Martin war die Diskussion der<br />
Präsidenten <strong>und</strong> Hauptgeschäftsführer der 18 Landesbauernverbände<br />
thematisch vom Health Check <strong>und</strong> von der<br />
künftigen Milchmarktpolitik angesichts der aktuell anstehenden<br />
politischen Entscheidungen im B<strong>und</strong>esrat geprägt.<br />
17.10.<br />
B<strong>und</strong>esrat, B<strong>und</strong>estag <strong>und</strong> B<strong>und</strong>espräsident stimmen einem<br />
500-Milliarden-Hilfsprogramm für Banken zu.<br />
27.10.<br />
Horst Seehofer tritt von seinem Amt als B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsminister<br />
zurück. Er wird zum Ministerpräsidenten<br />
in Bayern gewählt. Am 25.10.<strong>2008</strong> war Seehofer zum<br />
CSU-Vorsitzenden gewählt worden.<br />
27.10.<br />
Der DBV hat Landwirte aus verschiedenen B<strong>und</strong>esländern<br />
zum Agrarministerrat nach Luxemburg eingeladen, um die<br />
Thematik „Health Check“ mit dem Staatssekretär des B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministers,<br />
Gerd Lindemann, <strong>und</strong> dem<br />
Stellvertretenden Kabinettchef der EU-Agrarkommission,<br />
Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt, zu erörtern.<br />
27.10.<br />
Start der DBV-Postkarten-Aktion im Internet: Pflanzenschutz<br />
in Europa sichern!<br />
31.10.<br />
Ilse Aigner (CSU) erhält von B<strong>und</strong>espräsident Horst Köhler<br />
ihre Ernennungsurk<strong>und</strong>e zur B<strong>und</strong>esministerin für<br />
Ernährung, Landwirtschaft <strong>und</strong> Verbraucherschutz.<br />
November<br />
04.11.<br />
DBV-Präsidium: Zu Gast ist B<strong>und</strong>esumweltminister Sigmar<br />
Gabriel. Breiten Raum bei der Diskussion nahmen die<br />
Entwürfe zum neuen UGB ein, das der DBV in vielen Einzelmaßnahmen<br />
nach wie vor heftig kritisiert.<br />
15<br />
Agrarpolitische Zeittafel
05.11.<br />
Das B<strong>und</strong>eskabinett beschließt ein Konjunkturprogramm,<br />
das Investitionen der Wirtschaft, der Kommunen<br />
<strong>und</strong> der Privathaushalte in Höhe von 50 Milliarden Euro<br />
auslösen soll. Ein 15-Punkte-Programm soll die Auswirkungen<br />
der globalen Finanzkrise auf die deutsche Wirtschaft<br />
begrenzen <strong>und</strong> eine Rezession verhindern.<br />
07.11.<br />
Der B<strong>und</strong>esrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, keine<br />
einseitigen Einschränkungen auf nationaler Ebene innerhalb<br />
der europäischen Milchmarktordnung vorzunehmen.<br />
07.11.<br />
Mit deutlichen Worten wendet sich DBV-Generalsekretär<br />
Dr. Born im Verfahren zur Patentierung von GVO-Tomaten<br />
an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes.<br />
Er weist darauf hin, dass die freie Nutzung<br />
herkömmlicher Züchtungsverfahren elementar für die<br />
Züchtungsfortschritte in der Landwirtschaft ist. Das Europäische<br />
Patentamt müsse die Frage klären, wie patentierbare<br />
technische Verfahren von nicht patentierbaren<br />
klassischen Züchtungsverfahren abzugrenzen sind. Der<br />
DBV fordert erneut die B<strong>und</strong>esministerien für Ernährung,<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong> Verbraucherschutz sowie für Justiz<br />
auf, sich für eine Novellierung der Biopatent-Richtlinie<br />
einzusetzen.<br />
20.11.<br />
Beschluss des Ministerrates über den Health Check: Bereitstellung<br />
zusätzlicher Mittel für „sanften“ Ausstieg aus<br />
der Milchquote – Milchfonds, Anhebung der Milchquoten<br />
um fünfmal 1 Prozent in den Jahren <strong>2009</strong>/10 bis 2013/14,<br />
Modulation, Direktzahlungen über 5.000 Euro werden ab<br />
<strong>2009</strong> zusätzlich in vier Schritten um insgesamt 5 Prozent<br />
gekürzt, Direktzahlungen über 300.000 Euro werden ab<br />
<strong>2009</strong> zusätzlich um 4 Prozent gekürzt.<br />
27.11.<br />
DBV-Präsident Sonnleitner begrüßt die Einigung der<br />
Großen Koalition auf Eckwerte zur Novellierung des Erbschaftsteuergesetzes.<br />
Damit sei endlich Klarheit geschaffen<br />
<strong>und</strong> die Landwirte könnten ihre Betriebe weitgehend<br />
ohne Belastung durch die Erbschaftsteuer an die<br />
nächste Generation weitergeben. Vor allem die zuletzt getroffenen<br />
Vereinbarungen zur Bewertung land- <strong>und</strong> forstwirtschaftlichen<br />
Vermögens, zu den Freibeträgen sowie zu<br />
den deutlich praxisgerechteren Verschonungsregelungen<br />
– einschließlich der verkürzten Fristen – sind auch für die<br />
Landwirte von großem Vorteil.<br />
16
Dezember<br />
05.12.<br />
Aus Sicht des DBV enthält das vom B<strong>und</strong>esrat verabschiedete<br />
Konjunkturpaket Maßnahmen, die in die richtige<br />
Richtung weisen. Dennoch ist es für die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
<strong>und</strong> den ländlichen Raum unverständlich, dass<br />
im Rahmen der aktuellen Konjunkturprogramme nicht<br />
auch die Investitionsförderung in der Gemeinschaftsaufgabe<br />
zur Verbesserung der Agrarstruktur <strong>und</strong> des Küstenschutzes<br />
(GAK) aufgestockt wurde. Ebenfalls belässt es<br />
der Gesetzgeber bei der innerhalb Europas wettbewerbs-<br />
verzerrenden Besteuerung von Agrardiesel zu Lasten deutscher<br />
Landwirte.<br />
09.12.<br />
DBV-Präsidium: Zu Gast ist Prof. Dr. Thomas Mettenleiter,<br />
Präsident des FLI, des B<strong>und</strong>esforschungsinstituts für<br />
Tierges<strong>und</strong>heit. Das Präsidium fordert in einer Entschließung<br />
zur Bekämpfung der Blauzunge einen Mindestvorrat<br />
an Impfstoffen anzuschaffen.<br />
17.12.<br />
Politische Einigung zwischen Vertretern der EU-Mitgliedstaaten<br />
<strong>und</strong> des Europäischen Parlaments nach heftigsten<br />
Debatten über die Pflanzenschutznovelle.<br />
17.12.<br />
Das EU-Klimaschutzpaket passiert das Europäische<br />
Parlament.<br />
31.12.<br />
Käfighaltung für Hühner in Deutschland verboten –<br />
Kleingruppen erlaubt. EU-Länder haben drei Jahre Zeit,<br />
das Verbot umzusetzen.<br />
Ehrung<br />
Wilhelm Grimm, ehemaliger Präsident des Bauernverbandes<br />
Hamburg, erhält die Andreas-Hermes-Medaille.<br />
17<br />
Agrarpolitische Zeittafel
Agrarpolitik
Internationale Agrarpolitik<br />
Weltbauerntag in Warschau<br />
Im Juni <strong>2008</strong> fand der Weltbauerntag in Warschau mit der<br />
höchsten Teilnehmerzahl seiner Geschichte statt. Inzwischen<br />
gehören 115 Bauernverbände aus 80 Ländern weltweit dem<br />
Weltbauernverband IFAP an. Ajay Vashee aus Sambia wurde<br />
als neuer Präsident des Weltbauernverbandes gewählt. Thematisch<br />
standen die Preisentwicklungen auf den internationalen<br />
Agrarmärkten <strong>und</strong> die Rolle der Bioenergie – in vermeintlicher<br />
Konkurrenz zur Nahrungsproduktion – im Vordergr<strong>und</strong> der Diskussionen.<br />
Bauernvertreter aus aller Welt, auch aus den Entwicklungsländern,<br />
sehen die Bioenergie als Chance für eine<br />
standortangepasste Energiegewinnung <strong>und</strong> als einen positiven<br />
Beitrag, einer jahrelangen Tretmühle bei den Agrarpreisen zu<br />
entkommen, wenngleich die Nahrungsproduktion vornehmlichste<br />
Aufgabe für die Landwirte ist <strong>und</strong> bleibt. Der Deutsche<br />
Bauernverband hat sich besonders in die Debatte für ein in<br />
Warschau verabschiedetes Positionspapier zum internationalen<br />
Tierschutz eingebracht. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> zunehmend<br />
globaler Märkte ist der internationale Dialog über Standards<br />
künftig von herausragender Bedeutung.<br />
Zusammenarbeit des Weltbauernverbandes mit internationalen<br />
Organisationen<br />
Anlässlich des Welternährungstages am 16.10.<strong>2008</strong> forderte<br />
IFAP-Präsident Ajay Vashee alle Regierungen <strong>und</strong> internationale<br />
Organisationen auf, Agrarforschung <strong>und</strong> Wissenstransfer<br />
sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern<br />
zu verstärken. Im Bereich des Klimawandels ist die<br />
IFAP ein bedeutender Ansprechpartner <strong>und</strong> Diskussionsteilnehmer.<br />
Im Dezember <strong>2008</strong> nahm IFAP mit einer 20-köpfigen<br />
Delegation an der Konferenz zur Klimarahmenkonvention der<br />
Vereinten Nationen in Polen teil. Im Rahmen einer Veranstaltung<br />
zum Beitrag der Bauern zum Klimawandel betonte IFAP-<br />
Vizepräsidentin Elisabeth Gauffin, dass die Landwirtschaft<br />
nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sei. Im Februar<br />
<strong>2009</strong> diskutierte zudem Präsident Vashee während des<br />
Weltwirtschaftsforums in Davos mit dem Generalsekretär der<br />
Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, sowie mit dem FAO-Generaldirektor<br />
Jacques Diouf. Vashee betonte die Dringlichkeit<br />
größerer Investitionen zur Förderung der Landwirtschaft in<br />
den Entwicklungsländern. Die Aktivitäten des Weltbauernverbandes<br />
im Jahr <strong>2008</strong>, in die der Deutsche Bauernverband aktiv<br />
eingeb<strong>und</strong>en war, haben dazu beigetragen, die Schlüsselrolle<br />
der Landwirtschaft in der Wertschöpfungskette <strong>und</strong> in der<br />
19<br />
Agrarpolitik
Lösung weltweiter Herausforderungen wie der Versorgungssicherheit<br />
zu stärken.<br />
Multilaterale Verhandlungen in der WTO<br />
Im Juni <strong>2008</strong> ist in Genf bei der WTO ein letzter Versuch gescheitert,<br />
einen Durchbruch bei der ins Stocken geratenen<br />
Doha-R<strong>und</strong>e zu erreichen. Der europäische Bauernverband<br />
COPA <strong>und</strong> der Deutsche Bauernverband waren vor Ort, um auf<br />
ein Ergebnis zu drängen, das die europäische Landwirtschaft<br />
nicht einseitig im Agrarhandel belastet. In verschiedenen Gesprächen,<br />
insbesondere mit den europäischen Verhandlungsführern,<br />
sind die berufsständischen <strong>Positionen</strong> vorgetragen<br />
worden. Eine Einigung in Genf ist letztlich an einer Kontroverse<br />
zwischen den USA <strong>und</strong> Indien gescheitert.<br />
Bilaterale Verhandlungen<br />
Wegen des fehlenden Durchbruchs der multilateralen Handelsgespräche<br />
im Rahmen der WTO verstärkte die Europäische<br />
Kommission in <strong>2008</strong> ihr Engagement bei bilateralen Handelsgesprächen.<br />
Der europäische Bauernverband COPA sowie der<br />
Deutsche Bauernverband haben bei verschiedenen Gelegenheiten<br />
darauf hingewiesen, dass bilaterale Handelsgespräche<br />
nicht zu ausgewogenen Ergebnissen führen. Zudem verkomplizieren<br />
sie die Handelsabläufe. Dem multilateralen Ansatz<br />
sollte ungeachtet aller Schwierigkeiten Vorrang im Sinne eines<br />
fairen Handels eingeräumt werden.<br />
20<br />
Europäische Agrarpolitik<br />
Health Check – Überprüfung der Agrarpolitik<br />
Von der Vorlage der ersten Überlegungen der Kommission<br />
im November 2007 bis zur Entscheidung des EU-Agrarrats im<br />
November <strong>2008</strong> arbeitete der Deutsche Bauernverband auf<br />
allen Ebenen für die Kernanliegen der deutschen Bauern, vor<br />
allem für politische Verlässlichkeit bis 2013. DBV-Präsident<br />
Sonnleitner führte Gespräche mit den wichtigsten Entscheidungsträgern<br />
auf EU-Ebene, mit Michel Barnier, französischer<br />
Landwirtschaftsminister <strong>und</strong> amtierender EU-Ratspräsident.<br />
Auf Initiative des Deutschen Bauernverbandes haben EU-<br />
Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel wie auch ihr Stellvertretender<br />
Kabinettschef Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt verschiedene<br />
Regionen in Deutschland besucht, um sich über die<br />
Auswirkungen der Kommissionsvorschläge zum Health Check<br />
zu informieren. Parallel zu den entscheidenden Sitzungen des<br />
EU-Agrarrats von September bis November <strong>2008</strong> veranstaltete
der Deutsche Bauernverband drei Aktionen in Brüssel bzw. Luxemburg<br />
mit insgesamt r<strong>und</strong> 500 Teilnehmern. Im Mittelpunkt<br />
standen dabei die Diskussionen mit Vertretern von EU-Kommission<br />
<strong>und</strong> B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium über den jeweils<br />
aktuellen Verhandlungsstand. An den Aktionen nahmen<br />
Delegierte aus 11 Landesbauernverbänden teil. Darüber hinaus<br />
führte DBV-Präsident Gerd Sonnleitner im gesamten Jahr <strong>2008</strong><br />
zahlreiche Gespräche mit Agrarkommissarin Mariann Fischer<br />
Boel. All diese Gespräche <strong>und</strong> Aktivitäten haben maßgeblich<br />
dazu beigetragen, dass im Ergebnis die Pläne zu Degression<br />
<strong>und</strong> höherer Basismodulation deutlich abgemildert sowie eine<br />
Ausweitung der Milchquote um mehr als fünf Prozent, wie sie<br />
von 14 EU-Staaten gefordert worden war, verhindert werden<br />
konnten. Ein wichtiger Erfolg ist die Verankerung des vom<br />
Deutschen Bauernverband geforderten Begleitprogramms<br />
Milch (Milchfonds).<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband hat folgende Kernforderungen im<br />
Health Check:<br />
• Die Landwirte brauchen Planungssicherheit <strong>und</strong> politische<br />
Verlässlichkeit. Die GAP-Reform von 2003 muss in inhaltlicher<br />
wie finanzieller Hinsicht wie zugesagt bis 2013<br />
Bestand haben.<br />
• Keine weiteren Kürzungen über eine höhere Modulation<br />
bzw. über eine größenabhängige Staffelung oder höhere<br />
Untergrenzen der Direktzahlungen. Auch eine zusätzliche<br />
Kürzung über den sogenannten Artikel 68 (bisher Art. 69)<br />
wird strikt abgelehnt.<br />
• Vereinfachung vorantreiben: Vor allem bei Cross Compliance<br />
besteht weiter dringender Bedarf an einer Ent-<br />
21<br />
Agrarpolitik
schlackung des Kontrollumfangs. Die Aufnahme weiterer<br />
Prüfbereiche (z. B. Gewässerrandstreifen) wird strikt abge-<br />
lehnt.<br />
• Klare Perspektive in der Milchpolitik: Im Hinblick auf das<br />
Auslaufen der Milchquotenregelung 2015 müssen Begleit-<br />
maßnahmen vorgelegt <strong>und</strong> von der EU mit Finanzmitteln<br />
untersetzt werden (Milchfonds). Eine weitere Anhebung der<br />
Milchquoten ohne Rücksicht auf die Marktlage muss unter-<br />
bleiben.<br />
Langfristige europäische Agrarpolitik<br />
Nach dem Beschluss über den Health Check mit der Absicherung<br />
der Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2013 steht die Ausgestaltung<br />
der Europäischen Agrarpolitik für die Zeit nach<br />
2013 jetzt im Mittelpunkt der agrarpolitischen Diskussionen in<br />
Brüssel. Erste Reflexionen darüber haben schon <strong>2008</strong> begonnen.<br />
Der europäische Bauernverband COPA <strong>und</strong> der Deutsche<br />
Bauernverband werben intensiv für eine starke gemeinsame<br />
europäische Agrarpolitik auch nach 2013. Es ist notwenig,<br />
eine starke „erste <strong>und</strong> zweite Säule“ der EU-Agrarpolitik weiterzuentwickeln.<br />
EU-Direktzahlungen tragen zur Honorierung<br />
der gesellschaftlichen Leistungen einer marktorientierten <strong>und</strong><br />
wettbewerbsfähigen Landwirtschaft bei <strong>und</strong> sind ein Teilaus-<br />
22
gleich für die hohen europäischen Standards, die nicht über<br />
den Markt abgegolten werden.<br />
In Gesprächen mit wichtigen Verantwortlichen aus EU-<br />
Kommission <strong>und</strong> Europäischem Parlament werden vor allem<br />
die Bedeutung der Landwirtschaft für die Sicherstellung der<br />
Ernährung der EU-Bevölkerung, die Beiträge der Bauern zu<br />
Energieversorgung, Klimaschutz <strong>und</strong> Kulturlandschaft sowie<br />
die tragende Rolle der Landwirtschaft für den Erhalt vitaler<br />
ländlicher Räume unter Einhaltung der bestehenden hohen europäischen<br />
Nachhaltigkeitsstandards (Verbraucher-, Umwelt-<br />
<strong>und</strong> Tierschutz einschließlich Sozialstandards) herausgestellt.<br />
Nach gr<strong>und</strong>sätzlichen <strong>und</strong> System umwälzenden Reformen seit<br />
1992 kommt es darauf an, die europäische Agrarpolitik nach<br />
2013 behutsam <strong>und</strong> konsistent weiterzuentwickeln.<br />
Überprüfung der Finanzperspektive 2007-2013<br />
<strong>2008</strong> hat die Europäische Kommission mit den Vorarbeiten für<br />
eine Überprüfung der mittelfristigen EU-Finanzplanung 2007<br />
bis 2013 begonnen. Mittels einer Internetkonsultation <strong>und</strong> einer<br />
öffentlichen Anhörung hat sie sich einen Überblick über<br />
das Meinungsspektrum zu den EU-Finanzen zu verschaffen versucht.<br />
Der europäische Bauernverband COPA <strong>und</strong> der Deutsche<br />
Bauernverband haben sich aktiv in die Debatte eingebracht<br />
<strong>und</strong> absolute Verlässlichkeit bei den beschlossenen Ausgabenprogrammen,<br />
so auch bei der EU-Agrarpolitik, gefordert. Konkrete<br />
Vorschläge wird die neue Europäische Kommission erst<br />
2010 vorlegen.<br />
Zusammenarbeit mit Berufsstand außerhalb der EU<br />
Mit dem russischen Bauernverband AKKOR wurde ein Kooperationsprojekt<br />
begonnen, mit dem Unterstützung beim Aufbau<br />
der Verbandsorganisation in Russland geleistet werden<br />
soll. Dazu waren mehrfach Experten aus Deutschland in Russland<br />
zu Gast. Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche<br />
<strong>2009</strong> unterzeichneten die Präsidenten beider Verbände einen<br />
Kooperationsvertrag, der vom B<strong>und</strong>esministerium für Ernährung,<br />
Landwirtschaft <strong>und</strong> Verbraucherschutz gefördert wird.<br />
Europäischer Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialausschuss bezieht<br />
Position zur Landwirtschaft<br />
Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft sind im Europäischen<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialausschuss (EWSA) aktiv am Meinungsbildungsprozess<br />
zu europäischen Rechtsvorhaben beteiligt.<br />
Der Deutsche Bauernverband engagiert sich mit seinem<br />
EWSA-Mitglied insbesondere innerhalb der Fachgruppe Landwirtschaft,<br />
Ländliche Entwicklung, Umweltschutz. Im Jahr<br />
23<br />
Agrarpolitik
<strong>2008</strong> standen der Health Check <strong>und</strong> die Zukunft der Gemeinsamen<br />
Agrarpolitik im Mittelpunkt. Starke Beachtung fanden<br />
auch der Klimawandel, die Bioenergie <strong>und</strong> der Tierschutz.<br />
24<br />
Nationale Agrarpolitik<br />
Situationsbericht <strong>und</strong> Konjunkturbarometer Agrar<br />
Der Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes ist<br />
eine weithin geachtete Argumentationsgr<strong>und</strong>lage in Politik,<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Öffentlichkeit. Dieser ist im Internet auch<br />
unter www.situationsbericht.de abrufbar. Der gemeinsam mit<br />
der ZMP <strong>und</strong> der LAND-DATA erstelle Situationsbericht wird<br />
durch eine Betriebsanalyse auf Basis von Buchführungsdaten<br />
<strong>und</strong> eine Kurzfassung „Agrimente“ von i.m.a. (information.<br />
medien.agrar) ergänzt. Nach der Abschaffung des jährlichen<br />
Agrarberichtes konnte der DBV-Situationsbericht helfen, die<br />
entstandene Lücke zu schließen.<br />
Das Konjunkturbarometer Agrar ist zu einem anerkannten<br />
Indikator für die wirtschaftliche Stimmung der Landwirte<br />
geworden. Das Barometer hat die <strong>2008</strong> abflauende Agrarkonjunktur<br />
für jedermann erkennbar <strong>und</strong> treffsicher abgebildet.<br />
Es wird im Auftrag des Deutschen Bauernverbandes, der<br />
Landwirtschaftlichen Rentenbank, des Verbandes Deutscher<br />
Maschinen- <strong>und</strong> Anlagenbau <strong>und</strong> des B<strong>und</strong>esverbandes der<br />
Lohnunternehmen vierteljährlich erhoben.<br />
Die Stimmungslage in der deutschen Landwirtschaft hat<br />
sich in der zweiten Jahreshälfte <strong>2008</strong> deutlich verschlechtert.<br />
Der Index des Konjunkturbarometers Agrar, der sich aus der<br />
Einschätzung der aktuellen <strong>und</strong> zukünftigen wirtschaftlichen<br />
Lage der Landwirte zusammensetzt, lag zum Jahreswechsel<br />
<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong> bei 12,0 Punkten, während er ein Jahr zuvor noch<br />
39,4 Punkte notierte.<br />
Ländliche Entwicklung <strong>und</strong> Agrarstruktur<br />
In die von B<strong>und</strong>esminister Seehofer angestoßene Debatte<br />
um die Zukunft ländlicher Räume hat sich der Deutsche Bauernverband<br />
mit dem Ziel eingebracht, die Agrarstrukturen zu<br />
verbessern. Am Begleitausschuss für ländliche Entwicklung<br />
des B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministeriums hat sich der Deutsche<br />
Bauernverband aktiv beteiligt. Bei der Gemeinschaftsaufgabe<br />
Agrarstruktur <strong>und</strong> Küstenschutz hat sich der Deutsche Bauernverband<br />
für bessere Förderbedingungen bei den einzelbetrieblichen<br />
Maßnahmen, insbesondere Agrarinvestitionsförderung,<br />
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete <strong>und</strong> Agrarumweltmaßnahmen<br />
eingesetzt. Für die kommenden Jahre wird es ein
40<br />
20<br />
-20<br />
-40<br />
Juni 2000*<br />
wichtiges Ziel des Deutschen Bauernverbandes sein, dass es<br />
bei der von der EU geplanten Neuabgrenzung der benachteiligten<br />
Gebiete nicht zu Einschnitten kommt.<br />
Ein drängendes Thema ist der Flächenverbrauch, bei dem<br />
der Deutsche Bauernverband vor allem auf eine pragmatische<br />
<strong>und</strong> flexible Handhabung der Kompensationsregelung hinarbeitet<br />
(siehe Seite 117).<br />
DBV-Position<br />
Die ländlichen Regionen bieten große Chancen für eine positive<br />
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Es bringt<br />
aber wenig, die Förderpolitik für die Landwirtschaft gegen die<br />
Förderpolitik für den ländlichen Raum auszuspielen. Im Mittelpunkt<br />
des Aufgabenspektrums der Gemeinschaftsaufgabe<br />
Agrarstruktur <strong>und</strong> Küstenschutz sollte weiterhin die Förderung<br />
wettbewerbsfähiger Agrarstrukturen, die angemessene<br />
Honorierung der öffentlichen Leistungen bei der Pflege der<br />
Kulturlandschaft <strong>und</strong> beim Umweltschutz sowie die Lösung<br />
von Flächennutzungskonflikten im ländlichen Raum stehen.<br />
Dringlich ist eine Anpassung der Fördersätze der Agrarumweltmaßnahmen<br />
– aber auch der Ausgleichszulage – an die gestiegenen<br />
Kosten <strong>und</strong> Erlöse, um die Fördermaßnahmen für die<br />
Landwirte attraktiv zu halten. In den kommenden Jahren wird<br />
die GAK auch eine wichtige Rolle bei der investiven Begleitung<br />
der Milchviehbetriebe auf dem Wege des Auslaufens der staatlichen<br />
Milchquotenregelung spielen.<br />
Dez. 2000*<br />
Landwirte: Index des Konjunkturbarometers Agrar<br />
Langjähriges Mittel<br />
2000-<strong>2009</strong><br />
Juni 2001*<br />
Dez. 2001*<br />
Juni 2002<br />
Dez. 2002<br />
März 2003<br />
Juni 2003<br />
Sept. 2003<br />
Dez. 2003<br />
März 2004<br />
Juni 2004<br />
Sept. 2004<br />
Dez. 2004<br />
März 2005<br />
Juni 2005<br />
Sept. 2005<br />
Dez. 2005<br />
März 2006<br />
Juni 2006<br />
Sept. 2006<br />
Dez. 2006<br />
März 2007<br />
Juni 2007<br />
Sept. 2007<br />
Dez. 2007<br />
März <strong>2008</strong><br />
Juni <strong>2008</strong><br />
Sept. <strong>2008</strong><br />
Dez. <strong>2008</strong><br />
März <strong>2009</strong><br />
Landwirte *= ifo-Daten<br />
Konjunktur- <strong>und</strong> Investitionsbarometer 2000 bis <strong>2009</strong><br />
25<br />
Agrarpolitik
Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit
Die Landwirtschaft war mit ihren Themen im Jahr <strong>2008</strong> ein<br />
großes Medienereignis. Die Achterbahn der Erzeugerpreise auf<br />
den volatilen, sich weltweit orientierenden Agrarmärkten, die<br />
Auseinandersetzung der Milchbauern mit Marktpartnern <strong>und</strong><br />
Politik, die Diskussionen über Welternährung <strong>und</strong> Bioenergieerzeugung,<br />
der Bauerntag in Berlin mit seinem gesellschafts-<br />
<strong>und</strong> wirtschaftspolitischen Anspruch sowie die anhaltenden<br />
wirtschaftlichen Probleme der Sauenhalter <strong>und</strong> Schweine-<br />
mäster bestimmten die Pressearbeit des Deutschen Bauernverbandes.<br />
Die Ausbildungskampagne, „Der Tag des offenen<br />
Hofes“, die verbraucherorientierten Erntedankveranstaltungen<br />
<strong>und</strong> die Übergabe der Erntekrone an den B<strong>und</strong>espräsidenten,<br />
die Themen des Tierschutzes oder der Lernort<br />
Bauernhof – klassische Themen der Öffentlichkeitsarbeit –<br />
hatten es dagegen schwerer, überregional die Schlagzeilen<br />
der Medien zu bestimmen.<br />
Internationale Grüne Woche <strong>2008</strong><br />
Der ErlebnisBauernhof als zentraler Ort des Verbraucherdialoges<br />
in den Ausstellungshallen wurde weiter ausgebaut <strong>und</strong><br />
professionalisiert. Erstmals konnte ein genossenschaftlicher<br />
Lebensmittelhändler als Teil der Lebensmittelkette <strong>und</strong> Mitaussteller<br />
gewonnen werden. Der Deutsche Bauernverband<br />
thematisierte in mehreren Pressegesprächen <strong>und</strong> Pressekonferenzen<br />
die wirtschaftlichen Entwicklungen der Landwirtschaft<br />
<strong>und</strong> konnte mit den Themen Bioenergie, Welternährung, faire<br />
Preise <strong>und</strong> Wertschöpfung bei Lebensmitteln erfolgreiches<br />
„Themensetting“ betreiben. Vor allem im unmittelbaren Vorfeld<br />
der Ausstellung gelang mit Exklusivinterviews eine gelungene<br />
Branchendarstellung.<br />
Mit den DBV-Foren setzte der Deutsche Bauernverband für<br />
seine Mitglieder <strong>und</strong> die Fachbesucher wichtige Akzente <strong>und</strong><br />
lieferte exklusive Informationen <strong>und</strong> Entscheidungsgr<strong>und</strong>lagen<br />
für Investitionen. Große Beachtung in den Medien<br />
– insbesondere in den Regionalzeitungen – fand in diesem<br />
Jahr der vom Deutschen Bauernverband veranstaltete „Tag<br />
der Ausbildung <strong>2008</strong>“.<br />
Teller <strong>und</strong> Tank<br />
Landwirtschaft als Zukunftsbranche mit großer Innovationskraft<br />
war 2007/<strong>2008</strong> ein Medienthema wie selten zuvor. Nach<br />
Jahren der Preissenkungen hatte Mitte 2007 der Anstieg der<br />
Getreidepreise auf den Weltmärkten begonnen. Bioenergie <strong>und</strong><br />
-kraftstoffe entwickelten sich zu Themen sogar in den Finanzteilen<br />
der Zeitungen. Andere Produkte, wie die Milch, erlebten<br />
in der ersten Hälfte <strong>2008</strong> preislich ein kurzfristiges Hoch,<br />
27<br />
Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit
was sich zu einem besonderen Medienereignis entwickelte.<br />
Hungeraufstände <strong>und</strong> Demonstrationen gegen „zu hohe“ Lebensmittelpreise<br />
in mehreren Entwicklungsländern führten in<br />
Deutschland zu großer medialer Aufmerksamkeit. Anders als<br />
in den vergangenen Jahrzehnten wurde die Inflation durch<br />
die Lebensmittelpreise nicht mehr gebremst, sondern mit dem<br />
Ölpreisanstieg verstärkt. Obgleich sachlich die Gründe für gestiegene<br />
Lebensmittelpreise immer wieder genannt wurden,<br />
war schnell ein einfach zu kommunizierender „Schuldiger“<br />
gef<strong>und</strong>en: die Bioenergie. Gemeinsam mit dem B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsminister<br />
hat DBV-Präsident Sonnleitner deshalb<br />
u. a. vor der B<strong>und</strong>espressekonferenz in Berlin die Fakten zurechtgerückt.<br />
Im DBV-Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit<br />
wurde die Medienarbeit zu diesem Thema ebenso wie zur<br />
Milchpreisproblematik schwerpunktmäßig abgestimmt.<br />
Deutscher Bauerntag in Berlin<br />
Der Deutsche Bauerntag fand anlässlich des 60-jährigen Jubiläums<br />
des Deutschen Bauernverbandes in <strong>2008</strong> erstmals<br />
in Berlin statt. Er stand unter dem Motto „Tradition.Verantwortung.Zukunft“.<br />
Die Mitgliederversammlung wurde durch<br />
die Gr<strong>und</strong>satzrede von DBV-Präsident Gerd Sonnleitner, die<br />
Ansprachen von EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel<br />
<strong>und</strong> des damaligen B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministers Horst Seehofer<br />
sowie das Grußwort von LandFrauenpräsidentin Brigitte<br />
Scherb geprägt. Deutliches Zeichen der Wertschätzung der<br />
Landwirtschaft durch die B<strong>und</strong>esregierung war der Besuch <strong>und</strong><br />
die Ansprache von B<strong>und</strong>eskanzlerin Dr. Angela Merkel. Eine<br />
Podiumsdiskussion der Fraktionsvorsitzenden im Deutschen<br />
B<strong>und</strong>estag verdeutlichte die Position der B<strong>und</strong>estagsparteien<br />
zur Agrarpolitik. Die DBV-Fachforen, die in Landesvertretungen<br />
<strong>und</strong> Botschaften stattfanden, zeigten erneut das breite<br />
Aufgabenspektrum des Deutschen Bauernverbandes. Die Akkreditierung<br />
von über 130 Journalisten in der Pressestelle<br />
des Deutschen Bauernverbandes stellte sicher, dass aktuelle<br />
agrarpolitische Fragen öffentlich erfolgreich platziert werden<br />
konnten.<br />
Milch- <strong>und</strong> Schweinefleischkampagnen<br />
Die Kampagne für faire Erzeugerpreise, die der Deutsche Bauernverband<br />
seit dem Jahr 2002 mit seinen Landesbauernverbänden<br />
unter dem Slogan „Lebensmittel sind mehr wert!“<br />
durchführt, wurde <strong>2008</strong> im Hinblick auf die aufkommende<br />
Kritik der Verbraucher <strong>und</strong> von Teilen der Politik an zu hohen<br />
Lebensmittelpreisen konsequent weiterentwickelt. So hatte die<br />
Wochenzeitung „Die Zeit“ einen Artikel über die gestiegenen<br />
28
Lebensmittelpreise mit „Ein Land im Butterschock“ betitelt.<br />
Die Entwicklungen in der ersten Hälfte <strong>2008</strong> waren ungewöhnlich.<br />
Der Anstieg der Butterpreise entwickelte sich zum Verbraucherthema<br />
Nummer eins, so dass das Magazin „FOCUS“ im<br />
April von einem „Schock am Frühstückstisch“ schrieb, als die<br />
Butter von 0,79 Euro auf 1,19 Euro je 250-Gramm-Päckchen<br />
stieg.<br />
Die konsequente Fortsetzung von Milchbauern-Demonstrationen<br />
der vorangegangenen Monate im Jahr <strong>2008</strong> durch b<strong>und</strong>esweite<br />
Aktionstage (z. B. vor dem Brandenburger Tor <strong>und</strong><br />
vor Molkereien) sowie der Milchstreik haben für ein starkes<br />
gesellschaftliches Bewusstsein für die Probleme der Milchbauern<br />
gesorgt. Da das Thema Milch jeden Verbraucher betrifft,<br />
erklommen die Bauernproteste schnell die Schlagzeilen der<br />
Hauptnachrichten <strong>und</strong> wurden zu Aufmachern der Tageszeitungen.<br />
Der Deutsche Bauernverband hat von Anfang an die<br />
Listungsgespräche strategisch mit Presseinformationen begleitet<br />
<strong>und</strong> für Verständnis geworben.<br />
Auch die extrem schwierige Lage der Schweine haltenden<br />
Betriebe, besonders der Sauenhalter, hat der Deutsche<br />
Bauernverband zentral in seine Pressearbeit aufgenommen.<br />
Das Verbraucher- <strong>und</strong> damit das Medieninteresse blieben jedoch<br />
weit hinter dem der Milchpreisproblematik zurück. Mit<br />
der vom Deutschen Bauernverband entwickelten Plakatkampagne<br />
„Diese Saupreise sind zum Weglaufen!“, die von den Landesbauernverbänden<br />
stark aufgegriffen <strong>und</strong> genutzt wurde,<br />
wurde aber öffentlich wirksam auf die Existenz gefährdende<br />
Situation der Ferkelbetriebe aufmerksam gemacht.<br />
29
Pflanzenschutzmittel-Kampagne<br />
Ackerbauern, Obst- <strong>und</strong> Gemüsebauern sahen ihre Bemühungen,<br />
die Kulturen ges<strong>und</strong> zu erhalten, durch die sich anbahnende<br />
Gesetzgebung in Brüssel zum Pflanzenschutz ernsthaft<br />
gefährdet. Der Deutsche Bauernverband entwickelte deshalb<br />
erstmals eine besondere Kontaktaufnahme der Bauern mit den<br />
Europaabgeordneten: Eine Postkarten-Mail-Aktion über die<br />
Homepage des Deutschen Bauernverbandes ermöglichte jedem<br />
im Internet, seine Sorgen <strong>und</strong> seinen Protest gegen das Verbot<br />
eines effizienten Pflanzenschutzes zu artikulieren.<br />
Deutsche Bauern Korrespondenz<br />
Die dbk – Deutsche Bauern Korrespondenz – hat sich als<br />
Mitgliederzeitschrift des Deutschen Bauernverbandes zu einem<br />
unverzichtbaren Informationsmedium für ehren- <strong>und</strong><br />
hauptamtliche Führungskräfte, Entscheidungsträger <strong>und</strong><br />
politische Multiplikatoren der deutschen Land- <strong>und</strong> Agrarwirtschaft<br />
im gesamten B<strong>und</strong>esgebiet entwickelt. Mit den<br />
monatlichen Schwerpunktthemen analysiert die dbk aktuelle<br />
<strong>und</strong> für die Mitglieder des Deutschen Bauernverbandes bedeutende<br />
Themen. Dabei werden die Beiträge der DBV-Experten<br />
durch Gastbeiträge hochkarätiger Autoren aus Wirtschaft,<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Politik ergänzt.<br />
Internet<br />
Der Deutsche Bauernverband bietet den Besuchern von www.<br />
bauernverband.de in übersichtlicher <strong>und</strong> ansprechender Struk-<br />
30
tur aktuelle Informationen r<strong>und</strong> um Märkte <strong>und</strong> Politik. Der<br />
DBV-Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit hat einen Arbeitskreis<br />
„Internet“ gegründet, der die Strategie <strong>und</strong> die Aktivitäten<br />
des Deutschen Bauernverbandes <strong>und</strong> seiner Landesbauernverbände<br />
bei ihren Internetangeboten besser vernetzen soll.<br />
Synergieeffekte <strong>und</strong> Akzeptanzverbesserungen zu erreichen<br />
sind das Ziel dieses Arbeitskreises, der auch neue Entwicklungen<br />
im Internet, z. B. Videos, allen Landesbauernverbänden<br />
kostengünstig zugänglich machen wird.<br />
31<br />
Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit
Tierproduktion
Schweinefleischmarkt schwierig<br />
Das Jahr <strong>2008</strong> war für die Schweinehalter erneut ein schwieriges.<br />
Besonders in der ersten Jahreshälfte war die Schweineproduktion<br />
ein Verlustgeschäft. Enorm hohe Futterkosten<br />
führten zu drastischen wirtschaftlichen Verlusten in der<br />
Schweinhaltung. Hinzu kamen historische Tiefstpreise für<br />
Ferkel, die die Ferkelerzeuger in ihrer Existenz bedrohten.<br />
Nur langsam verbesserte sich die Situation durch die guten<br />
Exportmöglichkeiten für Schweinefleisch <strong>und</strong> ein rückläufiges<br />
Angebot in der EU. Durch steigende Einfuhren von Ferkeln <strong>und</strong><br />
Schlachtschweinen besonders aus Dänemark <strong>und</strong> den Niederlanden<br />
wuchs die Fleischerzeugung erneut auf ein Rekordniveau.<br />
Während im Sommer die Erzeugerpreise für Schlachtschweine<br />
ein auskömmliches Niveau erreichten, verbesserte<br />
sich die Situation bei den Ferkelerzeugern nur langsam <strong>und</strong><br />
erreichte erst im Dezember ein zufrieden stellendes Niveau.<br />
Die Preise für Schlachtvieh gingen jedoch im Winter <strong>2008</strong>/09<br />
erneut deutlich zurück.<br />
Aus den Bestandszählungen lässt sich ablesen, dass die<br />
Erzeugung in den kommenden Monaten EU-weit zurückgeht.<br />
Durch die infolge der Finanzkrise auftretenden Währungseinbrüche<br />
in den neuen Beitrittsländern der EU sowie in bedeutsamen<br />
Drittlandsmärkten kam allerdings der Export von<br />
Schweinefleisch zum Jahreswechsel <strong>2009</strong> ins Stocken. Auch<br />
die nachlassende Nachfrage besonders nach hochwertigen<br />
Teilstücken trug dazu bei, dass sich der Preis für Schlachtschweine<br />
in den ersten Monaten des Jahres <strong>2009</strong> nicht erholen<br />
konnte. Ein Anstieg der Erzeugerpreise ist in den kommenden<br />
Wochen dringend erforderlich.<br />
Pro-Kopf-Verzehr Selbstversorin<br />
Kilogramm gungsgrad<br />
<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> (%)<br />
Schweinefleisch 39,2 105,5<br />
Geflügelfleisch 11,0 82,1<br />
Rindfleisch 8,3 119,3<br />
Schaf- <strong>und</strong> Ziegenfleisch 0,7 51,4<br />
Rindfleischmarkt erfreulich<br />
Entgegen dem Trend der Vorjahre legte die Rindfleischerzeugung<br />
im Jahr <strong>2008</strong> in Deutschland um 1,3 Prozent zu. Innerhalb<br />
der Produktionsrichtungen zeigten sich allerdings<br />
erhebliche Unterschiede. So stiegen die Schlachtungen von<br />
Kühen um vier Prozent <strong>und</strong> die Schlachtungen von Bullen um<br />
0,5 Prozent an, während bei Schlachtkälbern ein Rückgang von<br />
33<br />
Tierproduktion
0,5 Prozent <strong>und</strong> bei Färsen sogar ein Rückgang von 2,5 Prozent<br />
zu verzeichnen war. Trotz des Zuwachses in der Rindfleischerzeugung<br />
lagen die Erzeugerpreise bei Bullen <strong>und</strong> Schlachtkühen<br />
r<strong>und</strong> 25 Cent oberhalb der Vorjahreslinie. Stabilisierend<br />
auf den Rindfleischmarkt wirkte vor allem der starke Rückgang<br />
der Rindfleischeinfuhren aus Brasilien. Die EU-Kommission<br />
kam endlich der Forderung des Berufsstandes nach, konsequent<br />
gegen die Rindfleischimporte aus Brasilien vorzugehen,<br />
die die strengen europäischen Auflagen nicht erfüllen. Die<br />
Kalbfleischpreise gingen entsprechend den geringeren Kosten<br />
für Milchpulver im Frühsommer <strong>2008</strong> zurück <strong>und</strong> halten sich<br />
seitdem auf einem konstanten Niveau.<br />
DBV-Position<br />
Jede zusätzliche Absatzalternative führt zu einer Verbesserung<br />
der Verhandlungssituation auf der Anbieterseite. Dies gilt<br />
umso mehr, als dass Deutschland bei Schweinefleisch mittlerweile<br />
Nettoexporteur ist. Das Drängen von Deutschem Bauernverband<br />
<strong>und</strong> Fleischwirtschaft, bisher nicht für den Export<br />
nutzbare Drittlandsmärkte zu öffnen, zeigte deutliche Erfolge.<br />
So wurden u. a. mit den Ländern Südafrika, Japan, Indien <strong>und</strong><br />
China Veterinärvereinbarungen getroffen. Wichtig ist nun,<br />
dass die neuen Exportchancen konsequent genutzt werden.<br />
Latente Gefahr durch Wildschweinepest<br />
Am 8. Januar <strong>2009</strong> wurde die Schweinepest bei Wildschweinen<br />
rechtsrheinisch in der Nähe von Köln festgestellt. Bis Mitte März<br />
wurde in dieser südlichen Region von Nordrhein-Westfalen bei<br />
über 20 Wildschweinen die Wildschweinepest nachgewiesen<br />
<strong>und</strong> im angrenzenden Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz traten<br />
sechs Fälle auf. Darüber hinaus wurde in der Pfalz bei zwei<br />
Wildschweinen das Virus nachgewiesen. Um eine Ausbreitung<br />
34
der Wildschweinepest zu verhindern, wurden in den betroffenen<br />
Kreisen erfolgreich Impfköder ausgelegt. Für die Schweinehalter<br />
kam es zu Vermarktungsauflagen (Untersuchungen, Transportbeschränkungen).<br />
Aufgr<strong>und</strong> des Auftretens der Wildschweinepest<br />
kam es zu einer Komplettsperre für den Export nach Japan.<br />
DBV-Position<br />
Um eine Übertragung der Wildschweinepest auf den Hausschweinbestand<br />
zu verhindern, gilt mehr denn je, die erforderlichen<br />
Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Angesichts der<br />
dramatisch angestiegenen Schwarzwildbestände in Deutschland<br />
ist eine drastische Reduktion des Schwarzwildbestandes<br />
mittelfristig unverzichtbar. Nur dadurch lässt sich das Existenz<br />
bedrohende Risiko für die deutschen Schweinehalter auf Dauer<br />
minimieren bzw. ausschalten.<br />
Fleischgesetz <strong>und</strong> Durchführungsverordnungen<br />
Seit November <strong>2008</strong> sind das neue Fleischgesetz <strong>und</strong> seine<br />
Durchführungsverordnungen in Kraft. Gegen den Widerstand<br />
des Berufsstandes wurden unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus<br />
die Bestimmungen über den Inhalt der Schlachtabrechnungen<br />
gestrichen. Immerhin wurde erreicht, dass die<br />
Neutralität der Klassifizierung gestärkt wurde <strong>und</strong> es einen Anspruch<br />
des Lieferanten gibt, die Klassifizierungsergebnisse der<br />
von ihm abgegebenen Tiere direkt <strong>und</strong> unbeeinflussbar durch<br />
den Schlachtbetrieb zu erhalten. Ferner wurde der Weg zu einer<br />
apparativen Klassifizierung von Rindern eröffnet, die bei<br />
Schweinen seit Jahren angewendet wird. Auch für Mastkälber<br />
wurde ein einheitlicher Zuschnitt für die Gewichtsfeststellung<br />
festgelegt.<br />
DBV für transparente Schlachtabrechnungen<br />
Die Vielzahl von Parametern bei der Schlachtabrechnung erschwert<br />
es dem Schweinehalter, seine Schweine entsprechend<br />
ihrer Qualität <strong>und</strong> ihres Typs optimal zu vermarkten. Um die<br />
Markttransparenz zu ermöglichen, hat der Deutsche Bauernverband<br />
zusammen mit der ZMP einen Schlachtabrechnungsvergleich<br />
aufgebaut <strong>und</strong> weiterentwickelt. Die Ergebnisse des<br />
Abrechnungsvergleichs zeigen, dass die Unterschiede zwischen<br />
den Betrieben auch bei vergleichbaren Bedingungen<br />
erheblich sind. Sie belegen den großen Wert des Vergleichs,<br />
der individuell offenlegt, an welcher Stelle in der Vermarktung<br />
Erlösreserven genutzt werden können. Deshalb appelliert der<br />
Deutsche Bauernverband an die Schweinehalter, im eigenen<br />
Interesse daran teilzunehmen. Die Vermarktungswege können<br />
per Fax zugesendet oder im Online-Verfahren eingegeben wer-<br />
35<br />
Tierproduktion
den. Mit einer besonderen Dienstleistung werden auch die Einzeltierdaten<br />
ausgewertet, wenn diese Daten elektronisch zur<br />
Verfügung gestellt werden können. Auch bei den Ferkelpreisen<br />
besteht bisher zu wenig Transparenz. Um die Sauenhalter zu<br />
unterstützen, soll auch hier ein für den Betrieb aussagekräftiger<br />
Vergleich erstellt werden.<br />
Verfütterungsverbot von tierischen Fetten aufgehoben<br />
Der Deutsche Bauernverband mahnte unablässig, die bestehenden<br />
Wettbewerbsnachteile bei den Futterkosten abzubauen.<br />
Dazu gehört die Aufhebung des nationalen Verfütterungsverbotes<br />
tierischer Fette. Über ein Jahr lang lag der<br />
Gesetzentwurf im B<strong>und</strong>estag, bis das Verbot im März <strong>2009</strong> für<br />
die Schweine- <strong>und</strong> Geflügelfütterung aufgehoben wurde.<br />
GVO-Nulltoleranz bei Eiweißfuttermitteln<br />
Von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist die Verfügbarkeit<br />
von Sojaschrot aus den Anbauländern in Übersee. Zwar konnte<br />
bei den letzten Zulassungen für gentechnisch veränderte Futtermittel<br />
<strong>2008</strong> der Zeitraum für die Zulassung verkürzt werden<br />
<strong>und</strong> damit eine Eskalation der Versorgungslage verhindert<br />
werden. Jedoch besteht angesichts immer neuer GVO-Sorten<br />
in Übersee durch die politisch bedingten Verzögerungen in der<br />
Zulassung sowie der praxisfernen Nulltoleranz für noch nicht<br />
zugelassene Eiweißfuttermittel eine ernsthafte Bedrohung für<br />
den Veredlungsstandort Deutschland.<br />
DBV-Position<br />
Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes darf es nicht sein,<br />
dass Fleisch aus Übersee importiert werden darf, der Import<br />
der Futtermittel, mit denen diese Tiere gefüttert werden, jedoch<br />
verboten ist.<br />
Information zur Lebensmittelkette<br />
Nach EU-Verordnung müssen bei der Lieferung von Schlachttieren<br />
bestimmte Daten zum Ges<strong>und</strong>heitszustand der Tiere an<br />
den Schlachtbetrieb gemeldet werden. Nachdem die EU-Kommission<br />
verdeutlicht hat, dass diese Lebensmittelketteninformation<br />
ein Kernanliegen des neuen Hygienerechtes ist, setzte<br />
sich der Deutsche Bauernverband für eine Standarderklärung<br />
als eine möglichst unbürokratische <strong>und</strong> praktikable Meldung<br />
ein. Auch konnte erreicht werden, dass die Übergangsfristen<br />
für die Einführung der Ketteninformation voll ausgeschöpft<br />
wurden. Danach ist die Lebensmittelketteninformation für<br />
Schweine ab <strong>2008</strong>, für Einhufer <strong>und</strong> Mastkälber ab <strong>2009</strong> <strong>und</strong><br />
für Rinder <strong>und</strong> Schafe ab 2010, notwendig. Bis Ende <strong>2009</strong> kann<br />
36
die Lebensmittelketteninformation auch mit der Anlieferung<br />
der Tiere am Schlachthof abgegeben werden <strong>und</strong> muss nicht<br />
24 St<strong>und</strong>en vor der Lieferung zugesendet werden.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband setzt sich weiterhin dafür ein,<br />
dass das EU-Hygienerecht gerade in diesem Punkt entbürokratisiert<br />
wird.<br />
Geflügelfleisch <strong>und</strong> Eier<br />
Marktentwicklung<br />
Der Hähnchenfleischmarkt war <strong>2008</strong> aufgr<strong>und</strong> der gestiegenen<br />
Nachfrage, insbesondere durch die Teilstückvermarktung, von<br />
Produktionsausweitungen gekennzeichnet. Damit passt sich<br />
die Erzeugerseite dem neuen Rekord beim Pro-Kopf-Verbrauch<br />
von Geflügelfleisch (18,8 Kilogramm) an, der auf die zunehmende<br />
Beliebtheit von Hähnchenfleisch (11,1 Kilo-gramm<br />
Verbrauch) zurückzuführen ist. Auch wenn die Hähnchenmast<br />
in Zeiten knapper Futterrohstoffe besonders von ihrer vorzüglichen<br />
Futterverwertung profitiert, ist es fraglich, ob sich die<br />
stabilen Preise in diesem Jahr fortsetzen können.<br />
Derzeit ist der Eiermarkt einem Strukturwandel ausgesetzt,<br />
da die vom Gesetzgeber geforderte Umstellung von der Käfighaltung<br />
auf Boden-, Freiland- <strong>und</strong> Kleingruppenhaltung erst<br />
37
Ende <strong>2009</strong> abgeschlossen sein wird. Es ist damit zu rechnen,<br />
dass zahlreiche kleinere Betriebe aus der Produktion aussteigen<br />
werden. Dieser Ausstieg ist zum einen in der unsachlich<br />
geführten Debatte um die Kleingruppe, zum anderen in den<br />
erheblichen Konsequenzen der Salmonellenbekämpfung begründet.<br />
Kleingruppenhaltung<br />
In Deutschland ist das Käfigverbot für Legehennen bereits<br />
zum 1. Januar <strong>2009</strong> in Kraft getreten. In den meisten anderen<br />
Mitgliedstaaten der EU gilt das Käfigverbot erst ab 2012. Der<br />
Import von Käfigeiern aus anderen Ländern nach Deutschland<br />
ist weiterhin erlaubt.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband steht zur neuen, tiergerechten<br />
Haltungsform für Legehennen, der Kleingruppe. Die Kleingruppenhaltung<br />
bleibt das einzige Haltungssystem für Hühner, in<br />
der die Tiere von den Exkrementen getrennt gehalten werden.<br />
Dies ist in Zeiten steigender Hygieneanforderungen eine wichtige<br />
Vorausetzung. Die Kleingruppenhaltung verbindet Verbraucher-,<br />
Umwelt-, Arbeits- <strong>und</strong> Tierschutz miteinander.<br />
Geflügelpest<br />
Die generelle Stallpflicht gilt nach wie vor, da das Virus der<br />
Geflügelpest in der Umwelt präsent ist.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband hat sich für risikoorientierte<br />
Ausnahmen von der Stallpflicht eingesetzt <strong>und</strong> appelliert an<br />
alle Geflügelhalter, die Biosicherheitsmaßnahmen auf den Betrieben<br />
sorgfältig einzuhalten.<br />
Eierkennzeichnung<br />
Die Vermarktungsnormen für Eier sehen für die ausgestalteten<br />
Käfige sowie den deutschen Standard der Kleingruppenhaltung<br />
keine neue Ziffer vor. Eier aus diesen Haltungssystemen<br />
sollen ebenfalls mit der Kennziffer 3 <strong>und</strong> den Worten „aus Käfighaltung“<br />
gekennzeichnet werden.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband setzt sich für eine neue Kennziffer<br />
für Eier aus der Kleingruppenhaltung ein. Die Fortschritte<br />
im Tierschutz müssen für den Verbraucher erkennbar sein, damit<br />
diese Weiterentwicklung durch eine entsprechende Kaufentscheidung<br />
anerkannt werden kann.<br />
38
Geflügelfleischimporte<br />
Die USA wollen über die WTO eine Aufhebung des bestehenden<br />
Importverbots <strong>und</strong> damit Öffnung des europäischen Marktes<br />
für amerikanisches Geflügelfleisch durchsetzen.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband hat sich klar dafür ausgesprochen,<br />
kein mit Chlor „dekontaminiertes“ Geflügelfleisch aus<br />
den USA zuzulassen. Eine Endproduktbehandlung würde die<br />
Maßnahmen in der Tierhaltung hinsichtlich der Prozesshygiene<br />
<strong>und</strong> speziell den hohen Anforderungen bei der Salmonellenbekämpfung<br />
infrage stellen.<br />
Tierschutz bei Masthähnchen<br />
Die unter deutscher Ratspräsidentschaft verabschiedete EU-<br />
Richtlinie zur Haltung von Masthähnchen muss bis Sommer<br />
2010 von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. B<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Länder wollen die unter besonderen Voraussetzungen mögliche<br />
maximale Besatzdichte von 42 Kilogramm je Quadratmeter<br />
nicht ermöglichen.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband fordert eine 1:1 Umsetzung der<br />
EU-Richtlinie in nationales Recht <strong>und</strong> kritisiert die geplante<br />
Verschärfung der maximalen Besatzdichte von 39 Kilogramm je<br />
Quadratmeter, da auch dieser Wert zu keinem Zeitpunkt überschritten<br />
werden darf.<br />
Salmonellose bei Legehennen<br />
Die EU gibt die Senkung der Salmonellenprävalenz in Legehennenherden<br />
vor, um das Risiko einer Salmonellose für die<br />
Verbraucher zu senken.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband setzt sich dafür ein, dass das<br />
vorgegebene Ziel einer Senkung der Salmonellenbelastung<br />
mit angemessenen Maßnahmen erreicht wird. So ist die<br />
Untersuchung von Eiern oder Hühnern nach einer positiven<br />
Umweltprobe eine sinnvolle Maßnahme, um falschpositive<br />
Erstergebnisse <strong>und</strong> damit enorme Konsequenzen für die Be-<br />
triebe zu vermeiden.<br />
• Da die Salmonellose die gesamte Lebensmittelkette betrifft<br />
– Landwirtschaft – Verarbeitungsindustrie – Lebensmittelhandel<br />
– Verbraucher – fordert der DBV eine faire Verteilung<br />
von Verantwortung <strong>und</strong> Kosten bei den Maßnahmen für die<br />
Zoonosenprävention.<br />
39<br />
Tierproduktion
Qualitätssicherung Eier<br />
Der Deutsche Bauernverband hat die Aufnahme der Anforderungen<br />
an die Legehennenhaltung in das Betriebsaudit Landwirtschaft<br />
der QS Qualität <strong>und</strong> Sicherheit GmbH erreicht. Damit<br />
soll Betrieben, die mit anderen Produktbereichen bereits<br />
QS-zertifiziert sind, die Möglichkeit gegeben werden, in einem<br />
Qualitätssicherungssystem auch die Eierproduktion prüfen zu<br />
lassen.<br />
DBV-Forum: „Eiererzeugung – Quo vadis Deutschland?“<br />
Dieses Forum zeigte in Vorträgen <strong>und</strong> Diskussionen mit Vertretern<br />
von BMELV, Wirtschaft <strong>und</strong> Legehennenhaltern die<br />
Problematik auf, in welcher ungewissen wirtschaftlichen Lage<br />
sich Legehennenhalter zwischen Salmonellenbekämpfung in<br />
Verbindung mit der Haltungsdebatte, Eierkennzeichnung <strong>und</strong><br />
Tierschutz-TÜV befinden.<br />
Futtermittel<br />
Volatile Märkte bei Soja- <strong>und</strong> anderen Ölschroten, bei Getreide,<br />
Futterphosphaten <strong>und</strong> Spurenelementen bestimmen die Futtermittelkosten.<br />
Die Tierhaltung in Deutschland hat einen Futterbedarf<br />
von 80 Millionen Tonnen Getreideäquivalent. Umso<br />
bedeutender ist damit die Verlässlichkeit der Qualitäten von<br />
Mischfutter für die Veredlung.<br />
40
Normenkommission für Einzelfuttermittel<br />
Einzelfuttermittel in der direkten Verfütterung sowie in Mischfuttermitteln<br />
müssen für die Veredlungswirtschaft einen Futterwert<br />
vorweisen <strong>und</strong> sicher sein. Der Deutsche Bauernverband<br />
hat 2001 im Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft<br />
(ZDL) die Positivliste für Einzelfuttermittel initiiert. Das<br />
Expertengremium Normenkommission für Einzelfuttermittel<br />
prüft jährlich Anträge von Herstellern der Lebensmittel- <strong>und</strong><br />
Energiewirtschaft auf Wertigkeit <strong>und</strong> Sicherheit. Jedes Produkt<br />
wird einer Risikobewertung unterzogen, bevor es in die<br />
Liste aufgenommen wird. Herkunft, Herstellungsverfahren,<br />
Futterzweck <strong>und</strong> -wert aller genannten Einzelfuttermittel<br />
müssen eindeutig beschrieben <strong>und</strong> mögliche Risiken genannt<br />
werden. Die Positivliste wird kontinuierlich weiterentwickelt.<br />
Im Oktober <strong>2008</strong> ist die 7. Auflage mit 338 gelisteten <strong>Positionen</strong><br />
erschienen. Mit der Einbindung der Positivliste in das<br />
QS-System ist diese seit Jahren fest in der Futtermittelwirtschaft<br />
etabliert. In Deutschland werden heute nahezu alle<br />
Mischfuttermittel nach Maßgabe der Positivliste erzeugt. Eine<br />
englischsprachige Fassung ist mit Blick auf die Änderung des<br />
europäischen Futtermittelrechts <strong>und</strong> zunehmendem Interesse<br />
ausländischer Anbieter erstmals erschienen.<br />
DBV-Position<br />
Die neue EU-Verordnung über das Inverkehrbringen von Futtermitteln<br />
sieht die Einrichtung eines freiwilligen Gemeinschaftskatalogs<br />
für Futtermittel-Ausgangserzeugnisse vor.<br />
Nach einem noch festzulegenden Verhaltenskodex sollen Einzelfuttermittelhersteller<br />
die Aufnahme in diese neue EU-Positivliste<br />
beantragen können. Der Deutsche Bauernverband setzt<br />
sich dafür ein, dass die Vorgaben der deutschen Positivliste in<br />
den Verhaltenskodex übernommen werden <strong>und</strong> die bestehende<br />
deutsche Liste darin einfließt.<br />
Verein Futtermitteltest<br />
Der Verein Futtermitteltest (VFT), dessen Träger der Deutsche<br />
Bauernverband mit seinen Landesverbänden sowie die Landwirtschaftskammern<br />
<strong>und</strong> die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft<br />
(DLG) sind, hat auch im vergangenen Jahr die Prüfung<br />
von Mischfuttermitteln mit Unterstützung des BMELV erfolgreich<br />
fortgesetzt. Geprüft wird der Futterwert von Mischfuttermitteln<br />
<strong>und</strong> damit die Qualität <strong>und</strong> der Nährstoffgehalt,<br />
aber auch die Deklaration auf dem Etikett. Diese wichtigen<br />
Aspekte durchleuchten die neuesten Warentestergebnisse des<br />
Vereins Futtermitteltest VFT mit über 25.000 Mischfuttermitteln<br />
auf der Internetseite www.futtermitteltest.de sowie die<br />
41<br />
Tierproduktion
Veröffentlichungen in den landwirtschaftlichen Wochenblättern.<br />
Alle getesteten Hersteller werden namentlich mit ihren<br />
Bewertungen vom VFT veröffentlicht. Dies bietet Landwirten<br />
umfangreiche Daten zur Bewertung der regionalen Anbieter<br />
von Futtermitteln.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband legt Wert darauf, dass bei den<br />
Veröffentlichungen klare <strong>und</strong> deutliche Aussagen bzw. verständliche<br />
Endbewertungen der Mischfutter erfolgen. So werden<br />
die Ergebnisse zielgerichtet in eine erfolgreiche Fütterung<br />
umgesetzt. Abweichungen von den genannten Qualitäten <strong>und</strong><br />
Komponentenanteilen gilt es noch kritischer zu durchleuchten,<br />
dies gilt auch für die Kennzeichnung von Futtermitteln.<br />
Nach der neuen Kennzeichnungsverordnung sind zukünftig die<br />
Anteile der Einzelkomponenten in absteigender Reihenfolge<br />
aufzuführen. Die Zusammensetzung der Mischfutter im Rahmen<br />
eines Warentests zu prüfen, wird erheblich wichtiger.<br />
Umsetzung Futtermittelhygieneverordnung<br />
Mit Inkrafttreten der europäischen Futtermittelhygieneverordnung<br />
im Jahr 2006 wurde für alle Futtermittelunternehmen in<br />
Europa ein einheitlicher Standard geschaffen. Als neuer Maßstab<br />
ist die Verordnung (EG) Nr.: 183/2005 auch für die Landwirtschaft<br />
relevant. Im vergangenen Jahr galt es, die Futtermittelhygieneverordnung<br />
praxisnah umzusetzen <strong>und</strong> die Anforderungen<br />
ohne unnötige zusätzliche Bürokratie auf den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben einzuführen. Ein besonderer Aspekt<br />
ist die direkte Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen. Hier<br />
hat der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit den anderen<br />
Organisationen im Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft<br />
ein praktikables Konzept zur Umsetzung der HACCP-<br />
Anforderungen formuliert. Diese unbürokratische Lösung wird<br />
von allen Kontrollbehörden in Deutschland anerkannt.<br />
DBV-Position<br />
Auf Basis eines risikoorientierten Sicherungsansatzes gewährleistet<br />
die Landwirtschaft auf ihrer Stufe ausreichenden Verbraucherschutz.<br />
Die Landwirtschaft muss von der Pflicht zur<br />
Umsetzung von HACCP-Kontrollen industrieller Futtermittelunternehmer<br />
ausgenommen bleiben. Merkblätter zur Anwendung<br />
von Futtermittelzusatzstoffen im landwirtschaftlichen Betrieb<br />
geben dafür ausreichende <strong>und</strong> praktikable Hilfestellungen.<br />
Neuordnung der Kennzeichnungsvorschriften<br />
Anfang <strong>2009</strong> hat das europäische Parlament dem im Trilogie-<br />
42
verfahren gef<strong>und</strong>enen Kompromiss zur Neufassung der Verordnung<br />
über das Inverkehrbringen von Futtermitteln zugestimmt.<br />
Die Bedingungen eines fairen Handels unter den Marktpartnern<br />
sowie Vereinfachung <strong>und</strong> Angleichung des Futtermittelrechts<br />
an das Lebensmittelrecht standen im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Zukünftig sollen Hersteller <strong>und</strong> Verwender von Futtermitteln<br />
weitestgehend freiwillig über gemeinsame Verhaltenskodizes<br />
entscheiden, welche Einzelfuttermittel zugelassen sind <strong>und</strong><br />
welche Informationen über die Zusammensetzung erfolgen.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband hat für den Landwirt als Futtermittelverwender<br />
höchste Transparenz eingefordert <strong>und</strong><br />
sich zusammen mit dem europäischen Bauernverband COPA<br />
für klare <strong>und</strong> unmissverständliche Informationsvorschriften<br />
für den Landwirt eingesetzt. Mit der Maßgabe, Einzelkomponenten<br />
in absteigender Reihenfolge anzugeben, können die<br />
Mischfuttermittelhersteller die bisherige Prozentangabe der<br />
Einzelkomponenten weglassen. Verpflichtend wird die Angabe<br />
von Energie- <strong>und</strong> Proteinwerten <strong>und</strong> weiterer analytischer Bestandteile.<br />
Der Deutsche Bauernverband arbeitet im europäischen<br />
Bauernverband intensiv daran, einen Verhaltenskodex<br />
zur Kennzeichnung von Mischfuttermitteln mit zu entwickeln,<br />
damit Landwirte von ihrem Marktpartner weiter in fairer Partnerschaft<br />
die erforderlichen Auskünfte erhalten können.<br />
Tierische Fette<br />
Der vorliegende Gesetzesvorschlag, mit dem das Verfütterungsverbot<br />
von tierischen Fetten für Schweine <strong>und</strong> Geflügel<br />
aufgehoben werden sollte, lag seit gut einem Jahr auf Eis. Der<br />
B<strong>und</strong>estag kam zu keiner Entscheidung, weil man die Lockerung<br />
des Verfütterungsverbotes völlig zusammenhanglos mit<br />
den Informationen im Verbraucherschutzgesetz verknüpft hat.<br />
Nachdem auf dem Fachforum des Deutsche Bauernverbandes<br />
anlässlich der Internationalen Grünen Woche <strong>2009</strong> das Thema<br />
erneut in breiter Öffentlichkeit diskutiert wurde, hat der B<strong>und</strong>estag<br />
im März eine Lockerung beschlossen <strong>und</strong> die Gesetzesänderung<br />
kann nach Zustimmung des B<strong>und</strong>esrates in Kraft<br />
treten.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband fordert seit langem, das Verfütterungsverbot<br />
aufzuheben, da es ökonomisch wie ökologisch<br />
unsinnig ist, diese „verlorenen“ Eiweißmengen als Sojaschrot<br />
aus Übersee zu importieren.<br />
43<br />
Tierproduktion
Tierische Proteine<br />
Wertvolle Eiweißfuttermittel gehen verloren, solange Schlachtnebenprodukte,<br />
die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet<br />
sind, vernichtet werden müssen, statt für die Schweine-<br />
<strong>und</strong> Geflügelhaltung als Futter eingesetzt zu werden.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband setzt sich für die Wiederzulassung<br />
an Nichtwiederkäuer ein. Die TSE-Verordnung muss überarbeitet<br />
werden. Das BSE-Risiko ist in der gesamten EU erheblich<br />
zurückgegangen. Die EFSA ist dringend gefordert, Verfahren<br />
zur Identifizierung der Herkunft der Proteine zuzulassen.<br />
Zulassung von GVO-Futtermitteln<br />
Der Deutsche Bauernverband fordert die beschleunigte Zulassung<br />
sowie Schwellenwerte für in der EU noch nicht zugelassene,<br />
aber in anderen Erzeugerländern bereits angebaute GVO-<br />
Produkte. Der Deutsche Bauernverband ist gegen die Vorgabe<br />
von Quoten für Nicht-GVO-Futtermittel in der Nutztierfütterung<br />
im Rahmen einer QS-Zertifizierung.<br />
QS-Futtermittel<br />
Die umfassende Kontrolle aller Futtermittel im QS-System vermindert<br />
das Risiko von Qualitätsmängeln <strong>und</strong> unerwünschten<br />
Stoffen. Seit April <strong>2008</strong> liefert ein neues Modul Futtermittelmonitoring<br />
in der QS Software-Plattform wertvolle Analyseergebnisse<br />
von Futtermittelproben. Der Leitfaden Futtermittelmonitoring<br />
wurde um einen Kontrollplan Glycerin erweitert.<br />
Zusammen mit der niederländischen Productshap Diervoeder<br />
(PDV) hat QS ein gemeinsames HACCP-Handbuch herausgegeben.<br />
Zur Vermeidung von Doppelaudits ist eine gegenseitige<br />
Systemanerkennung mit dem belgischen System Ovocom/<br />
Bemefa <strong>und</strong> dem niederländischen GMP B1-Standard zustande<br />
gekommen.<br />
Tierschutz<br />
Ferkelkastration<br />
Aufgr<strong>und</strong> des massiven Drucks von Tierschutzorganisationen<br />
auf Politik <strong>und</strong> Lebensmitteleinzelhandel, die betäubungslose<br />
Kastration zu verbieten, wurde von der Lebensmittelkette in<br />
den Niederlanden eine Selbstverpflichtung zur Betäubung<br />
der Ferkel beschlossen. Die Kosten für die benötigten Geräte<br />
werden über eine Umlage durch den Lebensmitteleinzelhandel<br />
getragen. Diese Entwicklung hatte auch Auswirkungen für<br />
44
Deutschland. Bedeutende Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel<br />
forderten eine Abkehr von der bisherigen Kastrationspraxis<br />
<strong>und</strong> setzten die Vieh- <strong>und</strong> Fleischwirtschaft unter<br />
Druck.<br />
DBV-Position<br />
Um schlimmeren Schaden für den Schweinemarkt abzuwenden,<br />
hat sich der Deutsche Bauernverband frühzeitig <strong>und</strong> intensiv<br />
mit möglichen Alternativen zur Kastration auseinandergesetzt.<br />
Dabei wurde schnell klar, dass das Betäubungsverfahren nach<br />
niederländischem Beispiel in Deutschland nicht umsetzbar ist.<br />
Die Betäubung entspricht nicht den Vorgaben des Tierschutzes,<br />
müsste von Tierärzten durchgeführt werden <strong>und</strong> wäre daher<br />
sehr teuer. Im Ergebnis wurde mit der Schmerzbehandlung<br />
eine Zwischenlösung gef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> in QS umgesetzt. Dadurch<br />
konnte eine Versachlichung der Diskussion erreicht werden.<br />
Neben einer belegbaren Schmerzlinderung beim W<strong>und</strong>schmerz,<br />
ist die Schmerzbehandlung in der Praxis umsetzbar <strong>und</strong> unter<br />
Kostengesichtspunkten im Vergleich zu allen anderen Alternativen<br />
vertretbar. Längerfristig laufen die Bestrebungen darauf<br />
hinaus, ganz auf die Kastration verzichten zu können. Hier besteht<br />
aber noch erheblicher Forschungsbedarf.<br />
Tiertransport<br />
Am 18. Februar <strong>2009</strong> wurde die nationale Tierschutz-Transportverordnung<br />
veröffentlicht. Durch die Verordnung wurden keine<br />
wesentlichen Verschärfungen der unmittelbar geltenden EU-<br />
Verordnung 1/2005 beschlossen. Bei innerstaatlichen Transporten<br />
von mehr als 8 St<strong>und</strong>en konnten sogar Ausnahmen von<br />
den hohen EU-Anforderungen an die Langstreckentransportfahrzeuge<br />
erreicht werden, wenngleich auch nicht in dem Ausmaß,<br />
wie es vom Deutschen Bauernverband gefordert wurde.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der massiven Kritik des Deutschen Bauernverbandes<br />
hat der B<strong>und</strong>esrat zudem die B<strong>und</strong>esregierung aufgefordert,<br />
auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, dass Tierhalter gr<strong>und</strong>sätz-<br />
45
lich vom Befähigungsnachweis sowie vom Zulassungsnachweis<br />
als Transportunternehmer befreit werden.<br />
Prüf- <strong>und</strong> Zulassungsverfahren für Haltungseinrichtungen<br />
Der Deutsche Bauernverband hat die obligatorischen Prüf-<br />
<strong>und</strong> Zulassungsverfahren für serienmäßig hergestellte Haltungseinrichtungen<br />
konsequent abgelehnt. Serienmäßig<br />
hergestellte Haltungseinrichtungen sollen künftig erst in<br />
den Verkehr gebracht <strong>und</strong> vom Landwirt verwendet werden<br />
dürfen, wenn sie ein Zulassungsverfahren bestanden haben.<br />
Das Gesetz ist die Rechtsgr<strong>und</strong>lage für entsprechende Durchführungsverordnungen,<br />
die zunächst für Legehennen vom<br />
B<strong>und</strong>esrat beschlossen werden sollen. Hier wird der Deutsche<br />
Bauernverband darauf achten, dass über den Weg der Zulassung<br />
die bestehenden Anforderungen nicht noch zusätzlich<br />
verschärft werden. Immerhin wurde klargestellt, dass das Zulassungsverfahren<br />
keinen Einfluss auf bereits installierte Stalleinrichtungen<br />
hat.<br />
DBV-Position<br />
Nach Ansicht des Deutschen Bauernverbandes läuft ein solches<br />
Prüf- <strong>und</strong> Zulassungsverfahren dem von der B<strong>und</strong>esregierung<br />
so oft versprochenen Bürokratieabbau in eklatanter Weise zuwider.<br />
Abermals wird im nationalen Alleingang über EU-Recht<br />
hinausgegangen <strong>und</strong> die entstehenden Kosten auf die investitionswilligen<br />
Betriebe umgelegt.<br />
Überprüfung des Leitfadens zur Stickstoffdeposition<br />
Die technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)<br />
verlangt, dass beim Bau <strong>und</strong> der Erweiterung von nach dem<br />
B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen<br />
auch die Stickstoffdeposition berücksichtigt wird. Dazu<br />
wurde eine Verwaltungsempfehlung in Form eines Leitfadens<br />
erarbeitet, der derzeit überprüft wird. Der Deutsche Bauernverband<br />
<strong>und</strong> seine Landesverbände haben erreicht, dass dieser<br />
Leitfaden überarbeitet wird.<br />
DBV-Position<br />
Kaum ein Stallbau könnte noch nach diesem Leitfaden genehmigt<br />
werden. Nicht hinnehmbar ist beispielsweise, dass<br />
Baumbestände, die um den Betrieb angepflanzt wurden, in die<br />
Ökosystembetrachtung einbezogen werden <strong>und</strong> zum Versagen<br />
der Genehmigung führen. Auch der Schwellenwert, ab dem die<br />
Stickstoffdeposition schädlich sein soll, ist aus Sicht des Deutschen<br />
Bauernverbandes dringend zu prüfen.<br />
46
Schafe, Ziegen, landwirtschaftliche<br />
Wildhaltung <strong>und</strong> Pferde<br />
Markt<br />
Im vergangenen Jahr konnten auf dem Lammfleischmarkt<br />
leicht steigende Preise verzeichnet werden. Marktexperten<br />
prognostizieren auch für das Jahr <strong>2009</strong> stabile Preise. Der<br />
geringe Selbstversorgungsgrad von 51,1 Prozent zeigt das erhebliche<br />
Wachstumspotenzial für dieses extensive Haltungsverfahren.<br />
Der Rückgang der Schafbestände auf 2,44 Millionen<br />
ist u. a. auf die erheblichen Verluste durch die Blauzungenkrankheit<br />
zurückzuführen.<br />
Die Zahl der in Deutschland gehaltenen Ziegen stieg auf<br />
b<strong>und</strong>esweit r<strong>und</strong> 180.000. Mit r<strong>und</strong> 6.000 Gehegen blieb die<br />
Zahl der Gehegehaltungen – vornehmlich Damwild- <strong>und</strong> zunehmend<br />
auch Rotwildgehege – im Vergleich zum Vorjahr<br />
konstant. Entsprechend wurden wie im Vorjahr etwa 15.000<br />
Hektar Grünland über diese extensive Weidehaltung gepflegt.<br />
Kennzeichnung <strong>und</strong> Registrierung<br />
Nach aktuellem EU-Recht wird zum 1. Januar 2010 die elektronische<br />
Kennzeichnung bei Schafen <strong>und</strong> Ziegen eingeführt.<br />
Auch wenn davon gr<strong>und</strong>sätzlich Schlachtschafe <strong>und</strong> damit<br />
Schafe in einem Alter unter einem Jahr ausgeschlossen sind,<br />
müssen im B<strong>und</strong>esgebiet über 1,6 Millionen Schafe zukünftig<br />
mittels dieser aufwändigen <strong>und</strong> kostenintensiven Methode gekennzeichnet<br />
werden. In keiner anderen landwirtschaftlichen<br />
Nutztierhaltung ist diese Kennzeichnungsform verpflichtend<br />
vorgeschrieben.<br />
DBV-Position<br />
Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes, der Vereinigung<br />
Deutscher Landesschafzuchtverbände sowie des B<strong>und</strong>esverbandes<br />
Deutscher Ziegenzüchter bedarf diese EU-Beschlussfassung<br />
einer gr<strong>und</strong>sätzlichen Überarbeitung. Das beschlossene<br />
Verfahren stellt keine Verbesserung des Verbraucherschutzes<br />
<strong>und</strong> der Bekämpfung von Tierseuchen dar. Vielmehr reicht<br />
das bis vor wenigen Jahren angewandte <strong>und</strong> in der Schweinehaltung<br />
nach wie vor praktizierte Verfahren der Bestandskennzeichnung<br />
vollkommen aus. In jedem Falle ist die B<strong>und</strong>esregierung<br />
aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die<br />
elektronische Kennzeichnung nicht verpflichtend eingeführt<br />
wird, zumal ein vom BMELV geförderter Feldversuch die elektronische<br />
Kennzeichnung noch auf ihre Praktikabilität <strong>und</strong><br />
Schwachstellen – auch unter tierschutzrechtlichen Aspekten<br />
– prüft.<br />
47<br />
Tierproduktion
Umsetzung der GAP-Reform<br />
Die aus Sicht der Schafwirtschaft bislang unerwünschte<br />
GAP-Reform – weg von der Tier- hin zu der Flächenprämie<br />
– findet b<strong>und</strong>esweit zunehmende Akzeptanz, wenngleich<br />
Rückzahlungsforderungen in einigen B<strong>und</strong>esländern durch<br />
Aberkennung von förderfähigen Flächen sowie Cross Compliance-Kontrollen<br />
zu erheblichen Unmutsäußerungen führen.<br />
DBV-Position<br />
Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes sowie der Vereinigung<br />
Deutscher Landesschafzuchtverbände muss gewährleistet<br />
werden, dass es gr<strong>und</strong>sätzlich zu keiner Aberkennung von Zahlungsansprüchen<br />
für bewilligte Flächen kommt. Ferner müssen<br />
die Bagatellgrenzen bei Cross Compliance-Kontrollen so korrigiert<br />
werden, dass ein Prozentsatz von verlorengegangenen<br />
Ohrmarken von mindestens 10 Prozent vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
des Einsatzes der Schaf- <strong>und</strong> Ziegenhaltung in der Landschaftspflege<br />
als durchaus vertretbar bewertet wird <strong>und</strong> es damit nicht<br />
zu Zahlungskürzungen bzw. Rückforderungen kommt.<br />
Pferde<br />
Die Pferdehaltung ist ein wichtiger Bestandteil der landwirtschaftlichen<br />
Tierhaltung. So beläuft sich der Pferdezuchtbestand<br />
auf etwa 110.000 Stuten <strong>und</strong> 9.000 Hengste. Insgesamt<br />
gibt es etwa eine Million Pferde, was einer Verdreifachung<br />
in den letzten 40 Jahren entspricht. Mehr als 10.000 Firmen,<br />
Handwerksbetriebe <strong>und</strong> Dienstleistungsunternehmen in<br />
Deutschland haben direkt oder indirekt das Pferd als Hauptgeschäftsgegenstand.<br />
R<strong>und</strong> 1,24 Millionen Menschen betreiben<br />
regelmäßig Pferdesport.<br />
DBV-Arbeitskreis „Pferdewirtschaft“ eingerichtet<br />
Zur Betreuung der anstehenden Themen r<strong>und</strong> um die Pferdezucht<br />
<strong>und</strong> -haltung wurde in Abstimmung mit den DBV-Mitgliedsverbänden<br />
Anfang <strong>2009</strong> ein DBV-Arbeitskreis „Pferdewirtschaft“<br />
ins Leben gerufen, der zukünftig einmal je Quartal<br />
48
im Rahmen einer Telefonkonferenz oder Arbeitssitzung tagen<br />
<strong>und</strong> somit aktuelle Themen r<strong>und</strong> um die Pferdehaltung behandeln<br />
wird. Besonderes Augenmerk wird aktuell auf die inhaltliche<br />
Begleitung des vom BMELV unterbreiteten Entwurfs<br />
zu den Leitlinien zur Pferdehaltung gelegt. Weitere Themen<br />
sind Fragen r<strong>und</strong> um die Pensionspferdehaltung, insbesondere<br />
rechtliche Belange im Zusammenhang mit Einstellungsverträgen<br />
sowie umsatzsteuerliche Aspekte.<br />
Imkerei<br />
Im Frühjahr <strong>2008</strong> wurden hohe Bienenvölkerverluste – im<br />
Durchschnitt von 30 Prozent – verzeichnet, die deutliche regionale,<br />
aber auch kleinräumliche Unterschiede aufwiesen. Als<br />
Ursache musste erneut die Varroa festgestellt werden. Andere<br />
Ursachen hatte das Bienensterben im Februar <strong>2008</strong> in Baden<br />
<strong>und</strong> Niederbayern durch giftige Staubabdrift von mit Clothianidin<br />
mangelhaft gebeizten Maissaatgutpartien. Seit dem<br />
15.05.<strong>2008</strong> ruht seither die Zulassung von Maissaatgutbehandlungsmitteln<br />
mit dem Wirkstoff Clothianidin.<br />
Im April wurden die Ergebnisse der AG Toleranzzucht Vertretern<br />
des BMELV, der zuständigen Landesministerien, Mitgliedern<br />
des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft <strong>und</strong> Verbraucherschutz<br />
<strong>und</strong> Pressevertretern vorgestellt <strong>und</strong> erläutert,<br />
wie die Zuchtarbeit im Kampf gegen die Varroa <strong>und</strong> die daraus<br />
resultierenden Völkerverluste fortgesetzt werden soll.<br />
Seit fünf Jahren besteht im Rahmen des R<strong>und</strong>en Tisches<br />
„Imker-Landwirtschaft-Industrie“ das weltweit einzigartige<br />
b<strong>und</strong>esweite Deutsche Bienenmonitoring-Projekt (DeBiMo)<br />
„Völkerverluste“, an dem sich u. a. neun deutsche bienenwissenschaftliche<br />
Institute <strong>und</strong> 123 Imker beteiligen. Eine Fortführung<br />
des Monitorings über <strong>2008</strong> hinaus wurde von allen<br />
Beteiligten als bedeutend angesehen, wobei eine Finanzierung<br />
durch das BMELV angestrebt wird.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband fordert im Gentechnikrecht<br />
eindeutige <strong>und</strong> klare Regelungen zur Haftung, zur Kennzeich-<br />
nung „Ohne Gentechnik" <strong>und</strong> die Untersuchungspflicht für<br />
Honig.<br />
• Um negative Auswirkungen von Wirkstoffen in Saatgutbeizen<br />
auf Bienen auszuschließen bzw. zu minimieren, ist<br />
sicheres <strong>und</strong> ordnungsgemäß gebeiztes Saatgut einschließ-<br />
lich einer Ausbringungstechnik, die Staubabdrift vermeidet,<br />
erforderlich.<br />
49<br />
Tierproduktion
Milch<br />
Markt- <strong>und</strong> Preisentwicklung<br />
Die Milchauszahlungspreise haben sich <strong>2008</strong> fast spiegelbildlich<br />
zum jahreszeitlichen Verlauf in 2007 entwickelt. Die Auszahlungspreise<br />
waren Anfang <strong>2008</strong> noch auf ähnlichem Niveau<br />
wie in den letzten Monaten des Jahres 2007, sind dann aber<br />
von Monat zu Monat gesunken. Im Durchschnitt des Jahres<br />
<strong>2008</strong> betrugen die Milchpreise in Deutschland etwa 33,5 Cent<br />
je Kilogramm (3,7 Prozent Fett, 3,4 Prozent Eiweiß) <strong>und</strong> erreichten<br />
damit das Niveau des Vorjahres. Der starke Rückgang<br />
der Verbraucherpreise für Butter, Magermilchpulver <strong>und</strong> Käse<br />
hat dann auch den Erzeugerpreis deutlich unter Druck gesetzt<br />
<strong>und</strong> zu dramatischen Erzeugerpreissenkungen geführt. Diese<br />
äußert angespannte Marktlage ist vor allem durch den deutlichen<br />
Rückgang des Binnenkonsums, durch ausbleibende Impulse<br />
aus dem Export sowie durch ungünstige Währungskonstellationen<br />
zum US-Dollar <strong>und</strong> osteuropäischen Währungen<br />
gekennzeichnet. Durch den Milchstreik <strong>und</strong> die Blockaden<br />
von Molkereien konnten etwa 250 Millionen Kilogramm Milch<br />
nicht angeliefert werden, was einen Umsatzverlust für die<br />
Milcherzeuger von etwa 100 Millionen Euro bedeutet. Trotz einer<br />
zeitlich beschränkten Anhebung der H-Milch-Preise – die<br />
maßgeblich durch Mitwirkung des Deutschen Bauernverbandes<br />
zustande kam – hat der Milchstreik die Marktgegebenheiten<br />
nicht verändert. Vielmehr haben die Verbraucher mit Kaufzurückhaltung<br />
<strong>und</strong> die Industrie mit einer Veränderung der Rezepturen<br />
reagiert. Weitaus dramatischer waren aber die teilweise<br />
verheerenden sozialen <strong>und</strong> menschlichen Auswirkungen<br />
des Milchstreiks in den Regionen, Dörfern <strong>und</strong> in den bäuerlichen<br />
Familien.<br />
Zur Stabilisierung der Märkte hatte der Deutsche Bauernverband<br />
zur Internationalen Grünen Woche <strong>2009</strong> Entlastungsmaßnahmen<br />
in Form von befristeten Exporterstattungen <strong>und</strong><br />
der Öffnung der Intervention gefordert. Die EU-Kommission<br />
hat auf diese Forderungen schnell reagiert <strong>und</strong> die Exporterstattungen<br />
für Milchprodukte (u. a. Butter, Käse, Mager- <strong>und</strong><br />
Vollmilchpulver) wieder aufgenommen <strong>und</strong> die Intervention<br />
von Magermilchpulver <strong>und</strong> Butter auch über ihre Höchstgrenzen<br />
der Einlagerung (Magermilchpulver 109.000 Tonnen, Butter<br />
30.000 Tonnen) ausgedehnt.<br />
Milchgipfel<br />
Am 29. Juli <strong>2008</strong> fand auf Einladung von B<strong>und</strong>esminister Horst<br />
Seehofer der sogenannte Milchgipfel statt. Es nahmen r<strong>und</strong><br />
60 Vertreter aus dem BMELV, den Agrarministerien der Länder,<br />
50
der Landwirtschaft, den Molkereien sowie des Handels teil.<br />
Der ehemalige B<strong>und</strong>esminister Seehofer forderte die EU-Kommission,<br />
den B<strong>und</strong> <strong>und</strong> die Länder sowie die Molkereien <strong>und</strong><br />
den Lebensmitteleinzelhandel auf, sich für die Sicherung einer<br />
leistungsfähigen Milchwirtschaft in Deutschland einzusetzen.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband hat auf dem Milchgipfel für<br />
die Milcherzeuger ein langfristig angelegtes Begleitpro-<br />
gramm gefordert, um Standortnachteile in den Mittelge-<br />
birgs- <strong>und</strong> Grünlandregionen auszugleichen, gesellschaft-<br />
liche Leistungen der Milchproduktion dauerhaft abzugelten<br />
<strong>und</strong> regionale Besonderheiten in den B<strong>und</strong>esländern durch<br />
spezifische Lösungsansätze aufzufangen. Im Einzelnen ging<br />
es um lang angelegte Förderelemente, welche unmittelbar<br />
die Rinder- bzw. Milchviehhaltung an schwierigen Standor-<br />
ten stabilisieren <strong>und</strong> Standortnachteile ausgleichen.<br />
• Die Finanzierung der Begleitmaßnahmen muss über die Einrichtung<br />
eines EU-Milchfonds erfolgen, der sich aus nicht<br />
verausgabten EU-Mitteln speist.<br />
• Investitionswillige Landwirte müssen an der zeitnahen Investitionsförderung<br />
für die Milchviehhaltung teilhaben können.<br />
• Ein wichtiger Punkt im Forderungskatalog des Deutschen<br />
Bauernverbandes ist der Abbau der deutlichen Strukturde-<br />
fizite in der deutschen Molkereiwirtschaft. Daher unterstützt<br />
der Deutsche Bauernverband die engere Zusammenarbeit<br />
der Molkereien in Teilbereichen, aber auch stärkere Ko-<br />
operationen bis hin zu Fusionen. Der weitere Ausbau von<br />
Milcherzeugergemeinschaften als Geschäftspartner der<br />
privaten Molkereiwirtschaft bietet Chancen, sich aktiv an<br />
der Marktgestaltung zu beteiligen.<br />
• Es gilt, Absatzförderungsmaßnahmen sowohl für den Binnenkonsum<br />
als auch für Drittlandsmärkte anzuschieben.<br />
Änderung der nationalen Rechtsetzung im Milchbereich<br />
Der B<strong>und</strong>esrat hat sich am 7. November <strong>2008</strong> mit Vorschlägen<br />
zur Änderung der nationalen Gesetzgebung im Milchbereich<br />
befasst: Abschaffung der Molkereisaldierung, Änderung des<br />
Umrechnungsfaktors, Verteilung der zweiprozentigen Quotenerhöhung.<br />
Vorangegangen waren intensive Diskussionen<br />
zur Einschränkung der Milchanlieferung in Deutschland. Der<br />
B<strong>und</strong>esrat hat mit der Begründung, dass einseitige nationale<br />
Mengeneinschränkungen keine nachhaltigen Erzeugerpreissteigerungen<br />
erwarten lassen <strong>und</strong> im Binnen- <strong>und</strong> Weltmarkt<br />
verpuffen würden, Änderungen abgelehnt. Im Vorfeld der Entscheidungen<br />
hat sich der Deutsche Bauernverband vehement<br />
51<br />
Tierproduktion
gegen eine EU-weite Quotenerhöhung gewandt. Da diese Quotenerhöhung<br />
letztendlich aber gegen Deutschland beschlossen<br />
wurde, hat sich der Deutsche Bauernverband für eine lineare<br />
Verteilung an alle aktiven Milcherzeuger ausgesprochen.<br />
Health Check<br />
Der EU-Agrarministerrat hat am 20.11.<strong>2008</strong> eine politische<br />
Einigung zur Überprüfung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik<br />
– Health Check – getroffen. Die Beschlüsse sind aus der<br />
Sicht des Deutschen Bauernverbandes nicht zufriedenstellend.<br />
Für den Milchbereich ergaben sich folgende Änderungen:<br />
• Die Milchquote wird um fünfmal ein Prozent in den Jahren<br />
<strong>2009</strong> bis 2013 erhöht. Bis zur letzten Verhandlungsst<strong>und</strong>e<br />
haben viele Mitgliedstaaten versucht, eine höhere Quo-<br />
tenanhebung durchzusetzen. Italien bekommt die volle Quo-<br />
tenerhöhung (5 Prozent) bereits zum 01.04.<strong>2009</strong> zugeteilt.<br />
• Des Weiteren wird der Fettkorrekturfaktor von 0,18 auf 0,09<br />
verändert, wenn der tatsächliche Fettgehalt über dem Refe-<br />
renzfettgehalt liegt. Die Veränderung der Fettkorrektur<br />
bedeutet für die meisten Mitgliedstaaten eine direkte Erhö-<br />
hung der Milchliefermengen.<br />
• Positiv zu bewerten ist, dass die private Lagerhaltung für<br />
Butter <strong>und</strong> die Interventionsverfahren für Butter <strong>und</strong> Ma-<br />
germilchpulver erhalten bleiben.<br />
• Zur Bewertung der Marktsituation muss die EU-Kommission<br />
zwei Marktberichte (2010 <strong>und</strong> 2012) vorlegen. Auf dieser<br />
Gr<strong>und</strong>lage sollen dann weitere Entscheidungen zum<br />
„sanften“ Quotenausstieg diskutiert werden.<br />
• Ein deutlicher Affront gegen alle Bauern ist die weitere<br />
Kürzung der Direktzahlungen durch die Anhebung der<br />
Modulation.<br />
Begleitmaßnahmen Milch<br />
Allerdings ist es der deutschen Delegation in der Schlussphase<br />
der Verhandlungen zum Health Check gelungen, die durch die<br />
Modulation gekürzten Mittel wieder zurück in die Landwirtschaft,<br />
speziell in die Milchproduktion, zu lenken. So wurden<br />
die „neuen Herausforderungen“ um die Begleitmaßnahmen<br />
Milch erweitert. Diese Mittel stehen aber erst ab 2010 für<br />
die Verwendung zur Verfügung. Zusätzlich kann Deutschland<br />
knapp 90 Millionen Euro aus dem EU-Konjunkturprogramm<br />
u. a. für Milchbegleitmaßnahmen einsetzen. Der Deutsche Bauernverband<br />
drängt auf eine zügige Umsetzung noch in <strong>2009</strong>.<br />
Wegfall Quotennachweis<br />
Die vom Deutschen Bauernverband geforderte Aufhebung der<br />
52
Quotenbindung im Agrarinvestitionsförderprogramm wurde<br />
im Health Check beschlossen. Mit Blick auf das Auslaufen der<br />
Milchquote in 2015 ist das eine Erleichterung für Milchviehbetriebe,<br />
die dringend notwendig ist. Der Nachweis ist rückwirkend<br />
für Anträge, die ab 1. Januar 2007 gestellt wurden, nicht<br />
mehr zu erbringen.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband hat die fünfmal einprozentige<br />
Quotenerhöhung im Rahmen des Health Checks strikt abge-<br />
lehnt. Da die im Rahmen des Health Checks erfolgte Quoten-<br />
erhöhung aber nicht mehr rückgängig gemacht werden<br />
kann, sollte eine lineare Verteilung an die aktiven Milcher-<br />
zeuger erfolgen.<br />
• Die Erhöhung der Modulation <strong>und</strong> die Einführung der<br />
Degression hatte der Deutsche Bauernverband hartnäckig<br />
abgelehnt. Obwohl die Kommissionsvorschläge für die Mo-<br />
dulation <strong>und</strong> Degression durch massives Einwirken des Deut-<br />
schen Bauernverbandes deutlich abgemildert werden konn-<br />
ten, bleibt der EU-Beschluss ein Ärgernis.<br />
• Der Deutsche Bauernverband hat sich mit seinen Forderungen<br />
nach einem Milchbegleitprogramm (EU-Milchfonds)<br />
durchsetzen können. Im Rahmen der neuen Herausforde-<br />
rungen besteht nun die Möglichkeit, die zusätzlichen Mittel<br />
aus der Modulation <strong>und</strong> der Degression wieder in die Land-<br />
wirtschaft, speziell in die Milchproduktion, zurückzuführen.<br />
• Bei der Umsetzung der Milchbegleitmaßnahmen über die<br />
aufgestockte Gemeinschaftsaufgabe (GAK) spricht sich der<br />
Deutsche Bauernverband für die Anhebung der Fördersätze<br />
in der investiven Förderung sowie die verlässliche Honorie-<br />
rung der Rinder- <strong>und</strong> Milchviehhaltung an Mittelgebirgs-<br />
<strong>und</strong> Grünlandstandorten aus. Aber auch die Förderung von<br />
Siloplatten <strong>und</strong> Güllelagern sollte möglich gemacht werden.<br />
• Mit den Beschlüssen des Health Checks zieht sich die EU-<br />
Kommission zunehmend aus der Verwaltung des Milch-<br />
marktes zurück. Eine konsequente <strong>und</strong> tiefgreifende Re-<br />
form der Molkereiwirtschaft <strong>und</strong> der Vermarktungsstruk-<br />
turen in Deutschland ist zur langfristigen Sicherung der<br />
Einkommen der Milchbauern unbedingt notwendig.<br />
• Die Molkereien müssen ihre Marktposition <strong>und</strong> Wertschöpfung<br />
erhöhen, um gegenüber marktbeherrschenden Handels-<br />
unternehmen im Binnenmarkt <strong>und</strong> den Herausforderungen<br />
des sich international weiterentwickelnden Marktes beste-<br />
hen zu können.<br />
• Um die Marktpotenziale im Sinne der Milcherzeuger zu nutzen,<br />
fordert der Deutsche Bauernverband die engere Zusam-<br />
53<br />
Tierproduktion
menarbeit der Molkereien, insbesondere im Ein- <strong>und</strong> Ver-<br />
kauf, aber auch stärkere Kooperationen bis hin zu Fusionen.<br />
• Da die zukünftige Marktverantwortung mehr auf den Schultern<br />
der Molkereien <strong>und</strong> Milcherzeuger lastet, wird eine<br />
engere Zusammenarbeit über Mengen <strong>und</strong> Preise dringend<br />
erforderlich. Der Deutsche Bauernverband erarbeitet mit<br />
den Milcherzeugern konkrete Lösungsmöglichkeiten.<br />
DBV-Milchkonferenzen<br />
Von April <strong>2008</strong> bis Januar <strong>2009</strong> hat der Deutsche Bauernverband<br />
vier große Milchveranstaltungen in Berlin durchgeführt.<br />
Mit mehr als 400 Milchbauern hat der Deutsche Bauernverband<br />
am 17. April <strong>2008</strong> vor dem Brandenburger Tor eindrucksvoll<br />
gegen das Preisdiktat des Handels demonstriert. Durchgeführt<br />
wurde die Aktion im Rahmen des DBV-Netzwerkes Milch – Vollversammlung<br />
der Fachausschüsse Milch der LBV – welches zum<br />
zweiten Mal in Berlin tagte.<br />
Unter dem Motto „Milchmarkt <strong>2008</strong> – was bringt die Zukunft!“<br />
diskutierten r<strong>und</strong> 250 Milcherzeuger aus ganz Deutschland<br />
anlässlich des Deutschen Bauerntages am 30. Juni <strong>2008</strong><br />
in Berlin. Die Milcherzeuger ließen keinen Zweifel daran, dass<br />
sie zur Bamberger Milcherklärung vom Bauerntag 2007 stehen.<br />
Am 3. Dezember <strong>2008</strong> traf sich das DBV-Netzwerk Milch erneut.<br />
Die Ergebnisse des Health Checks <strong>und</strong> die zukünftige Zusammenarbeit<br />
zwischen Erzeugern <strong>und</strong> Molkereien standen im<br />
Vordergr<strong>und</strong> der Diskussionen.<br />
Zukunftsorientiert präsentierten sich r<strong>und</strong> 700 Milcherzeuger<br />
auf dem Milch- <strong>und</strong> Junglandwirtekongress des Deutschen<br />
Bauernverbandes <strong>und</strong> des B<strong>und</strong>es der Deutschen Landjugend<br />
am 19. Januar <strong>2009</strong> im Rahmen der Internationalen Grünen<br />
Woche. Unter dem Motto „Deine Zukunft ist weiß – als Unternehmer<br />
den Milchmarkt 2015+ gestalten“ verdeutlichten sie<br />
ihre Vorstellungen <strong>und</strong> Überlegungen für eine wettbewerbsfähige<br />
Milchproduktion in Deutschland.<br />
54
Tierges<strong>und</strong>heit<br />
Kombibeleg bei Tierarzneimitteln<br />
Der Deutsche Bauernverband hat in Zusammenarbeit mit den<br />
Landesbauernverbänden den sogenannten Kombibeleg entwickelt.<br />
Damit wurden die Dokumentationspflichten beim Einsatz<br />
von Tierarzneimitteln durch den Tierhalter erheblich vereinfacht.<br />
Das Abschreiben der bereits vom Tierarzt gemachten<br />
Angaben gehört damit der Vergangenheit an.<br />
Orale Verabreichung von Tierarzneimitteln<br />
B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder wollen mit dem Berufsstand den sicheren Einsatz<br />
der zunehmend verabreichten Fertigarzneimittel über Trog<br />
<strong>und</strong> Tränke gewährleisten <strong>und</strong> erarbeiten einen Leitfaden dafür.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband setzt sich für praxisorientierte<br />
Empfehlungen ein <strong>und</strong> verweist darauf, dass über 99 Prozent<br />
der tierischen Lebensmittel nachweislich die strengen Rückstandshöchstmengen<br />
einhalten.<br />
EU-Tierges<strong>und</strong>heitsstrategie<br />
Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan zur Tierges<strong>und</strong>heitsstrategie<br />
2007-2013 vorgelegt. Darin sind vier Säulen unter<br />
dem Motto „Vorbeugen ist besser als Heilen“ formuliert.<br />
Ein einheitlicher Rahmen für die Gesetzgebung, Verbesserung<br />
der Biosicherheitsmaßnahmen <strong>und</strong> eine Beteiligung der Landwirte<br />
an den Kosten von Tierseuchen bilden Schwerpunkte des<br />
Aktionsplans.<br />
DBV-Position<br />
Im Rahmen der Tierges<strong>und</strong>heitsstrategie fordert der Deutsche<br />
Bauernverband, dass<br />
• die Biosicherheitsmaßnahmen an den Grenzen erhöht werden,<br />
damit die Tierbestände besser geschützt werden.<br />
• die eigenen Maßnahmen der Betriebe im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen<br />
anerkannt werden.<br />
• das Impfen bei der Bekämpfung von Tierseuchen eine wichtige<br />
Rolle einnehmen soll,<br />
• die EU das System der Tierseuchenkassen als sinnvollen Ansatz<br />
der geforderten Selbstbeteiligung anerkennt.<br />
Blauzungenkrankheit<br />
Die Blauzungenkrankheit (BTV) trat im Jahr 2006 erstmalig in<br />
Deutschland auf <strong>und</strong> hat besonders in 2007 große Schäden in<br />
Rinder-, Schaf- <strong>und</strong> Ziegenbeständen verursacht.<br />
55<br />
Tierproduktion
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband hat sich dafür eingesetzt, dass<br />
alle Halter von empfänglichen Tieren diese mit Impfstoffen<br />
gegen BTV8 schützen können.<br />
• Auch eine Notreserve an Impfstoffen für den bereits in Frankreich<br />
stark verbreiteten BTV1 ist auf Drängen des Deutschen<br />
Bauernverbandes angelegt worden.<br />
• Der Deutsche Bauernverband hat die EU-Kommission aufgefordert,<br />
eine gemeinsame Impfstoffbank mit Impfstoffen<br />
gegen verschiedene Serotypen anzulegen.<br />
• Der Deutsche Bauernverband konnte gemeinsam mit COPA<br />
erreichen, dass sich die EU im Jahr <strong>2008</strong> finanziell an der<br />
Bekämpfung der Blauzungenkrankheit beteiligt <strong>und</strong> für die-<br />
ses Jahr eine Aufstockung der Finanzmittel um 100 Millio-<br />
nen Euro angekündigt hat. Für die Zukunft erscheint die<br />
Impfung durch die Landwirte selbst durchaus realistisch <strong>und</strong><br />
sinnvoll.<br />
BSE<br />
Der Deutsche Bauernverband hat eine Anhebung des BSE-<br />
Testalters gefordert <strong>und</strong> erreicht, dass ab 1. Januar <strong>2009</strong> nur<br />
noch Rinder im Alter von mehr als 48 Monaten getestet werden.<br />
BVD-Verordnung<br />
B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Länder planten seit Jahren die Einführung einer verpflichtenden<br />
Bekämpfung der Bovinen Virus-Diarrhoe. Ende<br />
<strong>2008</strong> wurde die Verordnung im B<strong>und</strong>esrat beschlossen. Der Beginn<br />
der Bekämpfung wurde auf 2011 verschoben.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband konnte eine zweijährige Verschiebung<br />
zur Bekämpfung der Bovinen Virus-Diarrhoe (BVD)<br />
erreichen, da die Rinder haltenden Betriebe bereits durch die<br />
Blauzungen-Bekämpfung finanziell enorm belastet sind. Die<br />
Suche nach persistent infizierten Tieren <strong>und</strong> deren Ausmerzung<br />
auf freiwilliger Basis wird den Betrieben in der Zwischenzeit<br />
empfohlen.<br />
Schweinepestbekämpfung<br />
Zukünftig sollen weniger ges<strong>und</strong>e Tiere in Folge eines Schweinepest-Ausbruchs<br />
getötet werden müssen, indem nachweislich<br />
virusfreie Tiere aus Betrieben in den Restriktionsgebieten<br />
möglichst rasch wieder vermarktet werden dürfen. Die Agrarminister<br />
der Länder unterstützen deshalb das Freitesten nach<br />
einem Schweinepestfall. Dies ist ein Erfolg des Deutschen<br />
56
Bauernverbandes, der diese Forderung immer wieder eingebracht<br />
hat.<br />
DBV-Position<br />
Der nächste Schritt sollte sein, dass insbesondere in den Veredlungsgebieten<br />
geeignete Impfstoffe sinnvoll <strong>und</strong> ohne unnötige<br />
Handelsrestriktionen eingesetzt werden können.<br />
Tierzuchtrecht<br />
Gegen den Widerstand des Deutschen Bauernverbandes sowie<br />
der meisten deutschen Tierzuchtverbände wurde eine Reform<br />
des Tierzuchtgesetzes gemeinsam von B<strong>und</strong>estag <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esrat<br />
beschlossen, die einen Rückzug des Staates aus der Tierzucht<br />
ab 2013 vorsieht. Die Fortsetzung der Förderung ist auf<br />
freiwilliger Basis weiter möglich. Diese Reform ging deutlich<br />
über die Erfordernisse aus der Angleichung an EU-Recht hinaus.<br />
Damit besteht die Gefahr, dass sich die für die Tierzucht<br />
zuständigen Landesministerien aus der Tierzucht als Basis für<br />
die Gewinnung von ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> vitalen landwirtschaftlichen<br />
Nutztieren zurückziehen. Ferner ist zu befürchten, dass zukünftig<br />
ausschließlich leistungsstarke Tierarten <strong>und</strong> -rassen<br />
überleben werden <strong>und</strong> es zu entsprechenden tiergenetischen<br />
Verarmungen kommen wird.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband fordert gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft<br />
Deutscher Tierzüchter, dass die B<strong>und</strong>esländer<br />
weiterhin von der fakultativen Möglichkeit der hoheitlichen<br />
Durchführung bzw. Unterstützung der Tierzucht sowie<br />
deren Leistungsprüfung Gebrauch machen bzw. bei der Neuentwicklung<br />
von schlagkräftigen Tierzuchtorganisationen hilfreich<br />
zur Seite stehen.<br />
57<br />
Tierproduktion
Pflanzenproduktion
Getreide<br />
Dass die Getreidemärkte „funktionieren“, mussten die Getreideerzeuger<br />
im Berichtsjahr mit aller Konsequenz erfahren.<br />
Kannten die Kurse zu Beginn des Jahres <strong>2008</strong> nur den Weg<br />
nach oben, sind sie seit März geradezu implodiert. Die zweite<br />
Jahreshälfte ist geprägt von Ernüchterung <strong>und</strong> Resignation.<br />
Ausgezeichnete Witterungs- <strong>und</strong> Wachstumsbedingungen hatten<br />
in vielen wichtigen Erzeugerländern der Welt überdurchschnittliche<br />
Erträge für Getreide- <strong>und</strong> Ölsaaten zur Folge.<br />
Gleichzeitig wurde die Anbaufläche für Getreide um weltweit<br />
drei Prozent ausgedehnt, nachdem von steigenden Preisen im<br />
Vorjahr entsprechende Signale ausgegangen waren. Eine sehr<br />
hohe deutsche Ernte traf mit der Rekordernte in Europa <strong>und</strong><br />
der Welt zusammen. Auch augenblicklich sind keine Tendenzen<br />
einer kurzfristigen Erholung der Preise zu erkennen, da mit gut<br />
gefüllten Lägern in das neue Getreidewirtschaftsjahr gestartet<br />
wird.<br />
Teller oder Tank<br />
Angesichts der engen Versorgungssituation aufgr<strong>und</strong> der<br />
schwachen Vorjahresernte mit immer neuen Höchstständen<br />
der Getreidekurse, wurde sehr schnell die Verwendung von<br />
Biomasse für Bioenergie als Auslöser für diese Entwicklung<br />
verantwortlich gemacht. Die Diskussionen „Teller oder Tank“<br />
wurden vielerorts mit Emotionen statt mit Sachkenntnis geführt.<br />
Der Deutsche Bauernverband hat in vielen Beiträgen<br />
<strong>und</strong> politischen Diskussionen klargestellt, dass die temporär<br />
enge Versorgungslage Auslöser für die hohen Preise sei. Der<br />
Verbrauch von Getreide zur bioenergetischen Verwendung ist<br />
mit 5,1 Prozent des erzeugten Getreides nach wie vor gering.<br />
Unmissverständlich machte der Deutsche Bauernverband auch<br />
deutlich, dass die primäre Aufgabe der Landwirtschaft die<br />
Erzeugung qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel bleibt.<br />
Mit den ersten Prognosen internationaler Institutionen zur<br />
Getreideernte <strong>2008</strong> änderte sich jedoch das Bild. Schon im<br />
März wurden Rekordernten von Weizen prognostiziert. Die<br />
Institutionen verwiesen auf die weltweite Ausdehnung der<br />
Anbaufläche einerseits sowie auf die deutliche Erhöhung der<br />
Produktionsintensitäten. In Europa wuchs die Anbaufläche von<br />
Getreide gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Millionen Hektar auf<br />
60,43 Millionen Hektar. Auch Deutschlands Erzeuger hatten<br />
nach dem Aussetzen der Flächenstilllegung die Anbaufläche<br />
von Getreide um 470.000 Hektar erhöht. Die hohen Getreidepreise<br />
des vergangenen Jahres hatten somit ihre Wirkung<br />
auf das Angebotsverhalten der Landwirte nicht verfehlt. In der<br />
59<br />
Pflanzenproduktion
EU27 wurden angesichts guter Witterungs- <strong>und</strong> Wachstumsbedingungen<br />
mit fast 312 Millionen Tonnen Getreide annähernd<br />
50 Millionen Tonnen Getreide mehr als im Vorjahr geerntet.<br />
Trotz zunächst skeptischer Prognosen für das im Juni von Trockenheit<br />
gebeutelte Nordosteuropa wuchsen die Erträge mit<br />
jedem Druschtag. In Deutschland wurde mit 50 Millionen Tonnen<br />
Getreide fast das Rekordergebnis der Getreideernte 2004<br />
erzielt. Weltweit wurden die Vorjahresergebnisse mit über 684<br />
Millionen Tonnen Weizen um fast 75 Millionen Tonnen übertroffen.<br />
Die Endbestände konnten bei Weizen um mehr als 25<br />
Millionen Tonnen wieder aufgefüllt werden.<br />
Der Verbrauch geht zurück<br />
Im gleichen Zeitraum ist die Nachfrage nach Weizen weltweit<br />
um mehr als 30 Millionen Tonnen angestiegen, diese Zahl erfuhr<br />
jedoch regelmäßige Korrekturen nach unten. Denn insbesondere<br />
die Zahlen zum Verbrauch zu Fütterungszwecken<br />
mussten wiederholt reduziert werden. Die weltweite Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Finanzkrise hat das Wachstum der aufstrebenden<br />
Nationen in Asien deutlich gebremst. Doch gerade für diese<br />
Länder war ein stetig steigender Verbrauch von Getreide zum<br />
Zwecke der Verfütterung prognostiziert worden, der nun in der<br />
Form ausblieb. Dennoch wird langfristig der Trend zu steigendem<br />
Verbrauch anhalten.<br />
Betriebsmittelkosten explodieren<br />
Die Ausdehnung der Anbauflächen <strong>und</strong> die Steigerung der Anbauintensitäten<br />
hatten jedoch für die Landwirte einen weiteren<br />
bitteren Beigeschmack. Sie ließen die Preise insbesondere<br />
für Düngemittel geradezu explodieren. Eine Verdreifachung<br />
der Preise für Phosphate <strong>und</strong> eine Verdoppelung der Preise<br />
für Kali <strong>und</strong> Stickstoff sorgten bei den Landwirten neben gestiegenen<br />
Energiekosten für deutlich gestiegene Produktionskosten.<br />
Umso größer ist jetzt die Enttäuschung der Praxis: Die<br />
mit hohem Kapitaleinsatz produzierte Ernte <strong>2008</strong> findet nur<br />
noch zu Niedrigstpreisen ihren Weg in den Markt. Erst zum<br />
Jahresende sanken auf den Weltmärkten die Notierungen für<br />
die Düngemittel. Auf dem heimischen Markt hingegen war von<br />
dieser Entspannung noch nicht viel zu erkennen, so dass die<br />
Landwirte beim Einkauf von Düngemitteln noch deutliche Zurückhaltung<br />
üben.<br />
Intervention wird bedient<br />
Zum Jahresende verzeichnete auch die zeitweilig für überflüssig<br />
gehaltene Getreideintervention wieder Andienungen. Mittlerweile<br />
ist das Kontingent für Mais annähernd ausgeschöpft.<br />
60
Der Blick nach vorn<br />
Mit Spannung werden deshalb die ersten Prognosen zur Ernte<br />
<strong>2009</strong> erwartet. Bestätigen sich die Trends einer auch durch<br />
Bioenergie forcierten steigenden Nachfrage einerseits <strong>und</strong> einer<br />
wegen hohen Produktionskosten reduzierten pflanzlichen<br />
Produktion andererseits, könnten die Preise wieder steigen.<br />
Kommt es witterungsbedingt zu Ernteausfällen, könnte der<br />
Preisanstieg sehr deutlich ausfallen.<br />
DBV-Position<br />
• Das vergangene Jahr hat deutlich gezeigt, dass sich die<br />
Erzeuger nicht nur kontinuierlich mit den Produktmärkten,<br />
sondern auch mit den Märkten für Betriebsmittel befassen<br />
müssen. Der Deutsche Bauernverband liefert mit der regelmä-<br />
ßig erscheinenden Marktinformation Ackerbau eine Orien-<br />
tierungshilfe über die Geschehnisse auf den Märkten.<br />
• Um der Praxis auch weiterhin regelmäßig Informationen<br />
über die eng verflochtenen internationalen Märkte bereit-<br />
stellen zu können, setzt sich der Deutsche Bauernverband<br />
für eine f<strong>und</strong>ierte Marktberichterstattung auch nach dem<br />
Wegfall der ZMP ein. Dazu gehört auch, dass die Märkte für<br />
Betriebsmittel Berücksichtigung finden.<br />
Saatgut<br />
Die enorme Getreideernte des Jahres <strong>2008</strong> mit ihren guten bis<br />
sehr guten Qualitäten hat in Verbindung mit den niedrigen Erzeugerpreisen<br />
den Saatgutwechsel wieder sinken lassen. Nach<br />
54 Prozent in den Vorjahren ist jetzt mit einem Saatgutwechsel<br />
von nur noch 50 Prozent zu rechnen. Damit reagierten die<br />
Landwirte auch auf die drastisch gestiegenen Saatgutpreise im<br />
Vorjahr, deren Steigerungsraten über denen von Konsumware<br />
lagen.<br />
Die gemeinsam vom Deutschen Bauernverband <strong>und</strong> dem<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) getragene<br />
Rahmenregelung wurde einseitig seitens des BDP aufgekündigt.<br />
In der Folge entfallen die Vereinbarungen der Rahmenregelung<br />
wie z. B. die Freistellung von der Zahlung der Nachbaugebühr<br />
ab einem Saatgutwechsel von 60 Prozent. Das gesamte<br />
Nachbausaatgut zur Ernte <strong>2009</strong> unterliegt dem gesetzlichen<br />
Verfahren <strong>und</strong> ist komplett kostenpflichtig. Entsprechend der<br />
jüngs-ten Rechtsprechung beträgt die Nachbaugebühr gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
50 Prozent der Z-Lizenz.<br />
Bei der Neuregelung der Erfassung der Nachbaugebühr werden<br />
seitens der Saatgutwirtschaft Gespräche mit dem Handel<br />
61<br />
Pflanzenproduktion
geführt. Danach soll künftig der Verkauf von Z-Saatgut an den<br />
Endverbraucher nur möglich sein, wenn der Handel Namen <strong>und</strong><br />
Anschrift des Käufers gegenüber der Züchtungswirtschaft offenbart.<br />
Gleichzeitig muss der Landwirt die geforderte Transparenz<br />
über die Höhe der Z-Lizenz <strong>und</strong> der daraus resultierenden<br />
Nachbaugebühr bekommen.<br />
DBV-Position<br />
Der Erhalt des Landwirteprivilegs hat für den Deutschen Bauernverband<br />
oberste Priorität. Nach der Kündigung der Rahmenregelung<br />
durch den BDP sieht der Deutsche Bauernverband<br />
die Züchtungswirtschaft in der Pflicht, an neuen Systemen zur<br />
Erfassung der Nachbaugebühr zu arbeiten. Der Deutsche Bauernverband<br />
begleitet die Arbeiten <strong>und</strong> fordert den BDP auf, im<br />
Sinne der Transparenz <strong>und</strong> Nachvollziehbarkeit die Höhe der<br />
Z-Lizenzen <strong>und</strong> der Nachbaugebühr der Sorten offenzulegen.<br />
Zudem wird der Deutsche Bauernverband darauf achten, dass<br />
alle Datenschutzbelange des Berufsstandes ausreichend Berücksichtigung<br />
finden. Gemeinsam mit seinen Landesverbänden<br />
wird der Deutsche Bauernverband die Mitglieder über Umsetzung<br />
<strong>und</strong> konkrete Inhalte des gesetzlichen Verfahrens wie<br />
beispielsweise korrekte Auskunftsvoraussetzungen beraten.<br />
Kartoffeln<br />
Markt<br />
Der Kartoffelanbau <strong>2008</strong> schrumpfte gegenüber dem Vorjahr<br />
um 5,5 Prozent auf 259.800 Hektar. Im Schnitt wurden<br />
deutschlandweit aber mit r<strong>und</strong> 432 Dezitonnen pro Hektar<br />
mehr Kartoffeln geerntet als im Vorjahr (424 Dezitonnen).<br />
Insgesamt lag die Ernte mit 11,259 Millionen Tonnen r<strong>und</strong><br />
400.000 Tonnen unter Vorjahresniveau.<br />
Speisefrühkartoffeln<br />
Das Gesamtareal an Frühkartoffeln schwand um 1.300 Hektar<br />
auf 14.600 Hektar, wobei vor allem der geringere Anbau von<br />
frühem Verarbeitungsrohstoff in Nordrhein-Westfalen zu Buche<br />
schlug. Verspätete Auspflanzungen, aber zeitiger Bedarf<br />
trugen zu einem nicht ganz so hohen Ertragsniveau wie 2007<br />
bei. So blieb dann auch die Ernte mit 462.000 Tonnen deutlich<br />
kleiner als 2007 (514.000 Tonnen). Nach frühzeitiger Räumung<br />
der Lagerware aus 2007 <strong>und</strong> einem nur knappen Angebot<br />
an Frühkartoffeln aus dem südöstlichen Mittelmeerraum<br />
war der Bedarf an Frühkartoffeln im Sommer <strong>2008</strong> frühzeitig<br />
sehr hoch. Dies sorgte von Anfang an für ein überdurchschnitt-<br />
62
lich gutes Preisniveau. Die Statistik weist einen Rückgang der<br />
Speisekartoffelfläche von 96.400 auf 94.300 Hektar aus. Angesichts<br />
der hohen Erträge ging das Preisniveau während der<br />
Haupternte rasch zurück, mit der Vermarktung aus dem Winterlager<br />
konnten aber Aufschläge von bis zu 2 Euro pro Dezitonne<br />
durchgesetzt werden. Positiv für die hiesige Vermarktung fiel<br />
neben dem Export auch der erst nur geringe Wettbewerb mit<br />
Lieferungen aus Frankreich aus. Die Vermehrungsfläche <strong>2008</strong><br />
lag mit 15.885 Hektar „mit Erfolg feldbesichtigt“ erstmals<br />
unter 16.000 Hektar. Frühsommerliche Trockenheit in einigen<br />
Gebieten <strong>und</strong> teils geringer Knollenansatz führten zu nicht<br />
ganz durchschnittlichen Erträgen mit einem höheren Anteil an<br />
Übergrößen.<br />
Das mit Stärke- <strong>und</strong> Veredelungskartoffeln bestückte Areal<br />
fiel <strong>2008</strong> mit 151.600 Hektar deutlich kleiner aus als 2007<br />
(162.700 Hektar). In der Hauptsache ist der Schw<strong>und</strong> auf<br />
Stärkekartoffeln zurückzuführen, deren Fläche von 87.139 auf<br />
78.280 Hektar schrumpfte. Je nach Verwendung fiel die Ernte<br />
vor allem in der Qualität unterschiedlich aus. Die Stärkegehalte<br />
waren meistens hoch, was sowohl den Granulatherstellern<br />
wie auch der Stärkeindustrie zu Gute kam. Für die Chipsherstellung<br />
waren die Qualitäten nicht immer optimal.<br />
DBV-Position<br />
Für den Kartoffelanbau sind dringend Verbesserungen in der<br />
Wertschöpfung erforderlich, um ihn angesichts hoher Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Kapitalintensität sowie durch den konkurrierenden Anbau<br />
mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen auf begrenzter Fläche<br />
wettbewerbsfähig zu erhalten. Deutschland muss wichtigstes<br />
Anbauland für Kartoffeln bleiben. Das Ziel ist es daher, die<br />
Wertschöpfung durch Verbesserungen in der Qualität der Ware<br />
nachhaltig zu sichern <strong>und</strong> zu erhöhen. Den deutschen Landwirten<br />
muss hochwertiges modernes Pflanzgut zu ver-nünftigen<br />
Preisen zur Verfügung gestellt werden. Auch die Vermehrung<br />
muss in Deutschland langfristig tragbar bleiben.<br />
63
Stärkekartoffeln<br />
Die Stärkekartoffelerzeuger produzieren auf einem Drittel<br />
der deutschen Kartoffelfläche den hochwertigen Rohstoff für<br />
Nahrungsmittel, wie auch für industrielle Anwendungen, die<br />
Rohöl, tierisches Protein <strong>und</strong> chemische Zusatzstoffe ersetzen<br />
können. Diese modernen Produkte aus deutscher landwirtschaftlicher<br />
Produktion werden zu einem hohen Anteil exportiert.<br />
Neue Märke <strong>und</strong> Produkte geben der Branche mittel-<br />
fristig Perspektiven.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband begrüßt die verlängerte Übergangszeit,<br />
die im Rahmen des Ges<strong>und</strong>heitschecks der EU-<br />
Agrarpolitik festgelegt wurde, um den Erzeugern Planungssicherheit<br />
zu geben <strong>und</strong> die Stabilisierung der internationalen<br />
Absatzmärkte zu ermöglichen. Er setzt sich weiterhin dafür<br />
ein, dass der Sektor auch bei der Umsetzung der Beschlüsse<br />
<strong>und</strong> weiterer Schritte in seiner Anpassung unterstützt wird. Die<br />
Forderungen des B<strong>und</strong>esverbandes der Stärkekartoffelerzeuger<br />
wurden vom Deutschen Bauernverband unterstützt.<br />
UNIKA<br />
Der Deutsche Bauernverband kann auch im Jahr <strong>2008</strong> auf eine<br />
sehr gute <strong>und</strong> intensive Zusammenarbeit mit der Union der<br />
Deutschen Kartoffelwirtschaft e. V. (UNIKA) zurückblicken. Als<br />
übergreifende Organisation für die Kartoffelwirtschaft hat sich<br />
die UNIKA in den letzten Jahren intensiv für die Verbesserung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Kartoffelwirtschaft<br />
eingesetzt <strong>und</strong> in enger Abstimmung zwischen Kartoffelerzeugung,<br />
-züchtung, -verarbeitung, -vermarktung <strong>und</strong> Kartoffeltechnik<br />
<strong>und</strong> der mit der Kartoffel tangierten Agrar-Unternehmen<br />
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.<br />
Über 70 ehrenamtliche Mitglieder, in mittlerweile 4 aktiven<br />
Fachkommissionen „Pflanzgut“, „Phytosanitäre Fragen“, „Qualitätssicherung<br />
<strong>und</strong> Handelsfragen“ <strong>und</strong> „Technik der Kartoffelwirtschaft“<br />
sorgen für die fachliche Basis <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>lagenarbeit<br />
zur Erarbeitung zukunftsorientierter Lösungen.<br />
Das Jahr <strong>2008</strong> war das internationale Jahr der Kartoffeln. Die<br />
Welternährungsorganisation der Vereinigten Nationen wollte<br />
damit das Bewusstsein für die Bedeutung der Kartoffel als<br />
Gr<strong>und</strong>nahrungsmittel schärfen. Nach Mais, Reis <strong>und</strong> Weizen ist<br />
die Kartoffel die viertwichtigste Nahrungsmittelpflanze. Durch<br />
dieses „Internationale Jahr der Kartoffel“ konnte weltweit mit<br />
vielen Aktionen <strong>und</strong> Maßnahmen eine besondere – aus Sicht<br />
der Branche auch angemessene <strong>und</strong> notwendige – Beachtung<br />
für die Kartoffel geweckt werden. Die UNIKA hat beispielsweise<br />
64
im Rahmen einer Ernteaktion am 23. August <strong>2008</strong> vor dem<br />
Brandenburger Tor in Berlin das internationale Jahr der Kartoffel<br />
medienmäßig in Deutschland transportiert.<br />
DBV-Position<br />
Die deutsche Kartoffelbranche stellt sich geschlossen gegen<br />
einen Zugriff auf betriebsinterne Daten durch den Lebensmitteleinzelhandel.<br />
Von Seiten des LEH gab es wiederholt<br />
Bestre-bungen, interne Betriebs- <strong>und</strong> Produktionsdaten in<br />
einer allgemeinen Datenbank zu erfassen. Die Anforderungen<br />
an Lebensmittelsicherheit, rasche Rückverfolgbarkeit <strong>und</strong> Offenheit<br />
mit einer „gläsernen Produktion“ werden in der Agrarwirtschaft<br />
längst erfüllt. Daher nützt dieser erhebliche Mehraufwand<br />
in der Dokumentation weder der Wertschöpfungskette<br />
<strong>und</strong> dem Lebensmitteleinzelhandel noch hat der Verbraucher<br />
davon einen Vorteil.<br />
Zucker<br />
Die Rübenanlieferung ging gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Millionen<br />
Tonnen auf 23 Millionen Tonnen zurück. Als Gr<strong>und</strong> für<br />
diese Entwicklung ist ein weiterer reformbedingter Rückgang<br />
der Zuckerrübenanbaufläche um 27.662 Hektar zu nennen.<br />
5.689 Betriebe stellten im Vergleich zum Vorjahr den Zuckerrübenanbau<br />
ein. Aufgr<strong>und</strong> der günstigen Witterungsbedingungen<br />
konnte jedoch der Zuckerertrag pro Hektar im Vergleich<br />
zum Vorjahr leicht erhöht werden, da der durchschnittliche<br />
Zuckergehalt mit 18,04 Prozent etwa 0,55 Prozentpunkte über<br />
dem Vorjahr lag. Insgesamt beläuft sich die Zuckererzeugung<br />
aus Rüben auf 3,638 Millionen Tonnen <strong>und</strong> liegt damit etwa<br />
264.100 Tonnen unterhalb des Vorjahres.<br />
Umsetzung der Zuckermarktreform<br />
Das im Rahmen der Reform der Zuckermarktordnung verfolgte<br />
Ziel, Quoten in Höhe von sechs Millionen Tonnen einzuziehen,<br />
wurde annähernd erreicht: Etwa 5,8 Millionen Tonnen haben<br />
die Erzeuger zurückgegeben. Allerdings zieht dieses Ergebnis<br />
herbe Einschnitte für den Zuckersektor nach sich: 140.000 Erzeuger<br />
in Europa sind aus der Produktion ausgestiegen, 80 Fabriken<br />
wurden geschlossen. Die Zuckererzeuger, die im Rahmen<br />
der Reform Quoten abgeben, erhalten eine Umstrukturierungsbeihilfe.<br />
Bei der Entschädigungszahlung handelt es sich um einen<br />
Ausgleich für den Verzicht auf Einnahmen in den Folgejahren<br />
bis zum Jahre 2015. Deshalb wird gefordert, die Umstrukturierungsbeihilfe<br />
steuerlich auf mehrere Jahre zu verteilen.<br />
65<br />
Pflanzenproduktion
Öl- <strong>und</strong> Eiweißpflanzen<br />
Rapsernte <strong>und</strong> Marktentwicklung<br />
Mit 5,1 Millionen Tonnen haben die deutschen Rapserzeuger auf<br />
die letzten fünf Jahre bezogen ein durchschnittliches Ergebnis<br />
erzielt. Gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum 10 Jahre<br />
zuvor mit lediglich 2,8 Millionen Tonnen war dies sogar eine<br />
Steigerung um 84 Prozent. Dennoch hätte es deutlich mehr sein<br />
können, da die Nachfrage nach Raps- <strong>und</strong> Pflanzenölen das Angebot<br />
aus inländisch erzeugtem Raps (2,0 Millionen Tonnen bei<br />
40 Prozent Ölgehalt) bei weitem übertroffen hat. Hier können<br />
noch Marktanteile für die deutschen Erzeuger erobert <strong>und</strong> gesichert<br />
werden.<br />
Allein der Absatz an Biodiesel <strong>und</strong> Pflanzenölkraftstoff betrug<br />
im Jahr <strong>2008</strong> etwa 3,2 Millionen Tonnen, wovon etwa 80<br />
Prozent oder 2,6 Millionen Tonnen auf Rapsöle entfallen dürften.<br />
Für die Ernährung inklusive Margarine u. a. werden nochmals<br />
r<strong>und</strong> 0,6 Millionen Tonnen benötigt. Damit ist Deutschland<br />
zum größten Importeur von Rapssaaten <strong>und</strong> Raps in der EU<br />
geworden. Selbst der für <strong>2009</strong> politisch verordnete Rückgang<br />
des Reinkraftstoffmarktes hat nicht automatisch einen rückläufigen<br />
Bedarf an Rapsöl zur Folge, weil der Beimischungsmarkt<br />
den erneuten Rückgang beim B100 kompensieren dürfte <strong>und</strong><br />
zudem die Qualität von Raps-Biodiesel von der Mineralölindustrie<br />
höher eingeschätzt wird als vom Reinkraftstoffmarkt. Der<br />
über die Jahre zunehmende Bedarf an Rapsöl kommt auch in<br />
der Entwicklung der Ölmühlenkapazitäten in Deutschland zum<br />
Ausdruck. Diese ist in <strong>2008</strong> auf annähernd 8 Millionen Tonnen<br />
Rapsverarbeitung angestiegen mit einer Produktion von etwa<br />
3,2 Millionen Tonnen Rapsöl, die auch dem Bedarf entspricht.<br />
DBV-Position<br />
Nach Auffassung des Deutschen Bauernverbandes <strong>und</strong> der<br />
UFOP hat die Rapsproduktion eine hohe Bedeutung für den<br />
Ackerbau wie für den Markt. Doppelt so hohe Matif-Terminkontrakte<br />
Raps gegenüber Getreide sind eine gute Gr<strong>und</strong>lage für<br />
die Anbauentscheidung des Landwirts.<br />
Stärkung der heimischen Körnerleguminosen<br />
Der Anbau heimischer Körnerleguminosen in Deutschland hat<br />
zur Ernte <strong>2008</strong> eine Fläche von 80.000 Hektar unterschritten.<br />
Dieser entspricht somit nur noch der Hälfte des Anbaus im Mittel<br />
der Jahre 2002/2007. Damit wird eine „kritische Masse“ in<br />
Anbau <strong>und</strong> Erzeugung unterschritten, so dass sich Körnerleguminosen-Züchtung<br />
in Deutschland künftig kaum noch lohnen<br />
wird. Da Züchtungsprogramme sehr langfristig angelegt sind<br />
66
<strong>und</strong> ein Ausstieg nicht kurzfristig revidiert werden kann, geht<br />
entsprechendes Know-how <strong>und</strong> Innovationspotenzial unwiederbringlich<br />
verloren. Ein weiterer Zuchtfortschritt bei Körnerleguminosen<br />
ist somit für absehbare Zeit ausgeschlossen.<br />
DBV-Position<br />
Angesichts des dramatisch rückläufigen Anbaus haben der<br />
Deutsche Bauernverband <strong>und</strong> die UFOP eine Stärkung der heimischen<br />
Körnerleguminosen im Rahmen des Health Checks der<br />
EU-Agrarpolitik gefordert. Es ist als Erfolg des Berufsstandes<br />
festzuhalten, dass eine Verschiebung der Entkoppelung der<br />
Eiweißpflanzen-Beihilfe in Höhe von 55,57 Euro je Hektar<br />
bis längstens zum Januar 2012 erreicht werden konnte. Die<br />
gesonderte Beihilfe wird damit letztmalig für die Ernte 2011<br />
gewährt. Als weiterer Erfolg für den Berufsstand ist der PLA-<br />
NAK-Beschluss vom 29.04.<strong>2009</strong> zur Einführung einer neuen<br />
Agrarumweltmaßnahme „Klimaschonender Anbau von Körnerleguminosen“<br />
ab 2010 zu werten. Für die Nutzung dieser<br />
Maßnahme sind in einer fünfjährigen Verpflichtung jährlich<br />
mindestens 10 Prozent Körnerleguminosen auf der bestehenden<br />
Ackerfläche des Betriebes anzubauen. Als Beihilfe werden<br />
unter Anrechnung der Eiweißpflanzenprämie bis 220 Euro je<br />
Hektar Körnerleguminosenfläche gezahlt. Mit dem PLANAK-<br />
Beschluss ist der Rahmen gesetzt, den die B<strong>und</strong>esländer für<br />
die Förderung einer markt- <strong>und</strong> standortangepassten Landwirtschaft<br />
nutzen können.<br />
Darüber hinaus werden derzeit von Seiten des B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministeriums<br />
<strong>und</strong> der Länderagrarministerien Überlegungen<br />
angestellt, wie ein Zukunftsszenario für heimische<br />
Körnerleguminosen unter Berücksichtigung des Forschungsbedarfs<br />
sowie der Stärkung im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen<br />
der Zweiten Säule entwickelt werden kann. Der Deutsche<br />
Bauernverband <strong>und</strong> die UFOP unterstützen diese Überlegungen<br />
nachdrücklich.<br />
67
Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
Ernte<br />
In Deutschland betrug die Obsternte <strong>2008</strong> r<strong>und</strong> 1,3 Millionen<br />
Tonnen. Die Gemüseernte <strong>2008</strong> erreichte mit 3,5 Millionen<br />
Tonnen Rekordhöhe.<br />
Marktorganisation Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
Am 31. Dezember 2007 wurden im Amtsblatt der Europäischen<br />
Union die Durchführungsbestimmungen zur gemeinsamen<br />
Marktorganisation Obst <strong>und</strong> Gemüse veröffentlicht. Die Marktorganisation<br />
für Obst <strong>und</strong> Gemüse wurde dann mit der Verordnung<br />
361/<strong>2008</strong> vom 14. April <strong>2008</strong> in die Verordnung über die<br />
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte (Verordnung über<br />
einheitliche GMO) einbezogen.<br />
Auf nationaler Ebene bestimmte bei der Marktorganisation<br />
Obst <strong>und</strong> Gemüse die Erarbeitung der nationalen Strategie<br />
<strong>und</strong> des nationalen Umweltrahmens die Arbeit. Dabei konnte<br />
der nationale Umweltrahmen aufgr<strong>und</strong> nicht enden wollender<br />
Nachforderungen aus Brüssel erst zum 17. November <strong>2008</strong> notifiziert<br />
werden <strong>und</strong> damit in die nationale Strategie integriert<br />
werden.<br />
Im Berichtsjahr wurde die Vermarktungsnorm für Äpfel geändert.<br />
Dadurch wurden bei der Vermarktung von Tafeläpfeln –<br />
gegen den Widerstand der Erzeuger <strong>und</strong> Vermarkter – auch Äpfel<br />
unter 55 Millimeter vermarktungsfähig. Des Weiteren wurden<br />
die Vermarktungsnormen Obst <strong>und</strong> Gemüse „vereinfacht“.<br />
Von den in der Vergangenheit existierenden 36 spezifischen<br />
Vermarktungsnormen werden ab dem 1. Juli <strong>2009</strong> nur noch 10<br />
spezifische Vermarktungsnormen beibehalten. Dem vermeintlichen<br />
Bürokratieabbau wurde damit ein transparentes System<br />
für einen funktionierenden Handel sowie umfassenden Verbraucherschutz<br />
geopfert. Die neuen Regelungen zu den Vermarktungsnormen<br />
ab dem 1. Juli <strong>2009</strong> werden komplizierter<br />
<strong>und</strong> schwieriger <strong>und</strong> der Kontroll- <strong>und</strong> Verwaltungsaufwand<br />
wurde durch die Verschlankung der Brüssler Verordnungen<br />
eher erhöht als gesenkt.<br />
GAP-Reform<br />
Es ist dem Berufsstand gelungen, wesentliche Verbesserungen<br />
durchzusetzen. So hat der Agrarministerrat der Europäischen<br />
Union den 10-monatigen Verfügungszeitraum durch eine<br />
Stichtagsregelung ersetzt. Darüber hinaus wurden die nationalen<br />
Regelungen hinsichtlich der Einbeziehung der Obst-<br />
dauerkulturen für die Beantragung der Betriebsprämie im<br />
Jahre <strong>2008</strong> getroffen <strong>und</strong> die Prämienhöhe auf 49,50 Euro je<br />
68
Hektar prämienberechtigter Obstdauerkultur oder Rebschul-<br />
oder Baumschuldauerkulturfläche festgelegt. Des Weiteren<br />
wurden für das Antragsjahr <strong>2008</strong> die komplizierten OGS-Genehmigungen<br />
abgeschafft <strong>und</strong> die Flächenstilllegung ausgesetzt.<br />
Schulobstprogramm<br />
Der Europäische Agrarrat hat am 20. November <strong>2008</strong> in Brüssel<br />
eine politische Einigung beim Schulobstprogramm erreicht<br />
<strong>und</strong> auf seiner Dezembersitzung verabschiedet. Die Durchführungsbestimmungen<br />
der EU-Kommission zum Schulobstprogramm<br />
stehen noch aus. Das Schulobstprogramm ist mit einer<br />
Haushaltslinie von jährlich 90 Millionen Euro ausgestattet. Auf<br />
Deutschland entfallen etwa 12 Millionen Euro. Das Schulobstprogramm<br />
soll bereits zum Schuljahr <strong>2009</strong>/2010 starten.<br />
Der Deutsche Bauernverband begrüßt dieses Schulobstprogramm,<br />
allerdings kommt es nun auf die Durchführungsbestimmungen<br />
der Kommission <strong>und</strong> die anschließende Umsetzung<br />
in Deutschland an. Hier fordert der Berufsstand das<br />
B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium auf, alle Akteure, B<strong>und</strong>,<br />
Länder <strong>und</strong> Wirtschaft, gemeinsam zur Umsetzung an einen<br />
Tisch zu laden.<br />
Fruit Logistica<br />
Die Fruit Logistica vom 7. bis 9. Februar <strong>2008</strong> lockte etwa 50.000<br />
Fachbesucher aus über 120 Ländern auf den Branchentreffpunkt<br />
für Obst <strong>und</strong> Gemüse nach Berlin. Es präsentierten sich 2.110<br />
Aussteller aus 68 Ländern auf 81.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.<br />
Die wichtigsten deutschen Erzeugerorganisationen<br />
waren mit einem Gemeinschaftsstand in Halle 20 vertreten.<br />
QS<br />
Das QS-GAP-Rebenchmarking-Verfahren wurde am 14. März<br />
<strong>2008</strong> von der QS GmbH erfolgreich abgeschlossen. Audits nach<br />
der QS-GAP-Version <strong>2008</strong> waren bereits ab dem 1. Februar<br />
<strong>2008</strong> möglich. Anlässlich der Internationalen Grünen Woche<br />
veranstaltete der Deutsche Bauernverband ein Internationales<br />
Forum zur Qualitätssicherung am 24. Januar <strong>2008</strong>. Im<br />
Berichtsjahr ist es QS gelungen, die Internationalität von QS<br />
durch die Aufnahme der holländischen Vereinigung der Erzeugerorganisationen<br />
weiter auszubauen.<br />
Saisonarbeitskräfte<br />
Im Berichtsjahr wurde die Eckpunkteregelung für die Jahre<br />
<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong> um die Vermittlung bulgarischer Saisonarbeitskräfte<br />
für die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft erweitert. Insgesamt<br />
hat sich die Anwerbung von Saisonarbeitskräften im Berichts-<br />
69<br />
Pflanzenproduktion
jahr schwieriger gestaltet <strong>und</strong> die Anzahl der Stornierungen<br />
hat zugenommen. Der Berufsstand hat daher mehrfach die<br />
B<strong>und</strong>esregierung aufgefordert, umgehend die Arbeitnehmerfreizügigkeit<br />
umzusetzen sowie weitere Vermittlungsabsprachen<br />
mit Drittlandstaaten wie zum Beispiel der Ukraine <strong>und</strong><br />
Weißrussland zu treffen, um die Basis für die Vermittlung<br />
von Saisonarbeitskräften zu erweitern. Im B<strong>und</strong>eskanzleramt<br />
zeigte man hierzu vorsichtige Offenheit, der Durchbruch ist im<br />
Berichtsjahr allerdings noch nicht gelungen. Allerdings hat der<br />
Berufsstand erreicht, dass ab dem 1. Januar <strong>2009</strong> die Beschäftigungsdauer<br />
von ausländischen Saisonarbeitnehmern von vier<br />
auf sechs Monate verlängert wurde. Damit wird es im Jahre<br />
<strong>2009</strong> zu einer leichten Entspannung bei der Beschäftigung von<br />
Saisonarbeitskräften kommen. Das Gr<strong>und</strong>problem ist damit<br />
aber noch nicht gelöst (siehe Seite 126).<br />
Rückstandshöchstgehalte<br />
Seit dem 1. September <strong>2008</strong> gelten in der Europäischen Union<br />
einheitliche Rückstandshöchstgehalte. Damit wurde nach vielen<br />
Jahren eine zentrale Forderung des B<strong>und</strong>esausschusses<br />
Obst <strong>und</strong> Gemüse <strong>und</strong> des Deutschen Bauernverbandes zur<br />
Harmonisierung des europäischen Pflanzenschutzrechts erfüllt.<br />
Anlässlich der neuen EU-Regelung zu den einheitlichen<br />
Rückstandshöchstgehalten führte der Deutsche Bauernverband<br />
am 14. Oktober <strong>2008</strong> ein Forum zu einheitlichen Rückstandshöchstmengen<br />
durch. Beteiligt waren Vertreter des<br />
B<strong>und</strong>esamtes für Verbraucherschutz <strong>und</strong> Lebensmittelsicherheit,<br />
des B<strong>und</strong>esinstituts für Risikobewertung, des Verbraucherzentrale<br />
B<strong>und</strong>esverbandes, des B<strong>und</strong>esministeriums für<br />
Ernährung, Landwirtschaft <strong>und</strong> Verbraucherschutz, des Hauptverbandes<br />
des Deutschen Einzelhandels sowie von Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen.<br />
Im Berichtsjahr hat darüber hinaus die Europäische Kommission<br />
Ende November den Monitoringbericht über Pflanzenschutzmittelrückstände<br />
2006 in der Europäischen Union<br />
vorgelegt. Darin wurden von insgesamt 65.810 Obst-, Gemüse-<br />
<strong>und</strong> Getreideproben lediglich bei 4,4 Prozent Überschreitungen<br />
der Rückstandshöchstgehalte festgestellt. Damit geht der<br />
Prozentsatz mit Überschreitungen der Rückstandshöchstgehalte<br />
weiter zurück.<br />
Zu Nitrat in Gemüse hat die Europäische Behörde für die<br />
Lebensmittelsicherheit ein wissenschaftliches Gutachten veröffentlicht,<br />
wonach die günstigen Wirkungen des Verzehrs von<br />
Gemüse <strong>und</strong> Obst eindeutig gegenüber möglichen Risiken für<br />
die Ges<strong>und</strong>heit des Menschen durch die Aufnahme von in Gemüse<br />
enthaltenem Nitrat überwiegen.<br />
70
Pflanzenschutz<br />
Die Neuordnungen des Pflanzenschutzrechts wurden im Berichtsjahr<br />
auf nächster Stufe angegangen: die Verordnung<br />
zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie eine<br />
Richtlinie zum nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.<br />
Nachdem der Europäische Rat sich Mitte des Jahres auf<br />
einen gemeinsamen Standpunkt verständigte, stand im zweiten<br />
Halbjahr die zweite R<strong>und</strong>e im Europäischen Parlament an,<br />
wo dieser am 18. Dezember <strong>2008</strong> mit einem politischen Kompromiss<br />
zwischen Rat <strong>und</strong> Parlament beschlossen wurde. Der<br />
Kompromiss bedarf nun in <strong>2009</strong> noch der Bestätigung durch<br />
das Europäische Parlament <strong>und</strong> den Europäischen Rat.<br />
Des Weiteren wurde im Berichtsjahr das nationale Pflanzenschutzgesetz<br />
geändert. Dabei wurde die Dokumentationspflicht<br />
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nun<br />
auch im Pflanzenschutzgesetz verankert. Außerdem darf zukünftig<br />
nun auch Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut, das nach Deutschland<br />
eingeführt wird, mit den im Ausfuhrland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln<br />
behandelt sein.<br />
DBV-Position<br />
• Damit das Schulobstprogramm auch in Deutschland erfolgreich<br />
wird, ist eine unbürokratische <strong>und</strong> einheitliche Umset-<br />
zung <strong>und</strong> Anwendung erforderlich.<br />
• Die Übernahme der UN/ECE-Normen nach Abschaffung der<br />
EU-Normen zum 1. Juli <strong>2009</strong> muss erfolgen.<br />
• Das Eintrittspreissystem muss zur Sicherung eines gewissen<br />
Außenschutzes beibehalten werden.<br />
• Äpfel, Kirschen, Pflaumen <strong>und</strong> Einlegegurken müssen als<br />
sensible Produkte bei den WTO-Verhandlungen eingestuft<br />
werden.<br />
• Eine praxisgerechte Vereinfachung der Anwendungsbestimmungen<br />
des Pflanzenschutzrechts in Deutschland ist erfor-<br />
derlich.<br />
• Eine finanzielle Unterstützung seitens des B<strong>und</strong>es zu den<br />
Prämien für Hagelversicherungen ist vorzusehen.<br />
71
Nachwachsende Rohstoffe <strong>und</strong> Energie<br />
Deutschland <strong>und</strong> Europa setzten ambitionierte Ziele für<br />
erneuerbare Energien<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> wurden tiefgreifende Entscheidungen zur Förderung<br />
nachwachsender Rohstoffe beschlossen, die der Land-<br />
<strong>und</strong> Forstwirtschaft interessante Absatzwege eröffnen. Das<br />
EU-Klimapaket, das die Richtlinie über die Förderung erneuerbarer<br />
Energien, die Richtlinie zur Qualität von Kraftstoffen <strong>und</strong><br />
die Verordnung über Kohlendioxidemissionen von Neuwagen<br />
umfasst, wurde in EU-Recht <strong>und</strong> ab diesem Jahr in nationales<br />
Recht umgesetzt.<br />
Auf nationaler Ebene wurden ein Erneuerbare Energien-<br />
Wärmegesetz (EEW), das Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer<br />
Wärme zur Gebäudeheizung macht, sowie die Gasnetzzugangsverordnung,<br />
in der die vorrangige Einspeisung von<br />
Biogas ins Erdgasnetz geregelt wird, verabschiedet. Weiterhin<br />
wurde das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) novelliert <strong>und</strong><br />
das Marktanreizprogramm (MAP) zur Unterstützung von Techniken<br />
im erneuerbaren Energienbereich auf 500 Millionen Euro<br />
aufgestockt.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband begrüßt die angestrebte Harmonisierung<br />
der Bioenergiepolitik innerhalb der EU mit einheitlichen<br />
Zielen für Bioenergie, da sie in der verabschiedeten Form<br />
genügend Freiheiten für nationale Fördersysteme <strong>und</strong> deren<br />
Ausgestaltung bereithält. Voraussetzung bleibt allerdings die<br />
Verlässlichkeit dieser Vorgaben, um die Möglichkeiten nachhaltig<br />
nutzen zu können. Ein Hin <strong>und</strong> Her wie bei der derzeitigen<br />
Biokraftstoffpolitik der B<strong>und</strong>esregierung wäre dagegen kontraproduktiv.<br />
Die noch im Jahr <strong>2008</strong> sehr heftig geführte Debatte „Teller<br />
oder Tank“ hat sich aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes<br />
inzwischen überholt. Häufig zitierte Welternährungsexperten<br />
sind angesichts der Aktualität auf den Getreidemärkten sehr<br />
schnell von der Realität wieder vorhandener Überschüsse<br />
eingeholt worden. Insbesondere die Bauern in den Schwellen-<br />
<strong>und</strong> Entwicklungsländern benötigen kostendeckende<br />
Rohstoffpreise, um ausreichend Anreize für eine nachhaltig<br />
produzierende Landwirtschaft zu erhalten. Insofern haben<br />
auch immer mehr Entwicklungsländer Interesse an den neuen<br />
Absatzmärkten der nachwachsenden Rohstoffe zur stofflichen<br />
<strong>und</strong> energetischen Nutzung.<br />
Der Deutsche Bauernverband bekräftigt seine Auffassung,<br />
dass die Nahrungsmittelproduktion eindeutige Präferenz für<br />
72
die Landwirtschaft hat. Allerdings ist die Biomasse-Erzeugung<br />
zur Produktion von Wärme, Strom <strong>und</strong> Kraftstoff mittlerweile<br />
ein fester zusätzlicher Produktionszweig der Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
geworden, den es weiterhin abzusichern gilt.<br />
Biogas weiterhin Bioenergie mit größter Beteiligung<br />
der Landwirtschaft<br />
Ende 2007 waren etwa 4.000 Biogasanlagen mit einer elektrischen<br />
Gesamtleistung von 1.400 Megawatt installiert. Der<br />
überwiegende Teil dieser Anlagen wird von Landwirten betrieben<br />
oder es liegen Beteiligungen vor. Die gestiegenen Preise<br />
für nachwachsende Rohstoffe sowie die Unsicherheiten der erwarteten<br />
Novelle des EEG hatten den Zubau an neuen Biogasanlagen<br />
im letzten Jahr weitestgehend zum Erliegen gebracht.<br />
Nach Inkrafttreten des EEG <strong>2009</strong> zeichnet sich seit Jahresbeginn<br />
eine gesteigerte Nachfrage nach Biogasanlagen vor allem<br />
im landwirtschaftlichen Größensegment unterhalb 500 Kilowatt<br />
ab, ohne allerdings die boomartigen Zustände der Jahre<br />
2005/2006 anzunehmen. Aufgr<strong>und</strong> der Neuausrichtung des<br />
EEG <strong>2009</strong> auf die Nutzung von Gülle <strong>und</strong> Reststoffen sind es<br />
nun auch vermehrt Veredlungsbetriebe, die eine Investition in<br />
diesem Bereich in Betracht ziehen.<br />
Neben den landwirtschaftlichen Anlagen bis 500 Kilowatt sind<br />
auch weitere Investitionen in größere Gaseinspeiseanlagen<br />
zu beobachten. So wird geschätzt, dass sich die Zahl der Biogasanlagen,<br />
die Gas ins Erdgasnetz einspeisen <strong>und</strong> an anderer<br />
Stelle verstromen, von 12 Anlagen Anfang <strong>2009</strong> bis zum Ende<br />
des Jahres verdoppeln wird.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband konnte bei der Novelle des EEG<br />
einige für die Landwirtschaft entscheidende Verbesserungen<br />
erreichen. Insbesondere ist es gelungen, das EEG <strong>2009</strong> auf<br />
die Nutzung von Gülle <strong>und</strong> Reststoffen durch den Güllebonus<br />
auszurichten sowie die Mitvergärung von landwirtschaftlichen<br />
Reststoffen zu ermöglichen. Weiterhin bietet die Möglichkeit<br />
der Aufbereitung von Gülle mit Unterstützung des Wärmebonus<br />
vor allem für viehstarke Regionen einen guten Ansatz, die<br />
reichlich vorhandenen Nährstoffe transportfähig zu machen<br />
<strong>und</strong> in andere Regionen mit geringerer Wirtschaftsdüngerausstattung<br />
zu verbringen. Daher schätzt der Deutsche Bauernverband<br />
das EEG <strong>2009</strong> als ein gutes Instrument zur Wirtschaftsförderung<br />
im ländlichen Raum <strong>und</strong> wird seine Weiterentwicklung<br />
auch zukünftig aktiv begleiten.<br />
73<br />
Pflanzenproduktion
Biogaseinspeisung ins Erdgasnetz hält neue Möglichkeiten<br />
offen<br />
Die Zielsetzung im Rahmen des Integrierten Energie- <strong>und</strong><br />
Klimaprogramms sieht für eingespeistes Biogas einen Anteil<br />
von 6 Prozent im Jahr 2020 <strong>und</strong> 10 Prozent im Jahr 2030 vor<br />
– gemessen am heutigen Erdgasverbrauch. Allein die Zielerreichung<br />
bis 2020 erfordert anlagenseitige Investitionen in der<br />
Größenordnung von 10 bis 12 Milliarden Euro. Die Biogaseinspeisung<br />
sitzt dabei an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft,<br />
erneuerbare Energien-Branche <strong>und</strong> klassischer Energiewirtschaft.<br />
Die zurzeit geplanten Projekte werden durch<br />
Kooperationen dieser Marktakteure umgesetzt.<br />
Nutzung von Energiegetreide<br />
Getreide minderer Qualität, das zum Beispiel durch ungünstige<br />
Witterungsverhältnisse erst spät geerntet werden kann <strong>und</strong><br />
für die Nahrungs- oder Futtermittelerzeugung ungeeignet ist,<br />
bietet sich für landwirtschaftliche Betriebe als eine durchaus<br />
Kosten senkende Brennstoffalternative an.<br />
Ethischen Bedenken hat sich der Deutsche Bauernverband<br />
offensiv gestellt <strong>und</strong> mit der evangelischen <strong>und</strong> der katholischen<br />
Kirche eine gemeinsame Position erarbeitet. Darin<br />
befürworten auch die Kirchen unter besonderer Hervorhebung<br />
der ökologischen Vorteilhaftigkeit des Brennstoffs Getreide<br />
dessen energetische Nutzung.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Feinstaubdebatte werden auch Kleinfeuerungsanlagen<br />
im Rahmen der 1. B<strong>und</strong>esimmissionsschutzverordnung<br />
(1.BImSchV) diskutiert. Ein Verordnungsentwurf mit<br />
ambitionierten Grenzwerten für die Nutzung von Getreidestroh<br />
<strong>und</strong> Korn liegt bereits seit über einem Jahr vor. Allerdings fehlt<br />
bisher ein Zeitplan zur Umsetzung dieses Entwurfs.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband fordert, den Verordnungsentwurf<br />
der 1.BImSchV mit der Nutzungsmöglichkeit von Getreidestroh<br />
<strong>und</strong> Korn endlich zu verabschieden, um eine energetische Nutzung<br />
in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Der Berufsstand<br />
sperrt sich dabei nicht gegen strengere Grenzwerte, wenn diese<br />
nicht den Marktzugang der Getreide-Verbrennungstechnologie<br />
74<br />
Energierohstoff Preis in ct/kWh<br />
(März <strong>2009</strong>) (reine Brennstoffkosten)<br />
Heizöl: 47 ct/l 4,7 ct/kWh<br />
Erdgas: 74 ct/kg 5,1 ct/kWh<br />
Holzpellets: 20,50 ct/kg 4,1 ct/kWh<br />
z. B. Futtergerste: 10,50 �/dt 2,2 ct/kWh
zw. deren Weiterentwicklung verhindern. Der Kompromiss<br />
muss sich am zurzeit technologisch Machbaren orientieren, bei<br />
gleichzeitig intensiver Förderung der Technologieentwicklung.<br />
Biodiesel- <strong>und</strong> Pflanzenölkraftstoffbranche in der<br />
Konsolidierungsphase<br />
<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong> stellte sich für die deutsche Biodiesel- <strong>und</strong> Pflanzenölkraftstoffbranche<br />
erneut als schwierige Vermarktungsperiode<br />
dar. Der Zeitraum war geprägt durch Unterauslastung<br />
<strong>und</strong> Insolvenzen. Betroffen waren nicht nur die Betreiber von<br />
kleineren <strong>und</strong> mittleren Anlagen für die Gewinnung von Pflanzenölkraftstoff<br />
bzw. Biodiesel, sondern inzwischen ebenfalls<br />
industrielle Biodieselanlagen. Die deutsche Biokraftstoffbranche<br />
steht vor einer Konsolidierungsphase, die durch die<br />
niedrigen Preise für fossile Kraftstoffe noch beschleunigt wird.<br />
Einziger Lichtblick ist die Tatsache, dass die EU-Kommission<br />
inzwischen ein Antidumping-Verfahren gegen die USA mit<br />
dem Ergebnis eingeleitet hatte, B99 zukünftig mit einem Importzoll<br />
zu belegen. Mit der Option auf Fristverlängerung wird<br />
diese Maßnahme zunächst für 6 Monate eingeführt. Der Deutsche<br />
Bauernverband <strong>und</strong> die Union zur Förderung von Öl- <strong>und</strong><br />
Proteinpflanzen hatten wiederholt in Zusammenarbeit mit<br />
COPA/COGECA die Prüfung der Subventions- <strong>und</strong> Exportpraxis<br />
gegenüber der B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong> der EU-Kommission gefordert.<br />
Auf nationaler Ebene haben der Deutsche Bauernverband<br />
<strong>und</strong> UFOP massiv die alles andere als nachhaltig ausgerichtete<br />
Biokraftstoffpolitik der B<strong>und</strong>esregierung kritisiert. Mit der<br />
Vorlage eines Gesetzes zur Änderung der Förderung von Biokraftstoffen<br />
verlässt die B<strong>und</strong>esregierung schon nach knapp<br />
zwei Jahren ihren eingeschlagenen Weg hinsichtlich ihrer<br />
Quotenpolitik. Immerhin konnte verhindert werden, dass die<br />
Gesamtquote nicht gegenüber dem Vorschlag des B<strong>und</strong>esumweltministeriums<br />
auf 4,25 Prozent gesenkt werden soll. Der<br />
Kompromiss sieht nunmehr eine Gesamtquote in Höhe von<br />
5,25 Prozent für <strong>2009</strong> <strong>und</strong> 6,25 Prozent bis Ende 2014 vor.<br />
Massiv haben beide Verbände ebenfalls die schrittweise Anhebung<br />
der Besteuerung kritisiert. Immerhin konnte hier erreicht<br />
werden, dass der Gesetzentwurf eine Reduzierung der<br />
Teilbesteuerung für Biodiesel um 3 Cent für die Folgejahre vorsieht.<br />
Insofern bleibt der gesamten Branche im Moment nur<br />
die Hoffnung, dass die Rohölpreise wieder steigen. Besonders<br />
betroffen sind Anlagenbetreiber, die ausschließlich Biodiesel<br />
herstellen <strong>und</strong> keine Ölmühle betreiben. Einziger Lichtblick ist<br />
derzeit die Vermarktung von Rapsschrot, der zum Teil die Erlössituation<br />
stützt.<br />
75<br />
Pflanzenproduktion
DBV-Position<br />
Mit dem Ziel, insbesondere die Wettbewerbssituation der<br />
kleineren <strong>und</strong> mittleren Anlagenbetreiber zu verbessern,<br />
wird die Einführung einer energiesteuerfreien Sockelmenge<br />
in Höhe von maximal 10.000 Kubikmeter für existierende<br />
Biodiesel- bzw. Pflanzenölkraftstoffhersteller benötigt. Zur Sicherstellung<br />
eines Mindestabsatzes fordern Deutscher Bauernverband<br />
<strong>und</strong> UFOP, dass die Gesamtquote gemäß dem zurzeit<br />
geltenden Gesetz unverändert fortgeführt wird. Zudem muss<br />
die Verwendung von Biodiesel oder Pflanzenölkraftstoff mit<br />
voller Steuerbegünstigung auch auf staatliche Forstbetriebe<br />
<strong>und</strong> den öffentlichen Personennahverkehr erweitert werden.<br />
Darüber hinaus sollten Transportunternehmen, die nachweislich<br />
Biodiesel oder Pflanzenölkraftstoff verwenden, von der<br />
Politik durch eine Begünstigung in der Mautgebühr unterstützt<br />
werden. Die geforderten Maßnahmen können angesichts der<br />
Preisentwicklung am Dieselmarkt jedoch erst bei Änderung der<br />
Preisverhältnisse in vollem Umfang zur Entlastung beitragen.<br />
Bioethanol<br />
Die Bioethanolerzeugung ist in Deutschland von 0,31 Millionen<br />
Tonnen im Jahr 2007 auf 0,46 Millionen Tonnen im Jahr <strong>2008</strong><br />
gestiegen. Wesentliche Ursache hierfür war die nach dem B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz<br />
im Jahr <strong>2008</strong> für Benzin geltende<br />
Biokraftstoffquote von 2 Prozent (calorisch) bzw. 3,08 Prozent<br />
(Volumen). Die Bioethanolpreise sind im Jahr <strong>2008</strong> mit weniger<br />
als 60 Cent je Liter jedoch weiter unter Druck geblieben.<br />
Die Verwendung von Getreide für die Bioethanolproduktion<br />
ist mit ca. 0,94 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr<br />
(0,93 Millionen Tonnen) nahezu unverändert gewesen. Demgegenüber<br />
ist die Bedeutung von Melasse <strong>und</strong> Rübenstoffen als<br />
Bioethanolrohstoffe erheblich von 0,08 (in 2007) auf 0,57<br />
Millionen Tonnen in <strong>2008</strong> gestiegen. Mit der im Dezember<br />
<strong>2008</strong> beschlossenen EU-Richtlinie Erneuerbare Energien ist<br />
ein obligatorischer, bis zum Jahr 2020 zu erreichender, Min-<br />
76
destanteil von 10 Prozent (calorisch) Biokraftstoffen in allen<br />
EU-Mitgliedstaaten festgesetzt worden. Die damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Ausweitung des EU-Bioethanolmarktes ist für die weitere Entwicklung<br />
der in Europa führenden deutschen Bioethanolwirtschaft<br />
von ausschlaggebender Bedeutung.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband unterstützt gemeinsam mit dem<br />
B<strong>und</strong>esverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe)<br />
nachdrücklich den weiteren Ausbau der Bioethanolproduktion<br />
in Deutschland als unverzichtbare Zukunftsperspektive für den<br />
heimischen Ackerbau. Deutscher Bauernverband <strong>und</strong> BDBe<br />
fordern, dass Gr<strong>und</strong>lage der Verwendung von Biokraftstoffen<br />
in Deutschland <strong>und</strong> in der gesamten EU Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit<br />
<strong>und</strong> faire Wettbewerbsbedingungen sein<br />
müssen. Dies bedeutet, dass Kohlendioxidentlastung, Energieeffizienz,<br />
Versorgungssicherheit, Einhaltung gleichwertiger<br />
Umwelt- <strong>und</strong> Sozialstandards, Sicherung des Produktionsstandortes<br />
Deutschland/Europa <strong>und</strong> Wertschöpfung in den<br />
heimischen Regionen gleichrangige Kriterien sein müssen. Aus<br />
Sicht des Deutschen Bauernverbandes liegt ein wesentlicher<br />
Vorteil von aus den heimischen Rohstoffen Getreide <strong>und</strong> Zuckerrüben<br />
erzeugtem Bioethanol in den gleichzeitig in großen<br />
Mengen anfallenden Proteinfuttermitteln.<br />
Nachhaltigkeit für den Biomasseanbau<br />
Die europäische Richtlinie Erneuerbarer Energien sieht neben<br />
den Zielen für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2020<br />
in Höhe von 20 Prozent <strong>und</strong> einem Biokraftstoffanteil von 10<br />
Prozent im Jahr 2020 auch die Zertifizierung der Nachhaltigkeit<br />
dieser Kraftstoffe vor. Gr<strong>und</strong>legende Kriterien der Nachhaltigkeit<br />
sind in Europa die Vorschriften von Cross Compliance.<br />
Zusätzlich zu diesen Anforderungen sollen aber Flächen<br />
mit hoher Biodiversität von der Biomasseproduktion für die<br />
Biokraftstoffherstellung ausgeschlossen werden. Für Importe<br />
soll der Nachweis, dass diese nicht von geschützten Flächen<br />
(z. B. Regenwald) stammen, ausreichen. Weiterhin müssen für<br />
die produzierten Biokraftstoffe bestimmte Treibhausgasminderungen<br />
eingehalten werden. Dieser Wert soll für Biokraftstoffe<br />
für bis Ende Januar <strong>2008</strong> in Betrieb gegangene Anlagen mindestens<br />
35 Prozent <strong>und</strong> ab 2017 mindestens 50 Prozent betragen.<br />
Für Anlagen, die im Jahr 2017 in Betrieb gehen, gilt<br />
ein Mindestwert von 60 Prozent Treibhausgasminderung ab<br />
April 2017. Zusätzlich zu den Vorgaben für Biokraftstoffe hat<br />
die B<strong>und</strong>esregierung Ende Februar eine Nachhaltigkeitsverordnung<br />
für die Stromproduktion aus Biomasse vorgelegt. Von<br />
77<br />
Pflanzenproduktion
der Europäischen Kommission ist für Ende <strong>2009</strong> vorgesehen,<br />
neben den Nachhaltigkeitskriterien für die Biokraftstoffproduktion<br />
ebenfalls Kriterien für die Produktion der übrigen Bioenergien<br />
vorzulegen.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband sieht in der Schaffung internationaler<br />
Zertifizierungssysteme zur Sicherstellung einer<br />
nachhaltigen Rohstoffproduktion einen Schlüssel für die Weiterentwicklung<br />
nachwachsender Rohstoffe zur energetischen<br />
<strong>und</strong> stofflichen Nutzung. Auf diese Weise wird eine Entwicklung<br />
zur internationalen Harmonisierung der Anforderungen<br />
an die landwirtschaftliche Rohstoffproduktion stattfinden.<br />
Allerdings ist es nicht akzeptabel, dass zur Produktion von<br />
Biomasse für die Kraftstoffgewinnung über Cross Compliance<br />
hinaus das Verbot auf Flächen mit hoher Biodiversität in<br />
Europa durchgesetzt werden soll, während für Importe Cross<br />
Compliance nicht einmal in Ansätzen bindend ist. Zudem<br />
hat der Deutsche Bauernverband immer wieder betont, dass<br />
Wettbewerbsverzerrungen insbesondere dann auf internationalen<br />
Märkten auftreten werden, wenn es nicht gelingt, insbesondere<br />
sozioökonomische Kriterien als gleichrangig zu<br />
gewichtende Kriterien aufzunehmen. Ebenso müssen die Treib-<br />
hausgas-Verminderungseffekte der Nebenproduktverwertung<br />
stärker in den Bewertungsprozess einbezogen werden.<br />
Forst- <strong>und</strong> Waldwirtschaft<br />
Deutschland ist im europäischen Vergleich das holzreichste<br />
Land, noch vor Finnland oder Schweden. Deutsche Wälder<br />
umfassen 11 Millionen Hektar Fläche mit etwa 3,4 Milliarden<br />
Kubikmeter Holzvorrat. Allerdings werden vom jährlichen Zuwachs<br />
nur etwa zwei Drittel genutzt. Ohne Beeinträchtigung<br />
könnte die Nutzung der Wälder daher deutlich ausgebaut werden.<br />
Dabei gewinnt die energetische Nutzung von Holz als<br />
eine sehr wettbewerbsfähige Form der Biomassenutzung eine<br />
zunehmende Bedeutung. Darüber hinaus findet Holz jedoch<br />
auch zunehmende Verwendung als Baumaterial. Insgesamt<br />
finden im Forst- <strong>und</strong> Holzsektor r<strong>und</strong> 1,4 Millionen Menschen<br />
Beschäftigung. Etwa ein Drittel der Waldfläche wird von Landwirten<br />
im Haupt- oder Nebenerwerb bewirtschaftet.<br />
DBV-Position<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> dieser großen Bedeutung des Wirtschaftsektors<br />
Forst <strong>und</strong> Holz hat der Staat eine besondere Verant-<br />
78
wortung in der Gesetzgebung. Der Deutsche Bauernverband<br />
hat zusammen mit den Fachverbänden daher die einseitige<br />
Betonung der Schutzfunktion zu Lasten der Waldnutzer im Novellierungsvorschlag<br />
zum B<strong>und</strong>eswaldgesetz scharf kritisiert<br />
<strong>und</strong> erfolgreich abgewehrt. Vielmehr muss eine kleine Novelle<br />
des B<strong>und</strong>eswaldgesetzes dazu führen, dass die dringend notwendige<br />
Herausnahme von Kurzumtriebsplantagen aus dem<br />
Waldbegriff, die Erweiterung der Befugnisse von forstwirtschaftlichen<br />
Zusammenschlüssen <strong>und</strong> das Begehungsrecht klar<br />
geregelt werden.<br />
Langfristiges Ziel des Deutschen Bauernverbandes ist es, die<br />
Holzmobilisierung insbesondere aus dem klein strukturierten<br />
Privatwald zu verbessern. Dazu müssen besitzübergreifende<br />
Bewirtschaftungsstrategien genutzt werden, um Kosten <strong>und</strong><br />
Aufwand der Bewirtschaftung zu minimieren <strong>und</strong> damit die Attraktivität<br />
des Waldes für dessen Besitzer zu steigern.<br />
Zur Erreichung seiner Ziele arbeitet der Deutsche Bauernverband<br />
eng mit der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände<br />
<strong>und</strong> mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat zusammen.<br />
Beide Verbände haben ihren Dienstsitz ebenfalls im<br />
Haus der Land- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft in Berlin.<br />
Wein<br />
Die Weinabsatzentwicklung verlief im Berichtsjahr erstaunlich<br />
gut. Insbesondere das Verbraucherinteresse an deutschen Weinen<br />
nimmt zu, da sich wohl die Erkenntnis durchsetzt, dass<br />
deutscher Wein eine hohe Qualität <strong>und</strong> gleichzeitig ein valides<br />
Preis-Qualitäts-Verhältnis aufweist. Die <strong>2008</strong>er Weinmosternte<br />
lieferte dafür eine solide Gr<strong>und</strong>lage.<br />
Für den praktischen Weinbau war <strong>2008</strong> von der Diskussion<br />
über das EU-Pflanzenschutzpaket geprägt. Hier bestand die<br />
zentrale Forderung des Deutschen Bauernverbandes zusammen<br />
mit dem Deutschen Weinbauverband darin, die Regulierungen<br />
nicht zu überziehen, sondern so zu gestalten, dass<br />
eine qualitätsorientierte Traubenerzeugung unter den mitteleuropäischen<br />
Klimabedingungen auch weiterhin möglich<br />
bleibt. Dabei spielt die Hubschrauberspritzung, die nur in<br />
Weinbergsteillagen zum Einsatz kommt, eine zentrale Rolle.<br />
Die alles überlagernde Themenstellung des Berichtsjahres<br />
<strong>2008</strong> für die Weinwirtschaft war die Reform der gemeinsamen<br />
Marktorganisation für Wein. Nachdem sich der EU-Ministerrat<br />
bereits am 19. Dezember 2007 auf eine Reform der EG-Weinmarktorganisation<br />
verständigt hatte, hat es schließlich bis<br />
zum 6. Juni <strong>2008</strong> gedauert, bis die neue EG-Weinmarktorgani-<br />
79<br />
Pflanzenproduktion
sation als Verordnung (EG) Nr. 479/<strong>2008</strong> vom 29. April <strong>2008</strong> im<br />
EU-Amtsblatt Nr. L 148 vom 6. Juni <strong>2008</strong> veröffentlicht wurde.<br />
Wichtige Regelungsinhalte der reformierten EU-Weinmarktorganisation<br />
sind die<br />
• Einführung eines nationalen Finanzrahmens, wobei den<br />
Mitgliedstaaten EU-Finanzmittel zugewiesen werden, für<br />
die Förderung strukturverbessernder Maßnahmen,<br />
• schrittweise Abschaffung der Destillationsregelungen,<br />
• Verpflichtung der Mitgliedstaaten, eine dreijährige Rebflächenrodungsregelung<br />
für eine Gesamtfläche von 175.000<br />
Hektar mit einer im Laufe der drei Jahre schrittweise verrin-<br />
gerten Prämie anzubieten,<br />
• Abschaffung des Systems der Pflanzungsrechte bis Ende<br />
2015 mit der Möglichkeit, das Pflanzrechtesystem auf natio-<br />
naler Ebene bis Ende 2018 beizubehalten,<br />
• weitgehende Übertragung der Regelungskompetenzen bei<br />
den önologischen Verfahren vom Ministerrat auf die EU-<br />
Kommission (Ausnahme: Kompetenzen zur Regelung der An-<br />
reicherung, Säuerung u. Entsäuerung verbleiben beim Rat),<br />
• Absenkung der Anreicherungsspannen in den einzelnen<br />
Weinbauzonen um 0,5 Volumenprozent,<br />
• Abschaffung der bisherigen Klassifizierung der EU-Weine in<br />
Tafelweine <strong>und</strong> Qualitätsweine <strong>und</strong> deren Ersetzung durch<br />
eine Unterscheidung der Weine in Weine mit näheren Her-<br />
kunftsangaben <strong>und</strong> Weinen ohne nähere Herkunftsangaben<br />
sowie die<br />
• Zulassung der Angabe von Rebsorte <strong>und</strong> Jahrgang auch bei<br />
einfachen Weinen ohne nähere Herkunftsangabe.<br />
Die VO Nr. 479/<strong>2008</strong> wird durch mehrere Durchführungsverordnungen<br />
der EU-Kommission ergänzt. Von besonderer Bedeutung<br />
sind dabei insbesondere die Durchführungsbestimmungen<br />
zum neuen EG-Weinbezeichnungsrecht. Hier zeichnet sich<br />
ab, dass die von der deutschen Weinwirtschaft angestrebte<br />
Überführung des deutschen Qualitäts- <strong>und</strong> Bezeichnungssystems<br />
in das neue EG-Weinbezeichnungsrecht umgesetzt<br />
werden kann. Ziel der Kommission ist es, diese Verordnung bis<br />
Ende Februar <strong>2009</strong> abzustimmen.<br />
Der Deutsche Weinbauverband <strong>und</strong> der Deutsche Bauernverband<br />
kritisieren den Zeitdruck, der von Seiten der EU-Kommission<br />
auf die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der neuen EU-<br />
Bezeichnungsregeln ausgeübt wird. Es ist unzumutbar, dass<br />
die Mitgliedstaaten ihre nationalen Bezeichnungsregeln an die<br />
neuen EU-Vorschriften bis zum 1. August <strong>2009</strong> angepasst haben<br />
sollen, obwohl derzeit die bezeichnungsrechtlichen Durchführungsbestimmungen<br />
als Basis für die nationalen Gesetz-<br />
80
geber noch nicht verabschiedet sind <strong>und</strong> vermutlich frühes-<br />
tens erst im April im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden<br />
können.<br />
DBV-Position<br />
• Das traditionelle deutsche Bezeichnungssystem in Deutschland<br />
sollte weitestgehend beibehalten werden.<br />
• Ein Verbot der Verwendung der neuen Begriffe „Wein mit<br />
geschützter Ursprungsbezeichnung“ <strong>und</strong> „Wein mit geschütz-<br />
ter geographischer Angabe“ ist im Weingesetz zu verankern.<br />
• Die Zulassung des Weinbaus nur auf weinbauwürdigen abgegrenzten<br />
Flächen ist mindestens bis 2018 vorzusehen.<br />
• Die Höchstertragsregelung ist für alle Weine auf allen Rebflächen<br />
beizubehalten.<br />
• Das Qualitätsweinprüfungssystem ist zu erhalten.<br />
• Die erweiterte Süßung mit RTK ist abzulehnen. Die Mitgliedstaaten<br />
müssen ermächtigt werden, die Süßung mit RTK für<br />
einfache Weine ohne geschützte Herkunftsangabe zu<br />
verbieten.<br />
Alkohol<br />
Absatz- <strong>und</strong> Erzeugungslage<br />
Der Absatz an Agraralkohol der B<strong>und</strong>esmonopolverwaltung<br />
für Branntwein lag <strong>2008</strong> mit einem Volumen von r<strong>und</strong> 537.000<br />
Hektolitern Alkohol r<strong>und</strong> 6 Prozent unter der Vorjahresmenge.<br />
Dagegen nahmen die Einfuhren von Agraralkohol aus anderen<br />
EU-Mitgliedstaaten mit r<strong>und</strong> 1,18 Millionen Hektolitern<br />
Alkohol um fast 26 Prozent zu. Die Gesamtalkoholerzeugung<br />
in Deutschland (inklusive Alkohol aus nicht landwirtschaftlichen<br />
Rohstoffen) ging im letzten Betriebsjahr 2007/08 auf<br />
6,92 Millionen Hektoliter Alkohol zurück. Die hohe Produktionsmenge<br />
außerhalb des Branntweinmonopols (4,7 Millionen<br />
Hektoliter) resultiert im Wesentlichen aus der Produktion von<br />
Bioethanol für den Kraftstoffsektor in einer Größenordnung<br />
von etwa 4,35 Millionen Hektolitern Alkohol sowie der Erzeugung<br />
von Korndestillaten außerhalb des Monopols. Für das<br />
laufende Monopolwirtschaftsjahr <strong>2008</strong>/09 geht die B<strong>und</strong>esmonopolverwaltung<br />
für Branntwein von einem Zuwachs des<br />
Absatzes in den Vorbehaltssektoren auf über 600.000 Hektoliter<br />
Alkohol aus.<br />
Branntweinmonopol<br />
Für die landwirtschaftlichen Brennereien ist im laufenden Monopolwirtschaftsjahr<br />
<strong>2008</strong>/09 das Jahresbrennrecht wieder<br />
81<br />
Pflanzenproduktion
auf 60 Prozent festgesetzt worden. Wie in den Vorjahren wird<br />
auch im laufenden Jahr der Übernahmepreis um 5 Prozent gekürzt.<br />
Diese eingeschränkten Erzeugungsbedingungen sind im<br />
Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stützungsmittel<br />
für das Monopol von 143 Millionen Euro 1999 auf nur noch<br />
knapp 80 Millionen Euro für das Jahr <strong>2009</strong> festgesetzt worden<br />
sind.<br />
Zukunft des Branntweinmonopols nach 2010<br />
Der Deutsche B<strong>und</strong>estag hat in einer einstimmigen Entschließung<br />
vom 28. Mai <strong>2008</strong> die existenzielle Bedeutung des<br />
Branntweinmonopols für die Kartoffel- <strong>und</strong> Getreidebrenner<br />
aber auch für die Obst- <strong>und</strong> Gemeinschaftsbrennereien anerkannt<br />
<strong>und</strong> die B<strong>und</strong>esregierung aufgefordert, auf europäischer<br />
Ebene mit Nachdruck für die Verlängerung der bestehenden<br />
EG-beihilferechtlichen Ausnahmeregelung für das Branntweinmonopol<br />
um weitere 7 Jahre bis Ende 2017 einzutreten. Die<br />
Verlängerung der Ausnahmeregelung ist der einzig gangbare<br />
<strong>und</strong> praktikable Weg, die traditionelle Agraralkoholerzeugung<br />
in Deutschland <strong>und</strong> auch ihre wichtigen Funktionen für den<br />
Umwelt- <strong>und</strong> Klimaschutz aufrecht zu erhalten. Die Stützung<br />
der landwirtschaftlichen Agraralkoholerzeugung steht im Einklang<br />
mit der Lissabon-Strategie <strong>und</strong> weiteren Politikzielen der<br />
Europäischen Union. Der deutsche <strong>und</strong> EU-Alkoholmarkt wird<br />
nicht gestört, da der Marktanteil des in Deutschland gestützten<br />
Agraralkohols nur r<strong>und</strong> 1 Prozent des europäischen Marktes<br />
ausmacht.<br />
Hopfen<br />
Im B<strong>und</strong>esgebiet betrug die Erntemenge im Juli <strong>2008</strong> 39.500<br />
Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung der Ernte von 22<br />
Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 32.500 Tonnen. Die sehr<br />
gute Ernte <strong>2008</strong> hat in Deutschland zu vergleichsweise großen<br />
Freihopfenmengen geführt. Damit können in allen Marktsegmenten<br />
die Bedürfnisse des Braujahres <strong>2009</strong> vollständig abdeckt<br />
werden. Allerdings gibt der Deutsche Bauernverband zu<br />
bedenken, dass es eine Hopfenernte wie <strong>2008</strong> nur sehr selten<br />
gibt. Allerdings werden <strong>2009</strong> zusätzliche Junghopfenflächen<br />
in den Vollertrag kommen.<br />
Im Rahmen der „unbedenklichen“ Vertragsmenge dürften<br />
die Ernten <strong>2009</strong> <strong>und</strong> 2010 weitgehend verkauft sein. Für die<br />
Folgejahre bis einschließlich 2013/14 wurden ebenfalls bereits<br />
große Mengen kontrahiert. Nach Ansicht des Deutschen Bauernverbandes<br />
sollte die Brauwirtschaft am System der Vorkon-<br />
82
trakte festhalten, auch wenn eines Tages die Spotpreise wieder<br />
unter dem Kontraktniveau liegen werden. Nur so lässt sich der<br />
Hopfenmarkt einigermaßen stabilisieren.<br />
Zur Produktion von Qualitätshopfen wird eine ausreichende<br />
Auswahl gezielt einsetzbarer Pflanzenschutzmittel benötigt.<br />
Ansonsten funktionieren integrierter Pflanzenschutz <strong>und</strong> Resis-<br />
tenzmanagement nicht. Die Folge wären steigende Aufwandmengen<br />
wegen steigender Resistenzen <strong>und</strong> steigende Kosten.<br />
Dem Berufsstand ist in Sachen geschützter geographischer<br />
Angabe (g. g. A.) „Hallertauer Hopfen“ nach über fünfjähriger<br />
Verfahrensdauer seit Antragstellung beim Deutschen Patent-<br />
<strong>und</strong> Markenamt endlich ein Durchbruch gelungen. Auch konnte<br />
der Berufsstand erreichen, dass die EU-Fördermittel für die<br />
deutschen Hopfenerzeugergemeinschaften durch gesetzliche<br />
Verankerung in der Gemeinsamen Marktordnung abgesichert<br />
wurden.<br />
DBV-Position<br />
• Mit dem neuen „Europäischen Pflanzenschutzpaket“ sind<br />
für den Hopfenanbau zum einen Chancen (z. B. Dreizonen-<br />
zulassung), aber durch die neuen „Cut-off-Kriterien“ auch<br />
erhebliche Risiken verb<strong>und</strong>en. So könnten mit den Azolen<br />
für den Hopfenanbau lebensnotwendige Fungizide schon<br />
bald den neuen Bestimmungen zum Opfer fallen.<br />
• Darüber hinaus ist auch in Zukunft eine zentrale <strong>und</strong> gemeinsame<br />
Exportförderung <strong>und</strong> Messebeteiligung für die<br />
deutsche Hopfenwirtschaft von existenzieller Bedeutung.<br />
Tabak<br />
Durch den Vertragsanbau <strong>und</strong> die Marktlage kann der Tabakmarkt<br />
für den Berichtzeitraum als zufriedenstellend bis gut<br />
bewertet werden. Die im Jahr <strong>2008</strong> in Deutschland erzeugten<br />
Tabake konnten alle rechtzeitig unter Vertrag genommen werden,<br />
so dass jeder Tabakpflanzer sowohl seinen Vertragspartner<br />
als auch den zu erwartenden Rohtabakpreis kannte. Dank<br />
der vielerorts vorhandenen Beregnungsmöglichkeiten <strong>und</strong> des<br />
für den Aufwuchs guten Wetters, konnten die Tabakbestände<br />
gut heranwachsen <strong>und</strong> haben größtenteils zu guten bis sehr<br />
guten Qualitäten geführt. Bei der Quantität kann beim Virgin<br />
bis auf einige Ausnahmen in Norddeutschland von einer<br />
sehr guten Ernte, bei den luftgetrockneten Tabaken immerhin<br />
noch von einer guten Ernte gesprochen werden. Bis zum<br />
6. Februar waren in diesem Jahr alle Verwiegungen <strong>und</strong> somit<br />
der Jahrgang <strong>2008</strong> abgeschlossen. Probleme bereiteten<br />
83<br />
Pflanzenproduktion
vor allen Dingen die explodierenden Kosten für Energie <strong>und</strong><br />
Düngemittel, sowie die Beschaffung der Saisonarbeitskräfte,<br />
was zu teilweise erheblichen Problemen bei der Ernte <strong>und</strong> der<br />
Aufbereitung der Tabake führte.<br />
Die GAP-Reform verursachte nach wie vor Unsicherheiten<br />
bei den Tabakpflanzern bezüglich der zukünftigen Ausrichtung<br />
der Betriebe. Der Deutsche Bauernverband bemüht sich daher<br />
um verlässliche langfristige Rahmenbedingungen in Politik<br />
<strong>und</strong> Markt, um den Tabakanbau in Deutschland weiterhin erhalten<br />
zu können.<br />
Nach den Ergebnissen des Health Check im November <strong>2008</strong><br />
wird <strong>2009</strong> das letzte Jahr der Marktordnung <strong>und</strong> damit gekoppelter<br />
Prämienzahlungen sein. Diese Entwicklung hat dazu geführt,<br />
dass sich erste Käuferfirmen bereit erklärt haben, sich<br />
auch über das Jahr <strong>2009</strong> hinaus am deutschen Rohtabakmarkt<br />
zu engagieren. Dies eröffnet neue Perspektiven <strong>und</strong> lässt die<br />
Betriebe erstmals seit 2004 wieder leicht optimistisch in die<br />
Zukunft blicken.<br />
DBV-Position<br />
• Die Abschmelzung bei den „Tabakzahlungsansprüchen“ von<br />
2010 bis 2013 ist auszusetzen <strong>und</strong> die Strukturfondsmittel,<br />
die ab 2010 aus der Prämie der Tabakpflanzer kommen, müs-<br />
sen den aktiven Tabakpflanzern für produktspezifische<br />
Investitionen zur Verfügung stehen.<br />
• Eine schnellere <strong>und</strong> weniger bürokratische <strong>und</strong> stärker an<br />
den Erfordernissen des praktischen Anbaus ausgerichtete<br />
sowie auch EU-weit einheitlich gültige Zulassung neuer <strong>und</strong><br />
notwendiger Pflanzenschutzmittel muss erfolgen.<br />
84
Arznei- <strong>und</strong> Gewürzpflanzen<br />
Der Fachausschuss für Arznei- <strong>und</strong> Gewürzpflanzen tagte unter<br />
Vorsitz von Dr. Andreas Plescher im März <strong>2008</strong> in Bad Hersfeld<br />
<strong>und</strong> im September <strong>2008</strong> in Küsten.<br />
Wichtige Themen der Beratungen im deutschen Fachausschuss<br />
waren aktuelle Forschungsvorhaben zur Verbesserung der<br />
Wettbewerbsposition des Arznei- <strong>und</strong> Gewürzpflanzenanbaus,<br />
der Bereich Lückenindikationen im Arznei- <strong>und</strong> Gewürzpflanzenbau<br />
sowie der Pflanzenschutz generell <strong>und</strong> die GAP-Reform <strong>und</strong><br />
deren Auswirkungen auf den Arznei- <strong>und</strong> Gewürzpflanzenbau.<br />
Grüne Gentechnik<br />
Die Diskussion über den Einsatz gentechnisch veränderter<br />
(GVO)-Pflanzen in der Landwirtschaft wird weiterhin intensiv<br />
geführt. Zu wenig wird allerdings zwischen dem tatsächlichen<br />
Anbau in Deutschland <strong>und</strong> dem Import gentechnisch veränderter<br />
Futtermittel unterschieden.<br />
Rückläufige Anbaufläche<br />
Der Anbau betrug in Deutschland im Jahre <strong>2008</strong> etwa 2.700<br />
Hektar Mais <strong>und</strong> damit 0,2 Prozent der Maisanbaufläche. Für<br />
das laufende Jahr wird eher mit einer rückläufigen Anbaufläche<br />
gerechnet. Damit reagieren die Landwirte auf die sehr<br />
emotional geführte gesellschaftliche Debatte <strong>und</strong> auch auf<br />
die Zurückhaltung der Marktpartner. Die Maissorte MON810,<br />
ein gegen das Schadinsekt Maiszünsler resistenter Mais, bleibt<br />
der einzige zum Anbau zugelassene GVO-Mais in Europa. Seit<br />
April <strong>2009</strong> ist jedoch der Anbau von MON810 in Deutschland<br />
bis zur endgültigen Klärung durch die EU-Kommission untersagt,<br />
nachdem B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner<br />
die europarechtlich zulässige Schutzklausel gegen den Anbau<br />
verhängt hat.<br />
Die Stärkekartoffel Amflora, die zu annähernd 100 Prozent<br />
Amylosestärke produziert, findet nicht den Weg zur Zulassung.<br />
Obwohl die europäische Behörde EFSA die Unbedenklichkeit<br />
der Kartoffel wissenschaftlich bestätigt hat, findet der Vorschlag<br />
zur Zulassung nicht die erforderliche qualifizierte Mehrheit<br />
im Rat der europäischen Umweltminister. In der jetzt für<br />
die Entscheidung zuständigen Europäischen Kommission verweigert<br />
der Umweltkommissar die Zustimmung. Deshalb wurde<br />
die EFSA erneut aufgefordert, eine Bewertung von „Amflora“<br />
vorzunehmen.<br />
85<br />
Pflanzenproduktion
GVO-freie Anbauregionen auf freiwilliger Basis<br />
Die Bildung von GVO-freien Regionen auf freiwilliger Basis<br />
hat der Deutsche Bauernverband immer unterstützt. Erfolgt<br />
die Bildung verpflichtend durch die Kommune, stellt das aber<br />
einen tiefen Eingriff in das Eigentum des Landwirts dar. Der<br />
Landwirt muss seine Entscheidung zur Bewirtschaftung eigenständig<br />
fällen können. Dabei sind aber die Koexistenzregeln<br />
einzuhalten.<br />
Eiweiß-Importe sichern<br />
Die europäische Futtermittelwirtschaft ist auf umfangreiche<br />
Importe an Eiweißträgern aus den USA <strong>und</strong> Südamerika angewiesen.<br />
In diesen Ländern findet der Anbau von GVO-Pflanzen<br />
aber immer mehr Verbreitung; vereinzelt befinden sich Pflanzen<br />
im Anbau, die in Europa wegen des langwierigen Zulassungsprozesses<br />
noch keine Zulassung zum Import <strong>und</strong> zur<br />
Verarbeitung zu Lebens- oder Futtermitteln besitzen. Ohne Zulassung<br />
ist der Import, auch bei Vorhandensein kleiner Spuren,<br />
untersagt <strong>und</strong> Europa droht von Eiweißimporten abgeschnitten<br />
zu werden. Der Deutsche Bauernverband fordert deshalb<br />
eine Aufhebung der Nulltoleranz, um im Falle von Spuren nicht<br />
zugelassener GVO nicht komplette Schiffsladungen zurückschicken<br />
zu müssen.<br />
Bislang konnte die EU-Kommission noch keinen Vorschlag<br />
vorlegen, wie diesem Problem begegnet werden könnte. Allerdings<br />
hat der Deutsche Bauernverband erreicht, dass im aktuellen<br />
Fall die EU-Kommission einem drohenden Importstopp<br />
mit einer raschen Zulassung zuvorkommt. Dennoch ist das Prob-<br />
lem der Nulltoleranz nicht gelöst. Angesichts ständig neuer<br />
Zulassungen in Übersee dürfte schon bald wieder die Problematik<br />
eines Importstopps anstehen.<br />
Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ ist irreführend<br />
Die im vergangenen Jahr geschaffene neue Regelung zur<br />
Kennzeichnung von Produkten mit dem Etikett „Ohne Gentechnik“<br />
wird am Markt nur in begrenztem Umfang angewandt.<br />
Insbesondere bei Fleisch <strong>und</strong> Milch findet sie kaum Anwendung,<br />
da die Marktbeteiligten um die knappe Verfügbarkeit<br />
von kennzeichnungsfreien Futtermitteln <strong>und</strong> deren schwierige<br />
kontinuierliche Beschaffung wissen. Eine Studie aus Hessen<br />
kommt zum Ergebnis, dass der Verbraucher mit der Auslobung<br />
„Ohne Gentechnik“ verbindet, dass im gesamten Produktionsprozess<br />
auf den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen<br />
verzichtet wird. Stattdessen erlaubt die Kennzeichnung „Ohne<br />
Gentechnik“ in Futtermitteln Vitamine <strong>und</strong> Enzyme, die mit<br />
Hilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt wur-<br />
86
den. Ebenso ist erlaubt, in bestimmten Lebensabschnitten des<br />
Tieres, dessen Produkte „Ohne Gentechnik“ ausgelobt werden<br />
sollen, gentechnisch veränderte Futtermittel zu verabreichen.<br />
Die Studie belegt damit die seitens des Deutschen Bauernverbandes<br />
in der Diskussion über die Einführung der Kennzeichnung<br />
vorgebrachten kritischen Argumente.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband bekräftigt seine Haltung zur<br />
Grünen Gentechnik <strong>und</strong> rät Landwirten weiterhin vom Anbau<br />
ab. Verantwortlich sind dafür die verschuldensunab-<br />
hängigen Haftungsregelungen <strong>und</strong> die Ablehnung der Ver-<br />
braucher. Dennoch muss eine umfassende Erforschung der<br />
Grünen Gentechnik auch aus Gründen der Risikoabschätzung<br />
weiter vorangetrieben werden.<br />
• Angesichts des weit verbreiteten Einsatzes gentechnisch<br />
veränderter Futtermittel im Produktionsprozess bei Pro-<br />
dukten tierischer Herkunft ist eine Änderung der Kennzeich-<br />
nungsregelung bei diesen Produkten dringend erforderlich.<br />
Im Sinne einer ehrlichen <strong>und</strong> klaren Kennzeichnung fordert<br />
der Deutsche Bauernverband eine Prozesskennzeichnung<br />
der Produkte mit dem deutlichen Hinweis, dass die Produkte<br />
unter Verwendung gentechnisch veränderter Produkte<br />
hergestellt wurden. Die derzeit gültige Kennzeichnung<br />
„Ohne Gentechnik“ wird dem Anspruch an Wahrheit <strong>und</strong><br />
Klarheit nicht gerecht.<br />
• Um die europäische Futtermittelwirtschaft auch künftig ausreichend<br />
mit Eiweißfuttermitteln in erforderlichem Um-<br />
fang zu günstigen Preisen versorgen zu können, fordert der<br />
Deutsche Bauernverband endlich praktikable Lösungen zum<br />
Umgang mit der Nulltoleranz, die es ermöglichen, bei Spu-<br />
ren nicht in Europa zugelassener GVO-Anteile den Import zu<br />
ermöglichen.<br />
• Das Ausrufen verpflichtender gentechnikfreier Anbauregionen<br />
durch Gebietskörperschaften lehnt der Deutsche Bau-<br />
ernverband mit dem Hinweis auf den tiefen Eingriff in das<br />
Eigentum des Landwirts entschieden ab.<br />
87<br />
Pflanzenproduktion
Lebensmittelsicherheit/-recht<br />
QS – Qualität <strong>und</strong> Sicherheit<br />
Der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Raiffeisenverband,<br />
der Lebensmitteleinzelhandel <strong>und</strong> die Fleischwirtschaft (DVF<br />
<strong>und</strong> VDF) sowie die CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der<br />
deutschen Agrarwirtschaft mbH haben mit der QS GmbH ein<br />
weltweit führendes Qualitätssicherungssystem für Lebensmittel<br />
aufgebaut. Zahlreiche Unternehmen im In- <strong>und</strong> Ausland<br />
haben sich dem QS-System angeschlossen. Deutlich stieg die<br />
Zahl der teilnehmenden schweinehaltenden Betriebe am QS-<br />
System. Hier gab es einen Zugewinn von 1.490 Betrieben auf<br />
43.818 Systemteilnehmer in <strong>2008</strong>.<br />
Servicepaket Gesamtbetrieb – Landwirtschaft/<br />
Erzeugung<br />
Die Anforderungen aller Leitfäden der Stufe Landwirtschaft<br />
sind sowohl für die Betriebszweige (Produktionsarten) die stufenübergreifend,<br />
als auch die noch nicht stufenübergreifend<br />
am QS-System teilnehmen, in ein modulares Servicepaket zusammengeführt<br />
worden. Die Produktausschüsse des Deutschen<br />
Bauernverbandes haben diese umfangreiche Revision des Betriebsaudits<br />
Landwirtschaft begleitet. Anforderungen noch<br />
nicht zu einer Systemkette zählender Sektoren (Ackerbau,<br />
Grünland, Legehennen, Milchvieh <strong>und</strong> Kälber) sind nach den<br />
Vorgaben des Deutschen Bauernverbandes umgesetzt. Bei den<br />
stufenübergreifenden Bereichen in der Tier- <strong>und</strong> Pflanzenproduktion<br />
müssen die Anforderungen mit den Partnern der Kette<br />
abgestimmt werden.<br />
QS – Fleisch <strong>und</strong> Fleischwaren<br />
Im Sektor Fleisch <strong>und</strong> Fleischwaren beteiligen sich 101.242 Betriebe<br />
am QS-System. Heute sind in 23.728 Geschäften Fleisch-<br />
<strong>und</strong> Wurstwaren mit dem QS-Prüfzeichen zu finden. Sowohl bei<br />
Mastgeflügel als auch bei Mastschweinen sind heute über 80<br />
Prozent der deutschen Ware QS-zertifiziert. Standard ist bei<br />
beiden Produktionsrichtungen das breit angelegte QS-Salmonellen-Monitoring.<br />
Die Schweine-Salmonellenverordnung<br />
schreibt vor, dass Betriebe ab Frühjahr <strong>2008</strong> kategorisiert sein<br />
müssen. QS ermöglicht Nicht-QS-Betrieben, über ihre Bündler<br />
die Salmonellen-Datenbank zu nutzen.<br />
Neben Bayern, Baden-Württemberg <strong>und</strong> Thüringen konnten<br />
Datenaustauschvereinbarungen mit den QM-Milch-Organisa-<br />
88
tionen Schleswig-Holstein <strong>und</strong> Sachsen-Anhalt unterzeichnet<br />
werden. Voraussetzung für die Lieferfähigkeit von Schlachtkühen<br />
an QS-Schlachtbetriebe sind erfüllt, wenn QM-Milch-<br />
Betriebe in der QS-Datenbank geführt werden. 7.200 landwirtschaftliche<br />
Betriebe sind mit der Auditanerkennung QM-Milch<br />
berechtigt, ihre Schlachtkühe als QS-Tiere zu vermarkten.<br />
Mit dem Inkrafttreten des Leitfadens Tiertransport zum<br />
Januar <strong>2009</strong> wurde ein wichtiges Glied in der stufenübergreifenden<br />
Qualitätssicherung der QS geschlossen. Die Vorgaben<br />
gelten für Landwirte <strong>und</strong> Tiertransportunternehmen zunächst<br />
freiwillig, sind jedoch ab 2011 verpflichtend.<br />
Solange es keine Alternative zum vollständigen Verzicht auf<br />
die Ferkelkastration gibt, schreibt QS zur Linderung des postoperativen<br />
W<strong>und</strong>schmerzes den Einsatz von Schmerzmitteln<br />
bei der Kastration von Ferkeln vor. Bis praxistaugliche Alternativmethoden<br />
zur Verfügung stehen, müssen QS-Systemteilnehmer<br />
ab April <strong>2009</strong> Schmerzmittel bei der Ferkelkastration<br />
verabreichen.<br />
Mit dem Veterinäramt des Landkreises Borken wurde ein<br />
Modellprojekt initiiert, bei dem QS-zertifizierte landwirtschaftliche<br />
Betriebe künftig in der amtlichen Risikokategorie<br />
niedriger eingestuft werden. Damit reduziert sich die Zahl der<br />
amtlichen Kontrollen in diesen Betrieben.<br />
QS – Obst, Gemüse, Kartoffeln<br />
Mehr als 19.260 Betriebe beteiligen sich derzeit am QS-System.<br />
Von 9.364 landwirtschaftlichen <strong>und</strong> gartenbaulichen<br />
89
Betrieben verfügen 5.359 über ein QS-GAP Zertifikat. Die Qualitätsstandards<br />
QS-GAP <strong>und</strong> GLOBALGAP für Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
haben über ein Rebenchmarkingverfahren die gegenseitige<br />
Anerkennung bis 2011 erneuert. Damit können Landwirte, die<br />
nach einem der beiden Systeme auditiert sind, in das jeweilige<br />
andere System liefern.<br />
Im Bereich Obst, Gemüse <strong>und</strong> Kartoffeln ist die Zahl der<br />
Partner auf Stufe des Frucht- <strong>und</strong> Kartoffelgroßhandels auf<br />
476 Betriebe gewachsen. Auf der Stufe Lebensmitteleinzelhandel<br />
wuchs die Zahl der teilnehmenden Outlets auf 9.420.<br />
Ein Rückstandsmonitoring wurde als neues Modul aufgenommen<br />
<strong>und</strong> steht mit Benutzerhandbüchern im Internet für<br />
Großhändler, Bündler <strong>und</strong> Labore deutsch- <strong>und</strong> englischsprachig<br />
zum Abruf bereit. Das QS-Rückstandsmonitoring ist von<br />
gr<strong>und</strong>legender Bedeutung. Es dient dem Nachweis der Einhaltung<br />
der zulässigen Höchstmengen für Pflanzenschutzmittel<br />
bei Obst, Gemüse <strong>und</strong> Kartoffeln.<br />
DBV-Position<br />
Die gegenseitige Systemanerkennung sowie die Zusammenführung<br />
der verschiedenen Audits sind vorrangige Aufgaben<br />
des Deutschen Bauernverbandes. Zudem erfordert ein funktionierendes<br />
Krisenmanagement eine enge Zusammenarbeit<br />
zwischen Bündlern <strong>und</strong> Landwirten. Der Deutsche Bauernverband<br />
arbeitet intensiv daran, die vielen Leitfäden an eine<br />
unbürokratische <strong>und</strong> praktikable Handhabe anzupassen <strong>und</strong><br />
zu straffen. Mit der Zusammenführung der Leitfäden Tier- <strong>und</strong><br />
Pflanzenproduktion stehen bei QS seit April <strong>2008</strong> Checklisten<br />
zur Eigenkontrolle für die jeweiligen Produktionslinien im Internet.<br />
Damit wurde der Baustein für eine direkte Verzahnung<br />
z. B. mit dem Betriebsberatungssystem KKL gelegt. Für den<br />
Deutschen Bauernverband ist vorrangig, dass die gängigen<br />
Qualitätssicherungssysteme QS, QM <strong>und</strong> GLOBALGAP zu keiner<br />
Doppelarbeit im landwirtschaftlichen Betrieb führen. Die komplette<br />
Eigenkontrolle dieser freiwilligen Qualitätssicherungsprogramme<br />
sowie die Einhaltung von Cross Compliance mit<br />
Fachrechtsvorgaben bieten die Checklisten aus dem KKL.<br />
Lebensmittelkennzeichnung<br />
Das Inkrafttreten der neuen „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung<br />
brachte, wie erwartet, keine Ruhe in die Kennzeichnungsdebatte.<br />
Auch die Bereiche Nährwerte, Ampel, Herkunft, Tierschutz<br />
<strong>und</strong> Klimarelevanz bestimmen nach wie vor die Diskussionen.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband setzte sich im Berichtszeitraum<br />
90
sowohl national als auch auf EU-Ebene für klare <strong>und</strong> wahre<br />
Kennzeichnungsregelungen ein. Halbwahrheiten <strong>und</strong> Aussagen,<br />
die sich nicht selbst erschließen, verunsichern die Verbraucher<br />
<strong>und</strong> beinhalten keinen Mehrwert für die Produzenten.<br />
Deshalb sprach sich der Deutsche Bauernverband national<br />
gegen eine „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung aus, die einen<br />
gewissen Einsatz von GVO in der Produktion duldet. Der Gesetzgeber<br />
führte dennoch eine Lockerung herbei. Erwartungsgemäß<br />
stößt das Siegel bei Produzenten <strong>und</strong> Verbrauchern<br />
auf nur geringe Akzeptanz. Der Deutsche Bauernverband wird<br />
seinen klaren Kurs zur Lebensmittelkennzeichnung beibehalten.<br />
Deshalb lehnt er auch eine sogenannte „Ampel“ zur<br />
Nährwertkennzeichnung ab. Anstatt die Verbraucher über die<br />
Bedeutung eines Lebensmittels für eine vollwertige Ernährung<br />
aufzuklären, wird z. B. durch ein „Rot“ auf einem Päckchen<br />
Butter suggeriert, dass diese gr<strong>und</strong>sätzlich nicht gut für die<br />
Ernährung sei <strong>und</strong> deshalb besser weggelassen werden sollte.<br />
Herkunftskennzeichnung<br />
Auf EU-Ebene ist die Herkunftskennzeichnung durch mehrere<br />
Vorhaben betroffen. Sowohl in der sogenannten „Lebensmittelinformationsverordnung“<br />
als auch im „Grünbuch über die<br />
Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ wird überlegt, wie<br />
das Verlangen der Verbraucher nach Information über Ursprung<br />
bzw. Herkunft des Lebensmittels besser bedient werden<br />
kann.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband spricht sich dafür aus, dass im<br />
Idealfall der Mitgliedstaat, in welchem der wesentliche Beitrag<br />
zur Erzeugung des Rohstoffes erfolgt, ausgelobt wird. Sofern<br />
dies jedoch bei einzelnen Warenströmen, wie z. B. Mehl, logistisch<br />
nicht bzw. nur mit nicht vertretbarem Aufwand zu<br />
leisten ist, muss davon abgesehen werden können. Darüber<br />
hinaus fordert der Deutsche Bauernverband, dass künftig<br />
unterb<strong>und</strong>en wird, dass ein Drittlandsprodukt (z. B. Geflügelfleisch)<br />
mittels geringfügiger Verarbeitung in der EU (bloßes<br />
Marinieren) zu einem Lebensmittel aus der EU bzw. einem ihrer<br />
Mitgliedstaaten wird.<br />
Mess-/Eichwesen<br />
Das B<strong>und</strong>eswirtschaftsministerium legte im Berichtszeitraum<br />
einen Gesetzentwurf vor, der beabsichtigte, die staatliche Zulassung<br />
<strong>und</strong> Ersteichung in die Hand privater Konformitätsbewertungsstellen<br />
zu legen. Gleiches war für den technischen<br />
Teil der Nacheichung vorgesehen.<br />
91<br />
Lebensmittelsicherheit/-recht
DBV-Position<br />
Die deutsche Landwirtschaft ist in höchstem Maße auf Vorleistungen<br />
wie Futtermittel, Energie, Dünge- <strong>und</strong> Pflanzenschutzmittel<br />
in einer Höhe von etwa 27 Milliarden Euro angewiesen.<br />
Gleichzeitig werden durch sie jährlich r<strong>und</strong> 43 Millionen Tonnen<br />
Getreide, 27 Millionen Tonnen Milch <strong>und</strong> 7,5 Millionen Tonnen<br />
Fleisch produziert. Dies entspricht einem Produktionswert von<br />
r<strong>und</strong> 44 Milliarden Euro. Sowohl die landwirtschaftlichen Betriebsmittel<br />
als auch Produkte werden nach Qualität <strong>und</strong> Quantität<br />
abgerechnet. Hier kommt es auf eine verlässliche Messtechnik<br />
an, die die geplante Neuregelung nicht gewährleis-<br />
tet hätte. Auf Druck des Deutschen Bauernverbandes versagte<br />
das B<strong>und</strong>esjustizministerium die Zustimmung, worauf das<br />
B<strong>und</strong>eswirtschaftsministerium den Gesetzentwurf zurückzog.<br />
Hygienepaket<br />
Im Berichtszeitraum stand sowohl die Überprüfung des EU-<br />
Rechts als auch der nationalen Durchführungsvorschriften an.<br />
DBV-Position<br />
Die Beachtung von Hygieneerfordernissen bei der Produktion<br />
von Lebensmitteln liegt im ureigenen Interesse der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe. Dies gewährleistet Zufriedenheit der<br />
Abnehmer <strong>und</strong> Verbraucher, was Basis für den wirtschaftlichen<br />
Erfolg des Betriebes ist. Dennoch sind alle Vorschriften auf<br />
ihren Nutzen hin zu überprüfen. Gängelungen, die keinen zusätzlichen<br />
Beitrag zur Lebensmittelsicherheit gewährleisten,<br />
werden entschieden abgelehnt. Nur tatsächliche Risiken recht-<br />
92
fertigen staatliche Vorgaben. Deshalb fordert der Deutsche<br />
Bauernverband Erleichterungen bei den Anforderungen des<br />
Lebensmittelhygienerechts für bestimmte landwirtschaftliche<br />
Betriebe (z. B. extensive Haltungsformen) sowie bei der Lebensmittelketteninformation<br />
<strong>und</strong> die Einführung kleiner Mengen<br />
für den Rotfleischbereich.<br />
93<br />
Lebensmittelsicherheit/-recht
Ökologischer Landbau<br />
Ende <strong>2008</strong> haben in Deutschland knapp 20.000 Betriebe auf<br />
insgesamt gut 900.000 Hektar nach den Richtlinien der EG-<br />
Öko-Verordnung gewirtschaftet. Der Anteil der Bio-Flächen an<br />
der Gesamt-LN ist damit auf 5,4 Prozent angestiegen. Der Umsatz<br />
mit ökologisch erzeugten Lebensmitteln ist in <strong>2008</strong> um 10<br />
Prozent auf r<strong>und</strong> 5,8 Milliarden Euro angestiegen. Davon kommen<br />
nach Schätzung der ZMP etwa 1,2 Milliarden Euro unmittelbar<br />
als Erlös bei den Bio-Erzeugern an. Wenngleich sich für<br />
die Zukunft ein steigender Importdruck abzeichnet, waren die<br />
Erzeugerpreise für viele Bioprodukte in den vergangenen zwei<br />
Jahren relativ stabil auf zufriedenstellendem Niveau. Nicht zuletzt<br />
dadurch ist ein steigendes Umstellungsinteresse konventioneller<br />
Betriebe zu verzeichnen. Mit der seit 1. Januar <strong>2009</strong><br />
in Kraft getretenen Totalrevision der EG-Öko-Verordnung (Nr.<br />
834/2007, mit Durchführungsverordnung Nr. 889/<strong>2008</strong>) ist für<br />
die Bioerzeuger wieder vermehrt Rechtsicherheit eingetreten.<br />
Der DBV-Fachausschuss Ökologischer Landbau hat sich im<br />
vergangenen Jahr insbesondere mit der Marktentwicklung<br />
<strong>und</strong> der Erarbeitung von Durchführungsbestimmungen für<br />
die neue EG-Öko-Verordnung befasst. Nicht zuletzt durch sein<br />
Engagement <strong>und</strong> in Kooperation mit dem europäischen Bauernverband<br />
COPA konnten in zahlreichen Fällen praxisgerechte<br />
Regelungen durchgesetzt werden. Mit einer Veranstaltung zum<br />
ökologischen Landbau auf dem Deutschen Bauerntag in Berlin<br />
<strong>2008</strong> <strong>und</strong> mit einem Perspektivforum auf der BioFach in Nürnberg<br />
<strong>2009</strong> hat der Fachausschuss klar Stellung bezogen <strong>und</strong><br />
aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben.<br />
DBV-Position<br />
• Der ökologische Landbau soll innerhalb des Deutschen Bauernverbandes<br />
<strong>und</strong> seiner Landesbauernverbände als eigen-<br />
ständiges Marktsegment weiter gestärkt <strong>und</strong> profiliert wer-<br />
den. Der Informationsaustausch <strong>und</strong> die Zusammenarbeit<br />
der Erzeuger des ökologischen Landbaus soll weiter verbes-<br />
sert werden.<br />
• Die steigende Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln<br />
darf nicht allein von ausländischen Erzeugern ge-<br />
deckt werden. Daher setzt sich der Deutsche Bauernverband<br />
dafür ein, den Marktanteil der heimischen Bioerzeuger zu<br />
sichern <strong>und</strong> auszubauen. Dafür sind entsprechende poli-<br />
tische Rahmenbedingungen nötig, für die der Deutsche Bau-<br />
94
Umsatz (Mrd. Euro)<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2000<br />
Entwicklung des Ökologischen Landbaus in Deutschland<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Anbaufläche Betriebe Umsatz<br />
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
ernverband eintritt.<br />
• Der ökologische Landbau ist in hohem Maße auf züchterischen<br />
<strong>und</strong> technischen Fortschritt angewiesen, von dem<br />
vielfach auch konventionelle Betriebe profitieren können.<br />
Der Deutsche Bauernverband wirbt für einen deutlichen<br />
Ausbau der praxisbezogenen Forschung für den ökolo-<br />
gischen Landbau.<br />
• Der ökologische Landbau ist existenziell auf eine hohe<br />
Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> großes Verbrauchervertrauen ange-<br />
wiesen. Die „Echtheit“ von Biolebensmitteln muss daher<br />
bestmöglich gesichert sein. Mit zunehmender Komplexität<br />
der Warenströme im Ökomarkt muss daher auch das beste-<br />
hende Öko-Kontrollsystem weiterentwickelt werden. Hand-<br />
lungsbedarf besteht innerhalb Deutschlands, in zahlreichen<br />
EU-Ländern <strong>und</strong> insbesondere bei Drittlandimporten.<br />
• Die neue EG-Öko-Verordnung sieht vor, dass ab Mitte 2010<br />
alle Biolebensmittel mit einem noch zu entwickelnden EU-<br />
Siegel gekennzeichnet werden müssen. Zeitgleich soll eine<br />
verpflichtende Herkunftskennzeichnung eingeführt wer-<br />
den, die im Regelfall jedoch nur zwischen EU- <strong>und</strong> Nicht-EU-<br />
Herkünften unterscheidet. Diese Regelung geht sowohl an<br />
den Verbrauchererwartungen als auch an den Interessen<br />
der Landwirte vorbei. Der Deutsche Bauernverband setzt<br />
sich daher für eine praxisgerechte Überarbeitung der Her-<br />
kunftskennzeichnung sowie für die rasche Entwicklung eines<br />
neuen, marktwirksamen EU-Bio-Siegels ein.<br />
0<br />
Quelle: BMELV, BÖLW, ZMP<br />
ha LN bzw. Betriebe x 0,1<br />
95<br />
Ökologischer Landbau
96<br />
Marktpolitik/Absatzförderung<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> hat der Deutsche Bauernverband die Neuausrichtung<br />
der CMA hin zu einem modernen <strong>und</strong> transparenten<br />
Dienstleistungsunternehmen für die deutsche Land- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft<br />
aktiv begleitet. Diese Entwicklung wurde<br />
von der gesamten Wirtschaft positiv bewertet <strong>und</strong> unterstützt.<br />
Dennoch hat Anfang <strong>2009</strong> das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht<br />
in einem Gr<strong>und</strong>satzurteil über die Zulässigkeit sogenannter<br />
„Sonderabgaben“ das Absatzfondsgesetz unerwartet als verfassungswidrig<br />
<strong>und</strong> nichtig beurteilt. Damit entfallen die Abgaben<br />
der Flaschenhalsbetriebe zum Absatzfonds <strong>und</strong> somit<br />
auch die Geschäftsgr<strong>und</strong>lage für CMA <strong>und</strong> ZMP. Beide Durchführungsgesellschaften<br />
müssen daher – möglichst sozialverträglich<br />
– liquidiert werden.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband ist überzeugt, dass auch weiterhin<br />
eine gemeinsame Absatzförderung der Land- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft<br />
erforderlich ist. Die einzelnen Landwirte<br />
<strong>und</strong> die zumeist mittelständischen Unternehmen der<br />
Ernährungswirtschaft sind finanziell <strong>und</strong> organisatorisch<br />
nicht in der Lage, beispielsweise die Erschließung <strong>und</strong><br />
Pflege neuer Exportmärkte, die Imagearbeit für die heimische<br />
Landwirtschaft oder die Aufklärung über die Zubereitung<br />
<strong>und</strong> Qualität der deutschen Agrarerzeugnisse zu<br />
Deutscher Agraraußenhandel wächst<br />
Angaben in Milliarden Euro<br />
34,8<br />
19,5<br />
95 95<br />
Import<br />
96 96<br />
97 97<br />
39,7<br />
24,2<br />
98 98<br />
99 99<br />
Quellen: ZMP, BMELV, Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
00 00<br />
43,4<br />
30,4<br />
01 01<br />
02 02<br />
03 03<br />
45,2<br />
33,8<br />
04 04<br />
05 05<br />
06 06<br />
57,0<br />
46,0<br />
Export<br />
*geschätzt<br />
07 07 08* 08*<br />
62,2<br />
52,4<br />
Foto: mbfotos/fotolia<br />
© ZMP <strong>2008</strong> – G424
ewerkstelligen. Der Deutsche Bauernverband setzt sich für<br />
eine weitgehend privat finanzierte Lösung ohne EU-recht-<br />
liche Begrenzungen ein. Gerade bei der Exportförderung<br />
kann der Staat aber nicht aus der Verantwortung gelassen<br />
werden.<br />
• Völlig unverzichtbar für die Landwirtschaft ist eine neutrale<br />
Markt- <strong>und</strong> Preisberichterstattung, wie sie in den letz-<br />
ten Jahrzehnten sehr erfolgreich von der ZMP durchgeführt<br />
worden ist. Mit zunehmender Globalisierung <strong>und</strong> Volatili-<br />
tät der Märkte wird diese Aufgabe in Zukunft noch wichtiger.<br />
Dabei brauchen die Landwirte nicht nur Marktinformationen<br />
über die Situation auf den Absatzmärkten für landwirt-<br />
schaftliche Erzeugnisse, sondern künftig auch über die<br />
Beschaffungsmärkte für landwirtschaftliche Produktions-<br />
mittel wie Energie, Saatgut oder Düngemittel. Der Deut-<br />
sche Bauernverband hat daher die Gründung der „Agrar-<br />
markt Informations-Gesellschaft mbH“ (AMI) auf den Weg<br />
gebracht. Zusammen mit Agrarverlagen <strong>und</strong> weiteren Ver-<br />
bänden als Gesellschafter wird somit eine schlanke, aber<br />
äußerst effiziente <strong>und</strong> zielgerichtete Marktbeobachtung<br />
ermöglicht. Die AMI soll als privat finanziertes Dienst-<br />
leistungsunternehmen etabliert <strong>und</strong> zum führenden<br />
Anbieter von Marktinformationen für die Land- <strong>und</strong> Ernäh-<br />
rungswirtschaft weiterentwickelt werden.<br />
97<br />
Marktpolitik
Zusätzliche Einkommen<br />
Direktvermarktung<br />
Die Fördergemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauernhof“ beim<br />
Deutschen Bauernverband steht zum einen für die politische<br />
Interessenvertretung für die Belange der Direktvermarkter <strong>und</strong><br />
zum anderen für die Verbreitung des einheitlichen Werbe- <strong>und</strong><br />
Erkennungszeichens „Einkaufen auf dem Bauernhof“. Im Mittelpunkt<br />
der Arbeit im Berichtsjahr <strong>2008</strong> stand die Überarbeitung<br />
des Leitfadens für eine gute Lebensmittelhygienepraxis in der<br />
landwirtschaftlichen Direktvermarktung. Durch die Änderung<br />
des europäischen Lebensmittelhygienerechts wurde diese Anpassung<br />
erforderlich. Der Abschluss der Überarbeitung einschließlich<br />
des nationalen <strong>und</strong> europäischen Notifizierungsverfahrens<br />
wird bis zur zweiten Jahreshälfte <strong>2009</strong> dauern.<br />
DBV-Position<br />
• Für die landwirtschaftliche Direktvermarktung muss ein<br />
nichtamtliches Hinweisschild eingeführt werden.<br />
• Der Stellenwert der Direktvermarktung muss auch im ländlichen<br />
Raum gestärkt werden.<br />
Urlaub auf dem Bauernhof/Landtourismus<br />
Mit dem Betriebszweig Urlaub auf dem Bauernhof erzielen<br />
viele landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland einen erheblichen<br />
Beitrag zum Betriebseinkommen. Die vom Deutschen<br />
Bauernverband mitgetragene „B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft für<br />
Urlaub auf dem Bauernhof <strong>und</strong> Landtourismus in Deutschland<br />
e.V.“ hat die Aufgabe, den Bauernhof- <strong>und</strong> Landurlaub zu fördern<br />
<strong>und</strong> diese Urlaubsform zunehmend bekannt zu machen.<br />
Sie vertritt die politischen Interessen der Ferienbauernhöfe<br />
<strong>und</strong> unterstützt ihre Landesverbände bei deren Marketingaktivitäten<br />
<strong>und</strong> Qualitätsoffensiven. Im vergangenen Jahr wurden<br />
neue Qualitätsauszeichnungen für „Anerkannte Urlaubs-<br />
Obsthöfe“ <strong>und</strong> „Anerkannte Erlebnis-Höfe“ entwickelt <strong>und</strong><br />
am Markt eingeführt. Mit der Vermarktung der Erlebnis-Höfe<br />
unterstützt die B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft nun auch Betriebe,<br />
die über keine eigenen Übernachtungsmöglichkeiten verfügen<br />
<strong>und</strong> sich vor allem über den Tagestourismus ein weiteres<br />
Standbein schaffen.<br />
98
DBV-Position<br />
• Gemeinsam mit der B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft setzt sich<br />
der Deutsche Bauernverband dafür ein, dass die rechtlichen<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den länd-<br />
lichen Tourismus weiter verbessert werden. Kernforderun-<br />
gen sind insbesondere die bessere Staffelung der Schulfe-<br />
rienzeiten, Entlastung der Vermieter bei der R<strong>und</strong>funkge-<br />
bühr <strong>und</strong> die Beseitigung baurechtlicher Hürden durch die<br />
Genehmigungspraxis vor Ort.<br />
• Da sich Urlaubsgäste nicht an politischen Verwaltungsgrenzen<br />
orientieren, muss die Kooperation zwischen den Bun-<br />
desländern <strong>und</strong> den Landesverbänden weiter vorangebracht<br />
werden. Insbesondere bei der Vermarktung der Urlaubs-<br />
ferienhöfe über das Internet müssen weitere Synergien<br />
geschaffen werden.<br />
• Der Deutsche Bauernverband unterstützt die B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft<br />
in ihrer Forderung für einen „Masterplan für<br />
den ländlichen Tourismus in Deutschland“, mit dem eine<br />
länderübergreifende Entwicklungsstrategie von B<strong>und</strong>,<br />
Ländern <strong>und</strong> der Wirtschaft gemeinsam erarbeitet werden<br />
soll. Dadurch soll insbesondere auch die weitere Zersplitte-<br />
rung des Angebotes durch untereinander nicht koordinierte<br />
Länderinitiativen gestoppt werden.<br />
99<br />
Zusätzliche Einkommen
Überbetrieblicher Maschineneinsatz<br />
Lohnunternehmen<br />
Der überbetriebliche Maschineneinsatz bleibt angesichts der<br />
steigenden Kosten <strong>und</strong> des Wettbewerbs für die Landwirtschaft<br />
von großer Bedeutung. Zudem erreichen die Spezialmaschinen<br />
Leistungen <strong>und</strong> damit auch Größen- <strong>und</strong> Kostendimensionen,<br />
die von einzelnen Unternehmen oft nicht ausgeschöpft werden.<br />
Lohnunternehmer nehmen diese Herausforderungen an<br />
<strong>und</strong> bieten individuell auf K<strong>und</strong>enwünsche zugeschnittene<br />
Dienstleitungspakete von der Erledigung einzelner Aufgaben<br />
bis hin zur Bereitstellung ganzer Verfahrensketten. R<strong>und</strong> 3.100<br />
professionell geführte Lohnunternehmen mit modernen, leistungsfähigen<br />
Maschinen stehen der Landwirtschaft zur Seite.<br />
In manchen Regionen erbringen Lohnunternehmen bis zu<br />
90 Prozent der überbetrieblichen Leistungen <strong>und</strong> verschaffen<br />
somit den Landwirten durch Freisetzung eigener Arbeitskapazität<br />
die Freiräume für Wachstum. Etwa 29.000 Arbeitskräfte<br />
100
werden derzeit in den Lohnunternehmen im Vollerwerb beschäftigt,<br />
der Anteil an Aushilfskräften <strong>und</strong> Saison-AK nimmt<br />
angesichts der Komplexität der Maschinen <strong>und</strong> des damit erforderlichen<br />
Know-hows zur Bedienung <strong>und</strong> Ausschöpfung der<br />
installierten Leistung kontinuierlich ab.<br />
Der Fachkräftebedarf ist wachsend; deshalb werden seit<br />
2005 im Beruf zur Fachkraft Agrarservice junge Nachwuchskräfte<br />
in den Bereichen Pflanzenproduktion, Landtechnik <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen ausgebildet. 480 Auszubildende sind aktuell<br />
im B<strong>und</strong>esgebiet beschäftigt.<br />
DBV-Position<br />
Der B<strong>und</strong>esverband der Lohnunternehmen <strong>und</strong> der Deutsche<br />
Bauernverband arbeiten auf allen wichtigen agrarpolitischen<br />
Feldern der überbetrieblichen Zusammenarbeit eng zusammen.<br />
Einen Schwerpunkt bilden die Arbeitsgebiete Aus- <strong>und</strong><br />
Fortbildung, Transportwesen <strong>und</strong> Verkehrsrecht.<br />
Maschinenringe<br />
Die Idee des Maschinenringes wurde 50 Jahre. Sie hat sich über<br />
die Jahre kontinuierlich entsprechend der agrarpolitischen<br />
Rahmenbedingungen weiterentwickelt <strong>und</strong> repräsentiert heute<br />
eine innovative <strong>und</strong> leistungsfähige Gemeinschaft. B<strong>und</strong>esweit<br />
werden mit 7,6 Millionen Hektar etwa 45 Prozent der gesamten<br />
landwirtschaftlichen Nutzfläche mithilfe von Maschinenringen<br />
bewirtschaftet. Die Anzahl der Maschinenringmitglieder lag im<br />
vergangen Jahr bei 192.000 Betrieben <strong>und</strong> blieb somit trotz<br />
des Strukturwandels annähernd konstant. Insgesamt waren<br />
etwa 1.200 hauptberufliche <strong>und</strong> über 8.000 nebenberufliche,<br />
vermittelte Betriebshelfer im Einsatz.<br />
Die Maschinenringe bieten den landwirtschaftlichen Unternehmen<br />
eine breite Palette an Möglichkeiten, am technischen<br />
Fortschritt teilzuhaben <strong>und</strong> innovative Produktionsverfahren<br />
anzuwenden. Somit werden im Rahmen der Nachbarschaftshilfe<br />
nicht nur moderne <strong>und</strong> leistungsfähige Maschinen ausgelastet,<br />
sondern Maschinengemeinschaften ebenso initiiert wie<br />
die Zusammenarbeit mit anderen Partnern koordiniert.<br />
DBV-Position<br />
Der B<strong>und</strong>esverband der Maschinenringe <strong>und</strong> der Deutsche Bauernverband<br />
arbeiten in wichtigen praxisrelevanten Fragen der<br />
überbetrieblichen Zusammenarbeit eng zusammen <strong>und</strong> suchen<br />
gemeinsame Lösungen. Das betrifft zum Beispiel das Transportwesen<br />
oder auch das Verkehrsrecht.<br />
101<br />
Überbetrieblicher Maschineneinsatz
Recht
Allgemeine Rechtsfragen<br />
Vereinfachung der Handhabung von Zahlungsansprüchen<br />
Im Zuge des Health Checks wurde „die EU-Gr<strong>und</strong>verordnung“<br />
der GAP-Reform durch eine neue EU-Verordnung 73/<strong>2009</strong><br />
abgelöst. Dabei konnte der Berufsstand erreichen, dass die<br />
Handhabung der Zahlungsansprüche für die Landwirte <strong>und</strong><br />
Behörden wesentlich vereinfacht wurde. So wurden die bisherigen<br />
Zahlungsansprüche für Stilllegung in normale Zahlungsansprüche<br />
umgewandelt. Der Vorrang der Aktivierung<br />
dieser Zahlungsansprüche für Stilllegung ist entfallen. Außerdem<br />
bestehen für Zahlungsansprüche, die aus der nationalen<br />
Reserve zugeteilt wurden, die bisherigen 5-jährigen<br />
Verpflichtungen <strong>und</strong> Verfügungsbeschränkungen nicht mehr.<br />
Allerdings können die zuständigen Behörden ab dem Jahr<br />
2010 nicht genutzte Zahlungsansprüche bereits nach 2 Jahren<br />
(bisher 3 Jahre) in die nationale Reserve entschädigungslos<br />
einziehen.<br />
DBV-Position<br />
Der Berufsstand fordert weiterhin von der EU, bürokratische<br />
<strong>und</strong> unflexible Regelungen im Rahmen der GAP-Reform zu<br />
überprüfen. Dies betrifft u. a. die vom Berufsstand geforderte<br />
Aufhebung der Flächenbindung bei der Verpachtung<br />
von Zahlungsansprüchen.<br />
Änderung der Cross Compliance-Bestimmungen<br />
Der Deutsche Bauernverband hat von Beginn an die seit <strong>2008</strong><br />
erfolgte Abkehr von der verschuldensabhängigen Haftung<br />
der Betriebsinhaber für Cross Compliance-Pflichtverstöße<br />
bei Bewirtschafterwechsel während des Kalenderjahres kritisiert.<br />
Im Zuge der GAP-Reform konnte erreicht werden, dass<br />
die ganzjährige Verantwortlichkeit des Betriebsinhabers für<br />
die Einhaltung von Cross Compliance-Verpflichtungen auf den<br />
beantragten beihilfefähigen Flächen unabhängig von einem<br />
Bewirtschafterwechsel ab 2010 wesentlich verändert wurde.<br />
Ab 2010 gilt, dass bei dem Betriebsinhaber, dem die Handlung<br />
oder Unterlassung unmittelbar anzulasten ist, die Kürzung der<br />
Direktzahlungen vorzunehmen ist, wenn er selber in dem entsprechenden<br />
Jahr einen Beihilfeantrag gestellt hat.<br />
Außerdem konnte erreicht werden, dass im Jahre <strong>2008</strong><br />
eine Bagatellregelung für geringfügige Verstöße im Rahmen<br />
von Cross Compliance eingeführt wurde, die nicht sofort<br />
eine Sanktionierungsverpflichtung für die Behörden begründet.<br />
Deutschland hat von dieser Bagatellregelung sofort<br />
Gebrauch gemacht <strong>und</strong> diese für die Kontrollbehörden über<br />
103<br />
Recht
einen B<strong>und</strong>-Länder-Leitfaden zur Umsetzung der Bagatellregelung<br />
im Rahmen von Cross Compliance untersetzt.<br />
DBV-Position<br />
Der Berufsstand lehnt eine weitere Erhöhung der Cross Compliance-Verpflichtungen<br />
ab. Bei der nationalen Umsetzung<br />
kommt es darauf an, dass nur die von der EU geforderten<br />
Verpflichtungen bei Cross Compliance-Kontrollen Gegenstand<br />
sind <strong>und</strong> alle im EU-Recht eröffneten Spielräume zur<br />
Vereinfachung von Cross-Compliance national ausgeschöpft<br />
werden.<br />
Verwertung der BVVG-Flächen<br />
Die BVVG hatte Ende <strong>2008</strong> noch etwa 470.000 Hektar landwirtschaftliche<br />
Flächen in ihrem Bestand. Im Rahmen des begünstigten<br />
Flächenerwerbsprogramms an berechtigte Pächter<br />
kann die 35-prozentige Kaufpreisermäßigung EU-rechtlich<br />
nur noch bis zum 31.12.<strong>2009</strong> gewährt werden. Vor diesem<br />
Hintergr<strong>und</strong> konnte <strong>2008</strong> erreicht werden, dass die BVVG<br />
nahezu für 50.000 Hektar sogenannte EALG-Kaufverträge mit<br />
landwirtschaftlichen Betrieben abschließen konnte. Auch die<br />
in den neuen Privatisierungsgr<strong>und</strong>sätzen verankerte Möglichkeit<br />
des Pächterdirektkaufs zum Verkehrswert wurde von<br />
landwirtschaftlichen Betrieben gut angenommen.<br />
Bezüglich der juristisch umstrittenen Verfahren der BVVG<br />
zur Verkehrswertermittlung als Gr<strong>und</strong>lage für die Ableitung<br />
des ermäßigten EALG-Kaufpreises wurden durch den Berufsstand<br />
verschiedene Gerichtsverfahren begleitet. Im Interesse<br />
der erwerbsberechtigten Pächter <strong>und</strong> Alteigentümer konnte<br />
der Deutsche Bauernverband mit der Verabschiedung des Flächenerwerbsänderungsgesetzes<br />
erreichen, dass die umfangreichen<br />
20-jährigen Bindungen <strong>und</strong> Verfügungsbeschränkungen<br />
beim EALG-Kauf sowohl inhaltlich als auch zeitlich nunmehr<br />
auf 15 Jahre im Interesse der Erhöhung der Flexibilität<br />
der landwirtschaftlichen Betriebe reduziert wurden.<br />
DBV-Position<br />
• Der Deutsche Bauernverband erwartet von der BVVG, dass<br />
die noch ausstehende Realisierung von r<strong>und</strong> 1.000 Anträ-<br />
gen erwerbsberechtigter Pächter im Jahr <strong>2009</strong> sicherge-<br />
stellt wird. Der Deutsche Bauernverband fordert eine Pri-<br />
vatisierung der BVVG-Flächen mit Augenmaß.<br />
• Angesichts der aktuellen Wirtschafts- <strong>und</strong> Finanzkrise ist<br />
die jüngste Preisentwicklung am Bodenmarkt irrational.<br />
Für die landwirtschaftlichen Betriebe sind die BVVG-<br />
Flächen über Verlängerung bzw. Neuabschlüsse von Pacht-<br />
104
verträgen zu sichern. Existenzgefährdungen landwirt-<br />
schaftlicher Betriebe durch den Entzug von BVVG-Pacht-<br />
flächen sind auszuschließen.<br />
Raumordnungsgesetz<br />
Das B<strong>und</strong>esbauministerium legte im Berichtszeitraum einen<br />
Gesetzentwurf zur Änderung des Raumordnungsgesetzes vor,<br />
der in erster Linie der Föderalismusreform I geschuldet war.<br />
Um einer Zersplitterung in unterschiedliches Landesrecht<br />
vorzubeugen, machte der B<strong>und</strong>esgesetzgeber von seiner konkurrierenden<br />
Gesetzgebungskompetenz Gebrauch <strong>und</strong> gibt<br />
für die Zukunft einen einheitlichen Rahmen vor, von dem die<br />
Länder allerdings abweichen können. Durch die Neustrukturierung<br />
des Gesetzes wurde der bisherige eigenständige<br />
raumordnerische Gr<strong>und</strong>satz zur Berücksichtigung der Belange<br />
der Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft auf andere Gr<strong>und</strong>sätze<br />
wie z. B. Wirtschaft <strong>und</strong> Kulturlandschaft verteilt.<br />
DBV-Position<br />
Das Raumordnungsgesetz muss die Landwirtschaft für ihre<br />
Zukunftsaufgaben stärken. Mehr denn je stehen die Ernährungsvorsorge<br />
<strong>und</strong> die Frage der Energiesicherung im Fokus<br />
der Öffentlichkeit. Umso wichtiger ist eine eigenständige<br />
Regelung zu Gunsten der Landwirtschaft, die den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben den Schutz einräumt, den sie zur<br />
Bewältigung der elementar wichtigen Zukunftsaufgaben<br />
benötigen. Darüber hinaus müssen die nicht vermehrbaren<br />
landwirtschaftlichen Nutzflächen besser vor einer Inanspruchnahme<br />
durch Siedlung <strong>und</strong> Verkehr geschützt werden.<br />
Der Deutsche Bauernverband wird die mittlerweile beschlossene<br />
Neuregelung in ihrer Anwendung beobachten <strong>und</strong> für<br />
den Fall, dass durch die Neuregelung die Position der Landwirtschaft<br />
in der Raumordnung eine Schwächung erfährt,<br />
Nachbesserungen einfordern.<br />
Erfolgreich war der Deutsche Bauernverband mit seiner<br />
Forderung nach einer weiteren Aussetzung der 7-Jahresfrist<br />
für die erleichterte Umnutzung ehemals landwirtschaftlich<br />
genutzter Gebäude im Außenbereich. Nunmehr können die<br />
B<strong>und</strong>esländer diese Einschränkung unbefristet aussetzen.<br />
Steuerpolitik <strong>und</strong> Steuerrecht<br />
Erbschaftsteuerreform berücksichtigt Anliegen der<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
Nach zwei Jahren intensiver <strong>und</strong> kontroverser Debatte trat<br />
105<br />
Recht
zum 1.1.<strong>2009</strong> das neue Erbschaftsteuergesetz in Kraft. In<br />
dieser Debatte haben sich nach zähem Ringen die Argumente<br />
des Deutschen Bauernverbandes durchgesetzt, so dass land-<br />
<strong>und</strong> forstwirtschaftliches Vermögen auch ab <strong>2009</strong> weitestgehend<br />
erbschaftsteuerfrei auf die nächste Generation übergehen<br />
kann.<br />
Dies war nicht selbstverständlich. Nach der vom B<strong>und</strong>esverfassungsgericht<br />
geforderten Neubewertung aller Vermögensarten<br />
für die Erbschaft- <strong>und</strong> Schenkungsteuer sollte<br />
land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliches Vermögen statt bislang mit<br />
dem Ertragswert mit dem „Zerschlagungswert“ angesetzt<br />
werden. Durch intensiven Einsatz des Berufsstandes <strong>und</strong><br />
zahllosen Gesprächen mit Ministern, Ministerpräsidenten<br />
<strong>und</strong> Abgeordneten auf B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesebene konnte<br />
jedoch die Einsicht vermittelt werden, dass bei der Bewertung<br />
der Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft nicht auf die Zerschlagung,<br />
sondern auf die Fortführung abgestellt werden muss.<br />
So wurde erreicht, dass weiterhin ein am Ertragswert orientiertes<br />
Bewertungsverfahren zur Anwendung kommt. Land-<br />
<strong>und</strong> forstwirtschaftliche Betriebe werden demnach in einem<br />
typisierten Verfahren entweder mit kapitalisierten Reingewinnen<br />
oder kapitalisierten regionalen Pachtpreisen plus<br />
Zuschlägen für das Besatzkapital bewertet. Ein geldwerter<br />
Vorteil dieses sachgerechten Verfahrens ist unter anderem,<br />
dass in der Regel keine (teuren) Bewertungsgutachten erstellt<br />
werden müssen.<br />
Neben dem Erhalt einer sachgerechten Bewertung konnte<br />
auch eine umfängliche Einbeziehung sämtlichen land- <strong>und</strong><br />
forstwirtschaftlichen Vermögens in die Verschonungsregeln<br />
erreicht werden. So können sämtliche landwirtschaftlichen<br />
Betriebe, aber auch so gut wie alle landwirtschaftlichen<br />
106
Einzelflächen, unabhängig davon ob selbst bewirtschaftet<br />
oder verpachtet, von den Verschonungsregeln profitieren.<br />
DBV-Position<br />
Die Reform der Erbschaftsteuer war für die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft,<br />
unabhängig von der Produktionsrichtung <strong>und</strong> Betriebsgröße,<br />
von großer Bedeutung. Es ging um die Frage des<br />
Erhalts von Eigentum im ländlichen Raum <strong>und</strong> die zumutbare<br />
Übertragungsmöglichkeit landwirtschaftlichen Vermögens<br />
auf die nächste Generation. Die ursprüngliche Befürchtung,<br />
dass die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft zur großen Verliererin der<br />
Reform <strong>und</strong> die Generationenfolge auf dem Land zum Fiasko<br />
werden, konnte durch Einsatz aller Kräfte verhindert werden.<br />
Das neue Erbschaftsteuerrecht ist zwar nicht einfacher geworden,<br />
allerdings ermöglicht es weiterhin erbschaftsteuerfreie<br />
Übergaben land- <strong>und</strong> forstwirtschaftlicher Betriebe<br />
<strong>und</strong> Flächen. Nun kommt es darauf an, dass die Finanzverwaltung<br />
die neuen Regeln vernünftig umsetzt. Insbesondere die<br />
Vorgaben zur Umstrukturierung von Betrieben <strong>und</strong> zu Reinvestitionsmöglichkeiten<br />
müssen praktikabel <strong>und</strong> anwenderfre<strong>und</strong>lich<br />
ausgestaltet werden.<br />
„Doppelbesteuerung“ der Betriebsprämie verhindert<br />
Ende Juni <strong>2008</strong> sollte durch eine im B<strong>und</strong>essteuerblatt veröffentlichte<br />
Anweisung der Finanzverwaltung der <strong>Bilanz</strong>ierungszeitpunkt<br />
für die Betriebsprämie geändert werden.<br />
Danach sollte der <strong>Bilanz</strong>ierungszeitpunkt auf den Stichtag<br />
der Antragsstellung (15. Mai) vorverlegt werden, wogegen<br />
die Betriebsprämie bislang immer erst am Ende des Kalenderjahres<br />
zu erfassen war. Die Finanzverwaltung begründete<br />
ihre Pläne damit, dass der sogenannte 10-Monatszeitraum<br />
<strong>und</strong> die Stilllegungsverpflichtung abgeschafft wurden. Der<br />
Deutsche Bauernverband hielt massiv gegen diese Sichtweise,<br />
da sich durch diese Vereinfachungen die Besteuerung<br />
der Betriebsprämie nicht geändert hat <strong>und</strong> sich die Förderung<br />
weiterhin auf das Kalenderjahr bezieht. So ist für die<br />
Betriebsprämie ganzjährig Cross Compliance einzuhalten <strong>und</strong><br />
die Flächen müssen sich jederzeit während des Jahres in einem<br />
beihilfefähigen Zustand befinden. Diese Argumentation<br />
des Berufsstandes wurde von der Finanzverwaltung zunächst<br />
nicht gewürdigt. Damit drohte den r<strong>und</strong> 170.000 buchführenden<br />
landwirtschaftlichen Betrieben im Wirtschaftsjahr<br />
2007/<strong>2008</strong> sowohl die Versteuerung der Betriebsprämie für<br />
2007 als auch zumindest der Hälfte der Betriebsprämie für<br />
<strong>2008</strong>. Deutschlandweit hätte dies für die Landwirtschaft eine<br />
Zusatzbelastung von über 500 Millionen Euro bedeutet, die<br />
107<br />
Recht
in den Folgejahren nicht ausgeglichen worden wäre. Dieser<br />
gewaltige Liquiditätsabfluss hätte die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der heimischen Landwirtschaft extrem verschlechtert.<br />
Der Deutsche Bauernverband hat die Anweisung des B<strong>und</strong>esfinanzministeriums<br />
deshalb von Anfang an strikt abgelehnt.<br />
Nachdem sich die Finanzverwaltung über die mehrfach<br />
<strong>und</strong> frühzeitig vorgetragenen Argumente des Berufsstandes<br />
hinweggesetzt hatte, fanden intensive Gespräche auf<br />
Fachebene <strong>und</strong> mit der Politik statt. Schließlich zeigte die<br />
Initiative des Berufsstands nach drei Monaten Erfolg. Die<br />
Steuerreferenten von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern revidierten ihre<br />
Anweisung zur Vorverlegung des Zeitpunkts der bilanziellen<br />
Erfassung der Betriebsprämie <strong>und</strong> folgten der Argumentation<br />
des Bauernverbandes. Damit ist klargestellt, dass auch<br />
bei buchführenden Betrieben die Betriebsprämie weiterhin<br />
im Wirtschaftsjahr der Auszahlung steuerlich zur Geltung<br />
kommt.<br />
DBV-Position<br />
Durch geschlossenen berufsständischen Einsatz über alle<br />
Produktbereiche hinweg konnte eine massive steuerliche Zusatzbelastung<br />
für die Landwirtschaft verhindert werden. Mit<br />
der von der Finanzverwaltung ursprünglich vorgesehenen Änderung<br />
wäre es zu einer Erfassung von zwei Betriebsprämien<br />
im Wirtschaftsjahr 2007/08 gekommen („Doppelbesteuerung“),<br />
von denen 1,5 zu versteuern gewesen wären. Einzelbetrieblich<br />
hätte dies 2007 <strong>und</strong> <strong>2008</strong> für Milchviehbetriebe,<br />
Ackerbaubetriebe, Gemischtbetriebe <strong>und</strong> ökologisch wirtschaftende<br />
Betriebe zu Mehrbelastungen von durchschnittlich<br />
r<strong>und</strong> 5.000 Euro geführt.<br />
Leider hat die Finanzverwaltung in anderen steuerlichen<br />
Beurteilungen zur Agrarreform die Argumentation des Berufsstandes<br />
nicht aufgegriffen. So sind die Abschreibbarkeit<br />
zugekaufter Zahlungsansprüche <strong>und</strong> die umsatzsteuerliche<br />
Behandlung der Übertragung von Zahlungsansprüchen von<br />
der Finanzverwaltung bislang unbefriedigend gelöst.<br />
Konjunkturpakete I <strong>und</strong> II<br />
Die B<strong>und</strong>esregierung hat zur Überwindung der schwierigen<br />
konjunkturellen Lage bislang zwei „Konjunkturpakete“ verabschiedet,<br />
die auch steuerliche Maßnahmen vorsehen. So<br />
wurde im ersten Konjunkturpaket die degressive Abschreibung<br />
für bewegliche Wirtschaftsgüter mit 25 Prozent wieder<br />
eingeführt. Außerdem wurden auf Drängen des Berufsstandes<br />
die Betriebsgrößengrenze zur Inanspruchnahme<br />
von Investitionsabzugsbeträgen <strong>und</strong> Sonderabschreibungen<br />
108
(§ 7g EStG) von 125.000 Euro auf 175.000 Euro (Ersatz-)Wirtschaftswert<br />
angehoben. Dadurch kommen etwa 10.000 landwirtschaftliche<br />
Betriebe mehr in den Anwendungsbereich der<br />
Regelung. Im zweiten Konjunkturpaket wurde im Einkommenssteuerrecht<br />
der Gr<strong>und</strong>freibetrag angehoben, der Eingangssteuersatz<br />
abgesenkt <strong>und</strong> die Tarifkurve zugunsten der<br />
Steuerpflichtigen verschoben. Von diesen Maßnahmen profitieren<br />
auch land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Unternehmer.<br />
DBV-Position<br />
So wichtig das entschlossene Auftreten der B<strong>und</strong>esregierung<br />
zur Überwindung der Konjunkturkrise ist, so unverständlich<br />
ist es, dass nicht genügend landwirtschaftsspezifische<br />
Maßnahmen ergriffen wurden, obwohl die weltweite Konjunkturschwäche<br />
auch die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft in Mitleidenschaft<br />
zieht. Um Arbeitsplätze <strong>und</strong> Wohlstand in den<br />
ländlichen Regionen zu sichern, müssen deshalb Schritte zur<br />
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land-<br />
<strong>und</strong> Forstwirtschaft unternommen werden. Vordringlich ist<br />
dabei der Abbau von Wettbewerbsverzerrungen in gemeinsamen<br />
Märkten. Ein erster Schritt wurde bei der Agrardieselbesteuerung<br />
(s. u.) durch Abschaffung des diskriminierenden<br />
Selbstbehalts <strong>und</strong> der Obergrenze gemacht. Dennoch besteht<br />
im Vergleich zu Nachbarländern in Deutschland nach wie vor<br />
der mit Abstand höchste Steuersatz in der EU, den es nun<br />
durch Absenkung an das europäische Niveau anzugleichen<br />
gilt.<br />
Daneben ist die Einführung einer Risikoausgleichsrücklage,<br />
die den besonderen Risiken der land- <strong>und</strong> forstwirtschaftlichen<br />
Produktion Rechnung trägt, unabdingbar, da<br />
sie Landwirten gerade in schwierigen Zeiten eine größere<br />
Eigenvorsorge ermöglicht <strong>und</strong> die notwendige Liquidität für<br />
Investitionen erhalten kann. Landwirten sollte deshalb die<br />
Möglichkeit eröffnet werden, gewinnmindernde Rücklagen<br />
zum Ausgleich künftiger Risiken bilden zu dürfen. Diese in<br />
der Forstwirtschaft <strong>und</strong> der Versicherungsbranche bereits<br />
seit langem etablierte Rücklagenmöglichkeit dient vorbeugend<br />
der Stabilisierung der Betriebe <strong>und</strong> setzt aufgr<strong>und</strong> erhöhter<br />
bzw. verbesserter Liquidität Investitionsanreize. Zudem<br />
würden unwägbare Sondereinflüsse, wie derzeit in der<br />
Konjunkturkrise, ausgeglichen.<br />
Drittes Mittelstandsentlastungsgesetz bringt Erleichterung<br />
für Vereine<br />
Nach ursprünglichen Plänen des B<strong>und</strong>esfinanzministeriums<br />
sollten im dritten Mittelstandsentlastungsgesetz (MEG III)<br />
109<br />
Recht
Freibetragsregelungen für Vereine verschlechtert werden.<br />
Der Deutsche Bauernverband hat sich dazu sehr kritisch geäußert<br />
<strong>und</strong> weitere Vorschläge zum effektiven Bürokratieabbau<br />
eingebracht. Im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens<br />
wurden die Anmerkungen des Deutschen Bauernverbandes<br />
zur Vereinsbesteuerung berücksichtigt <strong>und</strong> die Freibeträge<br />
moderat angehoben, so dass Vereine bis zu 350 Euro im Jahr<br />
<strong>und</strong> teilweise auch bei der Steuererklärungspflicht entlastet<br />
werden. Diese Vereinfachung kommt Bauernverbänden auf<br />
Kreis- <strong>und</strong> Ortsebene, Landjugend- <strong>und</strong> Landfrauenverbänden,<br />
Maschinen- <strong>und</strong> Beratungsringen, landwirtschaftlichen<br />
Erzeugergemeinschaften <strong>und</strong> weiteren Vereinen im ländlichen<br />
Raum zugute.<br />
DBV-Position<br />
Der Abbau bürokratischer Hemmnisse, insbesondere für die<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, bleibt eine Daueraufgabe, bei der<br />
der Deutsche Bauernverband weiterhin fordernd, kritisch <strong>und</strong><br />
konstruktiv mitwirken wird. Besonders der DBV-Vorschlag,<br />
Umsätze aus landwirtschaftsnahen Dienstleistungen im Rahmen<br />
der Kleinunternehmerregelung bei der Umsatzsteuerpauschalierung<br />
land- <strong>und</strong> forstwirtschaftlicher Betriebe zu<br />
berücksichtigen, würde für spürbaren Bürokratieabbau <strong>und</strong><br />
Vereinfachung sorgen.<br />
Agrardiesel<br />
Durch anhaltenden Druck <strong>und</strong> unterstützt von eindrucksvollen<br />
Aktionen ist es dem Berufsstand gelungen, dass der<br />
Selbstbehalt von 350 Euro <strong>und</strong> die Rückerstattungsobergrenze<br />
von 10.000 Litern mindestens für <strong>2009</strong> <strong>und</strong> 2010<br />
ersatzlos gestrichen werden. Damit unterliegt wieder jeder<br />
Liter Agrardiesel dem ermäßigten Steuersatz von 25,56 Cent<br />
je Liter <strong>und</strong> nicht mehr wie bisher im Durchschnitt 40 Cent je<br />
Liter. Zudem erhalten r<strong>und</strong> 180.000 Betriebe erstmals überhaupt<br />
wieder eine Erstattung. Durch diese Maßnahme wird<br />
die deutsche Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft um r<strong>und</strong> 285 Millionen<br />
Euro pro Jahr entlastet.<br />
DBV-Position<br />
Die Gesetzesänderung stellt die Agrardieselverhältnisse vor<br />
dem Jahr 2005 wieder her <strong>und</strong> ist ein erster Schritt in Richtung<br />
Wettbewerbsgleichheit in Europa. Die neue Rechtslage<br />
muss nun schnell <strong>und</strong> unbürokratisch umgesetzt werden,<br />
damit die Erstattung rasch bei den Betrieben landet. Zudem<br />
müssen Selbstbehalt <strong>und</strong> Obergrenze dauerhaft entfallen.<br />
Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass in Deutschland<br />
110
nach wie vor der mit Abstand höchste Agrardiesel-Steuersatz<br />
in der EU gilt. Deshalb wird sich der Deutsche Bauernverband<br />
weiterhin hartnäckig dafür einsetzen, dass die europäische<br />
Agrardieselbesteuerung durch Absenken des deutschen Steuersatzes<br />
auf das unter 10 Cent je Liter liegende europäische<br />
Niveau harmonisiert wird.<br />
Umweltpolitik <strong>und</strong> Umweltrecht<br />
Umweltgesetzbuch<br />
Das Umweltgesetzbuch (UGB) war eines der größten umweltpolitischen<br />
Projekte in dieser Legislaturperiode. Der Deutsche<br />
Bauernverband hat sich frühzeitig in die Diskussion eingebracht<br />
<strong>und</strong> darauf hingewiesen, dass die Ziele des Koalitionsvertrages,<br />
die zersplitterten Umweltgesetze zusammenzufassen<br />
<strong>und</strong> zu vereinfachen, verfehlt wurden <strong>und</strong> stattdessen<br />
nicht zu rechtfertigende Verschärfungen in den ersten Entwürfen<br />
enthalten waren. Da es insbesondere für die geplante integrierte<br />
Vorhabengenehmigung keine politische Mehrheit gab,<br />
ist das UGB gescheitert. Dies bedeutet für die Landwirtschaft:<br />
• Keine Verschärfung der Anforderungen des immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsverfahrens.<br />
• Keine Änderung der Genehmigungspflicht von Be- <strong>und</strong><br />
Entwässerungsmaßnahmen.<br />
• Keine Verschärfung des Umweltschadensgesetzes.<br />
• Kein Umweltbeauftragter für landwirtschaftliche Tierhaltungsanlagen.<br />
• Keine Änderung der Vorschriften für kumulierende<br />
Anlagen.<br />
Die bisherigen Bücher II <strong>und</strong> III gehen nun als Novelle des<br />
Wasserhaushaltsgesetzes <strong>und</strong> des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes<br />
111<br />
Recht
ins Gesetzgebungsverfahren. Im Entwurf des Wasserhaushaltsgesetzes<br />
konnten im Laufe der Verhandlungen bereits folgende<br />
wichtige Verbesserungen erreicht werden:<br />
• Erhalt der „Alten Wasserrechte“.<br />
• Verbesserung bei der Regelung zu Gewässerrandstreifen,<br />
ursprünglich war vorgesehen: 10 Meter <strong>und</strong> vollständiges<br />
Verbot der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln <strong>und</strong><br />
Düngemitteln, jetzt: 5 Meter mit Abweichungsrecht der Län-<br />
der, Pflanzenschutzmittel <strong>und</strong> Düngemitteleinsatz nach<br />
guter fachlicher Praxis zulässig.<br />
• Uneingeschränkter Erhalt des Eigentümer- <strong>und</strong> Anliegergebrauchs<br />
(z. B. Entnahme aus hofeigenen Brunnen),<br />
damit auch keine Genehmigungspflicht für Drainagen.<br />
• Privilegierung der JGS (Jauche, Gülle, Silagesickersäfte)-<br />
Anlagen bleibt voll erhalten.<br />
Im Entwurf des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes konnten im Laufe<br />
der Verhandlungen bereits folgende wichtige Verbesserungen<br />
erreicht werden:<br />
• Einführung eines Vorrangs von Vertragsnaturschutzmaßnahmen<br />
vor Ordnungsrecht.<br />
• Deutliche Verbesserungen bei Regelung zu Eingriffs- <strong>und</strong><br />
Ausgleichsmaßnahmen:<br />
- Rücksicht auf agrarstrukturelle Belange<br />
- Für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeig-<br />
nete Böden sind nur im notwendigen Umfang in An-<br />
spruch zu nehmen.<br />
- Es ist vorrangig zu prüfen, ob Ausgleich oder Ersatz auch<br />
durch Maßnahmen zur Entsiegelung oder durch Bewirt-<br />
schaftungs- oder Pflegemaßnahmen erbracht werden<br />
kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der<br />
Nutzung genommen werden.<br />
• Vollständiger Erhalt der Unberührtheitsklausel: Trennung<br />
von Naturschutzrecht <strong>und</strong> Fachrecht bleibt.<br />
• Das naturschutzrechtliches Vorkaufsrecht geht zumindest<br />
nicht mehr den siedlungsrechtlichen Vorkaufsrech-<br />
ten im Rang vor.<br />
DBV-Position<br />
Auch für die Novellen des Wasserhaushalts- <strong>und</strong> des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes<br />
erwartet der Deutsche Bauernverband, dass<br />
keine Verschärfung des geltenden Rechts erfolgt. Das Scheitern<br />
der integrierten Vorhabengenehmigung <strong>und</strong> die Verzögerung<br />
des Verfahrens sind darauf zurückzuführen, dass in den<br />
ursprünglichen Entwürfen entgegen der politischen Vereinbarung<br />
eine Vielzahl nicht akzeptabler Verschärfungen enthalten<br />
war. Daraus müssen die Konsequenzen gezogen werden.<br />
112
Biopatente<br />
Das Fachgespräch des Deutschen Bauernverbandes zum Thema<br />
Biopatente im Oktober 2007 hat eine intensive Diskussion<br />
über dieses sehr emotionale Thema ins Rollen gebracht. Insbesondere<br />
ein Patent im Zusammenhang mit einem Gentest für<br />
Schweine erhitzt die Gemüter. Außerdem sind vor dem Europäischen<br />
Patentamt mittlerweile zwei Verfahren anhängig, in<br />
denen am Beispiel eines Brokkoli- <strong>und</strong> eines Tomatenpatentes<br />
entschieden werden soll, wo die Grenze zwischen einem herkömmlichen<br />
Kreuzungs- oder Selektionsverfahren <strong>und</strong> einem<br />
patentierbaren technischen Verfahren verläuft.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband spricht sich deutlich gegen Patente<br />
auf Tiere <strong>und</strong> Pflanzen aus. Im pflanzlichen Bereich ist<br />
der Sortenschutz als Instrument zum Schutz des geistigen<br />
Eigentums völlig ausreichend <strong>und</strong> hat sich bewährt. Mit Patenten<br />
droht eine Monopolisierung Jahrh<strong>und</strong>erte alten Züchtungswissens.<br />
Der Deutsche Bauernverband setzt sich dafür<br />
ein, dass ein Verbot der Patentierung von Pflanzen <strong>und</strong> Tieren<br />
in der EU-Biopatentrichtlinie aufgenommen wird. Außerdem<br />
muss es klare Regelungen im Hinblick auf patentierbare Verfahren<br />
geben. Es darf nicht sein, dass herkömmliche Züchtungsverfahren<br />
infolge einer „Garnierung“ mit technischen<br />
Elementen patentierbar werden. Der Deutsche Bauernverband<br />
wird weiterhin Landwirte, Politiker <strong>und</strong> Verbraucher über diese<br />
komplexe Materie informieren <strong>und</strong> aufklären. Der Berufsstand<br />
steht außerdem in engem Kontakt mit den Zuchtverbänden<br />
<strong>und</strong> prüft im Einzelfall auch rechtliche Schritte, wenn Gr<strong>und</strong>satzfragen<br />
betroffen sind.<br />
Richtlinie über Industrieemissionen<br />
Die Kommission hat Anfang <strong>2008</strong> einen Vorschlag zur Novellierung<br />
der Richtlinie über Industrieemissionen (IVU-Richtlinie)<br />
vorgelegt. Unter die IVU-Richtlinie fallen derzeit landwirtschaftliche<br />
Betriebe ab 2.000 Stallplätze für Mastschweine oder<br />
750 Plätzen für Sauen, bzw. 40.000 Plätze für Geflügel. Diese<br />
benötigen eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung.<br />
Geplant ist nun eine Differenzierung der Stallplatzzahlen bei<br />
Geflügel auf 30.000 Legehennen, 24.000 Enten oder 11.500 Puten.<br />
Weiterhin soll der Anwendungsbereich der Richtlinie auf<br />
die Ausbringung von Jauche <strong>und</strong> Gülle erweitert werden. Außerdem<br />
sind neue Kontroll- <strong>und</strong> Berichtspflichten vorgesehen<br />
sowie die Verpflichtung, mögliche Gewässer- <strong>und</strong> Bodenverunreinigungen<br />
festzustellen, gegebenenfalls zu sanieren <strong>und</strong> die<br />
Anlage nach Einstellung des Betriebes zurückzubauen.<br />
113<br />
Recht
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband lehnt die geplanten Verschärfungen<br />
<strong>und</strong> die zusätzlichen bürokratischen Auflagen ab, da damit<br />
kein Mehrwert für die Umwelt einhergeht <strong>und</strong> die Tierhalter<br />
unverhältnismäßig belastet werden. Für die Differenzierung<br />
der Tierplatzzahlen gibt es keine wissenschaftliche Begründung,<br />
einige der erst 2007 vom B<strong>und</strong>estag beschlossenen<br />
Erleichterungen müssten schon wieder rückgängig gemacht<br />
werden. Die Aufnahme der Gülleausbringung in den Anwendungsbereich<br />
der Richtlinie ist systematisch verfehlt, da die<br />
IVU-Richtlinie Anlagen <strong>und</strong> nicht landwirtschaftliche Tätigkeiten<br />
betrifft. Außerdem deckt die Nitratrichtlinie dies bereits<br />
ab. Der Deutsche Bauernverband wird sich gemeinsam mit dem<br />
europäischen Bauernverband COPA nachdrücklich für entsprechende<br />
Änderungen der Richtlinie einsetzen, um weitere Auflagen<br />
für tierhaltende Betriebe zu verhindern.<br />
Erosionsschutzkataster EU-rechtlich nicht erforderlich<br />
Das Direktzahlungen-Verpflichtungen-Gesetz zur Umsetzung<br />
von Cross Compliance sieht vor, dass ab <strong>2009</strong> spezifische Regelungen<br />
zum Erosionsschutz landwirtschaftlicher Flächen<br />
vorgenommen werden sollen. Zur Umsetzung dieser Vorgabe<br />
wurde im Berichtszeitraum von B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern ein flächenscharfes<br />
Erosionsschutzkataster erarbeitet. Je nach Erosionsgefährdung<br />
sollen Auflagen zum Schutz vor Erosion greifen.<br />
DBV-Position<br />
Aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes ist ein flächenscharfes<br />
Kataster für den Erosionsschutz mit daran geknüpften<br />
Auflagen im Rahmen von Cross Compliance nicht erforderlich<br />
<strong>und</strong> wäre EU-weit einmalig. Der Deutsche Bauernverband<br />
hatte gefordert, auf die Ausweisung von erosionsgefährdeten<br />
Flächen zu verzichten <strong>und</strong> stattdessen in Absprache mit den<br />
114
Landwirten vor Ort Erosionsschutzmaßnahmen über Beratung,<br />
Informationen <strong>und</strong> Agrarumweltprogramme zu ergreifen. Zwar<br />
wird am Gr<strong>und</strong>satz des Erosionsschutzkatasters festgehalten,<br />
jedoch wurde aufgr<strong>und</strong> der Kritik aus dem Berufsstand darauf<br />
verzichtet, alle Flächen in das Kataster aufzunehmen. Aufgenommen<br />
werden ausschließlich die erosionsgefährdeten<br />
Flächen. Darüber hinaus wurde die Einführung des Erosionsschutzkatasters<br />
vom 1.1.<strong>2009</strong> auf den 30.6.2010 verschoben.<br />
Klimaschutz: Landwirtschaft ist Teil der Lösung<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> wurden intensive Diskussionen über den Klimawandel,<br />
die Anpassung an den Klimawandel <strong>und</strong> mögliche<br />
Maßnahmen zur Reduzierung seiner Auswirkungen geführt.<br />
Auch die Rolle der Landwirtschaft im Zusammenhang mit dem<br />
Klimawandel hat dabei großen Raum eingenommen. Unbestritten<br />
ist, dass auch die Landwirtschaft zur Emission von<br />
Treibhausgasen beiträgt. Viel bedeutsamer ist aber, dass die<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft zu den Wirtschaftsbereichen zählt,<br />
die mit ihrer Produktion zum Klimaschutz (Kohlendioxidnutzung<br />
<strong>und</strong> -bindung) beiträgt. Kontrovers diskutiert werden jedoch<br />
die möglichen Reduzierungsmaßnahmen für Emissionen<br />
in der Landwirtschaft.<br />
DBV-Position<br />
Die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft ist im Zusammenhang mit dem<br />
Klimawandel ein wichtiger Teil der Lösung <strong>und</strong> nicht das Problem.<br />
Durch die Bindung von Kohlendioxid in landwirtschaftlichen<br />
Produkten <strong>und</strong> Böden kann die Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
als einziger Wirtschaftsbereich im Rahmen der eigentlichen<br />
Produktion einen positiven Beitrag für den Klimaschutz leisten.<br />
Zudem hat die Landwirtschaft ihre eigenen Emissionen<br />
seit 1990 bereits um r<strong>und</strong> 22 Prozent gesenkt. Im Zusammenhang<br />
mit dem Klimawandel setzt sich der landwirtschaftliche<br />
Berufsstand dafür ein, dass die positiven Leistungen der Landwirtschaft<br />
zur Reduzierung der Emissionen von Kohlendioxid<br />
anerkannt werden <strong>und</strong> von überzogenen Verzichts- <strong>und</strong> Extensivierungsstrategien<br />
Abstand genommen wird. Vielmehr ist die<br />
Landwirtschaft gefordert, eine hochproduktive <strong>und</strong> effiziente<br />
Landbewirtschaftung zu betreiben, um den steigenden Anforderungen<br />
an die Landwirtschaft bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln<br />
<strong>und</strong> nachwachsenden Rohstoffen gerecht werden<br />
zu können.<br />
Bodenschutz muss nationale Aufgabe bleiben<br />
Im Dezember 2007 hat der Entwurf für eine europäische Bodenschutzrahmenrichtlinie<br />
im zuständigen Umweltministerrat<br />
115<br />
Recht
nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Hintergr<strong>und</strong> ist,<br />
dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten keinen Bedarf für ein<br />
europäisches Handeln zum Schutz der Böden sieht. Auch unter<br />
französischer <strong>und</strong> slowenischer Ratspräsidentschaft im Jahr<br />
<strong>2008</strong> konnte kein gemeinsamer Standpunkt im Umweltministerrat<br />
zur Bodenschutzrichtlinie erreicht werden.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband hat von Beginn der Verhandlungen<br />
über eine europäische Bodenschutzrichtlinie betont, dass<br />
der Schutz landwirtschaftlicher Böden im Eigeninteresse der<br />
Landwirte liegt. Gleichwohl besteht kein Bedarf für eine europäische<br />
Richtlinie, zumal mit dem Richtlinienentwurf ein Übermaß<br />
bürokratischer Regelungen zu befürchten ist. Der Deutsche<br />
Bauernverband fordert weiterhin, dass der Bodenschutz<br />
nationale Aufgabe unter Anerkennung der bereits ergriffenen<br />
Maßnahmen bleiben muss.<br />
EU-Pflanzenschutzpaket bringt Harmonisierung in Europa<br />
Im Berichtszeitraum haben auf europäischer Ebene die abschließenden<br />
Verhandlungen zur Zukunft der europäischen<br />
Pflanzenschutzpolitik stattgef<strong>und</strong>en. Dabei wurde eine Richtlinie<br />
zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln<br />
sowie eine EU-Verordnung zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln<br />
verabschiedet. Mit der Zulassungsverordnung wird zukünftig<br />
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in drei Zonen<br />
Europas durchgeführt <strong>und</strong> dadurch eine stärkere Harmonisierung<br />
der Pflanzenschutzzulassung angestrebt.<br />
Mit der Anwendungsrichtlinie werden europaweit hohe<br />
Standards für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln gesetzt.<br />
Die Einführung von sogenannten Cut-off-Kriterien stellt<br />
eine Abkehr von der bisherigen risikobasierten Zulassung dar<br />
<strong>und</strong> hat zur Folge, dass bestimmte Wirkstoffe allein aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Stoffeigenschaften ohne Prüfung der Risikoexposition<br />
von der Zulassung ausgeschlossen werden.<br />
DBV-Position<br />
Die Verhandlungen zum europäischen Pflanzenschutzpaket<br />
wurden von Seiten des Deutschen Bauernverbandes sowie der<br />
Landesbauernverbände intensiv <strong>und</strong> kritisch begleitet. Die ers-<br />
ten Vorschläge des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments<br />
hätten dazu geführt, dass der Großteil der Pflanzenschutzwirkstoffe<br />
nicht mehr zugelassen würden <strong>und</strong> dadurch<br />
die landwirtschaftliche Produktion in Europa gr<strong>und</strong>sätzlich in<br />
Frage gestellt worden wäre. Durch das Aufzeigen möglicher<br />
Folgen <strong>und</strong> die Verdeutlichung der landwirtschaftlichen Be-<br />
116
troffenheit konnte erreicht werden, dass einerseits ein hohes<br />
Schutzniveau für Umwelt, Verbraucher <strong>und</strong> Anwender sichergestellt<br />
ist <strong>und</strong> andererseits die landwirtschaftliche Produktion<br />
<strong>und</strong> die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln nicht<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich in Frage gestellt werden. Darüber hinaus wurde<br />
erreicht, dass mit der Einführung des Zonenmodells die Verfügbarkeit<br />
von Pflanzenschutzmitteln in Europa verbessert<br />
werden kann. Hinsichtlich der neuen Anwendungsrichtlinie ist<br />
festzuhalten, dass eine Reihe von Auflagen <strong>und</strong> Regelungen,<br />
die bisher bereits über viele Jahre von landwirtschaftlichen<br />
Betrieben in Deutschland eingehalten werden, nunmehr europaweit<br />
vorgeschrieben sind. Dies betrifft beispielsweise auf<br />
europäischer Ebene die neue Einführung eines Pflanzenschutzgeräte-TÜV,<br />
die Vorschrift der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung für Landwirte<br />
sowie die Berücksichtigung der Gr<strong>und</strong>sätze des integrierten<br />
Pflanzenschutzes. Der Deutsche Bauernverband fordert für<br />
die Umsetzung der neuen europäischen Regelungen, dass die<br />
vorhandenen Spielräume für eine ausgewogene <strong>und</strong> verträgliche<br />
Regelung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln genutzt<br />
werden.<br />
Flächenverbrauch ist Verlust an Zukunftschancen<br />
Nach wie vor ist der Flächenverbrauch für Siedlungs- <strong>und</strong><br />
Verkehrsmaßnahmen mit über 100 Hektar pro Tag eines der<br />
größten ungelösten Umweltprobleme Deutschlands. Vom Ziel<br />
der B<strong>und</strong>esregierung, bis 2020 den Flächenverbrauch auf 30<br />
Hektar pro Tag zu reduzieren, ist Deutschland nach wie vor<br />
weit entfernt. Angesichts dessen muss der Flächenverbrauch<br />
für Siedlungs- <strong>und</strong> Verkehrsmaßnahmen aber auch für naturschutzrechtliche<br />
Ausgleichsmaßnahmen dringend gesenkt<br />
werden, um die Erzeugung von Nahrungsmitteln <strong>und</strong> nachwachsenden<br />
Rohstoffen angesichts der wachsenden Herausforderungen<br />
für die Landwirtschaft nicht zu gefährden.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband fordert unmissverständlich, den<br />
Flächenverbrauch durch Siedlungs- <strong>und</strong> Verkehrsmaßnahmen<br />
ebenso wie für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen<br />
radikal zu reduzieren <strong>und</strong> den Gr<strong>und</strong>satz festzuschreiben, dass<br />
bei Neuversiegelung an anderer Stelle entsiegelt werden muss.<br />
Zunächst im Rahmen des geplanten Umweltgesetzbuches <strong>und</strong><br />
nach dem Scheitern des UGB auch im Rahmen der Novelle des<br />
B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes fordert der Deutsche Bauernverband,<br />
dass der Entsiegelung Vorrang eingeräumt werden muss.<br />
Mit der Neufassung des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes werden in<br />
diesem Sinne erste Schritte in Richtung Schonung landwirt-<br />
117<br />
Recht
schaftlicher Nutzflächen im Rahmen der naturschutzrechtlichen<br />
Eingriffsregelung eingeführt. Zudem werden die Möglichkeiten<br />
von betriebsintegrierten Kompensationsmaßnahmen<br />
verankert. Ziel muss es zukünftig sein, dass nicht mehr der<br />
Flächenkauf <strong>und</strong> die Anlage fragwürdiger Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Vordergr<strong>und</strong> stehen, sondern die Schonung landwirtschaftlicher<br />
Nutzflächen, die Nutzung von betriebsintegrierten<br />
Maßnahmen oder aber die Verwendung von Ersatzgeldern für<br />
die Pflege vorhandener Biotope oder die Entwicklung der Gewässer<br />
im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie.<br />
Neufassung des Düngerechts erfolgt<br />
Im Berichtszeitraum wurde mit einer Neufassung des Düngegesetzes<br />
<strong>und</strong> einer Novellierung der Düngemittelverordnung das<br />
Düngerecht weitgehend überarbeitet. Mit der Düngemittelverordnung<br />
werden Anforderungen an alle Düngemittel gestellt,<br />
die in Verkehr gebracht werden. Daneben wurde das Düngegesetz<br />
an heutige wissenschaftliche Erkenntnisse sowie an neuere<br />
EU-Regelungen angepasst.<br />
DBV-Position<br />
Bei der Novelle der Düngemittelverordnung hat sich der Berufsstand<br />
dafür ausgesprochen, Kupfer <strong>und</strong> Zink als elementare<br />
Spurennährstoffe anzuerkennen <strong>und</strong> als solche von den<br />
Grenzwerten für Schwermetalle freizustellen. Darüber hinaus<br />
ist es gelungen, die besondere Situation landwirtschaftlicher<br />
Wirtschaftsdünger anzuerkennen <strong>und</strong> dies bei den Vorschriften<br />
bezüglich der Hygiene zu berücksichtigen. Ausdrücklich<br />
gefordert wurde von Seiten des Berufsstandes, dass zukünftig<br />
auch alle Klärschlämme <strong>und</strong> Bioabfälle nach dem Kreislaufwirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Abfallgesetz die hohen Anforderungen des<br />
Düngerechts erfüllen müssen, sofern sie als landwirtschaftliche<br />
Dünger verwendet werden. Bei der Neufassung des Düngegesetzes<br />
konnte zudem verhindert werden, dass bürokratische<br />
Aufzeichnungspflichten für alle landwirtschaftlichen Betriebe,<br />
die Wirtschaftsdünger verwenden, geschaffen werden. Nun<br />
sind die Länder gefordert, die neue Verordnungsermächtigung<br />
für die Regelung zum Verbringen von Düngemitteln verhältnismäßig<br />
<strong>und</strong> praxistauglich umzusetzen. Verhindert werden<br />
konnte, dass zukünftig zusätzlich zur flächendeckenden Umsetzung<br />
der EU-Nitratrichtlinie über die Düngeverordnung<br />
auch noch nitratsensible Gebiete mit spezifischen Auflagen<br />
ausgewiesen werden.<br />
Gute fachliche Praxis ist nicht normierbar<br />
Angestoßen durch eine kritische Diskussion über die Umwelt-<br />
118
verträglichkeit bzw. Nachhaltigkeit des Anbaus von Biomasse<br />
zur Herstellung von Biokraftstoffen wurde im Berichtszeitraum<br />
an verschiedenen Stellen mit der Zertifizierung der Nachhaltigkeit<br />
in der Landwirtschaft begonnen. Ziel der B<strong>und</strong>esregierung<br />
ist dabei, dass Biomasse zur Herstellung von Biokraftstoffen<br />
nachhaltig erzeugt sein <strong>und</strong> ein entsprechendes<br />
Treibhausgasminderungspotenzial aufweisen muss. Dies soll<br />
weltweit sichergestellt werden <strong>und</strong> durch eine neutrale Zertifizierung<br />
überprüft werden. Gleichzeitig erarbeitet das Deutsche<br />
Institut für Normung (DIN) eine Norm über die Nachhaltigkeit<br />
des Anbaus von Biomasse für Biokraftstoffe.<br />
DBV-Position<br />
Die Deutsche Landwirtschaft steht zum Anspruch einer nachhaltigen<br />
Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. Die umfangreichen<br />
Regelungen des landwirtschaftlichen Fachrechts<br />
sowie die Regelungen <strong>und</strong> Kontrollen im Rahmen von Cross<br />
Compliance stellen sicher, dass die Produktion von Nahrungsmitteln<br />
<strong>und</strong> nachwachsenden Rohstoffen in Europa nachhaltig<br />
erfolgt. Insofern fordert der Deutsche Bauernverband seit vielen<br />
Jahren, dass im Rahmen der WTO auch Umweltstandards<br />
verankert werden sollen. Hinsichtlich der Schaffung eines Zertifizierungssystems<br />
für Biokraftstoffe muss aber aus Sicht des<br />
Deutschen Bauernverbandes sichergestellt sein, dass neben<br />
den bestehenden Regelungen im Fachrecht sowie über Cross<br />
Compliance keine zusätzlichen Regelungen sowie bürokratischen<br />
Auflagen für die landwirtschaftlichen Betriebe neu geschaffen<br />
werden.<br />
Jagdrecht – Pflichtmitgliedschaft erhalten<br />
Die Arbeit der B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft der Jagdge-<br />
119<br />
Recht
nossenschaften <strong>und</strong> Eigenjagdbesitzer (BAGJE) war<br />
im vergangenen Jahr vor allem durch die Themen „Pflichtmitgliedschaft<br />
in Jagdgenossenschaften“ <strong>und</strong> steigende<br />
Schwarzwildbestände geprägt. Der Europäische Gerichtshof für<br />
Menschenrechte (EuGMR) hat in einem Urteil vom 10.07.2007<br />
auf die Beschwerde einer Jagdgegnerin entschieden, dass die<br />
Zwangsmitgliedschaft in einer Luxemburger Jagdgenossenschaft<br />
das Eigentumsrecht sowie den Gr<strong>und</strong>satz der (negativen)<br />
Vereinigungsfreiheit verletzt. Durch diese Entscheidung<br />
werden Fragen zur Bindewirkung <strong>und</strong> Übertragbarkeit im Verhältnis<br />
zum deutschen Jagdgenossenschaftsmodell aufgeworfen.<br />
Nach Auffassung der BAGJE ist die Pflichtmitgliedschaft<br />
in der deutschen Jagdgenossenschaft nach wie vor verfassungsgemäß,<br />
so wie es auch das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht<br />
erst 2006 entschieden hat. Der gesetzliche Hegeauftrag wäre<br />
auf Basis eines jagdlichen „Flickenteppichs“ nicht zu erfüllen.<br />
Die BAGJE erarbeitet in einer Arbeitsgruppe die Unterschiede<br />
des deutschen zum luxemburgischen Jagdrechtssystem, da absehbar<br />
ist, dass auch deutsche Jagdrechtsgegner den Weg zum<br />
EuGMR beschreiten werden.<br />
In einigen Regionen Deutschlands nehmen die Schwarzwildbestände<br />
stark zu. Dies ist besonders vor dem Hintergr<strong>und</strong><br />
der Seuchenhygiene <strong>und</strong> zum Teil steigender Wildschäden<br />
problematisch. Der Deutsche Bauernverband <strong>und</strong><br />
der Deutsche Jagdschutzverband haben daher im Jahr 2007<br />
die Projektträgerschaft eines „Modellvorhabens zur Schwarzwildbewirtschaftung<br />
in der Agrarlandschaft“ übernommen.<br />
Begleitet wird das Projekt durch ein beratendes Kuratorium,<br />
dem auch die BAGJE angehört. Ziel des vom BMELV initiierten<br />
Vorhabens ist die Entwicklung <strong>und</strong> Erprobung ackerbaulicher<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> sachgerechter Bejagungsmethoden zur effektiven<br />
Schwarzwildbewirtschaftung. B<strong>und</strong>esweit nehmen sechs<br />
Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen,<br />
Sachsen-Anhalt, Hessen <strong>und</strong> Bayern teil. Dazu werden<br />
über einen Zeitraum von drei Jahren unter anderem Bejagungsschneisen<br />
mit unterschiedlicher Einsaat, die Wirksamkeit<br />
von Beizmitteln sowie neuere Vergrämungsmaßnahmen <strong>und</strong><br />
die Auswirkungen von Engsaaten bzw. Breitsaaten getestet<br />
<strong>und</strong> auf ihre Betriebswirtschaftlichkeit untersucht. Weiterhin<br />
sollen Abschusskriterien entwickelt <strong>und</strong> speziell an der Wald-<br />
Feld-Grenze die Jagdstrategien übers ganze Jahr verbessert<br />
werden.<br />
Wichtig ist vor allem, alle Betroffenen an einen Tisch zu bringen,<br />
denn nach Auffassung des Deutschen Bauernverbandes ist<br />
nur ein gemeinsames <strong>und</strong> engagiertes Vorgehen von Landwirten,<br />
Jägern <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>eigentümern erfolgversprechend.<br />
120
Landtechnik <strong>und</strong> Verkehrsrecht<br />
Landtechnik ist sicher<br />
Unfälle mit landwirtschaftlichen Maschinen <strong>und</strong> Geräten sind<br />
seit Jahren rückläufig. Ursächlich ist unter anderem, dass<br />
die Hersteller bei der Konstruktion neuer Maschinen einem<br />
strengen Regelwerk mit hohen Sicherheitsstandards zur Vermeidung<br />
von Arbeitsunfällen unterworfen sind. Dennoch<br />
kommt eine Studie der Kommission für Arbeitsschutz <strong>und</strong> Normung<br />
(KAN) zum Schluss, das in Europa <strong>und</strong> damit auch unmittelbar<br />
in Deutschland geltende Normenwerk reiche nicht aus,<br />
um die in der sogenannten Maschinenrichtlinie (RL 2006/42/<br />
EG) festgelegten Schutzziele der Anwender umzusetzen. Die<br />
KAN, in der staatlicher Arbeitsschutz, aber auch die Berufsgenossenschaften<br />
vertreten sind, fordert eine 1:1-Umsetzung<br />
der Maschinenrichtlinie. Allerdings gilt die Richtlinie für alle<br />
Maschinen, mobile wie auch immobile. Aus Sicht des Arbeitsschutzes<br />
ist es erforderlich, dass auch die Landmaschinen die<br />
Anforderungen der Maschinenrichtlinie in Punkto Arbeitssicherheit<br />
voll erfüllen, ohne Berücksichtigung der besonderen<br />
Bedingungen in der landwirtschaftlichen Praxis. Dabei soll<br />
jede vorhersehbare Fehlanwendung, die zu einem Unfall führen<br />
kann, mittels Schutzeinrichtungen vermieden werden.<br />
Besondere Bedingungen der landwirtschaftlichen Praxis<br />
Es ist im ureigensten Interesse der Landwirtschaft, dass sichere<br />
Maschinen konstruiert werden. Allerdings dürfen die<br />
Anforderungen des Arbeitsschutzes auch nicht dazu führen,<br />
dass die Maschinen in ihrer Funktionsfähigkeit so weit eingeschränkt<br />
werden, dass ihr Einsatz nicht mehr effizient möglich<br />
ist. Der Deutsche Bauernverband hat seine Interessen<br />
in intensiven Gesprächen gemeinsam mit der Landtechnik-<br />
121<br />
Recht
industrie in verschiedenen Ausschüssen mit den Vertretern<br />
des Arbeitsschutzes zum Ausdruck gebracht. Allerdings stehen<br />
wichtige Fragen noch aus, wie beispielsweise der Einsatz<br />
beweglicher trennender Schutzreinrichtungen zum Schutze<br />
vor beweglichen Teilen, die sich erst nach Stillstand der Maschine<br />
öffnen lassen oder bei Öffnung einen Befehl zum Stillstand<br />
auslösen.<br />
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband anerkennt das hohe Schutzniveau<br />
der in der Praxis eingesetzten landwirtschaftlichen Maschinen<br />
<strong>und</strong> Geräte, welches durch ein strenges Normenwerk<br />
geregelt ist. Verbesserungsvorschläge, die zu einer weiteren<br />
Risikominimierung führen, müssen diskutiert werden <strong>und</strong><br />
können im Einzelfall auch hilfreich sein. Eine Umsetzung der<br />
Maschinenrichtlinie ohne Berücksichtigung der in der landwirtschaftlichen<br />
Praxis auftretenden Besonderheiten lehnt<br />
der Deutsche Bauernverband jedoch ab.<br />
Zweckbestimmung bei lof-Fahrerlaubnisklassen L <strong>und</strong> T<br />
Die Fahrerlaubnis-Verordnung sieht bei den Fahrerlaubnisklassen<br />
L <strong>und</strong> T eine gegenüber den anderen Fahrerlaubnisklassen<br />
nicht sachgerechte Sonderbehandlung vor. Die Abgrenzung<br />
der Fahrerlaubnisklassen erfolgt bei L <strong>und</strong> T nicht<br />
wie bei allen übrigen Fahrerlaubnisklassen nur über die Fahrzeugart,<br />
sondern auch über die Verwendung des Fahrzeugs.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich verfolgt die Fahrerlaubnis-Verordnung den<br />
Zweck, dass Fahrzeugführer, die am öffentlichen Straßenverkehr<br />
teilnehmen, ihre Befähigung, bestimmte Fahrzeugarten<br />
zu führen, im Rahmen einer Schulung <strong>und</strong> Prüfung nachweisen<br />
müssen; <strong>und</strong> dies allein aus Gründen der Verkehrssicherheit.<br />
Dabei ist es vollkommen unerheblich, wie bestimmte Fahrzeuge<br />
(in diesem Falle Traktoren <strong>und</strong> selbstfahrende Arbeitsmaschinen<br />
etc.) eingesetzt werden, da das Fahrverhalten derartiger<br />
Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr unabhängig<br />
von ihrem Verwendungszweck gleich ist.<br />
Für Landwirte <strong>und</strong> Lohnunternehmer ist es unbegreiflich,<br />
dass sie für das Führen ihrer landwirtschaftlichen Zugmaschine<br />
(für Arbeiten in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb)<br />
den Führerschein L bzw. T benötigen, dieser Führerschein sie<br />
aber nicht zum Führen der selben Zugmaschine im Rahmen<br />
von Arbeiten im Auftrag z. B. für eine landwirtschaftliche<br />
Genossenschaft oder eine Biogasanlage berechtigt. Durch die<br />
nicht sachgemäße Zweckbestimmung in § 6 der Fahrerlaubnis-<br />
Verordnung ist im letzteren Fall die Fahrerlaubnisklasse CE<br />
vorgeschrieben.<br />
122
DBV-Position<br />
Der Deutsche Bauernverband macht sich für eine Änderung<br />
im Führerscheinrecht dahingehend stark, dass die in § 6 formulierte<br />
Zweckbindung der Fahrerlaubnisklasse an land- oder<br />
forstwirtschaftliche Zwecke gestrichen wird.<br />
Kriterien-Kompendium Landwirtschaft<br />
Zusammen mit dem Verband der Landwirtschaftskammern<br />
hat der Deutsche Bauernverband das Kriterien-Kompendium<br />
Landwirtschaft (KKL) erstellt, mit dem das aktuelle Fachrecht,<br />
Cross Compliance-relevante Vorgaben sowie Anforderungen<br />
freiwilliger Qualitätssysteme wie z. B. QS <strong>und</strong> QM<br />
anschaulich <strong>und</strong> betriebsindividuell aufbereitet werden. In<br />
einer EDV-Lösung wurden diese Inhalte zudem elektronisch<br />
abgebildet. Da die Regelungen im Fachrecht <strong>und</strong> den Qualitätsmanagementsystemen<br />
eine hohe Dynamik aufweisen<br />
<strong>und</strong> sich häufig ändern, bildet die EDV-Lösung eine optimale<br />
Möglichkeit, Aktualisierungen zeitnah aufzunehmen. Die<br />
EDV-Version des KKL steht als „KKL Beratungs- <strong>und</strong> Servicesystem“<br />
als attraktives Beratungsprogramm zur Verfügung.<br />
Betriebsindividuelle Checklisten können einfach ausgefüllt,<br />
archiviert <strong>und</strong> als Beratungs- <strong>und</strong> Dokumentationswerkzeug<br />
eingesetzt werden. Mit der fortlaufenden Aktualisierung <strong>und</strong><br />
Pflege des Kriterien-Kompendiums durch ein b<strong>und</strong>esweit<br />
agierendes Redaktionsteam, unter Mitwirkung des Deutschen<br />
Bauernverbandes, wird garantiert, dass das KKL im Hinblick<br />
auf Vorschriften <strong>und</strong> Gesetzgebung stets auf aktuellem Stand<br />
ist. KKL wird in der Beratungspraxis von Landesbauernverbänden<br />
<strong>und</strong> Landwirtschaftskammern eingesetzt. Auch ist<br />
eine enge Verzahnung mit freiwilligen Qualitätsprogrammen<br />
sichergestellt. So konnten im vergangenen Jahr die Inhalte<br />
des KKL um die Anforderungen QS-GAP <strong>und</strong> GLOBALGAP erweitert<br />
werden.<br />
Neu hinzugekommen ist ein umfangreiches Modul für die<br />
Direktvermarktung sowie die Einpflege der neuen EU-Öko-<br />
Verordnung, womit jetzt auch Biobetriebe eine betriebsindividuelle<br />
Eigenkontrolle mit KKL durchführen können.<br />
DBV-Position<br />
Ständig wachsende Dokumentationspflichten <strong>und</strong> zersplitterte<br />
Anforderungen verschiedener Qualitätssicherungsprogramme<br />
machen Anstrengungen notwendig, um Landwirte<br />
von der Bürokratielast zu befreien.<br />
123<br />
Recht
Agrarsozialpolitik<br />
Agrarsoziale Sicherung<br />
In verschiedenen Gesetzgebungsverfahren zur agrarsozialen<br />
Sicherung konnten wichtige Forderungen des Berufsstandes<br />
eingebracht <strong>und</strong> umgesetzt werden. Zu nennen ist hier vor allem<br />
das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen<br />
in der gesetzlichen Krankenversicherung.<br />
Mit Inkrafttreten des Ges<strong>und</strong>heitsfonds zum 1. Januar <strong>2009</strong><br />
hätte die landwirtschaftliche Krankenversicherung nicht mehr<br />
an den Steuermitteln zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher<br />
Aufgaben – im Wesentlichen die Kosten für die Behandlung<br />
der familienversicherten Mitglieder – partizipieren<br />
sollen. Aufgr<strong>und</strong> massiven Drucks der berufsständischen Vertreter<br />
wurde die Beteilung der LKV an den Steuermitteln über<br />
den 31.12.<strong>2008</strong> hinaus erreicht. Weiterhin wurde die Teilhabe<br />
der LKV an den zusätzlichen B<strong>und</strong>esmitteln zur Krankenver-<br />
124
sicherung durch das Konjunkturprogramm (Gesetz zur Sicherung<br />
von Beschäftigung <strong>und</strong> Stabilität in Deutschland) durchgesetzt.<br />
Eine unbegründete Schlechterstellung der Landwirte<br />
<strong>und</strong> ihrer Familien konnte somit verhindert werden.<br />
Die im Jahr 2007 unter Beteiligung des Deutschen Bauernverbandes<br />
beschlossene Reform der landwirtschaftlichen<br />
Unfallversicherung (LUV) hat bereits im abgelaufenen Jahr<br />
<strong>2008</strong> eine finanzielle Entlastung für die landwirtschaftlichen<br />
Unternehmen gebracht. Die Abfindungsaktion von kleinen Unfallrenten<br />
hat zum Stichtag 9. Februar <strong>2009</strong> eine Senkung der<br />
Umlageforderung von r<strong>und</strong> 75 Millionen Euro bewirkt. Durch<br />
den verringerten Rentenbestand sowie die Einsparungen, die<br />
durch die Änderungen im Leistungsbereich erzielt werden<br />
konnten, wird das F<strong>und</strong>ament für eine zukunftsorientierte<br />
solide finanzielle Gr<strong>und</strong>lage der LUV gelegt, die nunmehr<br />
größtmögliche Beitragsstabilität garantiert.<br />
DBV-Position<br />
• Der sich fortsetzende Rückgang an Beitragszahlern in der<br />
landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV) <strong>und</strong><br />
Alterssicherung der Landwirte (AdL) <strong>und</strong> das dadurch<br />
bedingte sinkende Beitragsaufkommen bei steigenden<br />
Ausgaben für Altenteiler müssen auch in Zukunft bei der<br />
Finanzierung des agrarsozialen Sicherungssystems berück-<br />
sichtigt werden. Der B<strong>und</strong> muss zu seiner Einstandspflicht<br />
stehen.<br />
• Die Einsparungseffekte in der LUV dürfen aber nicht durch<br />
die von der B<strong>und</strong>esregierung beabsichtigte Senkung der<br />
B<strong>und</strong>esmittel zur LUV in Höhe von 100 Millionen Euro ab<br />
dem Jahr 2010 zunichte gemacht werden. Deshalb wird sich<br />
der Deutsche Bauernverband weiterhin intensiv für die<br />
Erhaltung der B<strong>und</strong>esmittel in Höhe von 200 Millionen Euro<br />
einsetzen.<br />
• Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung<br />
hat zum 1. Januar <strong>2009</strong> seine Arbeit aufgenommen.<br />
Nunmehr wurden die organisatorischen Voraussetzun-<br />
gen geschaffen, um die Strukturen der LSV effizienter<br />
auszurichten <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>lage für eine nachhaltige Redu-<br />
zierung der Verwaltungskosten zu legen. Der ständige<br />
Rückgang an Versicherten <strong>und</strong> Mitgliedern in den landwirt-<br />
schaftlichen Sozialversicherungssystemen bedingt eine<br />
kontinuierliche Anpassung der Organisation, um die Verwal-<br />
tungskosten im Griff zu halten. Der Deutsche Bauernver-<br />
band sieht die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträ-<br />
ger <strong>und</strong> ihren Spitzenverband dabei auf gutem Weg <strong>und</strong><br />
begleitet diesen intensiv <strong>und</strong> konstruktiv.<br />
125<br />
Agrarsozialpolitik
Arbeitsmarktpolitik<br />
Saisonarbeitskräfte<br />
Mit der Verlängerung der Beschäftigungsdauer osteuropäischer<br />
Saisonarbeitskräfte von vier auf sechs Monate mit Beginn des<br />
Jahres <strong>2009</strong> konnte eine Forderung des Berufsstandes zumindest<br />
teilweise erfüllt werden. Der Deutsche Bauernverband<br />
hatte die Verlängerung auf neun Monate gefordert, die aber<br />
von der B<strong>und</strong>esregierung strikt abgelehnt wurde. Durch die<br />
Anwendung der EWG-Verordnung Nr. 1408/71 hinsichtlich<br />
der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen für osteuropäische<br />
Saisonarbeitskräfte sowie die zunehmende Konkurrenz<br />
um diese Saisonarbeitskräfte aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher<br />
Entwicklungen werden die Gr<strong>und</strong>lagen für die Sicherung <strong>und</strong><br />
den Ausbau des Sonderkulturanbaus in Deutschland nur durch<br />
neue bilaterale Verträge mit Drittstaaten (z. B. Ukraine <strong>und</strong><br />
Weißrussland) erhalten bleiben können. Der Abschluss dieser<br />
Verträge wird aber nach wie vor von der B<strong>und</strong>esregierung entschieden<br />
abgelehnt.<br />
126
Im Frühjahr <strong>2008</strong> konnte Dank intensiver Bemühungen<br />
des Bauernverbandes erreicht werden, dass die bestehende<br />
Vermittlungsabsprache mit Bulgarien, die bisher nur für den<br />
Hotel- <strong>und</strong> Gaststättenbereich galt, auf den Bereich der Land-<br />
<strong>und</strong> Forstwirtschaft ausgeweitet wurde. Den Landwirten steht<br />
somit ein größerer Pool an Saisonarbeitskräften zur Verfügung,<br />
aus dem der Bedarf an Arbeitskräften gedeckt werden<br />
kann.<br />
Arbeitsschutz<br />
Auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes konnte in Zusammenarbeit<br />
mit dem Gesamtverband der deutschen Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaftlichen<br />
Arbeitgeberverbände (GLFA) durch eine intensive<br />
Aufklärungsarbeit in einigen Fällen eine weitere Überbürokratisierung<br />
für die landwirtschaftlichen Betriebe vermieden<br />
werden.<br />
DBV-Position<br />
Von der B<strong>und</strong>esregierung wird beabsichtigt, die Beschränkung<br />
der Arbeitnehmerfreizügigkeit gegenüber den Bürgern der<br />
neuen Mitgliedstaaten der EU über den 1.5.<strong>2009</strong> hinaus gelten<br />
zu lassen. Dies lehnt der Deutsche Bauernverband kategorisch<br />
ab. Die Gewährleistung der Arbeitnehmerfreizügigkeit muss<br />
für alle EU-Bürger gelten, auch damit die deutschen landwirtschaftlichen<br />
Betriebe einen gleichberechtigten Zugang zu den<br />
Arbeitnehmern haben, wie ihre Wettbewerber aus den anderen<br />
EU-Staaten. Die Beschränkungen müssen im Frühjahr <strong>2009</strong><br />
aufgehoben werden.<br />
127<br />
Agrarsozialpolitik
Bildung
Bildungspolitik<br />
Noch positiver Trend bei Ausbildungszahlen<br />
In den „grünen Berufen“ gab es im Ausbildungsjahr<br />
2007/<strong>2008</strong> (Stichtag 31.12.2007) b<strong>und</strong>esweit insgesamt<br />
42.847 Auszubildende (plus 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich)<br />
<strong>und</strong> 17.612 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge<br />
(plus 11,5 Prozent). Der Anteil von Jugendlichen mit außerlandwirtschaftlicher<br />
Herkunft unter den Auszubildenden ist<br />
in fast allen B<strong>und</strong>esländern weiter angestiegen. Im Zuge<br />
der anhaltenden technischen <strong>und</strong> strukturellen Weiterentwicklungen<br />
halten landwirtschaftliche Betriebe auf dem Arbeitsmarkt<br />
verstärkt Ausschau nach qualifizierten Fach- <strong>und</strong><br />
Führungskräften, die in der Lage sind, erhöhte berufliche Anforderungen<br />
zu meistern.<br />
Die Betriebe zeigen eine unverändert hohe Ausbildungsbereitschaft<br />
<strong>und</strong> konnten einen Teil der freien Ausbildungsstellen<br />
weiterhin nicht besetzen, weil dafür nicht genügend<br />
qualifizierte Bewerber zu finden waren. Die Nachfrage der<br />
Land- <strong>und</strong> Agrarwirtschaft nach angestellten Arbeitnehmern<br />
bzw. Arbeitnehmerinnen, die betriebliche Fach- <strong>und</strong> Führungsfunktionen<br />
wahrnehmen können, erhöhte sich weiter.<br />
In den östlichen B<strong>und</strong>esländern schlug der demografische<br />
Wandel <strong>2008</strong> deutlich auf den Ausbildungsstellenmarkt durch,<br />
der sich allmählich in Richtung eines Angebotsüberhangs an<br />
freien Ausbildungsplätzen entwickelte. Dadurch verschärfte<br />
sich der Wettbewerb mit anderen Berufsbereichen um geeigneten<br />
Nachwuchs weiter. Verstärkt wird diese Entwicklungstendenz<br />
durch die wachsende Nachfrage nach betrieblichen<br />
Führungskräften, die infolge des anstehenden Generationswechsels<br />
in den Betrieben entstanden ist.<br />
Landwirtschaftliche Aus- <strong>und</strong> Fortbildung entwickelt<br />
sich weiter<br />
Novellierungen landwirtschaftlicher Ausbildungsberufe <strong>und</strong><br />
Fortbildungsregelungen wurden <strong>2008</strong> in verschiedenen Bereichen<br />
fortgeführt bzw. neu auf den Weg gebracht. Aus der<br />
Praxis gab es dabei positive Resonanzen:<br />
• Der novellierte Beruf Tierwirt/in wurde von der Praxis gut<br />
angenommen. Erste konkrete Überlegungen zur Novellie-<br />
rung der Meisterprüfung im Beruf Tierwirt/in wurden<br />
eingeleitet.<br />
• Der 2005 eingeführte Beruf Fachkraft Agrarservice hat<br />
sich in der Praxis bewährt <strong>und</strong> verzeichnet weiter steigende<br />
Ausbildungszahlen. Das Verfahren zur Evaluierung der<br />
Erprobungsverordnung wurde <strong>2008</strong> beendet. Das Bun-<br />
129<br />
Bildung
deslandwirtschaftsministerium eröffnete das Verfahren<br />
zur Überführung in eine reguläre Ausbildungsverordnung.<br />
Gleichzeitig wurden fachliche Abstimmungen zur Einrich-<br />
tung einer Meisterprüfung für diesen Beruf fortgeführt<br />
<strong>und</strong> konkrete Konzepte unter den Sozialpartnern disku-<br />
tiert.<br />
• Mitte <strong>2008</strong> führte das B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium<br />
ein offizielles Antragsgespräch zur Novellierung des<br />
Berufs Pferdewirt/in durch, das zur Eröffnung eines Neu-<br />
ordnungsverfahrens führte. Das B<strong>und</strong>esinstitut wurde vom<br />
B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium angewiesen, das Ab-<br />
stimmungsverfahren der Sozialpartner zur Überarbeitung<br />
der Ausbildungsordnung anzugehen.<br />
• Die Sozialpartner stimmten die Eckdaten zur Novellierung<br />
des Berufs Molkereifachmann/-frau ab <strong>und</strong> führten dazu<br />
beim B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium ein Antrags-<br />
gespräch, das zur Eröffnung eines Neuordnungsverfahrens<br />
führte.<br />
• Die novellierte Meisterprüfung für den Beruf Forstwirt/in<br />
hat sich in der Praxis gut bewährt. <strong>2008</strong> gab es auf Bun-<br />
desebene mehrere Fachgespräche zur Einführung einer<br />
b<strong>und</strong>esweiten Fortbildung „Geprüfter Forstmaschinenfüh-<br />
rer“ die in ein Neuordnungsverfahren mündeten.<br />
• Nach massiven berufsständischen Interventionen beendete<br />
das B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium seine Blo-<br />
ckade des Verfahrens zum Erlass einer Meisterprüfungs-<br />
verordnung für den Beruf Brenner/in (Obst- <strong>und</strong> Kleinbren-<br />
nerei). Die Anforderungsverordnung trat Ende Oktober<br />
<strong>2008</strong> in Kraft.<br />
• Nach eingehenden politischen Vorklärungen wurde das<br />
Verfahren zur Novellierung der Ausbilder-Eignungsverord-<br />
nung (AEVO) unter Moderation durch das B<strong>und</strong>esinstitut<br />
eingeleitet. Die AEVO soll <strong>2009</strong> in aktualisierter Fassung<br />
wieder eingesetzt werden.<br />
• Erstmalig führte der Deutsche Bauernverband in Zusammenarbeit<br />
mit dem vlf-B<strong>und</strong>esverband, dem Verband der<br />
Landwirtschaftskammern <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esarbeitsgemein-<br />
schaft der höheren landwirtschaftlichen Fachschulen eine<br />
b<strong>und</strong>esweite Fachtagung für Leiter der landwirtschaft-<br />
lichen Fachschulen durch. Eine Vielzahl aktueller bildungs-<br />
politischer <strong>und</strong> -fachlicher Fragen wurde diskutiert.<br />
Entsprechende Fachtagungen sollen künftig in jährlichen<br />
Abständen stattfinden.<br />
• Gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag (DLT) führte<br />
der Deutsche Bauernverband im November <strong>2008</strong> ein<br />
Perspektivforum zur Bildung im ländlichen Raum durch.<br />
130
Gemeinsam mit dem DLT positionierte sich der Berufs-<br />
stand zur Zukunft der Bildung in ländlichen Regionen.<br />
Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsbereichen<br />
Als Mitglied im Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für<br />
Berufsbildung (KWB) war der Deutsche Bauernverband gemeinsam<br />
mit den Spitzenverbänden der anderen Wirtschaftsbereiche<br />
in laufende Aktivitäten zur bildungspolitischen Gesamtkoordination<br />
<strong>und</strong> Weiterentwicklung der Berufsbildung<br />
eingeb<strong>und</strong>en. Arbeitsschwerpunkte waren dabei u. a. Fragen<br />
der strukturellen Weiterentwicklung <strong>und</strong> Neuordnung der Berufsbildung,<br />
die Integration benachteiligter <strong>und</strong> behinderter<br />
Jugendlicher in Bildung <strong>und</strong> Beschäftigung sowie die Internationalisierung<br />
der Berufsbildung.<br />
Information <strong>und</strong> Nachwuchswerbung für Agrarberufe<br />
Zur Verbesserung von Berufsinformation <strong>und</strong> Nachwuchswerbung<br />
für die „Grünen Berufe“ führte der Deutsche Bauernverband<br />
seine b<strong>und</strong>esweite Ausbildungskampagne weiter<br />
<strong>und</strong> leitete die konkrete Umsetzung auf B<strong>und</strong>esebene mit<br />
gezielten Maßnahmen ein. Auf dem Bauerntag <strong>2008</strong> in Berlin<br />
wurde wieder der „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ausgezeichnet.<br />
Auf der Internationalen Grünen Woche Berlin fand<br />
erneut ein „Tag der Ausbildung“ statt.<br />
Bildungspolitische Gremienarbeit des Berufsstandes<br />
Der DBV-Fachausschuss für Berufsbildung befasste sich <strong>2008</strong><br />
unter Vorsitz des DBV-Bildungsbeauftragten Hans-Benno<br />
131<br />
Bildung
Wichert mit aktuellen bildungspolitischen Gr<strong>und</strong>satzfragen,<br />
Strukturfragen der landwirtschaftlichen Berufsbildung,<br />
Hochschulfragen, Neuordnungen agrarischer Bildungsgänge<br />
sowie mit Verbesserungsansätzen für die Berufsinformation<br />
<strong>und</strong> Nachwuchswerbung. Im Ausschuss für Berufsbildung<br />
der Agrarwirtschaft erörterten die für die „Grünen Berufe“<br />
zuständigen Fach- <strong>und</strong> Spitzenverbände schwerpunktmäßig<br />
aktuelle Strukturfragen der Berufsbildung, Entwicklungen<br />
im Neuordnungsgeschäft sowie Verfahren zur bildungspolitischen<br />
Koordinierung <strong>und</strong> berufsübergreifenden Positionierung<br />
des Agrarbereichs.<br />
DBV-Position<br />
Eine wettbewerbsfähige <strong>und</strong> nachhaltige Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
braucht einen leistungs- <strong>und</strong> anpassungsfähigen<br />
Bildungsbereich:<br />
• Berufsinformation <strong>und</strong> -beratung sowie Nachwuchsgewinnung<br />
für „Grüne Berufe“ müssen b<strong>und</strong>esweit auf allen<br />
Ebenen weiter verbessert <strong>und</strong> intensiviert werden. Zur<br />
Erleichterung des Übergangs von Schulabsolventen in die<br />
Berufswelt muss der wirtschaftsk<strong>und</strong>liche <strong>und</strong> naturwis-<br />
senschaftliche Unterricht der allgemeinbildenden Schulen<br />
ausgebaut werden. Auch die Ausbildungsreife Jugend-<br />
licher – inklusive persönlich-sozialer Kompetenzen – ist<br />
stark verbesserungsbedürftig. Hier ist die gesamte Gesell-<br />
schaft gefordert.<br />
• Berufliche Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung einschließlich der<br />
hochschulischen Ausbildung im landwirtschaftlichen<br />
Bereich müssen möglichst praxisnah, flexibel umsetzbar<br />
<strong>und</strong> unbürokratisch angelegt bleiben. Aus Sicht der Land-<br />
wirtschaft muss das bestehende Bildungsinstrumentarium<br />
bei praxisorientierter Umsetzung den Qualifizierungs-<br />
belangen des „grünen Bereichs“ entsprechen.<br />
• Durchlässigkeit, Transparenz <strong>und</strong> Flexibilität innerhalb des<br />
Berufsbildungssystems sind gr<strong>und</strong>legend zu verbessern.<br />
• Für die konzeptionelle Begleitung <strong>und</strong> die praktische<br />
Umsetzung der landwirtschaftlichen Berufsbildung sind<br />
die notwendigen Ressourcen bei zuständigen Stellen,<br />
Verwaltungen, Bildungseinrichtungen <strong>und</strong> berufsstän-<br />
dischen Organisationen nachhaltig abzusichern.<br />
• Berufsbildung <strong>und</strong> Qualifizierung des Agrarbereichs bedürfen<br />
einer systematischen <strong>und</strong> kontinuierlichen wissen-<br />
schaftlichen Begleitung. Diesbezüglich sind Abstim-<br />
mungen zwischen Berufsstand, B<strong>und</strong>esregierung, B<strong>und</strong>es-<br />
ländern <strong>und</strong> Wissenschaft zu intensivieren.<br />
132
Andreas Hermes Akademie<br />
Die Arbeit der Andreas Hermes Akademie (AHA) konzentriert<br />
sich auf die Vermittlung sogenannter „überfachlicher Qualifikationen“.<br />
Denn nicht das Fachwissen, sondern die persönlichen<br />
Fähigkeiten – die „Persönlichkeit“ – sind gefragt, wenn<br />
es darum geht, sich geänderten Rahmenbedingungen anzupassen,<br />
etwas umzusetzen <strong>und</strong> auch andere mitzunehmen. Durch<br />
die Zusammenarbeit mit 60 hochqualifizierten Trainerinnen<br />
<strong>und</strong> Trainern mit unterschiedlichen Trainings-, Beratungs- <strong>und</strong><br />
Coachingkompetenzen bietet die AHA ein breites <strong>und</strong> facettenreiches<br />
Spektrum überfachlicher Weiterbildungen an.<br />
Markt- <strong>und</strong> Trendanalyse<br />
In zwei Marktforschungen zur Zielgruppen- <strong>und</strong> Bedarfsanalyse<br />
in 2007 <strong>und</strong> <strong>2008</strong> hat die AHA in Zusammenarbeit mit der<br />
CMA den Weiterbildungsbedarf analysiert.<br />
Die wichtigsten Ergebnisse:<br />
• Teilnehmer <strong>und</strong> Veranstalter sehen weiterhin einen großen<br />
Bedarf an Weiterbildung <strong>und</strong> speziell auch an überfach-<br />
lichen Themen.<br />
• Sie sehen die unternehmerische Weiterbildung als kontinuierlichen<br />
Prozess <strong>und</strong> erwarten eine engere Verknüpfung<br />
fachlicher <strong>und</strong> überfachlicher Themen, möglichst schon in<br />
der Ausbildung.<br />
• Veranstalter setzen zunehmend auf Kooperation, um von<br />
den Erfahrungen anderer zu profitieren <strong>und</strong> deren Konzepte<br />
für die eigenen Belange zu adaptieren. Sie wollen den wach-<br />
senden <strong>und</strong> individueller werdenden Ansprüchen der Teil-<br />
nehmer gerecht werden.<br />
Neustrukturierung der AHA<br />
Eine Konsequenz der Erkenntnisse aus den Studien ist die gezieltere<br />
Ausrichtung der AHA-Arbeit auf die Bedürfnisse der<br />
Zielgruppen. So werden die Themen in vier Geschäftsbereichen<br />
organisiert:<br />
• Unternehmertrainings (z. B. bus)<br />
• Verbandsmanagement<br />
• Markt/Marketing<br />
• Aus- <strong>und</strong> Fortbildungen<br />
bus-Unternehmertrainings<br />
Insgesamt 303 bus-Unternehmertrainings (bus: Bauern- <strong>und</strong><br />
Unternehmerschulung) wurden im Jahr <strong>2008</strong> durchgeführt,<br />
davon sogar 42 im Ausland (Österreich, Schweiz, Belgien, Ita-<br />
133<br />
Bildung
lien, Luxemburg <strong>und</strong> Burkina Faso). Damit ist bus auch weiterhin<br />
das bewährte Trainingsangebot für bäuerliche Unternehmerinnen<br />
<strong>und</strong> Unternehmer. Die Vorteile:<br />
• Im Mittelpunkt steht der einzelne Teilnehmer, der im Laufe<br />
des Trainings seinen eigenen Weg, sein eigenes Projekt bzw.<br />
seine eigenen Ziele erarbeitet. Die Gruppe <strong>und</strong> die Trainer<br />
bieten Unterstützung, Impulse <strong>und</strong> einen kritischen Blick<br />
auf die eigenen Ideen.<br />
• Die einzelnen bus-Module bauen systematisch aufeinander<br />
auf. Dies sichert den Erfolg, denn dieser stellt sich erst<br />
durch den Prozess des „Selber-Tun“ ein.<br />
bus-Unternehmertrainings können für Gruppen von bis zu 15<br />
Teilnehmern vor Ort organisiert werden.<br />
Verbandsmanagement<br />
Eine wichtige Zukunftsaufgabe berufsständischer Organisationen<br />
ist die Qualifikation ehrenamtlich engagierter Personen.<br />
Aber auch die Qualifikation der hauptamtlichen Mitarbeiter<br />
<strong>und</strong> die Unterstützung von Organisationsentwicklungsprozessen<br />
werden immer mehr gefragt. Anpassungsfähigkeit wird<br />
auch von Organisationen erwartet.<br />
Know-how über politische Entscheidungsprozesse von der<br />
europäischen bis zur kommunalen Ebene ist dabei genauso gefragt,<br />
wie professionelle Moderation oder sogar Mediation bei<br />
der Diskussion kritischer Themen <strong>und</strong> Auseinandersetzungen<br />
unter den Mitgliedern. Ein Leuchtturm-Angebot mit jahrzehntelanger<br />
Tradition ist der jährlich im Januar <strong>und</strong> Februar stattfindende<br />
TOP-Kurs. Ehrenamtliche Nachwuchsführungskräfte<br />
lernen in dieser Intensiv-Schulung alle wichtigen Akteure in<br />
Politik <strong>und</strong> Gesellschaft kennen. Wichtiger aber noch erhalten<br />
sie das persönliche Rüstzeug, sich im Ehrenamt aktiv zu engagieren,<br />
selbstsicher aufzutreten <strong>und</strong> in ihrer Funktion auf den<br />
verschiedensten Ebenen Verantwortung zu übernehmen.<br />
Markt <strong>und</strong> Marketing<br />
Die Entwicklungen auf den Agrarmärkten dominieren aktuell<br />
nicht nur die Diskussion in den Verbänden, sondern auch das<br />
134
etriebliche Handeln in den landwirtschaftlichen Unternehmen.<br />
Untermauert durch die Ergebnisse der genannten Studie<br />
zum Weiterbildungsbedarf, erfordert diese Entwicklung ein angepasstes<br />
Qualifizierungsangebot, das die AHA entwickelt. Im<br />
Mittelpunkt stehen neben dem tieferen Verständnis der Marktzusammenhänge<br />
vor allem der betriebliche Umgang mit volatilen<br />
Märkten, das eigene Risikobewusstsein <strong>und</strong> das eigene<br />
Risikomanagement.<br />
Unterstützung<br />
Als zentrale Weiterbildungsinstitution konnte die AHA im Jahr<br />
<strong>2008</strong> verschiedene Förderungsmöglichkeiten nutzen, um die<br />
Weiterbildungsangebote für die Partner vor Ort möglichst<br />
kostengünstig anbieten zu können. Vor allem haben die CMA<br />
Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft<br />
mbH <strong>und</strong> die Landwirtschaftliche Rentenbank auch<br />
stets die Weiterentwicklung neuer bedarfsorientierter Weiterbildungsangebote<br />
tatkräftig unterstützt.<br />
Internationaler Praktikantenaustausch<br />
Fortbildung im Ausland erweitert berufliche Perspektiven<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2008</strong> nutzten 93 deutsche Praktikanten aus<br />
den „Grünen Berufen“ die Gelegenheit, sich durch Vermittlung<br />
der Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes im<br />
Ausland fortzubilden. Neun Programme in Europa sowie zehn<br />
in Übersee boten den jungen Fachkräften die Möglichkeit, sich<br />
durch ein Praktikum im Bereich der Land-, Haus-, Forst- <strong>und</strong><br />
Pferdewirtschaft sowie dem Garten- <strong>und</strong> Weinbau fachlich <strong>und</strong><br />
persönlich weiterzuentwickeln.<br />
Wie schon in den Vorjahren waren die Fernziele dabei am<br />
meisten gefragt: Die USA mit 25 Teilnehmern, gefolgt von<br />
Neuseeland mit 23, Australien mit 14 <strong>und</strong> Kanada mit 11 Bewerbern,<br />
waren auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten<br />
Praktikumsziele. Klarer Favorit in Europa war Irland mit 12 von<br />
22 Vermittlungen.<br />
Die wichtigste Gr<strong>und</strong>lage für eine erfolgreiche Vermittlungstätigkeit<br />
ist die professionelle <strong>und</strong> vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />
der Schorlemer Stiftung mit ihren ausländischen Programmpartnern.<br />
Auf den internationalen Konferenzen, die im<br />
abgelaufenen Geschäftsjahr in Irland (für Europa) <strong>und</strong> in der<br />
Schweiz (für Europa <strong>und</strong> Übersee) abgehalten wurden, wurde<br />
daher sehr viel Wert auf eine Optimierung dieser Zusammenarbeit<br />
gelegt.<br />
Um das Praktikumsangebot weiter bekannt zu machen,<br />
fanden im Laufe des Jahres zahlreiche Informationsveranstal-<br />
135<br />
Bildung
tungen an Fachschulen <strong>und</strong> Universitäten statt. Auch eine Präsentation<br />
auf dem jährlich stattfindenden Seminar „Arbeiten<br />
im Ausland“ der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner<br />
stieß wieder auf breites Interesse. Der „Tag der Ausbildung“<br />
des Deutschen Bauernverbandes auf der Internationalen Grünen<br />
Woche in Berlin bot eine weitere gute Gelegenheit, die<br />
Praktikantenprogramme einem breiten Publikum vorzustellen.<br />
In Kooperation mit der BauernZeitung wurde überdies die<br />
Broschüre „Agrarpraktika im Ausland“ erarbeitet, die detailliert<br />
<strong>und</strong> anschaulich über die Teilnahmebedingungen <strong>und</strong><br />
Bewerbungsabläufe sowie die angebotenen Länder <strong>und</strong> Programme<br />
informiert. In parallel geschalteten Blogs von BauernZeitung<br />
<strong>und</strong> top agrar kann man überdies live miterleben,<br />
welche vielseitigen Erfahrungen deutsche Praktikanten bei ihren<br />
Auslandsaufenthalten machen.<br />
Praktikanten aus aller Welt in Deutschland<br />
Multinational war auch in diesem Jahr wieder das internationale<br />
Praktikantenseminar: Die 13 Teilnehmer kamen aus sieben<br />
Ländern, viele davon aus Übersee. Vertreten waren Japan, Korea,<br />
Kanada, Brasilien, Argentinien, Ungarn <strong>und</strong> die Schweiz.<br />
Erstmals fand das internationale Praktikantenseminar im Bildungszentrum<br />
für Landwirtschaft, Ernährung <strong>und</strong> Umwelt in<br />
Triesdorf statt. Der Kurs vermittelte vielfältige Kenntnisse in<br />
Tier- <strong>und</strong> Pflanzenproduktion. Auch betriebswirtschaftliche<br />
Fragen <strong>und</strong> die Agrarpolitik Deutschlands <strong>und</strong> der EU wurden<br />
mit den Seminarteilnehmern diskutiert. Praktische Lehreinheiten<br />
<strong>und</strong> Exkursionen zu Landwirtschafts- <strong>und</strong> Gartenbaubetrieben<br />
sowie Verarbeitungseinrichtungen r<strong>und</strong>eten das Seminarprogramm<br />
ab.<br />
Erste Ergebnisse auf dem Weg der Schorlemer Stiftung zu<br />
mehr Internationalität zeigte die Zusammenarbeit mit einem<br />
neuen Programmpartner in Korea. Die Vermittlungen von jungen<br />
koreanischen Agrarfachkräften nach Deutschland sollen<br />
in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Ein neues<br />
136
Kooperationsprojekt mit Frankreich im Rahmen des EU-Programms<br />
„Leonardo da Vinci“ ermöglichte vier französischen<br />
Junggärtnern einen vierwöchigen Fortbildungsaufenthalt in<br />
Deutschland. Planungen zu einer weiteren Intensivierung der<br />
Zusammenarbeit mit Frankreich auf EU-Ebene sind bereits angelaufen.<br />
Projektarbeit mit Osteuropa<br />
Im Rahmen des Praktikantenprogramms, das die Schorlemer<br />
Stiftung mit der Russischen Föderation, der Ukraine <strong>und</strong> Weißrussland<br />
im Auftrag des B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministeriums<br />
durchführt, kamen im Jahr <strong>2008</strong> 51 Agrarstudenten nach<br />
Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen <strong>und</strong> Thüringen, um<br />
über vier Monate an einem intensiven Fortbildungspraktikum<br />
teilzunehmen. Neu in das Programm aufgenommen wurde ein<br />
zusätzlicher Lehrgangstag, der den Bedürfnissen nach interkulturellem<br />
Training Rechnung trägt.<br />
Die Kooperation mit dem im vergangenen Jahr neu gewonnenen<br />
Projektpartner, der landwirtschaftlichen Agraruniversität<br />
Kazan, konnte im zweiten Jahr der Zusammenarbeit<br />
weiter konsolidiert <strong>und</strong> optimiert werden. Aufgr<strong>und</strong> der intensivierten<br />
Betreuung, qualifizierten fachlichen Unterweisung<br />
<strong>und</strong> sorgfältigen Auswahl moderner <strong>und</strong> vielseitiger<br />
Gastbetriebe konnten sieben deutsche Junglandwirte in die<br />
Russische Föderation reisen <strong>und</strong> menschlich, sprachlich <strong>und</strong><br />
fachlich von ihrem 3-monatigen Fortbildungspraktikum optimal<br />
profitieren.<br />
137<br />
Bildung
Agrarforschung<br />
Initiativkreis Agrar- <strong>und</strong> Ernährungsforschung<br />
Der Initiativkreis, dessen Geschäftsführung der Deutsche<br />
Bauernverband wahrnimmt, versteht sich als Plattform der<br />
Agrar- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft für den Austausch mit der<br />
Wissenschaft. Der Initiativkreis setzte sich im Jahr <strong>2008</strong><br />
vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Aufbruchstimmung an den Agrarmärkten<br />
für die notwendige Stärkung der Agrarforschung<br />
in Deutschland ein. Insbesondere wurde der Kontakt zum<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Forschung <strong>und</strong> Bildung intensiviert,<br />
welches mit den Forschungsprogrammen „Bioenergie 2021“<br />
<strong>und</strong> „Kompetenznetze der Agrar- <strong>und</strong> Ernährungsforschung“<br />
seine Aktivitäten auf dem Gebiet der Agrarforschung deutlich<br />
ausweitete. Mit DBV-Generalsekretär Dr. Helmut Born<br />
war auch der Initiativkreis im Auswahlgremium des Kompetenznetzwettbewerbs<br />
vertreten, welcher auf die Förderung<br />
der Agrarwissenschaft abzielt <strong>und</strong> mit der Förderung von vier<br />
Kompetenznetzen der Agrarforschung abschloss. Darüber<br />
hinaus wurde Dr. Born in den sogenannten Bioökonomierat<br />
138
erufen. Der Bioökonomierat wird als beratendes Gremium<br />
der B<strong>und</strong>esregierung Empfehlungen zur Weiterentwicklung<br />
der Forschung in den Bereichen Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft,<br />
Nahrungsmittelverarbeitung, Fischerei <strong>und</strong> Aquakulturen,<br />
aber auch für Teile der Chemie-, Pharmazie-, Kosmetik- <strong>und</strong><br />
Textilindustrie geben.<br />
Ziele des Initiativkreises für das Jahr <strong>2009</strong><br />
• Inhaltliche Schwerpunktbeschreibung für die Agrar- <strong>und</strong><br />
Ernährungsforschung insbesondere auch im Hinblick auf<br />
den neu konstituierten Bioökonomierat<br />
• Förderung der Agrar- <strong>und</strong> Ernährungsforschung durch die<br />
EU<br />
• Möglichkeiten der Verbesserungen der Strukturen in der<br />
Agrarforschung<br />
DBV-Position<br />
Die Landwirtschaft spielt bei der Lösung wichtiger Zukunftsprobleme<br />
bei Ernährung, Umwelt- <strong>und</strong> Ressourcenschutz <strong>und</strong><br />
Klimawandel die entscheidende Rolle. Dazu muss die Agrarforschung<br />
deutlich ausgebaut werden. Der Wissenschaftsstandort<br />
Deutschland bietet dafür gute Voraussetzungen,<br />
wenn Strukturprobleme gelöst <strong>und</strong> die richtigen Forschungsschwerpunkte<br />
gesetzt werden.<br />
139<br />
Agrarforschung
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend<br />
Das Jahr <strong>2008</strong> war geprägt durch eine Vielzahl an hochkarätigen<br />
Veranstaltungen für Landjugendliche, Junglandwirte<br />
<strong>und</strong> Jungwinzer. Bei der B<strong>und</strong>esmitgliederversammlung in<br />
Bremen wurde Dajana Gillmaier verabschiedet <strong>und</strong> als neue<br />
Bildungsbeauftragte <strong>und</strong> stellvertretende Vorsitzende Katrin<br />
Biebighäuser gewählt. Inhaltliche Schwerpunkte der B<strong>und</strong>esmitgliederversammlungen<br />
im Jahr <strong>2008</strong> waren Themen wie<br />
z. B. agrarische Bildung, Rechtsextremismus, Ernährung <strong>und</strong><br />
Bewegung <strong>und</strong> Prävention.<br />
Internationale Grüne Woche <strong>2008</strong><br />
Die Gestaltung des Messestandes des B<strong>und</strong>es der Deutschen<br />
Landjugend erfolgte durch den Landesverband Berlin-Brandenburg,<br />
der einen nachdrücklichen Eindruck mit seiner „virtuellen<br />
Demonstration“ hinterließ. Das Theaterstück mit dem<br />
Titel „Die Macht des Schwarzen Goldes“ bei der Jugendveranstaltung<br />
im ICC wurde von Landjugendlichen der Rheinischen<br />
Landjugend auf die Beine gestellt. Die größte Landjugendfete<br />
Deutschlands mit r<strong>und</strong> 5.000 Besuchern fand in der „arena“<br />
in Treptow statt. Beim Jugendforum wurde mit den B<strong>und</strong>estagsabgeordneten<br />
Dr. Christel Happach-Kasan <strong>und</strong> Marlene<br />
Mortler diskutiert. Der Junglandwirtekongress des B<strong>und</strong>es der<br />
Deutschen Landjugend <strong>und</strong> des Deutschen Bauernverbandes<br />
war ein besonderes Highlight der Internationalen Grünen<br />
Woche <strong>2008</strong>. Mit klarem Blick wurde dabei über Rahmenbedingungen<br />
<strong>und</strong> Marktchancen von Junglandwirten diskutiert.<br />
Anschließend trafen sich r<strong>und</strong> 3.500 Junglandwirte <strong>und</strong> Landjugendliche<br />
zum Landjugendball, der zweitgrößten Veranstaltung<br />
im Rahmen der Grünen Woche.<br />
Übergaben der Erntekronen<br />
Gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband <strong>und</strong> dem Deutschen<br />
LandFrauenverband überreichte der B<strong>und</strong> der Deutschen<br />
Landjugend dem B<strong>und</strong>espräsidenten am 13. Oktober <strong>2008</strong> die<br />
Erntekrone der deutschen Landwirtschaft, die in diesem Jahr<br />
von der Bayerischen Jungbauernschaft, Landjugendgruppe<br />
Stockau-Lehen, geb<strong>und</strong>en wurde. Den Erntedank inmitten Berlins<br />
begleitete die Volkstanzgruppe der Bayerischen Jungbauernschaft<br />
Oberfranken.<br />
Stellvertretend für die deutsche Landwirtschaft übergab<br />
der BDL-Vorstand zwei Tage später dem B<strong>und</strong>estagsausschuss<br />
140
für Ernährung, Landwirtschaft <strong>und</strong> Verbraucherschutz seine<br />
Erntekrone. Geb<strong>und</strong>en aus dem Besten, was die sachsen-anhaltinische<br />
Ernte hergab, ziert das Erstlingswerk der Landjugend<br />
Sachsen-Anhalt seitdem den Sitzungssaal im Berliner<br />
Paul-Löbe-Haus. Mit der Erntekrone brachten die BDL-VertreterInnen<br />
auch wichtige Landjugendforderungen in den<br />
Agrarausschuss.<br />
JunglandwirtInnen beim Deutschen Bauerntag in Berlin<br />
Beim gemeinsam vom Deutschen Bauernverband <strong>und</strong> B<strong>und</strong><br />
der Deutschen Landjugend veranstalteten Junglandwirtetreff<br />
anlässlich des Deutschen Bauerntages in Berlin stand die „Bildung<br />
in der Landwirtschaft – die Basis für Unternehmertum<br />
junger LandwirtInnen“ im Focus. Dazu diskutierten mehr als<br />
100 junge Landwirtinnen <strong>und</strong> Landwirte mit hochrangigen<br />
Gästen in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Aufgr<strong>und</strong><br />
der steigenden <strong>und</strong> komplexen Anforderungen an die LandwirtInnen<br />
verdeutlichte die Veranstaltung, welch wichtige<br />
Gr<strong>und</strong>lage die Bildung für den beruflichen <strong>und</strong> betrieblichen<br />
Erfolg in der Landwirtschaft darstellt <strong>und</strong> diese somit als eine<br />
der wichtigsten Investitionen im Leben eines/er LandwirtIn<br />
angesehen werden muss.<br />
Zudem brachten sich die jungen LandwirtInnen aktiv in die<br />
Diskussionen der Fachforen beim Deutschen Bauerntag ein <strong>und</strong><br />
vertraten ihre <strong>Positionen</strong> als Diskussionsgäste auf den Podien.<br />
Projekt: Arbeitskreis Junglandwirte<br />
In regionalen Arbeitskreisen finden junge LandwirtInnen ein<br />
Forum, um sich zu vernetzen, fortzubilden, zu informieren <strong>und</strong><br />
zu diskutieren. Der Deutsche Bauernverband <strong>und</strong> der B<strong>und</strong> der<br />
Deutschen Landjugend begleiten daher das gemeinsame Projekt<br />
„Arbeitskreise Junglandwirte“. In <strong>2008</strong> konnte das Netzwerk<br />
junger LandwirtInnen weiter ausgebaut werden <strong>und</strong> die<br />
regionalen Arbeitskreise in ihrer Arbeit weiter unterstützt werden.<br />
Ein Material- <strong>und</strong> Servicepool wurde erstellt <strong>und</strong> bietet<br />
Handwerkszeug für die Arbeit vor Ort. Die Internetseite www.<br />
junglandwirte.de wurde als Informations-, Beratungs- <strong>und</strong><br />
Austauschplattform überarbeitet.<br />
Die Projektentwicklung kann mittels Beirat fachlich begleitet<br />
<strong>und</strong> evaluiert werden <strong>und</strong> profitiert von den unterschiedlichen<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Erfahrungen der Beiratsmitglieder<br />
sowie durch eine verbesserte Kommunikation zwischen den<br />
ProjektpartnerInnen.<br />
EuroTier: Young Farmers Day<br />
Gemeinsam mit der Jungen DLG <strong>und</strong> der Jungen ISN hatte der<br />
141<br />
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend den agrarischen Nachwuchs<br />
zum Young Farmers Day auf die Fachmesse Eurotier nach Hannover<br />
eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Tierges<strong>und</strong>heit<br />
als entscheidender Wettbewerbsfaktor. Tierges<strong>und</strong>heitsmaßnahmen<br />
zu betreiben, zu dokumentieren <strong>und</strong> in einheitlichen<br />
Standards zu definieren wurde ebenso deutlich wie die Forderung<br />
nach praxisgerechten Anforderungen bei einer 1:1-Umsetzung<br />
von Europäischem Recht in National- <strong>und</strong> Länderrecht.<br />
B<strong>und</strong>esarbeitskreis Agrarpolitik<br />
Mit hochaktuellen agrarpolitischen Themen setzte sich der<br />
b<strong>und</strong>esweite Arbeitskreis auseinander. Den Auftakt bildete die<br />
dreitägige Klausur, bei der das Thema „Bildung im Agrarbereich“<br />
im Mittelpunkt stand. Es wurden konkrete Forderungen<br />
zur Ausbildung, Fortbildung <strong>und</strong> zum Studium im Agrarbereich<br />
in Deutschland aufgestellt, die in ein umfassendes Gr<strong>und</strong>satzpapier<br />
flossen. Zudem positionierte sich der Arbeitskreis zum<br />
Pflanzenschutz <strong>und</strong> zur EU-Pflanzenschutzpolitik. Deutlich<br />
wurde, dass Pflanzenschutz nicht nur unter dem Gesichtspunkt<br />
von möglichen Risiken betrachtet werden darf, sondern eine<br />
notwendige bestands- <strong>und</strong> ertragssichernde Aufgabe in der<br />
Landwirtschaft darstellt.<br />
Zudem erarbeitete der Arbeitskreis ein Positionspapier zum<br />
Klimaschutzprogramm der B<strong>und</strong>esregierung, einschließlich<br />
Forderungen zur Novelle des Erneuerbaren Energien-Gesetzes.<br />
Weitere Themen in den Diskussionen des Arbeitskreises waren<br />
der Health Check der Gemeinsamen Agrarpolitik, die zukünftige<br />
Milchmarktpolitik <strong>und</strong> Begleitmaßnahmen für den Milchquotenausstieg<br />
sowie die Novellierung des Erbschaftssteuerrechts.<br />
Insbesondere zu diesen Themen wurden Staatssekretär<br />
Gert Lindemann vom B<strong>und</strong>eslandwirtschaftsministerium sowie<br />
der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Gerd Sonnleitner<br />
zu Arbeitskreissitzungen eingeladen.<br />
Agrartagung<br />
Der Umgang mit dem Klimawandel als eine der großen zukünftigen<br />
Herausforderungen war Schwerpunkt der Agrartagung<br />
des B<strong>und</strong>es der Deutschen Landjugend. Gemeinsam mit Ex-<br />
pertInnen aus Wissenschaft <strong>und</strong> Politik diskutierten die<br />
JunglandwirtInnen den Klimawandel <strong>und</strong> seine Auswirkungen<br />
auf der einen Seite sowie mögliche Strategien für die Landwirtschaft<br />
in verschiedenen Produktionsrichtungen auf der<br />
anderen Seite.<br />
B<strong>und</strong>esarbeitskreis Deutsche JungwinzerInnen<br />
Die jungen WinzerInnen aus den deutschen Weinbaugebieten<br />
142
setzten ihre Diskussion um die Reform der europäischen Weinmarktordnung<br />
intensiv fort <strong>und</strong> traten mit ihren <strong>Positionen</strong><br />
an die politisch Verantwortlichen auf nationaler als auch auf<br />
europäischer Ebene heran. Die JungwinzerInnen sind für eine<br />
Reform der EU-Weinmarktordnung, die auf die individuellen<br />
Bedürfnisse der WinzerInnen in den Regionen zielgerichteter<br />
eingeht <strong>und</strong> ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert, wobei<br />
die Stärkung der Weinbauregionen im Vordergr<strong>und</strong> steht. Der<br />
Arbeitskreis hat zudem konkrete Fördermaßnahmen für junge<br />
WinzerInnen im Rahmen des nationalen Stützungsprogramms<br />
der GMO Wein erarbeitet, die vor allem im Bereich der Investitionen<br />
notwendig sind. Weiterhin beschäftigte sich der Arbeitskreis<br />
mit der Umsetzung des neuen Weinbaustudiengangs<br />
in Rheinland-Pfalz <strong>und</strong> mit einem moderaten Weingenuss.<br />
Bildungsangebote<br />
Im Jahr <strong>2008</strong> wurden im Gesamtbildungskonzept des B<strong>und</strong>es<br />
der Deutschen Landjugend r<strong>und</strong> 50 verschiedene Seminare angeboten.<br />
Informationen zu den Themen <strong>und</strong> Terminen wurden<br />
in einem Jahreskalender zusammengestellt <strong>und</strong> durch jugendgemäße,<br />
freche Gestaltung aufbereitet. Detaillierte Informationen<br />
zu den Bildungsangeboten des B<strong>und</strong>es der Deutschen<br />
Landjugend sind auch auf der Homepage zu finden.<br />
B<strong>und</strong>esbildungswoche<br />
Zum zehnten Mal versammelten sich ehren- <strong>und</strong> hauptamtliche<br />
MitarbeiterInnen des B<strong>und</strong>es der Deutschen Landjugend am<br />
Wannsee, um sich in den Tagungen der Hauptamtlichen über<br />
aktuelle Themen <strong>und</strong> Herausforderungen des verbandlichen<br />
Alltags auszutauschen. Darüber hinaus gibt es einzig in der<br />
Verbandswerkstatt die Möglichkeit, dass Haupt- <strong>und</strong> Ehrenamt<br />
mit Fachwissen <strong>und</strong> Erfahrung zusammenkommen <strong>und</strong> gemeinsam<br />
verbandliche Themen diskutieren. Im Jahr <strong>2008</strong> wurden<br />
im Rahmen der Verbandswerkstatt die Themen Interkulturelle<br />
Öffnung, Pädagogik der Landjugend, Öffentlichkeitsarbeit für<br />
143
„Wir fürs Land“, Junglandwirtearbeit, jugendpolitische Arbeit<br />
auf Landesebene <strong>und</strong> www.meinelaju.de intensiv beraten <strong>und</strong><br />
diskutiert.<br />
Ak JumPo - Jugend macht Politik<br />
Der Arbeitskreis JumPo – Jugend macht Politik – tagte viermal<br />
im Jahr <strong>2008</strong>. Zum Jahresanfang beschäftigte sich der Arbeitskreis<br />
mit dem Thema Rechtsextremismus in ländlichen Räumen<br />
<strong>und</strong> erarbeitete dazu ein Gr<strong>und</strong>satzpapier mit klarer Botschaft<br />
<strong>und</strong> Inhalten: „NEIN zu Rechtsextremismus <strong>und</strong> Rassismus“,<br />
welches bei der B<strong>und</strong>esmitgliederversammlung im Frühjahr<br />
in Bremen beschlossen wurde. Nach einer intensiven Auseinandersetzung<br />
mit der Thematik hat der B<strong>und</strong> der Deutschen<br />
Landjugend eine wissenschaftliche Studie „Rechtsextremismus<br />
in den ländlichen Räumen“ in Auftrag gegeben. Die Studie<br />
wird im Jahr <strong>2009</strong> veröffentlicht werden.<br />
Bei seiner Sitzung am Rande des 13. Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfetages,<br />
an dem sich der B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend<br />
mit zwei Fachforen einbrachte, beschäftigte sich der Arbeitskreis<br />
mit dem Thema Ernährung <strong>und</strong> Bewegung. Die inhaltliche<br />
Auseinandersetzung mit dem Themenfeld brachte das Gr<strong>und</strong>satzpapier<br />
„Ernährung <strong>und</strong> Bewegung – Ges<strong>und</strong>es Aufwachsen<br />
für alle Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen“ hervor, welches einstimmig,<br />
bei der B<strong>und</strong>esmitgliederversammlung im November in Berlin,<br />
beschlossen wurde. Weitere Themen des Arbeitskreises Jugend<br />
macht Politik im Jahr <strong>2008</strong> waren Partizipation von Kindern<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen, EU-Vertrag, Kinderarmut <strong>und</strong> Wahlalter.<br />
Wir fürs Land<br />
Die Vorbereitungen für die große „Landjugend – Wir fürs<br />
Land“-Aktion liefen im Berichtszeitraum auf Hochtouren. Seit<br />
November <strong>2008</strong> wurde eine eigene Homepage zur Aktion eingerichtet.<br />
Unter www.wir-fuers-land.de konnte man sich einen<br />
Eindruck verschaffen, was vom 15. - 17. Mai <strong>2009</strong> im ganzen<br />
B<strong>und</strong>esgebiet umgesetzt wurde. In 48, 60 oder 72 St<strong>und</strong>en<br />
packten b<strong>und</strong>esweit tausende Landjugendliche an, um etwas<br />
Bleibendes für ihre Regionen, ihre Gemeinden auf die Beine<br />
zu stellen. Ob Verschönerung von Buswartehäuschen, Anlegen<br />
von Grillplätzen oder Renaturierung von Biotopen, die Landjugend<br />
hat sich all diesen Aufgaben gestellt. B<strong>und</strong>espräsident<br />
Prof. Dr. Horst Köhler war Schirmherr der Aktion.<br />
Landjugend-Kalender<br />
Der Landjugendkalender <strong>2008</strong> erschien erneut im bewährtem<br />
handlichen Taschenformat. Neben übersichtlichem Kalendarium<br />
<strong>und</strong> festen Landjugendterminen, bereichern ein Informa-<br />
144
tionsteil <strong>und</strong> (Internet-)Adressen den Kalender <strong>und</strong> geben einen<br />
umfangreichen Überblick über Verbände <strong>und</strong> Institutionen<br />
der Jugendarbeit.<br />
www.landjugend.de <strong>und</strong> Landjugend im Netz<br />
Durch die Integration der früheren laju.de-Seite in www.landjugend.de<br />
als feste Rubrik gibt es einen interaktiven Bereich<br />
für Austausch <strong>und</strong> Vernetzung. In verschiedenen Foren wird<br />
über Politik, Ausbildung, Jugendarbeit <strong>und</strong> Freizeit diskutiert.<br />
Insgesamt präsentiert die Landjugend-Homepage einen Mix<br />
aus Informationen zu Projekten, Aktionen <strong>und</strong> <strong>Positionen</strong>.<br />
Ende des Jahres <strong>2008</strong> ging eine überarbeitete Testversion online,<br />
die zeitgemäßer ist <strong>und</strong> mit einem modernen Anwendersystem<br />
mehr Spielräume hat <strong>und</strong> die Nutzung des Web 2.0 bzw.<br />
künftiger Entwicklungen erlaubt. In diesem Zusammenhang<br />
entstand auch eine englischsprachige Version, die gemeinsam<br />
mit der aktualisierten Version nach Ablauf einer Testphase in<br />
<strong>2009</strong> die bestehende Seite ersetzen wird. Zudem betreibt der<br />
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend mit L@N wie „Landjugend ans<br />
Netz“ einen Homepagegenerator, über den jede Ortsgruppe,<br />
jeder Arbeitskreis, jede Aktion <strong>und</strong> jedes Landjugendprojekt<br />
sich auch ohne besondere Kenntnisse <strong>und</strong> Kosten eine eigene<br />
Seite erstellen <strong>und</strong> betreiben kann.<br />
www.junglandwirte.de<br />
Im Sommer ging der neue Treffpunkt für junge AgrarierInnen<br />
online: ein Treffpunkt, der sich an den Bedürfnissen des landwirtschaftlichen<br />
Nachwuchses orientiert. Fach- <strong>und</strong> Sachinformationen<br />
aus der Berufsbranche sind genauso integriert<br />
wie Stellenbörsen bzw. Hinweise zu Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung.<br />
Es gibt Fachforen, die aktuelle Diskussionen erlauben <strong>und</strong> das<br />
Netzwerk der jungen LandwirtInnen verdichten. Angemeldete<br />
BesucherInnen von www.junglandwirte.de können sich nicht<br />
nur austauschen <strong>und</strong> dort ihre Interessen bündeln, sondern<br />
sich auch im Materialkoffer bedienen.<br />
Internationale Jugendarbeit<br />
Für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren hat der B<strong>und</strong> der<br />
Deutschen Landjugend in diesem Jahr wiederum zwei deutschfranzösische<br />
Sprachferien in den Alpen <strong>und</strong> am Meer angeboten,<br />
in Zusammenarbeit mit den Partnern Jungbauernschule in<br />
Grainau, ROUDEL <strong>und</strong> UCJG in Frankreich.<br />
Zudem hat der B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend 24 GruppendolmetscherInnen<br />
ausgebildet, die anschließend im Rahmen<br />
von Begegnungen junger Menschen als Sprach- <strong>und</strong> KulturmittlerInnen<br />
arbeiten können.<br />
145<br />
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend
DBV-Service GmbH <strong>und</strong> Intranet<br />
DBV-Service GmbH<br />
Als ein modern geführtes Tochterunternehmen des Deutschen<br />
Bauernverbandes bietet die DBV-Service GmbH gemeinsam<br />
mit den 18 Landesbauernverbänden ein umfassendes<br />
<strong>und</strong> breit gefächertes Serviceangebot für alle Mitglieder. In<br />
Ergänzung zu den umfangreichen landesspezifischen Angeboten<br />
gibt es ein attraktives Service- <strong>und</strong> Dienstleistungspaket<br />
mit einem interessanten Produkt-Portfolio.<br />
Vorteile nutzen<br />
Durch den Abschluss von Rahmenverträgen mit namhaften<br />
Autoherstellern wie Alfa Romeo, Chevrolet, Citroen, Fiat,<br />
Ford, Hy<strong>und</strong>ai, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mitsubishi,<br />
Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki <strong>und</strong><br />
Toyota profitieren die Landwirte von attraktiven Rabatten<br />
beim Neuwagenkauf. Darüber hinaus gibt es Vereinbarungen<br />
mit Unternehmen aus den Bereichen EDV <strong>und</strong> Büroausstattung,<br />
Großhandel, Mineralöl, Reifen <strong>und</strong> Autoservice, Versandhandel<br />
sowie Telekommunikation, die den Mitgliedern<br />
erhebliche Vergünstigungen <strong>und</strong> Preisvorteile verschaffen.<br />
Um den Bedürfnissen der Mitglieder auch in Zukunft gerecht<br />
zu werden <strong>und</strong> die Mitgliedschaft in den Bauernverbänden<br />
noch interessanter zu gestalten, erweitert <strong>und</strong> entwickelt<br />
die DBV-Service GmbH in enger Kooperation mit den<br />
Landesbauernverbänden ihr bestehendes Serviceangebot<br />
kontinuierlich weiter.<br />
Dabei sein ist alles<br />
Mit Hilfe einer Mitgliedskarte der Landesbauernverbände<br />
können die Angebote unbürokratisch <strong>und</strong> einfach abgerufen<br />
werden. Detaillierte Informationen dazu gibt es in den<br />
Landes- bzw. Kreisgeschäftsstellen der Bauernverbände.<br />
Intranet<br />
Das verbandseigene, auf Lotus-Domino basierende Intra-<br />
Netzwerk wird zwischenzeitlich von b<strong>und</strong>esweit über 4.200<br />
Anwendern genutzt. Der Deutsche Bauernverband zählt mit<br />
dieser Zahl an Installationen zu den großen Partnern im IBM-<br />
Mittelstandsprogramm. Zuverlässigkeit <strong>und</strong> Sicherheit die-<br />
146
ser Software aus dem Hause IBM haben sich nun schon über<br />
zehn Jahre bewährt. Zeitnah <strong>und</strong> aktuell stellt der Deutsche<br />
Bauernverband damit seinen Mitgliedsverbänden wichtige<br />
Informationen zur Verfügung. Alle Landesbauernverbände<br />
haben inzwischen Lotus-Verbindungen zu ihren Kreisgeschäftsstellen<br />
aufgebaut <strong>und</strong> lassen auch regionale Nachrichten<br />
<strong>und</strong> Daten in das Kommunikationssystem einfließen.<br />
Im berufsständischen Tagesgeschäft werden die Datenbanken<br />
DBV-R<strong>und</strong>schreiben, Presse-Informationen, Steuerinformationsdienst,<br />
Rechtsinfodienst, Sozialrecht, die R<strong>und</strong>schreiben<br />
der landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger <strong>und</strong> die<br />
Datenbanken mit Informationen über das aktuelle BSE-, Geflügelgrippe-<br />
<strong>und</strong> MKS-Geschehen eingesetzt.<br />
Die DBV-Service-Datenbank mit aktuellen Informationen<br />
über das Angebot der Service-GmbH wurde zu einem unverzichtbaren<br />
Instrument im Dienstleistungsbereich. Der<br />
Informationsfluss zwischen Landes- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esebene der<br />
berufsständischen Interessenvertretung wird durch die zunehmende<br />
Nutzung elektronischer Medien zusehends erleichtert.<br />
Die Landesverbände können selbstständig <strong>und</strong><br />
unabhängig von der B<strong>und</strong>esebene weitere Informationen bis<br />
zu den Kreisverbänden weitergeben. Für die Zusammenarbeit<br />
der drei DBV-Geschäftsstellen in Berlin, Bonn <strong>und</strong> Brüssel ist<br />
Lotus Domino inzwischen unverzichtbar.<br />
Zielgruppenorientiert informieren<br />
Nachdem das Präsidium des Deutschen Bauernverbandes im<br />
Dezember 2004 die Einführung einer einheitlich strukturierten<br />
Mitgliederverwaltung in den Landes- <strong>und</strong> Kreisverbänden<br />
vereinbart hatte, ging es in den Folgejahren darum,<br />
dieses Ziel gemeinsam zu realisieren. Ziel ist die Schaffung<br />
einer Kommunikations- <strong>und</strong> Informationsplattform, die dem<br />
Bedürfnis der Mitglieder nach schneller <strong>und</strong> zielgruppenorientierter<br />
Information gerecht wird. Das gr<strong>und</strong>sätzliche, alleinige<br />
Erhebungs- <strong>und</strong> Nutzungsrecht der Mitgliederdaten<br />
bleibt bei den jeweiligen Landes- <strong>und</strong> Kreisbauernverbänden.<br />
Dass alle Kriterien des Datenschutzes berücksichtigt werden,<br />
ist selbstverständlich.<br />
Auf B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesebene wurde in Arbeitsgruppen<br />
an den Themen Datenerfassung, Datenstrukturbeschreibung<br />
<strong>und</strong> die praktische Umsetzung des neuen Systems gearbeitet.<br />
Inzwischen wurden die verschiedenen DBV-Informationen<br />
Bauerninfo-Schwein, Milch-Info, Öko-Report <strong>und</strong> DBV-Marktinformation<br />
Ackerbau entwickelt, die regelmäßig an interessierte<br />
Bauern verschickt werden.<br />
147<br />
DBV-Service GmbH <strong>und</strong> Intranet
Haus der Land- <strong>und</strong><br />
Ernährungswirtschaft<br />
Immobilien- <strong>und</strong> Tagungsmanagement GmbH<br />
Seit dem Jahr 2005 sitzt der Deutsche Bauernverband im<br />
Haus der Land- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft (HdLE) in der Berliner<br />
Claire-Waldoff-Straße. Das Gebäude, welches seitens der<br />
Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt, für die Spitzenverbände<br />
von Land-, Forst- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft errichtet<br />
wurde, ist der Standort von mehr als 40 b<strong>und</strong>esdeutschen<br />
„grünen“ Verbänden <strong>und</strong> präsentiert sich auch als ein Kommunikationszentrum<br />
mit hervorragenden Veranstaltungsräumlichkeiten.<br />
Den organisatorischen Backgro<strong>und</strong> für ein angenehmes<br />
<strong>und</strong> effizientes Arbeiten <strong>und</strong> Tagen aller Mieter des<br />
HdLE schafft die DBV-Tochter HdLE Immobilien- <strong>und</strong> Tagungsmanagement<br />
GmbH. Sämtliche Büroräume sind vermietet, <strong>und</strong><br />
der Deutsche Bauernverband koordiniert inzwischen die Anbindung<br />
von weiteren landwirtschaftlichen Organisationen in<br />
den Bürogebäuden der Nachbarschaft.<br />
148
Tagen in der grünen Mitte<br />
Die GmbH bietet sich als Dienstleister für diejenigen Organisationen<br />
<strong>und</strong> Verbände an, die die Chance nutzen wollen, die<br />
vielfältigen Aktivitäten der Menschen des ländlichen Raumes<br />
der Öffentlichkeit, Wissenschaft <strong>und</strong> Politik zugänglich zu machen<br />
<strong>und</strong> für die deutsche Land-, Forst- <strong>und</strong> Ernährungswirtschaft<br />
zu werben.<br />
Sie leistet technische Hilfestellung, damit im HdLE ein Forum<br />
geschaffen werden kann für<br />
• die Kommunikation zwischen Organisationen <strong>und</strong> Einrichtungen<br />
der Landwirtschaft <strong>und</strong> des ländlichen Raumes,<br />
• die Kommunikation o.g. Einrichtungen mit anderen Gruppen<br />
des öffentlichen Lebens.<br />
Mehr als 12.000 Besucher können im Tagungsbereich des HdLE<br />
jährlich begrüßt werden. Auch externe Organisationen nutzen<br />
die Gelegenheit, in professioneller Atmosphäre zu tagen.<br />
Immer mehr Besuchergruppen aus den B<strong>und</strong>esländern nutzen<br />
die Gelegenheit, die berufsständischen Verbände in Berlin<br />
zu besuchen <strong>und</strong> kennenzulernen. Im Sommer <strong>2008</strong> trafen sich<br />
mehr als 1.000 Gäste im Park des HdLE, um den 60-jährigen<br />
Geburtstag des Deutschen Bauernverbandes zu feiern.<br />
149
Fachausschüsse des<br />
Deutschen Bauernverbandes<br />
Finanzen<br />
Der im Wesentlichen von den Hauptgeschäftsführern<br />
der Landesbauernverbände<br />
getragene Finanzausschuss<br />
befasst sich unter Leitung<br />
von DBV-Präsident Gerd Sonnleitner<br />
jährlich in zwei Sitzungen mit<br />
dem Etat <strong>und</strong> Jahresabschluss des<br />
Deutschen Bauernverbandes. Dabei<br />
stehen Fragen weiterer Kosteneinsparungen,<br />
der Budgetierung der Referatsarbeit <strong>und</strong> der<br />
Beitragsgestaltung im Vordergr<strong>und</strong>. Die wachsenden Herausforderungen<br />
einer modernen Öffentlichkeitsarbeit sowie der<br />
nunmehr vollzogene Berlin-Umzug des Deutschen Bauernverbandes<br />
waren in den letzten Jahren Schwerpunkte der Finanz-<br />
<strong>und</strong> Haushaltsentscheidungen des Deutschen Bauernverbandes.<br />
In jüngster Zeit kamen Fragen der Organisation <strong>und</strong><br />
Finanzierung länderübergreifender Dienstleistungen durch<br />
die Landesbauernverbände <strong>und</strong> den Deutschen Bauernverband<br />
hinzu.<br />
Betriebswirtschaft<br />
Der Fachausschuss analysiert unter<br />
Leitung von Präsident Frank Zedler<br />
alle ökonomischen Fragen von agrarpolitischer<br />
Relevanz <strong>und</strong> positioniert<br />
sich dazu. Im Mittelpunkt stehen<br />
Themen wie die starken Preisschwankungen<br />
für landwirtschaftliche Erzeugnisse<br />
<strong>und</strong> Betriebsmittel sowie<br />
auch die möglichen Auswirkungen<br />
der Finanzkrise auf die Landwirtschaft. Der Fachausschuss hat<br />
sich <strong>2008</strong>/09 intensiv mit der Risikoausgleichsrücklage <strong>und</strong> mit<br />
den Ergebnissen der europäischen <strong>und</strong> nationalen Programme<br />
zum Bürokratieabbau beschäftigt. Der DBV-Situationsbericht<br />
wird hier vorbereitet.<br />
150
Steuerpolitische Fragen<br />
Unter Vorsitz von DBV-Vizepräsident<br />
Norbert Schindler werden im<br />
Fachausschuss die für die Land- <strong>und</strong><br />
Forstwirtschaft wichtigsten steuerpolitischen<br />
Themen mit den Vertretern<br />
der Landesbauernverbände<br />
beraten. Der steuerpolitische Ausschuss<br />
bestimmt die Zielrichtung<br />
des verbandlichen Vorgehens im<br />
Steuerbereich, erarbeitet <strong>Positionen</strong> zu Gesetzgebungsvorhaben<br />
<strong>und</strong> gibt wichtige Impulse für die Steuerpolitik. Im<br />
Ausschuss werden außerdem steuerrechtliche Probleme erörtert,<br />
so dass er den Steuerreferenten der Landesbauernverbände<br />
als fachliche Austauschplattform dient. Die wichtigsten<br />
Themen des Ausschusses sind derzeit die praktische<br />
Umsetzung der neuen Erbschaftsteuer sowie die Konkretisierung<br />
steuerpolitischer Forderungen des Berufsstandes im<br />
Hinblick auf die B<strong>und</strong>estagswahl <strong>2009</strong>.<br />
Eier <strong>und</strong> Geflügel<br />
Unter Vorsitz von Johann Arendt<br />
Meyer zu Wehdel werden im Fachausschuss<br />
Eier <strong>und</strong> Geflügel Themen<br />
r<strong>und</strong> um die Produktion des Geflügels<br />
diskutiert. Schwerpunktthema<br />
des vergangenen Jahres war die Salmonellenbekämpfung<br />
sowie deren<br />
wirtschaftliche Folgen für die eventuell<br />
betroffenen Betriebe. In diesem<br />
Zusammenhang wurde auch die Gefahr eines Salmonelleneintrags<br />
über Futtermittel diskutiert. Der Fachausschuss<br />
hat der Aufnahme des Leitfadens Eier in das QS-Betriebsaudit<br />
Landwirtschaft zugestimmt, so dass QS-Eier am Markt etabliert<br />
werden kann. Auch weiterhin setzt sich der DBV für eine<br />
eigene Kennziffer bei Eiern aus der Kleingruppe sowie einer<br />
1:1-Umsetzung der EU-Hähnchen-Haltungsrichtlinie ein. Die<br />
Themen werden ergänzt durch die fachliche Begleitung des<br />
BMELV sowie Referenten der ZMP, die die Märkte sowie deren<br />
Perspektiven unter den gegebenen Bedingungen erläutern.<br />
151<br />
DBV-Fachausschüsse
Getreide/pflanzliche<br />
Qualitätsprodukte<br />
Unter Vorsitz von Präsident Dr.<br />
Klaus Kliem bearbeiten die Vertreter<br />
der Landesbauernverbände im<br />
Fachausschuss aktuelle Anliegen<br />
des Acker- <strong>und</strong> Pflanzenbaus. Neben<br />
umweltrelevanten <strong>und</strong> qualitätssichernden<br />
Fragestellungen gewinnen<br />
angesichts des Rückzugs der<br />
Politik aus den pflanzlichen Märkten marktanalytische Themen<br />
zu den dynamischen Märkten für pflanzliche Produkte<br />
sowie für Betriebsmittel an Bedeutung. Der global rapide<br />
steigende Bedarf an pflanzlichen Rohstoffen für Lebens- <strong>und</strong><br />
Futtermittel sowie für die Produktion von Bioenergie befördert<br />
Diskussionen über Strategien für eine flächeneffiziente<br />
Bewirtschaftung. Die <strong>Positionen</strong> des Berufsstandes werden<br />
nach intensiver Diskussion mit Vertretern von Verwaltung,<br />
Handel <strong>und</strong> Politik erarbeitet. Die Einbindung der Arbeiten<br />
in die europäischen Ausschüsse bei COPA/COGECA <strong>und</strong> der EU-<br />
Kommission stellt die Verflechtung mit europäischen Themen<br />
sicher.<br />
Kartoffeln<br />
Unter Vorsitz von DBV-Vizepräsident<br />
Werner Hilse werden kurz-,<br />
mittel- <strong>und</strong> langfristige Strategien<br />
für die Sicherung des deutschen<br />
Kartoffelanbaus aller Verwertungsrichtungen<br />
entwickelt. Dies wird<br />
ermöglicht durch Positionierung<br />
zu nationalen <strong>und</strong> europäischen<br />
Gesetzesentwürfen <strong>und</strong> anderen<br />
Regelwerken, zur Marktsituation <strong>und</strong> zu Vermarktungsmöglichkeiten<br />
oder Sortenkriterien. Die enge Zusammenarbeit<br />
bei spezifischen Themen insbesondere mit der Union der<br />
deutschen Kartoffelwirtschaft UNIKA e.V. <strong>und</strong> anderen Institutionen<br />
<strong>und</strong> Behörden der Branche ermöglicht die Erarbeitung<br />
relevanter Rahmenbedingungen <strong>und</strong> Handlungsmöglichkeiten<br />
für die Kartoffelerzeuger.<br />
152
Saatgutfragen<br />
Die Vertreter der Landesbauernverbände<br />
erarbeiten unter Vorsitz<br />
von Präsident Joachim Rukwied<br />
Lösungen zur Sicherstellung der<br />
Versorgung mit qualitativ hochwertigem<br />
<strong>und</strong> gleichzeitig preiswertem<br />
Saat- <strong>und</strong> Pflanzgut. Die Anliegen<br />
des Berufsstandes bei möglichen<br />
Änderungen des Sortenschutz- <strong>und</strong><br />
Saatgutverkehrgesetzes werden in den Dialog mit Vertretern<br />
des Ministeriums <strong>und</strong> der Saatgutwirtschaft eingebracht.<br />
Durch den Fachausschuss werden die Entwicklungen auf den<br />
Saatgutmärkten tiefgehend analysiert. Fragestellungen zur<br />
Umsetzung der Inhalte des Kooperationsabkommens werden<br />
mit dem B<strong>und</strong>esverband deutscher Pflanzenzüchter beraten,<br />
ebenso wie eine nachhaltige Saatgutvermehrung in Zeiten<br />
volatiler Märkte für landwirtschaftliche Rohstoffe.<br />
Agrarrecht<br />
Unter Vorsitz von Präsident Rainer<br />
Tietböhl erarbeiten die Vertreter<br />
der Landesverbände die berufsständischen<br />
Strategien zur Agrarrechtspolitik.<br />
Kernpunkte bilden<br />
die Herausarbeitung notwendiger<br />
Gesetzesänderungen sowie die Erarbeitung<br />
von Stellungnahmen zu<br />
aktuellen Gesetzgebungsverfahren<br />
auf europäischer <strong>und</strong> nationaler Ebene. Der Fachausschuss<br />
analysiert die aktuellen Schwerpunkte der berufsständischen<br />
Rechtsberatung <strong>und</strong> stimmt Beratungsgr<strong>und</strong>lagen wie Musterverträge<br />
oder -empfehlungen ab. Er gewährleistet <strong>und</strong><br />
koordiniert den Erfahrungsaustausch zwischen den Verbandsjuristen<br />
der Landesbauernverbände im Interesse der Qualifizierung<br />
der berufsständischen Rechtsarbeit.<br />
153<br />
DBV-Fachausschüsse
Agrarstruktur- <strong>und</strong><br />
Regionalpolitik<br />
Unter Leitung von Präsident Klaus<br />
Fontaine beschäftigt sich der Ausschuss<br />
mit einer breiten Themenpalette<br />
von der einzelbetrieblichen<br />
Investitionsförderung über den<br />
Agrarkredit bis hin zur allgemeinen<br />
Strukturförderung im ländlichen<br />
Raum. Ein besonderes Augenmerk<br />
hat stets auch die Landwirtschaft in den benachteiligten Gebieten.<br />
Aktuelle Themen sind die Umsetzung der Fördermaßnahmen<br />
aus Modulationsmitteln, darunter insbesondere die<br />
Agrarinvestitionsförderung. Ein besonders wichtiges Thema<br />
ist die anstehende Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete.<br />
Nebenerwerbslandwirtschaft<br />
<strong>und</strong> Erwerbskombinationen<br />
Im Ausschuss, unter Vorsitz von<br />
Präsident Werner Räpple, kommen<br />
die Anliegen der Landwirte im Nebenerwerb<br />
zur besonderen Geltung<br />
– immerhin die Mehrheit der<br />
landwirtschaftlichen Betriebe in<br />
Deutschland. Geachtet wird besonders<br />
auf die Behandlung der Nebenerwerbsbetriebe in der<br />
Steuer-, Sozial- <strong>und</strong> Förderpolitik. Der Ausschuss hat sich<br />
insbesondere bei der Erbschaftsteuerreform für eine angemessene<br />
Behandlung der Bauernfamilien im Nebenerwerb <strong>und</strong><br />
der privaten Gr<strong>und</strong>eigentümer im ländlichen Raum eingesetzt.<br />
Wichtiges Thema sind auch die verbesserten Befreiungsmöglichkeiten<br />
von Ehegatten in der Landwirtschaftlichen Alterssicherung<br />
bei kleineren Nebenerwerbsbetrieben.<br />
154
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Unter Vorsitz von Präsident Joachim<br />
Rukwied erarbeiten die Vertreter<br />
der Landesverbände die<br />
Kommunikationsstrategien des<br />
Berufsstandes. Dazu zählt die Entwicklung<br />
der Inhalte <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
der Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
zur Verbesserung des<br />
Images der Landwirtschaft, die Abstimmung von Kampagnen<br />
<strong>und</strong> Veranstaltungen des Berufsstandes, die Anpassungen<br />
der Konzepte an veränderte Medienangebote sowie die Darstellung<br />
einer unternehmerischen Landwirtschaft auf b<strong>und</strong>esweit<br />
bedeutenden Messen. Der Fachausschuss analysiert<br />
auch die Medienberichterstattung über Landwirtschaft <strong>und</strong><br />
Werbung für Agrarprodukte <strong>und</strong> unterstützt Organisationen<br />
für Schulaktivitäten <strong>und</strong> Verbraucherdialoge.<br />
B<strong>und</strong>esausschuss Obst <strong>und</strong><br />
Gemüse<br />
Unter Vorsitz von Gerhard Schulz<br />
erarbeiten die Mitglieder des B<strong>und</strong>esausschusses<br />
Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
die politischen Ziele <strong>und</strong> <strong>Positionen</strong><br />
für den Obst- <strong>und</strong> Gemüsebau. Dazu<br />
zählen auf der europäischen Ebene<br />
die Marktorganisation für Obst <strong>und</strong><br />
Gemüse, das Inverkehrbringen von<br />
Pflanzenschutzmitteln einschließlich<br />
der Prüfung der Wirkstoffe <strong>und</strong> der Zulassung der Pflanzenschutzmittel,<br />
die Rückstandshöchstmengen sowie alle<br />
markt- <strong>und</strong> handelspolitischen Belange für den Obst- <strong>und</strong><br />
Gemüsebau. Dazu gehört auch die Mitarbeit in den europäischen<br />
Gremien COPA/COGECA-Arbeitsgruppe Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
sowie dem Beratenden Ausschuss der EU-Kommission<br />
für Obst <strong>und</strong> Gemüse. National werden alle politischen Rahmenbedingungen<br />
für den Obst- <strong>und</strong> Gemüsebau konkret mit<br />
B<strong>und</strong>esregierung, B<strong>und</strong>estag <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esrat verhandelt.<br />
155<br />
DBV-Fachausschüsse
Berufsbildung <strong>und</strong><br />
Bildungspolitik<br />
Der Fachausschuss für Berufsbildung<br />
<strong>und</strong> Bildungspolitik erarbeitet<br />
unter Vorsitz des DBV-Bildungsbeauftragten<br />
Hans-Benno Wichert<br />
Gr<strong>und</strong>sätze <strong>und</strong> Leitlinien für die<br />
Ausrichtung <strong>und</strong> Umsetzung der<br />
landwirtschaftlichen Aus-, Fort-<br />
<strong>und</strong> Weiterbildung. Er befasst sich<br />
mit Zukunftsfragen der landwirtschaftlichen<br />
Berufsbildung einschließlich der umliegenden<br />
Bildungsbereiche bis hin zur Bildungsfinanzierung <strong>und</strong><br />
-förderung. Zudem wirkt der Fachausschuss bei der Abstimmung<br />
<strong>und</strong> Durchführung berufsständischer Aktivitäten zur<br />
Darstellung <strong>und</strong> Kommunikation von Agrarberufen mit. Weitere<br />
Schwerpunkte sind Fragen der Attraktivitäts- <strong>und</strong> Qualitätssicherung<br />
von landwirtschaftlicher Berufsbildung, der<br />
Berufsberatung <strong>und</strong> –information sowie der Mobilisierung<br />
ausreichender Ausbildungskapazitäten im Agrarbereich.<br />
Ökologischer Landbau<br />
Unter Vorsitz von Dr. Heinrich Graf von<br />
Bassewitz werden auf nationaler <strong>und</strong><br />
europäischer Ebene die Interessen<br />
der deutschen Erzeuger, die nach den<br />
Richtlinien des ökologischen Landbaus<br />
wirtschaften, vertreten. Der Fachausschuss<br />
begleitete die praktische<br />
Umsetzung der EG-Öko-Verordnung<br />
<strong>und</strong> der zugehörigen Durchführungsverordnungen<br />
unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltig stabilen<br />
Marktentwicklung, eines hohen Verbraucherschutzes <strong>und</strong> der<br />
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Erzeuger. Weitere Schwerpunkte<br />
sind die kontinuierliche Beobachtung <strong>und</strong> Analyse der<br />
Marktlage, die Sicherstellung einer gentechnikfreien Erzeugung<br />
<strong>und</strong> die Beseitigung von Hemmnissen für die weitere Entwicklung<br />
des ökologischen Landbaus. Seit Anfang <strong>2009</strong> steht der Fachausschussvorsitzende<br />
zudem der Arbeitsgruppe Ökologischer Landbau<br />
des europäischen Bauernverbandes COPA-COGECA vor, was<br />
den deutschen Einfluss auf europäischer Ebene stärkt.<br />
156
Schweinefleisch<br />
Unter Vorsitz von DBV-Vizepräsident<br />
Franz-Josef Möllers werden im Fachausschuss<br />
Schweinefleisch aktuelle<br />
Themen r<strong>und</strong> um die Schweinehaltung<br />
beraten <strong>und</strong> es wird Stellung<br />
bezogen. Im vergangenen Jahr<br />
stand besonders die schwierige wirtschaftliche<br />
Lage der Sauenhalter<br />
<strong>und</strong> Schweinemäster im Mittelpunkt<br />
der Diskussion. Zur Existenzsicherung dieser Betriebe wurden<br />
umfangreiche Maßnahmen erarbeitet <strong>und</strong> gegenüber Vertretern<br />
aus Politik <strong>und</strong> Wirtschaft eingefordert. Intensiv erörtert<br />
wurden Fragen zum Tierschutz, insbesondere Alternativen zur<br />
derzeitigen Ferkelkastration <strong>und</strong> die Gesetzesvorschläge zum<br />
Prüf- <strong>und</strong> Zulassungsverfahren für Haltungseinrichtungen<br />
sowie zum Tiertransport. Ein weiterer Schwerpunkt war die<br />
Einfuhrproblematik von Eiweißfuttermitteln, die durch die<br />
zeitverzögerte Zulassung von GVO-Futtermitteln in der EU im<br />
Vergleich zu den Entscheidungen in den USA entstehen. Auch<br />
das Fleischgesetz <strong>und</strong> die Durchführungsverordnungen wurden<br />
intensiv erörtert <strong>und</strong> dabei wurde auf ein Höchstmaß an<br />
Transparenz für die Erzeuger geachtet.<br />
Rindfleisch<br />
Unter Vorsitz von Präsident Friedhelm<br />
Schneider erörterte der Fachausschuss<br />
Rindfleisch im vergangenen Jahr Themen<br />
zur Rindfleischerzeugung in<br />
Deutschland. Dabei standen insbesondere<br />
Fragen zur Tierges<strong>und</strong>heit,<br />
wie die Bekämpfung der Blauzungenkrankheit,<br />
die BVDV-Verordnung sowie<br />
ein Verordnungsentwurf zur Tuberkulosebekämpfung<br />
im Vordergr<strong>und</strong>. Ausgiebig diskutiert wurde<br />
zudem die Durchführungsverordnung zum Fleischgesetz. In diesem<br />
Zusammenhang wurde auch die apparative Klassifizierung<br />
(Videobildanalyse) von Rinderschlachtkörpern erörtert. Weitere<br />
Themen befassten sich mit der Wirtschaftlichkeit der Bullenmast<br />
sowie dem Stand zum Health Check. Zu den Sitzungen werden<br />
regelmäßig Vertreter des BMELV hinzugezogen.<br />
157<br />
DBV-Fachausschüsse
Milch<br />
Der DBV-Fachausschuss Milch unter<br />
Leitung von DBV-Vizepräsident Udo<br />
Folgart erarbeitet die strategische<br />
Ausrichtung der Milchpolitik. Maßgebend<br />
sind die aktuellen <strong>und</strong> zukünftigen<br />
Rahmenbedingungen des<br />
Milchmarktes <strong>und</strong> die politischen<br />
Vorgaben der EU sowie des B<strong>und</strong>es.<br />
Im Mittelpunkt der Arbeit der Jahre<br />
<strong>2008</strong>/<strong>2009</strong> steht die Umsetzung der Health Check-Beschlüsse<br />
in nationales Recht sowie die Umsetzung der Begleitmaßnahmen<br />
Milch. Weiterhin steht die Diskussion um die zukünftige<br />
Zusammenarbeit zwischen Milcherzeugern <strong>und</strong> Molkereien<br />
im Fokus der Ausschussarbeit. Durch die Mitarbeit im COPA/<br />
COGECA-Milchausschuss sowie im Beratenden Ausschuss<br />
Milch der EU-Kommission wird die Position der deutschen<br />
Milcherzeuger auf europäischer Ebene vertreten.<br />
Umweltschutz<br />
Der DBV-Umweltausschuss unter Vorsitz von Präsident Friedhelm<br />
Decker dient dem Austausch zwischen Landesverbänden <strong>und</strong><br />
Deutschem Bauernverband, zwischen<br />
Haupt- <strong>und</strong> Ehrenamt zu allen Fragen<br />
des Boden-, Klima-, Emissions-, Gewässer-<br />
<strong>und</strong> Naturschutzes auf Ebene<br />
des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der EU. Dabei werden<br />
Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />
insbesondere hinsichtlich<br />
der möglichen Auswirkungen<br />
auf die landwirtschaftlichen Betriebe<br />
überprüft <strong>und</strong> Strategien für eine zielgerichtete<br />
Umsetzung anstehender Maßnahmen in Kooperation<br />
mit der Landwirtschaft entwickelt. So hat sich der Umweltausschuss<br />
im vergangenen Jahr maßgeblich dafür eingesetzt, dass<br />
es durch das geplante Umweltgesetzbuch nicht zu Verschärfungen<br />
für die Landwirte kommt. Dem Austausch von Erfahrungen mit<br />
der Umsetzung von gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern<br />
kommt im Fachausschuss ebenso eine große Bedeutung zu.<br />
158
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Unter Leitung von Präsident Rainer<br />
Tietböhl nimmt sich der Fachausschuss<br />
den umfangreichen Fragestellungen<br />
der Energiepolitik an.<br />
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen<br />
die energetische <strong>und</strong> stoffliche<br />
Nutzung von Biomasse <strong>und</strong> deren<br />
effizienter Einsatz als Energielieferant<br />
<strong>und</strong> Werkstoff. Weiterhin<br />
erfolgt eine Auseinandersetzung mit anderen regenerativen<br />
Energieformen sowie der Frage, wie Energie am effizientesten<br />
genutzt werden kann. Die aus den europäischen<br />
Beschlüssen zur erneuerbaren Energie resultierenden neuen<br />
gesetzlichen Vorgaben, vor allem die Nachhaltigkeitszertifizierung<br />
betreffend sowie die Umsetzung des Erneuerbare<br />
Energien-Gesetzes <strong>und</strong> die Änderung der Biokraftstoffförderung,<br />
bilden die Schwerpunkte der Arbeit des Ausschusses in<br />
diesem Jahr.<br />
Sozialpolitik<br />
Die Mitglieder des Ausschusses Sozialpolitik,<br />
der von Präsident Leo<br />
Blum geleitet wird, befassen sich<br />
schwerpunktmäßig mit der Weiterentwicklung<br />
der landwirtschaftlichen<br />
Sozialversicherung. Dabei<br />
werden vor allem Strategien erarbeitet,<br />
wie die vier Säulen dieses<br />
Sondersystems durch innovative<br />
Elemente zukunftsfest ausgestaltet werden können. Einen<br />
zweiten Schwerpunkt der Arbeit des DBV-Fachausschusses<br />
bilden die Entwicklungen in der gesetzlichen Sozialversicherung<br />
<strong>und</strong> deren Auswirkungen auf das agrarsoziale Sicherungssystem.<br />
Weiterhin ist die soziale Absicherung von Nebenerwerbslandwirten<br />
von großer Bedeutung, insbesondere aufgr<strong>und</strong> der<br />
Wechselwirkungen zwischen dem allgemeinem Sozialversicherungssystem<br />
<strong>und</strong> dem spezifischen agrarsozialen Sicherungssystem<br />
in Deutschland.<br />
159<br />
DBV-Fachausschüsse
160<br />
Fotomaterial & Impressum<br />
Die im Geschäftsbericht verwendeten Bilder stammen aus<br />
folgenden Quellen:<br />
agrar-press.com,<br />
Andreas Hermes Akademie,<br />
Deutscher Bauernverband,<br />
Europäische Union,<br />
Fendt,<br />
Manfred Knopp,<br />
Erwin Koch,<br />
Stefan Metzdorf,<br />
Dr. Anni Neu,<br />
Frank Ossenbrink,<br />
Dr. Jens Rademacher,<br />
G<strong>und</strong>ula Reuser,<br />
Agnes Scharl,<br />
Susanne Schübel (BDL),<br />
Jörg Schulte-Domhof,<br />
Evelyn Zschächner.<br />
Herausgeber:<br />
Deutscher Bauernverband e.V.<br />
Claire-Waldoff-Straße 7<br />
10117 Berlin<br />
Telefon: 0 30 - 3 19 04-0<br />
Telefax: 0 30 - 3 19 04-496<br />
Redaktion:<br />
Dr. Anni Neu<br />
Layout:<br />
Grafische Abteilung der LV Druck GmbH & Co. KG, Münster<br />
Gesamtherstellung:<br />
LV Druck GmbH & Co. KG, Münster<br />
Berlin, im Juni <strong>2009</strong>
Fachausschüsse<br />
Vorstand<br />
Präsident: Gerd Sonnleitner<br />
Stellvertreter: Präsident<br />
Norbert Schindler<br />
Stellvertreter: Präsident<br />
Udo Folgart<br />
Stellvertreter: Präsident<br />
Franz-Josef Möllers<br />
Stellvertreter: Präsident<br />
Werner Hilse<br />
Landesbauernverband in<br />
Baden-Württemberg e.V.<br />
Bopserstraße 17, 70180 Stuttgart<br />
Präsident: Joachim Rukwied<br />
Hauptgeschäftsführer: RA P. Kolb<br />
Badischer Landwirtschaftlicher<br />
Hauptverband e.V.<br />
Friedrichstraße 41, 79098 Freiburg<br />
Präsident: Werner Räpple<br />
Hauptgeschäftsführer: G. Henninger<br />
Bayerischer Bauernverband<br />
Körperschaft des öffentlichen Rechts<br />
Max-Joseph-Straße 9, 80333 München<br />
Präsident: Gerd Sonnleitner<br />
Generalsekretär: H. Müller<br />
Landesbauernverband Brandenburg e.V.<br />
Dorfstraße 1, 14513 Teltow<br />
Präsident: Udo Folgart, MdL<br />
Hauptgeschäftsführer: W. Scherfke<br />
Bremischer Landwirtschaftsverband e.V.<br />
Johann-Neudörffer-Str. 2, 28355 Bremen<br />
Vorsitzender: Hinrich Bavendam<br />
Hauptgeschäftsführerin: F. Reitzenstein<br />
Bauernverband Hamburg e.V.<br />
Brennerhof 121, 22113 Hamburg<br />
Präsident: Heinz Behrmann<br />
Hauptgeschäftsführer: N. N.<br />
Hessischer Bauernverband e.V.<br />
Taunusstraße 151, 61381 Friedrichsdorf<br />
Präsident: Friedhelm Schneider<br />
Generalsekretär: P. Voss-Fels<br />
Mitgliederversammlung<br />
Präsidium<br />
Präsidenten <strong>und</strong> Vorsitzende<br />
der ordentlichen Mitglieder<br />
Präsident<br />
Gerd Sonnleitner<br />
Generalsekretär<br />
Dr. Helmut Born<br />
Ordentliche Mitglieder<br />
Bauernverband Mecklenburg-<br />
Vorpommern e.V.<br />
Trockener Weg 1, 17034 Neubrandenburg<br />
Präsident: Rainer Tietböhl<br />
Hauptgeschäftsführer: Dr. M. Piehl<br />
Landvolk Niedersachsen<br />
Landesbauernverband e.V.<br />
Warmbüchenstraße 3, 30159 Hannover<br />
Präsident: Werner Hilse<br />
Hauptgeschäftsführer: J. J. Dwehus<br />
Rheinischer Landwirtschaftsverband e.V.<br />
Rochusstraße 18, 53123 Bonn<br />
Präsident: Friedhelm Decker<br />
Hauptgeschäftsführer: RA W. Bennerscheidt<br />
Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband<br />
e.V.<br />
Schorlemerstraße 15, 48143 Münster<br />
Präsident: Franz-Josef Möllers<br />
Hauptgeschäftsführer: Ass. W. Gehring<br />
Bauern- <strong>und</strong> Winzerverband<br />
Rheinland-Nassau e.V.<br />
Karl-Tesche-Straße 3, 56073 Koblenz<br />
Präsident: Leo Blum<br />
Hauptgeschäftsführer: Dr. J. Derstappen<br />
Bauern- <strong>und</strong> Winzerverband<br />
Rheinland-Pfalz Süd e.V.<br />
Weberstr. 9, 55130 Mainz<br />
Präsident: Norbert Schindler, MdB<br />
Hauptgeschäftsführer: F. Schatt<br />
Bauernverband Saar e.V.<br />
Heinestraße 2-4, 66121 Saarbrücken<br />
Präsident: Klaus Fontaine<br />
Hauptgeschäftsführer: H. Lauer<br />
Mitgliedsverbände, Organe <strong>und</strong> Gremien<br />
Verbandsrat<br />
Präsidenten der Landesbauernverbände<br />
Hauptgeschäftsführerbesprechung<br />
Hauptgeschäftsführer <strong>und</strong><br />
Generalsekretäre<br />
der Landesbauernverbände<br />
Geschäftsstelle Berlin<br />
Büro Brüssel<br />
Büro Bonn<br />
Sächsischer Landesbauernverband e.V.<br />
Wolfshügelstraße 22, 01324 Dresden<br />
Präsident: Wolfgang Vogel<br />
Hauptgeschäftsführer: Dr. J. Hilger<br />
Landesbauernverband<br />
Sachsen-Anhalt e.V.<br />
Maxim-Gorki-Straße 13, 39108 Magdeburg<br />
Präsident: Frank Zedler<br />
Hauptgeschäftsführer: Dr. F. Schumann<br />
Bauernverband Schleswig-Holstein e.V.<br />
Jungfernstieg 25, 24768 Rendsburg<br />
Präsident: Werner Schwarz<br />
Generalsekretär: RA P. Paulsen<br />
Thüringer Bauernverband e.V.<br />
Alfred-Hess-Straße 8, 99094 Erfurt<br />
Präsident: Dr. Klaus Kliem<br />
Hauptgeschäftsführer: Dr. E. Dänner<br />
B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend<br />
im Deutschen Bauernverband e.V.<br />
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin<br />
B<strong>und</strong>esvorsitzende: A. Hartmann / G. Hiestand<br />
Geschäftsführer: M. Sammet<br />
Deutscher Raiffeisenverband e.V.<br />
Adenauerallee 127, 53113 Bonn<br />
Präsident: Manfred Nüssel<br />
Generalsekretär: Dr. R. Meyer<br />
B<strong>und</strong>esverband Landwirtschaftlicher<br />
Fachbildung e.V.<br />
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin<br />
Präsident: Peter Seidl<br />
Geschäftsführer: Dr. H. Born<br />
Arbeitsgemeinschaft der Gr<strong>und</strong>-<br />
besitzerverbände e.V., Berlin<br />
Vorsitzender: M. Prinz zu<br />
Salm-Salm<br />
Arbeitsgemeinschaft Deutscher<br />
Rübenbauerverbände e.V.<br />
Berlin<br />
Vorsitzender: B. Conzen<br />
Arbeitsgemeinschaft Deutscher<br />
Tierzüchter e.V.<br />
Bonn<br />
Präsident: R. Böge, MdEP<br />
Arbeitsgemeinschaft Deutscher<br />
Waldbesitzerverbände e.V.<br />
Berlin<br />
Präsident: M. Prinz zu Salm-Salm<br />
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung<br />
des Qualitätsgerstenanbaues<br />
im B<strong>und</strong>esgebiet e.V., Eichenau<br />
Vorsitzender: Dr. H. G. Bellmer<br />
B<strong>und</strong> deutscher Baumschulen<br />
e.V. BdB<br />
Pinneberg<br />
Präsident: K.-H. Plum<br />
B<strong>und</strong>esverband BioEnergie e.V.<br />
Bonn<br />
Vorsitzender: H.-J. Lamp<br />
B<strong>und</strong>esverband der<br />
Kälbermäster e.V.<br />
Bonn<br />
Vorsitzender: H. Nienhaus<br />
B<strong>und</strong>esverband der<br />
Maschinenringe e.V.<br />
Neuburg<br />
Präsident: H.-M. Stölting<br />
B<strong>und</strong>esverband der Privaten<br />
Milchwirtschaft e.V.<br />
Bonn<br />
Präsident: U. Kraut<br />
Bauernverband der<br />
Vertriebenen e.V.<br />
Berlin<br />
Präsident: Chr. Walter<br />
B<strong>und</strong>esverband der Stärkekartoffelerzeuger<br />
e.V.<br />
Berlin<br />
Vorsitzender: W. Hilse<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Kartoffelbrenner e.V.<br />
München<br />
Vorsitzender: M. Empl<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Kornbrenner e.V.<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
Präsident: J. Böckenhoff<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Pflanzenzüchter e.V.<br />
Bonn<br />
Vorsitzender: Dr. K. von Kameke<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Saatguterzeuger e.V.<br />
Pölitz<br />
Vorsitzender: J. Krafft<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Tabakpflanzer e.V.<br />
Speyer<br />
1. Vorsitzender: H. Pfanger<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher<br />
Ziegenzüchter e.V.<br />
Berlin<br />
Vorsitzende: U. Höfken, MdB<br />
B<strong>und</strong>esverband für Landwirtschaftliche<br />
Wildhaltung e.V.<br />
Berlin<br />
Vorsitzender: K.-H. Funke<br />
B<strong>und</strong>esverband Landwirtschaftlicher<br />
Pächter e.V.<br />
Hannover<br />
1. Vorsitzender: J. Ricke<br />
B<strong>und</strong>esverband Lohnunternehmen<br />
e.V.<br />
Suthfeld/Riehe<br />
Präsident: K. Pentzlin<br />
Deutsche Landwirtschafts-<br />
Gesellschaft (DLG)<br />
Frankfurt/Main<br />
Präsident: C. A. Bartmer<br />
Assoziierte Mitglieder<br />
Deutscher Berufs- <strong>und</strong><br />
Erwerbsimkerb<strong>und</strong> e.V.<br />
Utting<br />
Präsident: M. Hederer<br />
Deutscher Imkerb<strong>und</strong> e.V.<br />
Wachtberg-Villip<br />
Präsident: P. Maske<br />
Deutscher Fischerei-<br />
Verband e.V.<br />
Hamburg<br />
Präsident: M. Brick<br />
Deutscher LandFrauenverband<br />
e.V.<br />
Berlin<br />
Präsidentin: B. Scherb<br />
Deutscher Weinbauverband e.V.<br />
Bonn<br />
Präsident: N. Weber<br />
Gesamtverband der Deutschen<br />
Land- u. Forstwirtschaftlichen<br />
Arbeitgeberverbände e.V., Berlin<br />
Präsident: L. Lampe<br />
Hauptverband der Landwirtschaftlichen<br />
Buchstellen <strong>und</strong> Sachverständigen<br />
e.V. HLBS, St. Au-<br />
gustin Präsident: Dr. J. Jaeschke<br />
LAND-DATA Gesellschaft für Verar<br />
beitung landwirtschaftlicher Da-<br />
ten mbH, Visselhövede Aufsichtsratsvorsitzender:<br />
G. Sonnleitner<br />
Landesverband Gartenbau <strong>und</strong><br />
Landwirtschaft e.V.<br />
Berlin<br />
Präsident: L. Grille<br />
Vizepräsident: A. Gerike<br />
Messe Berlin GmbH<br />
Berlin<br />
Vorsitzender: R. Hosch<br />
Milchindustrie-Verband e.V.<br />
Bonn<br />
Vorsitzender: Dr. K.-H. Engel<br />
Stand: Juni <strong>2009</strong><br />
Orden Deutscher Falkoniere<br />
(O.D.F.)<br />
Wilnsdorf<br />
Vorsitzender: G. Klein<br />
Raiffeisen- <strong>und</strong> Volksbanken-<br />
Versicherungen, Wiesbaden<br />
Vorstandsvorsitzender:<br />
Dr. F. Caspers<br />
Verband der Deutschen<br />
Binnenfischerei e.V.<br />
Brandenburg<br />
Präsident: Dr. Ch. Proske<br />
Verband der Landwirtschaftskammern<br />
Berlin<br />
Präsident: J. Frizen<br />
Verband Deutscher<br />
Hopfenpflanzer e.V.<br />
Wolnzach-Markt/Obb.<br />
Präsident: Dr. J. Pichlmaier<br />
Verband Deutscher<br />
Stutenmilcherzeuger e.V.<br />
Garching<br />
1. Vorsitzender: D. Bielicke<br />
Vereinigte Hagelversicherung<br />
VVaG, Gießen<br />
Aufsichtsratsvorsitzender:<br />
K. Mugele<br />
Vereinigung Deutscher Landes-<br />
schafzuchtverbände e.V.<br />
Berlin<br />
Vorsitzender: C. Lauenstein<br />
Zentralverband der Deutschen<br />
Geflügelwirtschaft e.V.<br />
Berlin<br />
Präsident: G. Wagner<br />
Zentralverband Deutscher<br />
Kaninchenzüchter e.V.<br />
Langen<br />
Präsident: P. Mickmann<br />
Zentralverband Deutscher<br />
Milchwirtschaftler e.V.<br />
Bonn<br />
Präsident: D. Doose<br />
Zentralverband Gartenbau e.V.<br />
Berlin<br />
Präsident: Heinz Herker
Organisationsplan des Deutschen Bauernverbandes (DBV)<br />
Geschäftsstelle Berlin<br />
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin, Telefon (030) 31904-0, Zentralfax (030) 31904-205<br />
Fax Generalsekretariat -196, Fax Pressestelle -431<br />
Büro Brüssel<br />
Rue de Luxembourg 47-51, B-1050 Brüssel, Telefon:(00322) 2854054, Telefax (00322) 2854059<br />
Büro Bonn<br />
In der Wehrhecke 1 c, 53125 Bonn, Telefon (0228) 92657-0, Telefax (0228) 92657-15<br />
Fachbereich Z<br />
Dr. Helmut Born<br />
Z.1 Personal/Finanzen/Organisation<br />
Verwaltungsleitung<br />
Dr. Christiane Volkinsfeld<br />
Dipl.-Kfm. (FH) Marco Groß<br />
Z.2 DBV-Service GmbH<br />
Dipl.-Geogr. Michael Lenz<br />
Dr. Christiane Volkinsfeld<br />
Dipl.-Kfm. (FH) Marco Groß<br />
Z.3 HdLE GmbH<br />
Dipl.-Geogr. Michael Lenz<br />
Dr. Christiane Volkinsfeld<br />
Z.4 Begabtenförderung/VLF<br />
(Büro Bonn)<br />
Ingrid Fleischer<br />
Finanzen<br />
Vorsitzender: Präsident G. Sonnleitner<br />
Geschäftsführer: Generalsekretär<br />
Dr. H. Born<br />
Betriebswirtschaft<br />
Vorsitzender: Präsident F. Zedler<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt<br />
U. Hemmerling<br />
Steuerpolitische Fragen<br />
Vorsitzender: Präsident N. Schindler, MdB<br />
Geschäftsführer: RA S. Jäckel<br />
1.1 Milch/Futtermittel/<br />
Qualitäts management<br />
Milch<br />
Dr. Rudolf Schmidt<br />
Dipl.-Ing. agr. Runa Mosel<br />
Futtermittel/Qualitätsmanagement<br />
Dipl.-Ing. agr. Insea Pewsdorf<br />
1.2 Tierische Erzeugung Vieh <strong>und</strong><br />
Fleisch/Tierschutz/Gentechnik<br />
Dr. Michael Starp<br />
Dipl.-Ing. (FH) Wanda Pierini<br />
Dipl.-Ing. agr. Christa Niemann<br />
(Münster, Projekt)<br />
Tierges<strong>und</strong>heit/Eier <strong>und</strong> Geflügel<br />
Dipl.-Ing. agr. Brigitte Wenzel<br />
Dipl.-Ing. (FH) Wanda Pierini<br />
1.3 Schafe/Ziegen/Ldw. Wildtierhaltung/Pferde/Tierzucht<br />
Dr. Stefan Völl (VDL)<br />
1.4 Pflanzliche Erzeugung/Getreide/<br />
Gentechnik/Zucker/Landtechnik<br />
Dr. Jens Rademacher<br />
Dipl.-Ing. agr. Dörte Hecheltjen<br />
Geflügel<br />
Vorsitzender: J. A. Meyer zu Wehdel<br />
Geschäftsführerin: Dipl.-Ing. agr.<br />
B. Wenzel<br />
Getreide/pflanzliche Qualitätsprodukte<br />
Vorsitzender: Präsident Dr. K. Kliem<br />
Geschäftsführer: Dr. J. Rademacher<br />
Kartoffeln<br />
Vorsitzender: Präsident W. Hilse<br />
Geschäftsführerin: Dipl.-Ing. agr.<br />
Dr. Markus Prüfe<br />
Saatgutfragen<br />
Vorsitzender: Präsident J. Rukwied<br />
Geschäftsführer: Dr. J. Rademacher<br />
Fachbereich 1<br />
Dr. Helmut Born<br />
Agrarrecht<br />
Vorsitzender: Präsident R. Tietböhl<br />
Geschäftsführer: RA Dr. W. Krüger<br />
Agrarstruktur- <strong>und</strong> Regionalpolitik<br />
Vorsitzender: Präsident K. Fontaine<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt<br />
U. Hemmerling<br />
Nebenerwerbslandwirtschaft <strong>und</strong><br />
Erwerbskombinationen<br />
Vorsitzender: Präsident W. Räpple<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt U. Hemmerling<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Vorsitzender: Präsident J. Rukwied<br />
Geschäftsführer: Dr. M. Lohse<br />
Präsident: Gerd Sonnleitner<br />
Generalsekretär: Dr. Helmut Born Assistent der Geschäftsführung: Dipl.-Ing. agr. Johannes Funke<br />
Stellv. Generalsekretär: Dipl.-Agrarökonom Adalbert Kienle<br />
1.6 Kartoffeln<br />
Dr. Markus Prüfe (UNIKA, BVS)<br />
Dipl.-Ing. agr. Hélène Simonin-<br />
Rosenheimer (BVS, UNIKA)<br />
1.7 Ölsaaten/Biodiesel<br />
Dr. Norbert Heim (UFOP)<br />
Dipl.-Ing. agr. Dieter Bockey<br />
(UFOP/AGQM)<br />
Dr. Manuela Specht (UFOP)<br />
1.8 Obst <strong>und</strong> Gemüse/Sonderkulturen<br />
Dr. Hans-Dieter Stallknecht<br />
Fachgruppe Obst<br />
Jörg Disselborg<br />
Fachgruppe Gemüse<br />
Jochen Winkhoff<br />
1.9 Marktpolitik/Öko-Landbau/<br />
Urlaub auf dem Bauernhof<br />
Dr. Frank Wetterich<br />
Referate<br />
Fachausschüsse<br />
2.1 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Pressesprecher<br />
Dr. Michael Lohse<br />
Medieninformationen<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Agnes Scharl<br />
dbk/Agrar-Verlag<br />
Dr. Anni Neu<br />
2.2 Internationale Beziehungen<br />
(Büro Brüssel)<br />
Dipl.-Ing. agr. Willi Kampmann<br />
M.sc. Hinnerk Winterberg<br />
2.3 Parlament/Gesellschaftspolitik/<br />
Verbandsorganisation<br />
Dipl.-Geogr. Anton Blöth<br />
2.4 Umweltpolitik<br />
Dipl.-Ing. agr. Steffen Pingen<br />
2.5 Betriebswirtschaft/<br />
Ländlicher Raum<br />
Dr. Peter Pascher<br />
2.6 Berufsbildung/Bildungspolitik<br />
Dipl.-Ing. agr. Martin Lambers<br />
B<strong>und</strong>esausschuss Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
beim DBV<br />
Vorsitzender: G. Schulz<br />
Geschäftsführer: Dr. H.-D. Stallknecht<br />
Berufsbildung/Bildungspolitik<br />
Vorsitzender: H.-B. Wichert<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. agr. M. Lambers<br />
Ökologischer Landbau<br />
Vorsitzender: Dr. H. Graf von Bassewitz<br />
Geschäftsführer: Dr. F. Wetterich<br />
Fachbereich 2<br />
Dipl.-Agrarökonom Adalbert Kienle<br />
Assistent des Präsidenten: Dipl.-Wirtsch. Ing. (FH) Christian Schneider<br />
2.7 Internationaler<br />
Praktikantenaustausch (Büro Bonn)<br />
Antje Bauch, M.A.<br />
Dipl.-Landsch.-Ökol. Stefan Metzdorf<br />
2.8 B<strong>und</strong> der Deutschen Landjugend<br />
Geschäftsführung<br />
Dipl.-Soz.Arb. Matthias Sammet<br />
Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Dipl.-Medienwissenschaftlerin<br />
Susanne Schübel<br />
Jugend- <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik<br />
Dipl.-Soz.Päd. Daniela Ruhe<br />
Agrarpolitik<br />
Dipl.-Ing. agr. Nannette Pankow<br />
Dipl.-Ing. agr. Katja Zippel<br />
Deutsch-Französisches Jugendwerk<br />
Dipl.-Päd. Timm Uekermann<br />
Abrechnung/Verwaltung<br />
Daniela Junius<br />
Schweinefleisch<br />
Vorsitzender: Präsident F. J. Möllers<br />
Geschäftsführer: Dr. M. Starp<br />
Rindfleisch<br />
Vorsitzender: Präsident F. Schneider<br />
Geschäftsführer: Dr. M. Starp<br />
Milch<br />
Vorsitzender: Präsident U. Folgart<br />
Geschäftsführer: Dr. R. Schmidt<br />
Stand: Juni <strong>2009</strong><br />
Fachbereich 3<br />
Dipl.-Volkswirt Udo Hemmerling<br />
3.1 Wirtschafts- <strong>und</strong> Energiepolitik<br />
Dipl.-Volksw. Udo Hemmerling<br />
3.2 Sozialpolitik/Landwirtschaftliche<br />
Arbeitgeber (GLFA)<br />
Dipl.-Ing. agr. Burkhard Möller<br />
Dipl.-Ing. agr. Anke Friedrich<br />
3.3 Agrarrecht<br />
RA Dr. Wolfgang Krüger<br />
3.4 Steuerrecht/Justitiariat<br />
RA Simon Jäckel<br />
3.5 Lebensmittelrecht/<br />
Verbraucherschutz<br />
RAin Petra Nüssle<br />
3.6 Umwelt- <strong>und</strong> Wettbewerbsrecht/<br />
Jagdgenossenschaften<br />
RAin Inken Lampe<br />
Umweltschutz<br />
Vorsitzender: Präsident F. Decker<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. agr. S. Pingen<br />
Nachwachsende Rohstoffe<br />
Vorsitzender: Präsident R. Tietböhl<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Volkswirt<br />
U. Hemmerling<br />
Sozialpolitik<br />
Vorsitzender: Präsident L. Blum<br />
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. agr. B. Möller
Deutscher Bauernverband e.V. Juni <strong>2009</strong><br />
Geschäftsstelle Berlin<br />
Claire-Waldoff-Straße 7<br />
10117 Berlin<br />
Telefon: 0 30 - 3 19 04-0<br />
Telefax: 0 30 - 3 19 04-205<br />
Büro Brüssel<br />
Rue de Luxembourg 47-51<br />
1050 Brüssel/Belgien<br />
Telefon: 0 03 22 - 28 540-54<br />
Telefax: 0 03 22 - 28 540-59<br />
Büro Bonn<br />
In der Wehrhecke 1c<br />
53125 Bonn<br />
Telefon: 02 28 - 92 657-0<br />
Telefax: 02 28 - 92 657-15<br />
E-Mail<br />
presse@bauernverband.net<br />
Internet<br />
www.bauernverband.de