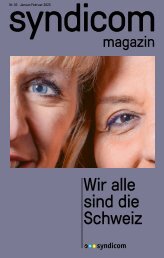syndicom magazin Nr. 3 - Im Netz gefangen
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>syndicom</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 3 Jan.–Feb. 2018<br />
<strong>magazin</strong><br />
<strong>Im</strong> <strong>Netz</strong><br />
<strong>gefangen</strong><br />
Unser Radio und<br />
TV zerschlagen?<br />
No Billag: NEIN!
Anzeige<br />
Bis zu<br />
10 %<br />
Prämien<br />
sparen<br />
Eine einfache Online-Krankenkasse und persönliche Beratung?<br />
Als Mitglied von <strong>syndicom</strong> bekommen Sie beides<br />
und erst noch günstiger. Jetzt mit nur ein paar Klicks wechseln:<br />
kpt.ch/<strong>syndicom</strong>
Inhalt<br />
4 Teamporträt<br />
5 Kurz und bündig<br />
6 Die andere Seite<br />
7 Gastautor<br />
8 Dossier: <strong>Netz</strong>e<br />
15 No zu No Billag<br />
18 Arbeitswelt<br />
24 Digitalisierung<br />
28 Recht so!<br />
29 1000 Worte<br />
30 Freizeit<br />
32 Bisch im Bild<br />
34 Aus dem Leben von ...<br />
35 Kreuzworträtsel<br />
36 Inter-aktiv<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
<strong>Im</strong> England des 19. Jahrhunderts schlossen sich<br />
die Arbeitenden während der (ersten) industriellen<br />
Revolution zusammen und bildeten ein<br />
Solidaritätsnetzwerk. So brachten die Trade<br />
Unions, also die Gewerkschaften, die Menschen<br />
zusammen. Und das lange vor Facebook. <strong>Im</strong><br />
Grunde haben wir, die Gewerkschaften, die sozialen<br />
<strong>Netz</strong>werke (neu) erfunden.<br />
Menschen haben sich von jeher vernetzt. Die<br />
Zeiten und die technischen Mittel ändern sich,<br />
aber der Zweck bleibt derselbe. Das Internet ist<br />
viel mehr als nur Kommunikation. Es verbindet,<br />
schafft Beziehung. Logisch, will <strong>syndicom</strong>, die<br />
Gewerkschaft der Vernetzung, auch in der vierten<br />
industriellen Revolution eine gestaltende<br />
Rolle spielen.<br />
<strong>syndicom</strong> nutzt das <strong>Netz</strong> mit my.<strong>syndicom</strong>.<br />
Doch wir wollen auch Werkzeuge zum Nachdenken<br />
schaffen, wie das kritische Dossier in<br />
diesem Heft über <strong>Netz</strong>e.<br />
Der Schriftsteller William Gibson sagte sinngemäss:<br />
Information ist kein kalter Fluss aus<br />
Einsen und Nullen, sondern ein lebendiges<br />
Wesen. Das <strong>Netz</strong> an sich ist nur ein Kommunikationsmittel.<br />
Was zählt, ist die Information. Das<br />
gilt auch für die Information des öffentlichen<br />
Rundfunks, des lebendigen Wesens, das unsere<br />
Demokratie nährt und durch No Billag vom Tode<br />
bedroht ist. Erinnern wir uns am kommenden<br />
4. März daran.<br />
4<br />
8<br />
23<br />
Giovanni Valerio
4<br />
Teamporträt<br />
PeKo Delémont-Porrentruy PostAuto Jura<br />
Jean-Jacques Roth (59)<br />
PeKo-Präsident. Arbeitete zuerst als<br />
Maurer und Lastwagenfahrer auf dem<br />
Bau. 1994 zu PostAuto. Ab 1996 in der<br />
PeKo. Lange Jahre Vize und zwei Jahre<br />
Präsident der Sektion Jura (gesamter<br />
Jura-Bogen).<br />
Raphaël Marquis (43)<br />
Seit der Lehre bei der Post und<br />
gewerkschaftlich organisiert. Fährt ab<br />
2001 für PostAuto. Eintritt in die PeKo<br />
2007, bis 2011. Seit 2017 erneut in der<br />
PeKo, er amtet als ihr Sekretär.<br />
Nelson Vaz (39)<br />
Fuhr zuerst Car im Familienunternehmen.<br />
Seit 2008 bei PostAuto und in der<br />
PeKo. Regionaldelegierter PeKo Region<br />
West. Mitglied Zentralvorstand<br />
<strong>syndicom</strong>.<br />
Zudem aktiv in der PeKo:<br />
Yves Thalmard (Vizepräsident) und<br />
Sébastien Jolliat (Kassier)<br />
Text: Sheila Winkler<br />
Bild: Thierry Porchet<br />
Teamgeist und die<br />
kollektive Solidarität<br />
sind der Treibstoff<br />
unseres Engagements.<br />
«Bei unseren Dienstplänen ist es gar<br />
nicht so leicht, die PeKo zu organisieren,<br />
denn wir fahren alle verschiedene<br />
Dienste. Kurze und lange<br />
Dienste. Früh-, mittel-, Spätdienste.<br />
Mit unterschiedlichen Pausen.<br />
Deshalb haben wir uns in einer<br />
WhatsApp-Gruppe organisiert. So ist<br />
jeder immer auf dem Laufenden, da<br />
wir uns nur alle zwei Monate zu einer<br />
Sitzung treffen können.<br />
Dass dieser permanente Austausch<br />
tatsächlich klappt, liegt an<br />
der Transparenz, die wir pflegen. Wir<br />
vertrauen uns. Wir legen Wert auf<br />
echte Demokratie. Jeder Entscheid<br />
wird gemeinsam getroffen.<br />
Mindestens einmal pro Jahr<br />
informieren wir, zusammen mit der<br />
Gewerkschaft, das Personal über<br />
unsere Fortschritte in den Verhandlungen<br />
mit der Direktion und<br />
nehmen die Vorschläge der Kolleginnen<br />
und Kollegen auf. Bei PostAuto<br />
hat eine PeKo besondere Aufgaben<br />
und eine hohe Verantwortung. Wir<br />
reden aktiv bei der Gestaltung der<br />
Dienstpläne mit. Denn von den<br />
Dienstplänen hängen unsere<br />
Gesundheit und die Sicherheit der<br />
Passagiere ab. Fast immer geht es<br />
dabei um Minuten. Etwa darum, wie<br />
viele Minuten wir für den Sicherheitscheck<br />
des Fahrzeugs haben. Oder<br />
für das Hochfahren des Bordsystems.<br />
Oder ob die Pausen garantiert sind.<br />
Das Gesetz verpflichtet den<br />
Arbeitgeber, das Personal anzuhören,<br />
bevor die Dienstpläne definitiv<br />
festgelegt werden. Die Ausweitung<br />
der gesetzlichen Bestimmungen soll<br />
in einer Vereinbarung festgehalten<br />
werden. Wir nehmen es sehr genau<br />
damit. Unsere PeKo besteht darauf,<br />
diese Dinge zu verhandeln. So haben<br />
wir der Direktion gerade wieder<br />
Zeitzuschläge und eine bessere<br />
Pausenregelung abgerungen.<br />
Möglich machen dies die enge<br />
Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft<br />
und unser Teamgeist. Die<br />
kollektive Solidarität ist der Treibstoff<br />
unseres Engagements.<br />
Wir erwarten von der Direktion,<br />
dass sie unseren Einsatz für PostAuto<br />
besser anerkennt. Grundvoraussetzung<br />
für Effizienz, Sicherheit und<br />
Qualität dieses öffentlichen Dienstes<br />
ist am Ende die Zufriedenheit des<br />
Fahrpersonals.»
Kurz und<br />
bündig<br />
Ringier schliesst Druckerei in Adligenswil \ Poststellenkampagne<br />
zeigt Wirkung \ Arbeitsrecht digital \ Kurse PeKos PostAuto \<br />
GAV-Jahr 2018 \ Mitgliederbeiträge von Steuern abziehen<br />
5<br />
Ringier vernichtet 172<br />
Arbeitsplätze in Druckerei<br />
Arbeitsrecht ist fit für<br />
Digitalisierung<br />
Agenda<br />
Der Kahlschlag in der Druckbranche geht<br />
weiter: Ringier schliesst die Zeitungsdruckerei<br />
in Adligenswil auf Ende Jahr.<br />
Der Konzern ignoriert dabei eine ganze<br />
Reihe von Vorschlägen, welche die<br />
Personalkommission und die Gewerkschaften<br />
<strong>syndicom</strong> und syna während<br />
der Konsultationsfrist erarbeitet hatten,<br />
um Arbeitsplätze in der traditionsreichen<br />
Druckerei zu retten. An mehreren<br />
Personalversammlungen wurden die<br />
Massnahmen diskutiert und am 15. Dezember<br />
schliesslich der Geschäftsleitung<br />
übergeben. Doch Ringier zeigte<br />
keinerlei Interesse. Offensichtlich war<br />
auch dieses Konsultationsverfahren nur<br />
eine triste Farce. Rentabilität geht<br />
wieder einmal über alles. Jetzt kämpfen<br />
Gewerkschaften und Belegschaft weiter:<br />
Ringier muss nun ein weitreichender<br />
Sozialplan abgerungen werden.<br />
Die Poststellenkampagne<br />
zeigt Wirkung<br />
Der Bundesrat muss über die Bücher<br />
und seine Kriterien zu den Poststellen -<br />
schliessungen überdenken. Das haben<br />
ihm die National- und Ständeräte in der<br />
Wintersession auferlegt. Der Rückzug<br />
der Post aus der Fläche ist erst einmal<br />
gebremst, die Poststellenkampagne der<br />
<strong>syndicom</strong> zeigt erste Wirkung. Die<br />
Haltung des Ständerates: Randregionen<br />
sollen nicht für ein bisschen mehr<br />
Gewinn bei der Post geopfert werden.<br />
Mit teilweise giftigen Kommentaren<br />
versuchten Leute wie Ruedi Noser, FDP,<br />
die Sache noch gegen den Service<br />
public zu wenden. Vergebens. Über den<br />
Service public richtet nicht der Markt<br />
und nicht die Technik, sondern der<br />
poli tische Wille. <strong>syndicom</strong>.ch/themen/<br />
kampagnen/poststellenkahlschlag/<br />
Bürgerliche möchten das Arbeitsrecht<br />
lockern unter dem Vorwand, die<br />
Digitalisierung mache das nötig. Jetzt<br />
zeigte eine juristische Spitzentagung<br />
des SGB: Unsinn. Das Arbeitsrecht ist<br />
im Prinzip fit für die Digitalisierung. Es<br />
braucht aber einige wichtige Verbesserungen,<br />
also das Gegenteil einer<br />
Lockerung: für die Bekämpfung von<br />
digitaler Schwarzarbeit, für den<br />
Gesundheitsschutz und die Regulierung<br />
des Home-Office.<br />
Schulung PeKos PostAuto<br />
Damit PeKos ihre Rechte besser<br />
wahrnehmen können, bietet die<br />
<strong>syndicom</strong> Kurse zum Arbeitszeitgesetz<br />
an. In Neuchâtel am 12. April, in Bern<br />
am 19. April, in Olten am 23. August und<br />
in Zürich am 30. August. Zudem<br />
beginnt die Schulung zu Rechten und<br />
Pflichten der PeKo-Mitglieder. Mehr<br />
Infos bei: sheila.winkler@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
2018, Jahr wichtiger GAV<br />
Der neue Swisscom-GAV ist gerade<br />
unter Dach und Fach, die Verhandlungen<br />
für den Presse-GAV haben endlich<br />
begonnen und bald rüsten wir uns für<br />
den GAV Druck. Um mehr über alle<br />
Gesamtarbeitsverträge zu wissen, das<br />
wichtigste Tool: GAV-Service.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/recht/gavtool/<br />
Mitgliederbeitrag von den<br />
Steuern absetzen<br />
Mitglieder in den Kantonen Genf, Jura,<br />
Aargau, Zürich, Baselland und Baselstadt<br />
sowie GrenzgängerInnen mit<br />
Wohnsitz in Frankreich können ihren<br />
Mitgliederbeitrag unter Umständen von<br />
den Steuern abziehen. Dazu braucht es<br />
eine Steuerbescheinigung. Wer bei my.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch angemeldet ist, druckt<br />
sich die Steuerbescheinigung bequem<br />
zu Hause aus. Wer sich auf<br />
my.<strong>syndicom</strong> noch nicht registriert<br />
hat, kann die Steuerbescheinigung<br />
unter info@<strong>syndicom</strong>.ch oder telefonisch<br />
unter 058 817 18 18 bestellen<br />
(Donnerstags jetzt auch bis 18 Uhr 30).<br />
Februar<br />
1.<br />
Podium Steueroase Schweiz<br />
Hochkarätig besetztes Streitgespräch,<br />
organisiert vom Arbeiterhilfswerk<br />
(solidar) im Volkshaus Zürich, 19 Uhr<br />
Anmeldung: goo.gl/CRqR4X<br />
6./8./13.<br />
Buchtreffs<br />
Am 6. in Bern, am 8. in Zürich und am<br />
13. in Basel beginnen die regelmässigen<br />
Treffen der Buchhändlerinnen und<br />
Buchhändler. Jeweils ab 19 Uhr. Bern,<br />
Restaurant National. Zürich, Restaurant<br />
Cooperativo. Basel Restaurant<br />
Pinar.<br />
28.<br />
70. Jahresversammlung der<br />
Pensionierten<br />
Anmeldefrist: 12.2.2018<br />
Basel, Restaurant L'Esprit (bei<br />
Heiliggeistkirche). 12 Uhr bis ca. 17 Uhr<br />
März<br />
4.<br />
Abstimmung No Billag<br />
Damit wir uns nicht nachträglich<br />
ärgern müssen.<br />
10.<br />
Tag der Freien 2018<br />
Hat Journalismus eine freie Zukunft?<br />
Müssen Fotografen und Journalisten<br />
ihre Arbeit künftig über Crowdfunding<br />
oder eigene Online-Abonnenten<br />
finanzieren? Und wie steht es um die<br />
neuen Medienprojekte?<br />
Kulturhaus Helferei, Zürich 13:15-17:15<br />
Für <strong>syndicom</strong>-Mitglieder 50 Franken,<br />
für alle anderen 100 Franken.<br />
Mehr und Anmeldung: goo.gl/aesuL3<br />
Vorschau<br />
9. Juni<br />
A.o. Kongress <strong>syndicom</strong><br />
In Bern.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/agenda
6 Die andere<br />
Hans C. Werner<br />
Seite<br />
ist seit 2011 Leiter der Human Resources bei Swisscom<br />
und Mitglied der Konzernleitung. Er hat in Betriebswirtschaft<br />
doktoriert und arbeitete früher als Rektor einer<br />
Kantonsschule, danach bei Swiss Re und bei Schindler.<br />
1<br />
Worin sehen Sie die Vorteile eines<br />
Gesamtarbeitsvertrags?<br />
Rund 13 000 Swisscom-Mitarbeitende<br />
sind dem GAV unterstellt. Er ist seit<br />
2000 stetig weiterentwickelt worden –<br />
im Dialog mit den Sozialpartnern.<br />
Bei gewissen Themen hat Swisscom<br />
eine Vorreiterrolle wahrgenommen.<br />
Ein GAV stellt eine gegenseitige<br />
Verpflichtung dar, die über die<br />
gesetzlichen Regelungen hinausgeht.<br />
Er trägt den Besonderheiten des<br />
Unternehmens und der Branche<br />
Rechnung, drückt Verbindlichkeit<br />
aus und schützt die Mitarbeitenden.<br />
2<br />
Und wo liegen die Nachteile solcher<br />
Kollektivvereinbarungen?<br />
Wenn ein Unternehmen aufgrund der<br />
Entwicklungen auf dem Markt rasch<br />
reagieren muss, aber aufgrund des<br />
GAV nicht die nötige Flexibilität hat.<br />
Oder, wenn sich Konzerngesellschaften<br />
in unterschiedlichen Märkten<br />
bewegen, aber für alle der gleiche<br />
GAV gilt. Ich schätze unsere Sozialpartnerschaft<br />
sehr, sie ist pragmatisch<br />
und lösungsorientiert. Nur so<br />
können wir in unserer schnelllebigen<br />
Branche gemeinsam die Zukunft<br />
gestalten.<br />
3<br />
Wie einigen Sie sich im Konfliktfall<br />
mit ihren Mitarbeitenden?<br />
Swisscom hat eine offene Feedbackkultur,<br />
da bleiben Konflikte nicht<br />
aus. Grundsätzlich suchen wir im<br />
Gespräch nach einer einvernehmlichen<br />
Lösung. Wir sind überzeugt,<br />
dass regelmässige Rückmeldung<br />
Konflikten vorbeugen kann. Das<br />
fördern wir mit unseren Beitrags- und<br />
Zielerreichungsgesprächen, dem<br />
360°-Feedback und unserer Mitarbeiterumfrage,<br />
bei der die Antworten der<br />
Mitarbeitenden in Echtzeit für alle<br />
sichtbar sind.<br />
4<br />
Was sind die Aufgaben der Personalvertretung<br />
in Ihrem Konzern?<br />
Die Personalvertretungen sind<br />
Gesprächspartner für wichtige<br />
operative Themen, die Auswirkungen<br />
auf die Mitarbeitenden haben. Bei<br />
Entscheiden dazu wirken sie mit. Die<br />
Mitwirkung reicht von einem Anspruch<br />
auf frühzeitige und umfassende<br />
Orientierung über Anhörung und<br />
Einbringen von Vorschlägen und<br />
Stellungnahmen und paritätischen<br />
Entscheiden bis hin zur eigenverantwortlichen<br />
Selbstverwaltung. Sie ist<br />
ein wichtiger Brückenbauer in<br />
unserer Organisation.<br />
5<br />
Wie bewerten Sie das Lohnniveau in<br />
Ihrer Branche? Liegt Ihre Firma eher<br />
höher oder eher tiefer?<br />
Grundsätzlich zahlt Swisscom faire<br />
und marktgerechte Löhne, die im<br />
Durchschnitt liegen sollten. Andernfalls<br />
würden wir etwas falsch<br />
machen: Zahlen wir überdurchschnittlich,<br />
schränken wir die<br />
Arbeitsmarktfähigkeit unserer<br />
Mitarbeitenden ein – wir würden<br />
ihnen gewissermassen «goldene<br />
Fesseln» anlegen. Zahlen wir zu<br />
niedrige Löhne, können wir nicht<br />
die Fachkräfte einstellen, die wir<br />
gewinnen müssen.<br />
6<br />
Wie hoch ist der Frauenanteil in Ihrer<br />
Firma?<br />
Der Anteil Frauen bei Swisscom in<br />
der Schweiz liegt per Ende 2016 bei<br />
26,8 Prozent. Dies ist ein Durchschnittswert.<br />
Wir haben sehr technisch<br />
orientierte Bereiche, bei denen<br />
wir trotz verschiedener Anstrengungen<br />
leider nach wie vor einen tiefen<br />
Frauenanteil haben. Auf der anderen<br />
Seite haben wir auch Einheiten wie<br />
etwa die Kommunikation, in denen<br />
der Frauenanteil auf marktüblich<br />
höherem Niveau liegt.<br />
Text: Sina Bühler<br />
Bild: Swisscom
Gastautor<br />
Hätte mich vor dreissig Jahren<br />
jemand gefragt, was ich mit dem Wort «<strong>Netz</strong>»<br />
verbinde, hätte ich wohl von Fischernetzen oder<br />
Spinnennetzen geredet. Dass ein Begriff wie<br />
Networking irgendwann zum selbstverständlichen<br />
deutschen Sprachschatz gehört, ahnte ich<br />
nicht. Inzwischen ist der Begriff «<strong>Netz</strong>» oder<br />
«Net» übernutzt. Alles scheint ein <strong>Netz</strong> oder Teil<br />
eines <strong>Netz</strong>es zu sein. Jeder, der mehr als einen<br />
Freund oder eine Freundin kennt, sieht sich als<br />
Zentrum eines <strong>Netz</strong>werks. Frage ich meine<br />
Bekannten, was sie gerade tun, antworten sie,<br />
sie seien am networken. Wer nicht von morgens<br />
bis abends Networking betreibt, verpasst den<br />
Tag. Das Austauschen von Visitenkarten wird zur<br />
Hauptaufgabe jeder Stehparty. Und weil jedes<br />
<strong>Netz</strong> wiederum mit anderen <strong>Netz</strong>en verknüpft<br />
wird, ist bald die ganze Menschheit vernetzt,<br />
was freilich die Bedeutung der Vernetzung wieder<br />
relativiert. Da ich als freier Autor nichts<br />
Konkretes zu verkaufen habe, besitze ich keine<br />
Visitenkarten. Stehe ich dann an einer Buchmesse<br />
oder sonst einem Grossanlass in einer<br />
Menge herum, in der alle Anwesenden untereinander<br />
Visitenkarten austauschen, gebe ich<br />
jeweils die Karten weiter, die ich zuvor erhalten<br />
habe, so dass kartenmässig alles im Flow bleibt.<br />
Das ist eine empfehlenswerte Partybeschäftigung,<br />
weil einem die Menschen dann zum<br />
Abschied alle möglichen Namen geben. Ausserdem<br />
hat man am andern Morgen nicht alle<br />
Taschen voller Visitenkarten, von denen man<br />
nicht mehr weiss, wer sie einem zugesteckt hat.<br />
<strong>Netz</strong>e und <strong>Netz</strong>werke sind allgegenwärtig.<br />
Trotzdem sollten wir ihre Bedeutung nicht überschätzen.<br />
Das Wort <strong>Netz</strong> suggeriert, alle Knoten<br />
eines <strong>Netz</strong>es seien gleich wichtig. Doch alle<br />
Vernetzung und alles Networking ändert nichts<br />
daran, dass es letztlich die Hierarchien sind, die<br />
darüber entscheiden, wer das Wort führt. Networken<br />
mag wichtig sein. Noch wichtiger ist es,<br />
von Fall zu Fall zu unterscheiden zwischen tragenden<br />
<strong>Netz</strong>en und <strong>Netz</strong>en, die uns einfangen.<br />
Damit alles<br />
im Flow bleibt<br />
Pedro Lenz lebt als freier Autor und<br />
Geschichtenerzähler in Olten. Er<br />
schreibt und performt meistens in<br />
Mundart. Gelernter Maurer, später<br />
Matur. Zahlreiche Buch- und CD-Veröffentlichungen,<br />
etliche Preise. Sein<br />
Bestsellerroman «Der Goalie bin ig»<br />
wurde bisher in neun Sprachen übersetzt<br />
und diente als Filmvorlage.<br />
Präsident des Komitees Nein zum<br />
Sendeschluss (gegen No Billag). Derzeit<br />
in Babypause. Mehr auf pedrolenz.ch<br />
7
Menschen machen <strong>Netz</strong>e. Was machen die <strong>Netz</strong>e mit uns?<br />
Wer das Kabel hat, steuert die Welt. Der Kampf um die Kontrolle<br />
Das Web ist tot. Was kommt nun?<br />
Demokratie braucht unabhängige Medien. Nein zu No Billag<br />
Dossier 9<br />
Gefangen<br />
im<br />
<strong>Netz</strong>
10 Dossier<br />
Von Menschen und <strong>Netz</strong>en.<br />
Wer die Kabel hat, steuert die Welt<br />
Wir sind im <strong>Netz</strong>. In vielen <strong>Netz</strong>en. Drei<br />
Milliarden Menschen zappeln schon in den<br />
Fängen von Facebook. Wir machen die <strong>Netz</strong>e.<br />
Doch was machen die <strong>Netz</strong>e mit uns?<br />
Text: Oliver Fahrni<br />
Bilder: Peter Mosimann<br />
Tatoos stechen und Drogen organisieren sind gesuchte<br />
Kompetenzen im Gefängnisleben. Neuerdings stehen<br />
dort aber andere Fachleute hoch im Kurs: IT-Freaks.<br />
Klammheimlich haben Häftlinge in der amerikanischen<br />
Kleinstadt Marion (Ohio) zwei Computer gebaut.<br />
Darüber verbanden sie sich mit dem <strong>Netz</strong> der Strafanstalt,<br />
hackten sich in die Gefängnisdatenbank und ins Internet,<br />
schauten Pornos, verschickten Mails und bauten<br />
einen regen Handel mit der Welt da draussen auf.<br />
Die Sache wurde über die automatisierte Mail einer<br />
Sicherheitssoftware ruchbar: Die Knastis hatten das<br />
erlaubte Internetvolumen des Gefängnissystems überschritten.<br />
Schliesslich fanden Wärter die Computer, die<br />
auf Sperrholzplatten montiert waren, unter der Decke<br />
eines Büros.<br />
Was der Untersuchungsbericht der Behörden im April<br />
2017 enthüllte, ist eine hübsche Parabel auf unsere Zeit.<br />
Sie erzählt von Menschen und <strong>Netz</strong>en, von Einschliessung<br />
und unbegrenztem Internet, aber auch von elektronischer<br />
Kontrolle, Datenspur und inneren Grenzen: Die<br />
Computer und das Internet wurden nicht für die Organisation<br />
eines Ausbruchs genutzt.<br />
3 Milliarden Facebook-Nutzer<br />
Menschen haben sich schon immer vernetzt, in<br />
Gemeinschaften, Bruderschaften und Organisationen<br />
aller Art, aber auch in weltumspannenden komplexen<br />
Handelsnetzen, Jahrtausende bevor 1958 das erste Modem<br />
in Betrieb ging. Lange vor Blogger (1999), MySpace<br />
und LinkedIn (2003), Facebook (2004), Youtube (2005),<br />
Twitter (2006), Whatsapp (2009), Instagram (2010) etc.<br />
Doch die Erfindung des Internets, das aus dem Arpanet<br />
des Pentagons hervorging, und seine Popularisierung<br />
durch das World Wide Web www (von Tim Berners-Lee um<br />
das Jahr 1989 am CERN in Genf entworfen) haben einen<br />
Prozess in Gang gesetzt, der die Grundlagen unserer Zivilisation<br />
erschüttert. Wohin uns die Wucht dieses Prozesses<br />
führt, wird man erst in einigen Jahrzehnten vermessen<br />
können.<br />
Was wir wissen: Die Welt zwitschert und summt. 2017<br />
nutzten monatlich 3 Milliarden Menschen Facebook.<br />
Täglich werden 269 Milliarden E-Mails abgeschossen.<br />
Über Whatsapp (2014 von Facebook gekauft) kommunizieren<br />
1,2 Milliarden Menschen. In Spitzenzeiten werden<br />
15 ooo Tweets pro Sekunde verschickt, und die Rockröhre<br />
Katy Perry hat 83 Millionen Twitter-Follower. Interessant,<br />
wenn man bedenkt, dass das menschliche Gehirn auf<br />
maximal 150 Kontakte ausgelegt ist, wie der britische<br />
Psychologe Robert Dunbar herausgefunden hat.<br />
Vor ein paar Jahren überschrieb der TV-Sender Arte<br />
eine Dokumentation über die digital natives, die Generation,<br />
die in den Social Media gross geworden ist, mit dem<br />
Titel: «Google zeigt mich, also bin ich.» Stimmt das? Sind<br />
wir 2018 erst wer, wenn wir im <strong>Netz</strong> sichtbar sind? Beim<br />
französischen Philosophen René Descartes hiess der Satz<br />
noch: Ich denke, also bin ich. Heute aber, so scheint es,<br />
wird man erst zur ganzen Person, zum vollen Subjekt,<br />
wenn man auf Facebook immer wieder die Standardfrage<br />
beantwortet: «Was machst Du gerade?» Und für seine Antworten<br />
wie «Vor der ersten Zigarette ein grosses Glas<br />
Orangensaft geschlürft» (samt Handy-Foto vom Frühstückstisch)<br />
gelikt wird. Je mehr man von sich preisgibt,<br />
und sei es noch so banal, desto mehr Likes bekommt man,<br />
desto sichtbarer ist man, desto stärker vernetzt ist man.<br />
Vernetzt? Wir ahnen: Das kann noch nicht alles<br />
gewesen sein. Höchste Zeit, dass wir uns als Mitglieder<br />
der <strong>Netz</strong>werk-Gewerkschaft <strong>syndicom</strong> etwas intensiver<br />
mit dem Thema <strong>Netz</strong>e beschäftigen.<br />
<strong>Netz</strong>werkgewerkschaft sind wir gleich doppelt. Wir<br />
arbeiten in Berufen, die <strong>Netz</strong>werke aller Art, vom Poststellennetz<br />
und anderen Logistiknetzen über Medien bis zu<br />
ICT-<strong>Netz</strong>en, bauen, betreiben, unterhalten. Und wir selbst<br />
haben uns in einer Gewerkschaft vernetzt.<br />
<strong>Netz</strong>e sind materiell – Verbindung zwischen Dingen<br />
Dies allein macht schon deutlich, wie sehr der Mensch<br />
<strong>Netz</strong>e braucht. <strong>Netz</strong>e fangen, verbinden, halten. Sie sind<br />
Werkzeug (Sieb, Fischernetz), vor allem aber die notwendige<br />
Organisationsform der Gesellschaft. Austausch und<br />
Handel brauchen <strong>Netz</strong>e. Ohne <strong>Netz</strong>e existiert keine<br />
Grundversorgung mit Strom, Wasser, Gas, Öl, Fernwärme<br />
etc. <strong>Netz</strong>e sorgen für Gesundheit, etwa durch die Abwasserkanalisation.<br />
Strassen- und Bahnnetze erhöhen die<br />
Reichweite, lassen uns in weiten Räumen schnell herumkommen.<br />
<strong>Netz</strong>e schaffen Sicherheit. Bei Blackouts wie<br />
1977 in New York bricht die öffentliche Ordnung rasch<br />
weg. Damals wurden 1600 Geschäfte geplündert und 1000<br />
Brände gelegt.<br />
Die materielle Seite der <strong>Netz</strong>e, mit der wir diese<br />
Titelgeschichte bebildern, wird oft unterschätzt. Hunderte<br />
Millionen Kilometer Leitungen, Schienen, Strassen,<br />
Google zeigt<br />
mich. Also bin<br />
ich. Das kann<br />
wohl noch<br />
nicht alles<br />
gewesen sein.
Rohre, Kanäle überziehen den Planeten, Myriaden von<br />
Leit-, Stell-, Kontroll-, Schleus- und Verstärkerwerken<br />
garantieren den Fluss der Dinge. Wer zur See fährt, kennt<br />
die beeindruckenden Karten mit den dicken Strängen von<br />
Seekabeln. Google liess gerade mehr als 9000 Kilometer<br />
Glasfaser zwischen den USA und Japan auf dem Seegrund<br />
verlegen, mit einer Kapazität von 60 Billionen Bytes pro<br />
Sekunde.<br />
Dass die Welt brummt, das baut auf dieses gigantische<br />
technische Werk, die lokalen, regionalen und globalen<br />
<strong>Netz</strong>werke.<br />
Doch <strong>Netz</strong>e tun weit mehr für uns – und sie stellen<br />
einiges mit uns an. Das ist ihre immaterielle Seite.<br />
Über Knoten, Maschen und die Löcher dazwischen<br />
Wenn wir Dinge verknüpfen, ordnen wir sie. In diesen<br />
<strong>Netz</strong>en, sogar im banalsten Stromnetz, fliessen Informationen.<br />
So wie wir die <strong>Netz</strong>e anlegen, ordnen wir Wissen,<br />
Zeichen und die Vorstellung von der Welt.<br />
Historiker und Sozialwissenschaftler erkennen in<br />
<strong>Netz</strong>en «Kulturtechniken». Denn die <strong>Netz</strong>e wirken auf den<br />
Menschen zurück, nicht erst mit dem Zwang, sich auf<br />
Facebook durch regelmässige Entblössung sichtbar zu<br />
machen. Der Plan des Metronetzes von Paris zum Beispiel<br />
bestimmt meine Vorstellung von einem städtischen<br />
Raum. Selbst Städte ohne U-Bahn wie Zürich oder Genf<br />
organisiere ich vor meinem inneren Auge nicht über<br />
Strassen, sondern über virtuelle Metrostationen. HB–<br />
Volkshaus–Escher Wyss. Darin ein<strong>gefangen</strong>: Die Kreise 4<br />
und 5, wo das Leben tobt. In Genf: Grottes–Place de Neuve,<br />
links die Uni–Plainpalais.<br />
Das sind die Knoten, die mit anderen Knoten eine<br />
Masche bilden, in der ein Raum umschlossen wird (die<br />
Löcher dazwischen). Eine Masche, die wiederum mit<br />
anderen Maschen zu einem <strong>Netz</strong> verknüpft ist. Wie in<br />
einem Fischernetz.<br />
Versuchen Stadtpolitiker, brennende Vorstädte zu<br />
befrieden, bauen sie zuerst nicht bessere Schulen sondern<br />
eine U-Bahn- oder Tramlinie dahin. Sie fangen den<br />
Raum ein.<br />
<strong>Netz</strong>e strukturieren unser Weltbild, auch komplexere<br />
Zusammenhänge als unsere simple Vorstellung von einer<br />
Stadt. Der 2016 verstorbene italienische Wissenschafter<br />
und Autor Umberto Eco («Der Name der Rose»), 40 Ehrendoktortitel,<br />
hat <strong>Netz</strong>e so definiert: «Das charakteristische<br />
Merkmal eines <strong>Netz</strong>es ist, dass jeder Punkt mit jedem<br />
anderen Punkt verbunden werden kann, und wo die<br />
Verbindungen noch nicht entworfen sind, können sie<br />
trotzdem vorgestellt werden. Ein <strong>Netz</strong> ist ein unbegrenztes<br />
Territorium.»<br />
Die Vernetzung als Befreiung<br />
Eco sagte das 1989. Damals betrieben Menschen erst klassische<br />
soziale <strong>Netz</strong>werke, die per Telefon, Brief, Fax und<br />
vor allem über Begegnung funktionierten. Es brauchte<br />
einige Anstrengung, die Punkte miteinander zu verknüpfen<br />
und in der Regel setzten diese <strong>Netz</strong>werke die<br />
Bekanntschaft mit den anderen Punkten voraus. Die<br />
Vorstellung von einer Infrastruktur oder einer Kommunikationsstruktur<br />
wurden noch weniger mit einem <strong>Netz</strong> als<br />
mit dem Bild eines Baumes und dessen Verästelungen<br />
verbunden. <strong>Netz</strong>e aber sind nicht linear.
12<br />
Dossier<br />
Eco knüpfte mit seiner neuen Vision von einem<br />
grenzenlosen Territorium an Konzepte an, die schon seit<br />
zwei Jahrhunderten schwelten und immer mächtiger wurden.<br />
<strong>Im</strong> revolutionären Frankreich des 18. Jahrhunderts<br />
begannen Denker, getrieben von neuen Erkenntnissen<br />
über die Natur, die Welt als <strong>Netz</strong> zu verstehen. Das prägte<br />
die Bauweise von Kanalisation, Telegrafen und Eisenbahn.<br />
Der Frühsozialist Saint-Simon ging noch einen<br />
Schritt weiter: Er entwarf das erste Programm zur<br />
globalen Vernetzung. Sie sollte eine gerechtere Welt<br />
hervorbringen.<br />
Anders als bei den alten Ägyptern, wo das <strong>Netz</strong> den<br />
Göttern dazu diente, Feinde einzufangen, steht das <strong>Netz</strong><br />
in der Neuzeit für die Schaffung von Verbindungen. Also<br />
für Entgrenzung, freien Austausch, Grenzenlosigkeit.<br />
Und doch sind wir im <strong>Netz</strong> <strong>gefangen</strong><br />
25 Jahre nachdem er das <strong>Netz</strong> als grenzenlos beschrieben<br />
hatte, wollte Eco das Internet «von Schwachsinn<br />
befreien». Und 230 Jahre nach Saint-Simons Utopie vom<br />
glücksbringenden weltweiten <strong>Netz</strong> ist die Welt zwar<br />
vernetzt, aber kaum gerechter geworden.<br />
Wir sind in der realen <strong>Netz</strong>welt angekommen. Jetzt<br />
wird an Universitäten <strong>Netz</strong>ökonomie gelehrt. <strong>Netz</strong>werkwissen<br />
und <strong>Netz</strong>werktechniken entscheiden, so behaupten<br />
Ökonomen, über Erfolg oder Misserfolg. Die Welt sehen<br />
wir nun als ein <strong>Netz</strong>werk von vielen <strong>Netz</strong>en. Selbst<br />
Jassclubs finden sich in <strong>Netz</strong>werken. <strong>Netz</strong>werkphilosophen<br />
und -historiker füllen inzwischen ganze Bibliotheken,<br />
von scharfen Kritikern bis zu den Vordenkern des Silicon<br />
Valley. Filme wie «Matrix» loten Grenzen aus. In Dave<br />
Eggers Roman «Der Circle» (2013) hat der Konzern «Circle»<br />
mit dem Social-Media-Konzept «TruYou» nicht nur alle<br />
anderen Konzerne verdrängt, sondern auch jede demokratisch<br />
gewählte Regierung überflüssig gemacht. Motto:<br />
«Ein einziger Button für den Rest deines Online-<br />
Lebens.»<br />
Davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Drei Weltkonzerne,<br />
Google, Facebook und Amazon, haben schon<br />
weitgehend die Kontrolle über das Web übernommen<br />
(siehe die Analyse des Social-Media-Masters von<br />
<strong>syndicom</strong>, Marc Rezzonico, auf Seite 14). Sie sind aus dem<br />
Nichts entstanden, machen heute bombastische Umsätze<br />
und werden jeden Tag mächtiger. In der <strong>Netz</strong>branche wird<br />
mit Milliardenübernahmen in einem brutalen Stechen<br />
und Hauen um die Vorherrschaft gerungen. Für die meisten<br />
User hat das <strong>Netz</strong> heute keine materielle Dimension<br />
«Du brauchst nur<br />
noch einen Knopf für<br />
den Rest deines<br />
(Online-)Lebens.»
Dossier<br />
13<br />
mehr, ist die Medien-Box erst einmal eingerichtet und der<br />
Laptop synchronisiert. Sie glauben, sich in einem virtuellen<br />
Raum zu bewegen. Dieser fundamentale Irrtum zeigt,<br />
wie gut die Konzerne darin sind, uns über die Realität der<br />
globalen Vernetzung zu täuschen.<br />
Dem Kabel sollst du folgen<br />
<strong>Im</strong> Sommer 2016 enthüllten führende Forscher, Web-<br />
Ingenieure und <strong>Netz</strong>aktivisten an einer Tagung in Berlin<br />
unter dem sprechenden Titel «Deep Cable», wie Konzerne<br />
und Sicherheitsdienste das Internet zu ihren Gunsten<br />
strukturieren. Am Beispiel der Untersee-Kabelstränge<br />
und der monumentalen Datencenter der Weltkonzerne<br />
wiesen sie nach, dass nicht unsere Likes, sondern die<br />
physische Infrastruktur der wirkliche Kampfplatz mächtiger<br />
Interessen ist. Für uns Nutzer unsichtbar, entscheidet<br />
sich dort, wer Zugriff auf die ungeheuren Datenmengen<br />
hat, die wir täglich produzieren. Weiter, wer über Big Data<br />
zur Kontrolle und Steuerung der User verfügt. Und wer die<br />
Hoheit über die Algorithmen ausübt. Also letztlich<br />
darüber, wie wir das Internet benutzen.<br />
Oder wie es uns benutzt. <strong>Netz</strong>e haben ein paar unangenehme<br />
Eigenschaften.<br />
Sie richten das, was wir tun, auf ihre Struktur aus. Logisch:<br />
Wir bewegen uns zwischen Knoten. <strong>Netz</strong>e disziplinieren<br />
uns. Erst recht, wenn sie so produktiv sind wie das<br />
Internet. Dieser Disziplinierung unterwerfen wir uns auch<br />
noch freiwillig – und liefern mit den Daten den Stock, der<br />
uns schlägt.<br />
Von <strong>Netz</strong>en geht ein mächtiger Sog aus. Denn sie<br />
geben vor, dass wir uns jederzeit mit jedem Punkt verbinden<br />
können. Und sie stellen Unmengen an Information<br />
zur Verfügung. Gratis, oder wenigstens sehr oft gratis. Das<br />
lenkt unsere Aufmerksamkeit ins <strong>Netz</strong>, das fesselt uns.<br />
Google, Facebook und Co. sind erfolgreich, weil sie unsere<br />
Aufmerksamkeit steuern. Das Instrument dazu ist der<br />
Algorithmus. Algorithmen sind geheim. Amazon hat über<br />
Big-Data-Anwendungen seine Kunden und Kundinnen<br />
schon so weit ausgeforscht, dass der Konzern, wie man bei<br />
Amazon intern sagt, «weiss, was du bestellen wirst, noch<br />
bevor du überhaupt daran denkst, etwas zu bestellen».<br />
Weil der Sog so mächtig ist, ist die Freiwilligkeit, die<br />
wir gerne in Anspruch nehmen, blosse Illusion. Aus Dave<br />
Eggers «Circle» wird unter dem Slogan «Leidenschaft, Partizipation,<br />
Transparenz» aus Freiwilligkeit Zwang, aus Indivudalität<br />
Konformität.<br />
<strong>Netz</strong>e haben scheinbar keine Hierarchie. Das ist anziehend.<br />
Tatsächlich herrscht im <strong>Netz</strong> die Hierarchie, welche<br />
die Konzerne installieren. Wir können sie nicht entschlüsseln.<br />
Wir erkennen aber: Sie unterscheidet nicht zwischen<br />
richtig und falsch, sinnvoll und sinnlos, wichtig oder<br />
unwichtig.<br />
Social-Media-<strong>Netz</strong>e machen aus uns den Rohstoff, mit<br />
dem sie arbeiten. In der Internetindustrie gilt der Spruch:<br />
Ist irgendetwas gratis, dann bist du die Ware. Misst man<br />
unseren Wert für Facebook an der Börsenkotierung des<br />
Konzerns, tragen jeder Schweizer und jede Schweizerin<br />
etwa 1000 Franken zu dessen Vermögen bei. Bei Google<br />
dürfte dieser Wert noch höher liegen.<br />
Schliesslich: Davon, dass die digitalen Konzerne den<br />
Kapitalismus per Uberisierung verschärfen, indem sie die<br />
Arbeit und die sozialen Beziehungen attackieren, ist an<br />
anderer Stelle die Rede: Siehe Manifest von <strong>syndicom</strong> zum<br />
digitalen Umbau, Seiten 24/25 dieses Heftes.<br />
Die Internetökonomie<br />
ist um ein zentrales<br />
Prinzip gebaut:<br />
Ist etwas gratis, dann<br />
bist du die Ware.<br />
Einspruch: Die Mächtigen fürchten das Internet<br />
Stimmt. Der (kurzlebige) politische Frühling in Ägypten<br />
wurde als «Internetrevolution» gefeiert. Oppositionsbewegungen<br />
überall auf der Welt nutzen die digitalen<br />
sozialen <strong>Netz</strong>werke. Unter der Maske von Fawkes drohen<br />
Anonymous-Hacker mit Vendetta. WikiLeaks und ähnliche<br />
<strong>Netz</strong>werke machen Reichen und Regierenden die<br />
Hölle heiss. Wahr ist: Einige Minister mussten wegen<br />
Enthüllungen im Web den Hut nehmen. Doch nachhaltig<br />
konnten <strong>Netz</strong>bewegungen den Gang der Dinge bisher<br />
nicht beeinflussen. Saint-Simons Traum bleibt Utopie.<br />
Eine wachsende Zahl von kritischen Köpfen sieht in<br />
der digitalen Vernetzung inzwischen eher die Gefahr, dass<br />
die Herrschaft einer Handvoll Konzerne über das Internet<br />
und seine Anwendungen wie das Web und die Social Media<br />
die Demokratie unterlaufen könnte.<br />
Lob der physischen Realität<br />
<strong>Netz</strong>e sind nützlich. Sie sind die bisher beste Form, uns<br />
ein Bild von der Welt zu machen. Zudem kann eine<br />
komplexe Welt mit komplexen Problemen, wie etwa dem<br />
Klimawandel, wohl nur mit ausgeklügelten <strong>Netz</strong>werkprozessen<br />
im Lot gehalten oder ins Lot gebracht werden.<br />
Sogar die schärfsten Kritiker erkennen das. Ihr besonderer<br />
Beitrag besteht darin, dass sie die Schleier über der<br />
physischen Realität der <strong>Netz</strong>e lüften. Bisher wurde viel<br />
über die Virtualität der <strong>Netz</strong>e gesprochen. Das Internet ist<br />
nicht virtuell. Die Beziehungen in den Social Media<br />
mögen teilweise virtuell sein, ihre Grundlage aber sind<br />
Kabel, Funkanlagen, Rechenzentren. Versteht man, dass<br />
materielle Kontrolle über diese <strong>Netz</strong>e ihren Inhalt (mit)<br />
bestimmt, gehen für eine <strong>Netz</strong>werkgewerkschaft<br />
Handlungsmöglichkeiten auf.<br />
Die <strong>Netz</strong>infrastruktur und die <strong>Netz</strong>hoheit, das macht<br />
die exorbitante Macht der US-Konzerne deutlich, müssen<br />
in Händen der öffentlichen Hand liegen oder dorthin<br />
zurückkehren. In den Vereinigten Staaten fordern Bürgergruppen<br />
die Verstaatlichung von Google. Unser Modell<br />
zielt eher auf einen digitalen öffentlichen Dienst, der<br />
Dienste wie Suchmaschinen und Big-Data-Lösungen<br />
anbietet. Und auf einen umfassenden Schutz unserer<br />
Daten.<br />
Nur wird dies allein nicht genügen. Wir werden das<br />
Ende von Facebook & Co. ausrufen und neue, endlich demokratische<br />
<strong>Netz</strong>e erfinden müssen.<br />
netzpolitik.org
14<br />
Dossier<br />
Das Web ist tot. Was kommt nun?<br />
Web 3.0 steht gegen Trinet.<br />
Das World Wide Web, das auf Vielfalt und<br />
Freiheit baute, gibt es seit 2014 nicht mehr.<br />
Schuld daran sind Google, Facebook, Amazon.<br />
Weshalb haben wir nichts bemerkt?<br />
Text: Marc Rezzonico<br />
Facebook und Google dominieren heute fast 70 % des<br />
Internetverkehrs. Nach einem spektakulären Wachstum<br />
im Onlinehandel ist nun auch Amazon zu diesen zwei Internetgiganten<br />
hinzugestossen.<br />
Wie konnte das geschehen? Nicht bei der Besucherzahl<br />
der Websites geschah die grosse Zäsur, nicht bei der<br />
Anzahl Internetnutzer oder bei den Schnittstellen der<br />
sozialen Medien. Sondern weiter in der Tiefe, bei den<br />
Leitungen, beim Datenverkehr und bei der Rollenverteilung<br />
zwischen den drei Konzerngiganten.<br />
Jedes der drei Unternehmen konzentrierte sich auf<br />
das, was es am besten konnte: «Social Media» bei<br />
Facebook, künstliche Intelligenz bei Google und<br />
Onlinehandel bei Amazon. Google hat seine Social-Media-Apps<br />
wie Google+ oder Google Waze aufgegeben,<br />
Facebook verzichtet auf Bing … Google und Facebook sind<br />
keine Konkurrenten, sondern Komplizen!<br />
Die 30 % des Web, die diese Unternehmen noch nicht<br />
beherrschen, werden schliesslich auch noch eingenommen<br />
werden. Und damit ist auch die Vielfalt des Web<br />
dahin, die zahlreichen Unternehmen Innovationen und<br />
Wachstum ermöglicht hatte: Webgemeinschaften konnten<br />
wachsen, und unabhängige Websites konnten fast<br />
überall einen Host finden. Die Webwirtschaft, wie man sie<br />
zu kennen glaubt, ist bedroht, weil die Webneutralität bedroht<br />
ist. Die <strong>Netz</strong>neutralität garantierte, dass alle Datenflüsse<br />
gleich behandelt wurden. Kurz vor Weihnachten<br />
wurde sie nun von der US-Regierung abgeschafft. Davon<br />
betroffen sind auch die Medien, unsere persönlichen Daten<br />
und die Politik.<br />
Die Ökonomie ist dabei entscheidend. In dieser neuen<br />
diskriminierenden Situation werden die Provider den<br />
Riesen Google, Facebook und Amazon schliesslich einen<br />
billigeren Zugang anbieten. In Portugal beispielsweise<br />
hat dies bereits begonnen. Dort überlässt man die Datenübertragung<br />
dem freien Spiel der Marktkräfte. Es werden<br />
Internetpakete für bestimmte Messaging-Dienste oder<br />
soziale <strong>Netz</strong>werke angeboten. Ein Internetabonnement<br />
ist dann günstiger, wenn man Gmail und Facebook<br />
benutzt und bei Amazon einkauft.<br />
So besteht für die kleinen Unternehmen kein grosses<br />
Interesse mehr daran, in eine eigene Website zu investieren.<br />
Stattdessen werden sie Facebook-Seiten benutzen.<br />
Kleine E-Commerce-Websites werden sich von Amazon<br />
aufkaufen lassen oder aufgeben. Google wird als Suchmaschine<br />
nicht mehr viel nützen, was seine Umstellung auf<br />
die künstliche Intelligenz erklärt. Es entsteht gerade ein<br />
<strong>Netz</strong>werk von drei <strong>Netz</strong>en für alle. Das Trinet.<br />
Doch auch das Web 3.0 existiert bereits<br />
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass längst ein paralleles<br />
Internet entstanden ist: das sogenannte Dark Web.<br />
Und das ist längst nicht alles. Verschiedenste Dienste und<br />
Plattformen arbeiten seit Jahren an weiteren, parallelen<br />
<strong>Netz</strong>werken, damit das Web wieder sicherer und weniger<br />
hierarchisch wird. Mittels neuer Technologien, eines<br />
neuen Wirtschaftsmodells und neuer Anwendungen<br />
versuchen sie, das Web wieder zu dezentralisieren und es<br />
so von der heutigen Kunden-/Server-Logik weg zum Web<br />
3.0 hin zu bewegen.<br />
Diese <strong>Netz</strong>e heissen IPFS, ZeroNet, Blockstack oder<br />
SAFE Network. Sie basieren auf Kryptowährung (Bitcoin),<br />
Kryptografie, Peer-to-Peer (P2P, BitTorrent) und Blockchains.<br />
Dank diesen neuen <strong>Netz</strong>werken werden die<br />
Nutzer ihre Daten wieder unter Kontrolle haben und<br />
deren Weitergabe neu definieren können.<br />
Dann wird man sich auf ein klar definiertes Wirtschaftsmodell<br />
stützen können, das beim ursprünglichen<br />
Web weitgehend fehlte. Dies hatte zur heutigen Werbeflut<br />
mit ihren Auswüchsen und Auswirkungen geführt.<br />
Schliesslich stellen immer mehr Akteure, darunter<br />
auch europäische Regierungen, die US-Dominanz bei der<br />
<strong>Netz</strong>regulierung infrage.<br />
Letztlich wird viel davon abhängen, ob wir das Diktat<br />
des Trinets von Google, Facebook, Amazon hinnehmen<br />
oder das Web 3.0 lernen. Sind wir bereit für den Wechsel<br />
der virtuellen Umgebung?<br />
netzpiloten.de/begriffsklarung-was-ist-das-web-30<br />
Akzeptieren wir die<br />
Diktatur des Trinet?<br />
Oder sind wir bereit<br />
für den Wechsel in<br />
das Web 3.0?
Dossier<br />
Demokratie braucht freie Medien<br />
Nein zur Initiative «No Billag»!<br />
15<br />
Den Meinungsmachern hinter der Initiative<br />
No Billag geht es nicht um die Abschaffung der<br />
Billag. Vielmehr wollen sie dem unabhängigen<br />
Radio und Fernsehen den Stecker ziehen.<br />
Text: Roland Kreuzer, Zentralsekretär Sektor Medien<br />
Die Rechtsbürgerlichen wollen mit No Billag den Service<br />
public in den Medien zerstören. Würde das Volk am<br />
4. März ihre Initiative annehmen, wäre dies das Ende für<br />
die SRG, aber auch für viele private Radio- und TV-Stationen.<br />
No Billag ist nicht ein Angriff auf die Firma, welche<br />
die Gebühren eintreibt, sondern eine Attacke auf die freie<br />
Meinungsäusserung.<br />
Die Existenz der SRG ist direkt abhängig von den Fernseh-<br />
und Radiogebühren, die drei Viertel zu den heutigen<br />
Einnahmen von 1,6 Milliarden Franken beitragen (ein<br />
Viertel sind Werbeeinnahmen). Wer hat ein Interesse daran,<br />
der SRG den Stecker zu ziehen? Finanzmächtige<br />
Gruppen, die über die notwendigen Geldmittel verfügen,<br />
um private Propagandasender aufzuziehen.<br />
Öffentliches Radio und Fernsehen gehört in Demokratien<br />
zu den grundversorgenden <strong>Netz</strong>en. Jetzt lässt der Initiativtext<br />
keine Zweifel an den Absichten der Initianten<br />
aufkommen. Neu soll gemäss Initiative No Billag in der<br />
Bundesverfassung im Artikel 93 stehen:<br />
• Der Bund versteigert regelmässig Konzessionen für<br />
Radio und Fernsehen.<br />
• Er subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen.<br />
Er kann Zahlungen zur Ausstrahlung von dringlichen<br />
amtlichen Mitteilungen tätigen.<br />
• Der Bund oder durch ihn beauftragte Dritte dürfen<br />
keine Empfangsgebühren erheben.<br />
Auf Deutsch: Nur wer richtig viel Geld hat und am meisten<br />
zahlt, darf in Zukunft senden. Gestrichen werden soll aus<br />
der Bundesverfassung dafür ein entscheidender Satz: «Radio<br />
und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen<br />
Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung<br />
bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des<br />
Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie<br />
stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die<br />
Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck.»<br />
Grosse Verlagskonzerne aber behandeln Information<br />
zunehmend als Ware, die möglichst viel Geld in die<br />
eigenen Taschen spülen soll: Tamedia ersetzt seine zwölf<br />
Redaktionen durch je eine Einheitsredaktion in der<br />
Deutsch- und der Westschweiz. NZZ und AZ Medien<br />
ziehen nach und geben ihren Regionalzeitungen einen gemeinsamen<br />
Einheitsmantel.<br />
Die Verblocherung der Information<br />
Christoph Blocher hat die Macht der Medien für<br />
seine politischen Zwecke längst erkannt und dehnt sein<br />
Medienimperium laufend aus: Zu «Weltwoche» und<br />
«Basler Zeitung» kaperte er letztes Jahr Dutzende von lokalen<br />
Gratiszeitungen, und nun streckt er seine Finger<br />
nach der mächtigen «Südostschweiz» aus.<br />
No Billag würde<br />
13 500 Jobs zerstören.<br />
Für SVP-Blocher<br />
und den Profit der<br />
Medienbarone.
16 Dossier<br />
Das ist brandgefährlich für das Land: Entscheiden künftig<br />
Milliardäre und profithungrige Aktionäre darüber,<br />
welche Infomationen wir bekommen sollen (und in<br />
welcher Form), sind die Auseinandersetzung mit<br />
gesellschaftsrelevanten Themen aus verschiedenen<br />
Sichtweisen und die Meinungsvielfalt in Gefahr. Es<br />
drohen eine weitere Verarmung der Medienlandschaft,<br />
ein Einheitsbrei und die «Berlusconisierung» respektive<br />
«Verblocherung» der öffentlichen Diskussion.<br />
In den vergangenen Jahren wurde schon deutlich,<br />
wohin das führt: Sachgerechte Darstellung, Vielfalt,<br />
kulturelle Entfaltung, wie sie heute als Auftrag für Radio<br />
und Fernsehen in der Bundesverfassung stehen, interessieren<br />
dabei nicht mehr.<br />
Der Service public in den Medien ist uns auch künftig<br />
1 Franken pro Tag wert<br />
Ohne Gebühren stehen 6000 Stellen bei der SRG auf dem<br />
Spiel. Insgesamt gehen die Mediengewerkschaften vom<br />
Verlust von bis zu 13 500 Arbeitsplätzen im Medienbereich<br />
aus, wenn No Billag Zustimmung fände. Denn auch<br />
viele regionale private Radio- und Fernsehstationen,<br />
Radiostationen in Berggebieten und nicht kommerzielle<br />
Alternativradios wie Rabe und Lora überleben nur<br />
dank ihres (kleinen) Anteils an den Gebührengeldern.<br />
Die No-Billag-Befürworter verbreiten eine Stimmung,<br />
die den Egoismus zum Mass aller Dinge erklärt und die<br />
Werte der Schweiz ablehnt. Motto: Wer Filme und Serien<br />
über Netflix oder Teleclub, Sport bei Sky, Musik über<br />
Bezahlkanäle hört und schaut – oder am liebsten sein<br />
eigenes Kulturangebot gratis herunterlädt –, soll nicht für<br />
ein Vollprogramm der SRG bezahlen müssen. Jede und<br />
jeder soll nur für den eigenen privaten Medienkonsum<br />
bezahlen!<br />
Wen kümmert es, dass diese Kommerzkanäle kaum<br />
Information bieten, schon gar nicht für ein viersprachiges<br />
Land wie die Schweiz. Minderheiten – kulturelle und<br />
sprachliche Minderheiten, Volksmusikfreunde etc. –<br />
haben in diesem Denken keinen Platz.<br />
Wer rechnen kann, weiss aber, dass die Abos der Pay<br />
TVs allein für die verschiedenen Mainstream-Sportangebote<br />
wie Champions League, Fussball-WM, Olympische<br />
Spiele, Skirennen etc. ohne Service-public-Angebot<br />
immens viel mehr kosten würden als die SRG. Darum geht<br />
es den Anti-SRG-Initianten ja gerade: Ohne SRG können<br />
sie die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer erst richtig<br />
schröpfen.<br />
Weil wir nicht wollen,<br />
dass uns Aktionäre<br />
und Reaktionäre ihr<br />
Programm aufzwingen,<br />
sagen wir am 4. März<br />
souverän Nein!<br />
die Diskussion über das Programm können wir nur führen,<br />
wenn die SRG als starkes öffentliches Medienunternehmen<br />
weiterbesteht. <strong>Im</strong> Blocher-TV sind wir Bürgerinnen<br />
und Bürger nicht gefragt. Da kommt nur einer zu<br />
Wort.<br />
Das Recht auf umfassende Information ist ein Grundrecht,<br />
das nur durch einen starken Service public in den<br />
Medien garantiert werden kann. Unabhängige Medien,<br />
die nicht privaten Interessen gehorchen müssen, sind<br />
entscheidend für die Meinungsbildung und das Funktionieren<br />
einer Demokratie. Dass dies so bleibt, dafür sorgen<br />
wir an der Urne.<br />
sgb.ch/aktuell/nein-zu-no-billag/<br />
madeinswitzerland.media/de/<br />
savethemedia.ch<br />
sendeschluss-nein.ch<br />
Die Diskussion über die Programme ist nur mit dem<br />
öffentlichen Fernsehen möglich<br />
Natürlich haben wir uns alle schon geärgert über<br />
manche Fernsehsendung oder die Ignoranz des Fernsehens<br />
gegenüber unseren Anliegen. Die SRG gehört aber<br />
der gesamten Bevölkerung. Darum kann öffentlich über<br />
den Programmauftrag diskutiert und gestritten werden.<br />
<strong>Im</strong> Blocher- oder Tagi-TV entscheiden allein die Bosse.<br />
Für <strong>syndicom</strong> als Gewerkschaft, als Teil der Zivilgesellschaft<br />
und als Organisation der Medienschaffenden ist<br />
die Programmdiskussion wichtig.<br />
Doch über das Programm stimmen wir am 4. März<br />
nicht ab. Wer der Initiative No Billag zustimmt, um die<br />
SRG zu strafen, schiesst sich in den eigenen Fuss: Denn
Dossier<br />
SRG: 65 Jahre Flimmern<br />
für die Schweiz<br />
17<br />
Das Schweizer Fernsehen stand von Anfang<br />
an für den nationalen Zusammenhalt.<br />
Und auch Kritik musste es früh einstecken<br />
– von rechts wie von links.<br />
Text: Stefan Boss<br />
Fernsehen in den 1950er-Jahren, wie geht das? Zum<br />
Beispiel so: Eine Schar von Leuten sitzt in einem Wirtshaus<br />
und schaut sich auf einer kleinen Flimmerkiste<br />
einen Schwank einer Schauspieltruppe an. Der erste<br />
regelmässige Testbetrieb des neuen Mediums begann vor<br />
65 Jahren in Zürich. Pro Tag wurde jeweils eine Stunde gesendet,<br />
an fünf Wochentagen.<br />
Kurz danach starteten Tests in der Westschweiz.<br />
Fernsehstudios wurden ab 1960 in Zürich, Genf und<br />
Lugano eingerichtet – drei Amtssprachen waren somit<br />
vertreten. «Die ‹Tagesschau› wurde anfänglich auf<br />
Deutsch, Französisch und Italienisch zu den gleichen<br />
Themen in Zürich produziert», erzählt die Historikerin<br />
Ursula Ganz-Blättler von der Uni St. Gallen. Der Zweck des<br />
Fernsehens war, den nationalen Zusammenhalt zu fördern.<br />
Er steht dank starker regionaler Berichtserstattung<br />
bis heute im Zentrum.<br />
Neben dem Zusammenhalt war in der Pionierzeit auch<br />
die internationale Zusammenarbeit wichtig. Die SRG setzte<br />
sich ein für die Eurovision, die Organisation für internationalen<br />
Programmaustausch. Ein Meilenstein für die<br />
internationale Fernsehübertragung war die Fussball-Weltmeisterschaft<br />
von 1954 in der Schweiz. In einem berauschenden<br />
Finalspiel schlug Deutschland im Berner Wankdorf<br />
damals Ungarn 3:2, es war «das Wunder von Bern».<br />
Zunächst waren Fernsehapparate teuer und deshalb<br />
vorwiegend in Gaststuben anzutreffen. «Die Wirte hofften,<br />
dadurch mehr Publikum anzulocken», sagt Ganz-Blättler,<br />
die im Historischen Lexikon der Schweiz den Eintrag<br />
zum Fernsehen verfasst hat. <strong>Im</strong> Jahr 1959 gab es dann bereits<br />
50 000 Konzessionen, 1968 überschritt die Zahl die<br />
Millionengrenze. <strong>Im</strong> gleichen Jahr bekam das Fernsehen<br />
Farbe. Heute umfasst sein Leistungsauftrag programmliche<br />
Vielfalt und föderalistischen Ausgleich.<br />
Für die rechten Parteien schafft das öffentliche Fernsehen<br />
zu viel gesellschaftliche Transparenz<br />
Doch von Anfang an gab es auch Kritik am Fernsehen. Radiomacher<br />
fürchteten die Konkurrenz. Zeitungsverleger<br />
und Annoncenagenturen wollten das Abfliessen von Werbegeldern<br />
verhindern. Sie erreichten, dass das Fernsehen<br />
bis 1965 gänzlich werbefrei blieb. Sonntags- und Unterbrecherwerbung<br />
wurde erst zu Beginn der 1990er-Jahre<br />
zugelassen, als die SRG ihre monopolähnliche Stellung<br />
verlor. In den 1970er-Jahren kritisierte die SVP erstmals,<br />
das Fernsehen stehe politisch links («Hofer»-Club). Das<br />
war wohl eine enge Sicht, denn auch linke und kulturkritische<br />
Kreise übten immer wieder Kritik am Fernsehen.<br />
Mit «No Billag» will die Rechte der SRG den Stecker<br />
ziehen. Man kann nur hoffen, dass die Abstimmung vom<br />
4. März die Geschichte des unabhängigen Schweizer Fernsehens<br />
und Radios nicht abrupt beendet.<br />
hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10986.php<br />
no-culture.ch<br />
«Mit No Billag würden<br />
wir auf ein GA für<br />
Information, Unterhaltung,<br />
Sport, Musik<br />
und Kultur in allen<br />
vier Landessprachen<br />
verzichten.» Franz Hohler<br />
Fotostrecke<br />
Die Bilder in diesem Themendossier stammen vom Berner<br />
Fotografen Peter Mosimann. Mosimann ist ein vielgereister<br />
Meister seines Fachs. Er hat die sichtbaren Zeichen unserer<br />
Vernetzung ein<strong>gefangen</strong>: eine Abhörstation auf Seite 1. Eine<br />
Handyantenne unter einem Autobahnviadukt (Seiten 8 und<br />
9). Strommasten, einen Eisenbahntunnel und die<br />
Verkehrsführung am Wandorf für die Seite 11. Auf 12 die<br />
Energiezentrale Bern. Von dort stammt auch der Stoppschalter<br />
Seite 17. Swisscom verarbeitet ihre Daten in einer<br />
Hochsicherheitsanlage (Seite 14). Das Schweizer Fernsehen<br />
in konzentrierter Produktion zeigt das Bild auf Seite 15, und<br />
auf Seite 16 laufen SRG-Kabel heiss.<br />
Manche, die sich auf Social Media tummeln, haben aus dem<br />
Blick verloren, dass <strong>Netz</strong>e nicht virtuell sind, sondern zuerst<br />
eine aufwendige materielle Infrastruktur. Das Leben 2018 ist<br />
in eine Vielzahl von <strong>Netz</strong>werken eingebunden, die immer<br />
enger zusammenspielen.<br />
petermosimann.ch (Seite mit ihren zahlreichen starken<br />
Reportagebildern)
18<br />
Eine bessere<br />
Arbeitswelt<br />
Wem gehört der neue<br />
Aufschwung?<br />
Den Arbeitenden! Das<br />
ist ökonomisch und<br />
politisch elementar.<br />
<strong>Im</strong> Jahr 10 der grossen Krise hat in<br />
einigen Ländern der Aufschwung eingesetzt.<br />
Sogar in der Schweiz, trotz der<br />
katastrophalen Politik der Nationalbank,<br />
die uns 150 000 Jobs gekostet<br />
hat. 2018, vermutet der SGB, wird die<br />
Wirtschaft um 2,5 Prozent wachsen.<br />
Zeit also, um über die Verteilung<br />
des Wachstums zu sprechen. Denn für<br />
die Krise haben vor allem jene bezahlt,<br />
die von ihrem Lohn leben. Mit Arbeitslosigkeit.<br />
Mit Unterbeschäftigung und<br />
Prekarisierung. Mit sinkenden Renten.<br />
Und stagnierender Kaufkraft.<br />
Die Ungleichheit hat scharf zugenommen.<br />
Ungleiche Gesellschaften<br />
vernichten Lebenschancen, sind weniger<br />
innovativ, zudem krimineller<br />
und kränker.<br />
Jetzt ist es an uns, soziale Fortschritte<br />
durchzusetzen. Der Aufschwung<br />
muss dafür genutzt werden,<br />
die Arbeitszeiten zu verringern. Heute<br />
arbeiten wir eine halbe Woche länger<br />
als 2013. Die AHV wollen wir stärken,<br />
denn die 2. Säule taumelt. Wir müssen<br />
den Sparwahn beim Service public<br />
stoppen und Ausgleich für die teuren<br />
Kassenprämien schaffen. Und klar ist<br />
ohnehin: Die Lohnuterschiede zwischen<br />
Mann und Frau müssen weg!<br />
Die Wirtschaft brummt wieder. Jetzt braucht es bessere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. (© chuttersnap)<br />
sgb: goo.gl/9L8bZw<br />
Jura: 4000 für<br />
sichere Busse und gute<br />
Chauffeurlöhne<br />
Das Paket, das die <strong>syndicom</strong> und der<br />
SEV kurz vor Weihnachten der jurassischen<br />
Regierung in Delémont übergaben,<br />
hatte es in sich: 4000 Bürgerinnen<br />
und Bürger forderten per<br />
Unterschrift, die Neu-Ausschreibung<br />
von Buslinien mit Auflagen zum<br />
Schutz der Arbeits bedingungen zu<br />
verbinden.<br />
Vor allem die branchenüblichen<br />
Löhne und Arbeitszeiten seien einzuhalten.<br />
Wer für den öffentlichen<br />
Verkehr Busse betreibe, solle einem<br />
Gesamtarbeitsvertrag unterschreiben,<br />
verlangen Gewerkschaften und<br />
Petitionäre. <strong>Im</strong>mer mehr Kantone<br />
schreiben ihre Verkehrslinien aus,<br />
weil sie sich Einsparungen erhoffen.<br />
Gehen die Konzessionen von PostAuto<br />
und Jurassischer Bahn an private<br />
Unternehmen über, könnten Jobs und<br />
Sicherheit gefährdet sein: Bei<br />
steigenden Fahrzeiten pro Tag etwa<br />
wächst die Gefahr der Überlastung.<br />
Link goo.gl/1LJmY2
«Die Flut der gesammelten Daten bringt die Logistik an ihre<br />
Grenzen und gefährdet den Zugang zu Diensten.» Matteo Antonini<br />
19<br />
In der Logistik wird<br />
die Teilung der<br />
Gesellschaft deutlich.<br />
Logistik ist die Antwort auf die<br />
Probleme Versorgung und Zugang.<br />
Sie basiert auf <strong>Netz</strong>werken und digitalen<br />
Daten. Seit einigen Jahren findet<br />
dort ein Paradigmenwechsel statt. Die<br />
Flut der Daten, die im Rahmen der<br />
Digitalisierung gesammelt werden,<br />
stellt eine wachsende Herausforderung<br />
für das Logistiknetz dar. Etwa bei<br />
der Lieferung. Wir können uns den<br />
Produkten, die uns ständig angeboten<br />
werden, nicht mehr entziehen. Und es<br />
entstehen laufend neue, immer<br />
stärker auf einzelne Kundinnen und<br />
Kunden zugeschnittene Produkte.<br />
Will das Vertriebs- und Verteilnetz<br />
diese Nachfrage befriedigen, gerät es<br />
unter Druck. Die Arbeitsbedingungen<br />
verschlechtern sich weltweit, die<br />
Prekarisierung nimmt zu. Häufig wird<br />
der Wettbewerb über den Preis und<br />
nicht über die Qualität geführt. Dabei<br />
machen die Kosten auf dem «letzten<br />
Kilometer» des <strong>Netz</strong>werks 50 Prozent<br />
des Endpreises aus. Das ist nicht nur<br />
bei der Paketzustellung so, sondern<br />
auch im Datennetz.<br />
Auch der Zugang zu Diensten ist<br />
nicht mehr gesichert. Der kürzliche<br />
US-Entscheid, die <strong>Netz</strong>neutralität zu<br />
kippen, folgt dem bekannten Muster<br />
der Privatisierungen des Service public<br />
bei Diensten wie Wasser, Bildung,<br />
Gesundheit, Strom. Die Gefahr einer<br />
Mehrklassengesellschaft beunruhigt<br />
uns zunehmend.<br />
Matteo Antonini ist Leiter des Sektors Logistik und<br />
Mitglied der <strong>syndicom</strong>-Geschäftsleitung<br />
Gewerkschaftliche Allianz gegen<br />
Dumping durch Auslagerungen<br />
Digitales Logistikdesign lässt alle Missbräuche zu. Aufträge in<br />
Spitzenzeiten an Subunternehmen auszulagern, ist nicht neu.<br />
Doch die Ausnahme wird immer mehr zum System, um die<br />
Arbeitsbedingungen zu drücken. Mit Fairlog halten wir dagegen.<br />
Tatort Genf: Ein Transportunternehmen<br />
teilt seinem Festangestellten<br />
jeweils am Morgen mit, ob und wie viel<br />
er zu tun hat – klassische Arbeit auf<br />
Abruf. Dafür erhält der Mann 20 Franken<br />
die Stunde. Daneben arbeitet er<br />
auch noch für andere Arbeitgeber. Als<br />
er deshalb einmal anderweitig<br />
verplant ist, wird er fristlos entlassen.<br />
Tatort Zürich: Ein Zentrumsleiter von<br />
PostLogistics hält die Personalressourcen<br />
bewusst knapp. Ihm ist<br />
erlaubt, Touren auszulagern, um<br />
Auftragsspitzen zu brechen. Hier aber<br />
wird das missbraucht. Die Unterkapazität<br />
wird gezielt herbeigeführt, um<br />
möglichst viel an andere Unternehmen<br />
auszulagern.<br />
Tatort Ostschweiz: <strong>Im</strong> Arbeitsvertrag<br />
eines Paketboten steht: «Der<br />
Arbeitnehmer verpflichtet sich,<br />
diejenige Arbeitszeit aufzuwenden,<br />
die zur erfolgreichen Erledigung der<br />
Aufgaben erforderlich ist.» Mit anderen<br />
Worten: unbegrenzte Arbeitszeit.<br />
In all diese Fälle sind Subunternehmen<br />
von grossen Transportfirmen<br />
involviert. Sie erledigen die Arbeit oft<br />
nicht mehr selbst, sondern kümmern<br />
sich nur noch um Generierung und<br />
Organisation der Aufträge.<br />
Ein Phänomen der Digitalisierung<br />
Diese Praxis wird Logistikdesign<br />
genannt. Dass ein Paket von A nach B<br />
kommt, und das möglichst effizient<br />
koordiniert mit anderen Lieferungen<br />
von verschiedenen Auftraggebern,<br />
darin liegt die Kunst des Logistikdesigns.<br />
In diesem Bereichen werden<br />
hohe Gewinnmargen generiert. Die<br />
Erledigung der Knochenarbeit überlässt<br />
man Dutzenden von Subunternehmen.<br />
Diese drücken gegenseitig<br />
die Preise derart, dass die Arbeitsbedingungen<br />
der Belegschaft massiv leiden.<br />
Erst die Digitalisierung erlaubt<br />
es, ein derart atomisiertes Konstrukt<br />
überhaupt koordinieren zu können.<br />
Diese Zersplitterung der Wertschöpfungskette<br />
fordert die Gewerkschaft<br />
massiv. Deshalb hat <strong>syndicom</strong><br />
mit den Gewerkschaften Unia und<br />
SEV den Verein Fairlog gegründet. Mit<br />
dieser Allianz wollen wir die Logistik<br />
und den Strassentransport in seiner<br />
ganzen Breite umfassen und endlich<br />
sozialpartnerschaftlich regulieren.<br />
(David Roth)<br />
Gegen Hektik und Auslagerungen: Die Logistik muss wieder fairere Arbeit schaffen (© Peter Leuenberger)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/logistik/fiarlog/
20 Arbeitswelt<br />
«Sie wollen uns Lektionen in Qualität erteilen. Dabei sind es<br />
ihre Restrukturierungen, die der Qualität schaden.» Antoine Grosjean<br />
Redaktionen in der Romandie<br />
machen Front gegen Tamedia<br />
Mit Stellenabbau, Schliessungen und Einheitsredaktionen will<br />
der Zürcher Grosskonzern Tamedia noch mehr Profit einfahren.<br />
Zum Schaden der Meinungsvielfalt. Jetzt sagen die Journalistinnen<br />
und Journalisten von fünf Blättern: Genug!<br />
Am 15. Dezember gingen in Lausanne<br />
fünf Westschweizer Redaktionen auf<br />
die Strasse, um zusammen mit <strong>syndicom</strong><br />
und impressum gegen ihren<br />
Arbeitgeber Tamedia zu protestieren.<br />
Die Forderungen der Personalvertretungen<br />
von «Le Matin», «Le Matin<br />
Dimanche», «Femina», «24 heures»<br />
und «La Tribune de Genève»: «Le Matin»<br />
soll weiterhin gedruckt werden<br />
und nicht nur als Digital-Ausgabe<br />
erscheinen. Für Kündigungen aus<br />
wirtschaftlichen Gründen soll ein<br />
zweijähriges Moratorium gelten. Und<br />
die Rentabilitätsvorgaben sollen<br />
gesenkt werden. Schliesslich habe<br />
Tamedia den Reingewinn im ersten<br />
Halbjahr 2017 um 37,1% steigern können.<br />
Weiter verlangen die Journalisten,<br />
dass Verhandlungen über die<br />
Reorganisation der Arbeit eröffnet<br />
werden.<br />
Ständige Angst um den Arbeitsplatz,<br />
inhaltliche Ausdünnung der<br />
Zeitungen und Übernahmeversuche –<br />
die Journalisten haben genug und<br />
setzen sich zur Wehr. Bei «Le Matin<br />
Dimanche», «Le Matin» und «La Tribune<br />
de Genève» (TG) boykottierten sie<br />
die «Qualitätssitzungen», die in Anwesenheit<br />
von Tamedia-Verwaltungsratspräsident<br />
Pietro Supino stattfinden<br />
Hartes Wort gegen brutale Realittät (© Sancey, Archiv)<br />
sollten. «Dass uns die Geschäftsleitung<br />
Unterricht in Qualität erteilen<br />
wollte, wo es doch gerade ihre Restrukturierungen<br />
sind, die der Qualität<br />
schaden – das hat uns extrem verärgert»,<br />
sagt Antoine Grosjean, Mitglied<br />
der Redaktoren-Vereinigung der TG.<br />
Ursache für die allgemeine Verdrossenheit<br />
ist die lange Reihe von Restrukturierungen,<br />
welche die Journalistinnen<br />
und Journalisten von<br />
Tamedia in der Romandie und auch in<br />
der Deutschschweiz über sich ergehen<br />
lassen mussten. Die Zürcher Mediengruppe<br />
hingegen hält die Massnahmen<br />
wirtschaftlich für nötig. 2016<br />
wurden bei der TG sechs Stellen gestrichen.<br />
Ende August 2017 kündigte<br />
Tamedia die Fusion von «Le Matin»<br />
und «20 Minutes» an: Neun Arbeitsplätze<br />
wurden abgebaut, sechs davon<br />
durch Entlassungen. Gleichzeitig wurde<br />
bekannt, dass verschiedene Ressorts<br />
der TG und von «24 heures»<br />
zusammengelegt werden. Das Ziel: In<br />
Zürich und in Lausanne sollen zwei<br />
Mantelredaktionen geschaffen werden.<br />
In Genf und Bern sorgte dies für<br />
Unmut bei Parlamentariern, die sich<br />
um die Stellung ihres Kantons in der<br />
Medienlandschaft sorgten.<br />
Der Demonstrationszug vom<br />
15. Dezember, an dem rund 120 Personen<br />
teilnahmen, blieb aber ohne<br />
Wirkung. In einer internen Abstimmung<br />
beschlossen die Journalisten<br />
deshalb mit sehr grosser Mehrheit ein<br />
Misstrauensvotum gegen Serge<br />
Reymond, den Leiter von Tamedia<br />
Westschweiz. Am 22. Dezember reiste<br />
eine Delegation für ein Gespräch mit<br />
dem Vorsitzenden der Tamedia-<br />
Geschäftsleitung, Christoph Tonini,<br />
und Pietro Supino nach Zürich.<br />
«Unserer Ansicht nach hatten die vorgeschlagenen<br />
Sitzungen mit Reymond<br />
nichts anderes zum Ziel, als Zeit zu<br />
gewinnen, damit der Umsetzung<br />
nichts im Wege steht», sagt Antoine<br />
Grosjean. «Wir hoffen, dass die Tamedia-Direktion<br />
konkrete Antworten auf<br />
unsere Forderungen hat. Wir sind fest<br />
entschlossen, nicht locker zu lassen.»<br />
(Dominique Hartmann)<br />
Post Scriptum (Red): Tamedia hat das<br />
Misstrauensvotum ignoriert.<br />
goo.gl/xVzLdf<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/presse<br />
Wir stehen auf, weil<br />
die freie Information<br />
auf dem Spiel steht<br />
Die Hiobsbotschaften kommen<br />
Schlag auf Schlag: Tamedia verpasst<br />
seinen zwölf Tageszeitungen je eine<br />
Zentralredaktion in Zürich und<br />
Lausanne – klarer Abbau journalistischer<br />
Vielfalt und vieler Stellen. Der<br />
Depeschen-Agentur SDA drohen die<br />
Verleger mit Ressourcenentzug – sie<br />
greifen die Grundversorgung mit<br />
verlässlichen Informationen an.<br />
Ringier schliesst die traditionsreiche<br />
Druckerei in Adligenswil – damit<br />
vernichtet der Konzern mehr als 150<br />
Stellen und befeuert die Monopolisierung<br />
im Zeitungsdruck. Die AZ Medien<br />
fusionieren mit den Regionaltiteln<br />
der NZZ-Gruppe – damit überziehen<br />
sie das Mittelland mit einem Mantelsystem,<br />
das den LeserInnen von<br />
St. Gallen über Luzern bis Basel die<br />
selben Inhalte beschert. Wir GewerkschafterInnen<br />
haben 2018 viel zu tun!<br />
Gleichzeitig blasen die Rechtsnationalen<br />
mit der Abschaffung der Radiound<br />
Fernsehabgabe zum Angriff auf<br />
die publizistisch vergleichsweise<br />
unabhängige SRG. «Cui bono» fragten<br />
die schlauen Römer, wem nützt das alles?<br />
Jenen Milliardären, die Medien<br />
billig zusammenkaufen, um ihr politisches<br />
Programm noch besser unters<br />
«Volch» zu bringen. Wem schadet es?<br />
Uns allen, die wir eine offene, gerechte,<br />
demokratische Schweiz wollen. Da<br />
gibt es nur eines: Ein klares NEIN zur<br />
No-Billag-Initiative!<br />
Stephanie Vonarburg leitet die Branche Presse<br />
und elektronische Medien und ist Mitglied der GL.
Korrekte Löhne und Arbeitszeiten sind im digitalen Brutalo-<br />
Kapitalismus von Amazon, Zalando & Co. nicht vorgesehen.<br />
21<br />
No Billag ist Gift<br />
für Menschen<br />
mit Behinderung<br />
Die No-Billag-Initiative trifft uns alle,<br />
aber Migrantinnen und Migranten sowie<br />
Menschen mit einer Behinderung<br />
besonders stark.<br />
Bei Annahme der Initiative muss<br />
nicht nur die SRG den Betrieb einstellen,<br />
auch den neun nicht kommerziellen<br />
Radios wie LoRa und RaBe droht<br />
das Aus. Deren mehr- und fremdsprachigen<br />
Sendungen sind hoch integrativ.<br />
Zu diesem Schluss kommt eine<br />
Studie des Bundesamts für Kommunikation:<br />
Sie informieren Migranten<br />
und Migrantinnen über das Leben in<br />
der Schweiz, sodass diese sich besser<br />
zurechtfinden können. Und die Inhalte<br />
sind ausgesprochen vielfältig, denn<br />
häufig werden sie von den Betroffenen<br />
selbst gemacht. Einen besonderen<br />
Beitrag zur Solidarität mit gesellschaftlichen<br />
Minderheiten leistet<br />
auch die SRG – in allen vier Landessprachen.<br />
Für Menschen mit Hörbehinderungen<br />
sind die meisten TV-Programme<br />
in den Hauptsendezeiten mit<br />
Untertiteln versehen, weitere mit Gebärdensprache.<br />
Für Menschen mit<br />
Sehbehinderungen stehen viele Sendungen<br />
als Hörversion zur Verfügung.<br />
Die Website von SRF ist barrierefrei.<br />
Diese Dienstleistungen des Service<br />
public wurden mit Behindertenverbänden<br />
kontinuierlich ausgebaut.<br />
Auch aus diesen Gründen: NEIN<br />
zur No-Billag-Initiative!<br />
Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung,<br />
Mitglied der Geschäftsleitung<br />
Schluss mit klug<br />
Die SDA entlässt, weil die Verleger ihre eigene<br />
Agentur totsparen. Kein Interesse mehr.<br />
Die Depeschenagentur SDA ist ein solider Pfeiler der Information<br />
in der Schweiz. Jetzt wird ihre Arbeit schlechter: Die<br />
Besitzer bauen 35 bis 40 Vollzeitstellen ab. Der Abbau läuft<br />
bereits: Seit November werden keine Abgänge mehr ersetzt.<br />
Aus der Nachrichtenschmiede ohne Profitdruck, die<br />
sich im Gegensatz zu den meisten ihrer Kundinnen durch<br />
ein halbwegs intaktes Qualitästbewusstsein auszeichnet,<br />
soll eine Firma werden, die Dividenden auszahlt. Grösste<br />
Aktionärin ist seit Kurzem die österreichische Agentur<br />
APA, ein wohl geplanter Kollateralschaden der Fusion zwischen<br />
SDA und Keystone.<br />
Die Story dahinter<br />
In Wahrheit aber geht es um viel mehr als ein bisschen<br />
Betriebswirtschaft und Fusion. Die SDA wurde 1895 von<br />
Zeitungsverlegern gegründet, um mit der geballten Wucht<br />
eines Journalistenpools zu hochqualifizierten und aktuellen<br />
Informationen und Beiträgen aus aller Welt und allen<br />
Regionen zu kommen. Und aus der Wirtschaft. Grosse nationale<br />
Agenturen sicherten im 20. Jahrhundert in vielen<br />
Ländern die demokratische Debatte, manchmal auch den<br />
Einfluss eines Landes in der Aussenpolitik.<br />
Seit einigen Jahren aber sparen die Medienhäuser ihre<br />
Agentur tot. Für 2018 muss die SDA mit 3,1 Millionen Franken<br />
leben. Für Ringier, Tamedia etc. haben qualifizierte<br />
Information und Wissen an Bedeutung verloren. Sie setzen<br />
eher auf Content. Also auf Gossip, kurzatmige News und<br />
nicht strukturierte, universell formatierte und immer wieder<br />
verwendbare Multimediapakete. Die gibts im Internet<br />
oder aus eigener Produktion billiger. Dass die SDA heute<br />
massiv abbaut, ist ein direktes Symptom des Zerfalls der<br />
journalistischen Öffentlichkeit in der Schweiz.<br />
Die SDA-Redaktion wehrt sich. In einer Resolution stellte<br />
sie ihre Forderungen dar. Unter anderem: keine Vermischung<br />
von Journalismus und PR, Diskussion über Inhalte.<br />
Verzollen für Amazon<br />
Onlinehandels-Multis setzen die Post und die<br />
Arbeitsbedingungen der Branche unter Druck<br />
Logistik in digitalen Zeiten ist auch dies: Die Post übernimmt<br />
künftig die Verzollung von Amazon- Paketen. Das<br />
verkürzt die Lieferzeit so massiv, dass die gesamte Palette<br />
des US-Weltkonzerns (229 Millionen Produkte) in der<br />
Schweiz lieferbar wird. Zum Entsetzen der Detailhändler.<br />
Der chinesische Konzern Alibaba hat seine Sendungen<br />
in die Schweiz 2017 um mehr als 40 Prozent gesteigert.<br />
Ganz ohne Werbung. Die Preise sind so tief, dass sich sogar<br />
Schweizer Händler bei Aliexpress eindecken.<br />
Zalando hat im süddeutschen Lahr ein riesiges Warenlager<br />
aufgebaut, um schneller in die Schweiz zu liefern.<br />
Lastwagenkolonnen karren die Pakete zur Schweizer Post.<br />
60 Prozent gehen auf dem selben Weg vom Kunden wieder<br />
zurück. Ein absurdes Geschäftsmodell.<br />
Doch die Post unternimmt alles, um diese Gross kunden<br />
zu halten. 60 Millionen Franken hat sie in ihre drei Paketzentren<br />
investiert. Sie experimentiert mit neuen Zustellungsformen<br />
und -zeiten, testet Roboter und Drohnen,<br />
nimmt den Konzernen die gesamte Administration ab.<br />
Dank Präzisionsarbeit der Logistiker und der Pöstlerinnen<br />
hält die Post noch rund 80 Prozent des Marktes. Mit sinkenden<br />
Margen. Die Konkurrenz zahlt schlechtere Löhne.<br />
Wenig mehr als 10 Euro Lohn pro Stunde<br />
Es könnte noch schlimmer kommen. Amazon plant nicht<br />
nur, in der Schweiz eine Drehscheibe zu errichten. Der<br />
Multi mit Monstergewinnen erwägt sogar, selber auszuliefern.<br />
Was dann der Logistikbranche droht, kann man etwa<br />
in Deutschland beobachten. Amazon bezahlt Einstiegslöhne<br />
um 10,52 Euro für Jobs unter extremen Bedingungen.<br />
Jetzt führte die Gewerkschaft ver.di gerade wieder einen<br />
harten Streik, um Amazon zu einem Kollektivvertrag zu<br />
zwingen. Doch korrekte Löhne und Pausen sind in den materiellen<br />
Niederungen dieses digitalen Brutalo-Kapitalismus<br />
von Amazon, Zalando & Co. nicht vorgesehen.<br />
Die Resolution der Redaktion ist hier: goo.gl/TRVHo1<br />
ver.di-Streiks bei Amazon: goo.gl/UAE3jQ
22 Arbeitswelt<br />
«Zu einem innovativen Unternehmen gehört eine innovative<br />
Sozialpartnerschaft mit guten Arbeitsbedingungen.» Daniel Hügli<br />
Salt macht den Salto. Gilt<br />
Premium nur für Kunden?<br />
Die Zukunft von Salt gleicht einem Hochseilakt. Nach<br />
Handwechseln und Geldentnahmen durch Besitzer Xavier Niel<br />
machen sich die Beschäftigten Sorgen um Job und Zukunft.<br />
<strong>syndicom</strong> sucht den sozialen Dialog mit dem neuen<br />
Management und strebt einen Gesamtarbeitsvertrag an.<br />
Das Engagement der Gewerkschaft<br />
<strong>syndicom</strong> für die Mitarbeitenden von<br />
Salt (vormals Orange) reicht in die Zeit<br />
des Markteintritts des Unternehmens<br />
im Jahr 1999 zurück. Hohe Wellen<br />
warf der Streik von 2003, mit dem wir<br />
bei einer Massenentlassung der<br />
damaligen Eigentümerin France<br />
Télécom einen verbesserten Sozialplan<br />
abringen konnten.<br />
2010 untersagte die Wettbewerbskommission<br />
die Fusion von Orange<br />
mit Sunrise. Also verkaufte France<br />
Télécom das Unternehmen 2012 an<br />
den Investmentfonds Apax Partners.<br />
Wie bei Investmentfonds üblich, wich<br />
die langfristige Strategie kurzfristigen<br />
Profitgelüsten.<br />
Der Milliardär übernimmt<br />
2015 kaufte der Milliardär Xavier Niel<br />
Orange. Bei seinem Antritt in der<br />
Schweiz gab sich Niel als langfristiger<br />
Investor und versprach industrielle<br />
Kontinuität, was sich aber umgehend<br />
als leeres Versprechen entpuppte: Zuerst<br />
liess er Orange in Salt umbenennen.<br />
Danach wechselte er praktisch<br />
das gesamte Topmanagement aus.<br />
Mit dem neuen CEO Andreas Schönenberger<br />
setzt Salt seither auf Innovation<br />
sowie schlanke Prozesse und<br />
Strukturen.<br />
Rauer Umgang mit dem Personal<br />
Diese Neuausrichtung bekommt besonders<br />
das Personal zu spüren. Nebst<br />
Stellenabbau ist die Rede von rauem<br />
Umgangston und enormem Druck.<br />
Anfang 2017 sickerte durch, dass<br />
Salt künftig Festnetzangebote bereitstellen<br />
wolle. Doch auch eine irritierende<br />
Zahl machte die Runde: Besitzer<br />
Xavier Niel soll sich einmal mehr<br />
eine satte Dividende ausgeschüttet<br />
haben, diesmal 500 Millionen Franken.<br />
In einem Unternehmen, das einerseits<br />
beträchtlich investieren<br />
muss, andererseits im harten Gegenwind<br />
steht, nennt man einen solchen<br />
Vorgang unter Ökonomen eine<br />
Substanzentnahme.<br />
Eigenkapital halbiert<br />
Ende 2017 wurde denn auch deutlich,<br />
dass das Eigenkapital des Unternehmens<br />
innert Jahresfrist mehr als halbiert<br />
wurde. Kein Wunder also, dass<br />
Salt für die Vergabe neuer Mobilfunkfrequenzen<br />
eine Preisobergrenze fordert.<br />
Salto mortale?<br />
Nach all den Saltos ist derzeit unklar,<br />
ob Salt sich noch in der Luft befindet<br />
oder doch neuerlich Boden unter den<br />
Füssen gefunden hat. Die rund 700<br />
Mitarbeitenden können auf die Unterstützung<br />
von <strong>syndicom</strong> zählen. «Premium»<br />
soll nicht nur für die Kundschaft<br />
gelten. Denn zu einem<br />
innovativen Unternehmen gehört<br />
auch eine innovative Sozialpartnerschaft<br />
mit guten Arbeitsbedingungen.<br />
(Daniel Hügli, Zentralsekretär Sektor<br />
ICT)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/telecom/salt/<br />
Michel Gobet geht in<br />
Pension. Das Team<br />
Logistik schreibt ihm.<br />
Dokument (Auszug).<br />
«Lieber Michel, der Schriftsteller<br />
Thomas Mann sagte: ‹Denken und<br />
danken sind verwandte Wörter; wir<br />
danken dem Leben, indem wir es<br />
bedenken.› Es fällt uns nicht leicht,<br />
uns vorzustellen, dass Du nach über<br />
35 Jahren Gewerkschaftsarbeit in den<br />
Ruhestand trittst. Du warst nie nur ein<br />
Funktionär. Du hast Deinen Beruf<br />
geliebt und gelebt.<br />
Deine Art, Probleme anzugehen,<br />
war nicht die 08/15-Vorgehensweise.<br />
Ein kritischer Geist, Deine Analysefähigkeit,<br />
ein strategisches Denkvermögen<br />
und das beharrliche, bisweilen<br />
fast sture Dranbleiben haben manch<br />
innovativer Lösung zum Durchbruch<br />
verholfen. Schnell und simpel, das<br />
war nicht Dein Ding. Wohlüberlegt,<br />
offen für Neues, oder sogar Unkonventionelles,<br />
da warst Du in Deinem<br />
Element.<br />
Von lebensbejahendem Naturell<br />
und auch ausserhalb des Berufes<br />
vielseitig interessiert, zeichnet Dich<br />
die Gabe aus, auf Leute einzugehen.<br />
Mehrsprachig und anregend.<br />
Kein Zufall, dass Du Redaktor für<br />
die französische Ausgabe der Zeitung<br />
der PTT-UNION warst. Lange Zeit der<br />
einzige Romand in der Zentrale. Und<br />
Gewerkschaftliches Urgestein: Michel Gobet<br />
(© UniGlobal)<br />
als Zentralsekretär hast Du die Interessen<br />
des Postautofahrpersonals, des<br />
Garagenpersonals und des Strassentransportes<br />
durchgesetzt. Auch Deine<br />
Zeit als stellvertretender Generalsekretär<br />
der PTT-UNION ist uns präsent.<br />
In Deinem Selbstverständnis hatte<br />
die Vernetzung der Gewerkschaften<br />
einen hohen Stellenwert. Dies sowohl<br />
auf nationaler wie internationaler<br />
Ebene. Du warst unser Aussenminister.<br />
Das Gesicht der PTT-UNION, der<br />
Gewerkschaft Kommunikation und<br />
der <strong>syndicom</strong> in den internationalen<br />
Gewerkschafsgremien.<br />
Daneben warst Du im Verwaltungsrat<br />
der Swisscom und der Post der<br />
Vertreter der Arbeitnehmenden. Nicht<br />
immer eine leichte Aufgabe, die<br />
Balance zwischen berechtigten Interessen<br />
der Mitarbeitenden und den<br />
betriebswirtschaftlichen Fakten zu<br />
finden.<br />
Lieber Michel, wir danken Dir für<br />
Deinen Einsatz zugunsten der Lohnabhängigen<br />
und wünschen Dir alles<br />
Gute.»
In Zeiten digitaler Revolution brauchen Gewerkschaften eine<br />
besonders offensive GAV-Politik.<br />
23<br />
Der brandneue Swisscom-GAV<br />
beweist: Sozialer Fortschritt geht<br />
auch mit Digitalisierung<br />
Economiesuisse würde den technologischen Umbruch gerne<br />
für den sozialen Abbruch nutzen. <strong>syndicom</strong>, Swisscom und<br />
eine aktive Belegschaft wählen jetzt einen klügeren Weg: Wir<br />
gestalten die neue Arbeitswelt in Sozialpartnerschaft.<br />
Noch bevor das Thema der Digitalisierung<br />
den Weg auf die Agenda des<br />
Bundesrates fand, forderte Economiesuisse<br />
einen weiteren Abbau der<br />
Bestimmungen zum Schutz der Arbeitenden.<br />
Das erfordere der digitale<br />
Umbau, behaupteten die Patrons.<br />
Auch die Instrumente der Sozialpartnerschaft<br />
seien nicht mehr geeignet,<br />
den Anforderungen des Arbeitsmarktes<br />
gerecht zu werden, fand die<br />
Konzern-Lobby. Dagegen hielt der<br />
Bundesrat im Bericht vom 7. November<br />
2017 fest, dass die Sozialpartner<br />
im Rahmen der digitalen Transformation<br />
sehr wohl eine Schlüsselrolle bei<br />
der Arbeitsmarktregulierung spiele.<br />
Vorzeige-GAV für bewegte Zeiten<br />
Jetzt bekräftigt der Abschluss des neuen<br />
Firmen-Gesamtarbeitsvertrags für<br />
die Swisscom, der am 1. Juli 2018 in<br />
Kraft tritt, die Haltung des Bundesrates:<br />
Es ist ein Vorzeige-GAV im Zeitalter<br />
der Digitalisierung geworden.<br />
Dies gelang, weil <strong>syndicom</strong> ein<br />
ganzes Paket von Forderungen aus der<br />
Analyse der digitalen Transformation<br />
abgeleitet hatte. Es nahm die künftigen<br />
Erfordernisse und Zumutungen<br />
voraus. Ausbildung, arbeitsfreie Zeit,<br />
Datenschutz, Mitbestimmung und<br />
soziale Sicherung sind dabei zentral.<br />
Wegweisende Verbesserungen<br />
<strong>syndicom</strong> will den ökonomischen<br />
Wandel mitgestalten. Wer das nicht<br />
tut, hat bereits verloren, bevor der Umbau<br />
eingesetzt hat. Chancen und<br />
Risiken liegen nahe beieinander.<br />
Diese Überlegungen sind die<br />
Treiber einer offensiven GAV-Politik,<br />
die von den Kolleginnen und Kollegen<br />
bei Swisscom mitgetragen wird. Eine<br />
Gewerkschaftspolitik, die nicht<br />
reagiert, sondern agiert. Die Verantwortung<br />
übernimmt. Und dabei<br />
Mitwirkungsrechte gewinnt.<br />
Die Digitalisierung ist dann eine<br />
Chance, wenn die Sozialpartner den<br />
Umbau gemeinsam gestalten. <strong>Im</strong> neuen<br />
GAV stehen den Mitarbeitenden<br />
ein Rechtsanspruch auf Aus- und Weiterbildung<br />
zu, ein besserer Schutz ihrer<br />
Daten sowie die Stärkung ihrer<br />
arbeitsfreien Zeit. Die Verlängerung<br />
des Elternurlaubs nimmt Rücksicht<br />
auf die Bedürfnisse von jungen Mitarbeitenden.<br />
Die Arbeit der gewerkschaftlichen<br />
Vertrauensleute wird<br />
durch einen umfassenden Kündigungsschutz<br />
abgesichert.<br />
Der digitale Umbruch bietet viele<br />
Möglichkeiten, Wirtschaft und Gesellschaft<br />
menschenfreundlicher und<br />
nachhaltiger zu gestalten. Eingebettet<br />
in die Sozialpartnerschaft minimieren<br />
wir die Risiken und nutzen die<br />
Chancen. (Giorgio Pardini)<br />
In der letzten Verhandlungsrunde wurden im Swisscom-GAV starke Fortschritte fixiert (© Caro Wälti)<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/telecom/<br />
Künstliche Intelligenz:<br />
von der Fiktion zur<br />
Realität<br />
Isaac Asimov, Biochemiker, Sachbuch-<br />
und Science-Fiction-Autor,<br />
formulierte vor 70 Jahren die ersten<br />
Grundgesetze der Robotik:<br />
1. Ein Roboter darf der Menschheit<br />
keinen Schaden zufügen oder<br />
durch Untätigkeit gestatten, dass die<br />
Menschheit zu Schaden kommt.<br />
2. Ein Roboter darf keinen Menschen<br />
verletzen oder durch Untätigkeit<br />
zu Schaden kommen lassen.<br />
3. Ein Roboter muss den Befehlen<br />
des Menschen gehorchen, es sei denn,<br />
die Befehle stehen im Widerspruch zu<br />
den vorstehenden Gesetzen.<br />
4. Ein Roboter muss seine eigene<br />
Existenz schützen, solange dieser<br />
Schutz nicht den vorstehenden Gesetzen<br />
widerspricht.<br />
Lange Zeit waren Roboter plumpe<br />
Maschinen, die der Mensch einsetzte.<br />
Dank modernen Techniken wie Sensorik<br />
und künstlicher Intelligenz werden<br />
Roboter fähig, feinmotorische Arbeiten<br />
auszuführen und Entscheide<br />
zu fällen, die auf den Menschen zurückwirken.<br />
Aus ethischer Sicht muss die Verantwortung<br />
für jedes Handeln von<br />
Robotern weiterhin beim Menschen<br />
liegen, denn Roboter befolgen Regeln,<br />
die von Menschen programmiert<br />
werden. Mit unserem Engagement tragen<br />
wir dazu bei, dass Asimovs literarische<br />
Fiktion zum Schutz der Menschheit<br />
Realität wird.<br />
Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT und<br />
Mitglied der Geschäftsleitung
24 Politik<br />
Wirtschaft 4.0: So wollen<br />
wir leben und arbeiten<br />
Die Arbeitenden, die sich in<br />
der Gewerkschaft <strong>syndicom</strong><br />
zusammengeschlossen<br />
haben, machen die digitale<br />
Transformation. Tag für Tag,<br />
ganz konkret, indem sie etwa<br />
neue <strong>Netz</strong>e bauen. Diese<br />
industrielle Revolution wird<br />
unsere Arbeit verändern und<br />
darüber hinaus unsere<br />
Lebensformen.<br />
Nur: Wie das geschieht,<br />
folgt nicht technischen<br />
Zwängen, sondern wirtschaftlichen<br />
und politischen<br />
Entscheiden. Zwei starke<br />
Gründe, uns eine eigene<br />
digitale Strategie zu geben.<br />
Am Kongress 2017 haben wir<br />
sie diskutiert. Hier wird sie<br />
skizziert.<br />
Text: Bo Humair<br />
Bilder: Creative Commons<br />
Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert<br />
arbeiten wir wieder länger: Die<br />
Wochenarbeitszeit steigt. Das ist<br />
nicht nur ökonomisch und gesellschaftlich<br />
absurd. Denn die Menge<br />
bezahlter Arbeit wird weniger, also<br />
müsste sie über die Senkung der<br />
Arbeitszeit besser verteilt werden.<br />
Seit dem Generalstreik galt die<br />
stetige Gewinnung von mehr freier<br />
Zeit als der Gang des Fortschritts<br />
und als elementare Errungenschaft<br />
der Gewerkschaften. Das war nichts<br />
als gerecht, weil die Produktivität<br />
unserer Arbeit stark wuchs.<br />
Doch dass wir heute wieder<br />
länger arbeiten, ist den Ewiggestrigen<br />
vom Gewerbeverband noch nicht<br />
genug. Sie wollen die gesetzliche<br />
Die Digitalisierer<br />
wollen uns 6 Tage<br />
arbeiten lassen.<br />
Mindestens.<br />
Höchstarbeitszeit auf 50 Stunden<br />
erhöhen. Also faktisch die 6-Tage-<br />
Woche wieder einführen.<br />
Damit liegen die Gewerbler in<br />
einem üblen Trend: Obschon wir<br />
die längsten Arbeitszeiten in Europa<br />
haben, greifen neoliberale Politiker<br />
im Dienst der Konzerne und im<br />
Verbund mit Digitalswitzerland und<br />
Avenir Suisse (von Swisscom<br />
mitfinanziert) das Arbeitsgesetz an.<br />
Drei parlamentarische Vorstösse<br />
fordern, die Arbeitszeit zu verlängern<br />
und zu flexibilisieren und den<br />
ohnehin schon schwachen Schutz<br />
der Arbeitenden abzubauen.<br />
Das ist viel mehr als der<br />
Versuch, zusätzlichen Gewinn aus<br />
unserer Arbeit zu pressen. In ihren<br />
Texten machen die Arbeitgeberverbände<br />
klar, dass sie den digitalen<br />
Umbau dazu benutzen wollen, die<br />
sozialen Beziehungen auf den Kopf<br />
zu stellen und unsere Errungenschaften<br />
zu schleifen.<br />
Ein zivilisatorisches Ringen<br />
Sie wollen die Arbeitszeit verlängern.<br />
Die Löhne senken. Die Arbeitsverträge<br />
und die GAV aushebeln. In<br />
der idealen Schweiz ihrer Träume<br />
ist der fest entlöhnte Angestellte ein<br />
Auslaufmodell. <strong>Im</strong>mer mehr<br />
arbeiten in Heimarbeit (als «Crowdworking»<br />
oder «Tele-Arbeit» verkleidet),<br />
in prekären Arbeitsverhältnissen,<br />
ohne garantiertes Auskommen,<br />
auf Abruf und ohne soziale Absicherung.<br />
Dass dabei auch die AHV und<br />
die anderen Sozialversicherungen<br />
einbrechen würden, macht klar,<br />
worum es hier geht: Diese Hardliner<br />
haben eine andere Gesellschaft im<br />
Sinn. Vorwärts in eine Form von<br />
Turbo-Feudalismus. Sie haben den<br />
Kampf um die Frage ausgerufen, wie<br />
wir künftig arbeiten und leben<br />
werden.<br />
Die Technik ist ein billiger Vorwand<br />
Schwarzmalerei? Schön wärs. Als<br />
Gewerkschaft nehmen wir die<br />
Strategien der Konzernlobbys, die<br />
sie in Dutzenden von Papieren<br />
aufgeschrieben haben, ernst. Nur ist<br />
ihr Modell nicht unser Modell.<br />
Die Digitalisierungs-Turbos<br />
glauben, einen starken Hebel in der<br />
Hand zu haben. Die technische<br />
Entwicklung. Und damit verbunden:<br />
die Arbeitsplätze. Diverse neuere<br />
Studien sagen den Verlust von<br />
vielen Millionen Arbeitsplätzen in
Roboter und Künstliche Intelligenz nehmen uns die Arbeit weg? Sehr gut, dann gewinnen wir freie<br />
Zeit. Doch das wird Millionen Jobs kosten? Falsche Frage. Wir können dank der steigenden<br />
Produktivität auch nur noch 25 Stunden arbeiten, die Arbeit besser verteilen und neue, bessere<br />
Jobs schaffen. Das Ringen zwischen sozialer Digitalisierung und digitaler Barbarei hat begonnen.<br />
25<br />
Europa voraus, bereits in den<br />
nächsten Jahren (nur der Schweizer<br />
Bundesrat malt in seinem Bericht<br />
mal wieder schön). 2055, so behauptet<br />
die brutale Beratungsfirma<br />
McKinsey, werde die Hälfte aller<br />
Arbeitsstunden von Robotern<br />
geleistet (siehe Grafiken, Seite27).<br />
Falsche Frage, falsche Anwort<br />
Nur wer länger arbeite, flexibler und<br />
billiger, werde in der digitalen Welt<br />
überleben, sagen die Konzerne. Und<br />
manche fallen auf diesen Unsinn<br />
sogar herein.<br />
Ein Blick in die reale Ökonomie<br />
(und in unsere eigene Geschichte)<br />
klärt uns auf. Gemacht wird in einer<br />
kapitalistisch organisierten Wirtschaft<br />
nicht, was technisch möglich<br />
wäre, sondern was den Aktionären<br />
Rendite verspricht. Sonst hätten wir<br />
längst intelligentere Verkehrssysteme.<br />
Modulare Computer, die zehn<br />
Jahre halten. Ökologische Energie.<br />
Und einiges mehr.<br />
Das ist der immense Nachteil<br />
der Digitalisierung durch die<br />
Konzerne. Digitale Techniken<br />
könnten uns von schwerer oder<br />
stumpfer Arbeit befreien. Sie<br />
könnten uns klüger und freier<br />
machen. Und uns dabei helfen, die<br />
Schweiz ökologischer und gerechter<br />
zu organisieren.<br />
Die bessere Digitalisierung<br />
Wie wir leben und arbeiten werden,<br />
hängt also davon ab, ob wir eine<br />
soziale Digitalisierung durchsetzen.<br />
Überlassen wir sie den Konzernen<br />
und ihren Aktionären, drohen<br />
Massenarbeitslosigkeit und digitale<br />
Barbarei.<br />
Zentraler Kampfplatz der<br />
Vierten Industriellen Revolution ist<br />
die Arbeit. Da sind wir Gewerkschaften<br />
kompetent. Roboter und<br />
Künstliche Intelligenz ersetzen<br />
menschliche Arbeit. Schlimm?<br />
Nicht, wenn wir die hohe Produktivität<br />
der Maschinen nutzen, um die<br />
Arbeitszeit zu reduzieren und neue,<br />
bessere Arbeit zu schaffen. Ein<br />
uraltes Thema. Der soziale Fortschritt<br />
hängt seit jeher davon ab, ob<br />
wir die Verteilung der steigenden<br />
Produktivität erzwingen können.<br />
1. Schritt: Die Deregulierung<br />
der Arbeit verhindern<br />
Technik und<br />
Politik sind klüger<br />
als Ökonomie. Das<br />
wollen wir nutzen.<br />
Die gute Nachricht lautet: In Zeiten<br />
technologischer und ökonomischer<br />
Umbrüche sind die Umbauprozesse<br />
für eine bestimmte Zeit offen und<br />
unentschieden. Mit ihrer Attacke<br />
auf die geordnete Arbeitsgesellschaft<br />
versuchen die Konzerne, eilig<br />
ein Fait accompli zu schaffen, noch<br />
bevor sie überhaupt substanziell in<br />
die digitalen Techniken investiert<br />
haben: Ist die Arbeit erst einmal<br />
dereguliert und uberisiert, sind die<br />
Spielräume für die andere, soziale<br />
Digitalisierung zu.<br />
Darum werden wir jede<br />
Aufweichung der Arbeitszeitregeln<br />
mit gewerkschaftlichen und<br />
politischen Mitteln verhindern.<br />
Gegen den Versuch, die Arbeitsverträge<br />
gesetzlich zu schwächen, um<br />
die Schein-Selbstständigkeit zu<br />
fördern, hat <strong>syndicom</strong> ein Modell<br />
für einen universellen Arbeitsvertrag<br />
entwickelt, der automatisch für<br />
alle Arbeitsverhältnisse gilt, die<br />
nicht durch einen GAV oder einem<br />
normalen Arbeitsvertrag abgedeckt<br />
sind. Notfalls werden wir ihn per<br />
Volksinitiative durchsetzen. Für<br />
Home-Office-Arbeiten entwickeln<br />
wir Eckwerte, die in die GAV<br />
getragen werden. Um die heimliche<br />
Ausweitung der Arbeitszeit zu<br />
stoppen, wollen wir das Recht auf<br />
Abschalten als Norm installieren.<br />
2. Schritt: Die Arbeitenden schützen<br />
Arbeit in digitalen Zeiten verlangt<br />
zeitgemässen Schutz. So muss die<br />
digitale Steuerung und Kontrolle<br />
der Arbeitenden, der digitale<br />
Taylorismus, offengelegt und<br />
gesetzlich wie im GAV reguliert<br />
werden.<br />
SUVA und Arbeitsmedizin<br />
müssen auf die Belastungen und<br />
Gefahren digitaler Arbeitsplätze<br />
ausgerichtet werden.<br />
Um die Sozialwerke zu garantieren,<br />
müssen Formen gefunden<br />
werden, die Maschinenarbeit per<br />
Robotersteuer an der Finanzierung<br />
von AHV, IV, ALV etc. zu beteiligen.<br />
3. Schritt: Die gesellschaftliche<br />
Debatte erzwingen<br />
Der 1. schweizerische Digitaltag der<br />
Konzerne (siehe Seite 26) machte<br />
klar, dass die Aktionäre und ihre<br />
Politiker einiges unternehmen, um<br />
eine offene Debatte über die Ausrichtung<br />
des digitalen Umbaus zu<br />
bremsen. Wollen wir seine Chancen<br />
packen, brauchen wir eine breite<br />
demokratische Aussprache über die<br />
Ausrichtung der Digitalisierung: Wo<br />
soll investiert werden, mit welcher<br />
Industriepolitik kann sie gesteuert<br />
werden, wie wird die geringer<br />
werdende Arbeit verteilt etc. Von der<br />
öffentlichen Hand verlangen wir eine<br />
gestaltende digitale Gesellschaftspolitik.<br />
Wir haben beschlossen, ein<br />
lebenslanges Recht auf Bildung und<br />
Weiterbildung zu erwirken. Einen<br />
stark ausgebauten und durchgesetzten<br />
Datenschutz. Einen Produktionsfonds,<br />
um sinnvolle Investitionen zu<br />
finanzieren. Und einen digitalen<br />
Service public, der digitale Techniken<br />
und Dienste allen zugänglich<br />
macht.<br />
Heute aber schon ist klar:<br />
Dieser Streit um die digitalen<br />
Chancen wird eine harsche Auseinandersetzung.<br />
Strategie, Thesen, alle Resolutionen im<br />
Detail: <strong>syndicom</strong>.ch/Digitalisierung
26<br />
Digidigihurra!<br />
ist die neue Bürgerpflicht<br />
90 Konzerne, ihre Lobbys,<br />
Bundespräsidentin Doris<br />
Leuthard und neoliberale<br />
Politiker wollen uns digitalen<br />
Enthusiasmus befehlen.<br />
Da bleibt nur eine Frage:<br />
Welche Digitalisierung<br />
meinen sie?<br />
Text: Oliver Fahrni<br />
Tanzende Drohnen, moderierende TV-Roboter, abgesperrte Bahnhöfe, schrille<br />
Inszenierungen und Wortgetöse: So intensiv wird gewöhnlich nur die<br />
Fussball-WM vermarktet. Diesmal ging es, am nationalen Digitaltag vom<br />
21. November, um die angelaufene industrielle Revolution. Ausgerichtet von<br />
Digitalswitzerland, einem Zusammenschluss von Banken, Konzernen,<br />
Verbänden, die sich Mitgliederbeiträge um 50 000 Franken leisten können.<br />
Flankiert von Swisscom, PTT und SBB. Samt Bundesräten als Edelstatisten.<br />
Zwar kommt die Wirtschaft 4.0 gerade dort nicht in die Gänge, wo sie<br />
den Menschen die erhofften Vorteile brächte. Bisher wird Digitalisierung vor<br />
allem zur Vernichtung von lebendiger Arbeit genutzt. Und selbst Topmanager<br />
aus dem Silicon Valley warnen vor entfesselter Künstlicher Intelligenz<br />
und marodierenden Robotern.<br />
Dies alles würde also eine grosse Debatte verdienen. Doch einer solchen<br />
offenen Auseinandersetzung wollten die Konzerne nun zuvorkommen, mit<br />
ihrer Monster-Roadshow und einem 108 Seiten starken Ringier-Prospekt,<br />
600 000-mal verteilt. Begeistert trommelte Bundespräsidentin Doris Leuthard<br />
für die digitale Mobilmachung. Kein Problem. Alles gut. Gring ache u seckle!<br />
Andere wollten da nicht nachstehen. PTT-Chefin Susanne Ruoff präsentierte<br />
einmal mehr ihr «Leuchtturm»-Projekt, den «historischen Durchbruch»,<br />
«weltweit führend»: Die Swiss-ID, die digitale Brandmarke für alle, realisiert<br />
von Swiss Sign, einem Gemeinschaftsunternehmen von Banken, Versicherungen<br />
und öffentlichen Betrieben. Fest im Blick: die Kundendaten.<br />
Spam vom Chef<br />
Wenn SwissSign-CEO Markus Naef versichert, die Daten würden «auf keinen<br />
Fall» kommerziell genutzt und die Datenhoheit bleibe «jederzeit beim Nutzer»,<br />
ist das bestenfalls ein Spam. Naef hofft darauf, dass die Bürgerinnen<br />
und Bürger schon wieder vergessen haben, was sie gerade noch über den<br />
gläsernen Menschen, WhatsApp und Google und Big Data gelesen hatten.<br />
Klar wird eine solche digitale Identität mit Informationen beladen werden –<br />
zum Beispiel über unsere Zahlungsfähigkeit oder unseren Leumund.<br />
Denn das Modell der Digitalisierung durch die Konzerne beruht ja gerade<br />
auf der systematischen Profilierung von jeder und jedem. Kein Konzern<br />
würde sonst Geld in Projekte wie Swiss Sign investieren. Die Erfahrung zeigt:<br />
Mit unseren Daten treiben sie jeden Missbrauch, den das Gesetz nicht explizit<br />
verbietet und die Datenschützer nicht verfolgen. Beides ist hierzulande<br />
schwach: das Gesetz und die Stellen, die das Gesetz durchsetzen sollten.<br />
So soll es auch bleiben, finden die Konzernherren. Ein zentrales Mantra<br />
des Digitaltages hiess: auf keinen Fall neue Regeln. Der Staat soll Daten<br />
liefern, auch jene von Post und Swisscom, und er soll die <strong>Netz</strong>e bauen und<br />
teure Projekte finanzieren – aber sich sonst raushalten. Mehr: Er solle gefälligst<br />
alle Regeln schleifen, die uns vor der Gier der Konzerne schützen, findet<br />
Digitalswitzerland. Etwa die Arbeitszeit-Regeln. So geht die schöne neue<br />
digitale Welt der Aktionäre. Und das Schlimmste dabei ist: Die Landesregierung<br />
teilt diese brutale urkapitalistische Vision.<br />
Darin war die vom Medienkonzern Ringier gesteuerte PR-Show erhellend:<br />
Sie führte uns ihre Digitalisierung vor. Die Digitalisierung ohne die<br />
Arbeitenden, ohne die Gewerkschaften, ohne Konsumenten und ohne die<br />
Zivilgesellschaft. Doch Digitalswitzerland sollte wissen, dass es so nichts<br />
wird, mit der befohlenen Hurra-Zustimmung. Und dem Bundesrat müsste<br />
jemand sagen, dass er auf Irrfahrt ist – gerade wenn Ministerin Leuthard per<br />
Virtual-Reality-Brille enthusiastisch die Eigernordwand durchsteigt.
Wir sind an immer mehr Systeme angehängt, die von uns Daten absaugen.<br />
Konzerne, aber auch Regierungen nutzen diese Daten und digitale Techniken der<br />
Automatisierung für den Totalumbau von Ökonomie und Gesellschaft.<br />
27<br />
Explodierende Datenmengen<br />
16,1<br />
163<br />
ZETTABYTES<br />
2016 2025<br />
Big Data: In der digitalen Welt müssen rasch wachsende<br />
Datenmengen verarbeitet werden. 1 Zettabyte (Zahl mit<br />
21 Nullen) entspricht 36 000 Jahren HD-TV-Sendungen.<br />
3 770 000 000 Menschen nutzen Internet<br />
Amazon<br />
339000 $<br />
Instagram<br />
321000<br />
Pics<br />
Apple<br />
48000<br />
Apps<br />
Tweets<br />
360000<br />
pro<br />
60<br />
sec<br />
Google<br />
5200000<br />
WhatsApp<br />
43750000<br />
Email<br />
253472000<br />
Facebook<br />
3320000<br />
Pro Minute werden 5,2 Millionen Suchanfragen bei Google<br />
gestartet, eine Viertelmilliarde E-Mails versendet und<br />
3,3 Millionen Facebook-Einträge gelikt.<br />
600 bis 700 Megabyte an Daten erzeugt heute ein Mensch.<br />
Täglich. Grob gesagt: 500 dicke Bücher. In drei Jahren soll<br />
sich diese Zahl auf 1,5 Gigabyte mehr als verdoppeln. Eine<br />
immense Datenspur.<br />
Google erhöht seine Speicherkapazität täglich um 1 Petabyte.<br />
Darauf würden 430 Millionen Stunden Film passen. Bei<br />
Facebook fallen jeden Tag 4 Petabyte neue Daten an.<br />
Noch vor wenigen Jahren wären diese Daten einfach ein<br />
Haufen Einsen und Nullen gewesen. Heute können gigantische<br />
Datensätze verknüpft und automatisch ausgewertet<br />
werden. Das geht nur mit immer schnelleren und vernetzten<br />
Rechnern, die bereits Trilliarden von Anweisungen pro<br />
Sekunde ausführen.<br />
<strong>Im</strong> Datenmining werden Profile von Gruppen und<br />
Einzelnen erstellt, mit dem Ziel, unser Verhalten nicht nur zu<br />
analysieren, sondern vorherzusagen und zu steuern.<br />
Amazon weiss schon heute, was ich morgen bestellen werde.<br />
Möglich machen dies komplexe Algorithmen. Die sind so<br />
gebaut, dass sie dazulernen. Jedes Mal, wenn wir einen<br />
Dienst benutzen, trainieren wir einen Algorithmus.<br />
In Milliardenprojekten (wie dem Humanbrainproject der<br />
EU unter Führung der Uni Lausanne) soll das menschliche<br />
Gehirn simuliert werden. Mit expliziten Zielen wie medizinischen<br />
Erkenntnissen oder dem Bau von neuronalen Computern<br />
und impliziten Zielen wie der Verhaltenssteuerung.<br />
Mobile Geräte sind die Voraussetzung für die intensive<br />
Vernetzung.<br />
66 % der Menschheit benutzen heute ein Handy.<br />
<strong>Im</strong> Januar 2017 wurden 8 Milliarden Handy-Verbindungen<br />
geschaltet.<br />
37 % der Menschheit tummeln sich heute auf Social Media.<br />
87 % der Facebook-Nutzer tun dies per Handy.<br />
Die Zahl der Internetbenutzer ist von 2016 auf 2017 um<br />
10 % gewachsen.<br />
Die Roboter übernehmen<br />
7000000<br />
© Grafiken: Tom Hübscher, tnt-graphics<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2012<br />
Roboter/robots/robot<br />
2014 2016 2019<br />
Die Roboterzeit beginnt. Ihre Zahl wächst rasch. Mit<br />
Sensorik und Künstlicher Intelligenz ausgerüstet, arbeitet<br />
ihre jüngste Generation zunehmend autonom.<br />
1 800 000 Industrieroboter waren 2016 im Einsatz, dazu<br />
über eine Million Roboter in anderen Bereichen. Jetzt setzt<br />
die Robotik zum grossen Sprung an. Künstliche Intelligenz<br />
und hochentwickelte Sensoren machen sie fähig, sensible<br />
Arbeiten zu verrichten.<br />
Roboter übernehmen Jobs der Menschen. Noch weit mehr<br />
Arbeitsplätze sind durch den systematischen Computereinsatz,<br />
Big Data, Künstliche Intelligenz und Vernetzung<br />
gefährdet.<br />
800 Millionen Jobs sollen bis 2030 weltweit automatisiert<br />
werden, sagt das McKinsey Global Institute.<br />
47 % aller Jobs könnten durch die Digitalisierung vernichtet<br />
werden, befürchtet eine Studie der Universität Oxford.<br />
Schon in den nächsten 3 Jahren wird die Digitalisierung<br />
5 Millionen Arbeitsplätze zerstören, glaubt das WEF.
28<br />
Recht so!<br />
Fragen an den <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienst:<br />
Guten Tag<br />
Ich gelange an Sie, weil mein Arbeitgeber jedes Jahr einen<br />
Weiter- und Teambildungsanlass mit anschliessendem<br />
gemeinsamem Apéro organisiert. Der Anlass findet jeweils<br />
am Samstag statt, damit der normale Betriebsablauf während<br />
der Arbeitswoche nicht gestört wird. In der Einladung<br />
zum Anlass steht, dass die Teilnahme freiwillig ist und nicht<br />
als Arbeitszeit gilt. Der Arbeitgeber erwartet aber, dass alle<br />
teilnehmen, und verlangt eine schriftlich begründete Abmeldung.<br />
Muss ich am Anlass teilnehmen?<br />
Mein Arbeitgeber vertritt die Meinung, dass für den Anlass<br />
keine Arbeitszeit gutzuschreiben ist, da dieser freiwillig sei.<br />
Das finde ich nicht richtig, und ich habe dies meinem Arbeitgeber<br />
auch gesagt. Dieser lehnt aber kategorisch die<br />
Anrechnung als Arbeitszeit ab. Ist das rechtlich zulässig?<br />
Für den Fall, dass der Arbeitgeber meine Abmeldung nicht<br />
akzeptieren sollte, möchte ich wissen, wie ich vorgehen<br />
muss, damit die Dauer des Anlasses als Arbeitszeit gutgeschrieben<br />
wird. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.<br />
Freundliche Grüsse<br />
Herr M. M., aus Basel<br />
Antwort des <strong>syndicom</strong>-Rechtsdienstes<br />
An einem vom Arbeitgeber als freiwillig<br />
bezeichneten Anlass können<br />
die Arbeitnehmenden teilnehmen<br />
oder sie können fernbleiben. Die<br />
Situation sieht jedoch wegen der klar<br />
geäusserten Erwartungshaltung<br />
anders aus. Aufgrund des Machtgefälles<br />
im Arbeitsverhältnis gerät die<br />
Einladung in die Grauzone zwischen<br />
Wunsch und Weisung. Die Grauzone<br />
wird verlassen, und es liegt definitiv<br />
eine Weisung vor, wenn eine Abmeldung<br />
nicht akzeptiert wird. Ich<br />
empfehle Dir, keinesfalls dem Anlass<br />
unbegründet fernzubleiben, sondern<br />
Dich entweder abzumelden oder<br />
teilzunehmen.<br />
Der springende Punkt ist die Freiwilligkeit:<br />
Die Teilnahme an einem<br />
Anlass muss nicht als Arbeitszeit<br />
gutgeschrieben werden, wenn es den<br />
Arbeitnehmenden frei steht, fernzubleiben.<br />
Akzeptiert der Arbeitgeber<br />
Deine Abmeldung aber nicht, so kann<br />
nicht mehr von Freiwilligkeit gesprochen<br />
werden. Die Einladung wird zur<br />
arbeitsrechtlichen Weisung, und die<br />
Zeit muss als Arbeitszeit gutgeschrieben<br />
werden. Das ergibt sich aus der<br />
Bestimmung von Art. 13 Abs. 1 der<br />
Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz,<br />
wonach als Arbeitszeit diejenige Zeit<br />
gilt, während der sich der Arbeitnehmende<br />
zur Verfügung zu halten hat.<br />
Sollte der Arbeitgeber Deine Abmeldung<br />
nicht akzeptieren, so weise ihn<br />
darauf hin, dass die Teilnahme in<br />
diesem Fall nicht mehr freiwillig,<br />
sondern obligatorisch ist. Konfrontiere<br />
ihn mit den oben erwähnten<br />
Bestimmungen. Sollte der Arbeitgeber<br />
sich dann immer noch weigern,<br />
Dir die Arbeitszeit gutzuschreiben,<br />
dann nimm mit <strong>syndicom</strong> Kontakt<br />
auf. Wir beraten, unterstützen und<br />
vertreten Dich gerne.<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/recht/rechtso
1000 Worte<br />
Ruedi Widmer<br />
29
30 Freizeit<br />
Tipps<br />
© Sébastien Bourquin<br />
Ein Tag, der die Welt und die<br />
Wirtschaft lesbar macht<br />
Ökonomen sind eine seltsame<br />
Zunft. Sie glauben, die Gesetze zu<br />
kennen, die die Welt regieren. Also<br />
die Weltformel zu besitzen. Sie<br />
sehen sich als eine Art Oberwissenschaft,<br />
besser als Philosophie,<br />
realer als Mathematik, wichtiger als<br />
Biologie. Wundern muss uns das<br />
nicht: Das Kapital beherrscht die<br />
Welt. Es belehrt uns gerne, und seine<br />
Ökonomen tun das auch. Dabei<br />
ist Ökonomie, vor allem die beliebte<br />
Betriebswissenschaft, bestenfalls<br />
eine Hilfswissenschaft, die mit<br />
völlig irren Annahmen arbeitet,<br />
schlechtenfalls nackte Ideologie.<br />
Schade. Es wäre so wichtig, mehr<br />
zu wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge.<br />
Doch Movendo hat<br />
die Lösung: die Kurse mit David Gallusser<br />
und Danièle Lenzin. Der<br />
nächste findet am 7. März 2018 in<br />
Zürich statt. Thema: Wie funktioniert<br />
unsere Wirtschaft? Gallusser<br />
ist ein Ökonom der anderen Art. Er<br />
spricht nicht in Geheimsprache. Er<br />
erklärt, mit sehr viel Material und<br />
Kenntnis. Lenzin weiss alles über<br />
Care-Ökonomie und einen feministischen<br />
Wirtschaftsbegriff. Mit ihnen<br />
wird das ein Tag, der die Welt<br />
lesbarer macht.<br />
Übrigens sind sehr viele Movendo-Kurse<br />
bis weit in den Frühling<br />
hinein ausgebucht. Rechtzeitig<br />
planen lohnt sich (siehe Link).<br />
Etwa für den Word- und Excelkurs<br />
im April. Oder für die Gesundheit<br />
am Arbeitsplatz im März. Oder<br />
die Anleitung für den Umgang mit<br />
Konflikten im Mai.<br />
<strong>syndicom</strong> hilft dabei. Auf der<br />
Internetseite «Mit uns auf Kurs»<br />
(siehe Link) gibt sie eine gute Übersicht<br />
über Movendo-Angebote und<br />
die snydicom- und Helias-Kurse.<br />
movendo.ch<br />
<strong>syndicom</strong>-Übersicht; goo.gl/JCKYD8<br />
Flanieren, trinken, hören:<br />
kleine literarische Fluchten<br />
Wo trifft man Gewerkschafterinnen<br />
und Gewerkschafter an? Auf Versammlungen?<br />
<strong>Im</strong>mer mal wieder.<br />
Auf der Strasse? Dort auch. Vor allem<br />
aber: in Buchhandlungen. Sie<br />
lesen noch. Das fällt auf. Es gibt die,<br />
denen historische Romane oder<br />
politische Analysen gefallen. Es gibt<br />
die Eisenbahnerotiker, die sich in<br />
Fachbuchhandlungen wie sinwel in<br />
der Berner Lorraine an istrischen<br />
Damplocks des 19. Jahrhunderts<br />
begeistern. Vor allem sind einige<br />
von uns klammheimlich Krimikenner,<br />
Aficionados südamerikanischer<br />
Literatur oder mit dem grossen<br />
US-Roman per Du.<br />
Für sie beginnt bald die schöne<br />
Saison. Denn mit der Schriftstellerei<br />
ist es wie mit der Popmusik: Wer<br />
schreibt, verdient sein Geld eher mit<br />
Auftritten und Lesungen als mit<br />
dem Verkauf der Bücher. Darum<br />
sind in den letzten Jahren zahlreiche<br />
Literaturfestivals aus dem<br />
Boden geschossen.<br />
Kein Dorf mehr ohne Literaturtage.<br />
Jedes Festival hat seine eigene<br />
Ambiance. Das sind gute Orte, um<br />
die Seele baumeln zu lassen und<br />
nebenbei klüger zu werden, indem<br />
man flaniert, trinkt, plaudert, hört<br />
und liest, wandert, sich in Bergen<br />
oder Altstädten tummelt. Dabei<br />
sind die Literaten oft eine angenehme<br />
Gesellschaft. Und fast immer ist<br />
das erschwinglich. Anders als Marbella<br />
auf jeden Fall.<br />
Zum Beispiel am Berner Literaturfest<br />
(22. bis 26. August). Eine<br />
Stadt wird zur Bühne.<br />
Zum Beispiel in Leukerbad<br />
(29. Juni bis 1. Juli). Lesungen in<br />
Bad und Schlucht, grossartig.<br />
Oder Erzählzeit ohne Grenzen in<br />
Singen/Schaffhausen (7. bis<br />
15. April). Achtung: literarischer<br />
Grenzverkehr.<br />
berner-literaturfest.ch,<br />
leukerbad: goo.gl/a9DgT3<br />
erzaehlzeit.com<br />
© Hartwig Klappert<br />
Vom Sinn des Streiks<br />
im dritten Jahrtausend<br />
Vor einem Jahrhundert, im November<br />
1918, fand der einzige landesweite<br />
Generalstreik der Schweiz<br />
statt. Unter anderem forderten die<br />
Arbeitenden den Achtstundentag,<br />
die Einführung des Frauenstimmrechts<br />
und die Schaffung einer AHV.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg schlief<br />
die Tradition des Streiks ein. Unter<br />
dem Einfluss der Arbeitgeberpropaganda<br />
glaubten viele sogar, Streiken<br />
sei in der Schweiz gesetzeswidrig.<br />
Die harte Arbeitgeberpolitik in den<br />
1990er-Jahren zwang Belegschaften<br />
mehrmals, den Arbeitsfrieden zu<br />
brechen. Darauf wurde das Streikrecht<br />
in der Bundesverfassung verankert.<br />
Über 300-mal traten Belegschaften<br />
seither in Ausstand. Hier knüpft<br />
dieser Band an. Diverse Autoren<br />
zeichnen die wichtigsten Streiks der<br />
letzten Jahre nach: von der Basler<br />
Zentralwäscherei über die Arbeitsniederlegung<br />
bei Novartis am<br />
16. November 2011 bis zum 33-tägigen<br />
Streik in den SBB-Werkstätten<br />
in Bellinzona. In Geschichten und<br />
Bildern erfahren wir, dass jeder<br />
Streik anders ist, aber in der Regel<br />
auf Sympathie in der Bevölkerung<br />
stösst. Kollektive Aktionen fördern<br />
die Solidarität, sogar in Sektoren,<br />
die keine Streik tradition kennen.<br />
In Interviews wägen Vania Alleva,<br />
Paul Rechsteiner und Enrico Borelli<br />
die Zukunft des Streiks und seine<br />
neuen Formen.<br />
Vania Alleva und Andreas Rieger (Hg.),<br />
Streik im 21. Jahrhundert, Rotpunktverlag,<br />
168 Seiten, CHF 25.−
Anzeigen<br />
7 %<br />
Rabatt!<br />
Mit Reka-Geld liegt für<br />
<strong>syndicom</strong>-Mitglieder mehr drin.<br />
Als Mitglied beziehen Sie bei <strong>syndicom</strong> Reka-Geld mit<br />
7 % Rabatt. Alle 9‘000 Annahmestellen in der ganzen<br />
Schweiz fi nden Sie unter rekaguide.ch<br />
Mit Reka liegt mehr drin.<br />
Reka_2015_Syndicom_NEU_d.indd 1 03.08.15 12:06<br />
graphic design: www.up-design.ch<br />
Stellenabbau, Monopolisierung, Einheitsbrei, Überstunden bis zum<br />
Umfallen, Einsamkeit im Grossraumbüro?<br />
Als starke und engagierte Gewerkschaft wehren wir uns für die freie<br />
Berichterstattung, die Medienvielfalt, gute Arbeitsbedingungen, den<br />
GAV und einen unabhängigen audiovisuellen Service public.<br />
Für eine demokratische, gut informierte Gesellschaft!<br />
Werde Mitglied und stärke unsere Bewegung: www.<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Wir sagen NEIN zu «No Billag»<br />
Démantèlement, monopolisation, uniformisation des médias, heures sup’<br />
jusqu’à épuisement, newsrooms dépersonnalisées ?<br />
En tant que syndicat fort et engagé, nous défendons le journalisme,<br />
la diversité des médias, les bonnes conditions de travail, la CCT et le<br />
service public des médias audiovisuelles.<br />
Pour une société démocratique, bien informée !<br />
Devenez membre et renforcez le mouvement : www.<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Nous disons NON à «No Billag»<br />
Smantellamento, monopolizzazione, uniformazione dei media,<br />
ore supplementari fino all’esaurimento, newsroom depersonalizzate?<br />
In qualità di sindacato forte e impegnato difendiamo il giornalismo,<br />
la diversità dei media, le buone condizioni di lavoro,<br />
il CCL e un servizio pubblico dei media audiovisivi indipendenti.<br />
Per una società democratica e ben informata!<br />
Diventa socio e rinforza il movimento: www.<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Diciamo NO a «No Billag»
32 Bisch im Bild Einige <strong>Im</strong>pressionen vom Kongress der <strong>syndicom</strong> am 10. und 11. November in<br />
Basel. Rund 400 Delegierte aus 13 Berufsfeldern und Gäste diskutierten unter<br />
dem Stichwort Arbeit 4.O eine umfassende Strategie und ein Manifest<br />
zum digitalen Umbau. Zudem gab sich die Gewerkschaft eine neue Leitung.
Fotografiert hat diese Bilder Fee Peper von ©Arts Vivants Produktionen. Mit einer Ausnahme: Das Foto der vier fröhlichen Damen<br />
auf Seite 32 wurde uns zur Verfügung gestellt.<br />
33
34<br />
Aus dem<br />
Leben von ...<br />
Mario Ramlow<br />
Der Blick fürs Technische<br />
1967 im Berliner Osten geboren, lernte<br />
Mario Ramlow Elektriker. Nach dem<br />
Mauerfall erwarb er sich an der<br />
Hochschule der Deutschen Telekom<br />
den Diplom-Ingenieur in Nachrichtentechnik.<br />
Seinen ersten Job fand er im<br />
Festnetz. 2001 stieg er bei Mobilcom<br />
in den Mobilfunk ein. Als die Firma<br />
zuging, machte sich Ramlow selbstständig.<br />
Die Alpine-Energie holte ihn<br />
2005 in die Schweiz. Heute leitet er bei<br />
Cablex als Projektmanager System<br />
Engineering den Bereich Tunnelanlagen<br />
im wachsenden Mobilfunkgeschäft. Er<br />
ist Mitglied des Firmenvorstandes und<br />
der Personalvertretung.<br />
Text: aufgezeichnet von Bo Humair<br />
Bild: Peter Mosimann<br />
Das neueste <strong>Netz</strong> ist<br />
immer schon das alte.<br />
«Zirkelt so ein Riesenkahn in den<br />
Hafen und macht seine Anlegemanöver,<br />
ist das schon genial. Ich bin<br />
gerne auf dem Wasser, ich hätte<br />
auch Seemann werden können. Oder<br />
Sportjournalist, wie mein Vater. Der<br />
kam in der Welt rum. Doch ich habe<br />
Elektriker gelernt. Es war die Zeit des<br />
Mauerfalls, eine intensive Zeit.<br />
Später habe ich Nachrichtentechnik<br />
studiert. Letztendlich ist es o.k.<br />
Ich machs halt und fühle mich wohl<br />
dabei. Technik liegt mir. Wer das gut<br />
macht, der steckt nicht einfach Teile<br />
zusammen, der hat einen Blick fürs<br />
Technische.<br />
Der besondere Reiz besteht darin,<br />
das ständig Erneuerte, das Unbekannte<br />
zu verstehen und damit<br />
funktionierende <strong>Netz</strong>e für die<br />
Menschen zu bauen. Vor ein paar<br />
Jahren haben wir noch Koaxialkabel<br />
verlegt, dann kam die Glasfaser. In<br />
der Nachrichtentechnik verändern<br />
sich die Dinge schnell. Jetzt wird mit<br />
der 5G-Funktechnik vieles zusammenwachsen,<br />
in hoher Kapazität und<br />
mit rasenden Übertragungsraten. Es<br />
geht um Gigabit/Sekunde. Wir<br />
beginnen gerade damit. Eines lernt<br />
man als <strong>Netz</strong>bauer: Steht ein <strong>Netz</strong><br />
erst einmal, wird schon das nächste<br />
gebaut.<br />
So wie es aussieht, wird der<br />
Funkbereich jetzt schnell wachsen.<br />
2018 werde alles mehr, sagt man bei<br />
Cablex. Wir hatten eine harte Zeit.<br />
Und die Umstrukturierung der Firma<br />
war heftig. Als Personalvertretung<br />
kamen wir mit unserer Mitwirkung<br />
an Grenzen, wir wurden zwar<br />
informiert. Aber die Ereignisse<br />
haben uns überrollt.<br />
Als ich in die Personalvertretung<br />
rutschte, trat ich <strong>syndicom</strong> bei.<br />
Darum gerissen habe ich mich nicht,<br />
nach meiner obligatorischen<br />
Mitgliedschaft beim Freien Deutschen<br />
Gewerkschaftsbund damals<br />
im Osten. In Berufen wie meinem<br />
macht man nicht viel Aufhebens um<br />
Überstunden oder Ähnliches. Wir<br />
improvisieren, tüfteln, finden<br />
Lösungen. Und muss in irgendeiner<br />
Ecke des Landes noch eine Anlage<br />
abgebaut werden, macht man das,<br />
klar, auch wenn es nicht im Pflichtenheft<br />
des Ingenieurs steht. Doch<br />
gerade die qualifizierten Berufsleute<br />
sollten in die Gewerkschaft. Denn<br />
erst wenn man bei <strong>syndicom</strong> dabei<br />
ist, merkt man, wie viel die Gewerkschaft<br />
bringt und tut. Niemand sollte<br />
sich da etwas vormachen: Nur die<br />
Gewerkschaft bewirkt korrekte<br />
Arbeitsverhältnisse. Vor allem in<br />
Branchen, wo am Ende des Tages<br />
schon alles anders ist als am Morgen.<br />
Cablex wird vermutlich Leute<br />
einstellen müssen, für den wachsenden<br />
Mobilfunk. Wir haben viele gute<br />
Berufsleute hier. Schweizer und<br />
Kollegen aus diversen Ländern. Zum<br />
Beispiel Tschechen. Sie sind gut<br />
ausgebildet, rasch in der Auffassungsgabe<br />
und sie arbeiten draussen<br />
viel weg. Sie haben ihren Anteil<br />
daran, dass das Schweizer <strong>Netz</strong><br />
besser ist als die <strong>Netz</strong>e unserer<br />
Nachbarn.»<br />
<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/netzinfrastruktur
<strong>Im</strong>pressum<br />
Redaktion: Marie Chevalley, Giovanni Valerio,<br />
Oliver Fahrni<br />
Tel. 058 817 18 18, redaktion@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Porträts, Zeichnungen: Katja Leudolph<br />
Fotos ohne ©Copyright-Vermerk: zVg<br />
Layout und Korrektorat: Stämpfli AG, Bern<br />
Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Bern<br />
Adressänderungen: <strong>syndicom</strong>, Adressverwaltung,<br />
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern<br />
Tel. 058 817 18 18, Fax 058 817 18 17<br />
Inserate: priska.zuercher@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abobestellung: info@<strong>syndicom</strong>.ch<br />
Abopreis ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen. Für<br />
Nichtmitglieder: Fr. 50.– (Inland), Fr. 70.– (Ausland)<br />
Verlegerin: <strong>syndicom</strong> – Gewerkschaft<br />
Medien und Kommunikation, Monbijoustr. 33,<br />
Postfach, 3001 Bern<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Magazin erscheint sechsmal im Jahr.<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 4 erscheint am 23. März 2018<br />
Redaktionsschluss: 11. Februar 2018.<br />
35<br />
Das <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsel<br />
Ideal für alle, die sich verwöhnen<br />
wollen: Zu gewinnen gibt es ein<br />
beliebtes Cold Pack, gespendet von<br />
unserer Dienstleistungspartnerin KPT.<br />
Das Lösungswort wird in der nächsten<br />
Ausgabe zusammen mit dem Namen der<br />
Gewinnerin oder des Gewinners<br />
veröffentlicht.<br />
Lösungswort und Absender auf einer<br />
A6-Postkarte senden an: <strong>syndicom</strong>-<br />
Magazin, Monbijoustrasse 33, Postfach,<br />
3001 Bern. Einsendeschluss: 20.2.18<br />
Der Gewinner<br />
Die Lösung des <strong>syndicom</strong>-Kreuzworträtsels<br />
aus dem <strong>syndicom</strong>-Magazin<br />
<strong>Nr</strong>. 2 lautet: GRENZGAENGER. Gewonnen<br />
hat Peter Bohren aus Thayngen. Die<br />
Hotelcard unserer Partnerin Hotelcard<br />
ist unterwegs. Wir gratulieren herzlich!<br />
Anzeige<br />
Stellenabbau, Monopolisierung, Einheitsbrei,<br />
Überstunden bis zum Umfallen,<br />
Einsamkeit im Grossraumbüro?<br />
Als starke und engagierte Gewerkschaft wehren wir<br />
uns für die freie Berichterstattung, die Medienvielfalt,<br />
gute Arbeitsbedingungen, den GAV und einen<br />
unabhängigen audiovisuellen Service public.<br />
design: www.up-design.ch<br />
Für eine demokratische, gut informierte Gesellschaft!<br />
Wir sagen NEIN zu «No Billag»
36 Inter-aktiv<br />
<strong>syndicom</strong> social<br />
INSTAGRAM 18.12.2017<br />
<strong>syndicom</strong> ist jetzt auch auf Instagram<br />
unterwegs! Dort zeigen wir die schönsten<br />
Bilder unserer Aktionen und vieles<br />
mehr. instagram.com/<strong>syndicom</strong>.<br />
Folgen Sie uns!<br />
FACEBOOK – KLAMAUK-Video 12.12.2017<br />
Martin Schwab – Mir scheint, dass der Bundesrat eher die<br />
Interessen der Wirtschaft vertritt als die Wüsche und<br />
Aufträge der Bevölkerung.<br />
WEB <strong>syndicom</strong>.ch 19.09.2017–19.12.2017<br />
ENDE NETZNEUTRALITÄT 14.12.20177<br />
<strong>Im</strong> offenen Web fliessen alle Daten<br />
gleich schnell durch die <strong>Netz</strong>e.<br />
Die Trump-Regierung hat diesen<br />
Grundsatz nun annulliert. Jetzt<br />
kommt das 2-Klassen-Internet. Das<br />
ist eine schlechte Nachricht<br />
für alle Benutzer, ausser für die<br />
grossen Provider und privilegierten<br />
Konzerne.<br />
Seit unsere neue Webseite online ist, hatten wir fast<br />
124 000 Pageviews, davon 23 500 via Smartphone, und<br />
fast 40 000 Sessions, davon 10 300 via Smartphone!<br />
SYNDICOM KONGRESS 2017 11.11.2017<br />
#syndicongress17 – Während unseres<br />
Kongresses in Basel wurden unsere<br />
Tweets mehr als 50 000-mal gelesen! Wir<br />
waren ein Topthema in Europe!<br />
MY.SYNDICOM 19.9.2017–19.12.2017<br />
Das Mitgliederportal my.<strong>syndicom</strong> ging<br />
am 20.9.2017 online, zusammen mit der<br />
neuen Website von <strong>syndicom</strong>. Bis heute<br />
haben sich bereits 1163 Mitglieder<br />
registriert. Sind Sie schon mit dabei?<br />
TWITTER – ApiyoAmolo 11.11.2017<br />
#<strong>syndicom</strong>kongress17 – Resolution für eine kämpferische<br />
<strong>syndicom</strong> ist ohne Gegenwehr angenommen. Yes, wir<br />
kämpfen!<br />
Facebook 30.11.2017<br />
TWITTER – Paul Rechsteiner 11.11.2017<br />
#syndikongress17 – NoBillag, das Risiko ist, die Schweiz<br />
zu berlusconisieren!<br />
Unser zuletzt meist gelesener und<br />
geteilter Post war: «Syndicom<br />
Kampagne erfolgreich! Das Postgesetz<br />
muss überarbeitet werden!»<br />
2060 haben die Nachricht gesehen,<br />
72-mal wurde sie gelikt und 16-mal<br />
geteilt! Danke!<br />
STELLENAUSSCHREIBUNGEN 17.12.2017<br />
Unsere Stellenausschreibungen stellen wir jetzt auch auf<br />
die Sozialen Medien Facebook, Twitter und Instagram.<br />
Folgen Sie uns, um jederzeit auch übers Smartphone<br />
informiert zu sein!<br />
ZAHLEN – FACEBOOK IN DER SCHWEIZ 2017<br />
4,2 Mio. Benutzer, 2 Mio. Frauen,<br />
2,2 Mio. Männer, 2,4 Mio. Deutschsprachige,<br />
1,2 Mio. Französischsprachige,<br />
470 000 Italienischsprachige,<br />
260 000 Spanischsprachige.<br />
1,9 Mio. zwischen 19 und 30 Jahre alt.<br />
250 000 zwischen 13 und 18 Jahre alt.


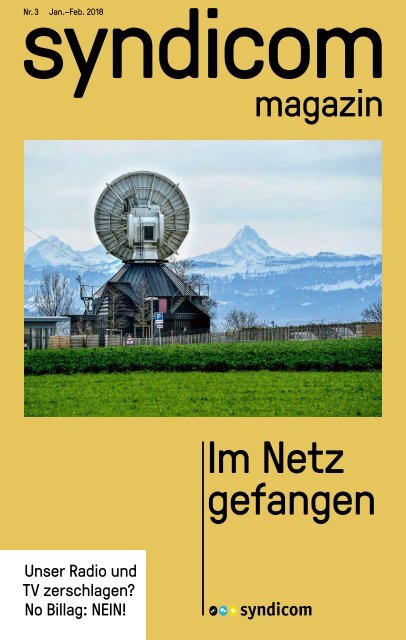


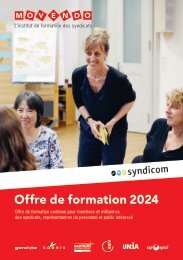



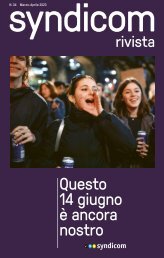

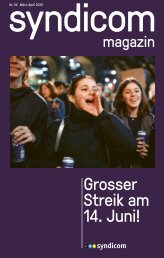


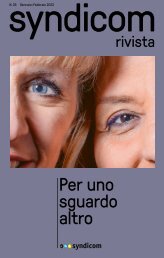
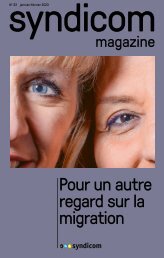
![2202456_[230122]_Syndicom_33_2023_DE_LOW_150_dpi](https://img.yumpu.com/67501302/1/164x260/2202456-230122-syndicom-33-2023-de-low-150-dpi.jpg?quality=85)