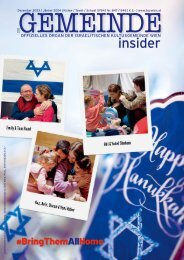Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN
#2, Jg. 9 | Februar 2020 | Shwat, Adar 5780 | € 4,90 | wina-magazin.at
Österreichische Post AG / WZ 11Z039078W / JMV, Seitenstetteng. 4, 1010 Wien / ISSN 2307-5341
KAMPF GEGEN
• Antisemitismus
Ein Blick in das Regierungsprogramm von Türkis-Grün
• Vergessen
Der Verein erinnern.at und die AG Frauen im Exil sammeln
Erinnerungen und lassen die NS-Verbrechen nicht vergessen
• Radikalisierung
Jugendanwalt Nik Nafs Arbeit für eine wirksame Integration
Nachrichten
Meinung
Magazin
Wir geben Ihnen unser
Wort. Täglich aufs Neue.
Lesen und erleben Sie
Journalismus in höchster
Qualität, digital neu
gedacht und händisch
kuratiert für maximales
Lesevergnügen.
„Die Presse“
DIGITAL
jetzt um nur
18 €
pro Monat
Keine höhere Macht,
sondern ganz normale
Menschen, haben das Tor
zur Hölle von Auschwitz-
Birkenau geschmiedet.
Editorial
Vor 75 Jahren haben die Soldaten der sowjetischen Armee die
Tore zur Unterwelt geöffnet und die wenigen Überlebenden
des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau von ihren unvorstellbaren
Qualen befreit.
Auschwitz wurde zur Zäsur in der Geschichte der westlichen Welt
und steht für all das, was nicht Menschlichkeit ist. Für das Unvorstellbare
und Unbegreifbare. Für das Ende einer Gesellschaft, die sich aus
den Fängen dieser Hölle nie wieder wirklich befreien konnte.
Auschwitz stellt uns jene Fragen, die sich davor niemand
zu stellen getraut hätte: Kann noch an G-tt oder an das Gute
im Menschen geglaubt werden? Gibt es noch Kunst nach
Auschwitz? Haben die Überlebenden die Hölle wirklich
überlebt, und wie weit tragen wir sie alle ein Stück in uns
weiter? Was macht Auschwitz mit den Nachgeborenen? Und
was bedeuten Schuld, Pflicht und Vergebung nach den Krematorien?
Doch die Antworten auf all diese Fragen können
weder Auschwitz noch die dort vernichteten Seelen noch die
immer leiser werdenden Zeitzeugen geben. Und vor allem
kann die Frage nicht beantwortet werden, wie all das geschehen
konnte. Wie wurden ganz normale Menschen zu hassenden,
mordenden Bestien werden – und wie konnten Millionen
zu Opfern dieses tobend-geordneten Wahns werden?
Wir haben unzählige Antworten darauf – doch die eine
Antwort gibt es nicht. Hätten wir sie, so hätte die Gesellschaft
danach alles getan, um auch nur annähernd Ähnliches
zu verhindern – doch Tötung aus „rassistisch motivierten“
Gründen gab es auch nach 1945 – und auch in Europa.
Die Zahl der Chancen, Hoffnungen, Lieben und der Gelächter,
die in Auschwitz vernichtet wurde, ist nicht messbar
und vor allem nicht begreifbar. Generationen tragen die
Vernichtungslager in ihren Genen – ihr Denken, Fühlen
und Glauben wird noch durch die Gaskammern mitbestimmt.
Auschwitz ist ein Ort, ein Friedhof, eine Gedenkstätte.
Auschwitz ist eine Warnung, eine Alarmglocke, das
lauteste Signal, um daran zu erinnern, wozu der Mensch
fähig ist, wohin Rassismus, Verleumdung humanistischer
Werte und moralischer Zerfall führen.
75 Jahre nach der Befreiung leben wir in einer Welt, in der gesellschaftliche
Regeln und Normen infrage gestellt werden. In der die Gesellschaften
sich immer mehr polarisieren und isolieren. Eine Welt der
Ismen, die immer heftiger das Sprechen, Denken und Fühlen vergiften.
Die Gedenkkultur sollte sich heute nicht mehr im Erinnern erschöpfen,
denn sie ist eines der stärksten Instrumente im Kampf gegen den neuerlichen
Zerfall humanistischer und liberaler Werte. Sie hat die Möglichkeit,
uns alle daran zu erinnern, dass das Schienennetz in die Krematorien
über viele kleine Wiesenwege führte und dass die Aufseher
in Auschwitz nicht über Nacht durch böse Magie plötzlich verzaubert
wurden, sondern ganz normale Menschen waren, die aus Gier und Neid
und angeheizt durch das Streichholz populistischer Parolen ihre moralische
Grenzen zunehmend fallen ließen. Wir leben heute in einer anderen
Welt, und es sind nicht die gleichen Menschen. Aber es ist das gleiche
Böse. Doch das Böse ist kein Wesen, ist nicht Auschwitz, sind nicht
die miesen Ismen. Das Böse ist vermutlich etwas, das nur wir Menschen
im Menschen erkennen und aufhalten können. Denn das Böse ist keine
höhere Macht, sondern sehr menschlich.
Julia Kaldori
„Es gibt die
Ungeheuer,
aber sie sind zu
wenige, als dass
sie wirklich gefährlich
werden
könnten. Wer
gefährlich ist,
das sind die
normalen
Menschen“
Primo Levi
© Markus Schreiber / AP / picturedesk.com
wına-magazin.at
1
S. 42
Mateja Koležnik widmet sich mit
ihrer Inszenierung des Einakters
Der Henker dem Werk der vergessenen
Schriftstellerin Maria Lazar.
INHALT
OFFENLEGUNG GEM. § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:
Jüdische Medien- und Verlags GmbH,
Seitenstettengasse 4, A-1010 Wien
Unternehmensgegenstand:
Herausgabe und Vertrieb des Magazins WINA
(10 x jährlich), diverse Sonderausgaben sowie
Betrieb des gleichnamigen Internetportals
wina-magazin.at
Geschäftsführung:
Jüdische Medien- und Verlags GmbH,
vertreten durch Julia Kaldori
Eigentumsverhältnisse:
Israelitische Kultusgemeinde Wien IKG (100 %)
Die IKG ist weiters Eigentümer des Magazins
Gemeinde Insider.
IMPRESSUM:
Medieninhaber (Verlag):
JMV – Jüdische Medien- und Verlags-
GmbH, Seitenstettengasse 4, 1010 Wien
Chefredaktion: Julia Kaldori,
office@jmv-wien.at
Redaktion/Sekretariat:
Inge Heitzinger (T. 01/53104–271)
Anzeigenannahme:
Manuela Glamm (T. 01/53104–272)
Redaktionelle Beratung: Matthias Flödl
Artdirektion: Noa Croitoru-Weissmann
Web & Social Media: Agnieszka Madany
Lektorat: Angela Heide
Druck: Print Alliance HAV Produktions GmbH.
MENSCHEN & MEINUNGEN
08 Kampf gegen Antisemitismus
Ein Blick in das Regierungsprogramm
von Türkis-Grün hinsichtlich Antisemitismus,
Rechtsextremismus, Erinnerungskultur
und Provenienzforschung.
10 „Erfolgreich scheitern“
Seit 20 Jahren kämpft der Verein
erinnern.at gegen das Vergessen
nationalsozialistischer Verbrechen.
Werner Dreier ist von Anfang an dabei.
13 Zwei Ringe der Erinnerung
Seit Kurzem hat die obersteirische
Stadt Judenburg ein Denkmal für ihre
einstige jüdische Gemeinde.
16 Lebensgeschichten im Exil
Die AG Frauen im Exil forscht zu Lebensgeschichten
von Frauen, die aus
Österreich geflüchtet sind.
19 Auswirkungen von Migration
Wie man mit spärlichem Material
eine ganze Familienchronik entstehen
lässt, zeigt der Historiker Pablo Rudich
in seiner Masterarbeit auf.
S. 35
Style-Vorlage. Im grauen
Februar beschäftigt sich WINA
mit der wahrscheinlich schönsten
Jugendkultur der Welt: den Mods!
20 „Zumeist die anderen“
Barbara Serloth zeigt in ihrem Buch
Nach der Shoah auf, wie hartnäckig
sich auch nach 1945 die antijüdischen
Vorurteile gehalten haben.
21 Die Rechte lässt grüßen
Politikwissenschaftler Matthias Falter
analysierte Nationalratsdebatten der
letzten Jahre und wie oft es dabei um
Rechtsextremismus ging.
22 „Abwertungen sind das Übel“
Der Wiener Kinder- und Jugendanwalt
Ercan Nik Nafs kämpft gegen die Radikalisierung
von Jugendlichen und
für eine wirksame Integration.
„Für FPÖ-
Wähler und Klimawandel-Leugner
habe ich kein
Verständnis.“
Shoshana Duizend-Jensen
S. 28
2 wına | Februar 2020
KULTUR
28 MenTschen
Als eine der ersten Frauen wurde
Shoshana Duizend-Jensen 2019
Mitglied des Tempelvorstands der IKG
und erhielt den Leon-Zelman-Preis.
30 „Wie eine Ziehharmonika“
Die unentbehrliche jüdische US-Hilfsorganisation
Joint Distribution Committee
schließt nach 100 Jahren ihre Pforten
in Wien.
32 Ein Wiener rettet New York
Der kürzlich verstorbene Felix Rohatyn
organisierte in den 1970er-Jahren die
Sanierung der insolventen Stadtverwaltung
der US-Metropole.
36 Florentin – bunt und anders
Die trendige Nachbarschaft im Süden
Tel Avivs ist laut der New Yorker
„Thrillist“ bei Insidern gleich nach New
Yorks Williamsburg gereiht.
42 Aus anderer Perspektive
Seit 2016 lebt der Israeli Itai Gruenbaum
in Wien. Das Leben hier gefällt
ihm gut. Am liebsten wäre ihm aber
ein Mix aus beiden Welten.
44 Entdeckung einer Begabten
Regisseurin Mateja Koležnik hat mit
Der Henker der vergessenen großen
Schriftstellerin Maria Lazar wieder
eine Stimme gegeben.
Coverfoto: Yonatan Sindel © flash 90
WINASTANDARDS
01 Editorial
24 Nachrichten aus Tel Aviv
Gisela Dachs über Gruppenzugehörigkeit
und Wahlverhalten in Israel
26 Warum Wien
Eine private Neuorientierung führte
Maurice Samuel Aigner nach Wien
34 Generation unverhofft
Wie Benjamin Abramov die
Spiritualität für sich entdeckte
35 WINA_Lebensart
Mods: die wahrscheinlich schönste
Jugendkultur der Welt
38 WINA_kocht
Wie stößt man mit Kindern auf das
Neujahrsfest der Bäume an?
39 Matok & Maror
Das iberische Tapas-Lokals Lola
41 Urban Legends
Alexia Weiss über weniger
Streamen für den Klimaschutz
46 KulturKalender
WINA-Tipps für den Februar
48 Das letzte Mal
Die Wiener Sängerin Isabel Frey über
Hoffnung in den Händen
„Wir haben uns mit
vielen Wissenschaftlerinnen
beschäftigt, und auch da sieht
man deutlich, dass sich Karrieren
entwickeln konnten,
die in Österreich
niemöglichgewesen
wären.“
Ilse Korotin
WINA ONLINE:
wina-magazin.at
facebook.com/winamagazin
S. 17
Die Historikerin und
Soziologin Ilse Korotin
leitet aktuell die 2002
gegründete Frauen-AG
und beschäftigt sich mit
Lebensgeschichten von
Frauen im Exil.
wına-magazin.at
3
12 wına | Dezember 2019
INTERVIEW MIT NOAH SCHEER & TALYA GOLDBERGER
diesen Herbst zum Präsidenten und zur Vizepräsidentin
der Jüdischen Österreichischen HochschülerInnen
gewählt. Auch sie wollen wie ihre Vorgänger an
der Spitze der jüdischen Studierenden die JÖH als
laute politische Stimme verstanden wissen.
Interview: Alexia Weiss, Fotos: Daniel Shaked
Talya Goldberger
und Noah Scheer.
Starke Stimmen
für die Jüdischen
Österreichischen
HochschülerInnen.
WINA: Die JÖH hat sich mit Benjamin Guttmann
und Benjamin Hess in den letzten Jahren sehr politisch
positioniert und ist klar gegen rechts und auch
gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ aufgetreten.
Wollen Sie diesen Kurs fortsetzen?
Noah Scheer: Ja! Die JÖH ist eine Organisation,
die die Interessen ihrer Mitglieder vertritt, und das
heißt für mich, gegen rechts und gegen Antisemitismus
aufzutreten. Die FPÖ ist für mich eine antisemitische
Partei, und deshalb ist es für mich ein
Auftrag der Mitglieder, gegen die FPÖ zu sein, aber
auch gegen die Normalisierung der Beziehungen
mit der FPÖ.
Warum ist es Ihnen als Studierendenorganisation
wichtig, sich auch politisch zu äußern?
Talya Goldberger: Wir sind die Stimme jüdischer
Studierender. In den letzten Jahren und insbesondere
in der letzten Regierungsperiode ist Antisemitismus
ein sehr präsentes Thema in Österreich.
Daher ist es wichtig, auch als JÖH lautstark aufzutreten
und dem Diskurs eine zweite jüdische
Stimme hinzuzufügen.
Noah: Ich glaube, dass sich junge Menschen heute
anderen Herausforderungen gegenüber sehen als
die Generation ihrer Eltern oder Großeltern. Ich
kann mir nicht vorstellen, wie mein Vater in den
1950er-Jahren in Wien aufgewachsen ist. Aber ich
weiß, wie es ist, heute in Österreich aufzuwachsen.
Wir fühlen uns grundsätzlich von der IKG repräsentiert,
aber junge Leute haben einen anderen Alltag.
Deshalb ist es wichtig, dass wir eine zweite Meinung
abgeben. Die jüdische Gemeinde ist nicht so
groß, und es ist schön, wenn wir mit einer Stimme
auftreten. Doch begrenzt das auch die Vielfältigkeit
des Dialogs. Wir wollen daher, dass es auch
eine junge jüdische Stimme gibt.
Sind Sie in Ihrem Alltag mit Antisemitismus konfrontiert?
Talya: Nein, ich persönlich in Wien noch nicht. Ich
muss allerdings anmerken, dass aus meinem Freundeskreis
in Deutschland antisemitische Übergriffe
berichtet wurden.
Noah: Ich bin in Graz aufgewachsen, wo es viel weniger
Juden gibt als in Wien. Ich persönlich habe
in der Schule Probleme gehabt. Mein Vater hat damals
gesagt, das ist, „weil du a Jud bist“. Ich habe
dem nie ganz zustimmen können.
Was für Probleme waren das?
Noah: Ich wurde eine Zeit lang gemobbt. Was interessant
daran war, dass es sich sehr auf meine
DIE JÜDISCHEN
ÖSTERREICHISCHEN
HOCHSCHÜLERINNEN
(JÖH)
wenden sich an alle
jüdischen Studierenden
in Österreich. Zum neuen
Vorsitzenden wurde diesen
Herbst Noah Scheer (geb.
1995 in Graz, aufgewachsen
in Graz und Hod Hasharon,
derzeit Master-Studium
der Humanmedizin an der
Sigmund-Freud-Universität
in Wien) gewählt, zu
seiner Stellvertreterin Talya
Goldberger (geb. 2000 und
aufgewachsen in Wien, derzeit
Diplomarbeit am Kolleg
für Grafik und Kommunikationsdesign
an der Höheren
Graphischen Bundes-Lehranstalt).
Insgesamt besteht
der Vorstand nun aus fünf
Frauen und zwei Männern.
Die weiteren Mitglieder
des Boards sind: Rahel
Esther Laubsch, Mark Elias
Napadenski, Lara Masliah-
Gilkarov, Eden Babacsayv
und Lara Guttmann.
joeh.at
INKLUSION EMPOWERMENT
„große“ Nase bezogen hat, die man doch als stereotypisch
jüdisch bezeichnen könnte. Mein Vater
hat diese Connection hergestellt. Ich habe es nicht
als antisemitisch verstanden, meine Schulkollegen
leugnen das bis heute, aber vielleicht war es unterbewusst
doch antisemitisch. Auf der Uni verstecke
ich es nicht, dass ich jüdisch bin, und werde weder
angefeindet noch sonst etwas.
Dann gibt es aber doch solche Begebenheiten: Bei
der letzten Uniparty, zu der ich gegangen bin, stehe
ich in der Schlange, da kommt ein anderer herein,
und der, der neben mir steht und den ich nicht
kenne, begrüßt ihn mit einem Holocaust-Joke. Und
ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los. Man
nimmt sich immer vor, dass man in so einem Fall
groß redet, und dann ist man überfordert. Deswegen,
glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht so tut,
als gäbe es das nicht, weil es vielen in Wien und in
Europa schon passiert ist. Man muss den Tatsachen
ins Auge schauen, dass viele Menschen in Österreich
antisemitische Bemerkungen machen oder
irgendeinen Blödsinn zu Israel sagen, der eigentlich
antisemitisch ist. Manchmal aus Unwissenheit.
Manchmal aus Intoleranz. Manchmal, weil sie sich
dabei nichts gedacht haben. Und manchmal, weil
Menschen direkt gegen Juden hetzen. Das passiert,
und deshalb darf man das die Menschen nicht vergessen
lassen.
Wie sehen Sie die Zukunft junger Jüdinnen und
Juden in Österreich?
Talya: Wien ist für Juden eine gute Stadt. Die jüdische
Gemeinde bietet Infrastruktur für die unterschiedlichsten
jüdischen Ausrichtungen. In Bezug
auf Antisemitismus ist Wien auch nicht die „Leading
City“. Ich habe keine Bedenken, mit einer Kette
mit einem Davidsternanhänger auf die Straße zu
gehen, während das vergleichsweise in Berlin nicht
ideal und viel riskanter für jüdische Jugendliche oder
Studierende ist.
Noah: Ich komme aus Graz, einer Stadt ohne jüdisches
Leben, und habe auch drei Jahre in Israel gelebt.
Ich finde Diaspora-Judentum etwas Wunderschönes,
und finde es wichtig, dass Israel existiert.
Aber für mich ist zwischen Graz und Israel Wien
genau das Richtige. Es gibt hier einen Reichtum an
jüdischem Leben, es gibt jüdische Infrastrukturen.
Ich finde diese Kombination aus dem gemütlichen
Leben und den Möglichkeiten, mein jüdisches Leben
auszuleben, wie ich will, wunderbar.
Was könnte man verbessern, um Wien für junge
Jüdinnen und Juden noch attraktiver zu machen?
wına-magazin.at
13
LESERBRIEFE
Sehr geehrte
Chefredaktion !
Mit großem Interesse habe ich den
Artikel Weil es auch eine junge Stimme
braucht (WINA, Jänner 2020) gelesen.
Darin beschreiben Noah Scheer
und Talya Goldberger ihre politische
Ausrichtung in ihrer Arbeit als Präsident
bzw. Vizepräsidentin der Jüdischen
Österreichischen HochschülerInnen.
Es tut gut zu sehen, dass
junge, engagierte Juden sich ihres
Judentums bewusst sind und sich
proaktiv für unsere jüdischen Belange
einsetzen, was ja meist mit
großem Zeitaufwand verbunden ist.
Und Zeit ist im Stadium bekanntlich
sehr kostbar. Soweit Dank und
Anerkennung. Ein kleiner Wermutstropfen
verbitterte mir aber die Lektüre
des ansonsten sehr informativen
Weil es auch eine
junge Stimme braucht
Noah Scheer und Talya Goldberger wurden
Artikels. Und zwar die Anmerkung
des neuen Präsidenten Noah Scheer,
wenn er meint, dass er aus Graz, „einer
Stadt ohne jüdischen Leben“,
kommt. Der erste Teil seiner Aussage
ist richtig, er kommt aus Graz, und
zwar aus einer höchst angesehenen
Ärztefamilie. Mit Verlaub – in der
Synagoge habe ich ihn aber in den
letzten Jahren kaum gesehen. Das
erklärt auch den zweiten Teil seiner
Bemerkung, nämlich, dass es in Graz
kein jüdisches Leben gäbe. Wäre er
nämlich öfters in der Synagoge gewesen,
hätte er sehr wohl mitbekommen,
dass wir in Graz ein höchst vitales,
vielfältiges, religiös und kulturell
anspruchsvolles Leben führen, das
sowohl von den Gemeindemitgliedern
als auch von den Freunden der
jüdischen Gemeinde höchste Anerkennung
erfährt. Es würde hier den
Rahmen sprengen, alle Aktivitäten,
religiöse wie nichtreligiöse aufzuzählen.
Übrigens: Noah hätte sich nur
die Mühe machen können, eine der
letzten Ausgaben jener Zeitschrift zu
lesen, der er ein Interview gab, nämlich
WINA. Da wurde ja kürzlich erst
über die Grazer jüdische Gemeinde
berichtet.
Nichtsdestotrotz wünschen wir
Grazer Juden ihm und seiner sympathischen
Vizepräsidentin allen
erdenklichen Erfolg und würden
uns freuen, wenn er uns bei nächster
Gelegenheit in unserer Synagoge
besucht.
Prof. Mag. Albert Kaufmann
-----------------------------
Sehr geehrte
Damen und Herren!
In der letzten Ausgabe Ihres Magazins
wird Herr Noah Scheer im
Rahmen des Artikels Weil es auch
eine junge Stimme braucht zu meinem
großen Befremden wie folgt
zitiert: „Ich komme aus Graz, einer
Stadt ohne jüdisches Leben […].“
Im März des laufenden Jahres
werden es vier Jahre, seitdem ich
die Geschicke der Grazer jüdischen
Gemeinde leiten darf. Ich kann freilich
nicht für die Jahre der Kindheit
oder Jugend von Herrn Scheer
sprechen, muss aber nachdrücklich
festhalten, dass diese Aussage die
Gegenwart der Grazer jüdischen
Gemeinde keinesfalls widerspiegelt
und schlichthin falsch ist.
Neben einem geregelten jüdisch
religiösen Leben wie etwa der regelmäßigen
Abhaltung der Gebete
nach traditionellem Ritus, Feiern
zu den allen jüdischen Feiertagen,
regelmäßigem Religionsunterricht,
Shiurim etc. verfügt die jüdische Gemeinde
Graz heute auch ein viel beachtetes
Kulturprogramm, das auch
von einem breiten Teil der nichtjüdischen
Bevölkerung in Anspruch genommen
wird und von Stadt Graz
und Land Steiermark mit nicht unbeachtlichen
budgetären Mitteln gefördert
wird. So erhielt die jüdische
Gemeinde mit ihrem Projekt Mobiles
Bethaus im Rahmen des Kulturjahres
2020 einen der höchsten
Förderzuschläge mit einer Gesamtförderung
von über hunderttausend
Euro. Nicht fehlendes jüdisches Leben,
sondern eine (wieder) lebendige
jüdische Gemeinde und die Aktivitäten
derselben haben dazu geführt,
dass die Landeshauptstadt
Graz nach erfolgreichen Verhandlungen
2019 1,8 Millionen Euro für
die Adaptierung unserer Synagoge
zur Verfügung gestellt hat. Und zwar
gerade weil Stadt und Land ganz offensichtlich
ein förderungswürdiges
jüdisches Leben in Graz erblicken.
Schließlich ist die Stadt Graz nach
der Bundeshauptstadt Wien gerade
aufgrund der nachhaltigen Arbeit
unserer Gemeinde die einzige Stadt
Österreichs, die eine Anti-Antisemitismus-
und -BDS-Resolution
verabschiedet hat.
All dies hat unsere Gemeinde bewerkstelligt,
obwohl wir eine Reihe
von Gemeindemitgliedern aus den
Kindertagen von Herrn Scheer
durch Todesfälle oder Abwanderung
verloren haben. Auch der Großteil
der Familie von Herrn Scheer
ist in den letzten Jahren aus Graz
abgewandert oder nimmt am Gemeindeleben
nicht teil. Umso höher
sind daher die von Erfolg getragenen
Anstrengungen der gegenwärtigen
Mitglieder zu bewerten, wieder
eine funktionierende Gemeinde
zu reetablieren. Eine Gemeinde, die
auch wieder für Zuwanderer attraktiv
wird, was wir G-tt sei Dank wieder
allmählich feststellen können.
Umso befremdlicher empfinden
Gemeindemitglieder und ich
die in Rede stehende Aussage von
Herrn Noah Scheer. Ich selbst habe
ihn in den letzten vier Jahren auch
kein einziges Mal bei Gebeten in
der Synagoge bei uns willkommen
heißen dürfen. Woher Herr Scheer
daher sein Wissen, wonach Graz
(gegenwärtig) eine Stadt ohne jüdischen
Lebens sei, bezieht, ist mir
ein Rätsel. Aus eigener Wahrnehmung
der letzten Jahre kann dieses
vermeintliche Wissen ebenso wenig
stammen wie aus dem Studium jüdischer
Medien, die regelmäßig über
das jüdische Leben in Graz zu berichten
wissen.
Wir Grazer Juden erhoffen uns
nicht unbedingte Anerkennung für
das, was wir unter nicht allzu leichten
Bedingungen an jüdischem Leben
zu bewerkstelligen vermögen.
Wir können uns trotz historischer
Verantwortung leider auch nicht von
jedem Mitglied einen aktiven Beitrag
zum Erhalt jüdischen Lebens
erwarten. Dass das gegenwärtige jüdische
Leben in Graz aber gerade
von Personen, die zwar seit Jahren
gar nicht mehr aktiv unserer Gemeinde
angehören, aber doch um die
Widrig- oder Schwierigkeiten von
kleinen jüdischen Gemeinden Bescheid
wissen müssten, durch die in
Rede stehende Bemerkung empfundener
Maßen nicht wertgeschätzt
und heruntergespielt wird, schmerzt
außerordentlich. Es schmerzt, weil
der Kern unserer Mitglieder mit all
seiner Energie aktiv am Wiederaufbau
jüdischen Lebens in der zweitgrößten
jüdischen Gemeinde Österreichs
arbeiten. Weil wir durch diese
unsere Arbeit versuchen, Graz wieder
für Juden, die Wert auf jüdisches
Leben legen, attraktiv zu
machen. Und weil gerade Bemerkungen
wie jene von Herrn Noah
Scheer dem Image der gegenwärtigen
Gemeinde nicht zuträglich
sind und diese Arbeit erschweren.
Für Herrn Scheer mag seine Äußerung
eine Randbemerkung sein,
für uns ist sie aber durch ihre Öffentlichkeit
nicht ohne Weiteres
hinzunehmen.
KV MMag. Elie Rosen,
Präsident der Jüdischen Gemeinde
Graz
-----------------------------
Eine kurze Stellugnahme
von Noah Scheer :
Sehr geehrte Redaktion,
Liebe LeserInnen,
mein Name ist Noah Scheer und
ich bin 24 Jahre alt. Ich habe in
meinem Leben schon einige Sta-
IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG
4 wına | Februar 2020
tionen durchlebt. Ich bin im wunderschönen
Graz geboren und aufgewachsen,
mit 16 Jahren in ein
Internat nach Israel gegangen, wo
ich auch die Schule abgeschlossen
habe. Mit 19 Jahren bin ich nach
Wien gezogen, um Medizin zu studieren.
Ich kann mit gutem Gewissen
sagen, dass ich „jüdisches Leben“
in Graz kennengelernt und
auch selbst erlebt habe. Ich bin dort
geboren, wurde dort beschnitten,
hatte meine Bar Mitzwa in der Grazer
Synagoge und bin in den Religionsunterricht
gegangen. Seit 2012
lebe ich nicht mehr in Graz. In dieser
Zeit hat sich bestimmt vieles verändert
weswegen ich nur limitiert Aussagen
über das aktuelle „jüdische
Leben“ dort treffen kann. Meiner
Meinung nach ist die Definition von
„jüdischem Leben“ jedoch sehr individuell
und bedeutet für jede und
jeden etwas ganz anderes.
Ich bin Zuhause mit wunderschönen
jüdischen Traditionen groß geworden.
Meine Eltern haben mir
Wissen und Bewusstsein für die jüdische
Religion, Kultur und Geschichte
weitergegeben. Dafür bin
ich sehr dankbar!
Gleichzeitig hat die Gemeinde versucht
eine gewisse Infrastruktur zu
bieten. Für mich war das Rückblickend
nicht was ich heute unter „jüdischem
Leben“ verstehe. Ich habe
„jüdisches Leben“ in Israel und Wien
nochmal ganz neu und anders kennengelernt.
Ich bin sehr froh über
all diese verschiedenen Eindrücke,
die ich gewinnen konnte und welche
mich in meinem jüdischen Bewusstsein
und Identität prägen.
Abschließend möchte ich betonen,
dass ich mich sehr freue, dass die
jüdische Gemeinde Graz und ihre
Leitung sich um das aktive jüdische
Leben bemühen und wachsen! Ich
möchte ihnen für ihr unermüdliches
Engagement und wertvolle Arbeit
danken und wünsche ihnen nur das
Beste für die Zukunft.
Noah Scheer
Präsident der Jüdischen
Österreichischen Hochschüler
Knapp 7.000
Überlebende,
davon etwa 500 ausgehungerte
Kinder, fanden die Soldaten der
sowjetischen Armee bei ihrer Befrei-
ung des KZs Auschwitz-Birkenau am
Lagergelände vor. Viele überlebten
ihre Befreiung nur um einige Stun-
den. Insgesamt mehr als 1,1 Mil-
lionen Menschen, davon etwa 90
Prozent Juden, , wurden hier, in der
größten Vernichtungsmaschinerie
der Nationalsozialisten, ermordet.
yad-vashem.org
ZITAT DES MONATS
„Eine kleine sprachliche
Sache fällt mir
immer wieder auf,
wenn ich Europa besuche,
insbesondere die
deutschsprachigen Länder.
Wenn die Leute mit mir reden
sprechen sie oft davon ‚was
damals passierte‘. ‚Damals‘,
das bedeutet dass früher,
in der Vergangenheit, Dinge
geschehen sind, die heute
nicht mehr geschehen; es ist
alles vorbei. Aber im Hebräischen,
oder im Jiddischen
(eigentlich in jeder Sprache,
wenn Juden über den Holocaust
sprechen) sagen die
Leute nie ‚damals‘. Sie sagen
‚dort‘. ‚Dort‘ bedeutet, dass
in diesem ‚dort‘ – nicht nur
in Deutschland, sondern im
Menschsein überhaupt – die
Dinge immer noch existieren.
Oder passieren. Und auf
alle Fälle ist es nicht vorbei.
Ganz bestimmt nicht für uns.“
David Grossman,
in Death as a way of Life
HIGHLIGHTS | 01
Knochen am
Gelände von
Auschwitz
freigeschwemmt
Durch riesige Regenmengen
wurden Ende Jänner tausende
Knochen auf dem Gelände des
ehemaligen Konzentrationslagers
freigelegt.
B esucher und Mitarbei-
ter der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau alarmierten
nach der Entdeckung
der freigelegten Kno-
chen am Gelände die Mitarbeiter
der Organisation ZAKA und den
Dachverband für die Erhaltung
europäischer jüdischer Friedhöfe,
CPJCE.
Die Funde sind weit verstreut,
die meisten liegen um die ehemaligen
Krematorien im Todes-
lager Birkenau. Die Knochen
wurden vermutlich nach der Befreiung
von Bewohnern der Umgebung
im Lager zerstreut, wäh-
rend sie dieses gestürmt und
das Gelände nach Wertgegen-
ständen abgesucht haben.
Yehuda Meshi Zahav, Direktor
von ZAKA, betonte gegenüber
Journalisten von Ynet News, , dass
das Einsammeln der freigelegten
Knochen auf Grund der Menge
und der Größe des Fundortes
eine sehr komplexe Aufgabe sein
wird, für die seine Organisation in
jedem Fall humanitäre Unterstüt-
zung brauche. Wenige Tage vor
dem internationalen Holocaust-
gedenktag betonte er weiters,
dass nicht nur das Gedenken an
die Opfer selbst wichtig sei, son-
dern auch das Gedenken an ihre
Würde. red
wına-magazin.at
5
THEMA KURZTITEL
„Ich wünschte, sagen zu können:
Wir Deutsche haben für immer aus der
Geschichte gelernt. Aber das kann ich
nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich
ausbreiten. Das kann ich nicht sagen,
wenn jüdische Kinder auf dem Schulhof
bespuckt werden. Das kann ich nicht
sagen, wenn unter dem Deckmantel
angeblicher Kritik an israelischer
Politik kruder Antisemitismus hervorbricht.
Das kann ich nicht sagen, wenn nur
eine schwere Holztür verhindert, dass ein
Rechtsterrorist an Jom Kippur in einer
Synagoge in Halle ein Blutbad anrichtet.
Natürlich: Unsere Zeit ist nicht dieselbe
Zeit. Es sind nicht dieselben Worte. Es
sind nicht dieselben Täter. Aber es ist
dasselbe Böse.“
Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident der Republik Deutschland
23. Jänner 2020, Yad Vashem
6
wına | Februar 2020
THEMA KURZTITEL
75. JAHRESTAG DER BEFREIUNG DES KZ AUSCHWITZ-BIRKENAU
Schuhe der Verschleppten und Ermordeten im
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.
In Auschwitz-Birkenau wurden mehr als
1.100.000 Juden, 70.000 Polen,
25.000 Sinti und Roma und etwa 15.000
Kriegsgefangene aus der Sowjetunion
und anderen Ländern ermordet.
© flash 90/Isaac Harari
„Umfragen zufolge geben mehr als
80 Prozent der Juden an, dass sie sich
heute in Europa unsicher fühlen. Mehr als
40 Prozent von ihnen geben an, dass sie
deshalb in Erwägung ziehen, den Kontinent
zu verlassen. […] In den letzten
Jahren sind jährlich etwa drei Prozent der
Juden aufgrund von Antisemitismus aus
Europa ausgewandert. Dies bedeutet,
dass es, wenn die aktuellen Trends
anhalten oder sich verschlechtern,
bis 2050 keine Juden mehr in Europa
geben könnte.“
Dr. Moshe Kantor
Stiftung World Holocaust Forum
23. Jänner 2020, Yad Vashem
wına-magazin.at 7
NEUES REGIERUNGSPROGRAMM
Kampf gegen
Antisemitismus
wird intensiviert
Handshake
gegen den
Antisemitismus:
Sebastian Kurz
und Werner
Kogler.
Das Regierungsprogramm von ÖVP
und Grünen setzt dabei an verschiedenen
Hebeln an: Im Visier ist sowohl
Antisemitismus von rechts wie auch
von islamistischer Seite. Das Kulturamt
ist nun im neuen Integrationsressort
angesiedelt. Eine Zusammenschau des
Arbeitsübereinkommens von Türkis
und Grün von Alexia Weiss.
ie neue türkis-grüne Regierung unter Kanzler
Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner
Kogler hat sich auf verschiedenen
Ebenen dem Kampf gegen Antisemitismus
verschrieben und stellt
sich dabei, wie es im Koalitionsprogramm
formuliert wird, „an die Spitze
des Kampfes gegen Antisemitismus“.
Dabei soll ein ganzes Maßnahmenbündel
„gegen Extremismus und Terrorismus“
geschnürt werden. Aber auch
außenpolitisch will sich Österreich vor allem
auf europäischer Ebene „gegen Antisemitismus
und Antizionismus“ einsetzen.
Angeführt wird dabei „die konsequente Umsetzung
der 2018 angenommenen Ratserklärung
zur Bekämpfung von Antisemitismus in Europa“.
Österreich habe, wird festgehalten, „eine
besondere historische Verantwortung und aktuelle
Verbindung zum Staat Israel. Wir bekennen
uns zum Staat Israel als jüdischem und demokratischem
Staat sowie zu dessen Sicherheit.
Das Existenzrecht Israels darf nicht in Frage
gestellt werden.“ Österreich werde daher Initiativen
und Resolutionen in internationalen
Organisationen nicht unterstützen, die dem Bekenntnis
Österreichs zu Israel zuwiderlaufen.
In Sachen Nahostpolitik kündigt die neue Regierung
an, sich „für nachhaltige Friedenslösungen
im Nahen Osten“ einzusetzen, „im Falle des
israelisch-palästinensischen Friedensprozesses
mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung“. Der
Staat Israel solle in anerkannten und dauerhaft
sicheren Grenzen in Frieden neben einem unabhängigen,
demokratischen und lebensfähigen
palästinensischen Staat leben können. Österreich
werde zudem wie bisher zivilgesellschaftliche
israelisch-palästinensische Friedensinitiativen
unterstützen „und auch seinen Einsatz
für den Aufbau demokratischer palästinensischer
Institutionen und nachhaltiger Kommunal-
und Sozialeinrichtungen fortsetzen“.
National will die Regierung den Kampf gegen
Antisemitismus auf den verschiedensten Ebenen
angehen. Geplant ist die Erstellung eines
„Aktionsplans gegen Rechtsextremismus und
gegen den religiös motivierten politischen Extremismus
(politischer Islam)“ sowie eines „Aktionsplans
gegen Rassismus und Diskriminierung“.
An konkreten Maßnahmen gegen Antisemitismus
von rechter Seite nennt das Regierungsprogramm
dabei zum Beispiel die Verankerung
einer Forschungsstelle Rechtsextremismus und
Antisemitismus im Dokumentationsarchiv des
Österreichischen Widerstandes (DÖW), die
auch wieder einen jährlichen Rechtsextremismusbericht
erstellen soll. Künftig sollen auch
rechtsextreme Burschenschaften wieder beobachtet
und deren Aktivitäten entsprechend
eingeschätzt werden. Eingerichtet werden soll
eine mobile Kompetenzstelle gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Gewalt. Eine Informations-
und Aufklärungskampagne gegen
Rechtsextremismus und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit soll Bewusstsein schaffen.
Eine Internetplattform soll über Rechtsextremismus
informieren. Distanzierungsarbeit
und Ausstiegsmöglichkeiten vor allem nach dem
Strafvollzug sollen zur Deradikalisierung beitragen.
Ins Visier nimmt die Regierung aber auch
verstärkt mögliche Bedrohungen von islamistischer
Seite. Vorgesehen ist die „Schaffung einer
unabhängigen staatlich legitimierten Dokumentationsstelle
zur wissenschaftlichen
© Georges Schneider/picturedesk.com
8 wına | Februar 2020
KAMPF GEGEN ANTISEMITISMUS
Erforschung, Dokumentation und Aufbereitung
von Informationen über den religiös motivierten
politischen Extremismus (politischer
Islam) sowie zur besseren Koordination der Präventions-
und Aufklärungsarbeit (nach Vorbild
des DÖW)“.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (BVT) soll neu aufgestellt
werden – als eines der Ziele wird die „Wiederherstellung
des Vertrauens seitens der Bevölkerung
und von Partnerdiensten“ angeführt.
Schwerpunkte der Arbeit des BVT sollen künftig
„rechtsextremer und politisch religiös motivierter
Extremismus“ sein.
Stärker ahnden will die Regierung zudem
„Gewalt und Hass im Netz“. Eingeführt werden
soll dabei etwa eine Ermittlungspflicht der
Strafverfolgungsbehörden. Opfer sollen stärker
als bisher unterstützt werden – dazu sollen
rechtliche Instrumente entwickelt werden, damit
sich Betroffene effektiver als bisher gegen
Hass im Netz zur Wehr setzen können. Geprüft
werden soll außerdem, wie Betroffene Sperren
gegen Accounts beantragen können, wenn
rechtswidrige Äußerungen festgestellt wurden.
In Sachen Erinnerungskultur wollen Türkis und
Grün eine Gedenkstrategie entwickeln „mit
dem Ziel, die unterschiedlichen Rechtsträger
der österreichischen Gedenkstätten, Sammlungen
und Museen zusammenzuführen unter dem
Dach des Parlaments die dauerhafte Finanzierung
sicherzustellen“. Die KZ-Gedenkstätte
Mauthausen soll weiterentwickelt werden und
dabei auch die Gedenkstätte Gusen angekauft
werden. Für Jugendliche soll es Erinnerungsangebote
inner- und außerhalb der Schulen geben.
Der Gedenkdienst (im Rahmen des Zivildienstes)
soll aufgewertet werden, die Trägerorganisationen
will die türkis-grüne Koalition
stärken.
Umgesetzt werden soll auch die Namensmauer
für Opfer der Schoah – und alle Schüler
und Schülerinnen sollen zumindest einmal
in ihrer Schulzeit die KZ-Gedenkstätte Mauthausen
besuchen können.
Ausbauen möchte die Regierung die Provenienzforschung.
Konkret heißt es dazu: „Provenienzforschung
und Kunstrückgabe sind ein
weltweites Erfolgsmodell und sollen jedenfalls
aufgrund des Kunstrückgabegesetzes auch in
der Stiftung Leopold weitergeführt werden. Die
Provenienzforschung sollte jedenfalls auch bei
Dauerleihgaben stattfinden.“
Neu ist, dass das Kulturamt in den Zuständigkeitsbereich
der Integrations- und Frauenministerin
Susanne Raab fällt. Insgesamt fällt im Regierungsprogramm
die starke Verknüpfung von
Religion und Integration auf, Beispiel Religionsunterricht:
Dieser soll „integrationsfördernd“
gestaltet sein. „In diesem Sinn soll sich der Religionsunterricht
an pädagogischer Qualität
und staatsbürgerlicher Erziehung orientieren,
unter anderem durch den stärkeren Austausch
der Schulaufsicht mit der Fachaufsicht.“ Bücher
und Materialien des Religionsunterrichts
sollen auch in Hinblick auf verfassungsrechtliche
Werte wie der Gleichstellung der Frau geprüft
werden – „Ziel unseres Bildungssystems ist
die Heranbildung freier, gebildeter, aufgeklärter
Menschen“. Verstärkte Kontrollen soll es dabei
auch in Kindergärten und Privatschulen geben.
Mehrmals wird dabei angeführt, dass „insbesondere
islamische“ Einrichtungen oder der „islamische
Religionsunterricht“ gemeint sei. Andere
Religionsgemeinschaften sind allerdings hier
nicht ausdrücklich ausgenommen – insgesamt
wird angeführt, dass es „klare Qualitätsstandards“
für alle, auch private Bildungseinrichtungen geben
müsse und es neue Errichtungsverfahren für
Privatschulen geben werde. Nur den Islam betrifft
das Kopftuchverbot für Schülerinnen bis
zum Alter von 14 Jahren.
Einsetzen will sich die Regierung aber auch
gegen die Bildung von Parallelgesellschaften.
Die neue Dokumentationsstelle für religiös motivierten
politischen Extremismus (politischer
Islam) soll einen jährlichen Bericht zur Entstehung
von Parallelgesellschaften beziehungsweise
„segregierten Milieus“ in Österreich erstellen.
Auch außenpolitisch
will
sich Österreich
vor allem auf
europäischer
Ebene „gegen
Antisemitismus
und Antizionismus“
einsetzen.
wına-magazin.at
9
INTERVIEW MIT WERNER DREIER
WINA: Sie sind Geschäftsführer von erinnern.at.
Wie sind Sie persönlich zu den Themen Holocaust
und Antisemitismus gekommen, denen dieser Verein
gewidmet ist?
Werner Dreier: Seit meinen Forschungen zur Vorarlberger
Landesgeschichte in den Zwanziger- und
Dreißigerjahren wurde ich das Thema Antisemitismus
nicht mehr los: 1988 gab ich einen Sammelband
zu „Antisemitismus in Vorarlberg“ heraus, und heute
arbeiten wir innerhalb von erinnern.at an aktuellen
Lernmaterialien. Ich wurde auch durch Begegnungen
mit ZeitzeugInnen geprägt, unvergesslich blieben
mir die Schulbesuche von Max Schneider, die
ich als junger Lehrer begleiten durfte.
Wie sieht Ihre Bilanz nach den ersten 20 Jahren
aus?
I Meine persönliche Bilanz ist etwas zwiespältig,
denn man könnte sagen, wir sind dabei, erfolgreich
zu scheitern. Einerseits erreichen wir hunderte Lehrpersonen,
die interessiert und engagiert sind und sich
auf einem hohen professionellen Niveau mit der Geschichte
des Nationalsozialismus, aber auch mit den
Folgen dieser Geschichte für unsere heutige Gesellschaft
auseinandersetzen. Wir sehen insbesondere
bei unseren jüngeren KollegInnen ein wachsendes
Interesse. Auch die Bereitschaft, ZeitzeugInnen einzuladen,
wächst, und es gibt einen sehr wertschätzenden
Umgang mit diesen. Es gelingt uns, den Holocaust
und den Umgang mit dem Völkermord an den
Jüdinnen und Juden in den Schulen in Österreich zu
einem relevanten Thema zu machen, und wir finden
interessierte Lehrer und Jugendliche. Das ist wirklich
sehr ermutigend und gar nicht selbstverständlich.
Andererseits beobachten wir in den letzten Jahren
Seit 20 Jahren kämpft der Verein erinnern.at vor
allem in Schulen gegen das Vergessen national-sozialistischer
Verbrechen. Seit 20 Jahren bringt sein Yad-
Vashem-Projekt österreichische Lehrpersonen zu Seminaren
nach Israel. Der Vorarlberger Historiker
Werner Dreier ist von Anfang an dabei.
Interview: Anita Pollak
„Der Begriff
Antisemitismus
ist
im neuen
Regierungsprogramm
sehr häufig
erwähnt.“
Werner Dreier
mit zunehmendem Erschrecken, wie der Antisemitismus,
der Antisemitismus in Zusammenhang
mit Israel, der Rassismus, der übersteigerte Nationalismus
auch in unserer Gesellschaft virulent sind.
Und da kann man sich schon manchmal fragen, ob
wir nicht erfolgreich scheitern.
In den letzten Jahren hat sich nicht zuletzt durch
die gesteigerte Zuwanderung von Menschen aus
islamischen Ländern, die mit dem Thema Holocaust
überhaupt nichts anfangen können, gesellschaftlich
einiges geändert. Man spricht auch von
einem importierten Antisemitismus. Beobachten
Sie das auch im schulischen Milieu?
I Was den Antisemitismus betrifft, so gibt es in allen
österreichweiten Befragungen zwischen einem
Viertel bis zu einem Drittel Menschen, die sich
auf die eine oder andere Weise antisemitisch äußern.
Das variiert in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen
ein bisschen. Es scheint einerseits
einen Zusammenhang mit der Bildung zu geben,
andererseits sehen wir doch, dass sich auch hochgebildete
Menschen antisemitisch äußern oder sogar
agitieren. Mit der Vorstellung, dass Antisemitismus
mit höherer Bildung verschwindet, und der
10 wına | Februar 2020
VIRULENTER ANTISEMITISMUS
WERNER DREIER
geb. 1956 in Bregenz, studierte
Geschichte und Germanistik,
war Lehrer und forschte und
publizierte zu Antisemitismus
und Nationalsozialismus. Seit
2000 Aufbau und Leitung von
erinnern.at, dort verantwortlich
für Lehrerbildung und EntwicklungvonUnterrichtsmaterialien,
zuletzt der Lern-App „Fliehen
vor dem Holocaust“. Mitglied
der österreichischen Delegation
zur International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA).
Beriet OSZE/ODIHR und Unesco
zu lehren und lernen über und
gegen Antisemitismus.
© privat
Zuweisung des Antisemitismus an Zuwanderergruppen
sollte man also vorsichtig sein.
Bei den Lehrpersonen, die mit uns zu den Seminaren
nach Israel nach Yad Vashem fahren, sind
manchmal auch muslimische Lehrkräfte dabei. Sie
haben teilweise andere Fragen und einen anderen
Hintergrund, aber sie sind gleichermaßen interessiert.
Deshalb fahren sie ja mit zu diesen anspruchsvollen
Seminaren. Lehrpersonen berichten uns auch
von migrantischen Kindern, deren Interesse an der
Frage von Massengewalt und Völkermord trotz anderer
kultureller und historischer Hintergründe ein
großes ist.
Beobachtet man konkret antisemitische Vorurteile
im schulischen Milieu, und was bedeuten die
gestiegenen Zahlen für Ihr Projekt?
I Es gibt Untersuchungen etwa in berufsbildenden
Schulen, die sagen, ja, es gibt einen bedenklichen
Anteil von antisemitischem Sprechen, z. B. an Berufsschulen.
Ich kenne keine validen Zahlen, was
dabei die Zuwanderer betrifft, es gibt aber Beobachtungen,
dass es bei muslimischen Jugendlichen
einen etwas höheren Anteil von antisemitischen
Äußerungen insbesondere im Zusammenhang mit
Israel gibt als in der Restbevölkerung. Für uns bedeutet
es, dass wir unsere Bemühungen in der Aufklärungsarbeit
über Antisemitismus und in der Präventionsarbeit
gerade in Berufsschulen verstärken.
Wie funktioniert das konkret?
I Wir entwickeln gerade gemeinsam mit bayrischen
und schweizerischen KollegInnen ein Projekt, das
Lehrpersonen in ihrer Ausbildung jene professionellen
Fähigkeiten und Kompetenzen, Haltungen
und Motivationen vermittelt, die es ihnen dann ermöglichen,
in ihrer Arbeit besser mit Antisemitismus
und Ähnlichem umgehen zu können. Weiters
bieten wir adäquate Materialien für heterogene
Klassen mit Jugendlichen ganz unterschiedlicher
wına-magazin.at
11
PROJEKT FLUCHTPUNKTE
Herkünfte an, in denen möglichst viele Jugendliche
einen Anknüpfungspunkt finden sollen. Das
heißt einen Punkt des Interesses, bei dem sie auch
empathisch sein können. Ein solches ist das Projekt
Fluchtpunkte. Dabei geht es um Menschen, die sich
in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen
dem Nahen Osten und dem europäischen Raum
bewegen, wie die Flucht von jüdischen Menschen
aus Europa nach Palästina oder die Flucht heute
von Syrien nach Europa, und dass man über diese
Flucht- und Migrationserfahrungen Lernen generieren
kann.
Sind derartige Ziele im Lehrplan festgeschrieben?
IDer Lehrplan in Österreich stellt nur einen Rahmen
dar, der aber diese Inhalte in den Schulen möglich
macht. In den meisten Lehrplänen ist auch das
Thema Antisemitismus verankert, d. h. es gibt Ankerpunkte,
die eine Bearbeitung dieses Themas notwendig
machen. Ebenso sind Nationalsozialismus
und Holocaust in allen österreichischen Schulen als
Lehrplaninhalte vorgesehen.
Inwiefern korreliert das mit dem Yad-Vashem-Projekt,
in dem es um persönliche Erfahrungen der
Lehrpersonen geht? Welche Auswirkungen zeigen
sich da?
I Es hat sich aus den hunderten persönlichen Kontakten
an vielen wichtigen Plätzen und Institutionen
in Österreich ein sehr schönes und tragfähiges
Netzwerk herausgebildet, das für uns sehr wichtig
ist, wenn wir z. B. Seminare anbieten oder Schulen
für Testungen neuer Lernmaterialien suchen. Mittlerweile
sind diese Seminare ja auch Teil von Hochschullehrgängen,
in die sie integriert sind, etwa der
Lehrgang über Pädagogik an Erinnerungsorten in
Oberösterreich.
Apropos Gedenkstättenpädagogik. Gibt es da vermehrt
Initiativen, Jugendliche an Holocaust-Orte
heranzuführen, oder kommt man davon eher ab.
Wie ist da die Tendenz?
I Es gab einen Erlass des Unterrichtministeriums,
der den Besuch von Gedenkstätten fördern sollte,
und es gibt auch von unserer Seite dazu viele Initiativen,
im Wesentlichen die Gedenkstätte in Mauthausen,
aber auch die Gedenkstätte Auschwitz betreffend.
Wir erarbeiten im Moment Materialien für die
neue Ausstellung der Gedenkstätte Auschwitz, und
erinnern.at ist auch in Mauthausen mit der Vor- und
Nachbereitung des Gedenkstättenbesuchs befasst.
DAS YAD-VASHEM-
PROJEKT
Seit dem ersten
Seminar für österreichische
Lehrpersonen
an der Gedenkstätte
Yad Vashem im Herbst
2000 besuchten fast
800 Lehrerinnen und
Lehrer in insgesamt
34 Seminaren Israel.
Dort erlebten sie an der
International School for
Holocaust Studies und
für einige Tage auch
am Center for Humanistic
Education an der
Gedenkstätte Lohamei
Hagetaot ein jeweils
zweiwöchiges Seminar.
Die Seminarkosten
werden vom Bundesministerium
für Bildung,
Wissenschaft und
Forschung getragen.
„Es gibt einen
bedenklichen
Anteil
von antisemitischem
Sprechen,
z. B. an Berufsschulen.“
Werner Dreier
Im Moment sind wir auch an einem neuen internetbasierten
Projekt beteiligt: einer Geodaten referenzierten
Landkarte zu NS-Erinnerungsorten, die für
unterschiedliche Endgeräte optimiert ist und einen
Besuch von regionalen, lokalen Gedenkorten sowie
eine Auseinandersetzung mit diesen ermöglichen soll.
Welchen Stellenwert haben die Aufarbeitung des
Holocaust und das Problem des steigenden Antisemitismus
im Programm der neuen Regierung?
I Der Begriff Antisemitismus ist darin jedenfalls sehr
häufig erwähnt, ebenso findet das Gedenken an den
Nationalsozialismus Erwähnung, und auch unsere
Arbeit ist im Regierungsprogramm angesprochen.
Ich bin optimistisch, dass es sich nicht nur um Lippenbekenntnisse
handelt, sondern auch um substanzielle
Inhalte.
Wie wird sich das im Budget niederschlagen, denn
derlei Initiativen kosten ja etwas?
I Das ist die Kernfrage, daran wird es sich zeigen, wie
ernsthaft das gemeint ist. Wir arbeiten seit 20 Jahren
unter ganz unterschiedlichen Regierungen und haben
das große Glück, auf der Beamtenebene immer
starke Unterstützung zu finden. Martina Maschke
und Manfred Wirtitsch vertreten das Unterrichtsministerium
im Vorstand von erinnern.at, und ich
erwarte mir die Fortsetzung dieser positiven Entwicklung.
Aus Ihrer Arbeit erwächst auch eine intensive Beziehung
zu Israel. Ist diese eine Einbahnstraße, oder
kommt da ein Austausch zustande?
I Wir sind gerade in einem sehr schönen Projekt, einem
Schulbuchdialog mit Israel involviert. Da analysieren
wir gemeinsam die österreichischen und israelischen
Schulgeschichtsbücher und untersuchen,
wie Themen wie jüdische Geschichte, Nationalsozialismus,
Antisemitismus und Israel in österreichischen
Geschichts- und Geografiebüchern dargestellt
werden. Die israelischen KollegInnen analysieren die
Darstellung Österreichs in israelischen Schulbüchern.
Das ist ein teilweise sehr komplexer Dialog.
Welche Rolle spielt Österreich in diesen israelischen
Schulbüchern?
I Josef II. und die Anerkennung der jüdischen Religion
wie auch der Zionismus und Herzl spielen zum
Beispiel eine größere Rolle, während interessanterweise
der Nationalsozialismus im Wesentlichen als
deutsches Phänomen abgehandelt wird.
12 wına | Februar 2020
AUSGANGSPUNKT SCHULPROJEKT
Zwei Ringe
der Erinnerung
Seit Kurzem hat die obersteirische Stadt Judenburg ein Denkmal
für ihre einstige jüdische Gemeinde, aber nicht bloß für
jene vor 1938, sondern auch für die im 15. Jahrhundert.
InitatorInnen.
Künstler Clemens
Neugebauer,
Katja Heiden,
Professorin am
Judenburger Gymnasium,
Michael
Schiestl, Leiter des
Stadtmuseums.
(v. l. n. r.).
Text und Fotos: Reinhard Engel
Es sind vom Hauptplatz hierher
nur wenige Schritte. Auf
einem kleinen, etwas erhöhten
Rasenstück zwischen
engen Gässchen steht das
Denkmal zur Erinnerung an die ausgelöschte
jüdische Gemeinde: „Zwei Ringe
im Strom der Zeit.“ Es handelt sich um
elliptische weiße Betonskulpturen, in die
stählerne gekrümmte Platten eingefügt
sind. „Wenn man die Ringe betritt, und
das soll man auch, kann man gegen das
Licht die aus dem Stahl herausgefrästen
Namen lesen“, erklärt Katja Heiden, Professorin
für bildnerische Erziehung am
Judenburger Gymnasium und Initiatorin
des Denkmals.
Es gibt auch an anderen Orten Tafeln
mit den Namen vertriebener und ermordeter
Jüdinnen und Juden, meist geht es
dabei um die Opfer der Nazi-Verfolgung
ab 1938. Ihrer wird auch hier gedacht, aber
eben nicht ausschließlich. „Das Denkmal
steht im alten jüdischen Viertel“, erklärt
Michael Schiestl, Leiter des Stadtmuseums,
denn „es gab im 15. Jahrhundert
hier eine blühende jüdische Gemeinde.“
40 Namen aus der Zeit vor der Vertreibung
1496 stehen auf einem der beiden
Ringe, 97 weitere von 1938 auf dem zweiten.
„Man muss betonen, dass diese Listen
nicht wirklich vollständig sind“, so Frau
Heiden.
Gestaltet und errichtet wurde das
Denkmal vom steirischen Künstler Clemens
Neugebauer (siehe Kasten: Erinnerung
auch in Leoben). Er verweist noch
auf weitere Details der Plastik: „Die Ringe
sind unterbrochen als Symbol für die brutale
zweimalige Unterbrechung der Leben
der Judenburger Juden. Und auch die
Stahlplatten mit den Namen sind nicht
makellos. Sie zeigen Spalten, Risse wie
Blitze, so wie das Unheil ganz plötzlich
über diese Menschen hereingebrochen
ist.“ Die mit einer Art Edelrost überzogenen
Stahlplatten hinterlassen nach jedem
Regen ihre Spuren auf dem weiß gestrichenen
Betonrund – je nach Interpretation
bluten oder weinen sie.
Auch wenn Neugebauer für die Umsetzung
verantwortlich zeichnet, geht das
Ring-Denkmal auf die Ideen und Konzepte
einer größeren Gruppe zurück. Der
Ausgangspunkt war dabei eine Schulprojekt,
das Heiden initiierte und über Jahre
hin weiterverfolgte, bis zur praktischen
physischen Umsetzung im Herbst 2019.
Brutale Endpunkte. Beteiligt waren
Schülerinnen und Schüler aus Judenburg
und aus der Wiener Zwi-Perez-Chajes-
Schule. Der ursprüngliche Entwurf von
Jonathan Djanachvili, Magdalena Winter,
Daniela Gruber-Veit, Nechama Zvia
Hermon, Teresa Mösslacher, Christina
Pally und Helene Riegelhaupt wurde
später adaptiert. Er hatte für die beiden
Ringe noch Mosaiken vorgesehen, auf
diese wurde aber aus praktischen Gründen
und der Furcht vor frühzeitiger Verwitterung
schließlich verzichtet. Die endgültige
Form entstand im Schuljahr 2017/18
in Judenburg gemeinsam mit dem Atelier
Neugebauer.
wına-magazin.at
13
JÜDISCHES LEBEN
Doch das Projekt hatte viel früher
und grundlegender begonnen, auch unter
Einbindung von Geschichts- und Religionslehrern.
„Nachdem es hier kein jüdisches
Leben mehr gibt, wollten wir den
Jugendlichen dieses vermitteln. Man arbeitet
nicht über jemanden, sondern mit
jemandem.“ Also nahm Heiden Kontakt
mit ihrer Kollegin Anna Erdelyi an der
ZPC-Schule auf. „Wir haben uns sofort
verstanden und sind heute gut befreundet.“
Das Projekt sollte dann die steirischen
Jugendlichen einer siebenten Klasse nach
Wien führen, wo sie die ZPC-Schule
besuchten sowie das Museum am Judenplatz.
Hier konnten sie erstmals mit
jüdischen Gleichaltrigen diskutieren. Umgekehrt
reisten die jüdischen Wiener Kids
in die Obersteiermark, erhielten vom Museumsleiter
Schiestl einen Überblick über
die Gemeindegeschichte von Judenburg,
über Blütezeiten und brutale Endpunkte,
besuchten die ehemals jüdischen Orte
in der Stadt. Erst dann arbeiteten sie in
Teams an den künstlerischen Entwürfen
für das künftige Denkmal.
Dieses war das vordergründige Ziel des
Projekts, und die Gemeinde Judenburg
hatte sich bereiterklärt, es zu finanzieren.
Dahinter aber stand eine viel gegenwärtigere
Absicht, im Konzept so formuliert:
„Ein weiteres Ziel war es, dass den
Jugendlichen im Rahmen dieses Projekts
die Möglichkeit gegeben wurde und wird,
einander zu begegnen, Verschiedenartigkeit
in der Kultur, Religion und Identität
zu erfahren, aber vor allem auch Gemeinsamkeit
zu erleben, übereinander etwas zu
lernen und einander zu verstehen.“
„Allein hätten wir das nicht machen
können“, gibt sich Heiden realistisch. „Es
hat nicht zuletzt auch deshalb funktioniert,
weil die jüdischen Schüler da waren
und andere mitgezogen haben.“ Und
es war auch in Judenburg eine besonders
kreative, intelligente Klasse
in diesem Jahrgang. Heiden,
nachdenklich: „Mit
manchen anderen wäre das
eventuell nicht gegangen.“
Wie ist sie eigentlich zu
dem Thema gekommen?
„Ich stamme aus Graz und
habe vor meiner Arbeit hier
an der Schule in Wien gelebt.
Ich habe zunächst einmal
einfach wissen wollen,
woher der Name Judenburg
kommt.“ Und sie hatte be-
40 Namen aus
der Zeit vor der
Vertreibung 1496
stehen auf einem
der beiden Ringe,
97 weitere von
1938.
„Die Ringe sind unterbrochen
als Symbol
für die brutale
zweimalige Unterbrechung
der Leben der
Judenburger Juden.“
Clemens Neugebauer
Begegnung bei den Entwürfen für das Denkmal:
Schülerinnen und Schüler aus Judenburg
und der Wiener Zwi-Perez-Chajes-Schule.
14 wına | Februar 2020
OBERSTEIERMARK
reits gute Erfahrungen mit Schulprojekten
gesammelt, wusste, dass man auch
fächerübergreifend viel erreichen kann,
wenn man die Jugendlichen fordert. Was
war der politisch-historische Hintergrund
in der steirischen Stadt selbst? Der Historiker
Schiestl, der einiges über das jüdische
Leben in der Region publiziert hat,
wählte bei der Eröffnung im Herbst 2019
klare Worte:
„Von der Geschichte der Judenburger
Juden zu erzählen, das heißt in erster
Linie, sich durch ein Dickicht von Legenden,
von Mythen und Vorurteilen zu
bewegen, die Jahrhunderte lang und bis
in die Gegenwart diese Geschichte verdunkelt
und bis zur Unkenntlichkeit entstellt
haben. Und es gehört wirklich zu
den bedauernswerten Kapiteln der lokalen
Geschichtsschreibung, dass sie dieser
Legendenbildung nicht nur nichts entgegengesetzt
hat – nämlich die schlichten
Fakten, die aus den Schriftquellen zu erzählen
wären –, sondern sie hat an dieser
Mythenbildung und vor allem am Verfälschen
und am Verschweigen aktiv mitgewirkt.
[…] Die Geschichte der Juden
bleibt dabei so gut wie unsichtbar, wie ein
unliebsames und […] aus der Art geschlagenes
Mitglied der Verwandtschaft, dessen
Existenz man lieber verschweigt, weil
man sich sonst unangenehmen Fragen zu
stellen hätte.“
Stadt jüdischer Gelehrsamkeit. Schiestl
erinnerte in seiner Rede an die blühende
kleine mittelalterliche jüdische Gemeinde
von Judenburg „mit einer umfassenden
religiösen Infrastruktur, mit einer Synagoge,
mit rituellem Bad, einem Spital, einem
Friedhof und anderen sozialen und
Erinnerung an
den jüdischen
Friedhof und die
Zeremonienhalle
im obersteirischen
Leoben.
religiösen Einrichtungen“. Judenburg war
auch eine Stadt jüdischer Gelehrsamkeit,
wie Pergamentfunde belegten. Geblieben
sei aber nur das Vorurteil vom jüdischen
Geldverleiher, damals eine der wenigen
ökonomischen Aktivitäten, die der Landesfürst
den Juden zugestand, bis er sie
wieder vertreiben ließ.
Und auch zu den Jahren 1938 und 1945
fand der Historiker klare Worte, nämlich
„dass bei diesem Diebeszug durch die jüdischen
Geschäfte und Häuser alles geraubt
wurde, was den neuen ‚Herrenmenschen‘
begehrenswert erschien: Möbel, Kleidungsstücke,
Motorräder, Automobile,
Teppiche, Musikinstrumente, Schmuck,
Geschirr […], ganze Privatsammlungen,
z. B. Porzellan- und Zinngeschirrsammlungen,
und Bibliotheken haben praktisch
über Nacht den Besitzer gewechselt.“
Schon im November 1938 wurde
der Gauleitung in Graz stolz gemeldet,
die Stadt sei „judenfrei“.
Darüber hinaus möge man nicht vergessen,
„dass die meisten Protagonisten
und die Profiteure dieses Raubzuges
nach 1945 als ehrenwerte Bürgerinnen
und Bürger weiterhin für das Wohl dieser
Stadt gewirkt haben und ihre Mordsgesinnung
an die folgenden Generationen
weitergeben durften.“
„Es ist wirklich einer der bitteren postumen
Siege des Nationalsozialismus, dass
er nach der Vertreibung und nach der Ermordung
der meisten jüdischen Familien
dieser Stadt auch das Wissen und die Erinnerung
an diese reiche und lebendige
jüdische Tradition ausgelöscht hat.“ Dem
solle das Denkmal und die kreative Zusammenarbeit
der Jugendlichen deutlich
Widerspruch entgegensetzen.
ERINNERUNG
AUCH IN LEOBEN
C
lemens
Neugebauer, der
Künstler, der für die Umsetzung
des Judenburger
Denkmals verantwortlich zeichnet,
hat sich nicht zum ersten
Mal mit der unrühmlichen Vergangenheit
der Obersteiermark auseinandergesetzt.
Er ist ein vielseitig kreativer Kopf: Musiker,
Komponist, Keramiker, Maler, Unternehmer.
In seiner Firma „3D Kunst“ hat er
etwa den riesigen stählernen Stier am Red-
Bull-Ring in Spielberg geplant und aufgestellt
und auch das mächtige Bühnenbild
für Verdis Aida im burgenländischen Steinbruch
St. Margarethen aus Styroporteilen
gefertigt.
In seinen Jahren als Kunsterzieher am Leobener
Gymnasium betreute er zwei historische
Projekte. Im ersten ging er mit einer
siebenten Klasse der Lebensgeschichte
des 1921 in Leoben geborenen jüdischen
Violinisten und Bratschisten Gideon Röhr
nach. Dieser hatte als Kind in Leoben an
der Musikschule seine Grundausbildung erhalten
und dann – nach der Flucht mit seinen
Eltern nach Palästina – in Israel und in
Schweden Karriere gemacht. Bei diesem
Projekt fanden die Jugendlichen heraus,
dass es bis 1938 im Haus der Musikschule
einen jüdischen Betraum gegeben hatte.
Heute erinnern daran – und an Röhr – zumindest
Wandtafeln.
In einem weiteren Projekt forschte Neugebauer
mit 18-jährigen Mädchen zum einstigen
jüdischen Friedhof in Leoben. „Er war
in einer Ecke an der Mauer des großen städtischen
Friedhofs untergebracht“, erzählt er.
„Die Nazis haben alle Grabsteine geraubt
und für den Straßenbau verwendet, die
Gräber selbst sind geblieben, man weiß nur
nicht, wer wo liegt.“ Als Erinnerung setzten
die Schülerinnen 57 Granitplatten in eine
Wiese, die Namen der hier begrabenen Jüdinnen
und Juden findet man an einer Tafel
an der Friedhofsmauer. Und auch die Umfänge
der längst abgerissenen kleinen jüdischen
Zeremonienhalle machten die Schülerinnen
mit einer Art Fundament wieder
sichtbar. Es reicht sogar über die heutige
Friedhofsmauer hinaus bis zur Straße.
wına-magazin.at
15
LEBEN MIT BRÜCHEN
Frauen bot das Exil auch
NEUE PERSPEKTIVEN
Die Arbeitsgemeinschaft „Frauen im Exil“ forscht seit 2002 im Rahmen der
Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung zu Lebensgeschichten von
Frauen, die aus Österreich geflüchtet sind. Das Gros dieser Arbeit erfolgt unbezahlt.
Insgesamt ist die Exilforschung unterdotiert und konnte bisher nicht
an den Universitäten breit etabliert werden. WINA machte einen Blick darauf,
was diese Art der Forschung leistet.
Text: Alexia Weiss, Foto: Daniel Shaked
Susanne Bock hat sich den Traum eines
Universitätsstudiums erst spät erfüllt.
1978, bereits im Ruhestand, begann
sie, Sprachwissenschaft und Anglistik
zu studieren. 1983 schloss sie mit dem Magisterium
ab, 1993 setzte sie ein Doktorat darauf.
Ihre Vita ist durchzogen von Brüchen – doch
eines hat sie nie verloren: ihre Kraft. Heute lebt
sie, fast 100-jährig, in einem Seniorenheim in
Wien.
Geboren wurde sie 1920 als Susanne Hackl.
Die jüdische Familie lebte im neunten Bezirk
in eher ärmlichen Verhältnissen. Bocks Elternhaus
war assimiliert. Politisch sozialisiert
wurde das Mädchen bei den Roten Falken. Sie
war eine gute Schülern und schaffte den Übertritt
von der Hauptschule
in das Gymnasium. Fast
führte ihr politisches Engagement
jedoch dazu,
dass sie von der Schule
flog: Ab Februar 1934
galten ihre politischen
Aktivitäten als illegal, 1936 wurde sie verhaftet
und für einige Tage inhaftiert. Es gelang jedoch,
den Schulausschluss zu verhindern. Ab
April 1938 musste sie – da war sie bereits in
der Maturaklasse – eine jüdische Sammelklasse
besuchen. Die Matura konnte sie im Juni noch
ablegen, sofort danach flüchtete sie aus Wien.
In Cesenatico hatte sie im Sommer 1937 in
einem Ferienheim Wolfgang Bock kennengelernt.
Ihre Jugendliebe musste sie jedoch zurücklassen,
als sie erneut nach Italien aufbrach.
Mailand war die erste Station ihres Exils: Dort
arbeitete sie bis Februar 1939 als Kindermädchen.
Dann floh sie erneut, gelangte über
Frankreich nach England. Es folgten ein Umzug,
eine Umschulung, eine neue Tätigkeit auf
die andere. In Surrey arbeitete sie zunächst als
Hilfskraft in einem Rekonvaleszentenheim, in
Ilse Korotin: Die
Historikerin und Soziologin
leitet aktuell
die 2002 gegründete
Frauen-AG.
16 wına | Februar 2020
EXISTENZ NEU AUFBAUEN
Die Frauen-AG. Kathrin Sippel,
Traude Bollauf, Primavera Driessen
Gruber, Elisabeth Lebensaft (sitzend
von links) und Katharina Prager, Ilse
Korotin, Irene Messinger, Ursula Stern
(stehend von links).
Bristol begann sie über Vermittlung des Jüdischen
Hilfskomitees die Ausbildung zur
Krankenschwester. Englisch hatte sie bereits
in Wien erlernt, so kam sie gut zurecht.
Doch der Ausbruch des Krieges zwang
sie erneut weiterzuziehen. In Wales ergatterte
sie über den Czech Refugee Trust einen
schlecht bezahlten Job in einem Hostel
für Waldarbeiter. 1940 lernte sie den um
acht Jahre älteren slowakischen Flüchtling,
Kommunisten und Spanienkämpfer Ivan
Lipschitz kennen und heiratete ihn. So
konnte sie ihm nach London folgen, wo sie
in einem neuen Beruf zu arbeiten begann:
als Näherin. Als ihr Mann in die tschechoslowakische
Armee eingezogen wurde,
übersiedelte sie erneut, nun nach Oxford,
wo inzwischen ihre Mutter lebte, die sich
ebenfalls nach England retten hatte können.
Dort jobbte sie als Fabriksarbeiterin
in einer Metall verarbeitenden Fabrik und
besuchte zusätzlich die Abendschule, sie
wollte sich auf ein Studium vorbereiten.
Doch schon folgte der nächste Neuanfang:
Nun ging es nach Slough, dort hatte sie
eine Stelle als Laborantin in einer Buntmetallgießerei
ergattert. Als der Betrieb
einsparen musste, wurde sie gekündigt.
Dieses Mal machte sie jedoch einen Karrieresprung:
Sie wurde Mitarbeiterin und
Lektorin bei einer wissenschaftlichen metallurgischen
Zeitung in London.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
reiste sie zu ihrem Mann in die
Slowakei. Dort beherrschte sie aber die
Landessprache nicht und war überdies
als Deutschsprachige und Jüdin Anfeindungen
ausgesetzt. Während der Kriegsjahre
hatte sie es geschafft, mit Verwandten
und Freunden lose in Verbindung zu
bleiben. So erfuhr sie, dass Wolfgang Bock
nach Wien zurückgekehrt war, und machte
sich 1946 auf den Weg in ihre Heimatstadt
– teilweise zu Fuß. In Österreich galt
es zunächst, um die Wiedererlangung ihrer
Staatsbürgerschaft zu kämpfen. Bis sie
ihren Jugendfreund heiraten konnte, vergingen
weitere Jahre. Erst 1949 gelang die
© privat
Die Arbeitsgemeinschaft
„Frauen und Exil“
Begründet wurde die Arbeitsgemeinschaft
„Frauen und Exil“ 2002
von der bereits verstorbenen Exilforscherin
Siglinde Bolbecher. Heute
gehören dem Team der so genannten
„Frauen-AG“ an: die Historikerin und
Soziologin Ilse Korotin (Leitung), die Judaistin
und Historikerin Evelyn Adunka,
die Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin
Heidi Behn, die Journalistin
und Zeithistorikerin Traude Bollauf, die
Literaturwissenschafterin Susanne
Blumesberger und Liesl Fritsch, die
selbst im Exil in England zur Welt kam
und als Kind mit ihrer Mutter nach
Österreich zurückkehrte, die Juristin
Primavera Driessen Gruber, die sich
seit vielen Jahren des Themas Musiker
und Musikerinnen im Exil annimmt, die
Theaterwissenschaftlerin Christine
Kanzler, die Museologin Hadwig Kräutler,
die Exilforscherin Elisabeth Lebensaft,
die Sozialwissenschaftlerin Irene
Messinger, die Kulturwissenschaftlerin
und Historikerin Katharina Prager, die
Übersetzerin und Historikerin Katrin
Sippel und Ursula Stern, die Koordinatorin
der Frauen-AG.
Wer zu diesem Kreis dazustoßen
möchte, ist jederzeit willkommen,
betont die Frauen-AG. Interessante
Einblicke in das Thema gibt es bei der
Vortragsreihe Exil von Frauen –
historische Perspektive und Gegenwart.
Das genaue Programm findet
sich auf: exilforschung.ac.at
komplizierte Scheidung von ihrem ersten
Mann.
Noch einmal musste sich Susanne
Bock in Wien eine neue Existenz aufbauen.
Über Freunde in der kommunistischen
Partei tat sich zunächst ein Posten als
Sekretärin und Lektorin in der britischen
Nachrichtenagentur auf. Als diese aufgelöst
wurde, begann sie im Sommer 1947
für das „American Jewish Joint Distribution
Committee“ zu arbeiten. 1951 wechselte
sie zur damals neu gegründeten israelischen
Fluglinie El Al, 1954 kam ihr Sohn
Peter zur Welt. Noch einmal wechselte sie
die Branche und machte sich mit einem
Sport- und Spielwarengeschäft selbstständig.
Später eröffnete sie mit einem
Geschäftspartner einen Betrieb für keramische
Wand- und Bodenbeläge. Ihr Arbeitsleben
beendete sie schließlich als Sekretärin
einer humanitären Organisation.
Exil der einfachen Frauen. Es sind so
vielfältige Geschichten wie jene von Susanne
Bock, welchen die Frauen der Arbeitsgemeinschaft
„Frauen und Exil“ im
Rahmen der Österreichischen Gesellschaft
für Exilforschung (öge) in ihrer Arbeit auf
der Spur sind. Wenn es um Menschen im
Exil geht, werden gerne die erfolgreichen
Wissenschaftler- oder Künstlerkarrieren
vorgeführt. Doch für viele bedeutete
die Flucht, sich anderswo eine völlig neue
Existenz aufzubauen. Lineare Lebensgeschichten
sind dabei die Ausnahme.
Der Frauen-AG in der öge war es seit ihrer
Gründung im Jahr 2002 immer ein Anliegen,
auch das Exil der einfachen Frauen
zu dokumentieren, sagt Ursula Stern. Sie
erzählt, dass gerade Susanne Bock selbst,
die sich von Beginn an in der Frauen-AG
engagierte und inzwischen Ehrenmitglied
ist, darauf gepocht hat, „dass man auch das
Exil der einfachen Frauen recherchiert“.
So widmet sich die Frauen-AG bis heute
grundsätzlich Frauenschicksalen im Exil.
Viele Tagungen hat man über die Jahre
schon abgehalten, noch mehr Vorträge
wına-magazin.at
17
EINFLUSS AUF SOZIALARBEIT
organisiert, und auch das eine oder andere
Buch ist entstanden. Stellvertretend
kann hier etwa der Band Wissenschafterinnen
in und aus Österreich, herausgegeben
von Brigitta Keintzel und Ilse Korotin,
genannt werden. Die Historikerin und
Soziologin Korotin ist auch die Leiterin
der Frauen-AG.
Die beiden Wissenschaftlerinnen Irene
Messinger und Katharina Prager, ebenfalls
Mitglieder der Frauen-AG, veröffentlichten
zuletzt das Buch Doing Gender in Exile.
Geschlechterverhältnisse, Konstruktionen und
Netzwerke in Bewegung, nachdem sie zuvor
eine gleichnamige Konferenz organisiert
hatten. Was ihnen im Rahmen ihrer
Recherchen über die Jahre auffiel: Sich
im Exil eine neue Existenz aufzubauen,
war zwar durchaus beschwerlich. Mehr
als Männer nützten Frauen die neue Situation
aber auch für einen persönlichen
Aufbruch. „Vielen standen plötzlich
mehr selbstbestimmte Möglichkeiten offen“,
sagt Messinger. „Das Beispiel, das ich
sehr eindringlich finde, ist, dass das Leben
junger orthodoxer Jüdinnen klar vorgezeichnet
gewesen wäre: Heirat und Kinder.
Durch das erzwungene Exil hatten sie
auch andere Optionen, die manche ergriffen
haben.“
Aber auch für Frauen, die in der alten
Heimat bereits studiert hatten, eröffneten
sich im Exil neue Möglichkeiten, betont
Korotin. „Wir haben uns mit vielen Wissenschafterinnen
beschäftigt, und auch
da sieht man deutlich, dass sich Karrieren
entwickeln konnten, die in Österreich nie
möglich gewesen wären.“ Sie nennt dabei
die Bereiche Psychologie, Psychotherapie
und Psychoanalyse in den USA, in denen
einige Frauen aktiv wurden. Kehrten
sie nach dem Sieg der Alliierten über die
Nationalsozialisten allerdings wieder nach
Österreich zurück, „hatten sie im Berufsleben
wieder kaum Chancen gegenüber den
Männern“, bedauert Stern. Schon vor der
NS-Zeit hätten zudem Frauen, die zum
Beispiel Medizin studiert hatten, oftmals
unentgeltlich gearbeitet.
Messinger kennt aber auch andere Facetten.
Sie lehrt an der Fachhochschule für
soziale Arbeit in Wien und forscht dort
derzeit über das Exil von Fürsorgerinnen,
das waren die Sozialarbeiterinnen der
1920er- und 1930er-Jahre. Abseits weniger
herausragender Einzelbiografien sei die
Geschichte der Vertreibung und des Exils
dieser Berufsgruppe noch nicht bearbeitet
und bilde eine Leerstelle in der Professionsgeschichte.
Auch eine andere Gruppe
„Wir haben uns mit
vielen Wissenschaftlerinnen
beschäftigt,
und auch da sieht
man deutlich, dass
sich Karrieren entwickeln
konnten, die in
Österreich nie möglich
gewesen wären.“
Ilse Korotin
sei noch nicht beforscht, „jene, die im Exil
social work studiert haben und dann nach
Österreich zurückgekommen sind und hier
das Selbstverständnis der Sozialarbeit stark
beeinflusst haben“. Das will sie in ihrem
aktuellen Projekt gemeinsam mit Thomas
Wallerberger sichtbar machen.
Messinger kann ihrer Forschungsarbeit
im Rahmen ihrer Tätigkeit für die
Fachhochschule nachgehen, gefördert
vom Zukunftsfonds und Nationalfonds.
Andere Projekte im Bereich der Exilforschung
erhielten ebenfalls Forschungsförderungen,
für Publikationen kann man um
Druckkostenförderung ansuchen. Ein Teil
der Forschungsarbeit erfolge jedoch unbezahlt
– und es fehle auch an den Mitteln,
um nötige Infrastruktur zu finanzieren.
Die Frauen-AG verfügt beispielsweise
über keine eigenen Räumlichkeiten und
wäre daher nicht einmal in der Lage, einen
Nachlass zu übernehmen, um diesen
aufzuarbeiten, bedauert Korotin.
Fehlende Mittel. Bereits bei der Gründung
der Exilgesellschaft 2002 und kurz
darauf der Frauen-AG habe die inzwischen
verstorbene Mitbegründerin, die
Exilforscherin Siglinde Bolbecher, auf die
Etablierung eines Lehrstuhls für Exilforschung
sowie eine Ausstellung zum Thema
gepocht, erzählt Stern. Beides wurde trotz
vieler Gespräche bisher nicht realisiert. Die
finanzielle Situation verschärft sich zudem
zusehends, so Korotin. Nicht nur, dass es
keine Mittel für die Frauen-AG gebe, auch
Förderungen für einzelne Projekte seien
immer schwerer zu lukrieren. Zuletzt habe
etwa die Österreichische Nationalbank
die Förderung von geisteswissenschaftlichen
Forschungsarbeiten eingestellt. Das
bedeute prekäres Arbeiten – und mache
die Exilforschung auch für junge Wissenschaftlerinnen
unattraktiv.
Was Korotin zudem ebenfalls bedauert:
Über die Jahre habe sie viele spannende
Projekte mitverfolgt, doch nach
dem Ende der Laufzeit wurden die biografischen
Unterlagen nicht vernetzt dokumentiert.
Hier fehle die Nachhaltigkeit.
Die Frauen-AG betont, dass es dringend
eine Datenbank brauche, welche die Nachlässe
und Interviews mit Zeitzeugen auffindbar
mache. Oft seien die Hinterlassenschaften
verstreut, Teile befänden sich
in Archiven, andere bei Nachkommen. In
einem elektronischen Archiv könnten die
Bestände digital zusammengetragen und
für die wissenschaftliche Bearbeitung erschlossen
werden.
Dass der Exilforschung bisher so ein
niedriger Stellenwert eingeräumt wurde,
bedauern Stern, Korotin und Messinger.
Sehr zuversichtlich sind sie nicht, dass sich
da in absehbarer Zeit etwas ändert. Sie
werden aber nicht müde, für die Anliegen
der Exilforschung Bewusstsein zu schaffen
– und dabei vor allem für das Erforschen
von Frauenschicksalen. Frauen, das
betrifft nicht nur das Exil, sondern auch
den Widerstand, eine die Eigenschaft, im
Nachhinein ihre Rolle herunterzuspielen,
obwohl sich gerade Frauen nach der
Flucht oft besser im Alltag zurechtfanden
als Männer, so Korotin. Ihre Errungenschaften
nachzuzeichnen, sei daher auch
aus der feministischen Perspektive spannend
– und könne nicht zuletzt, wie Messinger
betont, auch herangezogen werden,
wenn es um die Situation von geflüchteten
Frauen heute gehe.
Das ist auch Stern ein wichtiges Anliegen.
Sie betont, dass es in der Exilforschung
einen Paradigmenwechsel von der ausschließlichen
Befassung des historischen
Exils während der Ära des Nationalsozialismus
sowie des Austrofaschismus hin zu
einer Erweiterung des Forschungsgegenstandes
auf die gegenwärtigen Flucht- und
Migrationsbewegungen gebe. Die Fragen,
die zu stellen seien: „Gibt es vergleichbare
Aspekte zwischen dem Exil von Frauen
zwischen 1933 und 1945 und dem Asyl
von Frauen heute? Was sind die Gemeinsamkeiten,
was sind die Unterschiede? Ist
der Beitrag zur Erinnerung an die Verfolgung
konstitutiv für unsere Haltung gegenüber
heutigen Fluchtbewegungen, und
führt die eigene Flüchtlingserfahrung, sei
es zur Zeit der Schoah, sei es in den Jahren
nach 1945, zu praktizierter Solidarität
mit den heute Verfolgten?“
18 wına | Februar 2020
IDENTITÄTSKONSTRUKTIONEN
© Pablo Rudich/privat
Pablo Rudich:
DAZWISCHENDASEIN.
Jüdisches Leben
zwischen Czernowitz,
Wien und Montevideo.
Mandelbaum Verlag
2019, 142 S., 20 €
Es gab weder Briefe noch Tagebücher,
und dem persönlichen Gespräch
über die Jugend in Wien
verweigerte sich der jüdische Vater im
uruguayischen Exil. Dennoch wollte der
Sohn, der 1964 in Montevideo geboren
wurde und 1978 in die Geburtsstadt
seines Vaters übersiedelte, die Familiengeschichte
recherchieren. Als Historiker
wählte Pablo Rudich für die Spurensuche
zum Lebensweg seiner jüdischen
Großeltern und seines Vaters den akademischen
Zugang: In seinem Buch DA-
ZWISCHENDASEIN. Jüdisches Leben
zwischen Czernowitz, Wien und Montevideo
stellt er das Schicksal einer jüdischen
Familie exemplarisch in den größeren
Zusammenhang von Vertreibung,
Flucht und Exil.
Die „globale“ Bukowina und Czernowitz,
die Kriegsflüchtlinge im Ersten
Weltkrieg sind ebenso Thema wie die
„Zugehörigkeit und Identitätskonstruktionen
im Lichte von Staatsbürgerschaft
und Heimatrecht“. Aber auch Zufälle
interessieren Rudich: „Ich war dreizehn
Jahre alt, als ich in Wien ankam, mein
Vater Alfred Rudich dreiundfünfzig. Als
er 1938 gezwungenermaßen aus Wien
fliehen musste, kam er als Dreizehnjähriger
in meiner Geburtsstadt Montevideo
an, sein Vater, Wolf Rudich, war damals
dreiundfünfzig“, erzählt der Autor.
Dem Vater sollte es auch nicht nützen,
dass er seine Erinnerungen verdrängte
und diese seinen Kindern vorenthielt.
„In der Gegenwart holt uns des Vaters
Vergangenheit ein. Wie aus Zufall hat
jedes von uns vier erwachsenen Kindern
nun eine Wohnung im 2. Bezirk, der Leopoldstadt“,
so Pablo. „Ein großer Teil dieses
Bezirks ist seit der Anlage des ersten
jüdischen Ghettos Anfang des 17. Jahrhunderts
mit der Geschichte der Juden
und Jüdinnen eng verbunden.“
Die Auswirkungen
von Migration
Wie man sich mit
spärlichem Material eine
Familienchronik bastelt,
zeigt der Historiker
Pablo Rudich in
seiner Masterarbeit auf.
Von Marta S. Halpert
Die Großeltern des Historikers, Serafine
König und Wolf Rudich, stammten
aus Czernowitz, aus dem östlichen Randgebiet
der Habsburgermonarchie. Die
Hauptstadt der Bukowina, ein Hort des
blühenden jüdischen Lebens, der Vielsprachigkeit
und einer immens reichen
Kulturtradition, gehört heute zur Ukraine.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs
1914 mussten die Großeltern vor einer
russischen Offensive nach Wien flüchten.
1918 kehrten sie vorübergehend nach
Czernowitz zurück, ließen sich aber später
in Wien an verschiedenen Adressen
nieder. „Mein Großvater war Jurist, viel
mehr ist den vorhandenen Quellen nicht
zu entnehmen. Nur dass ein beträchtlichen
Teil von ‚Buko-Wienern‘ damals in
Wien lebte“, lacht Pablo Rudich, der später
auch in Barcelona und Stuttgart lebte.
In dieser Masterarbeit, die zum gut
leserlichen Buch wurde, bemüht er sich,
das Schicksal von Jüdinnen und Juden
mit ähnlich gelagerten Lebenssituationen
nachzuzeichnen. „Diese Untersuchung
hat den Anspruch, nicht nur die
Frage der jüdischen Identität zu behandeln,
sondern in einem breiteren Sinn den
Fokus auf die Auswirkungen von Migrationen
auf die individuelle und kollektive
Identität der betroffenen Menschen
zu lenken“, schreibt Pablo Rudich.
Er stellt sich angesichts der – erzwungenen
– kosmopolitischen Lebenssituation
seiner Familie die Frage, wie Migranten
von ihrem Zielland beeinflusst
werden und umgekehrt dieses beeinflussen.
„Dass dieser kulturelle Austausch negative
Folgen haben soll, ist ein mani-
pulatives, häufig von Angst schürenden
Politikern hervorgebrachtes Argument“,
lautet das Fazit des Historikers.
Pablo Rudich, der auch als Fremdenführer
tätig ist, hat zwei Söhne und eine
Tochter; seine Schwester Julieta Rudich
ist Lateinamerika-Expertin im ORF-
Fernsehen und gestaltet umfassende Reportagen
für das Weltjournal. „Obwohl
der Vater uns nie explizit etwas von jüdischer
Identität mitgegeben hat, sind wir
ohne eindeutige Absicht im bis 1938 jüdischsten
Viertel Wiens angekommen,
Pablo Rudich (rechts) mit seinem Vater Wolf
Ruddich und seinen drei Geschwistern.
man könnte auch sagen ‚beheimatet‘. Und
das, obwohl die Rückkehr meines Vater
nach Wien für seine Kinder zu einer Entwurzelung
von deren eigenem Geburtsland
Uruguay führte.“ Prägend war für
die vier Rudich-Geschwister auch, dass
sie aus einer nomadischen Genealogie
stammen und zwischen 1973 und 1978
dreimal das Land gewechselt haben. „So
wird für mich die wiederholt gestellte
Frage, woher ich bin, zu welchem Land
ich mich zugehörig fühle, immer schwerer
zu beantworten.“
wına-magazin.at
19
AUSGRENZENDE HALTUNG
Barbara Serloth:
Nach der Shoah.
Politik und Antisemitismus
in Österreich
nach 1945.
Mandelbaum Verlag,
304 S., 25 €
„Antisemiten sind
zumeist die anderen“
Barbara Serloth zeigt in ihrem Buch Nach der Shoah
auf, wie hartnäckig sich auch nach 1945 die antijüdischen
Vorurteile in Österreich gehalten haben.
Von Marta S. Halpert
Wer die früheren Bücher und
Publikationen von Barbara
Serloth kennt, weiß, dass die
Politikwissenschaftlerin nicht nur akribisch
recherchiert und schonungslos
aufdeckt, sondern sich auch keineswegs
scheut, die Aufmerksamkeit auf wunde
Punkte der österreichischen Innenpolitik
zu lenken. 2016 legte sie im Mandelbaum
Verlag ihre Arbeit Von Opfern, Tätern und
jenen dazwischen vor (siehe dazu Wie Antisemitismus
die Republik mitbegründete in
WINA 12/17). Jüngst erschient im gleichen
Verlag Nach der Shoah. Politik und
Antisemitismus in Österreich nach 1945.
Serloth stellt sich die Frage, wie sich
trotz aller gegenteiliger Beteuerungen der
tief verwurzelte Antisemitismus in der
„beobachteten Demokratie“ der Nachkriegsjahre
halten konnte. Dieser wirkte
sich nämlich brutal skrupel- und schamlos
auf die Forderungen der österreichischen
Juden und Jüdinnen nach Restitution
und Gleichberechtigung aus. „Österreich
macht es sich heute mit dem Nationalsozialismus
nicht mehr so einfach. Man
stellt sich – wenn auch nicht ganz – der
Mitschuld an dessen Gräueltaten, doch
der Opfermythos gehört noch immer zum
gängigen Narrativ“, stellt die Autorin fest.
„Aber im Gegensatz zum Nationalsozialismus
geht man mit dem Antisemitismus
auch jetzt noch relativ sorglos um – zumindest
dann, wenn es um den eigenen
geht. Antisemiten sind zumeist die anderen.“
Für das rechte politische Lager existiere
vor allem der muslimische Judenhass,
für die Linken der rechtsradikale. Ferner
konstatiert Serloth, dass die Konservativen
den christlichen Antisemitismus genauso
gerne ausblenden wie die Linken
den antizionistischen.
„Der Nationalsozialismus und seine Untaten wurden
kurzerhand exterritorialisiert und als Gesamtpaket
der Bundesrepublik Deutschland übergeben.“
Stereotype verfestigt. Die langjährige
Lektorin des Instituts für Staatswissenschaften
der Universität Wien ist auch
Leiterin der politischen Dokumentation
der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion.
In ihrem neuen Buch analysiert
sie sowohl die politischen und parlamentarischen
Diskurse wie auch die Gesetzwerdungsprozesse
und letztlich die Restitutionsgesetze
seit 1945. Mit äußerster
Sorgfalt zeigt sie die ambivalente, ausgrenzende
Haltung der damaligen politischen
Eliten auf: Das Vorurteil, dass
Juden und Jüdinnen, die ihr Eigentum
zurückforderten, sich bereichern wollten,
blieb dabei zentral. „Die Gruppe der Geflohenen
wurde in den politischen Narrativen
zumeist auch nach 1945 aus der
Wir-Gemeinschaft der ‚echten‘ Österreicherinnen
und Österreicher entfernt. Damit
ging nicht immer, aber auffallend häufig
die Delegitimation ihrer politischen
Wortmeldungen und/oder rechtlichen
Ansprüche einher“, stellt die Wissenschaftlerin
fest. So hätten sich in der langen
Nachkriegszeit die antisemitischen
Stereotype innerhalb der demokratischen
Strukturen verfestigt. Erst in den späten
1980er-Jahren wurde mit dem Aufbrechen
des Opfermythos – auch infolge
der Waldheim-Affäre – mit der Aufarbeitung
der NS-Vergangenheit und der
Restitutionsfrage begonnen. „Der Nationalsozialismus
und seine Untaten wurden
kurzerhand exterritorialisiert und als Gesamtpaket
der Bundesrepublik Deutschland
übergeben.“
Die tiefer liegenden Wurzeln für das
Verhalten nach der Schoah sieht Serloth
in der Ausblendung des Austrofaschismus
in Österreich zwischen 1934 und
1938: Einerseits hätte seine Erwähnung
die Mär von der demokratischen Kontinuität
infrage gestellt, andererseits war
man bedacht, die politischen Gräben des
Bürgerkrieges zuzuschütten. Das politische
Ziel sei es gewesen, die erzählte Einigkeit,
die österreichische „Schicksalsgemeinschaft“
nicht mit Aufarbeitungen
der geschichtlichen Realität zu entzaubern.
„Nur durch die Erzählung, dass die
österreichische Demokratie allein wegen
der Okkupation durch das als fremde
und feindliche Macht dargestellte Hitler-Deutschland
gewaltsam unterbrochen
worden war, konnten der Opfermythos
gestärkt und die Unschuldsthese abgesichert
werden.“
Die Autorin beschreibt die Integration
der „Ehemaligen“ anhand von Beispielen,
die beweisen, wie diese Gruppe verhätschelt
und politisch umworben wurde, bei
gleichzeitiger Verniedlichung ihrer Taten.
Und sie zeigt auf, wie die Arisierungen
heruntergespielt und abgewertet wurden,
während die Flucht „ins sichere Ausland,
wo es ihnen so gut ging“ brutal verharmlost
wird.
20 wına | Februar 2020
TEIL DER NORMALITÄT
Matthias Falter:
Die Grenzen der Demokratie.
Politische Auseinandersetzungen
um
Rechstextremismus
im österreichischen
Nationalrat.
Facultas Verlag,
289 S., 60,70 €
Die Rechte
lässt grüßen
Das Thema Rechtsextremismus
ist in Debatten des österreichischen
Parlaments sehr präsent.
Zu diesem Ergebnis kommt der Politikwissenschaftler
Matthias Falter in seiner
Dissertation, die nun unter dem Titel Die
Grenzen der Demokratie auch als Buch erschienen
ist. Genauer angesehen hat er
sich dabei die politischen Auseinandersetzungen
um Rechtsextremismus im österreichischen
Nationalrat in den Jahren
1999 bis 2013.
Dabei erstaunt dann doch, wie oft über
Rechtsextremismus diskutiert wurde:
Falter fand in 39 Prozent aller Nationalratssitzungen
themenspezifische Kontroversen,
Äußerungen oder Zwischenrufe.
Besonders stachen dabei die Jahre
1999 bis 2002 – damals kam es zur ersten
schwarz-blauen Koalition – heraus. Der
Politikwissenschaftler spricht hier von
Rechtsextremismus als „Querschnittsmaterie“,
denn debattiert wurde darüber
„oftmals unabhängig von den jeweiligen
Tagesordnungspunkten“.
Ein Beispiel: Gleich die erste Sitzung
des damals neu gewählten Nationalrats
Ende Oktober 1999 entwickelte sich als
Reaktion auf Aussagen des FPÖ-Kandidaten
für das Amt des Zweiten Nationalratspräsidenten,
Thomas Prinzhorn,
zu einer Debatte über Rassismus und
eben auch Rechtsextremismus, wie Falter
nachzeichnet. „Während des Wahlkampfs
hatte Prinzhorn in einem Interview
behauptet, dass AusländerInnen mit
staatlicher Unterstützung fruchtbarkeitssteigernde
Hormonpräparate bekommen
würden, während dies InländerInnen oft
verwehrt bliebe. Prinzhorn reproduzierte
damit verschwörungstheoretisch aufgeladene
rassistische Diskurse, die eine Be-
Der Politikwissenschaftler
Matthias Falter analysierte
Nationalratsdebatten,
um festzustellen,
wie oft es dabei um
Rechtsextremismus ging.
Die Forschungsergebnisse
sind ernüchternd.
Von Alexia Weiss
drohung der imaginierten biologischen,
d.h. ‚völkischen‘ Substanz konstruieren.
Vergangenheitspolitische Dimension
bekam die Debatte um Prinzhorn noch
durch Medienberichte über die Verwicklung
von Prinzhorns Konzern in Arisierungen
während der NS-Zeit.“
Rechte Tendenzen. Die Debatte um
Prinzhorn habe sich in der Folge zu einer
generellen Debatte über extrem rechte
Tendenzen in der FPÖ und einen allgemeinen
gesellschaftlichen Rechtsruck
entwickelt. Politischer Hintergrund war
der große Erfolg der FPÖ unter Jörg
Haider bei der vorangegangenen Nati-
onalratswahl. Prinzhorns Äußerung sei
im Kontext eines von ethnischen Feindbildern
geprägten Wahlkampfes der FPÖ
gefallen. „Mit dem affichierten Plakatslogan
‚Stop der Überfremdung‘ hatten
die Freiheitlichen einen Begriff aus
dem historischen und zeitgenössischen
rechtsextremen Denken in den offiziellen
Wahlkampf eingeführt und damit
auch zu einer Normalisierung beigetragen“,
analysiert Falter. „Spitzenkandidat
Prinzhorn und Parteichef Haider wurden
auf einem weiteren Wahlplakat als
‚zwei echte Österreicher‘ präsentiert, das
an ein ÖVP-Plakat von 1970 erinnerte,
in dem sich der ÖVP-Spitzenkandidat
Josef Klaus als ‚echter Österreicher‘ gegenüber
dem jüdischen SPÖ-Kandidaten
Bruno Kreisky präsentierte.“
Man merkt bei der Lektüre des Buches
also rasch: Hier ist man mitten in der
österreichischen Verfasstheit der Gesellschaft,
die zwar in Nationalratsdebatten
oft diskutiert, aber in der Realität kaum
verändert wird. Davon zeugten nicht zuletzt
die Vorkommnisse und Debatten
unter der türkis-blauen Koalition von Sebastian
Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian
Strache (FPÖ) in den vergangenen
Jahren. Falter spricht von einem „uneindeutigen
Verhältnis zwischen Rechtsextremismus
und der demokratischen
Gesellschaft“ und konstatiert: „Dem abstrakten,
parteiübergreifenden Konsens
der Ablehnung von Rechtsextremismus
steht die Normalisierung extrem rechter
Positionen und Politiken gegenüber.
Rechtsextremismus ist Teil der österreichischen
Normalität und manifestiert
sich im semiprivaten Raum ebenso wie
in der politischen und medialen Öffentlichkeit.“
wına-magazin.at
21
ZUNEHMENDE RADIKALISIERUNG
Der Wiener Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs
kämpft an vielen Fronten gegen die zunehmende Radikalisierung
von Jugendlichen und für eine wirksame Integration.
erfolgung, Radikalisierung und Bedrohung
kennt Ercan Nik Nafs aus
der eigenen Familiengeschichte. Er
stammt aus dem kurdisch-armenischen
Teil der Türkei, in dem die meisten Alewiten
leben, eine von der Türkei nicht anerkannte
Glaubensgemeinschaft, die sich
immer außerhalb des Islams gesehen hat.
„Das Gebiet war über Jahrhunderte
hinweg von Verfolgung betroffen, es gab
Genozide an Armeniern und Kurden.
Meine Großeltern gehörten einer Generation
elternloser Kinder an, denn deren
Eltern kamen in einem Genozid um.“
Diesen Background einerseits und
seine Erfahrung, „wie das Leben anders
sein kann in Freiheit und Sicherheit“, die
er in Österreich machte, erkennt er rückblickend
als prägend.
„1992 bin ich als Student nach Wien
gekommen, 1992 wurde in Wien auch die
Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA)
gegründet.“ Seit 2014 leitet Ercan Nik
Nafs als ausgewiesener Extremismusexperte
diese Stelle in der Alserbachstraße.
„Wir sind als Ombudsstelle mit der
Wahrung der Rechte von Kindern und Jugendlichen
beauftragt. Man kann sich an
uns wenden, wenn man glaubt, dass diese
Rechte verletzt werden. Es kommen Beschwerden
über Schulen und Anfragen zu
Jugendschutz, und es gibt eine Netzwerkarbeit
mit anderen Behörden.“
Diese führte 2014 über einen Gemeinderatsbeschluss
auch zum „Netzwerk Demokratiekultur
und Prävention“, das sich
dem Thema Dschihadismus widmete, der
tausende junge Menschen aus Europa in
die Kriegsgebiete zog.
„Unser Ziel war es, Jugendliche vor
Mord und Tod zu bewahren, davor, sich
selbst oder anderen zu schaden. Wir haben
mit einer Vielzahl von Jugendlichen
und deren Eltern gearbeitet, unterstützt
von den Präventionsabteilungen der Polizei,
dem LKA und dem BVT gemeinsam
mit vielen Dienststellen. Unser Ziel
ist mittlerweile nicht nur der Kampf gegen
den Dschihadismus. Unser Rezept gegen
Extremismus ist die Stärkung der Demokratiekultur
und der Menschenrechte und
Von Anita Pollak
andererseits der Schutz vor Armut, Diskriminierung
und vor Gewalt, Menschen,
die von Ausgrenzung bedroht sind, zu integrieren,
einen Platz in der Gesellschaft
anzubieten und entschieden gegen nationalistische
Gruppen vorzugehen.“
Alarmierende Studie. Trotz aller derartigen
Bemühungen stellte der Soziologe
Kenan Güngör in einer aktuellen Studie
fest, dass die Radikalisierung unter
Jugendlichen alarmierend zugenommen
hat, obwohl es, was das Demokratieverständnis
betrifft, sogar eine positive Entwicklung
gab. Gleichzeitig nehmen Gewaltbereitschaft
und Antisemitismus zu.
Auch Frauenfeindlichkeit und Homophobie
sind verstärkt wahrnehmbar.
Haben sich diese Tendenzen seit der
Einwanderungswelle 2015 und danach, in
der doch viele Jugendliche aus Afghanistan
und Syrien zu uns kamen, verstärkt?
„Sie haben sich verändert. Die erste Studie
von 2016, die in Wiener Jugendeinrichtungen
gemacht wurde, hatte, was die
Gewaltbereitschaft betraf, ebenso alarmierende
Ergebnisse, und auch die abwertenden
Einstellungen, also Antisemitismus,
Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Sexismus
und ethnokulturelle Abwertungen
waren sehr hoch, aber diese Untersuchung
betraf nur Jugendliche in gewissen
Jugendeinrichtungen. Die aktuelle Studie
bezieht sich auf etwa 800 Jugendliche
in ganz Wien in einer Face-to-face-Befragung.
Alarmierend ist dabei die ausgeprägte
Homophobie und dass es beim An-
tisemitismus ganz unterschiedliche Werte
gibt. Bei aus Bosnien stammenden Jugendlichen
hat nur beim Antisemitismus eine
ungeheure Steigerung stattgefunden.“
Immerhin zwei Drittel dieser an sich
gut integrierten bosnischen Jugendlichen
sind der Überzeugung, so stellen die Studienautoren
fest, dass Juden „zu viel Einfluss
auf der Welt“ hätten. Mehr als die
Hälfte afghanischer Jugendlicher wünscht
sich an der Spitze des Staates eine religiöse
Führerfigur und bejaht Gewalt als legitimes
Mittel, „wenn die Ehre beleidigt wird“.
Die Ursachen dieser schockierenden
Ergebnisse ortet Ercan Nik Nafs unter
anderem in Gewalterfahrungen im Elternhaus,
prägenden Einstellungen in
der Familie und in sogenannten Diskriminierungserfahrungen
in Bildungseinrichtungen.
„Was den Antisemitismus betrifft, sind
für mich auch die seit Jahren laufende Propaganda
gegen Israel, die antisemitischen
Kampagnen im Iran und der Türkei und
rechtsextremer Gruppen dafür verantwortlich.
Beim Al-Quds-Tag hat man in Berlin
israelische Fahnen verbrannt. In der Türkei
zieht der Präsident praktisch jeden Tag gegen
Israel ins Feld, und türkische Zeitungen
fordern Muslime dazu auf, Jerusalem
zurückzuerobern. Aber eine antisemitische
Tradition gibt es auch in Europa seit Ewigkeiten,
und in den islamischen Ländern
sind der Judenhass und die Verfolgung der
Juden auch nichts Neues.“
Zur antisemitischen Indoktrinierung in
den Herkunftsländern komme die mittlerweile
globale Verhetzung in den sozialen
Netzwerken, die auch hierzulande bekämpft
werden müsse.
Spitze des Eisbergs. Gibt es, wenn man
das Beispiel der antisemitischen bosnischen
Jugendlichen betrachtet, die ja seit
den 1990er-Jahren da sind, überhaupt
Hoffnung auf Aufklärung?
„Abwertungen
sind das Grundübel
katastrophaler Zeiten“
22 wına | Februar 2020
THEMA KURZTITEL
© Robert Newald/picturedesk.com
„Nur in Europa oder Österreich zu sein,
reicht nicht. In Österreich waren in den
letzten Jahren islamistische und rechtsextreme
Gruppen enorm aktiv, und es
gab kein systematisches Vorgehen dagegen.
Wir haben wohl Enormes gegen den
Dschihadimus unternommen, aber der ist
nur die Spitze des Eisbergs der Barbarei.
Darunter gib es weit mehr. Jetzt hoffen
wir, in diesem Jahr einmal den Eisberg
anzufassen. Wir fordern seit einigen Jahren
eine Beobachtungsstelle für Islamismus,
um zu erfahren, welche Gruppen tatsächlich
demokratiefeindliche Haltungen
propagieren, und dasselbe fordern wir auch
für Rechtsextreme und dass darüber Stellen
wie die unsere informiert werden, damit
wir wissen, mit welchen gefährlichen
Gruppen wir es zu tun haben.“
Immer wieder werden, was die religiöse
Radikalisierung betrifft, auch die Koranschulen
erwähnt, in die man ja nicht
wirklich hineinleuchten kann.
„Alle geschlossenen Räume, in denen
Kinder und Jugendliche sind, müssen geöffnet
werden. Wir hatten bereits 2015 gemeinsam
mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft
Initiativen zur Erarbeitung
von Leitlinien auf Grundlage der modernen
Pädagogik und der Kinderrechte gestartet,
was aber leider nicht zustande gekommen
ist.“
Aktiv werden kann die KJA nur, wenn
ein Mandat in Form einer Beschwerde
vorliegt, stellt Nik Nafs fest, aber jede Art
von Indoktrinierung stelle Gewalt dar.
„Kinder, die in einer gewissen Abwertungseinstellung
gegen ihre Umwelt aufwachsen,
entwickeln auf Dauer Haltungen,
die für ihre Entwicklung und die Gesellschaft
schädlich sind. Abwertungen sind
das Grundübel katastrophaler Zeiten gewesen,
wenn wir uns nur an Nazi-Deutschland
erinnern.“
Wie gelangt man aber über die Diagnose
zur Therapie oder vielleicht sogar zur
Prophylaxe?
„Viele Studien sagen, Vorurteile werden
abgebaut, wenn Gruppen und Cliquen
durchmischt sind. Demokratie- und Menschenrechtsbildung
müssen aber gelernt
werden, da gibt es den gesellschaftlichen
Bildungsauftrag. Viele Kinder, Jugendliche,
aber auch Frauen erleben Gewalt in
den eigenen vier Wänden, daher ist Gewaltprävention
in den Familien vorrangig.
Das sind schwierige, aber nicht unlösbare
Aufgaben, man muss sie jedoch verfolgen.
Viele Empfehlungen dazu sind bis jetzt
auf Bundesebene nicht umgesetzt worden.
Im neuen Regierungsprogramm
stehen aber
einige Dinge, die wir
seit Jahren fordern, wie
eine Dokumentationsstelle
Rechtsextremismus,
ein Aktionsplan
zur Demokratiebildung
und eine Dokumentationsstelle
des politischen
Islams, die zum
Islamismus in Österreich
forschen und alle
zuständigen Stellen
informieren soll. Dazu
müsste aber zuerst eine
Definition des politischen
Islams oder Islamismus
vorliegen, d. h.
wir sind noch ganz am
Beginn unserer Bestrebungen.
Wenn aber
diese Stelle weisungsfrei
wäre und mit den
notwendigen Mitteln
als multiprofessionelle
Einheit entsprechend
personell ausgestattet
werden würde, könnte
es in einigen Jahren
durchaus Erfolge geben.
Weiters gibt es seit 2002 in Österreich
keinen Rechtsextremismusbericht
mehr. Dieser müsste ebenso erstellt werden
wie ein nationaler Aktionsplan gegen
Rechtsextremismus. Ansätze sind da, aber
diese müssten so etabliert werden, dass sie
Erfolge haben können.“
Rechtsextreme Mitte. Gerade in Zusammenhang
mit dem neuen Regierungsprogramm
ortet die Linguistin Ruth Wodak
„rechtsextreme Narrative“ und warnt
vor einer schleichenden Normalisierung
rechtsextremer Positionen, die sich auf die
Mitte der Gesellschaft zubewegen. Auch
„In Österreich
ist eine neue
Zeit angebrochen,
die uns andere Türen
öffnet.“
Ercan Nik Nafs
Ercan Nik Nafs sieht diese
Gefahr und darin auch einen
weiteren Auftrag für
seine Arbeit. „Bei Radikalisierungsprozessen
wie auch
in den sogenannten Turboradikalisierungen
der letzten
Jahre spielen ganz unterschiedliche Faktoren
eine Rolle. Einerseits persönliche
biografische Brüche, andererseits Abwertungseinstellungen,
die fast so alt wie die
Menschheit sind und immer reproduziert
werden. Es gibt ja auch Parteien, die solche
Ideologien fördern. Die Arbeit, Abwertungsideologien
zu bekämpfen, wird nie
aufhören. Seit eineinhalb Jahren läuft das
Programm AWID gegen Abwertungseinstellungen,
das Informationsmaterial für
Schulen etablieren soll. Bis wir aber merken,
dass es ein Problem gibt, und danach
ein Programm entwickeln können, das zu
Lösungsansätzen führt, vergehen Jahre.
D. h. dieses Rad muss ständig am Laufen
gehalten werden. Wir leben in besonderen,
unsicheren Zeiten, es gibt weltweit eine
Kontinuität der Konflikte, und das macht
vielen Menschen Angst. Ich denke aber, in
Österreich ist eine neue Zeit angebrochen,
die uns andere Türen öffnet.“
Ercan Nik Nafs.
„Meine Großeltern
gehörten einer Generation
elternloser
Kinder an, denn
deren Eltern kamen
in einem Genozid
um.“
wına-magazin.at
23
NACHRICHTEN AUS TEL AVIV
Klappe,
die Dritte
Trotz aller politischen Debatten entscheidet vor allem
die Gruppenzugehörigkeit über das Wahlverhalten der
Israelis. Allzu viel Spielraum ist da nicht.
Man darf allerdings bezweifeln, dass
Netanjahus Likud-Partei diesmal mehr
Stimmen bekommt als beim letzten Mal.
Diesmal wird es ein Montag sein,
nicht wie üblich ein Dienstag,
ansonsten hat sich auch beim
dritten Anlauf innerhalb eines
Jahres nicht viel verändert: Am
2. März finden (schon wieder)
Wahlen statt, und niemand kann mit Sicherheit
vorhersagen, dass diesmal dabei am Ende eine Regierung
herauskommt.
Einmal abgesehen von den Kosten, die mit diesem
Limbo verbunden sind, und den vielen aufgeschobenen
Entscheidungen, die an Budgets
gebunden sind, funktioniert das Land aber eigentlich
ziemlich gut. Die Menschen stehen wie immer
morgens auf, gehen zur Arbeit, bereiten sich
auf immer mögliche kriegerische Auseinandersetzungen
vor, planen Ferien und teilen in diversen
WhatsApp-Gruppen Gleichgesinnten mit, was sie
so von der Lage halten.
Als beim letzten Raketenalarm in Tel Aviv, das
war um halb acht in der Früh im November, der
gesamte Unterricht in den Schulen abgesagt wurde,
erinnerte zwei Minuten später ein Elftklässler seine
Mitschüler daran, dass ja gerade Dienstag sei. „Vielleicht
könnte man das doch gleich ausnutzen und
Wahlen abhalten“, witzelte er, wo doch schon
die Klassenzimmer – wenn auch aus anderen
Gründen – freigeräumt seien. Bisher haben die
Wahltage den Kindern immerhin schon drei zusätzlich
freie Tage in einem Jahr gebracht.
Bei den älteren Jahrgängen, die fast alle Whats-
App-Gruppen haben, die sie mit ihren Mitschülern
von einst verbinden, kursiert gerade ein anderer
Witz: Ein Roboter serviert Drinks in einer Bar
und führt mit den Gästen Gespräche auf Augenhöhe.
Dazu fragt er vorher immer jeweils nach ihrem
IQ. Als ein Mann mit einem IQ von 150 zu ihm
kommt, diskutiert der Roboter mit ihm über Gentechnologie
und Klimawandel. Der Mann nimmt
sich daraufhin vor, den Roboter zu testen. Er geht
hinaus und kommt als Gast mit IQ 100 zurück. Der
Roboter redet mit ihm prompt über Fußball und
Frauen. Schließlich probiert derselbe Gast noch einen
dritten Anlauf – mit IQ 50. Daraufhin wendet
sich der Roboter an ihn und startet, langsam und
deutlich, das Gespräch mit: „Und … du … wirst
… nun ... wieder … Bibi … wählen?“
Gegen das Image der Unterbelichteten wehrten
sich in einer mehrteiligen Fernsehreportrage Likud-Aktivisten.
Seit Netanjahu offiziell angeklagt
wurde, gehen sie für ihn auf die Straße. Ihre Botschaft
lautete: Man könne für Bibi sein und trotzdem
noch klar denken. Ihr Hauptargument: Ein
erfolgreicher Regierungschef sollte nicht von Richtern
oder Staatsanwälten abgesetzt werden dürfen,
dafür wären allein die Wähler zuständig.
Man darf allerdings bezweifeln, dass Netanjahus
Likud-Partei diesmal mehr Stimmen bekommt als
beim letzten Mal. Die jüngsten Umfragen bestätigen
den Abwärtstrend. Auch lag Benny Gantz von
Blau-Weiß erstmal vorne bei der Frage, wer als
Ministerpräsident am meisten geeignet wäre.
Tektonische Veränderungen des Wahlverhal-
Von Gisela Dachs
24 wına | Februar 2020
© Hadas Parush/flash90
tens sind aber nicht zu erwarten. Denn letztlich
gehe es bei den Wahlen weder um die Anklagen
gegen Bibi oder um die Annektierung des Jordantals
noch um Säkularisierung, schreibt Chefredakteur
Aluf Benn in Haaretz. In seinem Artikel mit
dem Titel Sag mir, wo du wohnst, und ich sage dir,
was du wählst erinnert er daran, dass all diese heiß
debattierten Themen nur ein Deckblatt seien für
den Kampf zwischen rivalisierenden „Stämmen“ –
wie sie Präsident Rivin in seiner berühmten Rede
2015 beschrieben hatte. Rivlin thematisierte dabei
die sozioökonomischen Veränderungen der israelischen
Gesellschaft, die aus sich zahlenmäßig
immer mehr angleichenden vier Gruppen bestehe:
säkulare, nationalreligiöse, ultraorthodoxe und arabische
Israelis. Benn zieht ähnliche Linien, was das
Wahlverhalten angeht. Gestützt durch statistische
Daten, lassen sich die (säkularen und gebildeten)
wohlhabenderen Schichten und die arabischen Israelis
auf der Linken verorten und die Gottesfürchtigen
und die breite Mittelschicht auf der Rechten.
Kein Wunder, dass sich Blau-Weiß als Zentrumspartei
präsentiert.
In der Hoffnung auf ein klareres Wahlergebnis
und um verlorene Stimmen zu verhindern, haben
sich nun Politiker auf beiden Seiten in gemeinsamen
Listen zusammengetan. Seitdem die Sperrklausel
2015 auf 3,25 Prozent angehoben wurde, ist
die Sorge kleiner Parteien groß, den Sprung in die
Knesset nicht zu schaffen. Wie es aussieht, werden
es diesmal die Kandidaten von nur acht Parteilisten
ins Parlament schaffen, so wenig wie noch nie.
So hat auch der Chef der Israelischen Arbeitspartei
haAwoda, Amir Peretz, letztlich zähneknirschend
einer Allianz mit Meretz zugestimmt. Die
Sorge war groß, dass es die historische Gründer-
Groß oder
klein? Am Ende
der aktuellen
Entwicklungen
könnten nur
noch zwei Großparteien
bestehen
bleiben
– oder zahllose
personalisierte
„Mikroparteien“.
partei des Landes alleine vielleicht gar nicht mehr
ins Parlament schaffen würde. Amir kann bestenfalls
mit einer Handvoll an Knesset-Abgeordneten
rechnen. Das ist heute alles, was übrig geblieben ist
von der Partei, die das Land in der ersten Hälfte
seiner Geschichte allein regiert hat. Damit liegen
die israelischen Sozialdemokraten aber voll im europäischen
Trend.
In den vergangenen sieben Jahren hat sich das
linke Spektrum stark verkleinert. Hatten es 2013
noch acht zentristisch-linke Listen in diese 19.
Knesset geschafft, werden es jetzt in der 23. Knesset
nur mehr drei sein: Blau-Weiß, Arbeitspartei-
Wie es aussieht, werden es diesmal die Kandidaten
von nur acht Parteilisten ins Parlament
schaffen, so wenig wie noch nie zuvor.
Gesher-Meretz und die Vereinte arabische Liste.
Während die Listenzahl insgesamt abgenommen
hat, nahm aber die Zahl der Parteien innerhalb
dieser Listen zu. 2013 gab es insgesamt neun Parteien
in den Blöcken, heute bestehen die drei Listen
aus zehn Parteien: drei in Blau-Weiß, drei in Arbeitspartei-Gesher-Meretz
und vier in der Vereinten
Liste. Beim Israelischen Demokratischen Institut
(IDI) fragt man sich, ob dies nur eine vorübergehende,
technische Angelegenheit sei oder eine neue
Entwicklung, an deren Ende zwei Großparteien stehen
könnten, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten.
Andernfalls könnten künftig noch mehr „Mikroparteien“
entstehen, die eine Entwicklung hin zur
politischen Personalisierung reflektieren.
wına-magazin.at
25
ARUM
WIEN
Foto & Redaktion: Ronnie Niedermeyer
Maurice Samuel
Aigner:
„Ich kann es mir gar
nicht mehr vorstellen,
woanders zu leben
als in Wien – außer
natürlich in Israel!“
26 wına | Februar 2020
MAURICE SAMUEL AIGNER
wurde 1953 in München geboren und arbeitete
dort als selbstständiger Unternehmer. Eine berufliche
und private Neuorientierung führte ihn
2009 nach Wien, wo er zuerst für eine Hausverwaltung,
dann für Privatstiftungen administrativ
tätig war. Seit einem Jahr ist er in Pension.
Ich kam in München als Sohn einer Jüdin zur Welt
und wusste lange Zeit nicht, was das für mich bedeutet.
Dass ich überhaupt begann, mich mit meinem Judentum
zu beschäftigen und damit auch meine weitläufige
Verwandtschaft in Israel kennenlernte, verdanke ich
meiner zweiten Ehefrau. So erfuhr ich nach und nach:
Die Großeltern meiner Mutter waren georgische Juden.
Nach der Oktoberrevolution flüchteten sie in die Türkei
– manche Verwandte gingen nach Persien, andere
nach Erez Israel. Der Großvater meiner Mutter wurde
Rabbiner an der Shalom-Synagoge in Istanbul. Ihre Eltern
organisierten für sie ein Schidduch mit einem türkischen
Juden – von dem wollte meine Mutter aber nichts
wissen und ging zu Verwandten nach Paris. Im Winter
1941/1942 wurde sie dort von der Gestapo gefasst.
Sie kam in ein Außenlager des KZs Dachau, betrieben
von der Deutschen Sprengchemie Geretsried, die Dynamit
herstellte. Mit gefälschten Papieren konnte meine
Mutter glücklicherweise zurück nach Frankreich flüchten,
wo sie bis Kriegsende in einem katholischen Kloster
versteckt wurde. Während ihrer Flucht lernte sie meinen
nichtjüdischen Vater kennen – einen Münchner, der sie
nach dem Krieg in seine Heimatstadt holte. Als ich dort
heranwuchs, war Judentum bei uns nie Thema. Weil sie
einen Goj geheiratet hatte, gab es auch keinen Kontakt
zu den Großeltern. Meine Mutter überlegte, mir einen
jüdischen Namen zu geben, doch mein Vater war dagegen
– da sie Französisch miteinander sprachen, einigten
sie sich auf Maurice. Und wie schon vorhin erwähnt, war
erst meine zweite Ehefrau „schuld“ daran, dass ich mich
heute überhaupt als Jude sehe. Ihre Eltern waren nämlich
Wiener Juden, die nach München gezogen waren –
so hatte ich zu Wien bereits eine gewisse Affinität. Wir
waren öfters hier zu Besuch – auch in der jüdischen Abteilung
am 4. Tor des Zentralfriedhofs, wo das Grab ihrer
Großmutter liegt. Durch diese Beschäftigung mit den
Wurzeln spürte ich in Paris meine eigene Großmutter auf,
die inzwischen von Istanbul dorthin gezogen war. Zum
Glück konnte ich noch viel Zeit mit ihr verbringen und
erfuhr so meine Familiengeschichte, die mir daheim verschwiegen
worden war. Wie es aber im Leben so oft ist,
erlebte ich in München nach und nach einen beruflichen,
einen gesundheitlichen und letztlich auch einen privaten
Bankrott. Wien war in mehrfacher Hinsicht ein naheliegender
Fluchtort. Im Stadttempel fand ich eine neue seelische
Heimat. Dort lernte ich Judith kennen: Ich hatte
Jahrzeit auf meine Mutter und sie auf ihren Vater. Die
Blicke trafen einander, wir begannen zu reden – nu, was
soll ich sagen, inzwischen sind wir seit sieben Jahren ein
Paar. Und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, woanders
zu leben als in Wien – außer natürlich in Israel!
TIPP: Das Pariser Café „La Mercerie“ (Ecke Berggasse/
Servitengasse) importiert seine eigenen Éclairs au chocolat
direkt aus Frankreich. Bessere wirst du in Wien nicht finden.
HIGHLIGHTS | 02
Der Freund der Welt
Zum 142. Geburtstag des theologischen
Universalgelehrten Martin
Buber zwischen Berlin, Heppenheim
und Jerusalem.
Eigentlich gab es neben den drei großen
Psychologen des 20. Jahrhunderts
Freud, Jung und Alfred Adler niemanden
in den letzten 120 Jahren, der
das dialogische Prinzip dermaßen verkörperte
wie Martin Buber (1878–1965).
Dies auch mathematisch. Jeder, der in Jerusalem
seinen Nachlass einsieht, wird
staunen – rund 50.000 Briefe liegen dort,
die meisten bisher nicht gedruckt. Und
das sind nur jene, die sich erhalten haben!
Wien, seine Geburtsstadt, Lemberg,
Berlin, Heppenheim bei Worms, ab 1938
Jerusalem waren die äußeren Stationen.
Die inneren, intellektuellen, geistesgeschichtlichen
und religiösen waren weltumspannend.
Dass der Privatgelehrte,
Philosoph und Bibelexeget, Publizist, Übersetzer
und Chassidismus-Kenner, Lehrer
und Kontaktknüpfer in Rehavia, Jerusalem,
der Jahre 1948ff. im jungen, armen
Staat Israel einen großbürgerlichen Haushalt
mit Dienstpersonal unterhielt, war
ein Widerspruch, den Buber aushielt. Genauso
wie er aushielt, sich nach 1945 mit
Deutschen zu treffen, die Täter waren und
Nazis wie der Philosoph Martin Heidegger.
Aussöhnung, Versöhnung und Frieden
waren für ihn keine leeren Worte. Er
füllte sie intensiv mit Leben.
Dominique Bourels jüngste Biografie
über Buber erschien 2015
in Frankreich, zwei Jahre später
auf Deutsch. Mit fast 1.000 Seiten,
auf denen reichlich aus Korrespondenzen
zitiert wird, ist sie
monumental im Umfang und reicht
dennoch immer noch nicht aus, um
das Leben Bubers zwischen Dialog und
Widerspruch – allzu gerne legte er sich
mit den Mächtigen an, unter anderem mit
David Ben-Gurion –, Allwissenheit und
Weisheit, Spiritualität und weltlichem Dauerwirken
zu erfassen. A.K.
www.tipp
Drew Binskys Weltreise
Dem 28-jährigen Weltenbummler,
Drew „Binsky“ Goldberg fehlen
nur noch fünf Länder, bis er von
sich behaupten kann, alle von der
UN anerkannten Staaten der Erde
besucht zu haben. Seit acht Jahren
ist er unterwegs, hat bereits
zwei Guinness-Weltrekorde aufgestellt
und veröffentlicht seine Reisevideos
regelmäßig auf seinem
YouTube-Kanal und sozialen Medien.
Ein besonderes Highlight:
sein Besuch beim letzten Juden
in Afghanistan.
youtube.com/drewbinsky
Martin Buber,
ein Gigant des
20. Jahrhunderts
zwischen Dialog
und Widerspruch.
WINA PLOTKES
Red-Bull-Athlet
Fabio Wibmer bikt
durch Israel
Der Osttiroler Fabio Wibmer inszeniert
Israels Städte und Landschaften
auf eine neue Art. Seine
aufsehenerregenden Mountainbike-Videos
haben ihn bekannt gemacht. Vor
Kurzem ist er einer Einladung nach Israel
gefolgt. Gemeinsam mit dem israelischen
Tourismusministerium und
seinem neuen Canyon-Torque-Mountainbike
präsentierte er unter dem
Motto „Israel ist mein Spielplatz“ waghalsige
Tricks vor der Kamera.
Der 24-Jährige aus dem Team der Red
Bull Athletes reiste mit einer Crew quer
durch Israel und zeigte sich begeistert.
Nachdem er sich mit der Topografie,
Land und Leuten vertraut gemacht
hatte, wurden die spektakulären Kulissen
ausgewählt und in Szene gesetzt.
Von Eilat über den Timna-Nationalpark,
die Negev-Wüste und die Salzinseln
am Toten Meer über die Altstadtmauern
von Jerusalem, die Strandpromenade
in Tel Aviv und Jaffa – überall
filmte er kunstvolle Bike-Stunts. Prominente
Unterstützung bekam er in seinem
Video von Magier Uri Geller.
Wibmer hat in den vergangenen Jahren
zahlreiche Wettbewerbe gewonnen,
und sein YouTube-Kanal zählt
bereits fast vier Millionen Abonnenten.
Auf seinen Social-Media-Kanälen
schwärmt der Mountainbiker von Israel
und schreibt: „Wahrscheinlich der
coolste Ort, an den ich je gereist
bin!“ I.L.
Aus der Zweiradperspektive:
Der österreichische
Mountainbiker
Fabio Wibmer macht
Israel zu seinem Spielplatz.
© Ullstein/Abraham Pisarek/picturedesk.com; Michael Hayter; Instagram
wına-magazin.at
27
28 wına | Februar 2020
„Für FPÖ-
Wähler und
Klimawandelleugner
habe
ich kein
Verständnis.“
MEN T SCHEN: SHOSHANA DUIZEND-JENSEN
„Innerhalb der Halacha haben
Frauen ungeahnte Möglichkeiten“
Als eine der ersten Frauen wurde Shoshana Duizend-Jensen im Frühjahr
2019 Mitglied des Tempelvorstands der IKG. Die Historikerin, die sich auf
Wiener jüdisches Leben spezialisiert, erhielt im selben Jahr den Leon-
Zelman-Preis. Redaktion und Fotografie: Ronnie Niedermeyer
WINA: Sie wollten vor der Schiffschul fotografiert werden.
Welchen Bezug haben Sie zu diesem Haus?
Shoshana Duizend: Die Schiffschul – 1864 von ungarisch-jüdischen
Zuwanderern in der Großen Schiffgasse 8
errichtet – verkörpert für mich das konsequente Eintreten
für Thoratreue inmitten einer bereits sehr antisemitischen,
feindseligen und gewaltbereiten Umwelt. In der Schiffschul
wurde Gebet und Talmudlernen gelebt, sie vergab
Kaschrutzertifikate für die frommen jüdischen Institutionen,
und sie bildete Generationen von Talmud-Thora-
Schülern aus. Während des Novemberpogroms wurde das
Hauptgebäude grausam gesprengt: Noch heute klafft an
diesem Platz nahe des Donaukanals eine wild verwachsene
Baulücke. Nur das dazugehörige Gebäude des ehemaligen
Beith Hamidrasch ist heute noch übrig. Sogar
dieses steht noch immer nicht unter Denkmalschutz, ist
also dem Verfall preisgegeben.
Sie beschäftigen sich beruflich mit der Geschichte des Judentums
in Wien. Erleben Sie dabei Situationen, bei denen
Ihr objektiver Zugang als Historikerin von Ihrem persönlichen
Zugang als Jüdin beeinflusst wird?
❙ Wenn ich jüdische Vereine erforsche und ihre Akten lese,
erfreue ich mich an dem vergangenen vielfältigen jüdischen
Leben, das darin abgebildet wird. Besonders beeindruckend
war die große Anzahl der wohltätigen Organisationen in
Wien – von Wöchnerinnen bis zu Greisinnen und Greisen
fanden viele dort Unterstützung und Fürsorge. Die Adressen
aller Synagogen und Bethäuser Wiens schwirren mir
im Kopf herum. Ich versetze mich in eine Art Zeitreise
und versuche anhand von Bauplänen und Beschreibungen
zu rekonstruieren, welche Atmosphäre dort vorhanden war.
Diese Beschäftigung ist aber auch schmerzlich, da das jüdische
Leben Wiens in seiner damaligen Form für immer
verschwunden ist.
Dennoch konnten Jahrhunderte an Diskriminierung und Verfolgung
die jüdische Präsenz in Wien nicht auslöschen. Welche
Bedeutung hat Wien für Jüdinnen und Juden – und welche
Bedeutung hat umgekehrt das Judentum für Wien?
❙ Bis zur großen Katastrophe der Schoah haben beide Seiten
enorm voneinander profitiert. Wie ein roter Faden zieht
es sich durch die Geschichte Wiens: Juden haben einen
wesentlichen Teil der Gesellschaft und Ökonomie geprägt
und gefördert. Dafür erhielten sie auch relative Freiheiten,
sich weiterzuentwickeln und – wenn sie es wollten – auch
ihre Identität beizubehalten. Auch nach 1945 lässt sich dieses
Phänomen beobachten, als Rückkehrer aus den KZs in
Wien wieder prosperierende Unternehmen gründeten. Im
Wiener Stadt- und Landesarchiv sind tausende Beweise
dieser staunenswerten Entwicklung zu finden.
Für Außenstehende scheint das orthodoxe Judentum sehr
traditionelle Rollenbilder für Männer und Frauen zu propagieren.
Inwieweit entspricht das der alltäglichen Realität?
❙ Die Rollenbilder sind oft nicht sehr gut zu verstehen, wenn
man sie nicht selbst lebt. Wer zum Beispiel weiß, dass Frauen
davon befreit sind, ihre täglichen Gebete an bestimmten
ortsgebundenen Plätzen wie Synagogen zu verrichten, sondern
dies neben und mit ihren Kindern zu Hause tun können,
wird diese Erleichterung zu schätzen wissen. Ich denke,
dass es in vielen orthodoxen Familien schon weit fortgeschritten
ist, sich auch als Vater im Haushalt und in der
Kinderbetreuung einzubringen. Die Tradition, dass Männer
Thora lernen und Frauen Berufen nachgehen, hat doch auch
etwas sehr Selbstbestimmendes für Frauen. Wenn ich zu
Wohltätigkeitsveranstaltungen der orthodoxen Frauen gehe,
bewundere ich, wie perfekt sie sich selbst organisieren und
ihr eigenes Leben führen. Zudem ist es ja für Frauen nicht
verboten, Thora und Talmud zu studieren. Innerhalb des
Rahmens der Halacha haben Frauen ungeahnte Möglichkeiten,
ihre Identität zu wahren, Großartiges zu leisten und
in der Gesellschaft einen gleichberechtigten Platz zu finden.
Welche Entwicklungen würden Sie sich dennoch wünschen?
❙ Wir als fromme Jüdinnen und Juden dürfen allgemeine
gesellschaftliche Anliegen nicht außer Acht lassen. Wer
weiterhin den Klimawandel leugnet oder als Jude bzw. Jüdin
FPÖ wählt, weil diese Partei angeblich israelfreundlich
ist – dafür habe ich kein Verständnis.
wına-magazin.at
29
JEWISH JOINT
„Der Joint arbeitet wie
eine Ziehharmonika“
Eine unentbehrliche jüdische US-Hilfsorganisation
schließt nach 100 Jahren ihre Pforten in Wien – vorläufig.
Von Marta S. Halpert
30 wına | Februar 2020
Auf die eine oder andere Art ist fast
für jeden in der jüdischen Community
der Name Joint ein Begriff“,
sagt Wolfgang Weninger. Dass man
ab Februar 2020 in Österreich nur mehr in
der Vergangenheitsform über das American
Jewish Joint Distribution Committee
(JDC), kurz: Joint, wird sprechen können,
stimmt den Leiter des Österreich-Büros
nachdenklich: „Damit geht die 100-jährige
Geschichte dieser jüdisch-amerikanischen
Flüchtlingshilfsorganisation in Wien vorläufig
zu Ende. Aber man vergleicht den
Joint mit einer Ziehharmonika: Wenn es
Arbeit gibt, dehnt er sich wieder aus.“
Warum wird das Büro des JDC jetzt geschlossen?
Dafür gibt es mehrere hoch politische
Ursachen, und die erläutert Amir
Shaviv, der Geschäftsführer des Transmigrationsprogramms
in New York: „In den
letzten Jahren fokussierte sich die Arbeit
in Wien auf die Betreuung der jüdischen
Asylanten aus dem Iran. Während sie auf
ihre endgültigen Ausreisepapiere in die
USA warteten, unterstützte sie das JDC
in allen humanitären und religiösen Belangen,
und die HIAS*, als offizielle US-
Agency, erledigte den bürokratischen
Aufwand.“ Doch im Jänner 2017 erteilte
Präsident Trump den Erlass, die Einwanderung
aus sieben muslimischen Staaten,
darunter auch dem Iran, zu stoppen. Daraufhin
stellte auch die österreichische Regierung
die Erteilung von Transitvisa aus
Teheran nach Wien ein.
„Infolge dessen konnte das Wiener
Joint-Büro seine ursächlichste Mission
nicht mehr erfüllen, vor allem, weil seit
zwei Jahren kein einziger jüdischer Flüchtling
aus dem Iran hier ankam“, erläutert
Shaviv. „Leider gibt es keinerlei Anzeichen
dafür, dass sich die amerikanische Politik in
nächster Zukunft ändert.“ Ab den 1980er-
Jahren bis 2017 waren rund zehntausend
iranische Juden auf der Durchreise in Wien
auf ihrem Weg in die USA. Signifikant
Verlegung von 1.000 jüdischen
Flüchtlingen aus dem
Salzburger Displaced-Persons-
Lager in neue Quartiere in der
Nähe von München unterstützt
durch das JDC.
abgenommen hatte der Flüchtlingsstrom
schon ab 2010, als pro Jahr nur mehr zirka
einhundert Personen hier durchreisten.
Hat der große Freund Israels auch die
Auswanderung für Juden in seinem Erlass
inkludiert? „Ja“, sagt Wolfgang Weninger,
„aber mit dem Lautenberg-Amendment,
einer Gesetzesnovelle aus dem Jahr 1990,
konnten wir da ein legales Schlupfloch
finden.“ Diese Abänderung wurde in den
1990-Jahren eigentlich zur Erleichterung
der Einwanderung von russischen Juden
gemacht und besagte, dass die religiösen
Minderheiten nicht Verfolgung nachweisen
müssten, sondern, dass es auch genüge,
wenn sie „Furcht vor Verfolgung“ angaben.
„Das bezog sich dann natürlich ebenso
auf verfolgte Christen und Bahai aus dem
Iran“, erklärt der Büroleiter.
Das JDC war ursprünglich 1914 gegründet
worden, um die jüdischen Opfer
des Ersten Weltkriegs zu unterstützen.
In der Zwischenkriegszeit waren zunächst
die verarmten jüdischen Gemeinden in der
Sowjetunion und in Osteuropa im Fokus
der jüdisch-amerikanisch Wohlfahrt. Ab
1933 konzentrierte sich JDC auf die Unterstützung
der jüdischen Bevölkerung in
Deutschland und in den von der Wehrmacht
besetzten Gebieten Ost- und Westeuropas:
etwa durch Spenden für Krankenund
Waisenhäuser, für Nahrungsmittel
und zum Teil auch für den bewaffneten
jüdischen Widerstand. Außerdem half die
NGO mit eigenen Büros in zahlreichen
europäischen Ländern bei der Organisation
der Emigration und übernahm auch
Reise- und Visakosten.
Dieser Teil der Arbeit nahm nach den
Novemberpogromen 1938 stark zu, bei
Kriegsbeginn erhöhte sich die Zahl der
Flüchtlinge noch einmal. Der US-Rabbiner
Joseph J. Schwartz übernahm 1940 in
Paris das Amt des europäischen Direktors
des JDC. Seine Bemühungen um Hilfeleistung
gingen mitunter über die Grenze
der Legalität hinaus – so zahlte das Komitee
auch für falsche Papiere. Schwartz
sorgte nicht nur dafür, dass jüdische
Flüchtlinge, die Lissabon mit gültigen
Reisepapieren erreichten, von dort aus mit
dem Schiff weiterreisen konnten. Er unter-
* HIAS steht für Hebrew Immigrant Aid Society und wurde 1881 gegründet, um Juden aus Russland zu helfen, die vor den Pogromen flohen.
In Wien ist HIAS keine jüdische Agency, sondern ein non-sectarian refugee support center.
© Science Source / PhotoResearchers / picturedesk.com; United States Information Servic / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com
DISTRIBUTION COMMITTEE
15 Millionen Dollar hatte das
JDC mit der Kampagne SHARE bis
zum Ende des Krieges lukriert, um
damit jüdisches Leben in Europa
zu retten. Plakat: Johnstone Burke
Studios. Lithographie.
stützte auch Insassen französischer Internierungslager
sowie französische Krankenhäuser,
Waisenheime und Suppenküchen.
Auch in das Ghetto Theresienstadt, nach
Polen und in andere von den Deutschen
besetzte Gebiete wurden Lebensmittelpakete
und Geld geschickt.
Ab Juni 1940, nach der deutschen Besetzung
von Paris, wurden die Hilfsaktionen
von Lissabon aus koordiniert: Die portugiesische
Hauptstadt wurde zu einer der
zentralen Transitstationen auf dem Weg
nach Übersee. Diese Aktivitäten wurden
durch den Kriegseintritt der USA erschwert,
da das JDC ab diesem Zeitpunkt
keine Büros in feindlichen Ländern mehr
unterhalten durfte. Mit Hilfe des in der
Schweiz ansässigen JDC-Mitarbeiters
Saly Mayer gelang es jedoch, Finanzhilfen
weiterhin in Osteuropa zu verteilen
und damit zahlreiche lebensnotwendige
Mittel zur Verfügung zu stellen.
Nach dem Krieg war das JDC die wichtigste
jüdische Hilfsorganisation für Überlebende
der Schoah. Es betreute die Displaced
Persons (DPs) in den Auffanglagern
in Deutschland, Österreich, Italien und
Osteuropa und finanzierte Nahrungsmittel,
Kleidung und Berufsausbildung. Nach
der Staatsgründung Israels im Mai 1948
organisierte das JDC auch den Transport
jüdischer Auswanderer dorthin. Die Organisation
beteiligte sich auch an der Claims
Conference und dem daraus folgenden
Claims Committee.
100 Jahre in Wien aktiv. Doch wie
kommt der Leiter des Wiener Büros
Wolfgang Weninger auf das 100-Jahr-Jubiläum
in Wien? „Soweit ich das aus den
geschichtlichen Unterlagen recherchieren
konnte, kam bereits während des Ersten
Weltkrieges Hilfe über die niederländische
diplomatische Vertretung hierher“,
so der ehemalige Student der Geschichte.
„Es gab zwar kein JDC-Büro, aber Delegationen
aus den USA kümmerten sich regelmäßig
um jüdische Kriegsflüchtlinge.
Finanzielle Hilfe ist erst ab 1919 gekommen,
kolportiert wird eine Million Dollar.“
Stolz zeigt Weninger ein vergilbtes
Schwarz-weiß-Foto, das er in alten Dokumenten
gefunden hat: Es zeigt die Verteilung
von Mazza für Pessach und anderer
Lebensmittel im Jahr 1929 im Leopoldstädter
Tempel, der 1938 vollkommen niedergebrannt
wurde. „Es wurden Suppenküchen
errichtet, wichtig war vor allem die
medizinische Versorgung der Alten und
der Kinder.“ Für diese Zeit sehr fortschrittlich,
wurden Mikrokredite vergeben, damit
Menschen wieder Fuß fassen konnten.
Bereits 1987 hat Weninger bei der amerikanischen
Hilfsorganisation angedockt,
um bei der Abwicklung der Ausreise von
Juden aus der Sowjetunion zu helfen.
„Die Emigrationswelle ist damals förmlich
explodiert“, erzählt der Wiener. „In
den 1970er-Jahren kamen auch viele Juden
über Wien. 1979 mit dem Einmarsch
der Russen in Afghanistan war dann Pause.
Erst unter Präsident Gorbatschow gingen
die Zahlen wieder hinauf.“ Parallel
zu der russischen Auswanderung wurde
ab 1979/80, nach dem Sturz des Schahs
von Persien, auch ein Hilfsprogramm für
jüdische Iraner eingerichtet. „Es handelte
sich großteils um Familienzusammenführung,
fast alle Personen hatten bereits Verwandte
in den USA. Bemerkenswert war
der hohe Ausbildungsgrad der Iraner“, berichtet
Weninger. Zuerst übersetzte er medizinische
Befunde für jene Personen, die in
Spitälern versorgt werden mussten. „Bis auf
ein Jahr Unterbrechung für den Zivildienst
1990 bin ich da picken geblieben“, lacht er.
Wie sah es mit der Hilfe in den Bundesländern
aus? „Ich weiß nur von den Hilfsaktionen,
die nach 1945 in der amerikanischen
Besatzungszone in Oberösterreich
und Salzburg stattfanden – und ein jüdisches
DP-Lager gab es auch in der Obersteiermark.“
Im März 2019 wurde in der
Grazer Kultusgemeinde eine berührende
Gedenkveranstaltung für einen JDC-Helfer
abgehalten: „Im November 1945 eröffnete
der erst 26-jährige britische Staatsbürger
Hyman Yantian ein Joint-Büro und
organisierte für die DPs nicht nur Nahrungsmittel,
Kleidung
und Bildungsprogramme,
sondern
finanzierte in der
Steiermark Erholungsheime
für jüdische
Kinder und Erwachsene
sowie ein
„In den letzten
Jahren fokussierte
sich die Arbeit
in Wien auf die
Betreuung der
jüdischen Asylanten
aus dem
Iran.“ Amir Shaviv
jüdisches Studentenheim
in Graz.“
Auch beim Wiederaufbau
der Gemeinde
für die wenigen
nach Graz
zurückgekehrten Jüdinnen
und Juden spielte der Joint eine wesentliche
Rolle. „Die finanzielle Unterstützung
kam immer aus den USA, aber ohne
die logistische Hilfe der Israelitischen Kultusgemeinde
sowie die medizinische Betreuung
durch ESRA hätten wir das alles
nicht schaffen können“, sind Amir Shaviv
und Wolfgang Weninger überzeugt. „Wir
haben immer einen Ansprechpartner in
der IKG gehabt und sind mit unseren Asylanten
auch zu den Feiertagen und diversen
Veranstaltungen eingeladen worden.“
Auch wenn es im Wiener Joint-Office
in den letzten beiden Jahren ruhig geworden
ist, war die Hilfsorganisation im
Jahr 2019 in 28 Ländern in Zentral- und
Osteuropa aktiv, insbesondere im Aufbau
des jüdischen Gemeindelebens nach dem
Kommunismus. Die Republiken der ehemaligen
Sowjetunion ausgenommen, hilft
der Joint in Ländern wie Deutschland,
Ungarn, Polen, Bulgarien, Rumänien, der
Tschechischen Republik, auf dem Balkan
und in den baltischen Staaten. Aber auch
ganz neue und innovative Projekte fördert
Joint heute: Das Mozaik Hub in Budapest
zum Beispiel ist ein Inkubator für jüdische
Sozialunternehmer, die dort ein Trainingsprogramm
absolvieren, um eine neue Generation
an Führungskräften für das Community
Building vorzubereiten.
An welches menschliche Erlebnis
während der Flüchtlingsbetreuung erinnert
sind Wolfgang Weninger gerne zurück?
„Von der iranischen Gastfreundschaft
war ich immer wieder überwältigt:
Egal, wie wenig sie hatten, auch damit haben
sie einen überhäuft.“ Tief berührt hat
ihn auch das Erlebnis mit einer jungen Iranerin,
die sich länger in Wien aufhalten
musste, weil sie einmal abgelehnt wurde.
„Wir haben mit den Durchreisenden verschiedene
Programme gemacht, Ausflüge,
Museumsbesuche – und auch eine Reise
zur Gedenkstätte des KZs Mauthausen.
Das war wichtig, denn die Iraner
wussten sehr wenig über
den Holocaust.“ Die 20-Jährige
bat dort einen polnischen
Überlebenden um ein gemeinsames
Foto, das sie auch
machen durfte. Im Jahr darauf
war die junge Frau bei der
Befreiungsfeier im Mai wieder
dabei und traf den weit
über Neunzigjährigen erneut.
Nach den freudigen Umarmungen
fragte sie ihn dieses
Mal auch über seine Jugenderlebnisse
als Häftling aus.
wına-magazin.at
31
FINANZWELT POLITIK
Eine Zigarette habe ihm einst das
Leben gerettet, erzählte Felix
Rohatyn. Die Zigarette zündete
sich ein Deutscher Wachsoldat an und
winkte abgelenkt das Auto seiner Familie
durch, die im Jahr 1940 vom besetzten
Paris in Richtung Marseille unterwegs
war, von wo sie in die neue Welt flüchten
wollte. Im Rückspiegel habe er gesehen,
dass schon das nächste Fahrzeug wieder
kontrolliert wurde.
Feliks Jerzy Rohatyn wurde 1928 in
Wien als Sohn bürgerlicher jüdischer polnischer
Eltern geboren. Er sollte in den
USA eine beispiellose Karriere als Investmentbanker
machen, die ihn auch in die
höchsten politischen Kreise führte. Sein
Meisterstück war die Rettung der Stadtverwaltung
von New York, die 1975 an der
Kippe zur Zahlungsunfähigkeit stand. Später
wurde er noch US-Botschafter in Paris.
Sein Urgroßvater sei Rabbiner in einem
polnischen Städtel gewesen, erzählte Rohatyn.
Der Name leitet sich jedenfalls von einem
Ort in Westgalizien her, der damals
zur Donaumonarchie gehörte und in dem
es eine jüdische Einwohnermehrheit gab.
Sein Vater Alexander managte von Wien
aus mehrere Brauereien, an denen die Familie
Anteile hielt, in Österreich, Rumänien
und in Jugoslawien. Felix wurde in
ein Internat in der Schweiz geschickt, damit
er eine solide Ausbildung erhalte und
Französisch lerne.
Doch die Rohatyns konnten auch die
politischen Zeichen der Zeit lesen. Schon
1935 übersiedelten sie vor dem Hintergrund
zunehmender nationalsozialistischer
Macht nach Paris. Als die Deutschen
Frankreich im Blitzkrieg besiegt hatten
und zunächst Paris und den Norden und
Westen besetzten, entschloss sich die Familie
zur Flucht. Dabei handelte es sich
um Mutter, Großmutter und den Stiefvater
von Felix – sein Vater blieb zurück und
überlebte den Krieg als U-Boot in Orleans.
Nach dem knapp gelungenen Übertritt
in das noch nicht besetzte Vichy-Frankreich
sollten die Rohatyns noch einmal
Glück haben. Sie standen auf den Listen
des brasilianischen Diplomaten Luís
Martins de Souza Dantas, der – entgegen
den Anweisungen seines eigenen Außenministeriums
– 800 Visa für Juden ausstellte
und diesen damit die Schiffsreise
über Casablanca auf den amerikanischen
Kontinent ermöglichte (siehe Der vergessene
Judenretter in WINA 2/19). Nach einer
Wartezeit in Brasilien zog die Familie
schließlich in die USA.
Ein Wiener
RETTET NEW YORK
Im Dezember 2019 starb der bekannte Investmentbanker
Felix Rohatyn. Er war an zahlreichen großen
Firmenübernahmen beteiligt, Mitte der 1970er-Jahre
organisierte er die Sanierung der insolventen Stadtverwaltung
der US-Metropole.
Von Reinhard Engel
Felix ging in Manhattan zur Schule und
studierte dann Physik im Middlebury College
in Vermont. Allerdings interessierte
er sich deutlich mehr fürs Skifahren als
für die akademischen Angebote, schrieb
er später in seiner Autobiografie Dealings.
Um etwas anderes von der Welt zu sehen
und eventuell seinem Vater beruflich
nachzufolgen, kehrte er nach dem Krieg
nach Frankreich zurück, wo dieser wieder
als Brauer Fuß gefasst hatte. Felix schuftete
in einer Brauerei, wurde aber von den
kommunistischen Arbeitern als Sohn des
Bosses schikaniert. „Ich sah bald, dass weder
Bier noch Frankreich meine Zukunft
sein sollten. Also kehrte ich zurück nach
Middlebury und beendete mein Studium.“
Nach seinem Abschluss wusste er nicht
so recht, was er machen sollte, da bot sich
ihm durch Zufall ein Sommerjob in einer
kleinen Privatbank an, bei Lazard Frères.
Daraus sollten Jahrzehnte einer außergewöhnlichen
Karriere werden.
Ein weiterer Zufall setzte Rohatyn
innerhalb des Bankgeschäfts auf die zukunftsträchtigsten
Geleise. Ursprünglich
hatte er im Devisenhandel begonnen, sich
dort eingearbeitet und auch schon recht
ordentlich verdient. Doch der Vater einer
Freundin, der Whiskey-Mogul und
Gründer von Seagram’s, Samuel Bronfman,
gab ihm den Rat, ins Investment
Banking zu wechseln, dort spiele künftig
die Musik. Er möge kurzfristig mit
weniger Gehalt zufrieden sein und sich
parallel dazu in Abendkursen ordentlich
für diese Aufgabe vorbereiten. Roha-
tyn folgte diesem Rat, sein Chef, André
Meyer, stimmte diesem Wechsel zu.
Im Übernahmekarussell. Rohatyn sollte
tatsächlich die richtige Wahl getroffen haben.
In den späten 1950er-Jahren begann
sich das Übernahmekarussell in der US-
Wirtschaft bereits zu drehen, und er war
mitten drin. So mischte er bereits bei einem
der ersten großen Takeovers mit, als
ITT, bis dahin vor allem ein Telekomausstatter
außerhalb der USA, eine große regionale
Versicherung übernahm – und damit
in Richtung branchenübergreifendes
Konglomerat marschierte. Rohatyn sollte
dann lange Jahre im Board von ITT sitzen
und zahlreiche weitere Akquisitionen
mit betreuen.
Doch bald kam eine erste öffentliche
Aufgabe auf ihn zu. In Vertretung der
kleinen, feinen Privatbank Lazard hatte
er einen Direktorenposten bei der New
Yorker Börse erhalten. Und dort standen
die Zeichen auf Sturm. 1970 hatte sich
eine ganze Reihe kleinerer Investmentbanken
übernommen, sie hielten zu viel
Risiko in den Büchern und drohten unterzugehen,
dabei zahlreiche Investoren
mitzureißen. Rohatyn gehörte zum engen
Kreis an der New York Stock Exchange,
der mit der Einrichtung eines Notfonds
und dem Anstoß zur Übernahme wackeliger
Marktteilnehmer dafür sorgte, dass
keine größere Krise à la Lehman daraus
wurde. Nach dieser Sanierung widmete
er sich wieder seinen eigentlichen Geschäften,
er war inzwischen Partner ge-
32 wına | Februar 2020
CORPORATE TAKEOVERS
„Ich glaube, der Marktkapitalismus ist das
beste je erfundene ökonomische System. Aber
er muss fair sein, er muss reguliert sein, und er
muss ethisch sein.“ Felix Rohatyn
© Brendan Mcdermid / Reuters / picturedesk.com
worden und hatte es auch zu einem gewissen
Wohlstand gebracht.
Doch die Herkulesaufgabe sollte noch
kommen. 1975 stand die heimliche Welthauptstadt
New York City vor dem finanziellen
Kollaps. Dazu hatten mehrere
Entwicklungen beigetragen. Einige Jahre
schwacher Wirtschaftsentwicklung im
Gefolge der Ölkrise ließen Unternehmen
wie wohlhabende Privatleute abwandern,
die Steuerbasis verkleinerte sich. Dem gegenüber
weitete die städtische Bürokratie
ihre Angebote aus, genau wusste niemand,
wie viele Menschen für das Rathaus
arbeiteten, aber es waren mehr als 300.000.
Und schließlich wurde diese Service-Expansion
alles andere als solide finanziert.
Weil die Stadt keine langfristigen Anleihen
mehr verkaufen konnte, holte sie sich
immer wieder teure kurzfristige Gelder,
konnte sie aber nicht zurückzahlen und
brauchte weitere Kredite. Auf einmal sagten
die Banken nein. Die Zahlungsunfähigkeit
der Stadt stand unmittelbar bevor,
und auch der Staat New York war bedroht.
Dessen Gouverneur, Hugh Carey, ersuchte
Rohatyn, einen Notfallplan zu erarbeiten,
um die Insolvenz kurzfristig
abzuwenden, die unabsehbare Folgen haben
könnte: Massenarbeitslosigkeit, im
schlimmsten Fall eine nationale und internationale
Wirtschaftskrise. Mittelfristig
sollten die gesamten Finanzen der Stadt
auf solide Beine gestellt werden.
Es wurde über Monate ein Tanz auf
dem Vulkan. Die Grundidee war, eine
Auffanggesellschaft des Staates New York
zu gründen, die ihrerseits Anleihen
ausgeben konnte, die der Markt und
unterschiedliche Institutionen kaufen
würden. Die Bundesregierung
unter Präsident Gerald Ford verweigerte
jede Hilfe, sowohl in der
Form direkte Finanzierung wie auch
als Garantien. Ford, ein Republikaner,
nutzte die missliche Lage der
Großstadt für politisches Kleingeld:
Da sehe man, dass die linken Demokraten
nicht wirtschaften könnten.
Dennoch war Rohatyn erfolgreich,
nicht zuletzt, weil er die mächtigen
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
von seiner Seriosität überzeugen konnte,
ihnen klar machte, dass ihre Zustimmung
zu einem harten Sanierungskurs essenziell
sei. Er brachte sie sogar dazu, mit ihren
Pensionsfonds die neuen Anleihen zu
zeichnen, trotz eines Personalabbaus von
etwa 20 Prozent.
Von den Verhandlungen mit den Arbeiterführern
berichtete Rohatyn später,
man habe sich zu einzelnen Punkten oft
rasch im kleinen Kreis geeinigt, musste aber
der Basis harte nächtliche Verhandlungen
vorspielen. Dabei habe man gemeinsam
Fernsehen geschaut oder gepokert, in den
frühen Morgenstunden traten dann alle erschöpft
vor die Kameras und verkündigten
die schwierig errungen Einigung. Ganz
am Ende des Sanierungsprozesses gab es
dann doch noch Hilfe aus Washington, europäische
Regierungschefs wie Valerie Giscard
D’Estaing und Helmut Schmidt hatten
vor einer Eskalation gewarnt, und Ford
gab nach. Letzten Endes dürfte ihn aber
die harte Haltung die Wahl gekostet haben,
der Demokrat Jimmy Carter zog ins
Weiße Haus ein.
Rohatyn kehrte in seine Investmentbank
zurück, war auch in einer neuen intensiven
Phase von corporate takeovers immer
wieder bei entscheidenden Deals
führend dabei. Zu den bekanntesten gehörte
die Übernahme von RJR Nabisco, einem
Tabak- und Lebensmittelkonglomerat
durch die Investmentbank KKR, oder
jene der Unterhaltungsgruppe RCA (mit
ihren Universal Studios) durch den japanischen
Technologiekonzern Matsushita.
Doch Rohatyn war als seriöser, eher
konservativer Banker nicht mit allen Entwicklungen
einverstanden. So schienen
ihm Junk-Bond-Finanzierungen oftmals
unseriös und zu riskant, er beteiligte
sich nur selten an feindlichen Übernahmen,
kritisierte auch immer wieder die
enormen Boni und Profite, die sich Manager
bei den Deals selbst genehmigten,
gleichzeitig aber die Firmen brutal auf
Gewinn trimmten. „Ich bin ein Kapitalist.
und ich glaube daran, Profite zu erzielen.“
Aber all zu oft habe er die andere
Seite gesehen: Massenentlassungen, beschädigte
Gemeinden, Umverteilung von
den Arbeitnehmern weg. „Ich glaube, der
Marktkapitalismus ist das beste je erfundene
ökonomische System. Aber er muss
fair sein, er muss reguliert sein, und er muss
ethisch sein. Das habe ich in meinen fünfzig
Jahren in der Finanzwelt und in der
Politik gelernt.“
Rohatyn, politisch ein überzeugter Demokrat,
stand mehrmals knapp vor einem
Wechsel in die Politik, doch auch unter
Bill Clinton sollte es weder mit dem Chefposten
in der Weltbank noch mit einem
Direktorenjob bei der Bundesbank Fed
klappen. 1999 kehrte dann das ehemalige
jüdische Flüchtlingskind aus Wien nach
Europa zurück, als mächtiger amerikanischer
Botschafter in Paris und Chef von
1.000 Mitarbeitern. Nach seiner Pensionierung
engagierte er sich vor allem für eine
Wiederbelebung der maroden US-Infrastruktur,
argumentierte zäh für deren Modernisierung
und Ausbau.
Eine Börsenkrise erwischte ihn dann
doch noch persönlich. Rohatyn hatte
für Lehman als Berater für europäische
Märkte gearbeitet. Und wie viele andere
auch, musste er die Investmentbank nach
deren Zusammenbruch mit einem Karton
in den Händen verlassen. Seine Expertise
wurde aber schnell wieder nachgefragt, von
seinem jahrzehntelangen Arbeitgeber Lazard.
Rohatyn starb 91-jährig im Dezember
2019 in New York.
wına-magazin.at
33
GENERATION UNVERHOFFT
Von Person A zu
Person Benjamin
Wie der 22-jährige Benjamin Abramov die
Spiritualität für sich entdeckte.
Text & Foto:
Anna
Goldenberg
Es sind hektische Tage für Benjamin Abramov.
Er muss zum Friseur, gleich
kommt die Möbellieferung, die Arbeit
ruht nicht, und zudem sind noch die
letzten Kleinigkeiten für den Sonntag
zu klären. Da ist nämlich die Hochzeit
des 22-Jährigen. „Für so etwas braucht es materielle und
spirituelle Vorbereitung“, sagt Benjamin an diesem Donnerstag
Mitte Jänner. „Es geht nicht um die Hochzeit,
sondern um das Leben danach.“
„Doch dann hab ich gemerkt, im
Ökosystem sitzt jemand anderer
an oberster Stelle.“
Mit diesen philosophischen Sinnsprüchen passt er
in sein Umfeld. Gerade sitzt er in einem dunkelvertäfelten
Raum des Bet Halevi, des 2006 eröffneten Gemeindezentrums
am Augarten. Betrieben von Chabad,
werden hier sefardische Bräuche mit der chassidischen
Tradition kombiniert. Das Schönste an Chabad sei die
„gute Stimmung“, so Benjamin: „Jeder hat einen kleinen
Funken. Egal, was du gestern getan hast – heute kannst
du eine Mizwa erfüllen.“
Dass sich Benjamin in dem religiösen Umfeld wohlfühlt,
war nicht immer so. Er wuchs in einem traditionellem
Haushalt auf, Kaschrut, Schabbat und Feiertage
ja, aber so gläubig wie heute war er damals nicht.
Eine „Light Version“ des Judentums lebte er damals, sagt
Benjamin. Die Eltern kommen aus dem heutigen Usbekistan;
wie viele in der bucharischen Gemeinde wanderten
sie erst nach Israel aus und kamen später nach
Wien, wo Benjamin und seine beiden älteren Schwestern
geboren sind.
Seine gesamte Schulkarriere absolvierte er an der
ZPC-Schule; nach der Matura schrieb er sich für mehrere
Studien in Wien ein. Architektur, Informatik,
Stadtplanung. Nichts passte gut. Erst bei einem Diplomlehrgang
in Grafikdesign und Onlinemarketing an
der Deutschen Pop, einer Privatakademie, fand er sich
wieder.
Die Orientierungslosigkeit beim Studienbeginn war
damals nicht die einzige Schwierigkeit. Im Jahr nach seiner
Matura hatte Benjamin gesundheitliche Probleme;
eine Operation war notwendig. Nichts Lebensbedrohliches,
alles lief gut – doch die Sache erschreckte ihn. „In
dem Alter denkt man, man hat die Kontrolle über alles“,
erzählt er. „Doch dann hab ich gemerkt, im Ökosystem
sitzt jemand anderer an oberster Stelle.“ Eine
„Kettenreaktion“ begann, Benjamin entdeckte die Spiritualität
für sich.
Er engagierte sich bei der Jugendorganisation Jadbejad,
wo ihn ein neugewonnener Freund ins Bet Halevi
mitnahm. Hier beschäftigte er sich mit der Torah.
„Ich hab mich neu kennengelernt“, erzählt er. „Bet Halevi
ist wie eine Fabrik. Du gehst als Person A rein und
kommst als Person B wieder raus.“ Wobei Person Benjamin
hier gar nicht so oft rauskommt. Mittlerweile arbeitet
er nämlich auch für das Zentrum, organisiert Veranstaltungen
und übernimmt Grafik und Marketing
– und seit Kurzem ist auch seine Wohnung gleich dort.
Nur die Möbellieferung fehlt noch.
34 wına | Februar 2020
LEBENS ART
Style-Vorlage
Im grauen Februar beschäftigt sich WINA mit der wahrscheinlich
schönsten Jugendkultur der Welt: den Mods!
Christopher Just:
Der Moddetektiv
Milena Verlag.
504 S., € 21
Der letzte Dandy. Der Wiener
Autor Christopher Just erklärt
den Mod – und seinen
Romanhelden Sandemann.
Fun Fact
Beim Vorspielen für die spätere
Mod-Kultband The Who (Tommy,
Quadrophenia) fragte Sänger Roger
Daltrey den Gitarristen Pete
Townshend lediglich: „Can you
play E? Can you play B? And can
you play Hava Nagila?“
thewho.com
WINA: Mod-Sein ist eine Jugendkultur der 1960er-Jahre.
An welchen Orten kann man sie in Wien heute noch finden?
Christopher Just: Da ich in den 1980er-Jahren Mod gewesen
bin, habe ich den Kontakt zur gegenwärtigen Szene längst
verloren und weiß auch nicht, wie viele es überhaupt noch
gibt. Auf Alt-Wiener-Mods stößt man aber am ehesten im
Abbey Road Shop in der Zieglergasse, wenn der Laden etwa
ein Special mit 60s-DJs initiiert, oder am Donnerbrunnen,
wenn sie sich im Frühjahr zu einer Scooter-Ausfahrt treffen.
Und natürlich auf Konzerten von Mod-Bands wie The
Who oder bei Paul Weller, dann allesamt in Parkas und mit
aufgeputzten Vespas und Lambrettas.
Was kann man von ihr lernen?
❙ Ein gewisses Gefühl für Stil und Ästhetik bei Mode und
Design. Wie ein gut geschnittener Anzug aussieht, wie man
sich exzentrisch kleidet, ohne affig auszusehen. Klassischer
Stil, statt kurzlebigen Trends hinterherzuhecheln. Und mit
Leidenschaft anders als die anderen sein zu wollen (obwohl
dies wiederum dem Gruppengefüge widerspricht, ein Dilemma,
mit dem auch Sandemann hadert).
Popmusik verbindet!
Die fantastische siebenköpfige
Band Men of North Country
kommt aus Tel Aviv. Die Inspirationsquelle
für ihre Songs
findet sich jedoch im US-amerikanischen
Soul, der in den
1960er-Jahren im Norden Englands
für volle Tanzflächen und
die Entstehung der legendären
Northern-Soul-Szene sorgte.
menofnorthcountry.com
„Die anderen Mods, die Soulallnighters, die Scooter Runs,
das Partycrashen, das Popperbashen – all das interessierte
ihn nicht mehr wirklich. Geblieben war ihm der Style –
denn es war der einzige Style.“ Aus: Der Moddetektiv
Unique Uniform
Stilsicheres Kleiden ist für Mods
kein Problem. So lange die akkuraten
Hemden, Hosen und
ikonischen Parkas aus dem
Regal von Ben Sherman
aka Arthur Benjamin Sugarman
stammen. Der
in Brighton geborene
Sohn eines jüdischen
Verkäufers gründete
1963 die Firma, um
junge Londoner Jazzfans
mit den beliebten
amerikanische
Button-down-Hemden
zu versorgen, die von
Jazzkünstlern wie Miles
Davis und Dizzy Gillespie
getragen wurden.
Der Rest ist Mod-Geschichte
…
bensherman.com
Warum ist der Titelheld und Privatermittler Sandmann als
Mod angelegt?
❙ Ich wollte einen lonesome Hero als Protagonisten, jemand,
der sich isoliert, sich freiwillig aus der Gesellschaft ausschließt
und dadurch längst den Bezug zur Gegenwart verloren hat.
Jemand, der mit sich selbst und seinen Erinnerungen allein
bleibt und seinen Gedanken an „die gute alte Zeit“ nachhängt.
Sandemann ist einerseits eine schrullige, tragikomische
Figur, weil er sich seit Jahrzehnten nicht mehr wesentlich
verändert hat, ein übriggebliebener, einsamer Saurier, der
selbst den Kontakt zu seinen „Artgenossen“ abgebrochen hat.
Wenn so ein Charakter plötzlich gezwungen wird, sich der
Gegenwart zu stellen, hagelt es lustige Situationen. Andererseits
hat Sandemann auch etwas Strahlendes, ist ein Ehrenmann,
ein Ritter – der letzte Dandy und Individualist, der
sich dem Mainstream elegant verweigert.
Was wird bei Ihnen selbst immer im Mod-Modus bleiben?
❙ Ich werde niemals eine Vespa mit einem späteren Baujahr
als 1978 fahren – die letzten Vespas, die noch runde Hinterbacken
hatten. Und im Großen und Ganzen: mein Dandytum
und ein leichter Hang zur Exzentrik.
Rocking Roller
Einem echten Mod kommen freilich
nur originale Scooter in den
Stall. Für Neueinsteiger eignet
sich vielleicht aber auch die
Lambretta V200 – sie springt
verlässlich an, ist schick und
schnell genug, um sich vor dem
natürlichen Feind des Mods
(dem Rocker!) zu retten.
lambretta.com
© Julia Stix; Hersteller
wına-magazin.at
35
STÄNDIG IM UMBRUCH
Florentin –
bunt und anders
Die trendige Nachbarschaft im Süden Tel Avivs ist laut
der New Yorker „Thrillist“ bei den Insidern gleich an
zweiter Stelle nach New Yorks Williamsburg gereiht
und verspricht Fun, Art und gutes Essen.
Von Daniela Segenreich-Horsky
s geht vorbei an Kartons und
Plastiksäcken mit Textilien, die
vor Großhandelslokalen abgestellt
sind, an funky Hostels, Schneidereien,
schäbigen Fassaden mit bunter
Graffiti, an Galerien und Pop-up-Shops,
Bars und übervollen Cafés. Neben dem
Levinsky-Markt findet man Girlanden
und Plastikdekorationen in schrillen
Farben, Schaufenster voller Perlen
und bunter Steine für Modeschmuck,
endlos viele Lampen und Luster in der
Wolfson-Straße, und hinter den runden
Bauten des modernen Reviat-Florentin-
Komplex sind noch einige der alten Metallhandlungen,
Tischlerwerkstätten und
Garagen versteckt.
Das ist Florentin, ein schräges Viertel
zwischen den neueren Teilen von Tel
Aviv und dem alten Jaffo. Einst Wohnort
von mittellosen jüdischen Immigranten
sowie billige Arbeitsstätte von Garagen-
und Werkstättenbetreibern, erweist
es sich heute als noch gerade erschwingliche
Alternative für junge Menschen und
Künstler: Teils schäbig, teils farbenfroh,
mit einer ganz speziellen Atmosphäre
und den angesagtesten Bars von Tel Aviv.
In der WhatsApp-Gruppe der Nachbarschaft
warnen junge Anrainer vor dem
Polizisten, der gerade in der Abarbanel
Street Strafmandate verteilt, Hundesitter
werden gesucht, Insider-Witze weitergeleitet.
Ein junger Mann bietet einmal
pro Woche indisches Abendessen zu
günstigen Preisen in seiner Florentiner
Wohnung an. Man kann aber auch Yogagruppen,
Kunsthandwerk und Maniküre
finden …
Einer der beliebtesten Spots des Viertels
ist der Levinsky-Markt. Hier kann
man eingelegte Früchte, exotische Gewürze,
Nüsse und Mandeln in jeglicher
Form und vieles mehr findet. Vor dem
„Cafe Levinsky“ von Benny Briga findet
sich jeden Freitag eine Warteschlange ein.
Begonnen hatte Briga vor sechs Jahren
mit Kaffee und Keksen, inzwischen hat
der Tel Aviver mit der grauen Mähne das
„Gazoz“, das erfrischende Limonadengetränk,
mit dem sich die Israelis schon in
den 1930er-Jahren an heißen Sommertagen
Kühlung verschafften, wieder zum
Hit gemacht. Jetzt ist sein etwa drei Quadratmeter
großer Laden Fixpunkt für Besucher
des Markts geworden, die dann die
schwere Entscheidung zu treffen haben,
ob sie ihr Gazoz „gadol o katan“ – „groß
oder klein“ wollen. Der Rest wird für den
Kunden entschieden, denn es ist „Limonade
Free Style“: Jedes Glas wird ein Unikat,
mit echter Guave, eingelegtem Hibiskus
und Kirschen, Granatapfelkernen,
Mandarinenstücken, Melone, verschiedenen
grünen Blättern, Kambuga-Tee
und dazu Sirup und Soda.
Hunderte farbenfrohe Gläser von eingelegtem
Obst und Likören zieren den
Laden. Man findet hier so ziemlich alles,
was man aus den Früchten und Blättern
von Brigas Dachgarten und den
Produkten des Marktes machen kann.
Demnächst soll es auch selbstgemachte
Marmeladen geben. Vor dem kleinen
Geschäft steht Brigas Truck, auf dem es
Sitzplätze für die Kunden gibt. Wenn er
nicht gerade ein Getränk kreiert, sitzt der
Besitzer mit Freunden auf Schemeln vor
seinem Laden auf der Straße, heute, wie er
versichert, schon seit sechs Uhr früh: „Du
wirst es nicht glauben, aber der erste Gast
ist heute schon um 6.15 Uhr gekommen.“
Gleich nebenan sperren mehr und
mehr junge Designergeschäfte und trendige,
coole Cafés auf: Neben „Tony und
Esther“, dessen Tische die Seitengasse der
Levinsky-Straße verstellen, gibt es den
neuen Pop-up-Shop „Capriza“ von Omer.
Sie verkauft Vintage und junge Designer
und betreibt auch die Galerie mit Künstlern
aus dem Viertel: „Es ist leider schon
etwas teuer hier, wir werden bald ein anderes
Lokal suchen müssen …“, erzählt die
Jungunternehmerin, während ein Auto mit
Sesam Street-artigen tanzenden Stoffpuppen
und lauter Musik vorbeifährt, dessen
großes Poster einen guten und heiteren
Tag wünscht.
Nicht weit vom Markt hat Amit Oved
vor sieben Monaten ihren Shop „Badyna“
mit asiatischen Stoffen, Kleidern
und Schmuck eröffnet: „Es ist hier immer
noch billiger als in Tel Aviv. Das hier wird
einmal wie Soho in London, und ich will
ein Teil davon sein.“ Früher hat sie gleich
nebenan bei ihrem Großvater in seinem
Großhandel für Modeschmuckzubehör
gearbeitet, jetzt kreiert sie ihren eigenen
Schmuck aus afrikanischen Perlen, Draht
und indischer Seide.
Gil Lemel lebt schon seit sieben Jahren
in Florentin und schwärmt: „Ich mag
diese Nachbarschaft, sie ist voller Inspiration
und junger Leute, die etwas kreieren.
Es gibt hier eine ganz spezielle Energie,
eine spezielle Gemeinschaft von Menschen.
Hier hat die Kunst ihren Platz, und
jeder kann sagen: ‚Ich bin, was ich bin.‘ “
Vor mittlerweile zwei Jahren begann die
junge Designerin, trendige Rucksacktaschen
zu nähen und von ihrer Wohnung
aus zu verkaufen. Jetzt beschäftigt sie schon
zwei Näherinnen und vertreibt ihre Designs
auf diversen Märkten und weltweit
über das Internet. Die stylischen Rucksäcke
eignen sich auch bestens für Vegans,
denn sie sind aus Stoffen und Kunstleder
gefertigt. Ihr Lieblingscafé in der Gegend
ist „Hamalabiya“: „Da gibt es guten Malabi
und sehr gute Preise!“
Schmutzig, aber fun. Shilat Ifergan entwirft
und fertigt in ihrem Studio an der
Nahalat Binyamin Mall exklusive Brautkleider.
Sie liebt die Arbeit an den kleinen
Details: „Durch die Handarbeit mit
den Perlen und Spitzen ist jedes Kleid ein
wenig anders. Es ist ein sehr entwickelter,
gefragter Markt hier, und die Klientel ist
urban und modisch.“ Ifergan hat vorher
© Daniela Segenreich-Horsky; Shilat Ifergan; Gil Lemel
36 wına | Februar 2020
STEIGENDE IMMOBILIENPREISE
Gil Lemel designt stylische Rucksäcke
auch für Vegans (li).
Shuk Levinsky, einer der beliebtesten
Spots des Viertels (re).
„Ich mag diese
Nachbarschaft, sie
ist voller Inspiration
und junger Leute, die
etwas kreieren. Es
gibt hier eine ganz
spezielle Energie.“
Gil Lemel
Shilat Ifergan entwirft
exklusive Brautkleider (li).
bei einem bekannten Designer gearbeitet,
wollte sich aber immer schon selbstständig
machen und wählte für ihr Studio ein ehemaliges
Büro in einem der alten Häuser
aus den Sechzigerjahren: „Ich liebe Florentin,
es ist ein bisschen schmutzig, aber
fun! Und es ist so praktisch, weil ich hier
so nahe an den Stoff- und Nähzubehörgeschäften
bin.“ Ihre bevorzugten Cafés
sind „Aqua Terra“, wo man auch Pflanzen
erwerben kann, und „Tony ve Esther“.
Die frischesten Blumen gibt es gleich
vis a vis bei „Karmi“, wo man seinen Strauß
zu günstigen Preisen selbst zusammenstellen
kann. Und hier ist auch das „Kiosko“
ein kleines Straßencafé mit herrlichen
hausgebackenen Kuchen und kleinen
Imbissen. Im Innenraum, der eher an ein
Wohnzimmer erinnert,
sitzen junge Menschen
bei Kaffee und Snacks
an ihren Laptops.
Überall im Viertel
und vor allem am
Rande von Florentin, in
der Salame-Straße, wird
rege gebaut, und die Immobilienpreise
klettern
ständig aufwärts. Während
man die alten schäbigen
Wohnungen noch
recht günstig erwerben
kann, sind die Wohnungspreise
in den Neubauten inzwischen
bei über 10.000 Euro pro Quadratmeter
angelangt.
Nur wenige Straßenzüge weiter östlich
glaubt man sich in Afrika angelangt.
Hier, in der Nähe des Levinsky-Parks
und rund um die Bialik-Rogozin-Schule,
deren Schüler zu etwa 90 Prozent Ausländer
sind, haben sich die großteils illegalen
afrikanischen und sonstigen Einwanderer
und Flüchtlinge niedergelassen
und betreiben ihre kleinen Läden. In diesen
Straßen ist weit und breit kein Weißer
zu sehen. Es gibt allerlei afrikanische
Speisen in einfachen, schlecht beleuchteten
Buden. In einem Lokal verfolgt eine
Gruppe von Männern ein Fußballspielspiel,
Frauen gehen nicht ins Café, nur
die Besitzerin ist hier.
Es ist nicht klar, wie lange diese Menschen
noch in diesem Teil Tel Avivs geduldet
sein werden, das Viertel ist in ständigem
Umbruch begriffen, der Boden wird
immer teurer. Wer Mut hat, kauft hier jetzt
eine Wohnung und wartet ab.
wına-magazin.at
37
WINAKOCHT
Wie stößt man mit Kindern auf das
Neujahrsfest der Bäume an, …
... und warum steckt man Messer zum Kaschern in die Erde? Die Wiener Küche steckt
voller köstlicher Rätsel, die jüdische sowieso. Wir lösen sie ab sofort an dieser Stelle. Ob
Koch-Irrtum, Kaschrut oder Kulinargeschichte: Leser fragen, WINA antwortet.
Werte WINA-Kochexperten,
bei uns werden zum Tu-BiSchwat-Seder neben
Früchten auch vier verschiedene Gläser Wein
gereicht. Woher kommt dieser Brauch, und wie
kann ich ihn kindgerecht teilen?
Michaela S. aus Wien
Tu BiSchwat gehört zu den jüngeren Feiertagen
– obwohl sein Datum schon in der
Mischna erwähnt wird. Im 16. Jahrhundert
entwickelten Mystiker aus Safed den Tu-Bi-
Schwat- nach dem Muster des Pessach-Seder.
Auch zum Neujahrsfest der Bäume trinkt man
vier Gläser Wein, doch steht dabei die Verbundenheit
mit Erez Israel im Vordergrund. Weshalb
traditionell auch 15 verschiedene Früchte
gereicht werden, die in Israel wachsen.
Dort war das Datum ursprünglich ein
Stichtag für die Berechnung der Zehntabgaben:
Es markierte nämlich den Beginn einer
neuen Vegetations- und Pflanzperiode, den
Frühlingsanfang. Um diese Entwicklung vom
Winter (weiß) zum Sommer (rot) und zudem
den Aufstieg von der materiellen zur geistigen
Welt zu symbolisieren, beginnen wir beim
Trinken mit Weißwein. Das zweite Glas enthält
Weiß- mit einigen Tropfen Rotwein, das
dritte Glas mehr Rot- als Weißwein und das
vierte nur Rotwein. Kindgerecht ließe sich
diese Symbolik durch das Anbieten von vier
Fruchtsäfte umsetzen – beginnend bei Apfelsaft,
über Orangen- und Ananassaft bis hin zu
rotem Traubensaft. Um den Nachwuchs zudem
für das traditionelle Früchteessen zu begeistern,
probieren Sie doch mal unser Rezept
für „Couscous seffa“ aus.
Im Laufe der langen Geschichte hat sich die
ursprüngliche Bedeutung übrigens mit neuen
Sinnzusammenhänge verbunden: In der modernen
Zeit ist Tu BiSchwat auch ein Fest,
an dem wir uns dankbar zeigen für die Natur
und ihre Geschenke. So hat sich Tu BiSchwat
heute in Israel zum Tag des Umweltschutzes
entwickelt, an dem vor allem Schüler Bäume
pflanzen. Dafür ist es in Österreich im Februar
freilich noch zu kalt. Aber warum säen Sie mit
SÜSSER FRÜCHTE-
COUSCOUS
ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN):
500 g Couscous
750 ml Milch
eine Prise Salz
1 EL Butter
70 g Staubzucker
1 Prise Zimt
250 g gehackte Trockenfrüchte
nach Belieben
(Rosinen, Datteln, Feigen,
Aprikosen, Bananen, Äpfel,
Birnen, Beeren …)
80 g gehackte Mandeln
100 ml Orangenblütenwasser
Kerne eines Granatapfels
ZUBEREITUNG:
Die Milch mit Butter, Staubzucker,
Zimt und Salz erhitzen,
den Couscous in einer
großen Schüssel damit übergießen
und quellen lassen.
Gehackte Trockenfrüchte
und Mandeln untermischen.
Den Couscous mit dem Orangenblütenwasser
durchfeuchten.
Zum Servieren in
eine runde Schüssel füllen
und stürzen. Mit Granatapfelkernen
dekorieren.
Ihren Kindern nicht ein paar Früchtesamen im
Kisterl auf der Fensterbank aus?
Liebe Redaktion,
nachdemichversehentlicheinFleischmesserzum
Schneiden von Käse verwendet hatte, riet meine
Mutter, es zum Kaschern in die Erde zu stecken.
Reicht das denn?
Selma K. aus Wiener Neustadt
War der Käse kalt, können Sie dem Rat
Ihrer Mutter durchaus folgen und das
fleischige Messer zehnmal in die Erde stecken.
Dadurch werden Fettreste und Käsegeschmack
vom Messer entfernt. Diese Vorgehensweise leitet
sich aus dem Talmud ab, in dem folgende
Geschichte erzählt wird: Einst saßen Mar Jehuda
und Bati bar Tobi vor dem Perserkönig
Sapor, der eine Zitrusfrucht aß. Er bot Bati bar
Tobi davon an. Bevor er aber auch Mar Jehuda
eine Scheibe abschnitt, steckte er das Messer
zehnmal in die Erde. Erstaunt über die Ungleichbehandlung
fragte Bati bar Tobi: „Bin ich
etwa kein Israelit?“ Der König, der jedem der
beiden nach persischer Sitte eine Frau in das
Gemach gesandt und gesehen hatte, dass nur
Bati bar Tobi sie auch behalten hatte, erwiderte:
„Von Mar Jehuda bin ich überzeugt, dass er die
Gebote streng einhält.“
Grundsätzlich sind die Kaschernregeln
aber ein bisschen umfangreicher. Denn war
der fragliche Käse warm, reicht ein In-die-
Erde-Stecken nicht. Das Besteck muss abgebrüht
oder durch Feuer fast zum Glühen
gebracht werden. Aus hygienischen und praktischen
Gründen verfährt man allgemein am
besten so: Hat man das Besteck verwechselt,
lässt man es 24 Stunden ungenutzt. Danach
wird es in kochendes Wasser gesteckt und anschließend
kalt abgespült. Jetzt ist es parve und
kann wieder eingesetzt werden – entweder für
Fleischiges oder Milchiges.
Wenn auch Sie kulinarisch-kulturelle
Fragen haben, schicken Sie sie bitte an
office@jmv-wien.at, Betreff „Frag WINA“.
© 123RF
38 wına | Februar 2020
MATOK & MAROR
Spanien in der City
Unter die lebendigen iberischen und lateinamerikanischen Gäste des Tapas-Lokals
Lola dürfen sich ruhig auch mehr Wienerinnen und Wiener wagen.
Wollen Sie teilen?“ Es ist die
erste Frage des freundlichen
Spaniers beim Tisch, der sich
dann als Geschäftsführer Sanchez Maldonado
herausstellt. Gerne, denn es ist
wohl die beste Art, im Lola das vielfältige
Angebot zu genießen: Jeder Gast
bekommt einen mittelgroßen Teller, die
Speisen werden in schneller Reihenfolge
in der Tischmitte eingestellt.
„Wir stammen aus allen Regionen
Spaniens“, erklärt Maldonado auf die
Frage nach der Spezialisierung der Küche.
„Deshalb finden sich bei uns auch
Gerichte aus den unterschiedlichsten
Gegenden des Landes.“ Tapas sind
hier nicht die – oft mayonnaiselastigen
– Minibrötchen, wie man sie etwa in
den Pintxo-Bars des Baskenlandes findet.
Diese bestellt der Gast dort an der
Theke, nimmt sie meist gleich selbst vor
Ort zu sich und nippt dazu sein kleines
Bier vom Fass oder sein Glas Rotwein, eigentlich
schon wieder auf dem Absprung
ins nächst Lokal.
Im Lola geht es gemütlicher zu. Hier
wird am Tisch serviert, und Küchenchef
Francisco Medina bietet kreative Raciones
an, also Portionen kalter und warmer
Gerichte. Diese sind etwas kleiner
als unsere mitteleuropäischen Hauptspeisen,
aber deutlich größer als bloße Häppchen.
Die ideale Lösung ist also das gemeinsame
Mahl. „Wir wollten hier in
Wien ein typisch spanisches Tapas-Lokal
aufmachen“, erinnert Maldonado an
die Anfänge vor mehr als fünf Jahren.
„Und nach wie vor importieren wir einen
Teil der Lebensmittel und Weine selbst,
da man nicht alles in Österreich bekommen
kann.“ Das Restaurant im ehemaligen
Textilviertel im Ersten Bezirk besteht
aus einem einzigen Raum, auf einer
Seite von einem riesigen Spiegel dominiert,
am anderen von einer Bar mit typisch
spanischen Keramikfliesen. „Es ist
auch von einem spanischen Architekten
„Wir stammen aus allen
Regionen Spaniens.
Deshalb finden sich
bei uns auch Gerichte
aus den unterschiedlichsten
Gegenden des
Landes.“
Teilen und
genießen
gehört zum festen
Genusspogramm
des Lola.
WINA- TIPP
LOLA − SPANISCHES TAPASRESTAURANT
Gonzagagasse 14, 1010 Wien
Mo.− Fr., 17.30−23 Uhr
+43/(0)1 532 30 71
reservierung@lolatapas.at
lolatapas.at
geplant worden“,
so der Geschäftsführer.
„Seine
Anregungen hat
er aus dem Stil
der 1920er-Jahre
genommen.“
Ganz frisch
sind hingegen die
– nicht koscheren
– Speiseangebote.
Es beginnt zum
Aperitif mit dem
Klassiker Pan con
Tomate, dünnem Toastbrot mit Paradeisfruchtfleisch
und Olivenöl darauf. Dann
kommen schon die Pimientos de Padrón,
mittelscharfe gebratene Pfefferoni mit
ganz dünner Haut, gewälzt in Meersalz
(€ 7,50). Fischig kann man mit gegrilltem
Tosta de Salmón fortfahren, Lachs auf
Toast mit Avocadocreme (€ 9,50), oder
mit einer Mojama de atún, einem Carpaccio
von geräuchertem Tunfisch, Olivenöl
und Mandeln, dazu ein süßes Fruchtchutney
(€ 9,80). Wer vegetarisch
weitermachen
will, mag sich eventuell für
eine Torrecita de queso de cabra
entscheiden, einen kleinen
Turm aus Ziegenkäse
mit gegrillten Melanzani
und „balsámico de chocolate“
(€ 11,90). Als warme
Hauptspeise gibt es Lomos de dorada, gegrillte
Goldbrassenfilets auf einer Paprikasoße
(€ 23,90).
Für die Desserts sollte man sich etwas
Platz lassen. Crema Catalana, die spanische
Version der Crème brûlée, eine Art
Pudding mit geflammtem Karamelldeckel
(€ 5,50), oder eine Schokocrêpe
(€ 5,50) sollten sich noch ausgehen.
Und es gibt ein umfassendes, seriös
kalkuliertes Weinangebot, das seinerseits
aus den unterschiedlichsten Regionen
Spaniens kommt. Paprikasch
© Reinhard Engel
wına-magazin.at
39
HIGHLIGHTS | 03
Der Herr der Jeans
„Levi Strauss: A History of American
Style“. Eine Ausstellung im Contemporary
Jewish Museum in San Francisco
Was haben Jeans mit dem Goldrausch
zu tun? Und was das beschauliche Buttenheim
in Oberfranken mit strapazierfähigen
Arbeitshosen, die von Kalifornien aus die
Welt eroberten?
1853 landete Levi (eigentlich: Löb) Strauss
aus Buttenheim zwischen Bamberg und Erlangen
24-jährig in San Francisco, der wuseligen
Hafenstadt in Nordkalifornien. 20 Jahre
später wurde ein Patent auf nietenverstärkte
Hosen von ihm und Jacob Davis eingereicht,
der ein Jahr zuvor die Taschen von Arbeitshosen
aus Denim so verstärkte, dass sie nicht
mehr einrissen. Aus dem Stand war die Nachfrage
nach diesen „Waist Overalls“ groß, auch
weil das Marketing clever war. 1890 erhielten
die Kupferniethosen (die elf Jahre später
eine zweite rückseitige Tasche aufgenäht
bekamen) die Nummer „501“. Strauss starb
1902 im Alter von 73 Jahren. Erst 1937 – da
gab es seit drei Jahren mit „Lady Levi’s“
das erste Frauenhosenmodell – wurden
die Nieten verdeckt. Eine Generation
später wurden Jeans Ausdruck
der jugendlichen Protestkultur, dann
Modeobjekt, dies bis heute. Das Contemporary
Jewish Museum in San
Francisco zeigt nun die bis dato größte
Levi’s-Ausstellung, bestückt mit mehr als
200 Exponaten, mehrheitlich aus den gut
gehüteten Firmenarchiven. A.K.
ARISIERTE KINOLANDSCHAFT
In die faszinierenden Bestände des Wiener
Stadt- und Landesarchivs im Gasometer
D bieten die wechselnden Foyer-
Ausstellungen stets spannende Einblicke.
Ab 2. März widmet sich die neue Schau
der bewegenden Geschichte der Wiener
Kinos vom „Lichtspieltheater zum
Multiplex“. In ihrem Eröffnungsvortrag
geht Angela Heide (WINA) u. a. auf die
oft langwierigen und hoch emotionalen
Rückstellungsverfahren ab Ende 1945
ein. 3. März 2020, ab 18 Uhr
Nutz- und Kultobjekt.
Levi Strauss’
Erfindung ist heute
fixer Modebestandteil
der Menschheit.
Bis 9. August 2020
thecjm.org
André Derains
Illustration von Apollinaires
L’Enchanteur
pourrissant (1909).
Bis 23. Februar 2020
zadkine.paris.fr
Der geträumte Wald
„Le rêveur de la forêt“: eine Ausstellung
im Pariser Musée Zadkine
Das weiße Atelierhaus Ossip Zadkines
(1890−1967) ist von der Rue d’Assas
im Pariser 6. Arrondissement nicht zu sehen.
Ein sich weitender Durchgang führt
zu dem eingeschossigen, ruhigen Ateliergebäude
mit kleinem Garten, das umzingelt
ist von hohen Mietshäusern und daran
erinnert, wie noch im Jahr 1928 Montparnasse
aussah, als Zadkine dieses Studio bezog,
in dem er bis zu seinem Tod arbeitete.
„Komm“, schrieb er kurz nach dem Einzug,
„und schau dir meinen Wahnsinn von Assas
an, und du wirst verstehen, dass sich das
Leben eines Menschen ändern kann durch
einen Taubenschlag, durch einen Baum.“
Letzteres nimmt die Schau Le rêveur de la
forêt wörtlich – Arbeiten in vielerlei Arten, Stilen
und Manieren über Bäume und das
Motiv des Waldes. Aus mehr als einem
Jahrhundert stammen die rund hundert
Exponate. Zu sehen sind Arbeiten
von sehr bis weltbekannten Künstlern,
Picasso, Giacometti und Gauguin, Max
Ernst und Constantin Brancusi, fast interessanter
sind Werke jener Künstlerinnen
und Künstler, die in Lexika
stehen, jedoch stiefmütterlich vom musealen
Betrieb behandelt werden, der
Surrealist Victor Brauner, André Masson
oder die Bildhauerin Germaine Richier,
daneben jüngere, hochinteressante
wie Laure Provost. A.K.
MUSIK TIPPS
MOSZKOWSKI
Wie so viele virtuose Pianis-
ten-Komponisten der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts
ist auch Moritz Moszkowski (1854−1925)
heute mehr vergessen denn Repertoire.
Dabei sind seine Werke für Klavier wie Or-
chester noch immer beeindruckend und
hörenswert. Ian Hobson und die Sinfonia
Varsovia präsentieren nun mit Orchestral
Music, Volume One (Tocca) die Welterstein-
spielung von Johanna d’Arc, , ein eindrucks-
volles musikalisches Fresko.
ARTIE SHAW
Wenn die Zeiten so düster wer-
den wie die Wintertage, dann
braucht man einen akusti-
schen Vitaminschub, der Energie bringt.
Dafür sorgt der großartig swingende Kla-
rinettist Artie Shaw (1910−2004). Auf
These Foolish Things: The Decca Years
(Sepia) finden sich 47 Aufnahmen, die
Shaw von 1949 bis 1955 für dieses La-
bel aufnahm, darunter Standards wie Se-
renade in Blue, Travelin oder These Foo-
lish Things. . Wer wippt da nicht mit.
KURT WEILL
New York, New York! Wer
meint, Leonard Bernstein,
später Martin Scorsese hät-
ten den hektischen Puls der Metropole am
Hudson eingefangen, der irrt. Kurt Weill
tat es am Broadway schon 1947 mit dem
Musical Street Scene. . „Meine Kreativität
ist kein Vogel“, verriet Weill, „sondern ein
Flugzeug“. Das zeigt diese hochdynami-
sche Produktion des Orchestra Teatro Real
Madrid (Regie: Tim Murray) auf DVD und
Blu-Ray: hinreißend schwungvoll. A.K.
© ADAGP, Paris, 2019; Musée d’Art Moderne de Paris/Roger Viollet; Labels; CJM, Levi Strauss Co Archives
40 wına | Februar 2020
URBAN LEGENDS
Zwischen Genuss und
Verzicht
Die dritte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel ist inhaliert, und
für Ende Februar kündigt sich bereits das nächste Serienhighlight an:
Hunters mit Al Pacino. Doch die Umwelt schreit auf.
Das Internet und die zunehmende
Digitalisierung haben
die Welt näher zusammengebracht.
Das bringt auch für Juden
und Jüdinnen in der Diaspora große
Vorteile. Einerseits sind Flüge nach Israel
über die Jahre immer günstiger geworden,
VON ALEXIA WEISS vor allem lassen sie sich nun übers Netz auch
sehr kurzfristig leicht von zu Hause buchen.
Andererseits wurden Laptop und Smartphone auch zum
globalen Shoppingcenter. Mit wenigen Klicks kann ich
Kerzen für die Chanukkia oder Partydekoration für eine
Bar-Mizwa-Feier aus den USA, England oder Israel bestellen
und nach Österreich versenden lassen.
Vor allem aber bringen Streamingdienste wie Netflix
und Amazon Prime jüdisches Lebensgefühl in das eigene
Wohnzimmer. Einerseits bekommt man nun auch leicht
Zugriff auf israelische Serien wie Shtisel, Fauda, When heroes
fly oder Srugim. Andererseits produzieren diese Streamingdienste
nicht nur Mainstreamware, sondern auch viele
Nischenprodukte. Hier sei The Marvelous Mrs. Maisel genannt,
deren dritte Staffel mir rund um Chanukka wunderbare
Fernsehstunden beschert hat.
Interessanterweise wurde gerade diese Serie über eine
jüdische Stand-up-Comedian in den 1950er-Jahren weit
über jüdische Communitys hinaus zu einem Serienerfolg.
Man könnte auch sagen: Die Nische goes Mainstream.
Eine Serie, die schon im Vorfeld alleine auf Grund der Besetzung
verspricht, ein Quotenerfolg zu werden, ist Hunters.
Zu sehen ist die Geschichte von Holocaust-Überlebenden,
die in den USA Nazis jagen, ab 21. Februar auf Amazon
Prime. Al Pacino wird dabei einen der Jäger spielen.
Ich weiß also schon, was ich mir Ende Februar ansehen
werde. Gleichzeitig plagt mich dann doch ein Stück weit
das schlechte Gewissen. Denn umso mehr die Welt durch
gemeinsamen Konsum zusammenrückt, desto schneller
schreitet auch die Zerstörung des Planeten voran.
Jedes Paket, das um die halbe Welt reist, sorgt für zu vermeidenden
CO 2
-Ausstoß. Jedes Streamen ebenso. Gerade
der Onlinekonsum von Serien ist äußerst umweltschädlich.
Eine halbe Stunde Streaming produziert laut Berechnungen
des französischen Think Tanks The Shift Project Emissionen,
die 1,6 Kilogramm Kohlendioxid entsprechen. Das
Streamen war 2018 für den Ausstoß von Treibhausgasen
in der Höhe jener verantwortlich, die in dem Jahr in ganz
Spanien produziert wurden. Doch diese Menge werde sich
in den kommenden Jahren noch verdoppeln, schätzt The
Shift Project. Heute entstehen bereits 34 Prozent des globalen
Datenverkehrs durch das Streamen.
Wie werden wir die Umwelt retten und den Klimawandel
verlangsamen? Da gibt es individuelle Ansätze (etwa
durch persönliche Einschränkungen), aber auch den Ruf
nach staatlichen Regulierungen (Verboten). Persönlich
meine ich: Es wird wohl eine Kombination aus beidem
Umso mehr die Welt durch gemeinsamen Konsum zusammenrückt,
desto schneller schreitet auch die Zerstörung des Planeten voran.
nötig sein. Da das Thema allerdings zu ernst ist, um einfach
abzuwarten – nicht zuletzt aus Verantwortung für das
eigene Kind, die eigenen Kinder, versuche ich doch jetzt
schon, auch den Schutz der Umwelt in mein eigenes Konsumverhalten
miteinzubeziehen.
Interessanterweise fällt es sehr leicht, auf den eigenen
Pkw zu verzichten und vorrangig den öffentlichen Verkehr
zu nutzen. Fleisch esse ich ohnehin seit Kindheitstagen
nicht. Auf die Annehmlichkeiten des Netzes zu verzichten,
ist da schon ungemein schwerer. Gerade das Ansehen
einer gut gemachten Serie lässt einen für einige Stunden
in eine andere Welt eintauchen, das entspannt und erfreut.
Ist hier nun Verzicht das Gebot der Stunde? Ich bin unentschlossen.
Immerhin kann nicht jeder alles richtig machen.
Darüber reflektieren sollte man aber allemal. Und
dann vielleicht entscheiden, was ist mir wirklich wichtig
anzusehen, und worauf kann ich doch verzichten. Denn
auch solche Serien zu streamen, die ohnehin permanent
auf diversen TV-Kanälen laufen, fällt dann doch unter vermeidbar.
Zeichnung: Karin Fasching
wına-magazin.at
41
ZWEIERLEI MASS
Österreich lag so gar nicht auf
seinem Radar. Schon längere
Zeit wollte Itai Gruenbaum
für ein paar Jahre nach Europa
ziehen. Vorgeschwebt war ihm dabei
etwa Deutschland oder Großbritannien.
Doch dann reihte sich Zufall an Zufall,
und so landete er schließlich 2016 in Wien.
Da waren zunächst die Österreicher, die
er im Kuba-Urlaub kennenlernte. Sie luden
ihn nach Wien ein, von hier aus reiste
er nach Budapest, nach Berlin. Auf einem
Flug hörte er, wie sich Israelis, die
in Wien lebten, miteinander unterhielten,
nach der Landung kam er mit ihnen ins
Gespräch. Sie erzählten ihm von der Facebook-Gruppe
„Israelis in Wien“, dort postete
er, dass er auf der Suche nach einem
Job sei. Kurz darauf bekam er ein verlockendes
Angebot bei Emarsys, einem von
einem Israeli gegründeten Wiener Anbieter
von Marketing-Software.
Itai Gruenbaum ist mehr als technikaffin.
Nach seinem Armeedienst studierte
er sowohl Mathematik wie auch Industrial
Engineering. Für seinen ergänzenden
MBA wählte er einen Managementstudiengang
mit Spezialisierung auf IT. Noch
während des Studiums arbeitete er bei Intel,
nach seinem Abschluss bis zu seinem
Aufbruch nach Europa war er sieben Jahre
in Israels Hightechbranche tätig, war im
Produktmanagement tätig, unterstützte
den Aufbau neuer Unternehmen und half,
neue Einnahmequellen zu erschließen.
In Europa wollte er sich die hiesige way
of life ansehen. Ihn interessierten aber zunehmend
auch der Consulting-Bereich
und die Start-up-Branche. Er entwickelte
sich dabei dennoch in eine andere Richtung:
Heute stehen NGOs und Startups
im Sozialbereich, aber auch generell
Unternehmen, die auf einer soliden Basis
stehen wollen, bei ihm im Fokus. Ihnen
möchte er mit Hilfe von Technologie helfen,
sich langfristig selbst finanzieren und
damit nachhaltig agieren zu können. „Oft
ist es so, dass NGOs über Projektfinanzierungen
arbeiten. Das heißt dann aber auch,
dass ein Projekt nicht fortgeführt werden
kann, wenn das Funding endet.“ Er trennte
sich von Emarsys, wurde zunächst selbstständig
und ist heute Partner der Consulting-Agentur
freims.
Für seine Tätigkeit bei Emarsys ist er im
Rückblick dankbar, sie ermöglichte einen
guten Start in Wien. Er hatte aber das Gefühl,
dass das dort englischsprachige Um-
AUS ANDERER
PERSPEKTIVE
Seit 2016 lebt der Israeli Itai Gruenbaum in Wien.
Das Leben hier gefällt ihm gut, dennoch möchte er
eines Tages wieder zurück in seine Heimat gehen.
Am liebsten wäre ihm ein Mix beider Welten.
Text: Alexia Weiss, Foto: Daniel Shaked
42 wına | Februar 2020
EUROPEAN WAY OF LIFE
Itai Gruenbaum lebt
observant, was hier
nicht immer ganz
einfach ist. Zurück in
Israel will er beide Lebensweisen
behalten.
feld auch seine Bemühungen torpedierte,
gut Deutsch zu lernen und sich in die hiesige
Gesellschaft zu integrieren. Er besuchte
Deutschkurse und freut sich heute,
es bis zur B1-Prüfung geschafft zu haben.
Er hatte zudem das Bedürfnis, die neue
Sprache auch mehr in seinen Alltag integrieren
zu wollen. So kam der Sport ins
Spiel.
Im Kindesalter hatten seine Eltern ihn
zum Judotraining geschickt. „Judo lehrt
dich Disziplin, macht dich stärker, schult
die Koordination und sorgt für Kondition.
Judo macht dich aber auch mental stärker.
Meine Eltern wollten, dass ich sportlicher
und selbstbewusster werde. Mich hat der
Sport insgesamt stärker gemacht.“
Das kam ihm bei seinem Armeedienst
zugute. Dort war er zunächst Fallschirmspringer.
Nach seiner Ausbildung zum Offizier
arbeitete er als Verbindungsoffizier
zu den palästinensischen Behörden. Dabei
half, dass er gut Arabisch spricht. Dieses
lernte er in der Schule. Zu Hause wurde
es nicht gesprochen, obwohl seine Mutter
– sie kam als 18-Jährige aus dem Irak nach
Israel – arabischsprachig ist.
In Wien beschloss er, wieder mit dem
Judotraining anzufangen, und suchte sich
einen Verein. Dort wurde seinem Bedürfnis,
auf ein Ziel hin zu trainieren, entsprochen.
Was Gruenbaum an Österreich
schätzt, dass es hier eine Wettbewerbskultur
auch für über 30-Jährige gebe. Seit einigen
Jahren nimmt er an den internationalen
österreichischen Meisterschaften des
Judoverbandes teil. 2019 errang er in der
Klasse 40 bis 44 Jahre und bis 81 Kilo Platz
eins. Das spornt den Kampfgeist auch für
das heurige Jahr an.
Im Judoverein kam er aber auch mehr
mit Deutsch Sprechenden in Kontakt als
in seinem ersten Wiener Arbeitsumfeld.
Man lerne eine Sprache nur gut, wenn man
sie auch im Alltag anwende, ist er überzeugt.
Im Verein freundete er sich aber
auch mit einem syrischen Flüchtling an,
der damals weder Deutsch noch Englisch,
sondern nur Arabisch sprach. Inzwischen
haben der Mann und seine Familie Asyl,
und er arbeitet in seinem Beruf als Automechaniker.
Itai Gruenbaum erzählt, dass er gerne
mit Menschen ins Gespräch kommt –
auch über Israel. Syrer hätten allesamt von
klein auf Israel als Feind vermittelt bekommen,
so seine Erfahrung. Dann gebe es die
einen, die sagen, wir sind in diesen Konflikt
geboren worden, es ist aber nicht unser
Konflikt und schon gar nicht, seitdem wir
hier in Österreich ein neues Leben angefangen
haben. Es gebe aber auch die anderen,
die ihren Hass auf Israel weiter pflegen.
Bei ihnen sehe er auch die Differenzierung
zwischen Israel und Juden allgemein nicht.
Gerne würde Itai Gruenbaum ein positiveres
Israel-Bild vermitteln. Er bedauert,
dass sein Land nur dann in die Schlagzeilen
komme, wenn es zu bewaffneten
Auseinandersetzungen mit Palästinensern
komme. Das sei auch das Erste, worauf
ihn Österreicher ansprechen würden.
„Immer wieder werde ich von Menschen
gefragt: Ich würde so gerne Urlaub in Israel
machen, aber ist es nicht sehr gefährlich
dort?“
Relaxtes Wien. Angesprochen
darauf, dass es ja
tatsächlich ein höheres Anschlagsrisiko
in Israel gebe
als in Österreich, meint
Gruenbaum: Das stimme.
Aber es komme auch darauf
an, in welchem Teil
Israels man sich aufhalte.
Er meint allerdings, dass
das wiederum ein gutes
Beispiel dafür sei, wie mit
zweierlei Maß gemessen
werde, wenn es um Israel
gehe. „Hier in Österreich
kann sich keiner vorstellen,
wie es ist, mit Raketen angegriffen
zu werden.“ Vor
dieser Gewalt fürchte man sich. Gleichzeitig
werde Israel aber von vielen verurteilt,
wenn es sich gegen solche Angriffe wehre.
Was Gruenbaum an Österreich schätzt,
ist der gut ausgebaute Sozialstaat. Dinge
wie den guten öffentlichen Verkehr, fünf
Urlaubswochen, die Babykarenz würde er
sich auch für Israel wünschen. Andererseits
funktioniere hier vieles viel langsamer als in
seiner Heimat: von der Lieferfrist für Möbeln
bis hin zu Leistungen der Stadtverwaltung.
Er ortet darin auch den Grund,
dass viele Menschen hier in Bezug etwa auf
den Wechsel eines Telekomanbieters recht
träge seien. „Dinge sind teils zu kompliziert
und dauern zu lange.“ Ideal wäre eine Mischung
der Lebensweise in Österreich und
Israel, meint er – und natürlich vermisst er
das Meer und das gute Essen in Tel Aviv.
Anderes sieht er in Österreich ambivalent.
Menschen seien hier relaxter – aber
oft eben schon zu relaxt. Und: Es werde
hier sehr viel Wert auf den Schutz der eigenen
Privatsphäre gelegt. Das sei durchaus
positiv, aber oft schon zu stark ausgeprägt
– dann etwa, wenn selbst Nachbarn
einander nicht kennen. „Das gibt es in Israel
nicht. Dort weiß
„[In Israel]
weiß rasch
jeder alles
über den anderen.
Das mag
manchmal
grenzüberschreitend
sein,
dafür hilft man
einander auch.“
Itai Gruenbaum
rasch jeder alles über
den anderen. Das mag
manchmal grenzüberschreitend
sein, dafür
hilft man einander
auch.“
Itai Gruenbaum lebt
observant – das sei in
Israel leichter als in
Österreich. „Wenn ich
in Wien koscher leben
möchte, muss ich strikter
sein.“
In nicht allzu ferner
Zukunft möchte Gruenbaum
wieder zurück
nach Israel gehen. Begleiten
wird ihn seine
Freundin, die er hier
kennengelernt hat und die sich schon auf
das Leben in Israel freue. Für sich mitnehmen
möchte Itai Gruenbaum ein wenig
von der „European way of life“, der europäischen
Lebensweise. Die hat er ja zur
Hälfte auch in seinen Genen: Sein Großvater
väterlicherseits floh aus Deutschland
vor den Nazis, von ihm hat er auch seinen
Familiennamen. Seine Großmutter
stammte aus Italien.
wına-magazin.at
43
SCHARFSICHTIGE JOURNALISTIN
Ich kann aus heutiger Sicht nicht beurteilen
oder bewerten, aus welchen
Motiven das schriftstellerische Werk
von Maria Lazar vor und nach dem Zweiten
Weltkrieg verdrängt wurde: Weil sie
eine Frau war oder weil sie eine jüdische
Frau war? Tatsache ist, dass sie trotz ihres
Talentes vergessen wurde“, sinniert Mateja
Koležnik über die Autorin des Einakters
Der Henker, ihrer jüngsten Regiearbeit
am Wiener Akademietheater. Jedenfalls ist
es der slowenischen Regisseurin und der
Dramaturgin Sabrina Zwach zu danken,
dass der Person und dem Schaffen Maria
Lazars, 1895 in Wien geboren, endlich die
gebührende Aufmerksamkeit zuteilwird.
„Es ist faszinierend, wie weitsichtig
diese junge Frau war: Bereits mit 20 Jahren
schrieb sie unter dem Eindruck der Gräuel
des Ersten Weltkrieges den Einakter Der
Henker. Sie hat damals schon intellektuell
und emotional begriffen, welche Ausrede
von den Akteuren danach benutzt werden
würde, und zwar: ‚Ich habe meine Pflicht
getan‘“, erläutert Koležnik und fügt hinzu:
„Dieser Satz ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg
und bei allen kriegerischen Konflikten
seither unser ständiger Begleiter.“
Es ist kein Zufall, dass Koležnik, die bereits
2017 für Josefstadt-Direktor Herbert
Föttinger mit ihrer Inszenierung von Ibsens
Wildente einen großen Erfolg einfuhr,
an der Wiedergeburt von Lazars Der Henker
beteiligt war. Doch Zufall war es, dass
Sabrina Zwach, Dramaturgin am Berliner
Ensemble und am Wiener Burgtheater,
im Rahmen ihrer Recherche nach weiblichen
Romanautorinnen aus Wien auf Maria
Lazar stieß. „Lazar absolvierte ebenso
wie Helene Weigel das berühmte Mädchengymnasium
der Eugenie Schwarzwald.
Diese Pädagogin war eine ihrer größten
Förderinnen“, erzählt Zwach. Über
Schwarzwald wurde sie auf Lazar aufmerksam
und fand bald reichlich Publikationen,
darunter auch das 1921 an der
Neuen Wiener Bühne uraufgeführte Stück
Der Henker. „Ich war sehr aufgeregt und
auf Anhieb mächtig beeindruckt, deshalb
wollte ich, dass etwas aus meinem Fundstück
entsteht.“
Die gebürtige Heidelbergerin hatte bereits
sowohl mit Martin Kušej wie auch
mit Mateja Koležnik zusammengearbeitet:
„Ich wusste, dass sie an das Burgtheater
kommt und spürte sofort, dass Lazar jene
spannende Autorin sein könnte, die ihr liegen
würde“, so Zwach, „Mateja Koležnik
verfügt über eine puristische und so bestimmte
Theatersprache, dass es ihr ge-
Wiederentdeckung
einer Begabten
Maria Lazar: Die verdrängte und vergessene jüdische
Schriftstellerin aus dem Schottenhof. Mit dem Einakter
Der Henker hat ihr die Regisseurin Mateja Koležnik
wieder eine Stimme gegeben.
Von Marta S. Halpert
lingt, verborgene performative Qualitäten
in den Schauspielern zu erwecken.“ Mit
ihrer Begeisterung steckte Zwach sowohl
ihre Kollegen in der Burgtheater-Dramaturgie
an wie auch letztendlich Koležnik:
„Ich wusste, dass das nur eine Regisseurin
kann, die über eine Phantasie verfügt, die
über diese sprachlich anspruchsvollen 21
Seiten hinausgeht.“
So entstand im Verbund von drei starken
Frauen die Produktion von Der Henker:
Im neunzigminütigen Einakter wird
man Zeuge der letzten Stunden eines
zum Tode verurteilten Mörders, der seinen
Henker kennenlernen will und diesen
zwingt, den Akt der Hinrichtung nicht
als professionelle Pflichterfüllung, sondern
aus tiefster persönlicher Überzeugung oder
zumindest mit einem Gefühl – Hass – zu
vollziehen. In der Todeszelle werden moralische
Standpunkte und Haltungen durchexerziert.
Der Mörder wird zum Herausforderer
des Henkers in einer ethischen
Debatte, die kompromisslos und überraschend
bis zu Ende geführt wird.
Doch wer war diese Maria Lazar, die
in Eugenie Schwarzwalds Salon 1916 von
Oskar Kokoschka (Dame mit Papagei) porträtiert
wurde? Diesen Salon frequentierten
so prominente Schriftsteller wie Jakob
Wassermann, Egon Friedell, Robert Musil
und auch Elias Canetti.
In Vergessenheit geraten. Maria Lazar
war das jüngste von acht Kindern einer
jüdisch-großbürgerlichen Wiener Familie,
die im Schottenhof im ersten Bezirk
wohnte. Ihr Vater war Eisenbahndirektor,
ihr Bruder Erwin ein berühmter Kinderarzt
am AKH. Die ältere Schwester Auguste
begründete die sozialistische Kinder-
und Jugendliteratur.
Nach der Matura 1914 und acht Semestern
Studium der Geschichte an der
Universität Wien schreibt Lazar während
ihrer Anstellung als Lehrerin an Schwarz-
© Lukas Beck/Burgtheater
44 wına | Februar 2020
LITERARISCHER EXPRESSIONISMUS
Regisseurin und Hauptdarsteller:
Mateja Koležnik und
Itay Tiran. Der israelische
Schauspieler kreierte den
Mörder in Maria Lazars Der
Henker.
© bpk / Staatsgalerie Stuttgart
„Sie hat damals schon
begriffen, welche Ausrede
von den Akteuren
danach benutzt werden
würde: ‚Ich habe
meine Pflicht getan.‘“
Mateja Koleznik
walds Landerziehungsheim am Semmering
ihren ersten Roman Die Vergiftung,
der 1920 erscheint. „Dieser fulminante
erste Roman ist eine der gnadenlosesten
Abrechnungen mit der bürgerlichen
Lebenswelt in Österreich vor Beginn des
Ersten Weltkriegs und damit einer der
überzeugendsten weiblichen Beiträge
zum literarischen Expressionismus“,
schreibt der 1990 in München geborene
Germanist Albert Eibl, der den programmatischen
Verlag „Das vergessene Buch“
in Wien betreibt und dem die erneute Publikation
von Die Vergiftung im Jahr 2014
zu danken ist.
Als Lazar in den 1920er-Jahren für ihren
Roman Viermal ich keinen Verleger findet,
wendet sie sich der journalistischen
Arbeit zu und veröffentlicht bis 1933 über
hundert Beiträge im Wiener Tag und fallweise
auch in der Arbeiter-Zeitung. Trotz
ihres Renommees als scharfsichtige Journalistin
befindet sie sich ständig in finanziellen
Nöten. 1923 heiratet sie Friedrich
Strindberg, den Sohn Frank Wedekinds
und Frieda Uhls, die mit August Strindberg
verheiratet war. Die Ehe, der Tochter
Judith entstammt, wird bald wieder
geschieden. Die schwedische Staatsbürgerschaft,
die sie durch die Heirat erworben
hatte, sollte ihr später das Leben retten.
Als alleinerziehende Mutter kämpft
Lazar um ihren Lebensunterhalt: Vergeblich
versucht sie dem Zsolnay Verlag Übersetzungen
der skandinavischen Literatur
schmackhaft zu machen. Genia Schwarzwald
interveniert mehrmals für sie. Der
Kiepenheuer Verlag bekundet tatsächlich
Interesse für die Übertragungen aus dem
Dänischen und Schwedischen. Lazar fasst
den Entschluss, ihren nächsten Roman Veritas
verhext die Stadt unter dem nordischen
Pseudonym Esther Grenen erscheinen zu
lassen, und gibt sich als dänische Übersetzerin
aus. „Diese raffinierte Taktik, sich auf
dem literarischen Markt zu behaupten, ist
nach Lazars Antwort auf die abwartende
Haltung großer Verlage angesichts des aufsteigenden
Nationalsozialismus und Antisemitismus
zu sehen“, zeigt sich der Germanist
Johann Sonnleitner überzeugt. Er
widmet seine Recherchen als Professor für
neuere deutsche Literatur an der Universität
Wien zahlreichen jüdischen Exilautorinnen.
Schon Mitte 1933 emigriert Lazar angesichts
der Sorge um den Aufstieg der
Nazis mit ihrer Tochter sowie Bertolt
Brecht und Helene Weigel nach Dänemark.
Sie wohnen alle in einem Haus bei
der Schriftstellerin Karin Michaëlis auf der
Insel Fünen. 1935 übersiedelt Lazar nach
Kopenhagen, 1939 flieht sie vor den vorrückenden
Nazis nach Schweden, wo sie
in einem Archiv arbeitet. Aus einem ihrer
letzten, sehr berührenden Gedichte – Die
schöne Stadt – wird offensichtlich, warum
sie 1945 eine Rückkehr nach Österreich
ablehnt: Zwei ihrer Schwestern wurden
in der Schoah ermordet. An einer unheilbaren
Knochenkrankheit leidend, nimmt
sie sich am 30. März 1948 in Stockholm
das Leben.
In ihrem großen Exilroman Die Eingeborenen
von Maria Blut befasst sie sich
mit der schleichenden Entwicklung des
Nazismus in der österreichischen Provinz.
Ein Kapitel daraus erschien 1937 in der
von Brecht, Lion Feuchtwanger und Willi
Bredel herausgegebenen deutschsprachigen
Moskauer Exilzeitschrift Das Wort.
Mit der Drucklegung dieses Werkes 2015
hat der junge Verleger Albert Eibl einen
weiteren großen Schritt zur Wiederentdeckung
dieser völlig zu Unrecht in Vergessenheit
geratenen Autorin gemacht.
Schmales, starkes Gesamtwerk. Maria
Lazars Gesamtwerk umfasst acht Romane,
drei Dramen, eine Zitatensammlung, Gedichte,
einige Essays und zahlreiche Artikel
als Publizistin.
Trotz ihrer Vernetzung mit der Wiener
Kunstszene funktionierte die Ausgrenzungs-
und Abwertungsmaschinerie der
männlich dominierten Gesellschaft: Maria
Lazar fehlt in fast allen Anthologien
und Sammelbänden. „Man fragt sich, wie
so eine Begabung in Vergessenheit geraten
konnte“, wundert sich Dramaturgin Sabrina
Zwach, deren Recherchen sie auch
in das Thomas-Mann-Haus in Los Angeles
führten: „Dort zuckte man nur mit den
Achseln, als ich nach Maria Lazar fragte.
Das ist ein Phänomen, denn man muss viel
Kraft aufwenden, um sie in all diesen Männerbiografien
zu ignorieren. Aus Schwarzwalds
Salon und über ihre Literatur hatte
sie enge intellektuelle Beziehungen zu den
Großen dieser Zeit.“
In ihrem Einakter Der Henker stellt Maria
Lazar fünf Männer und nur eine Frau
auf die Bühne – das hat, meint Regisseurin
Mateja Koležnik, mehr als nur gesellschaftspolitische
Bedeutung: „Diese Männer
sprechen nur über ihre Pflicht, keiner
fühlt sich schuldig, keiner redet von einer
ideologischen Überzeugung, geschweige
denn über Leidenschaft. Faszinierend
ist, in welcher präzisen, modernen Sprache
sich diese Täter artikulieren.“ Als einen
Glücksfall dieser derzeit laufenden
Produktion bezeichnet Sabrina Zwach
das Zusammenwirken von Koležnik und
dem israelischen Schauspieler Itay Tiran in
der Hauptrolle des Mörders. „Mateja und
Itay kommen aus Gesellschaften, in denen
kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden
haben“, erzählt Zwach, und die
angesprochene Regisseurin fügt hinzu: „Jedes
Mal, wenn ich sagte, ich kenne Menschen
mit dem posttraumatischen Syndrom,
hat Itay gerufen ‚ich auch‘.“
wına-magazin.at
45
FEBRUAR KALENDER
FESTIVAL
div. Spielorte und Beginnzeiten
ikg-kultur.at
13. BIS 27. FEBRUAR 2020
LACHEN UND STAUNEN
Die diesjährige Ausgabe des Festivals
der jüdischen Kultur steht ganz unter
dem Motto „jüdischer Humor“. Wie facetten-
und traditionsreich, aktuell und
relevant dieser Aspekt jüdischen Lebens
ist, stellen u. a. Vivian Kanner in ihrem
Eröffnungskonzert (13.2., Porgy &
Bess), Roman Grinberg und Paul Chaim
Eisenberg in ihrem gemeinsamen Humor-Programm
Oj, hab ich gelacht!
(25.2., Urania, ACHTUNG: Ausverkauft!)
und die beiden Stand-up-Comedians
Shahar Hason und Yohay Sponder in ihrem
Funny Monday-Programm (18.2.,
Werk X am Petersplatz; 19.2., Urania)
unter Beweis. Die „Open Mic“-Funny
Night lädt alle Interessierten zur aktiven
Teilnahme am 17. Februar in das Werk X
am Petersplatz ein (Anmeldung unter
kultur@ikg-wien.at nur noch bis 2.2.!).
Und mit Woody Allen (Manhatten, 16.2.)
und John Turturro (Fading Gigolo, 23.2.)
im Votiv Kino sind auch zwei große Komikerpersönlichkeiten
des jüdischen
Films heuer mit dabei.
Ein besonderes Highlight der diesjährigen
Ausgabe ist der große Abschlussabend
am 27. Februar in der Wiener
Urania (19.30 Uhr) mit dem aus Israel
stammenden international vielbeschäftigten
Mentalisten Roy Yozevitch. Unter
dem Titel Mind Games with Dr. Roy beweist
Yozevitch in seiner weltweit tourende
neuen Show, dass die Kunst des
Gedankenlesens auch beste Unterhaltung
bietet.
KONZERT
19 Uhr
Zentrum Im Werd,
Im Werd 6,
1020 Wien
zentrumimwerd.at
14. FEBRUAR 2020
UNVORSTELLBAR?
Die beiden jungen in Wien
lebenden Sängerinnen Esther
Wratschko und Isabel
Frey (S. 48) fragen im Debütkonzert
des von ihnen
gegründeten jiddischen A-
cappella-Duos Wratschko
& Frey nach den Geheimnissen
einer Welt, die schöner
wäre als die, in der
wir seit Jahrtausenden zu
(über)leben gelernt haben.
Wie wäre es In a shener
velt, so auch der Titel
des Konzertes; wie lassen
sich die Ambivalenzen zwischen
dem Leid in unserer
Welt und dem Wunsch, ihm
zu entkommen, musikalisch
fassen; und welche Position
und Funktion nimmt dabei
die Tradition des jiddischen
Volksliedes ein? Das zweistimmige
Programm versammelt
unter anderem sozialkritisches
Wiegenlied,
Klagelied über Mädchenhandel
und antikapitalistische
Nigun und verdeutlicht,
dass das jiddische
Volkslied für unsere Welt relevant
ist und bleibt.
FILM & GESPRÄCH
15.30 Uhr
Österreichisches Filmmuseum,
Augustinerstraße 1, 1010 Wien
filmmuseum.at
9. & 16. FEBRUAR 2020
500 VON 150.000
Elf Stunden, fünf Nachmittage lang interviewte
1997 der österreichische Historiker
Albert Lichtblau den bis zuletzt unermüdlichen,
streitbaren und heute aus der österreichischen
Zeitgeschichte nicht mehr
wegzudenkenden Architekten, Autor und
Zeitzeugen Simon Wiesenthal. Der Schoah-
Überlebende erinnert sich, erzählt, lacht
und verzweifelt in diesen langen Stunden
des Erinnerns an Verfolgung, Ermordung
und Nichtaufarbeitung. Wiesenthal
formuliert sein Credo – „Recht, nicht Rache“
– und macht deutlich: Nazis sollten
uns nicht regieren! Am Ende stehen das
Unerreichte und die Ungeduld der letzten
Tage. „Man hätte 100.000 Büros“ wie das
seine gebraucht, resignierte der müde gewordene
Nimmermüde vor bald 25 Jahren.
Was hat sich seither getan, was wurde weiter
aufgedeckt, angesprochen, aufgearbeitet?
Expert*innen und Weggefährt*innen
erzählen im Rahmen von Ich bin einer der
500 von 150.000 seit Jänner und noch bis
Mitte Februar auf Einladung des Wiener
Wiesenthal Institutes nach der Projektion
der fünf Teile des historischen Filmdokuments
über ihre Begegnungen mit Wiesenthal,
selbst Erlebtes, wissenschaftliche
Erkenntnisse der letzten Jahre und aktuelle
Diskurse.
9.2.: Interview v. 20.11.1997 (Film, 56 Min.), danach
Dagi Knellessen (VWI) im Gespräch mit René
Bienert, Claudia Kuretsidis-Haider und Heidemarie
Uhl; 16.2.: Interview v. 21.11.1997 (Film, 116
Min.), danach Béla Rásky und Éva Kovács (VWI) im
Gespräch mit dem Ehrenpräsidenten der IKG Wien,
Ariel Muzicant
© Sascha Osaka (Otto Lechner); Müller/Divjak; Privatsammlung Kinsky (Café Palmhof); IKG Kultur (Kulturwoche); USC Shoa Foundation
46 wına | Februar 2020
Von Angela Heide
MUSIKFESTIVAL
div. Orte und Beginnzeiten
akkordeonfestival.at
AUSSTELLUNG
Jüdisches Museum,
Dorotheergasse 11, 1010 Wien
jmw.at
22.FEB.BIS22.MÄRZ2020
DIE KUNST DES AKKORDEONS
Von 22. Februar an findet heuer
zum 21. Mal das Internationale
Akkordeonfestival Wien statt. Wie
stets unter der künstlerischen Gesamtleitung
von Initiator und Gründer
Friedl Preisl zeichnet dieses
Jahr bereits zum sechsten Mal die
Musikerin und Musikkuratorin Franziska
Hatz für die inhaltliche Zusammenstellung
des dichten Programms
verantwortlich. An dessen
rund 50 musikalischen Events nehmen
mehr als 200 hochkarätige
Künstlerinnen und Künstler teil, darunter
Akkordeon-Legende Otto
Lechner (Foto), der auch gleich
die Eröffnungsgala mit dem französischen
Duo Arnott – Themenschwerpunkt
ist dieses Jahr „Vive
la France“ – bestreitet. An zahlreichen
Wiener Spielstätten bietet das
Festival wie jedes Jahr vielseitige
Veranstaltungen, in dessen Zentrum
die schier unendlichen Facetten
des Akkordeons stehen. Neben
Konzerten von Publikumslieblingen,
gerne gesehenen Festivalgästen
und spannenden Newcomern
gibt es Stummfilme mit musikalischer
Begleitung, Workshops sowie
ein bereitgefächertes Rahmenangebot
rund um das Akkordeon. Neu ist
die Reihe „Moving Accordions“, die
viel Bewegung auf und abseits der
Bühne verspricht!
22. JÄNNER BIS 1. JUNI 2020
UNWIEDERBRINGLICH
Da, wo sich ab 1919, kurz nach Ende des
Ersten Weltkrieges und zu Beginn der ersten
großen Jahre des „Roten Wien“, das beliebte
„Café Palmhof“ von Otto und Karl Pollak befunden
hat, auf der Mariahilfer Straße 135
in Wien-Fünfhaus, geht man heute in einen
Supermarkt. Einst wurde hier getanzt, Theater
gespielt und das gesellschaftliche Leben
Wiens der Zwischenkriegszeit mit geprägt.
Konzerte, die hier stattfanden, wurden regelmäßig
von der RAVAG (Radio Verkehrs AG)
übertragen und zählten zum kulturellen Alltag
der Stadt. 1938 wurde das beliebte Kaffeehaus
„arisiert“, die Familie nach Theresienstadt
deportiert. Karl wurde nur drei Tage
nach der Ankunft nach Auschwitz deportiert
und dort ermordet, Otto, der im Ersten Weltkrieg
ein Bein verloren hatte, verdankte diesem
Umstand sein Überleben. Anfang der
1950er-Jahre wurde der Betrieb rückgestellt,
doch Otto, von zwei Kriegen, Verfolgung
und Ermordung seiner Familie schwer
traumatisiert, lehnte es ab, hier erneut einen
„Unterhaltungsbetrieb“ zu eröffnen.
In der von Theresa Eckstein und Janine
Zettl kuratierten Ausstellung Wir bitten zum
Tanz. Der Wiener Cafetier Otto Pollak des
Jüdischen Museums Wien steht die Lebensgeschichte
Otto Pollaks im Zentrum. Beispielhaft
zeichnet sein Schicksal die Situation
jüdischer Träger des Wiener Kultur- und
Gesellschaftslebens der Zwischenkriegszeit
nach und macht deren eminente Bedeutung
anhand des beliebten Vorstadtcafés Palmhof
deutlich.
AUSSTELLUNG
Künstlerhaus Bregenz,
Gallusstraße 10,
6900 Bregenz
mueller-divjak.art
BIS 1. MÄRZ 2020
VIELSCHICHTIGER
PARCOURS DER POESIE
Mit ihrer aktuellen Ausstellung laden
die seit 15 Jahren im Team arbeitenden
Künstler*innen Jeanette
Müller und Paul Divjak im Künstlerhaus
Bregenz anhand eines Parcours
rund um die von ihnen entwickelte
Kunstfigur „Berta“ zur
„sinnlichen Entdeckung und Entwicklung
neuer Denk- und Handlungsräume
gegen die Zersplitterung
der Welt“ ein. Die Schau
unternimmt unter dem Titel 77.000
GENERATIONS – Berta says: We
need to find a new conception of
man auch ein „Plädoyer für die
Ausweitung von Zeithorizonten und
die Möglichkeiten des gemeinsamen
Wirkens“. Raumgreifende Installationen,
Skulpturen, Sound- und
Bild-Collagen, Texte, Performances
und speziell komponierte Düfte
zählen zu den ästhetischen Ausdrucksweisen
des erfolgreichen
Künstler*innenduos, das in seiner
neuen Arbeit auch auf das umfangreiche
Archiv des Bertalanffy Centers
for the Study of Systems Science
(BCSSS) zurückgreift.
Führungen: 7. u. 27.2.2020, 16 Uhr
Haben auch Sie einen Veranstaltungstipp?
Schreiben Sie uns einfach unter:
wina.kulturkalender@gmail.com
wına-magazin.at
47
DAS LETZTE MAL
Das letzte Mal ...
Das letzte Mal, dass mir Musik geholfen
hat, war ...
... als ich angefangen habe, jiddische
Revolutionslieder zu singen und sich
plötzlich meine bürgerliche Familie meine
„radikalen“ politischen Gedanken gerne
anhörte.
Das letzte Mail eine Revolution gestartet
habe ich ...
... als ich auf der Donnerstagsdemo mein
Lied Daloy Politsey/Nieder mit HC gegen
die schwarz-blaue Regierung vorgetragen
habe und zwei Wochen später die Koalition
wegen des Ibiza-Skandals tatsächlich
auseinandergebrochen ist. Auf der Kundgebung
am Ballhausplatz habe ich das
Lied dann noch ein letztes Mal mit dem
Zusatz „Heute ist Straches
letzter Tag“ gesungen.
Das letzte Mal, dass ich mir „a shener
velt“ gewünscht habe, war ...
... als ich das neue Regierungsprogramm
gesehen habe, in dem rassistische Politik
mit halbherzigen ökologischen Reformen
verknüpft ist. Ich sehne mich nach
Klimagerechtigkeit, nicht nach Ökofaschismus.
Das letzte Mal, dass ich dachte:
„So schlecht ist die Welt eigentlich
gar nicht“, war ...
... als ich an den „Fridays for Future“
teilgenommen habe und mir der Mut,
die Kreativität und der Kampfgeist der
neuen Generation Hoffnung für eine
bessere Welt gemacht hat.
Das letzte Mal ein neues jiddisches
Wort gelernt habe ich ...
... in einem sozialkritischen Wiegenlied,
das ich mit meinem neuen A-capella-Duo
Wratschko & Frey arrangiert habe. Da
singt eine Mutter ihrem Kind vor, dass
die Reichen in schönen Palästen leben,
während der arme Mann an Rheuma
leidet, weil ihm „Vilgotsch“ (= Feuchtigkeit)
von den Wänden rinnt.
ES LEBE DIE
REVOLUTION
Es gibt immer ein erstes Mal – aber auch ein letztes. In dieser
Ausgabe erzählt die Wiener Sängerin Isabel Frey über
Hoffnung in den Händen und „Vilgotsch“ an den Wänden.
Die Wienerin Isabel Frey (25) singt jiddische Revolutions- und
Widerstandslieder. Am 14. Februar um 19 Uhr findet das
Debütkonzert ihres jiddischen A-capella-Duos Wratschko & Frey statt.
Gemeinsam mit Esther Wratschko werden dabei unter dem Titel „In a
shener velt“ zweistimmig jiddische Volkslieder – vom sozialkritischen
Wiegenlied bis zum antikapitalistischen Nigun – vorgetragen.
Infos unter isabelfrey.com
© Erika Kapin
48 wına | Februar 2020
Josef Polleros
OJ, HAB ICH GELACHT!
JüDISCHER HUMOR In WORT & MUSIK
Roman Grinberg: Humor & Gesang
Sasha Danilov: Klarinette
Special Guest: Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg
MInD GAMES WITH DR. ROY
Dr. Roy Yozevitch: Mentalist
David Stein
Dienstag
25. Februar
19:30 Uhr
Urania
Mittlerer Saal
1., Uraniastraße 1
Der jüdische Humor ist dicht und
dichterisch, überraschend und
verständlich zugleich, aus dem Leben
gegriffen, erdacht, erlebt und überliefert
von dem Volk, das über die eigenen
Schwächen und Unzulänglichkeiten so
herrlich lachen kann.
Mit „Oj, hab ich gelacht! Der jüdische
Humor in Wort und Musik“ präsentiert
Roman Grinberg eine Collage aus 100
Jahren jüdischer Tradition verpackt
in Liedern, Witzen, Geschichten und
Gedichten.
Roman Grinberg gilt als einer der
vielseitigsten und gefragtesten
Experten Wiens in Sachen jüdischer
Kultur & Humor. Als renommierter
Musiker sowie als Kenner und Sammler
jüdischer Witze, ist er weit über die
Landesgrenzen bekannt. In Kombination
mit Special Guest Oberrabbiner Prof.
Paul Chaim Eisenberg erwartet Sie ein
erfrischender Abend, an dem Tränen
in den Augen und Bauchschmerzen
vor Lachen garantiert sind.
„Oj, hab ich gelacht“ werden auch Sie
nach diesem humoristischen Abend
sagen können.
Donnerstag
27. Februar
19:30 Uhr
Urania
Mittlerer Saal
1., Uraniastraße 1
Dr. Roy Yozevitch ist ein internationaler
Mentalist aus Israel, der
mit seinen Shows bereits in Indien,
den Vereinigten Staaten, China
und in vielen Städten Europa
aufgetreten ist und sein Publikum
mit seiner Gabe begeisterte.
Die Kunst des Gedankenlesens
ist wie keine andere Form der
Unterhaltung. Es ist eine Achterbahnfahrt
durch die Fähigkeiten
des menschlichen Geistes. Auf
der Reise durch die aufregende
Welt der Gedanken, wird Sie Dr.
Roy Yozevitch begleiten. Er hat das
Talent, zufällige und willkürliche Gedanken,
Vorahnungen oder Bauchgefühle,
die sich oft schon wenig
später als richtig herausstellen, zu
erkennen und zu beeinflussen.
Dr. Yozevitch demonstriert auf
humorvolle, intelligente und
interaktive Weise die Kunst
des Gedankenlesens sowie der
mentalen Beeinflussung und wird
Sie gleichzeitig zum Lachen,
aber auch zum Staunen bringen.
Lassen Sie sich verzaubern!
Kartenpreis: 18 – 30€ • Karten erhältlich unter: www.ikg-kultur.at
Cover_0220_GR.indd 3 29.01.2020 11:25:11
Eröffnungskonzert Vivian Kanner • Open Mic Funny Night •
Stand Up Comedy Shahar Hason & Yohay Sponder •
Jüdischer Humor in Wort & Musik Roman Grinberg und
Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg •
Mentalist Dr. Roy Yozevitch
Mehr Informationen unter: www.ikg-kultur.at
Cover_0220_GR.indd 4 29.01.2020 11:25:13