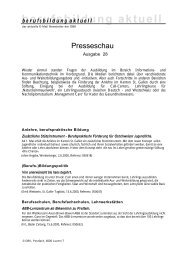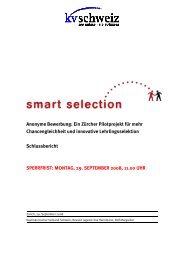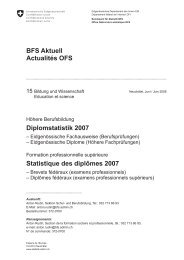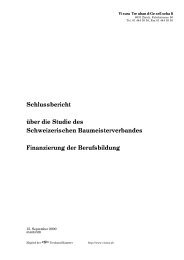Reflektierte Praxis - Bbaktuell
Reflektierte Praxis - Bbaktuell
Reflektierte Praxis - Bbaktuell
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 4<br />
Autorenbeleg<br />
Gianni Ghisla / Luca Bausch / Elena Boldrini<br />
nischer Anwendung abzielt. Dies wird curriculumtechnisch greifbar, wenn man<br />
an die integrierte Verwendung der zwei grundlegenden Ordnungsprinzipien,<br />
der Fachsystematik und der Situationensystematik auf dem curricularen<br />
Kontinuum denkt (vgl. clEmEnt, 2003; Ghisla, 2007). Im Curriculum liegt die<br />
Möglichkeit, jene Vermittlung zu antizipieren, die schlussendlich im konkreten<br />
Unterrichtsalltag von den Lehrkräften verwirklicht werden muss. Didaktisch wird<br />
das Integrationsprinzip nachvollziehbar, wenn man an die Beziehung zwischen<br />
den drei Ressourcentypen denkt: Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen können<br />
ihren eigentlichen Trägheitsstatus überwinden, wenn sie in einer integrierenden,<br />
kompetenzorientierten Perspektive vermittelt werden.<br />
➢ Reflexion und Selbständigkeit<br />
Situations- und Kompetenzorientierung der Lehr- und Lernarrangements, wie sie<br />
mit dem CoRe-Modell postuliert wird, lässt sich nur dann produktiv gestalten,<br />
wenn das angestrebte „situative Wissen“ (KaisEr, 2005; Ghisla, 2007) zunehmend<br />
reflexiv und selbständig seitens der Lernenden aufgebaut werden kann. Konkret<br />
geht es um die Förderung eines diskursiven und eines praktischen Bewusstseins 33 .<br />
Eine solche Perspektive ist nicht nur in lerntheoretisch-didaktischer Hinsicht von<br />
Bedeutung, sondern kann sich auch für die Entwicklung einer persönlichen und<br />
beruflichen Identität der Auszubildenden als entscheidend erweisen. Dazu ist<br />
aber eine kontinuierliche Vermittlung zwischen den relevanten beruflichen und<br />
den Alltagserfahrungen einerseits und dem schulischen Wissen andererseits<br />
notwendig, also zwischen Theorie und <strong>Praxis</strong>. Je nach Anforderungen und Möglichkeiten<br />
des eigenen Fachbereichs sollte sich jede Lehrkraft auf diese Arbeit<br />
konzentrieren, und so eine gemeinsame Verantwortung teilen. Insbesondere gilt<br />
es, verschiedene Ressourcen, etwa unterschiedliches Wissen, auf die beruflichen<br />
Tätigkeiten zu beziehen und so Sinnzusammenhänge zu erzeugen. Allerdings<br />
braucht es auch spezifische Kompetenzen, um diesen Prozess gezielt fördern<br />
zu können, was u. a. durch systematische Übung bei der Beschreibung, Analyse<br />
und Reflexion der Situationen geschehen kann. Eine dazu bestimmte Lehrkraft<br />
kann diese Funktion übernehmen und die Verschränkung der fachlichen bzw.<br />
lernspezifischen Aspekte mit der Entwicklung der Persönlichkeit so unterstützen,<br />
dass eine selbstsichere und verantwortungsvolle Identität anvisiert werden<br />
kann.<br />
3.4.2. Verantwortung der Lernorte<br />
Die Gestaltung der Ausbildung als partnerschaftliche Aufgabe führt dazu, dass<br />
jeder Lernort eine spezifische Hauptverantwortung für den Aufbau von bestimmten<br />
Kompetenzen und für deren Beurteilung übernimmt. Aus Tab. geht die entsprechende<br />
Aufteilung hervor, wobei grundsätzlich im Betrieb sämtliche Kompetenzen<br />
zum Zuge kommen 34 .<br />
33 Diese Begriffe lehnen sich an die Arbeiten von GiddEns, 1988 [1984]) an. Vgl. Ghisla, 2007.<br />
34 Es liegt auf der Hand, dass im Betrieb sämtliche Kompetenzen eingeübt werden. Mit Ausnahme<br />
der Kompetenzen 11 und 12 trägt der Betrieb auch zur Beurteilung aller Kompetenzen bei.<br />
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 104. Band, Heft 3 (2008) – © Franz Steiner Verlag, Stuttgart