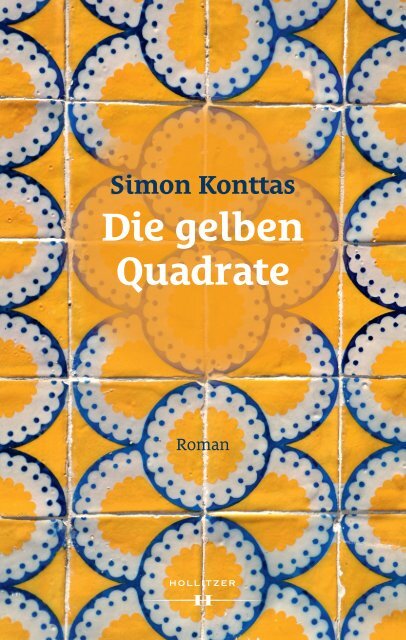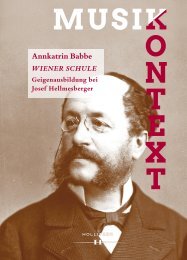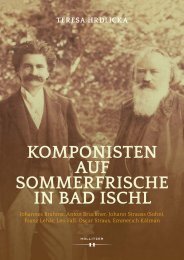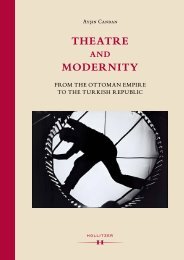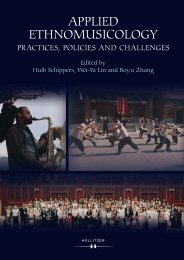Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> <strong>gelben</strong> <strong>Quadrate</strong>
SIMON KONTTAS<br />
DIE GELBEN QUADRATE<br />
Roman
Lektorat: Teresa Profanter<br />
Umschlaggestaltung: Daniela Seiler<br />
Satz: Daniela Seiler<br />
Hergestellt in der EU<br />
Simon Konttas: <strong>Die</strong> <strong>gelben</strong> <strong>Quadrate</strong><br />
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von:<br />
MA 7 – Kulturabteilung der Stadt Wien<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
© HOLLITZER Verlag, Wien 2018<br />
www.hollitzer.at<br />
ISBN 978-3-99012-529-8
1<br />
„Stört’s dich, wenn ich zumache?“, fragte die zwanzigjährige,<br />
etwas dickliche junge Frau, nachdem sie ihre ausgerauchte<br />
Zigarette in den Innenhof des Altbaus geworfen<br />
hatte, und mit glasigen Augen dem zischelnden Verlöschen<br />
des Stummels in einer der Pfützen folgte.<br />
„Pfui, dieser Regen, schon seit drei Tagen“, sagte sie und<br />
wandte sich dabei wieder dem Brett zu, auf dem geschälte<br />
Kartoffeln im fleckigen Licht der Küche matt glänzten.<br />
„Nein, nein“, sagte Sebastian, geistesabwesend und in Gedanken<br />
an den seit gestern Abend erwarteten Anruf.<br />
Sebastian Calan, Student der Philosophie, bewohnte mit<br />
zwei weiteren – er pflegte nicht „Mitbewohner“, sondern<br />
nur das unverfänglichere Wort „Menschen“ auf diese anzuwenden<br />
– Menschen also eine Wohnung eines alten Hauses<br />
im fünften Wiener Gemeindebezirk mit hohen Zimmerdecken<br />
und knarrenden Fußböden.<br />
Betrat man die in vier einzelne Zimmer mit gemeinsamer<br />
Küche geteilte Wohnung, durchquerte man einen immer im<br />
Dunkeln liegenden Vorraum mit einem im Laufe der vielen<br />
Jahre schon schwarz gewordenen Parkettboden; linkerhand<br />
befand sich ein kleines Badezimmer; geradeaus gehend gelangte<br />
man in einen gemeinschaftlich genutzten Raum, in<br />
dessen einer Ecke ein Aquarium stand und an dessen Ende<br />
sich ein weiterer Flur in das mit vielen Teppichen ausgelegte<br />
Zimmer des anderen „Menschen“ öffnete. Von der <strong>Die</strong>le<br />
kommend, gellte einem sogleich das Weiß der alten Kacheln<br />
5
der Küche entgegen, in deren einem Eck sich der Raum mit<br />
der Toilette befand, die einer der ehemaligen und schon<br />
längst ausgezogenen Bewohner mit alten Filmplakaten,<br />
Werbebändern und eigenen Zeichnungen beklebt hatte: ein<br />
winzig kleiner Raum, in welchem man stets das Gefühl hatte,<br />
als ob ein eiskalter Luftzug die entblößten Beine umwehte,<br />
in welchem sich länger als notwendig aufzuhalten jedoch<br />
um der vielen Bildchen willen nicht unbedingt unangenehm<br />
war, wie Sebastian schon oft festgestellt hatte.<br />
So saß auch jetzt der dritte „Mensch“, Bruno, ein vierzigjähriger<br />
und, wie auch die junge Frau, etwas dickerer Mann,<br />
auf ebenjenem Ort, wobei sein ausgestoßenes Gepfeife die<br />
Räume halb mit Lustigkeit, halb mit einer gekünstelten<br />
und darum, zumal für Sebastian, nicht unbedingt leicht erträglichen<br />
Unbefangenheit erfüllte. Das Mädchen, ähnlich<br />
unbedarft wie ihr älterer Mitbewohner und von weniger<br />
anspruchsvollem Gemüt, begann zu lächeln. Zwischen den<br />
beiden entspann sich ein sorgloses Geplänkel, das mit der<br />
knarrenden Wasserspülung, deren krachendes und schäumendes<br />
Kreischen die gesamte Wohnung auszufüllen schien,<br />
ein jähes Ende fand. Der Mann, der eine einer Tonsur ähnelnde<br />
Glatze hatte, strich sich, aus dem kleinen, kalten Raum<br />
tretend, mit selbstgefälliger Zufriedenheit über den Bauch<br />
und platzierte sich auf einer der Arbeitsflächen. Währ end<br />
er sich streckte, wippte er mit den Beinen hin und her, wobei<br />
er, nach einigem Gähnen und Knacken mit den wulstigen<br />
Fingern – Sebastian wunderte sich immer aufs Neue,<br />
dass aus diesem weichen Wulst sich ein derartiges Knacken<br />
überhaupt vernehmen ließ – sagte: „Mmhh, das riecht gut.<br />
Was wird das, wenn’s fertig ist?“<br />
„Ein ganz normaler Kartoffelauflauf“, sagte Beate.<br />
„Mmhh, ich mag Kartoffeln sehr“, sagte Bruno.<br />
<strong>Die</strong> beiden „Menschen“ hatten, nachdem sie hier, einige<br />
Monate vor Sebastian, eingezogen waren, Gefallen gefunden<br />
6
an der Tatsache, dass die Initialen ihrer Namen sich deckten;<br />
dies in mundfertig-rascher Schalkhaftigkeit als Schicksal<br />
ausgelegt und beschlossen, dass, nach Aufnahme der vierten<br />
und letzten Mitbewohnerin, man in der Wohngemeinschaft<br />
ein Herz und eine Seele sein wolle; welches Vorhaben<br />
weniger durch die nach Sebastians Einzug an ihm spürbar<br />
werdende Abstandnahme von einer allzu raschen und voreiligen<br />
Berührung der Lebenskreise anderer Menschen vereitelt<br />
wurde, denn eher durch die gereizte Verschlossenheit<br />
der neuen Mitbewohnerin Carolina, die sich, außer abends,<br />
kaum je blicken ließ und sich auch sonst in einer schweigsamen<br />
Ummanteltheit gefiel, in der sie, wie Sebastian beobachten<br />
konnte, ihr vorgeblich durch die Männer verursachtes<br />
Leid ungestört bejammern konnte. Auch an diesem<br />
Septembervormittag saß sie in ihrem Zimmer und versteckte<br />
sich vor den anderen. Man wusste davon. Um aber etwas<br />
zu sagen, flüsterte Bruno mit ernstem Gesichtsausdruck und<br />
so, als ob er auf Grundlage dieses Wissens weitere Aussagen<br />
tätigen wollte: „Und die Caro, wo ist die?“<br />
„Im Zimmer, natürlich.“<br />
„Ach so“, war die Antwort des ältesten der Mitbewohner.<br />
Dann schwieg man wieder und die vorgebliche Wichtigkeit<br />
der Sache verebbte.<br />
Sebastian hatte für Bruno weder eine Zuneigung, noch<br />
war ihm dieser Mensch sonderlich angenehm. An die unteren<br />
Küchenschränke gelehnt, glitt sein Blick an Brunos<br />
Gestalt ab und er fragte sich: ‚Was ist eigentlich an diesem<br />
Menschen dran? Wie kann es sein, dass er schon vierzig<br />
Jahre alt ist, sich aber benimmt wie ein Zwanzigjähriger?<br />
Was hat er sein Lebtag lang eigentlich gemacht? Wozu auch<br />
muss er sich in seinem Aquarium seit Neuestem eine kleine<br />
Schildkröte halten?‘ – Und indem Sebastian zugleich an<br />
das kleine Tier und an den dicken Menschen dachte, der in<br />
wippender Selbstgefälligkeit vor ihm stand, empfand er so<br />
7
etwas wie Mitleid mit der Schildkröte, die in einförmiger<br />
Nichtigkeit ihre traurigen Runden im Aquarium drehte, ab<br />
und an ihr Köpflein aus dem Wasser streckend, angewiesen<br />
auf die Gutmütigkeit von Menschen wie Bruno oder Beate,<br />
die, wenn sie geruhten, es nicht zu vergessen, das Tier fütterten;<br />
wobei sie dies aber häufig zu tun vergaßen. Das bald<br />
in erstickender Größe wie aufplatzende und bald wie unverhältnismäßig<br />
aufgequollene Mitleid mit dem Tier verdichtete<br />
sich in einem prüfend-wägenden Blick auf Bruno, der wieder<br />
mit seinem Pfeifen begann und an das schmale und hohe<br />
Fenster getreten war, dann das Pfeifen unterbrach und sagte:<br />
„Pfoah, so ein Wetter. Ich mag das Wetter im September<br />
überhaupt nicht. Eigentlich mag ich nur den Sommer. Im<br />
Sommer geh ich ins Gänsehäufl, aber man kann ja auch auswärts<br />
schwimmen gehen, oder? Ich meine, was willst du im<br />
Winter eigentlich machen; kannst ja nur zu Hause sitzen und<br />
nichts tun, ich meine: Was willst du im Winter machen? Ich<br />
verstehe die Caro schon irgendwie. <strong>Die</strong> liest ja viel, oder?<br />
Aber ich hab gar keine Kraft zu lesen. Das Wetter schlägt<br />
mir einfach zu sehr aufs Gemüt …“ Sebastian horchte auf:<br />
Hatte Bruno soeben das Wort „Gemüt“ verwendet? Aber<br />
wie sollte man sich diesen, nun, zwar nicht Koloss, aber anständig<br />
beleibten Menschen beim Schwimmen vorstellen,<br />
und das auch noch gemütvoll …? „…und dann fühl ich mich<br />
einfach so müd beim Lesen. Ich bewundere das, keine Frage,<br />
das muss ich schon sagen, genau. Ich habe letztens ein Buch<br />
über die Aura des Menschen ausgelesen. Sehr interessant. Du<br />
musst die Aura von unten bis oben entoden oder so irgendwie<br />
heißt das: Ich glaube, da sagt man ‚entoden‘. Das heißt:<br />
du musst dich hinstellen und dann dich ganz auf die Mitte<br />
deines Körpers konzentrieren und dann musst du gut und<br />
langsam atmen. Das ist deshalb, damit du deine Aura reinigst.<br />
Dann fühlst du dich sauber und kannst dich ganz mit<br />
voller Energie den Sachen widmen, genau.“ Bruno hatte die<br />
8
Angewohnheit, am Ende seiner Ausführungen das Wörtchen<br />
„genau“ zu verwenden, so als ob er jene Bestätigung, deren<br />
er auswärts nicht teilhaftig wurde, sich einfach selber gebe.<br />
„Und, kommt die Lydia heut übrigens?“, fragte Bruno,<br />
sich in einem jähen Ruck vom Fenster zu Sebastian wendend,<br />
der, noch am Faden wie tropfenweise sich formender<br />
Gedanken spinnend, nicht sofort zu antworten vermochte.<br />
Nach einigen Augenblicken erst nickte er. Dann, als sich<br />
Bruno erneut zum Fenster drehen wollte, um sein Selbstgespräch<br />
fortzusetzen, sagte Sebastian: „Ach so, nein, nein,<br />
sie kommt nicht. Ich fahre hin. Ich fahre zu ihr.“<br />
„Ach so, du fährst heute nach Blumau?“, fragte Beate.<br />
„Ja, ja“, sagte Sebastian.<br />
„Blumau ist übrigens ein schöner Ortsname, findest du<br />
nicht? Lass dir das auf der Zunge zergehen: Blum. Au. <strong>Die</strong> Au,<br />
wo die Blumen blühen, fast wie im Paradies, oder? <strong>Die</strong> Lydia<br />
hat dort ein Pferd stehen, oder?“ Sebastian bejahte die Frage.<br />
„Seit wann kennt ihr euch eigentlich?“, fragte Bruno,<br />
wobei er aber, ohne die Antwort abzuwarten, fortsetzte:<br />
„Genau. Blum. Au. Finde ich schön, oder? Da gibt es ja das<br />
Sommertheater und die Steinerschule ist dort, oder? Ich war<br />
einmal dort, in der Gegend, Fliesen legen. Ja, das ist aber<br />
auch schon zwanzig Jahre her. Da hab ich noch Kraft in den<br />
Muskeln gehabt, echt wahr. Ordentliche Muskeln und sogar<br />
einen Waschbrettbauch hab ich gehabt.“ Beate wandte sich<br />
um: „Echt?“, fragte sie, das „E“ in die Länge ziehend.<br />
„Pfoah, wenn ich noch Fotos hätte, könnt ich die euch<br />
zeigen. Anfang der Neunziger war das, genau. Da habe ich<br />
noch einen Waschbrettbauch gehabt. Aber, na ja, man kann<br />
ja nicht alles haben. <strong>Die</strong> Zeiten ändern sich eben, oder? Ich<br />
mein, so ist das halt, da kannst du nichts machen. Ich weiß<br />
nicht, was ich heute als Student tun würde, wenn ich kein<br />
Geld hätte. Damals ist es uns wirtschaftlich ja noch gut gegangen.<br />
Du hast dich wo hingestellt, hast gesagt: Hallo, da<br />
9
in ich, nehmt mich und – zack, bum – da haben sie dich dann<br />
genommen. Und ich hab wirklich gut verdient, als Student.<br />
Ich mein, ich war ja auch fesch, ich mein, mit Verlaub, jetzt<br />
kann ich das sagen. Ich hätte mehr Freundinnen haben können.<br />
Ich sage: ‚hätte‘. Ich weiß wirklich nicht, was ich heute<br />
tun würde, um zu Geld zu kommen. Heute kannst du einfach<br />
nichts machen. Du bist heute einfach total hilflos, ich<br />
meine, die Wirtschaftskrise und das alles. Was kannst du<br />
schon machen? Du kannst Plasma spenden oder Schmuck<br />
stehlen, genau … und dann verkaufen, oder du kannst drei<br />
Handys … – die kannst du anmelden und dann gleich wieder<br />
verkaufen, genau … aber ich meine: Wer macht das,<br />
wer tut sich das an? Aber so ist das halt, genau. <strong>Die</strong> Zeiten<br />
ändern sich und wir müssen uns an die Zeit anpassen, da<br />
hilft nichts. Wenn du nichts machen kannst, kannst du eben<br />
nichts machen, da hilft das Jammern auch nichts. Ich meine,<br />
du brauchst ja nur aus dem Fenster schauen. Das Wetter war<br />
einfach auch besser, damals. Ich meine auch: Wie soll ich<br />
jetzt noch trainieren? So einen strammen Waschbrettbauch<br />
bekomme ich nie mehr wieder zusammen, aber die Zeiten<br />
ändern sich eben, genau.“<br />
„Dann musst du dich eben entoden“, sagte Beate.<br />
„Ja, genau, deshalb hab ich ja auch das Buch gekauft. Ich<br />
hab’s ja nicht umsonst gekauft. Du kannst ja nichts machen,<br />
was willst du tun? Im Kaffeehaus kann ich auch nicht den<br />
ganzen Tag sitzen, das Spazierengehen wird auch langweilig<br />
mit der Zeit. Pfoah, jetzt hab ich mich geschreckt!“, rief<br />
Bruno plötzlich aus.<br />
„Huh, ich mich auch.“ Das an der Wand angebrachte Telefon<br />
klingelte, ein richtiges Festnetztelefon, dessen Notwendigkeit<br />
von der alten Vermieterin, die in einer Villa im<br />
neunzehnten Bezirk wohnte und sich immer mit dem Taxi<br />
in die Cafés des ersten Bezirks fahren ließ, aufs Entschiedenste<br />
verteidigt wurde.<br />
10
„Ist das jetzt dein Professor?“, fragte Bruno, während<br />
Sebastian, innerlich unwillig sowohl über diese ihm dreist<br />
anmutende Frage wie auch über den Anruf selber, den er<br />
mehr gefürchtet denn erwartet hatte, sich dem laut und<br />
aufdringlich läutenden Apparat näherte. ‚Alles ist in dieser<br />
Wohnung laut und aufdringlich: die knarrenden Bretter,<br />
die Toilettenspülung, das Telefon, dieser Bruno. Zum<br />
Glück geht mein Zimmer auf eine Sackgasse. Gott sei Dank<br />
ist es in meinem Zimmer ruhig.‘ Sebastian atmete, in dieser<br />
Mischung von Beklemmung und Glück, schwer und ihm<br />
war plötzlich – ‚Wie lange schon‘, fragte er sich, habe ich<br />
nicht so gefühlt? Und warum nicht?‘ – nach Weinen zumute:<br />
‚Ja, warum habe ich nicht so gefühlt? Und jetzt das. Jetzt<br />
ruft dieser Wilmitsch mich an. Seinetwegen fühle ich so.<br />
Seinetwegen erlebe ich ein Gefühl. Dann aber wird er mich<br />
vereinnahmen, dann wird er mich binden und ich werde sein<br />
Mitarbeiter sein und dann werde ich nichts mehr empfinden,<br />
dann werde ich abstumpfen und versauern in der stickigen<br />
Luft der Archive und des Kellers. Und wozu das alles? Für<br />
die neue Edition irgendeines Werks, für das sich niemand<br />
interessiert? Wozu das alles? Kurzes Erleben, kurzes Aufflackern<br />
einer menschlichen Regung und dann soll das alles<br />
aus sein, überfrachtet und überstickt von der erbärmlichen<br />
Nichtigkeit der Wissenschaft und wozu, wozu …?‘ Sebastian<br />
hörte Professor Wilmitschs fröhliche, bubenhafte Stimme,<br />
der das beständige Lächeln eingeschrieben war wie einem<br />
Baumblatt seine Adern. Und kaum hatte Sebastian sich<br />
versehen, sagte er ein ‚Ja‘ und in diesem Augenblick, als er<br />
es aussprach, schien ihm, dass alles egal und gleichgültig sei;<br />
nicht einmal mehr der trotzende Unmut, verursacht durch<br />
die dreiste Ungezwungenheit Brunos, vermochte ihn noch<br />
zu stören. ‚Mich stört nichts, weil mir alles egal ist. Mir<br />
ist alles egal, weil ich plötzlich innerlich abgestorben bin.‘<br />
Sebastian war, als ob er ausspucken müsste, wie nach einer<br />
11
langen Anstrengung, die er bald auskostete und die er zugleich<br />
lächerlich übertrieben fand. Er sprach mit Wilmitsch.<br />
12
2<br />
<strong>Die</strong> Mutter von Sebastians Freundin Lydia, eine kleine,<br />
schwarzhaarige Frau, die, hierin ganz das Gegenteil ihrer<br />
trägen und schwerblütigen Tochter, großen Gefallen fand<br />
an Gartenarbeit und an haushälterischen Verrichtungen,<br />
wohnte – schon seit Langem von ihrem Mann geschieden –<br />
in einem heruntergekommen wirkenden Häuschen am<br />
Rande des Örtchens Blumau. Das Häuschen ähnelte einem<br />
englischen Cottage. Seine Wände waren weiß getüncht, es<br />
war einstöckig, hatte an einer Stelle ein sehr weit hervorragendes<br />
Dach und war niedrig, viel zu niedrig für Sebastians<br />
Geschmack. So sehr Lydias Mutter Helga in der Arbeit im<br />
Freien Sinn und Kraft fand, so wenig tat sie dies innerhalb<br />
ihrer eigenen vier Wände. <strong>Die</strong> innerhäuslichen Verhältnisse<br />
waren zwar nicht unsauber oder gar unhygienisch, aber<br />
es herrschte ein ziemliches Durcheinander, das durch die<br />
dösende und lustwandelnde Anwesenheit von zehn Katzen<br />
und Katern nicht wenig unterstrichen wurde; die Enge der<br />
Zimmer sowie die Niedrigkeit der Zimmerdecken trugen<br />
das Ihre bei, um dem Haushalt einen Anstrich von sorgloser<br />
Wildheit zu verleihen. Auch tummelten sich in dem Haus<br />
zwei Hunde, die dank des großen Gartens jedoch so gut wie<br />
nie ausgeführt wurden. <strong>Die</strong> zwei großen Tiere, gutmütig<br />
und ihres an Gerüchen reichen Lebens froh, waren von derselben<br />
dahingefläzten Urwüchsigkeit wie sie auch die Katzen<br />
auszeichnete und wie sie Sebastian – leider zu oft – auch<br />
an Lydia glaubte ausmachen zu können.<br />
13
In diesem Haus nun hielt sich Sebastian vor einem Jahr auf.<br />
Seit seiner Verbindung mit Lydia war es zu sehr vielen Besuchen<br />
gekommen, die, wenngleich die inneren Verhältnisse<br />
nicht ganz Sebastians Erwartung übersichtlicher Reinlichkeit<br />
entsprachen, er dennoch nicht ungern über sich ergehen<br />
ließ, zumal die Nähe des Waldes, heller Lichtungen und kleiner<br />
Flüsse seinem Wesen, wie ihm schien, sehr schmeichelte.<br />
Auch hatte Helga eine eigentümlich mütterliche Sympathie<br />
für den Lebensgefährten ihrer Tochter entwickelt, nicht zuletzt<br />
weil Sebastian sich immer einem der beiden Hunde annahm,<br />
um diesen auszuführen, wobei er oft mehrere Stunden<br />
lang mit dem Tier ausblieb, das dann, von solchem ungewöhnlichen<br />
Abenteuer ermattet zurückkehrend, sich gleich<br />
in sein Körbchen legte, um in seliger Indolenz einzuschlafen.<br />
Besondere Vorliebe hatte Sebastian für den schwarzen<br />
Mischlingshund, der auch an diesem Tag vor einem Jahr zu<br />
seinen Füßen lag, als er, Äpfel für einen Kuchen schälend<br />
(Helga hatte ihn darum gebeten), dem pausenlos laufenden<br />
Radioprogramm seine Aufmerksamkeit schenkte.<br />
Helga besaß keinen Fernseher oder andere ähnliche ‚Kontakte<br />
zur Außenwelt‘, wie sie, in einer ihrer Tochter ganz<br />
entgegengesetzten Verschmitztheit zu sagen pflegte, stolz<br />
auf ihre Abgeschiedenheit, die es ihr auch gestattete, in<br />
solch dem Durcheinander ergebenen Wohnverhältnissen zu<br />
hausen, ohne dabei auf andere mit einer allzu übertriebenen<br />
Reinlichkeit Rücksicht nehmen zu müssen.<br />
Es war ein gutes Radioprogramm, das neben klassischer<br />
Musik und World Music Reportagen aus anderen Ländern<br />
brachte sowie Diskussionssendungen. ‚Ich versteh zwar<br />
nicht viel von dem, was die Leut da reden, aber ich hör mir’s<br />
schon gern an, weil sie so schön sprechen. Das mag ich‘, hatte<br />
Helga einmal gesagt. An jenem Nachmittag, nachdem ein<br />
tönender Gong die Nachrichten eingeläutet hatte, folgte<br />
eine Diskussionsrunde. Es wurde über literarische und<br />
14
philosophische Neuerscheinungen gesprochen. Der Moderator,<br />
bekannt für seine weiche und tragend-tiefe Stimme,<br />
beherrschte mit milder Teilnahme die sich Unterhaltenden,<br />
von denen einer über ein erst neulich erschienenes Werk eines<br />
gewissen Geronimo Weißler zu sprechen begann. Sebastian<br />
hatte am Vortag, im Café sitzend, zufällig einen Artikel<br />
über eben diesen Weißler gelesen, dessen Foto, beinah größer<br />
als der Text selber, neben diesem abgedruckt war: ein gutaussehender,<br />
dreiunddreißig Jahre alter Mann, der, eine<br />
schlanke Blondine im Arm, mit in den Nacken geworfenem<br />
Haar, in seines Erfolgs sicherer Selbstgewissheit in die Kamera<br />
lächelte. Sebastian hatte den Text nur überflogen und<br />
nicht viel von dem aus Weißlers Buch Zusammengefassten<br />
verstanden. Der Artikel handelte mehr von des ‚Pop‘-Philosophen<br />
(wie Weißler betitelt wurde) schöner Freundin, die,<br />
selbst eine Philosophin, sich zuerst als Model, wie es in dem<br />
Artikel hieß, ‚durchgeschlagen‘ hatte, bevor sie, vermittels<br />
der Berühmtheit ihres Lebensgefährten, jener Aufmerksamkeit<br />
teilhaftig geworden war, die ihr eigentlich schon vor<br />
seinem Ruhm gebührt hätte. Es war ein Frauenmagazin, das<br />
Sebastian durchgeblättert hatte. Vergeblich versuchte er aus<br />
dem Artikel herauszulesen, worin die denkerische Leistung<br />
der Model-Philosophin bestanden haben sollte, die, wenn<br />
sie in gedruckter Form vorläge, sicherlich nicht wenig einschlägig<br />
wäre, wie Sebastian dachte.<br />
Helgas Hund blickte, zu Sebastians Füßen liegend, auf,<br />
als sich dieser nun doch erhob, um das Radiogerät lauter<br />
zu stellen.<br />
<strong>Die</strong> eigentliche Gesprächsrunde über Weißlers zwar nicht<br />
erstes, aber neuestes und vorgeblich bahnbrechendes Werk,<br />
hatte erst begonnen. Ölig weich eine nicht gerade leicht<br />
nachvollziehbare Frage formulierend, wandte sich der Moderator<br />
an einen der Philosophen, der, nach einem Räuspern,<br />
den offenbar ebenso wenig leicht nachvollziehbaren Versuch<br />
15
wagte, das in Weißlers Buch Dargestellte der Hörerschaft zu<br />
vermitteln: Der eigentlich interessante Gedanke, so der Philosoph,<br />
bestehe darin, dass die Welt, laut Weißlers Untersuchungen,<br />
in Wirklichkeit gar nicht existiere; nicht, weil<br />
sie nicht etwa in actu existiere, sondern weil das denkende<br />
Subjekt nicht vermöge, sich seiner Beteiligtheit an dem, was<br />
Welt sei, zu entschlagen, sprich (der Philosoph verwendete,<br />
so wie Bruno das Wörtchen ‚genau‘, ebenso häufig das<br />
Wörtchen ‚sprich‘) aus der Welt herauszutreten. Da sei nun<br />
einmal ‚gleichsam‘ die ‚axiomatische Annahme‘ des Philosophen<br />
Weißler. Es handle sich dabei um einen ‚radikalen<br />
Realismus‘, den Weißler ja, wie bekannt sei, vor einem Jahr<br />
an einem heißen Juliabend in Rom mit seinem Freund und<br />
Mitdenker Karl Rank, ausgerufen habe, indem die beiden<br />
Denker sich durch ein Fachblatt an die denkerische<br />
Öffentlichkeit gewandt hatten, diesem Ausruf zu folgen, um<br />
‚gleichsam‘ ein neues Zeitalter des ‚fühlenden Denkens, in<br />
dem nichts unmöglich sein soll‘ auszurufen. Das aber wolle<br />
er nur am Rande für die ‚Hörerinnen und Hörer ins Gedächtnis<br />
rufen‘. Es sei also insofern ein ‚radikaler Realismus‘,<br />
als er sich ‚diametral‘ vom Konstruktivismus unterscheide,<br />
indem dieser behaupte, es gebe in einer Situation nur so viele<br />
Glieder, wie es Glieder gibt; was man sich konkret so denken<br />
könne: Man sitze hier im Radiostudio in Wien und so<br />
gebe es die Hörerschaft, das Radio und das Thema, über das<br />
geredet werde; der ‚radikale Realismus‘ jedoch gehe davon<br />
aus, dass es zu jedem Bezugspunkt der Realität einen weiteren<br />
Bezugspunkt gäbe, indem er denselben von innen heraus<br />
konstruiere, wobei man sich das Ergebnis wie ein Netz<br />
vorstellen könne. Der Moderator fragte, ob er dies anhand<br />
eines Beispiels den ‚Hörerinnen und Hörern‘ näher erläutern<br />
können; das sei ja doch ‚durchaus kompliziert‘. Nein,<br />
da dürfe man, so der Philosoph, nicht zu kompliziert denken<br />
und so sagte er: „Stellen Sie sich vor, Sie lesen ein Buch,<br />
16
wobei Ihnen jemand zuschaut. Für den Konstruktivismus<br />
gibt es das Buch, den Leser, den Zuschauer. Für Weißler jedoch<br />
gibt es das Buch, das Buch für den Leser, das Buch für<br />
den Zuschauer; und, weiter gesprochen, gibt es laut Weißler<br />
den Zuschauer für den Zuschauer, den Zuschauer für das<br />
Buch und so weiter …“ – Man müsse sich also, so der Interviewte,<br />
die Welt wie ein großes Geflecht vorstellen, in dem<br />
die Interaktionen nicht mehr einseitig perzipiert werden<br />
dürfen, sondern man ‚gleichsam‘ eine Perspektive des ‚äußeren<br />
Innen‘ und ‚inneren Außen‘ einnehmen müsse, was ja<br />
bekanntlich auch Weißler in seinem neuesten Werk sehr<br />
schön mit Gedichten von Rilke illustriere, in welchen – vor<br />
allem im Stundenbuch – die Perichorese der Dinge gewürdigt<br />
würde. Der Moderator sagte: „Wir sollten hier vielleicht<br />
das Wort ‚Perichorese‘ als Durchdringung …“, aber der<br />
Interviewte unterbrach ihn: „Richtig, als Durchdringung<br />
begreifen. Das ist ein aus der russischen Orthodoxie entlehnter<br />
Begriff, genauer, aus der Dogmatik, durch welchen<br />
die wechselseitige Durchdringung der drei Hypostasen der<br />
Trinität bezeichnet wird.“ – Rilke nun habe dieses Gefühl<br />
der Durchdringung, das ja auch ‚gleichsam eminent‘ ein Gefühl<br />
des Weltzusammenhangs sei, in seiner Philosophie des<br />
‚Außen ist Innen und Innen ist Außen‘ gelebt und ‚kongenial‘<br />
in seinen Gedichten darzustellen gewusst; Weißler nun falle<br />
hier der Verdienst zu, das von Rilke und vielen anderen im<br />
Laufe der Geistesgeschichte ‚gleichsam‘ nur mystisch Empfundene<br />
in klare Kategorien überführt zu haben, wobei<br />
Weißler auch Konsequenzen fürs eigene Handeln und für<br />
den Diskurs ziehe; wobei sich Weißler auch dieses Begriffes<br />
zu Genüge bediene, um darzustellen, dass kein Diskurs nur<br />
an sich selber Genüge finde, sondern nur im Rahmen eines<br />
Netzwerkes ‚konfigurierter Interaktion‘ Sinn habe.<br />
Nachdem der Philosoph geendet hatte, fragte, seine Frage<br />
noch zögerlich, in stirnrunzelndem Nachdenken sich bilden<br />
17
lassend, der Moderator, inwieweit Weißlers Thesen dem<br />
Zeitgeist entsprächen, zumal der Gedanke des ‚Netzes‘<br />
in ‚unserer vernetzten Zeit‘ auf der Hand liege. Wieder<br />
räusperte sich der so Gefragte und setzte an: dass natürlich<br />
jede Philosophie einer zeitgeistigen Strömung ihre ‚Reverenz‘<br />
erweise, sie aber nichtsdestotrotz als ‚gleichsam‘<br />
eigen ständige Substanz, wenn man das so plakativ und ‚salopp‘<br />
sagen wolle, wahrgenommen werden müsse, da nur<br />
die konzentrierte, aus dem Zusammenhang gerissene Betrachtung,<br />
‚gleichsam‘ im Stile der ‚epoché‘ der Phänomenologen,<br />
einen Anhaltspunkt bieten könne für ein der Sache<br />
gemäßes Verstehen, wobei man natürlich, wenn man sich an<br />
die Sache aus diesem Blickwinkel herantaste, durchaus die<br />
Geschichte und den Diskurs mit ins Spiel nehmen dürfe, um<br />
nicht einer solipsistischen, ‚gleichsam‘ autistischen Betrachtungsweise<br />
zu verfallen …<br />
Sebastian erhob sich, schaltete das Radio ab und setzte das<br />
Schälen der Äpfel fort. Es war still im Haus. <strong>Die</strong> Katzen bewegten<br />
sich lautlos, der schwarze Hund schlief, der andere<br />
Hund war im Garten, Lydia befand sich bei ihrem Pferd im<br />
Stall und Helga war weggefahren, um Einkäufe zu erledigen.<br />
<strong>Die</strong> Ausführungen des langsam und gewählt sprechenden<br />
Philosophen – er sprach so, als ob er jedes einzelne Füllwort,<br />
deren er viele gebrauchte, zehnmal abwägen müsste –<br />
hatten in Sebastians Kopf eine sonderbare Leere erzeugt.<br />
Er betrachtete den Apfel, den er in der Hand hielt, und sah<br />
dann aus dem Fenster. Es war sehr warm für einen Septembertag,<br />
und es schien die Sonne. Sebastian war, als könne<br />
er sich, im Überschwang eines kitzelnden Augenblicks, in<br />
den im Garten im Erdreich wühlenden Hund hineindenken.<br />
Es wühlte und grub in ihm und schwere, trockene Erdklumpen<br />
warfen sich ihm ins Gesichts; er grub und grub,<br />
bis er auf etwas Hartes stieß, ein Stück Stein; dann trat<br />
er einen Schritt beiseite und grub an einer anderen Stelle<br />
18
weiter, so lange, bis er ausglitt und auf etwas Flüssiges stieß.<br />
Dann macht er kehrt und trottete durch den Garten, in dem<br />
schon seit Jahren verstreutes Plastikspielzeug lag, das eines<br />
der Nachbarskinder, als es sich mit seinen Eltern hier<br />
aufhielt, vergessen hatte. Über eine der Plastikgießkannen<br />
wucherte schon etwas Moosartiges und in zwei, drei Jahren<br />
würde die Erde diese Kanne vielleicht schon ganz verschluckt<br />
haben; so wie Bäume, die an Maschendrahtzäunen<br />
wachsen, diese überwuchern und den Zaun in sich aufnehmen;<br />
gerade so, als hätte der Baum einen Mund, der sich auf<br />
immer und ewig um den Zaun schließe, ihn nie mehr wieder<br />
loszulassen. Sebastian fühlte plötzlich einen seltsamen Ekel<br />
in sich aufsteigen und schüttelte sich. Ein Apfel fiel zu Boden.<br />
Der Hund, aus seinem Schlaf gerissen, erschrak, stieß<br />
an Sebastians Fuß.<br />
„Ach, lass liegen“, sagte Sebastian zu dem Hund. Der blickte<br />
ihn an, groß und erwartungsvoll. „Blödsinn“, sagte Sebastian<br />
und hob den Apfel auf, um ihn zur Abwasch zu tragen. Dort<br />
wusch er den Apfel und legte ihn ungeschält in die Schale.<br />
„So, steh auf“, sagte er zu dem Hund, der gehorchte, sich<br />
streckte und reckte und begann, Sebastian nachzutrotten.<br />
„Ich gehe jetzt in den Garten und du gehst da jetzt auch<br />
hin und pinkelst dann, ja?“ Der Hund blickte Sebastian an.<br />
„Du sollst Lulu machen gehen“, sagte er und lachte dabei.<br />
Plötzlich war ihm nach Lachen zumute. „Lulu geh machen,<br />
ja, gelt, Lulu!“, rief er dem Hund zu, der, sich immer ungestümer<br />
bewegend, es gar nicht mehr erwarten zu können<br />
schien, weiteren Anweisungen Sebastians Folge zu leisten.<br />
Der September verging, nachdem er so manchen sonnigen<br />
Tag ins Land gesandt hatte, windig und regnerisch.<br />
Von abweisender Widersinnigkeit wie das Wetter erschien<br />
Sebastian auch der Besuch der Universität, deren entweder<br />
überheizte, unterkühlte oder stickige Säle nur ein Gleichnis<br />
und Bildnis für jene innere Gestimmtheit abgaben, die<br />
19
ihn schon seit mehreren Jahren daran hinderten, Sinn und<br />
Zweck der ihm angedeihenden Ausbildung klar ins Auge zu<br />
fassen, ohne dass er dabei die Kraft und den Mut gefunden<br />
hätte, entweder den angestrebten Zweig der Ausbildung zu<br />
wechseln oder gar auf einen Besuch dieser ‚Anstalt‘, wie er<br />
sie nannte, zu verzichten. Der durch diese Unschlüssigkeit<br />
verursachte Zwist mit seiner eigenen Redlichkeit war ein<br />
weiterer Grund, ihm schon die schiere Anwesenheit in diesen<br />
Räumen zu verleiden. Schon vor zwei Jahren hatte sich<br />
Sebastian gesagt: ‚Ich muss etwas tun, ich muss etwas dagegen<br />
tun; ich muss etwas erleben. Das ist nicht das Leben. Das<br />
macht mich krank.‘ – Und doch hatte er nichts getan, hatte<br />
Jahr um Jahr in nicht gerade vorbildloser Anständigkeit seine<br />
wissenschaftliche Ausbildung durchlaufen, so wie Menschen<br />
eben, die ihrer Arbeit überdrüssig sind, diese durchführen,<br />
weil sie nicht anders können, weil sie es sich nicht<br />
‚leisten‘ können, auf diese Arbeit zu verzichten. ‚Ich kann<br />
es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht leisten‘, hatte auch<br />
Sebastian immer wieder für sich selber wiederholt; dann jedoch,<br />
wenn er sich fragte, worin dieses Leisten bestünde und<br />
worin auch der Verlust, würde er dem zwar nicht Gehassten,<br />
aber ihn in verschiedener Weise seelisch Drückenden den<br />
Rücken kehren, fand er darauf keine Antwort; und wenn er<br />
eine fand, so ließ ihn diese nur mit einem Entsetzen zurück,<br />
gerade so, als ob ein plötzlicher Ekel vor seiner eigenen Person<br />
Besitz ergreife von ihm; ein Ekel, gerade noch unscheinbar<br />
und klein genug, als dass dieser nicht die Kraft hatte,<br />
ihn entweder vor inneren Schmerz zu zerfressen oder eine<br />
Änderung in dem Drückenden herbeizuführen. Dass dieser<br />
Ekel mit so lascher Halbheit ihn fasste, schwärzte zusätzlich<br />
zu aller Missgestimmtheit Sebastians Gemüt. Gerne hätte er<br />
den großen Ekel empfunden, einen ‚gigantischen Hass‘, wie<br />
er einmal zu einem guten Freund gesagt hatte; denn ihm<br />
schien in solchen Moment des Halbhalben, dass erst der große<br />
20
und ganze Hass und der große und ganze Ekel befreien könnte;<br />
dass erst in dem Nichtgedachten, in dem Unüberlegten,<br />
in dem nicht von der Angst Zerfressenen sich der Ekel Bahn<br />
brechen könne, weil er so groß würde, so übermächtig groß,<br />
dass er, wie das Moos die Gießkanne, alle Angst überwuchere<br />
und in sich einsauge wie eine Schlange ihre Beute, mag sie<br />
noch so groß sein, mag sie auch so groß sein, dass die Schlange<br />
an dieser Beute innerlich zerplatze, und so groß auch, dass<br />
sie tatsächlich zerplatze: dass also ihre Haut reiße und alles<br />
Gedärm sich ihr entwinde, samt der Beute, samt allen<br />
Eingeweiden. Solch einen Hass und Ekel hätte sich Sebastian<br />
gerne herbeigewünscht; und ihm schien, dass einer der<br />
Gründe, weshalb er solcher Aufwallungen nicht fähig sei,<br />
in Lydia bestünde. Nicht in ihrer Lethargie und langsamen<br />
Verfasstheit, sondern darin, dass sie einfach da war: er hatte<br />
eine Freundin; und manchmal hasste er sich dafür; aber<br />
der Hass reichte nicht aus, um den einen großen Hass zu<br />
bilden und zu gestalten, der es vermocht hätte, eine Veränderung<br />
herbeizuführen. Das spürte und wusste Sebastian;<br />
und indem er es spürte, hasste er Lydia. Aber das war kein<br />
Hass, nur ein Hässchen, kein Ekel, sondern ein Ekelchen,<br />
etwas nicht Ganzes, etwas Halbes, etwas, im Grunde, Unwürdiges.<br />
Was war es dann? Indolenz? Feigheit? War es ein<br />
Sicheinrichten im Leben, in den Gewohnheiten; eine rein<br />
intellektuelle Einstellung, eine Verkostung der Dinge des<br />
Lebens, eines Lebens, das immer die anderen lebten, man<br />
selber aber niemals? Man verkostete da ein bisschen, dort ein<br />
bisschen, schließlich war man ja gebildet; man las hier ein<br />
bisschen, dort ein bisschen; informierte sich da ein bisschen<br />
über diese und jene gedankliche Strömung, las und studierte<br />
ein bisschen diese Theorie und jene Gedanken, aber leben …<br />
das sollen die anderen machen. Sebastian schien es trivial,<br />
sich solche Vorwürfe zu machen; und gerade darin, dass es<br />
ihm trivial erschien, glaubte er einen Hauch der Möglichkeit<br />
21
wahren Lebens in sich auszumachen; dann beherrschte ihn<br />
eine Vorfreude und Gewissheit. Fand er diese Gedanken jedoch<br />
nicht trivial, sondern spann er sie, gerade so, als ob es<br />
keine besseren gäbe, dann war ihm, als ob alles so wäre wie<br />
ein Septemberwetter: bald herbstlich, bald nachsommerlich,<br />
dann aber wieder grau und regnerisch; es schien ihm dann<br />
alles eintönig, farblos und dumm.<br />
An einem solchen Tag dummen Zwistes mit seinem eigenen<br />
Gemüt besuchte Sebastian die Vorlesung von Professor<br />
Wilmitsch, nachdem er erfahren hatte, dass dieser der Onkel<br />
des nun allerorten gelobten Geronimo Weißler war. Nachdem<br />
Wilmitsch, ein oft, viel und gern lächelnder Mann von<br />
kaum fünfzig Jahren, im Zuge eines Symposiums ein langes<br />
Gespräch mit Sebastian geführt hatte, versprach ihm dieser,<br />
regelmäßig seine Vorlesungen zu besuchen. Er tat es, weil<br />
er nicht wusste, was er sonst tun sollte; und er tat es, weil<br />
er sich verpflichtet glaubte, den Professor nicht zu enttäuschen.<br />
Man sprach oft miteinander; der Professor entpuppte<br />
sich als nicht nur leutselig, sondern gar als freundschaftlich,<br />
einladend und ‚einfach‘. Er lud Sebastian zu Vorträgen ein;<br />
man sah einander oft, stand manches Mal vor dem Kaffeeautomaten,<br />
scherzte und plauderte. Ein Jahr verging, bis<br />
Wilmitsch Sebastian den Vorschlag machte, dieser solle doch<br />
sein Assistent werden: „Sie sind ja so belesen, Herr Calan!<br />
So einen wie Sie, der den Schopenhauer auswendig kennt,<br />
brauche ich, wissen Sie. Worüber wollen Sie eigentlich Ihre<br />
Diplomarbeit schreiben? Wissen Sie das schon? …“ – und<br />
Wilmitsch ließ nicht ab, Sebastian zu bedrängen, freundlich<br />
lächelnd und ihm immer wieder einen oder mehrere Kaffees<br />
aus dem Automaten spendierend.<br />
22