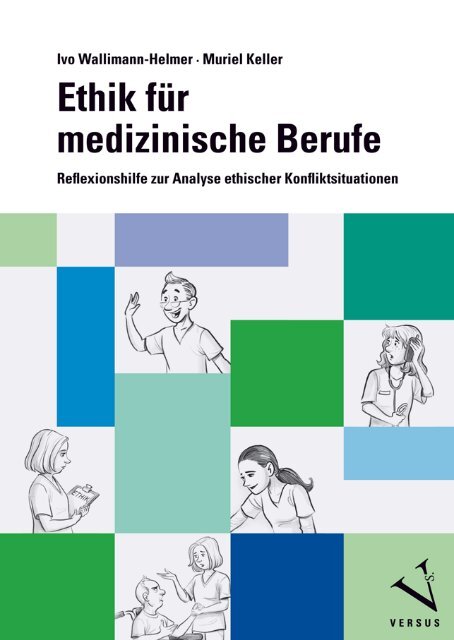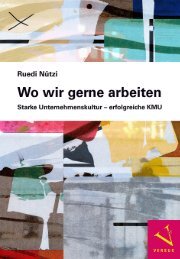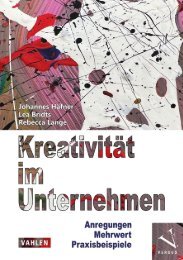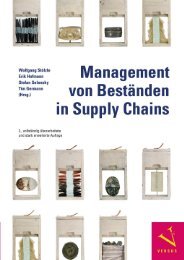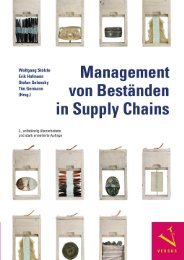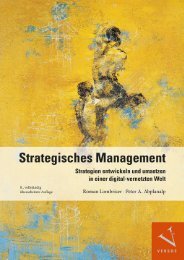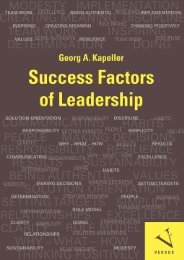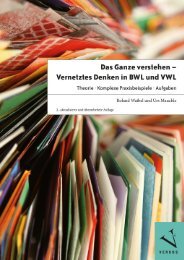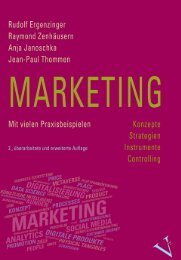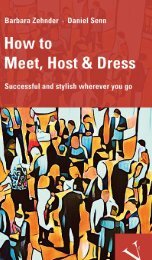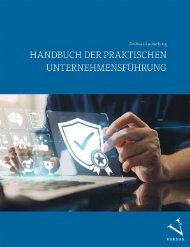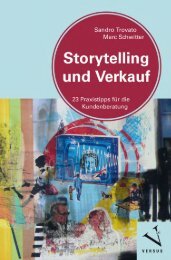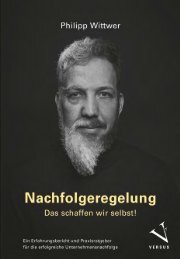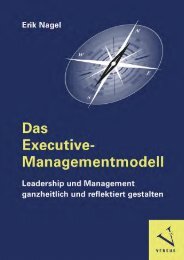Leseprobe: Wallimann/Keller: Ethik für medizinische Berufe
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in<br />
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />
Das Werk einschliesslich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.<br />
Dies gilt insbesondere <strong>für</strong> Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen<br />
Systemen.<br />
© 2018 Versus Verlag AG, Zürich<br />
Weitere Informationen zu Büchern aus dem Versus Verlag unter<br />
www.versus.ch<br />
Illustrationen: Miriam Fritz · Berlin<br />
Satz und Herstellung: Versus Verlag · Zürich<br />
Druck: CPI books<br />
ISBN 978-3-03909-276-5
7<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
Vorwort<br />
2009 erhielten drei Physiotherapeuten und ein <strong>Ethik</strong>er den Auftrag, die im<br />
Schweizerischen Medizinalberufegesetz geforderten ethischen Kompetenzen in<br />
Gesundheitsberufen im Bachelorstudiengang «Physiotherapie» an der Zürcher<br />
Hochschule <strong>für</strong> Angewandte Wissenschaften zu unterrichten. Dabei war uns stets<br />
wichtig, nicht nur ethische Theorie, sondern Kompetenzen <strong>für</strong> die Alltagspraxis<br />
zu vermitteln. Die in diesem Buch gewählte Darstellung von Theorie und Anwendung<br />
unseres Instruments orientiert sich eng an der Struktur und dem didaktischen<br />
Konzept unseres Unterrichts. Im Laufe der Jahre haben wir unseren gesamten<br />
Unterricht verschriftlicht. Die Idee da<strong>für</strong> entstand, weil während dessen<br />
erster Durchführung Mathieus Geburtstermin angekündigt war und wir nicht<br />
wussten, ob einer der Dozenten, Ivo <strong>Wallimann</strong>-Helmer allenfalls ausfallen<br />
würde. Dies wäre katastrophal gewesen, weil unser Unterrichtskonzept vorsieht,<br />
dass jeweils 120 Studierende in parallelen Gruppen begleitet werden.<br />
An dieser Stelle danken wir herzlich Yvonne Mussato und Fredy Bopp, die bei<br />
der Entwicklung und bei den ersten Anwendungen unseres Instruments in der<br />
Praxis tatkräftig mitgewirkt haben. Ebenso gilt unser Dank der Studiengangleiterin<br />
des Bachelorstudiengangs Physiotherapie, Cécile Ledergerber, die uns Unterrichtsentwicklung<br />
und Durchführung in diesem Team so wohlwollend ermöglicht<br />
hat. Darüber hinaus haben wir von einer Reihe weiterer Personen hilfreiche Hinweise<br />
und Rückmeldungen erhalten. Wir bedanken uns hier<strong>für</strong> ganz herzlich bei<br />
Christina Arn, Anna Chabin, Denise Dempfle, Sonja Helmer-<strong>Wallimann</strong>, Tanja<br />
Krones, Nadine Küenzi, Mathias Lindenau, Georg Marckmann, Settimio Monteverde,<br />
Regula Ott, Barbara Reiter, Vera Stucki, Selina Stutz, Patrik Vonlanthen
8 Vorwort<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
und Ursula <strong>Wallimann</strong>. Zu guter Letzt richtet sich unser Dank natürlich auch an<br />
die über 1000 Physiotherapie- und <strong>Ethik</strong>studierenden mit denen wir unser Instrument<br />
sowie Teile dieses Manuskripts erproben und weiterentwickeln durften.<br />
Auch Anne Buechi und Anja Lanz vom Versus Verlag danken wir herzlich <strong>für</strong> die<br />
Unterstützung bei der Realisierung des Buchprojektes.<br />
Ivo <strong>Wallimann</strong>-Helmer und Muriel <strong>Keller</strong><br />
Winterthur, im Herbst 2017
9<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
2 Kleine Einführung in die <strong>Ethik</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
2.1 Irritation und Störendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
2.2 Moral als Gegenstand der <strong>Ethik</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
2.3 Wertesysteme der Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
2.4 Bereiche der <strong>Ethik</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
2.5 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
3 Prinzipienethik nach Beauchamp und Childress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
3.1 Rekonstruktion der Moral – vier Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
3.2 Verfahren – Interpretation und Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
3.3 Ergänzungen zu Beauchamp und Childress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
3.4 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
4 Die Fallanalyse im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
4.1 Erste Phase: Fallbeschreibung und ethische Fragestellung . . . . . . . . 45<br />
4.2 Zweite Phase: Interpretation bzw. Spezifikation der Prinzipien . . . . 47<br />
4.3 Dritte Phase: Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
4.4 Vierte Phase: Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />
4.5 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10 Inhaltsverzeichnis<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
5 Erste Phase: Fallbeschreibung und ethische Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . 53<br />
5.1 Irritation und Fallerläuterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
5.2 Ethische Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />
5.3 Handlungsalternativen und intuitive Antwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
5.4 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />
6 Zweite Phase: Interpretation der Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
6.1 Respekt vor der Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />
6.1.1 Schwellenwertbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />
6.1.2 Informationsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
6.1.3 Konsensbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
6.1.4 Erläuterungen zum Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
6.2 Nicht-Schaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />
6.2.1 Arten von Schäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
6.2.2 Das Prinzip der Doppelwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
6.2.3 Verbotenes, Erlaubtes und Gebotenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
6.2.4 Erläuterungen zum Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />
6.3 Fürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
6.3.1 Perspektiven des Wohlergehens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />
6.3.2 Zumutbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
6.3.3 Paternalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
6.3.4 Erläuterungen zum Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />
6.4 Gerechtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />
6.4.1 Gleichbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />
6.4.2 Priorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />
6.4.3 Rationierung und Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
6.4.4 Erläuterungen zum Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />
6.5 Übertragung der Interpretationen ins Hauptraster . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />
6.6 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />
7 Dritte Phase: Gewichtung der Prinzipien und Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />
7.1 Mögliche Ergebnisse der Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />
7.2 Vorgehen bei der Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105<br />
7.3 Rechtfertigung der Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />
7.4 Übertragung der Gewichtung ins Hauptraster . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />
7.5 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />
8 Vierte Phase: Umsetzung und andere Analyseinstrumente . . . . . . . . . . . . . . 113<br />
8.1 Chancen unseres Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />
8.2 Grenzen unseres Instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />
8.3 Andere Analyseinstrumente und Entscheidungshilfen . . . . . . . . . . 118<br />
8.4 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Inhaltsverzeichnis 11<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
9 Kleines Einmaleins der <strong>Ethik</strong>theorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />
9.1 Utilitarismus/Konsequentialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />
9.2 Deontologie/Kantianismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />
9.3 Vertragstheorie/Kontraktualismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
9.4 Tugendethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />
9.5 Ergänzende Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130<br />
10 Fallbeispiele und Lösungsvorschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133<br />
10.1 Marie (Ärztinnen und Ärzte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />
10.2 Laura (Ergotherapeutinnen und -therapeuten) . . . . . . . . . . . . . . . . . 140<br />
10.3 Salome (Hebammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144<br />
10.4 Martin (Pflegepersonal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148<br />
10.5 Stefan (Physiotherapeutinnen und -therapeuten) . . . . . . . . . . . . . . . 151<br />
10.6 Interdisziplinärer Fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
10.7 Weitere Fallsammlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159<br />
Analyseraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169<br />
Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Sollte Marie ihre Entscheidung beibehalten oder rückgängig machen?<br />
Abschnitt 10.1 «Marie (Ärztinnen und Ärzte)»
13<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
1<br />
Einleitung<br />
In Gesundheitsberufen ist <strong>Ethik</strong> allgegenwärtig. Das Bewusstsein hier<strong>für</strong> hat<br />
schon länger aber sicherlich in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies<br />
zeigt sich nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch daran, dass in vielen grösseren<br />
Gesundheitsinstitutionen <strong>Ethik</strong>komitees geschaffen worden sind. Zudem<br />
wird der <strong>Ethik</strong> in der Ausbildung zu Gesundheitsberufen zunehmend mehr Gewicht<br />
eingeräumt. Entsprechend ist in den letzten Jahren die Zahl der Publikationen<br />
zu diesem Thema deutlich gestiegen und man kann sich mit Fug und Recht<br />
fragen, weshalb nun noch ein weiteres Buch zur <strong>Ethik</strong> in Gesundheitsberufen auf<br />
den Markt kommt.<br />
In diesem Buch nehmen wir eine Schwierigkeit sehr ernst, die in der <strong>Ethik</strong><br />
häufig vergessen geht: <strong>Ethik</strong>theorien <strong>für</strong> den Bereich der Medizin anzuwenden,<br />
ist nicht so einfach, wie es aus der Perspektive der Theorie häufig erscheint. Der<br />
Grund hier<strong>für</strong> liegt einerseits darin, dass es in der <strong>Ethik</strong> keine Standardmeinung<br />
gibt, andererseits ist die Übersetzung von ethischen Theorien in die <strong>medizinische</strong><br />
Berufspraxis häufig vernachlässigt worden. Im Folgenden führen wir ein Instrument<br />
zur Analyse von <strong>medizinische</strong>n Einzelfällen ein, das zwar theoriebasiert,<br />
aber stark anwendungsbezogen aufgebaut ist. Zusammen mit der <strong>für</strong> die Anwendung<br />
des Instruments nötigen Hintergrundtheorie bietet es eine Reflexionshilfe<br />
<strong>für</strong> den <strong>medizinische</strong>n Berufsalltag.<br />
Wir wollen keine alles umfassende Einführung in die <strong>Ethik</strong> bieten. Vielmehr<br />
orientieren wir uns stark an der von Beauchamp und Childress – die beiden einflussreichsten<br />
Medizinethiker der letzten Jahrzehnte – entwickelten Methodik zur<br />
Analyse von <strong>medizinische</strong>n Einzelfällen. Im Rahmen unseres Unterrichts im<br />
Bachelorstudiengang «Physiotherapie» an der Zürcher Hochschule <strong>für</strong> Ange-
14 1 Einleitung<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
wandte Wissenschaften (ZHAW) hat sich gezeigt, dass mit dieser Methodik nicht<br />
nur ein Zugang zur <strong>Ethik</strong> auf theoretischer Ebene möglich ist, sondern auch eine<br />
ernsthafte Auseinandersetzung mit ethischen Herausforderungen in der Berufspraxis<br />
stattfindet. Wir sind überzeugt, dass mit unserem Instrument eine praxisbezogene<br />
Einführung in die <strong>Ethik</strong> möglich ist. Gleichzeitig zeigt unsere langjährige<br />
Erfahrung, dass unser Instrument eine praxistaugliche Reflexionshilfe <strong>für</strong><br />
ethische Herausforderungen im <strong>medizinische</strong>n Berufsalltag darstellt.<br />
Da dieses Buch als praxisbezogenes Handbuch konzipiert ist, haben wir bewusst<br />
auf kleinteilige Quellenangaben und Zitate verzichtet. Gleichzeitig basiert<br />
dieses Buch in seiner Entstehung viel stärker auf unserer praktischen Unterrichtserfahrung<br />
denn auf ausführlichem Literaturstudium. Aus diesen beiden Gründen<br />
beschränken sich unsere vielleicht etwas spärlich erscheinenden Literaturangaben<br />
zum einen auf unsere zentralen Inspirationsquellen und zum anderen ausschliesslich<br />
auf deutschsprachige, weiterführende Literatur.<br />
Unsere Erläuterungen gliedern sich in drei Teile, die sich an der Struktur unseres<br />
Unterrichts und unserem Instrument zur medizinethischen Fallanalyse orientieren.<br />
Wir haben versucht, die einzelnen Kapitel so zu gliedern, dass sie nicht nur<br />
<strong>für</strong> die Einzellektüre, sondern auch <strong>für</strong> die Diskussion in Gruppen genutzt werden<br />
können. Zur Förderung des Verständnisses und <strong>für</strong> die Diskussion finden sich deshalb<br />
am Ende jedes Abschnitts Kontrollfragen und Arbeitsaufträge. Gleichzeitig<br />
wird jedes Kapitel mit Kurzzusammenfassungen der einzelnen Abschnitte eingeführt.<br />
Diese dienen nicht nur dem Leseüberblick, sondern sollen auch die Repetition<br />
bzw. das Nachschlagen der Kapitelinhalte erleichtern.<br />
Im ersten Teil, werden die Grundlagen <strong>für</strong> die Fallanalyse gelegt (Kapitel 2<br />
und 3). Das Kapitel 2 bietet eine kurze Einführung in die <strong>Ethik</strong> und zeigt, wie<br />
man ethische Herausforderungen erkennen kann. Danach wird in Kapitel 3 kurz<br />
in die Theorie von Beauchamp und Childress eingeführt, da diese die zentrale<br />
Grundlage unseres Instruments bildet. Die Bearbeitung von Kapitel 2 ist <strong>für</strong> diejenigen<br />
wichtig, die bis anhin noch über keine Kenntnis der <strong>Ethik</strong> verfügen. Das<br />
Kapitel 3 ist in erster Linie dann relevant, wenn man sich <strong>für</strong> die Unterschiede<br />
und Gemeinsamkeiten zwischen unserem Instrument und der Theorie von Beauchamp<br />
und Childress interessiert. Wer bereits über gewisse Grundkenntnisse in<br />
der <strong>Ethik</strong> verfügt, kann mit der Lektüre ohne Weiteres im zweiten Teil beginnen.<br />
Der zweite Teil dieses Buches bietet eine umfangreiche Einführung in die<br />
Funktionsweise unseres Instruments (Kapitel 4 bis 8). Dieser Teil ist der Kern<br />
unserer Darstellung. Im Kapitel 6 findet sich eine detaillierte Erläuterung der vier<br />
nach Beauchamp und Childress grundlegenden medizinethischen Prinzipien:<br />
Respekt vor der Autonomie, Nicht-Schaden, Fürsorge und Gerechtigkeit. In Kapitel<br />
7 werden Vorschläge <strong>für</strong> die Festlegung der Gewichtung der vier Prinzipien<br />
gemacht. Insbesondere wird in diesem Kapitel gezeigt, welche Rolle die vier klassischen<br />
normativen Theorien des Utilitarismus, der Deontologie, der Vertragstheorie<br />
und der Tugendethik unserer Meinung nach in der medizinethischen Fall-
1 Einleitung 15<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
analyse spielen können. Im Kapitel 8 wird auf verschiedene alternative Analyse-<br />
Modelle <strong>für</strong> den <strong>medizinische</strong>n Berufsalltag eingegangen, um die Rolle aufzuzeigen,<br />
die unser Analyseinstrument bei der Umsetzung ethischer Überzeugungen<br />
und bei interdisziplinären Fallbesprechungen spielen kann.<br />
Ergänzend zu den Erläuterungen zu unserem Instrument und dessen Anwendung<br />
findet sich im dritten Teil dieses Buches im Kapitel 9 ein kleines Einmaleins<br />
der klassischen vier <strong>Ethik</strong>theorien. Damit bieten wir eine knappe Einführung in<br />
die vier klassischen Theorien der normativen <strong>Ethik</strong>, die in unserem Instrument<br />
zunächst keine Rolle spielen. Diese Theorien sind in der <strong>Ethik</strong> von zentraler Bedeutung<br />
und können <strong>für</strong> die Anwendung unseres Instruments hilfreich sein.<br />
Als Material <strong>für</strong> die Einübung der ethischen Kompetenzen stellt das Kapitel 10<br />
Fallbeispiele <strong>für</strong> verschiedene Berufsgruppen des Gesundheitswesens zur Verfügung.<br />
Diese Fallbeispiele können bei der Bearbeitung der Erläuterungen zu<br />
unserem Instrument zu Übungszwecken eingesetzt werden (Kapitel 5 bis 8). In<br />
den Aufträgen und Kontrollfragen zu diesen Erläuterungen findet sich immer eine<br />
Frage oder ein Auftrag zu einem eigenen oder einem von uns vorgeschlagenen<br />
Fallbeispiel. Für jedes Fallbeispiel findet sich in Kapitel 10 ein Lösungsvorschlag.<br />
Das Fallanalyseraster (unser Instrument) sowie weitere Analyseraster zur Interpretation<br />
der vier Prinzipien von Beauchamp und Childress werden im laufenden<br />
Text gezeigt und finden sich ab Seite 161. Darüber hinaus können diese Raster<br />
unter www.versus.ch/medizinethik zum Ausdrucken heruntergeladen werden.<br />
Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre und Bearbeitung und hoffen,<br />
dass unser Instrument hält, was wir im Rahmen unseres Unterrichts immer wieder<br />
erfahren haben. Es soll eine praxistaugliche ethische Reflexionshilfe im <strong>medizinische</strong>n<br />
Berufsalltag sein.
173<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
Stichwortverzeichnis<br />
Einträge mit kursiven Seitenzahlen verweisen auf<br />
Kapitel 10 «Fallbeispiele und Lösungsvorschläge».<br />
A<br />
Abwesenheit von Zwang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
Alltagsmoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94<br />
Analyseinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . 31, 118–119<br />
Chancen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />
Grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />
prozessorientierte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />
vier Phasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43–44<br />
Angaben zur Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
angewandte <strong>Ethik</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 28<br />
Antwort, intuitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 60<br />
Aphasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
Argumentarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />
Arten von Schäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 80<br />
Ärztinnen und Ärzte . . . . . . . . . . . . . 136–139, 154<br />
Aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–150, 154<br />
Atemtherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156<br />
Autonomie, Respekt vor . . . . . 31, 35, 65, 86, 141,<br />
145, 152<br />
Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
Autorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
B<br />
Beauchamp und Childress . . . . . . . . . . . 13, 31–32<br />
vier Prinzipien . . . 14, 31–38, 44, 47, 105–107<br />
Gewichtung . . . . . . . . . . . . 49–50, 101–103<br />
Interpretation . . 37, 47–48, 63–64, 150, 157<br />
Behandlungsempfehlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
Behandlungsrhythmus . . . . . . . . . . . . . . . 141–143<br />
Behandlungsstandards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156<br />
Bereichsethiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
Bereitschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
Berufsethos . . . . . . . . . . 25, 34, 137, 141, 149, 156<br />
Berufsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . 155, 157–158<br />
«best interest» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />
Bettenzuteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136–139<br />
Bottom-up-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 39, 46<br />
C<br />
Care Ethics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 36, 129
174 Stichwortverzeichnis<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
D<br />
Delir-Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158<br />
Demenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–149<br />
Deontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 125–126<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />
Dilemma, ethisches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />
Doppelwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–77, 80<br />
Dringlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 150<br />
Durchschnittsnutzenutilitarismus . . . . . . . . . . . 124<br />
E<br />
Einverständnis, informiertes . . . . . . 65–66, 70–72<br />
Enthaltsamkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
Entscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />
selbstbestimmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65–67<br />
Entscheidungshilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119<br />
Erfolgsaussicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />
Ergotherapeutinnen und -therapeuten 140–143, 154<br />
Erlaubtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
Erstmobilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151<br />
<strong>Ethik</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
angewandte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 28<br />
Bereichs- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
Gegenstand der . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 23, 26<br />
Medizin- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–29<br />
Meta- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27<br />
normative . . . . . . . . . . . 14–15, 26–27, 34, 121<br />
Prinzipien- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 37, 121<br />
Tugend- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 128–129<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129<br />
ethische Fallanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
vier Phasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 47<br />
ethische Frage . . . . . . . . . . . . . 45–46, 57–58, 155<br />
ethisches Dilemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />
F<br />
Fachgespräch, interdisziplinäres . . . . . . . . . . 57–58<br />
Fallanalyse, ethische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
vier Phasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 47<br />
Fallbeispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133<br />
interdisziplinäres . . . . . . . . . . . . . . . . . 154–159<br />
Fallbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . 39, 45–46, 135<br />
«First come – first served» . . . . . . . . . . . . . 95, 138<br />
Frage<br />
ethische . . . . . . . . . . . . . . . 45–46, 57–58, 155<br />
-stellung . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 45–46, 57–58<br />
Warum- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
Fürsorge . 31, 35, 73, 81–82, 86, 145, 149, 152, 156<br />
Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />
G<br />
Gebotenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />
Geburt . . . . . . . . . . . . . . . 144, 146–147, 154, 156<br />
Gerechtigkeit . 31, 35, 90, 137–138, 141, 145, 149<br />
formale Bedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />
Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />
materiale Bedingungen . . . . . . . . . . . . . . 92–93<br />
Gesamtbeurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />
Gesetzesformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />
Gesprächsgrundlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />
Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 49–51<br />
Festlegen der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />
Kategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />
nach einem Grundsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />
nach mehreren Grundsätzen . . . . . . . . . . . . . 110<br />
Rechtfertigung der . . . . . . . . . 39, 102, 109, 111<br />
Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105–108<br />
Gleichbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 97<br />
Gleichheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />
Glücksutilitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />
Grund <strong>für</strong> die Irritation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />
H<br />
Haltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48–49<br />
Handlungsalternativen . . . . . . . . . . . . . . . 47, 51, 59<br />
Hebammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144–147, 154<br />
I<br />
Informationsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . 68, 72<br />
informiertes Einverständnis . . . . . . . 65–66, 70–72<br />
Infusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
interdisziplinärer Fall . . . . . . . . . . . . . . . . 154–159<br />
interdisziplinäres Fachgespräch . . . . . . . . . . 57–58<br />
interdisziplinäres Team . . . . . . . . . . 154, 156–157<br />
Interpretation der Prinzipien . . 37, 47–48, 63–64,<br />
150, 157<br />
Intuitionismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 43<br />
intuitive Antwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 60<br />
Irritation . . . . . . . . . . . . . . . 19–20, 39, 54–55, 155<br />
Grund <strong>für</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />
K<br />
Kaiserschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144–147, 154<br />
Kantianismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 125<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />
Kaufkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />
klinischer Pragmatismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />
kognitive Fähigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Stichwortverzeichnis 175<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
Kognitivismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
Komplikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 153, 157<br />
Kompromiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158<br />
Konsensbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 72<br />
Konsequentialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 123<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />
Kontraktualismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 126<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />
körperliche Schäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
Kostengutsprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140–142<br />
Kosten-Nutzen-Analyse . . . . . . . . . . . . 93, 96, 138<br />
L<br />
Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140–143<br />
Lösungsvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br />
Lungenkrebs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151<br />
M<br />
Magensonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154, 157<br />
Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136–139<br />
Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–150<br />
medikamentöse Ruhigstellung . . . . . 154, 156–159<br />
Medikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
Medizinethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–29<br />
Metaethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27<br />
Missachtung von Wertesystemen . . . . . . . . . . . . 75<br />
Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23, 26<br />
Alltags- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
-vorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23<br />
Wertesysteme der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
moralische Gleichgültigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Moralismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
N<br />
nachträgliche Rechtfertigung . . . . . . . . . . . . . . 109<br />
Nicht-Schaden . . 31, 35, 73, 81, 137, 145, 152, 156<br />
Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />
Non-Kognitivismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
normative <strong>Ethik</strong> . . . . . . . . . 14–15, 26–27, 34, 121<br />
Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23<br />
Notsituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
P<br />
Paternalismus . . . . . . . . . . . . . . . . 86–88, 153, 158<br />
Patientenverfügung . . . . . . . . . . . 68, 102, 136, 139<br />
Patientenwohl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />
Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48–49<br />
des Wohlergehens . . . . . . . 82–85, 88, 142, 150<br />
Pflegegrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149<br />
Pflegeinstitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148<br />
Pflegepersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–150, 154<br />
Pflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 28<br />
negative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />
positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />
Physiotherapeutinnen und -therapeuten . . 151–154<br />
Pneumonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
Präferenzutilitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />
Pragmatismus, klinischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118<br />
Prinzipien, vier . . . . . . 14, 31–38, 44, 47, 105–107<br />
Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . . 49–50, 101–103<br />
Interpretation . . . . 37, 47–48, 63–64, 150, 157<br />
Prinzipienethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 37, 121<br />
Priorisierung . . . . . . 93–94, 97, 138, 143, 150, 159<br />
in Notsituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
Prozessorientierte Analyseinstrumente . . . . . . . 118<br />
R<br />
Rationierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />
Rationierungsstandard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
REA-Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />
Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Rechtfertigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 26, 110<br />
der Gewichtung . . . . . . . . . . . 39, 102, 109, 111<br />
nachträgliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />
Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151–152<br />
Respekt vor der Autonomie . . . 31, 35, 65, 86, 141,<br />
145, 152<br />
Hilfsraster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />
Ressourcenknappheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 95<br />
Ruhigstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154, 156–159<br />
S<br />
Salome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144–147<br />
Schäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
Arten von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 80<br />
körperliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />
unbeabsichtigte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
Schädigung des Selbstwertgefühls . . . . 74, 141, 153<br />
Schicksal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152<br />
Schlaganfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
Schluckstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />
Schlucktherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157<br />
Schwangerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 146, 154<br />
Schwellenwertbedingungen . . . . . . . . . . 66–67, 71
176 Stichwortverzeichnis<br />
.............................................................................................................................................................................<br />
selbstbestimmte Entscheidung . . . . . . . . . . . 65–67<br />
Selbstwertgefühl, Schädigung des . . . 74, 141, 153<br />
Situation, Angaben zur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
Sollens-Aussage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21–22, 58<br />
sozialer Nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />
Spenderorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />
Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151–153<br />
Stellvertreterentscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />
Störendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–20<br />
Sturzgefahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148, 150<br />
T<br />
Team, interdisziplinäres . . . . . . . . . . 154, 156–157<br />
Teamkonflikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156<br />
Tetraparese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140<br />
Therapieabbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153<br />
Therapiereduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 142<br />
Therapieverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152<br />
Top-down-Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 38, 40<br />
Triage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 138<br />
-massnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />
Tugendethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 128–129<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129<br />
W<br />
Warteliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 95<br />
Warum-Frage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
Wertesysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 152<br />
der Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
Missachtung von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
Wertvorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23<br />
Wohlergehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 84, 86<br />
Perspektiven des . . . . . . . . 82–85, 88, 142, 150<br />
Würdeformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
Z<br />
Zeitaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />
Zeitmangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–149<br />
Zumutbarkeit . . . . . . . . . . . . . 83–84, 88, 146–147<br />
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 111<br />
Zuständigkeitsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–85<br />
Zuteilung der Betten . . . . . . . . . . . . . . . . 136–139<br />
Zwang, Abwesenheit von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />
Zweckformel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />
U<br />
Überlegungsgleichgewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
Unfallversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 142<br />
Utilitarismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 123–124<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />
V<br />
Verbotenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />
Verständnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
Vertragstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 126–127<br />
Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />
Vertretbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />
vier Prinzipien . . . . . . 14, 31–38, 44, 47, 105–107<br />
Gewichtung . . . . . . . . . . . . . . 49–50, 101–103<br />
Interpretation . . . . 37, 47–48, 63–64, 150, 157