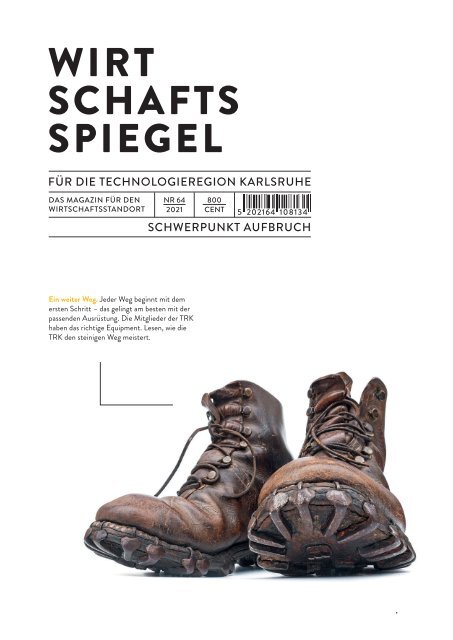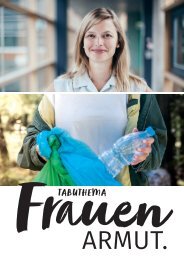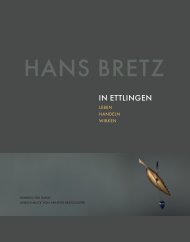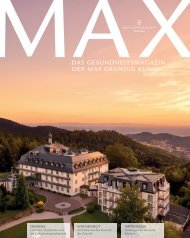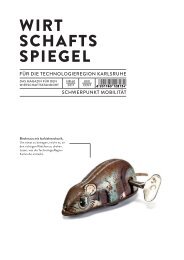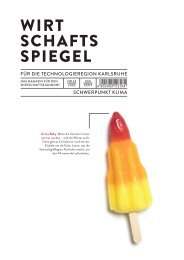Wirtschaftsspiegel 2021: Aufbruch
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt - das gelingt am besten mit der passenden Ausrüstung. Die Mitglieder der TechnologieRegion Karlsruhe haben das richtige Equipment und viele tolle Ideen. Lesen, wie die TRK den steinigen Weg aus der Corona-Krise meistert.
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt - das gelingt am besten mit der passenden Ausrüstung. Die Mitglieder der TechnologieRegion Karlsruhe haben das richtige Equipment und viele tolle Ideen. Lesen, wie die TRK den steinigen Weg aus der Corona-Krise meistert.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
WIRT<br />
SCHAFTS<br />
SPIEGEL<br />
FÜR DIE TECHNOLOGIEREGION KARLSRUHE<br />
DAS MAGAZIN FÜR DEN<br />
WIRTSCHAFTSSTANDORT<br />
NR 64<br />
<strong>2021</strong><br />
800<br />
CENT<br />
5 <strong>2021</strong> 64 108134<br />
SCHWERPUNKT AUFBRUCH<br />
Ein weiter Weg. Jeder Weg beginnt mit dem<br />
ersten Schritt – das gelingt am besten mit der<br />
passenden Ausrüstung. Die Mitglieder der TRK<br />
haben das richtige Equipment. Lesen, wie die<br />
TRK den steinigen Weg meistert.<br />
1
Stadt Karlsruhe<br />
Wirtschafts för de rung<br />
AUFBRUCH<br />
EDITORIAL<br />
LIEBE LESERINNEN,<br />
LIEBE LESER,<br />
das Titelbild des diesjährigen <strong>Wirtschaftsspiegel</strong> symbolisiert:<br />
ein steiniger und steiler Weg durch die Coronapandemie<br />
liegt schon hinter uns. Wir kennen das Ziel, doch der Weg<br />
dahin ist nicht ausgeschildert, immer wieder kommen unerwartete<br />
Abzweigungen und sogar Grenzschließungen haben<br />
wir in der Region erleben müssen.<br />
Foto ARTIS – Uli Deck<br />
Allerdings kann ein Virus uns nicht aufhalten, gemeinsam –<br />
Wirtschaft, Wissenschaft und öffentliche Hand – arbeiten<br />
wir weiter über Rhein und Lauter hinweg an der Zukunft und<br />
der Transformation unserer TechnologieRegion Karlsruhe und<br />
greifen dabei auf die Erfahrungen der letzten Monate zurück.<br />
Wie so viele haben wir auf „digital“ umgestellt. Mit den<br />
Online-Veranstaltungen des Welcome Centers oder den<br />
Weiterbildungen der UITP-Academy konnten wir weltweit<br />
neue und größere Zielgruppen erreichen. Umfangreiche und<br />
komplexe Projekte werden zwischenzeitlich nahezu ausschließlich<br />
digital vorangetrieben. Online-Workshops, wie wir<br />
sie z.B. für die Weiterentwicklung unserer Energiestrategie<br />
eingesetzt haben, gehören heute wie selbstverständlich zu<br />
den Standardwerkzeugen unserer täglichen Arbeit.<br />
Strahlen Sie mit uns! Am Innovationsstandort Karlsruhe!<br />
Als Partner der Wirtschaft arbeiten wir Hand in Hand mit Unternehmen, Investoren und Institutionen. Mit<br />
unseren umfassenden Serviceleistungen unterstützen wir Sie in Ihrer räumlichen Entwicklung sowie in Ihrer<br />
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit. Von der Gründungsberatung über Immobilien- und Ansiedlungsservice<br />
bis hin zur Internationalisierung Ihres Business: Verlassen Sie sich auf einen starken Partner, wertvolle<br />
Kontakte und etablierte Netzwerke. Sprechen Sie uns an!<br />
www.karlsruhe.de/wirtschaft<br />
Immer up to date mit dem Newsletter der Wirtschaftsförderung<br />
karlsruhe.de/wirtschaft_news<br />
© Stadt Karlsruhe | Layout: buntebüffel GmbH | Bild: iStock/atakan<br />
Viele von uns haben aber auch die Zeit genutzt, um unsere<br />
Region im „echten und analogen“ Leben zu erwandern,<br />
die Schönheiten zwischen Bühl bis Bruchsal, von Saverne<br />
über Landau bis zum Nordschwarzwald zu erkunden und zu<br />
erleben. Ich selbst finde Ruhe und Entspannung beispielsweise<br />
im nahen Waghäusel, wo ich an den dortigen Seen eine<br />
einmalige ornithologische Tierwelt bewundere.<br />
Lassen Sie uns mutig für das „neue Normale“ jetzt die Wanderschuhe<br />
schnüren, lassen Sie uns gemeinsam aufbrechen.<br />
Auf den kommenden Seiten finden Sie erfolgreiche Beispiele<br />
für dieses Umdenken, Ideen und Innovation für die neue<br />
Normalität, die die Arbeitsplätze von morgen schaffen und<br />
unseren Wohlstand sichern helfen. Werfen Sie einen Blick in<br />
die Zukunft unserer Region mit der mittlerweile 64. Ausgabe<br />
des <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>s.<br />
Bleiben Sie gesund – positiv im Kopf und negativ auf dem<br />
COVID-Teststreifen – das wünscht Ihnen<br />
Ihr Jochen Ehlgötz<br />
Geschäftsführer der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH<br />
Stadt Karlsruhe Wirtschafts för de rung<br />
Zährin ger straße 65 | 76133 Karlsruhe<br />
Tel.: +49 721 133-7300 | Fax: +49 721 133-7309<br />
wifoe@karlsruhe.de 2 NR 64 <strong>2021</strong> | www.karlsruhe.de/wirtschaft<br />
WIRTSCHAFTSSPIEGEL 1
INHALTSVERZEICHNIS<br />
INHALTS<br />
VER<br />
ZEICHNIS<br />
WIRTSCHAFTSSPIEGEL <strong>2021</strong> NR. 64<br />
DIE PANDEMIE HÄLT DIE WELT UND DIE<br />
TRK IN ATEM. WIE GEHEN DIE MENSCHEN<br />
UND UNTERNEHMEN MIT KRISEN UM, WAS<br />
MUSS SICH VERÄNDERN, WAS HAT SICH<br />
SCHON VERÄNDERT?<br />
MUTIGE MEINUNG<br />
WAS DIE KÖPFE DER TECHNOLOGIEREGION KARLSRUHE BEWEGT.<br />
NATALIE LUMPP 42 HANS BRETZ 43 ENNO-ILKA UHDE 54 FANCESCA ESPOSITO 55<br />
OBERBÜRGERMEISTERIN CORNELIA PETZOLD-SCHICK 68 OBERBÜRGERMEISTERIN MARGRET MERGEN 69<br />
PROF. ECKART KÖHNE 80 MARTIN WACKER 81<br />
01 AUFBRUCH<br />
TRAUEN WIR UNS, WAGEN WIR DEN SCHRITT INS UNGEWISSE: AUFBRUCH<br />
BRAUCHT MUT, LEIDENSCHAFT, NEUGIER. DAS FINDET SICH IN DER TRK.<br />
WO MAN HINBLICKT, SIND DIE MENSCHEN BEREIT FÜR EINE NEUE NORMALITÄT.<br />
DR. FRANK MENTRUP IM INTERVIEW 4 INTERVIEW MIT JOCHEN EHLGÖTZ 10 WOHIN DIE FÜSSE TRAGEN –<br />
ILLUSTRATION 12 100 JAHRE VOLKSWOHNUNG 14 MASKENHERSTELLER MEDPE IN KARLSRUHE 20<br />
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG: KARLSRUHE BAUT SEINE STÄRKEN WEITER AUS 22 MESSE KARLSRUHE: WIE<br />
DIGITAL KÖNNEN MESSEN WERDEN? 26 WAS MACHT CORONA MIT DEN IMMOBILIENPREISEN? 28<br />
MIT DEM „KARLSRUHER WERKZEUGKOFFER“ ZUM RE-START BEI EVENTS 30 BAD HERRENALB IM BLICK 32<br />
VOLLACK: DIE KRISE ALS CHANCE IN EINE NEUE ARBEITSWELT 34 AL’S KOLUMNE 36<br />
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN IN DER TRK 38<br />
2 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
DIGITALISIERUNG 02<br />
TOTAL DIGITAL: GLASFASERAUSBAU IN DER REGION,<br />
KAFFEE BESTELLEN PER APP, ROSIGE ZEITEN IM ONLINE-BANKING.<br />
BÜHL GRÜNDET DIGITALES INNOVATIONSZENTRUM 44<br />
DIE WELT NACH CORONA: NEUE ERFAHRUNGEN<br />
ODER BUSINESS AS USUSAL IN BADEN-BADEN? 46 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG: KI MADE IN KA 48<br />
ZAHNTECHNIK IM WANDEL: DIGITALES ARBEITEN IM HANDWERK 50<br />
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG:<br />
TECHNOLOGIETRANSFER MIT GENUSSFAKTOR 52 CORONA LÄSST ONLINE-BANKING WACHSEN 56<br />
ENERGIE 03<br />
WENN GANZE QUARTIERE IN DER CITY DIE ENERGIEWENDE ANPACKEN UND AUS<br />
DEM GRUNDWASSER SELTENE METALLE GEFÖRDERT WERDEN.<br />
HOEPFNER BRÄU BAUT INTELLIGENTES QUARTIER 60 E-MOBILITÄT WIRD NACHHALTIGER 62<br />
EVOHAUS: STROM CLEVER STEUERN MIT ENOCOO 64 MIT TELEMAXX GEMEINSAM FÜR GLASFASER 94<br />
MOBILITÄT 04<br />
ÖPNV IST, WENN PAKETE BAHN FAHREN. FINDET MAN NUR IN DER TRK.<br />
INIT: #INITTOGETHER ODER NEUE TECHNOLOGIEN IM ÖPNV 70<br />
INSTITUT FÜR NACHHALTIGE MOBILITÄT IN<br />
KARLSRUHE ERÖFFNET 72 BRUCHSAL: INNOVATIONSSTANDORT MIT HOHER LEBENSQUALITÄT 76<br />
REGIOKARGO: GÜTERTRANSPORT PER STADTBAHN 78<br />
REGION 05<br />
EIN SCHUSTER, DER BEI SEINEN LEISTEN BLEIBT,<br />
100-JÄHRIGE FIRMENJUBILÄEN UND INVESTITIONEN, DIE SICH LOHNEN.<br />
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG: AKTIVE FLÄCHENPOLITIK STÄRKT DEN WIRTSCHAFTSSTANDORT 84<br />
DIE NEUE<br />
FRAU AN DER AOK-SPITZE: PETRA SPITZMÜLLER 86 HWK: DIE BESTE ZEIT FÜR INVESTITIONEN IST JETZT 88<br />
SPARKASSE KARLSRUHE IM DEUTSCHLANDWEITEN BANKENTEST GANZ VORNE 90<br />
MENSTRADITION: FIRMA EHLGÖTZ ZWISCHEN HISTORIE UND ZUKUNFT 92<br />
100 JAHRE UNTERNEH-<br />
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG:<br />
KARLSRUHE PROFILIERT SICH ALS WISSENSCHAFTSSTADT 96 EINZIGARTIGE SCHUH-KUNSTWERKE 98<br />
HIER VERWURZELT: PRODUKTE AUS DER REGION 102<br />
EDITORIAL 1 START-UPS 66 UNTERNEHMENSPROFILE 104 IMPRESSUM 105<br />
DIE TECHNOLOGIEREGION IM ÜBERBLICK 106<br />
RUBRIKEN 06<br />
3
AUFBRUCH<br />
MIT WEGWEISENDEN<br />
IDEEN RICHTUNG<br />
ZUKUNFT<br />
2020 war kein einfaches Jahr, <strong>2021</strong> soll in jedem Fall besser werden. So zumindest lautet wohl der Vorsatz<br />
vieler Menschen in der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK). Nicht immer ganz einfach, doch der Rathaus-<br />
Chef und Vorsitzende im Aufsichtsrat der TRK, Dr. Frank Mentrup, blickt optimistisch in die Zukunft „nach“<br />
Corona. Über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, neue Partner und den Wunsch, am Abend wieder<br />
auszugehen spricht Oberbürgermeister Mentrup im Interview mit dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
März 2020: Die Welt fährt runter,<br />
Karlsruhe und die gesamte Region<br />
ebenfalls. Grenzen werden dicht<br />
gemacht, das öffentliche Leben steht<br />
so gut wie still. Ein Jahr später hat<br />
Corona die TRK noch immer im Griff,<br />
auch wenn viele Menschen mittlerweile<br />
geimpft sind und Geschäfte und<br />
Lokale wieder geöffnet haben.<br />
Herr Mentrup, 2020 war ein harter Ritt,<br />
<strong>2021</strong> könnte sich so fortsetzen. Wie geht<br />
es Ihnen in der aktuellen Corona-Lage?<br />
Es ist immer noch eine komische, befremdliche<br />
Stimmung und, um ehrlich<br />
zu sein, bin ich darüber sogar ganz froh.<br />
Denn wir sollten uns nicht daran gewöhnen,<br />
dass wir nur noch über kleine<br />
Bildschirmbildchen miteinander kommunizieren,<br />
anstatt uns persönlich zu<br />
begegnen. Maximales Homeoffice kann es<br />
auch nicht sein, weil es aus meiner Sicht<br />
nicht zur menschlichen Natur und ihren<br />
Bedürfnissen passt, gar keinen Kontakt<br />
nach außen mehr zu haben.<br />
Trotzdem haben während der Pandemie<br />
die Menschen in der Region und ich natürlich<br />
die Einschränkungen als ein Stück<br />
weit neuen Alltag akzeptiert. Die meisten<br />
können damit auch gut umgehen. Für<br />
Kinder und Heranwachsende oder auch<br />
Menschen in prekären Lebensverhältnissen<br />
ist es allerdings sehr schwer. Und für<br />
manche Branchen ist es – trotz diverser<br />
Hilfsschirme – die reine Katastrophe.<br />
Wenn Sie die letzten Monate Revue passieren<br />
lassen, wo hätten Sie sich mehr<br />
Rückendeckung seitens des Bundes und<br />
des Landes gewünscht?<br />
Ich hätte mir vor allem gewünscht, dass<br />
man die Ernsthaftigkeit der Ansagen, die<br />
man richtigerweise gemacht hat, auch<br />
genauso ernsthaft umsetzt. Schauen<br />
wir auf das Beispiel der Novemberhilfen:<br />
Wenn ich diese als unkomplizierte<br />
Wirtschaftshilfe ankündige und es ist<br />
teilweise bis in den Februar hinein nicht<br />
abgewickelt worden, dann verliert man<br />
Vertrauen – und zwar auf breitester<br />
Front. Oder die knappen Impfstoffdosen<br />
für die erste Impfphase verbunden<br />
mit vollmundigen Versprechen.<br />
Vieles hätte konsequenter<br />
>><br />
Foto Presse- und Informationsamt, Stadt Karlsruhe<br />
„Etwas Gutes aus der Krise:<br />
Persönliche Kontakte, die<br />
man während der Pandemie<br />
aufgebaut hat, sollten erhalten<br />
und vertieft werden.“<br />
4 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
5
AUFBRUCH<br />
Fotos Presse- und Informationsamt, Stadt Karlsruhe<br />
1 Das Städtische Klinikum Karlsruhe ist das größte<br />
Krankenhaus in der TRK und ein Maximalversorger.<br />
2 Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe: Naherholung<br />
mitten in der City.<br />
3 Festplatz mit Stadthalle und Schwarzwaldhalle –<br />
aktuell ohne Events.<br />
>> umgesetzt gehört, damit die<br />
Menschen nicht den Eindruck bekommen,<br />
am Ende im Stich gelassen zu werden.<br />
Dieses Gefühl macht sich seit etwa März<br />
zunehmend breit und das macht mir<br />
große Sorgen.<br />
Die Auswirkungen der Coronapandemie<br />
werden die Menschen in der<br />
TechnologieRegion Karlsruhe mit Sicherheit<br />
noch länger spüren: nicht nur<br />
beruflich und finanziell, sondern auch,<br />
was die Freizeitgestaltung angeht. Viele<br />
Kultureinrichtungen sind seit Monaten<br />
geschlossen – manche bleiben es<br />
vielleicht für immer.<br />
Wie ist Karlsruhe und die TRK für die<br />
Zukunft aufgestellt?<br />
Ich glaube, bei den starken Strukturen,<br />
die die TRK ausmachen – etwa unsere<br />
Infrastruktur, was den Verkehr betrifft,<br />
und die Wirtschaftsstruktur – da ist die<br />
Begeisterung der Menschen in der Region<br />
ungebrochen. Auch die Begeisterung, für<br />
die Region einzustehen, hat sich durch die<br />
Krise nicht verändert.<br />
Was wir aber noch nicht abschätzen<br />
können mit den langfristigen Auswirkungen<br />
ist die Krise der Oberzentren, die<br />
Corona ausgelöst hat. Mit städtischen<br />
Mitteln finanzieren wir Infrastruktur, die<br />
in ihrer Bedeutung weit über die Stadt<br />
Karlsruhe, teilweise sogar über die Region<br />
hinausgeht: das Städtische Klinikum,<br />
eine eigene Eisenbahngesellschaft wie die<br />
AVG und den ÖPNV der Region. Aber<br />
auch große Kultureinrichtungen wie das<br />
Badische Staatstheater oder das ZKM, die<br />
wir mindestens zur Hälfte finanzieren. Die<br />
Bäderbetriebe mit dem großen Europabad<br />
gehören auch dazu, ebenso unsere<br />
Messe- und Kongressgesellschaft. Das<br />
sind alles Angebote, mit denen die Stadt<br />
Karlsruhe weit über ihre Grenzen hinaus<br />
wichtige Aufgaben erfüllt und bei denen<br />
die Kosten derzeit explodieren, nicht nur,<br />
weil die Kunden und Besucher fehlen.<br />
Diese Kosten werden wir auf Dauer, trotz<br />
des derzeitigen Finanzausgleichs, jedoch<br />
nicht tragen können. Diese Situation<br />
betrifft nicht nur Karlsruhe, sondern alle<br />
Oberzentren im Land.<br />
Daher müssen wir uns in der TRK darauf<br />
einstellen, dass wir politische Lobbyarbeit<br />
machen müssen, damit diese Infrastrukturen<br />
stärker vom Land und vielleicht auch<br />
vom Bund mitfinanziert werden.<br />
„Die meisten können mit<br />
dem neuen ‚Alltag‘ gut<br />
umgehen. Für Kinder und<br />
Heranwachsende oder auch<br />
Menschen in prekären<br />
Lebensverhältnissen ist es<br />
allerdings sehr schwer.“<br />
Müssen wir uns auf Schließungen<br />
gefasst machen?<br />
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir<br />
müssen aber vielleicht Angebote umstrukturieren,<br />
um Kürzungen oder Schließungen<br />
zu vermeiden.<br />
Schauen wir auf das Beispiel ÖPNV. Wir<br />
haben neue Stadtbahnwagen angeschafft,<br />
nehmen neue Strecken in Betrieb und<br />
reaktivieren tote Streckenabschnitte. Wir<br />
haben viel zusätzliches Personal eingestellt,<br />
um das Thema Fahrermangel in den<br />
Griff zu bekommen – all diese Entwicklungen<br />
haben zunächst viel Geld gekostet.<br />
In ein paar Jahren werden wir uns<br />
vielleicht fragen müssen: Kann ich mir den<br />
10-Minuten-Takt überhaupt leisten oder<br />
muss ich einen Wagen mehr anhängen<br />
und fahre vielleicht nicht mehr ganz so<br />
häufig? Da könnte eine Angebotsmodifizierung<br />
stattfinden müssen, die allerdings<br />
schade wäre. Lasst uns Bund und Land<br />
überzeugen, dass wir an dieser Stelle eine<br />
stärkere gemeinsame Verantwortung<br />
eingehen müssen.<br />
„Warum in die Ferne schweifen“, heißt<br />
ein sehr berühmtes Sprichwort, wenn<br />
doch das Gute so nah ist. Statt Urlaub<br />
am spanischen Strand oder in der Südsee<br />
zu machen, haben viele Menschen<br />
die Region (wieder) für sich entdeckt.<br />
Viele haben sich auf Werte und Traditionen<br />
besonnen und einfach auch mal<br />
über den Gartenzaun geschaut und<br />
den Nachbarn gefragt, wie es denn so<br />
geht. Nachbarschaftshilfe war und ist<br />
gefragter denn je.<br />
Das sind gute Entwicklungen, die<br />
stattgefunden haben: Die Region<br />
erleben, lokal denken und handeln<br />
und die Nachbarn, ob jung oder<br />
alt, unterstützen.<br />
Was wünschen Sie sich sollte davon auch<br />
in Zukunft erhalten bleiben?<br />
Wenn wir die Nachbarn ansprechen,<br />
denke ich natürlich erstmal an unsere<br />
Nachbarn im Elsass, im Kraichgau und<br />
Schwarzwald und in der Pfalz, aber auch<br />
an mein persönliches Umfeld, die Nachbarn<br />
ein Haus weiter. Ich finde, da sollten<br />
wir ansetzen und das Verhältnis vertiefen:<br />
Persönliche Kontakte, die man während<br />
der Pandemie aufgebaut hat, sollten<br />
erhalten und vertieft werden. Das erlebe<br />
ich jeden Tag. Durch die Einschränkungen<br />
durch Corona haben sich verstärkt nachbarschaftliche<br />
Gruppen in den sozialen<br />
Netzwerken gebildet. Diese Selbstorganisation<br />
sollten wir stärker würdigen und<br />
versuchen, auch nach der Krise, wenn wir<br />
alle in einer neuen Normalität leben, aufrechtzuerhalten.<br />
Auf andere achten und<br />
gemeinsam etwas anpacken, das würde<br />
ich mir wünschen, dass es bleibt.<br />
Im März 2020 wurden die Grenzen<br />
geschlossen, auch ins französische<br />
Elsass durften die Menschen in der<br />
Region nicht fahren. Lediglich Pendlern<br />
war es erlaubt, von der einen Seite auf<br />
die andere Seite des Rheins zu fahren.<br />
Und doch waren die TRK und das Elsass<br />
verbunden im Kampf gegen das Virus.<br />
Französische COVID-Patienten wurden<br />
im Städtischen Klinikum Karlsruhe<br />
behandelt. Die Zusammenarbeit lief<br />
auch auf anderen Ebenen weiter, >><br />
6 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
7
eispielsweise zwischen den<br />
Städten Karlsruhe und Straßburg.<br />
Standen diese europäischen Verbindungen<br />
jemals in Frage oder haben<br />
Sie nach dem Motto „Jetzt erst recht!“<br />
weitergemacht?<br />
Beim ersten Lockdown gab es noch<br />
die Schließung der innereuropäischen<br />
Grenzen, es wurde als „alternativlos“<br />
dargestellt. Alle Gebietskörperschaften<br />
entlang der deutsch-französischen<br />
Grenze sind virtuell zu mehreren Ausschusssitzungen<br />
zusammengekommen.<br />
Dabei haben wir immer wieder betont,<br />
dass es keine Grenzschließungen geben<br />
darf, aber man hat trotzdem alles dicht<br />
gemacht. Und im zweiten Lockdown, der<br />
im Dezember kam, haben unsere Appelle<br />
doch gewirkt: Man hat das Mittel<br />
Grenzschließung nicht mehr in Erwägung<br />
gezogen, zumindest an der Grenze zu<br />
Frankreich. Ich muss sagen, das war eine<br />
phänomenale Lernkurve auf nationaler<br />
Ebene, die ich nach dem ersten Lockdown<br />
nicht erwartet hätte. Wir waren im<br />
März und April 2020 richtig verzweifelt.<br />
Dass die Grenzen im zweiten Lockdown<br />
weitgehend offen geblieben sind, ist ein<br />
voller Erfolg.<br />
Ich glaube, dass aus der Krise heraus<br />
gerade für die grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit nochmal ganz viel Kraft<br />
und Bereitschaft gewachsen ist, weil so<br />
eine Grenzschließung, die<br />
dann einfach erstmal angeblich alles<br />
klärt, eigentlich alles nur noch<br />
schlimmer macht. Das steckt jetzt<br />
als Grunderfahrung in unseren Knochen,<br />
jetzt kann es im Grunde nur noch nach<br />
vorne gehen. Von daher wird es eine<br />
deutlich intensivere Zusammenarbeit<br />
geben, vor allem dann, wenn wir uns<br />
auch wieder physisch treffen können.<br />
Manchmal schafft die verstärkte Distanz<br />
eine viel größere Nähe zueinander.<br />
2020 stand in vielen Bereichen hinter<br />
Corona an, dabei waren die Stadt<br />
Karlsruhe und die TRK hinter den<br />
Kulissen weiterhin aktiv, um weiterhin<br />
volle Kraft voraus in Richtung Zukunft<br />
zu starten.<br />
Herr Mentrup, welche spannenden Entwicklungen<br />
erwarten Sie in diesem Jahr?<br />
Da gibt es gleich zwei interessante<br />
Projekte. Zum einen hat das Land<br />
Baden-Württemberg im Dezember<br />
letzten Jahres einen Innovationspark<br />
ausgeschrieben. Auf den haben wir<br />
uns zusammen mit Stuttgart und dem<br />
Neckar-Alb-Kreis beworben. Mit diesen<br />
beiden Regionen haben wir ein Konsortium<br />
gegründet und Mitte Januar die<br />
Bewerbung eingereicht.<br />
Allein, dass wir das gemeinsam mit den<br />
anderen Regionen angegangen sind, ist<br />
schon eine Erfolgsstory für sich: Dass<br />
es uns gelungen ist, mit einem großen<br />
württembergischen Landesteil zusammenzuarbeiten,<br />
mit dem wir vorab eher<br />
in Konkurrenz standen – Anträge zu formulieren<br />
und die Kosten untereinander zu<br />
verteilen, Verantwortlichkeiten zu klären<br />
und Rahmenbedingungen zu schaffen.<br />
Das zweite Thema hat mit Mobilität zu<br />
tun. Das Bundesverkehrsministerium hat<br />
Anfang 2020 angekündigt, ein Deutsches<br />
Zentrum Mobilität der Zukunft<br />
zu gründen. Da haben wir uns als Stadt<br />
Karlsruhe im Sommer recht frech darauf<br />
beworben. Das Zentrum sollte von Beginn<br />
an in München sein, wir dachten uns aber,<br />
dass geht doch auch bei uns – immerhin<br />
stammen die Erfinder des Autos und des<br />
Fahrrades aus Karlsruhe.<br />
Der Hauptsitz des Zentrums bleibt jetzt<br />
zwar in München, es gibt jedoch weitere<br />
Standorte und wir versuchten unser<br />
Glück. Ich habe dafür bereits im Herbst<br />
erste Gespräche im Bundestag geführt. Es<br />
ist uns nun gelungen, dass der Haushaltsausschuss<br />
den Standort Karlsruhe in den<br />
Haushaltsentwurf des Bundes eingetragen<br />
hat. Jetzt geht es darum, diesen Standort<br />
auszuformen und mit Leben zu füllen. Das<br />
ist ein großartiger Erfolg für die Stadt<br />
und für die gesamte TechnologieRegion.<br />
Eine tragende Rolle bei diesem Zentrum<br />
neben München zu spielen, ist eine schöne<br />
Anerkennung für die Leistungsfähigkeit<br />
und die Innovationskraft der Region!<br />
Denken Sie darüber nach, die TRK noch<br />
zu erweitern, wenn die Zusammenarbeit<br />
mit Stuttgart oder dem Neckar-Alb-<br />
Kreis gut läuft?<br />
Ich würde nicht aus unserer Region und<br />
anderen Regionen gemeinsame Großregionen<br />
machen wollen, sondern den Weg in<br />
der vertieften Kooperation suchen. Jede<br />
Region hat ihre Spezifika, und das ist auch<br />
gut so. Sich bei allem im Alltag auf Dinge<br />
einigen und Dinge klären zu müssen, das<br />
bislang bei uns wirklich hervorragend<br />
funktioniert, steht ab einer gewissen<br />
Größe und Beliebigkeit einer Großregion<br />
der gewünschten Kreativität und Innovationskraft<br />
im Weg. Nach der Erweiterung<br />
nach Landau 2019 und ins nördliche<br />
Elsass 2020 ist derzeit bei der TRK<br />
flächenmäßig nicht mehr geplant. Wenn<br />
es doch einen Beitrittskandidaten gäbe,<br />
dann würde ich den eher im Süden sehen,<br />
denn die Metropolregion Rhein-Neckar<br />
ist so schon groß genug. Auch hier stehen<br />
wir einer vertieften Zusammenarbeit offen<br />
gegenüber.<br />
Spannend wird auch eine intensivere<br />
Zusammenarbeit mit Straßburg und<br />
dem südlichen Elsass – zudem die beiden<br />
Departements Nord- und Süd-Elsass<br />
ja gerade zu einem Euro-Departement<br />
zusammengegangen sind.<br />
WEGE AUS DER KRISE<br />
„GLOBALE PROBLEME MIT REGIONALEN KOMPETENZEN LÖSEN“<br />
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“, so hat es Willy Brandt gesagt. Zurückblicken<br />
bringt also wenig, höchstens, um aus der Vergangenheit zu lernen. Aber die Zukunft muss aktiv angegangen<br />
werden, wir stecken mitten im <strong>Aufbruch</strong> in die neue Normalität. Das weiß auch TRK-Geschäftsführer Jochen<br />
Ehlgötz. Der <strong>Wirtschaftsspiegel</strong> hat ihn zum digitalen Interview getroffen.<br />
<strong>Aufbruch</strong> ist das Thema, die Wanderstiefel sind fest geschnürt,<br />
die Reise in die Zukunft hat begonnen. Dabei ist die Technologie-<br />
Region Karlsruhe (TRK) schon lange im Auf- und Umbruch.<br />
„Neu gestartet sind wir 2017, als wir die TechnologieRegion als<br />
GmbH gegründet und damit die Zusammenarbeit auf professionellere<br />
Beine gestellt haben“, sagt Jochen Ehlgötz.<br />
Ein Wagnis, auch für den Geschäftsführer der TRK, doch der<br />
Erfolg ist geblieben, der Neustart geglückt. Und jetzt, über ein<br />
Jahr nach dem Beginn der Coronapandemie ist ein <strong>Aufbruch</strong><br />
erneut nötig. „Ohne das Wort überstrapazieren zu wollen,<br />
aber ich glaube schon, dass in jeder Krise auch eine Chance<br />
steckt“, so Ehlgötz weiter. „Und deshalb verbinde ich mit den<br />
Neustarts, die in meinem beruflichen und privaten Leben nötig<br />
waren, am Ende immer positive Erfahrung.“<br />
REGIONALE STÄRKEN NUTZEN<br />
„Region in Bewegung – Transformation gemeinsam gestalten“ –<br />
die im April <strong>2021</strong> durch das Land Baden-Württemberg<br />
prämierte Regionalentwicklungsstrategie wird ein ganz<br />
wichtiger Treiber der künftigen Weiterentwicklung sein.<br />
„Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit sind<br />
als zentrale Säulen fest in unserer Agenda verankert“, fasst<br />
Ehlgötz die Kernpunkte zusammen.<br />
So wird es mit der „regioKArgoTramTrain“ einen Prototyp<br />
einer neuartigen Güter-Stadtbahn geben. Sie wird gleichzeitig<br />
Fahrgäste und Güter aus der Region in die Stadt transportieren,<br />
um angesichts des stetig zunehmenden Lieferverkehrs<br />
im urbanen Raum mit einem ganzheitlichen Lieferkonzept<br />
Abhilfe zu schaffen. Mit „RegioMORE“ soll in Bühl ein regionales,<br />
grenzüberschreitendes „Digital Ecosystem“ entstehen,<br />
das insbesondere die mittelständischen Unternehmen<br />
der lokalen Wirtschaft sowie Wissenschaft, Schulen, Bürger<br />
und Kommunen lückenlos miteinander – und nicht zuletzt<br />
grenzüberschreitend – vernetzt. Und schließlich das „LastMile-<br />
CityLab“: in Bruchsal entsteht das weltweit erste Citylabor zur<br />
Entwicklung und zum Test von Gütertransport-Technologien im<br />
urbanen Raum. Neben autonom fahrenden Lastenrädern und<br />
Liefer-Robotern wird künftig auch die VoloDrone, ein elektrisch<br />
angetriebenes Lasten-Luftfahrzeug, die Stadtquartiere mit<br />
Gütern versorgen.<br />
Ehlgötz weist zudem auf die Potenziale regionaler Produktion<br />
und Lieferketten hin. Die globale Pandemie zeigt, wie<br />
globalisiert und vernetzt die Welt ist. „Wir müssen hier in der<br />
Region noch krisensicherer werden. Wir müssen Wege finden,<br />
wie wir Innovationen aus der Region schneller umsetzen<br />
können – nicht nur in Pandemie-Zeiten. Wir haben hier viele<br />
regionale Ideen, die helfen, globale Probleme zu lösen. Das<br />
haben Carl Benz mit Auto, Haber-Bosch mit ihrem Verfahren<br />
für Kunstdünger oder Otto Lehmann als geistiger Vater der<br />
LCD-Technologien in der Vergangenheit bewiesen. Wir brauchen<br />
ein neues Zeitalter in der Innovation Vorfahrt bekommt<br />
und durch Bürokratie beschleunigt und nicht gebremst wird.“<br />
DIE KRISE BRINGT VERÄNDERUNGEN<br />
„Corona bringt massive Veränderungen mit sich, Schwachstellen<br />
werden offensichtlich und der Transformationsdruck<br />
hat sich erheblich erhöht“, ist sich Jochen Ehlgötz sicher –<br />
und neue Fragestellungen wollen beantwortet sein. „Welche<br />
Instrumentarien gibt es, wie organisieren wir Homeoffice, was<br />
bedeutet das für die Mobilität, was ändert sich für Produktionsprozesse<br />
unter Pandemiebedingungen, was passiert mit<br />
Büros, wenn sie nicht mehr genutzt werden – viele Veränderungen,<br />
auf die wir in der TRK reagieren müssen.“<br />
POSITIVE FOLGEN UND EXISTENZIELLE BEDROHUNG<br />
Corona birgt die Gefahr der Spaltung – gesellschaftlich und<br />
wirtschaftlich. Vielen Betrieben in der TRK ist es bislang gut<br />
gelungen, auf Corona zu reagieren. „Die Region ist gewappnet,<br />
der Mittelstand ist breit aufgestellt und die Unternehmen<br />
sind sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden<br />
bewusst. Oftmals waren es die familiengeführten<br />
Betriebe, die sehr schnell auf die Krise reagiert haben und<br />
diese nutzen, um neue Produkte sowie Dienstleistungen zu<br />
entwickeln und an den Markt zu bringen“, so der Geschäftsführer<br />
der TRK weiter.<br />
Fast schon eine positive Nachricht, könnte man sagen: In<br />
vielen Fällen hat die Corona-Krise die Digitalisierung vorangetrieben.<br />
„Was uns die Betriebe in der Region ebenfalls positiv<br />
zurückspiegeln, ist die Möglichkeit, dass Mitarbeitende mobil<br />
arbeiten können, was vorher in diesem Umfang nicht denkbar<br />
war“, sagt Ehlgötz und spielt auf die Vorurteile des Arbeitens<br />
zuhause an: „Die Befürchtungen der Arbeitgeber, dass die<br />
Produktivität darunter leiden würde, hat sich nicht bestätigt.<br />
Im Gegenteil: Die Menschen sind flexibler und damit steigt<br />
die Motivation und die erbrachte Leistung stimmt. Also hat<br />
Homeoffice schlussendlich einen positiven Effekt. Daher glaube<br />
ich, dass das auch in Zukunft erhalten bleibt.“ In Homeoffices<br />
zahlreicher regionaler Partner ist während des Lockdowns,<br />
der Antrag zum Thema „Innovationspark Künstliche Intelligenz“<br />
entstanden. „Corona hält uns nicht auf, die Zukunft<br />
weiterzudenken – mit Partnern aus ganz Baden-Württemberg<br />
haben wir einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht<br />
und dafür eine Genossenschaft gegründet“, erläutert Ehlgötz.<br />
„Jetzt hoffen wir auf den Zuschlag, weil KI ein wichtiger Treiber<br />
für die Zukunftsfähigkeit unserer Region ist.“<br />
Allerdings, und das ist die dramatische Seite von Corona: Einige<br />
Unternehmen in der Region konnten oder werden die Krise<br />
nicht überstehen. „Wir wissen, dass es in den letzten Monaten<br />
in vielen Bereichen existenzbedrohend war, ob Einzelhandel,<br />
Messedienstleister, Event-Bereich, Gastronomie – hier sind<br />
von Tag zu Tag mehr Firmen existenziell bedroht, weil über<br />
Wochen kein Umsatz da war. Gerade auch kleine Unternehmen<br />
stehen vor großen Problemen. Hier wünschen wir uns für<br />
die Region ein deutlich effektiveres Vorgehen zum Beispiel bei<br />
den Hilfen für Unternehmen. Selbständige und Unternehmen<br />
können nicht wochenlang auf Zahlungen warten und auch<br />
Verfahren müssen einfach, transparent und verlässlich sein.<br />
Es kann nicht sein, dass Betriebe wochenlang warten, bis die<br />
zugesagten Zahlungen erfolgen. Hinzu kommt: Das Fehlen<br />
einer verlässlichen Öffnungsstrategie mit verbindlichen Rahmenbedingungen<br />
im regionalen Maßstab ist eine der zentralen<br />
Hürden, die die wirtschaftliche Zukunft vieler Branchen in<br />
Frage stellt. Von den zahlreichen indirekten Auswirkungen,<br />
beispielsweise auf die Innenstädte, ganz zu schweigen.“ Wird<br />
es hier keine Änderung geben, so wird, sagt Ehlgötz weiter, die<br />
Wirtschaft in einigen ihrer tragenden Säulen kaputt gehen.<br />
Foto ARTIS – Uli Deck<br />
Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der TechnologieRegion Karlsruhe.<br />
WENIGER REISEN, BESSER FÜRS KLIMA<br />
Auch die Geschäftsstelle der TRK hat coronabedingt auf<br />
digitale Events und Konferenzen umgestellt. Und siehe da:<br />
„Wir hatten einen wesentlich größeren Zulauf gegenüber<br />
Präsenzveranstaltungen, denn die Leute können sich einfach<br />
einwählen, sind dabei und müssen nicht anreisen oder nach<br />
Feierabend zu einer Veranstaltung.“ Ehlgötz führt das Beispiel<br />
des Stammtisches für internationale Fach- und Führungskräfte<br />
des Welcome Centers der TRK an, der ebenfalls im virtuellen<br />
Raum stattgefunden hat. „Trotz Zeitverschiebung hatten<br />
wir Teilnehmende aus dem Iran, Vietnam und sogar Australien<br />
und Brasilien dabei“, sagt er mit Stolz. „Der Wirkkreis wird<br />
größer. Wir können zielgruppenspezifisch weltweit Menschen<br />
ansprechen.“ Außerdem, so der TRK-Geschäftsführer, würde<br />
man dadurch Reisekosten einsparen und den CO2-Ausstoß<br />
senken, was Umwelt und Klima zu Gute kommt.<br />
GRENZEN OFFENHALTEN – ZUSAMMENARBEIT<br />
ÜBER RHEIN UND LAUTER AUSBAUEN<br />
„Als TechnologieRegion denken wir über Rhein und Lauter<br />
hinweg. Eine Grenzschließung wie im ersten Lockdown ist der<br />
falsche Weg“, so Ehlgötz, „stattdessen müssen wir voneinander<br />
lernen, unsere Konzepte austauschen, bewerten, gemeinsame<br />
Wege finden. Gemeinsam sind wir stark. Daher möchten<br />
wir an den Stellschrauben drehen, die eine grundsätzliche<br />
Verbindlichkeit für den künftigen Umgang mit ähnlichen<br />
Situationen haben werden“, erklärt Jochen Ehlgötz. Dazu soll<br />
die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen grenzübergreifend<br />
vertieft und auf regionaler Ebene institutionell verankert<br />
werden. „Als Grenzregion sind die deutschen Partner am<br />
Mittleren Oberrhein und der Südpfalz mit den französischen<br />
Freunden im Elsass ganz eng verflochten – das weiter auszubauen<br />
sehen wir auch als unseren Beitrag für ein zusammenwachsendes<br />
Europa.“<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
10 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
11
Illustration Felicitas Riffel – Werbeagentur von Schickh
AUFBRUCH<br />
Foto Carl Forger für VOLKSWOHNUNG<br />
Ein runder Geburtstag ist immer ein guter Anlass, um Vergangenes Revue passieren zu lassen und über die<br />
Zukunft nachzudenken. Zum 100-jährigen Jubiläum hat sich die VOLKSWOHNUNG einiges in dieser<br />
Richtung vorgenommen: Mit einem ehrlichen Blick zurück zeigt sie sich offen für Neues, stellt Bewährtes<br />
in Frage und will mit einem neuen Markenauftritt dynamisch durchstarten. In anderen Worten, es steht ein<br />
großer <strong>Aufbruch</strong> bevor. Was dieser mit sich bringt, darüber hat der <strong>Wirtschaftsspiegel</strong> mit Geschäftsführer<br />
Stefan Storz und Pia Hesselschwerdt, Leiterin der Unternehmenskommunikation, gesprochen.<br />
Ganz einfach ist der Karlsruher Wohnungsmarkt nicht: Die Mieten sind – wie in den meisten<br />
Großstädten – relativ hoch, bezahlbare Wohnungen rar gesät oder werden privat vergeben, der<br />
Umzug in die umliegenden Gemeinden ist für viele Suchende keine Option. Genau hier hat die<br />
VOLKSWOHNUNG ihre Kernkompetenz, denn sie sorgt seit 1922 für bezahlbaren Wohnraum<br />
in Karlsruhe. Die Nettokaltmiete liegt im Schnitt bei 6,31 Euro/Quadratmeter, ein günstiger Preis<br />
im Vergleich zu den sonstigen Durchschnittsmieten in Karlsruhe. Neben der Vermietung hat die<br />
VOLKSWOHNUNG außerdem viel Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung ehemals<br />
militärisch genutzter Areale wie der amerikanischen Kaserne in Kirchfeld-Nord oder der Kaserne<br />
im jetzigen Knielingen 2.0.<br />
Gerade die Vermarktung bringt zusätzliche finanzielle Mittel für den Neubau oder Sanierungen im<br />
Bestand. Zwischen 2012 und 2020 hat die städtische Gesellschaft über 900 Wohneinheiten neu<br />
errichtet, von denen ein Drittel öffentlich gefördert ist. Allein 2019 wurden 27 Millionen Euro in den<br />
Neubau von Mietwohnungen investiert, 2020 waren es sogar rund 35 Millionen Euro. Bis 2025, so<br />
das Ziel, sollen über 1.000 weitere Mietwohnungen in der Stadt entstehen. Mehr als die Hälfte davon<br />
soll ebenfalls öffentlich gefördert sein.<br />
ZEIT FÜR NEUE WEGE<br />
Die städtische Wohnbaugesellschaft hat aber ein weitaus größeres Bild vor Augen als „nur“ die<br />
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Zum 100-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr positioniert<br />
sich die VOLKSWOHNUNG konzeptionell neu und verpasst sich zudem einen frischen Anstrich.<br />
Das Unternehmen befindet sich also mitten in einem Auf- und Umbruch.<br />
100 JAHRE<br />
VOLKSWOHNUNG<br />
Das Thema <strong>Aufbruch</strong> ist das<br />
Leitmotiv im <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>,<br />
passt aber auch sehr gut zur<br />
VOLKSWOHNUNG. Warum?<br />
Storz: Wie in vielen Großstädten ist<br />
auch in Karlsruhe die Nachfrage nach<br />
bezahlbarem Wohnraum riesig. Daher<br />
planen wir in den kommenden Jahren<br />
viele Neubauprojekte, die sicherlich<br />
dazu beitragen, die Lage etwas zu entspannen.<br />
Sehr viele unserer Gebäude<br />
wurden in den 1950er oder 60er<br />
Jahren errichtet. Hier gibt es inzwischen<br />
einen großen Bedarf an<br />
Sanierungen und Modernisierungen,<br />
die wichtig für den Werterhalt sind,<br />
aber auch um die Klimaschutzziele<br />
der Stadt Karlsruhe zu erreichen. Das<br />
Thema Nachhaltigkeit spielt für uns<br />
eine große Rolle und ist fest in unserer<br />
DNA verankert. Hinzu kommen die<br />
Herausforderungen, die der demografische<br />
Wandel mit sich bringt. Wir<br />
stellen uns darauf ein, dass Wohnen in<br />
den nächsten 20 bis 30 Jahren mehr<br />
Flexibilität und mehr gemeinschaftlich<br />
genutzte Flächen braucht. Zum Glück<br />
sind wir digital schon ziemlich gut<br />
aufgestellt, was uns in dieser Zeit der<br />
Pandemie intern die Umstellung<br />
auf mobiles Arbeiten leicht gemacht<br />
hat. Für die Mieter haben wir mit<br />
der neu entwickelten Mieter-App<br />
„Meine VOWO“ unser digitales<br />
Angebot ausgebaut und dadurch<br />
den Kundenservice erweitert. >><br />
14 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
15
AUFBRUCH<br />
2<br />
3<br />
1 Blumenwiesen für den Artenschutz an<br />
fünf Standorten.<br />
2 Zentrale der VOLKSWOHNUNG am<br />
Ettlinger-Tor-Platz.<br />
3 Quartierspielplatz im Rintheimer Feld –<br />
für alle Altersstufen etwas dabei.<br />
Fotos VOLKSWOHNUNG<br />
>> Das alles sind Aspekte, die zwar<br />
schon in den letzten 100 Jahren für<br />
uns auf der Tagesordnung standen, aber<br />
im Zusammenspiel erfordern diese Themen<br />
Klima, Neubau, Modernisierung<br />
und Transformation, dass wir uns ein<br />
Stück weit neu erfinden und uns selbst<br />
hinterfragen müssen. Deshalb haben<br />
wir uns Ende 2020 auf eine Reise<br />
begeben, wir sind im <strong>Aufbruch</strong> und<br />
wollen das auch nach außen hin sichtbar<br />
transportieren.<br />
Hesselschwerdt: Unsere Kommunikation<br />
bildet derzeit nicht wirklich<br />
ab, wofür wir stehen. Unser soziales<br />
Engagement und die guten Beziehungen<br />
zu unseren Mietern werden nur<br />
gering wahrgenommen; ebenso unsere<br />
innovativen und um Nachhaltigkeit<br />
bemühten Aktivitäten im Neubau- und<br />
Sanierungsbereich. Auch unser Logo,<br />
das graue Haus mit rotem Dach, führt<br />
da in die falsche Richtung. Wir bauen<br />
ja keine kleinen Einfamilienhäuser,<br />
sondern versuchen ganze Quartiere<br />
so zu planen, dass sie lebenswert für<br />
alle sind und mehr bezahlbarer und<br />
gleichzeitig attraktiver Wohnraum in<br />
Karlsruhe entsteht.<br />
Storz: Genau! Deshalb testen wir an<br />
verschiedenen Stellen aus, was es in<br />
Zukunft braucht und welchen Mehrwert<br />
wir für unsere Mieter und auch<br />
die Stadtgesellschaft schaffen können.<br />
Aktuell stecken wir mitten in mehreren<br />
Pilotprojekten, teils in der Planung,<br />
teilweise aber auch schon in der praktischen<br />
Umsetzung, um Zukunftsthemen<br />
sinnvoll abzubilden.<br />
Was sind das für Pilotprojekte, von<br />
denen Sie gerade gesprochen haben?<br />
Storz: Zum Beispiel wurden unsere<br />
1<br />
Garagenaufstockungen in<br />
Rintheim vom Ministerium für Wirtschaft,<br />
Arbeit und Wohnungsbau<br />
Baden-Württemberg als beispielgebendes<br />
Projekt ausgezeichnet und gefördert.<br />
Gemeinsam mit dem Architekten,<br />
Dr. Falk Schneemann, stocken wir<br />
bestehende Garagenhöfe mit modularen<br />
Wohnungen in Holzbauweise auf.<br />
Im Laufe dieses Jahres entstehen dann<br />
zwölf Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen<br />
mit kompaktem, überwiegend sozial<br />
gefördertem Wohnraum für Studierende<br />
und Alleinerziehende. Das löst sicher<br />
nicht die Wohnungsprobleme in Karlsruhe,<br />
setzt aber neue Impulse und findet<br />
überregional bestimmt Nachahmer.<br />
Besonders spannend ist für uns auch<br />
die Zusammenarbeit mit Start-ups,<br />
die wir als Partner über das Netzwerk<br />
hubitation kennenlernen. Bereits<br />
mitten in der Umsetzungsphase sind wir<br />
mit Lumoview, die eine effiziente und<br />
praktikable Lösung gefunden haben, um<br />
digitale Wohnungsgrundrisse zu erstellen.<br />
Das klingt erstmal simpel, ist aber<br />
für uns enorm wichtig, um zum Beispiel<br />
Förderanträge zu stellen.<br />
Impulse nach außen setzen ist<br />
wichtig, aber woher kommt der<br />
interne Impuls, den Außenauftritt<br />
zu überdenken und überarbeiten?<br />
Hesselschwerdt: Nicht nur der Blick<br />
nach außen, sondern auch nach innen<br />
hat gezeigt, dass aktuelle Themen wie<br />
unser soziales Engagement, spezielle<br />
Angebote für unsere Mieter – wie<br />
Vergünstigungen beim Carsharing<br />
oder im ÖPNV – und unser Engagement<br />
für die Umwelt im jetzigen<br />
Auftritt nicht umfassend dargestellt<br />
werden. Deshalb sind wir, mit Unterstützung<br />
unseres Aufsichtsratsvorsitzenden,<br />
Bürgermeister Daniel Fluhrer,<br />
in einen Strategieprozess eingestiegen<br />
und haben uns die Fragen gestellt:<br />
‚Wer sind wir? Was machen wir?<br />
Wofür stehen wir?‘ Zusätzlich haben<br />
wir gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat,<br />
Stakeholdern und unseren<br />
Mietern reflektiert, wie sie die<br />
VOLKSWOHNUNG sehen.<br />
Das Bild war nicht immer positiv belegt.<br />
Aber die Kernbotschaften waren<br />
eindeutig: Wir stehen für bezahlbaren<br />
Wohnraum, für Nachhaltigkeit und<br />
soziales Engagement. Und genau das<br />
wollen wir in unserem Gesamtauftritt<br />
authentisch vermitteln. Hierfür ist aber<br />
ein kompletter Relaunch notwendig.<br />
Wie gehen Sie den Relaunch der<br />
Marke VOLKSWOHNUNG an?<br />
Hesselschwerdt: Wie bereits angedeutet<br />
wurde uns bei den Befragungen klar,<br />
dass es eine große Diskrepanz zwischen<br />
unserer Eigen- und der Fremdwahrnehmung<br />
gibt. Die spannende Frage<br />
war nun: ,Wie schaffen wir es, diese<br />
zu beseitigen?‘ Dafür haben wir uns<br />
externe Unterstützung geholt von der<br />
Agentur Heine/Lenz/Zizka mit Sitz<br />
in Frankfurt und Berlin, die uns seit<br />
November 2020 bei diesem Prozess<br />
begleitet. Gemeinsam haben wir ein<br />
Konzept entwickelt, das die Neuausrichtung<br />
der Kommunikation definiert.<br />
Das Ergebnis kann sich schon bald sehen<br />
lassen – im Sommer erscheint der<br />
Geschäftsbericht im neuen Design.<br />
Welche Aussage über die Wahrnehmung<br />
hat Sie besonders<br />
zum Nachdenken gebracht?<br />
Hesselschwerdt: Mir ist vor allem ein<br />
Zitat im Kopf geblieben: ‚Die<br />
VOLKSWOHNUNG ist ein gesetzter,<br />
seriöser, recht langweiliger<br />
Mittfünfziger mit Bauchansatz, der<br />
gedanklich jung geblieben ist und viel<br />
Lebenserfahrung besitzt.‘ Da kann man<br />
sich bildlich schon sehr gut vorstellen,<br />
wie die Karlsruher uns wahrnehmen.<br />
Aber klar, so eine Aussage ist im ersten<br />
Moment ernüchternd. Trotzdem<br />
sind wir dankbar für das Feedback, das<br />
wir von Mietern, Stakeholdern, Politik<br />
und aus der Stadtverwaltung bekommen<br />
haben. Damit können wir jetzt<br />
arbeiten. Unser Ziel ist eine nahbare,<br />
transparente und unverwechselbare<br />
Kommunikation.<br />
Storz: Die ehrlichen Rückmeldungen<br />
haben uns sehr geholfen, das war wichtig<br />
für den Prozess. Erst dadurch wurde<br />
uns klar, dass zu wenig von dem was wir<br />
machen auch in der Karlsruher Bevölkerung<br />
ankommt. Eine Mitarbeiterin<br />
hat es in der Umfrage auf den Punkt<br />
gebracht: ‚Wir tun so viel Gutes, doch<br />
keiner weiß es.‘<br />
Dann lassen Sie uns darüber<br />
sprechen: Was genau macht die<br />
VOLKSWOHNUNG denn noch?<br />
Storz: Wir möchten in vielen Bereichen<br />
innovativ denken und handeln. In<br />
Rintheim und Oberreut setzen wir mit<br />
unserem Partner, der KES, der Karlsruher<br />
Energieservice GmbH, zum Beispiel<br />
gerade das Projekt Mieterstrom um,<br />
wo mit Photovoltaik-Anlagen auf den<br />
Mietshäusern der eigene Strom<br />
produziert wird. Das sogenannte 100-<br />
Dächer-Programm läuft gut und soll in<br />
etwa zwei Jahren abgeschlossen sein.<br />
Dies ist ein weiterer Baustein auf dem<br />
Weg zu unserem Ziel, bis 2040 einen<br />
klimaneutralen Wohnungsbestand<br />
zu haben. Neben Insektenhotels und<br />
Blühwiesen, die übrigens nicht nur<br />
von unseren Mietern sehr geschätzt<br />
werden, ist uns auch eine nachhaltige<br />
Quartiersentwicklung sehr wichtig. Es<br />
nützt ja nichts, wenn man eine tolle<br />
Wohnung hat, aber die Kinder keinen<br />
Spielplatz in der Nähe haben oder wenn<br />
es keinen Treffpunkt für die Nachbarschaft<br />
gibt. Hier geht es um viel mehr<br />
als das reine Wohnen, es geht darum,<br />
dass die Menschen sich wohlfühlen und<br />
gerne dort leben.<br />
Soziales Engagement ist Ihnen<br />
also ebenso wichtig wie das<br />
Engagement für die Umwelt.<br />
Was ist Ihr Herzensprojekt?<br />
Storz: Da kann ich mich gar nicht entscheiden<br />
(lacht). Mir persönlich liegt<br />
besonders die ganzheitliche Betrachtung<br />
von Wohnen und Nachbarschaft<br />
am Herzen. Die Nachfrage nach neuen<br />
Wohnformen, wo Nachbarn füreinander<br />
da sind und die Gemeinschaft<br />
stärker in den Fokus rückt, nimmt<br />
merklich zu. Auf diesem Gebiet möchten<br />
wir uns noch mehr engagieren<br />
Die VOLKSWOHNUNG GmbH,<br />
gegründet 1922, ist eines der größten<br />
Immobilienunternehmen in Baden-<br />
Württemberg. Etwa 13.400 Wohnungen<br />
und über 240 Gewerbeeinheiten<br />
werden von ihr verwaltet und betreut.<br />
Bis 2025 wird die Immobiliengesellschaft<br />
mehr als 1.000 weitere Wohnungen<br />
bauen, von denen über die Hälfte<br />
der Mietpreisbindung unterliegt.<br />
Knapp 300 Mitarbeitende hat die<br />
VOLKSWOHNUNG – vom Architekten,<br />
über den Immobilienprofi bis hin<br />
zum Servicetechniker und Gärtner.<br />
und ergänzen unseren Bestand deshalb<br />
um Sonderwohnformen wie<br />
Mehrgenerationenhäuser, ambulant<br />
betreute Wohngemeinschaften oder<br />
auch Konzeptvergaben für Baugemeinschaften.<br />
Gerade für die Menschen<br />
mit besonderem Unterstützungsbedarf<br />
möchten wir durch Kooperationen<br />
mit sozialen Trägern den Zugang zu<br />
Wohnraum erleichtern. Wichtig ist<br />
mir auch, dass wir als kommunales<br />
Wohnungsunternehmen Institutionen,<br />
Initiativen und Vereine zu fördern, die<br />
in unseren Wohngebieten tätig sind. So<br />
können wir unsere Quartiere und die<br />
aktiven Menschen vor Ort unterstützen<br />
und die Lebensqualität steigern. Bei<br />
unserem Engagement achten wir sehr<br />
darauf, dass unsere Aktivitäten einen<br />
Mehrwert für unsere Mieter haben.<br />
Es gibt also jede Menge zu<br />
erzählen, warum haben die<br />
Bürger so selten davon gehört?<br />
Storz: Mit unserem hohen Bauvolumen<br />
und der Umsetzung der vielen<br />
großen Projekte haben wir uns in der<br />
Vergangenheit eher auf unser Tun<br />
konzentriert, jetzt ist es aber auch Zeit,<br />
darüber zu reden. Wir erneuern uns<br />
nicht nur, indem wir uns einen neuen<br />
Anstrich verpassen, sondern positionieren<br />
uns zu den zukunftsorientierten<br />
Themen auch anders.<br />
>><br />
16 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
17
Fotos Carl Forger für VOLKSWOHNUNG<br />
PIA HESSELSCHWERDT<br />
Pia Hesselschwerdt ist seit August 2020 Leiterin der Unternehmenskommunikation<br />
und Pressesprecherin. Vor ihrer<br />
Tätigkeit bei der VOLKSWOHNUNG leitete sie den Bereich<br />
Netzwerke und Kooperationen beim Bildungsträger Konzept-e<br />
für Bildung und Soziales in Stuttgart. Ihr Fokus liegt auf einer<br />
transparenten und authentischen Kommunikation innerhalb<br />
und außerhalb des städtischen Unternehmens.<br />
STEFAN STORZ<br />
Stefan Storz ist seit Mai 2018 Geschäftsführer der<br />
VOLKSWOHNUNG. Von 2010 bis zu seinem Wechsel nach<br />
Karlsruhe war der gebürtige Mannheimer Geschäftsführer der<br />
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH. Der Diplom-<br />
Kaufmann, Steuerberater und ehemaliger Wirtschaftsprüfer<br />
legt sein Augenmerk auf die Entwicklung von nachhaltigen<br />
und sozialgerechten Quartieren in der Stadt und in der<br />
TechnologieRegion Karlsruhe.<br />
>> Nachhaltigkeit und Klimaschutz<br />
sind viel mehr in den Fokus der öffentlichen<br />
Wahrnehmung gerückt.<br />
Hesselschwerdt: Und genau dieses<br />
Selbstverständnis gilt es jetzt, nach<br />
außen zu transportieren. Mit unserem<br />
zukünftigen Markenauftritt haben wir<br />
ganz andere Instrumente an der Hand,<br />
um unsere ,Geschichten‘ zu erzählen.<br />
2022 wird die VOLKSWOHNUNG<br />
das 100. Jubiläum feiern. Was ist bis<br />
dahin geplant und wie soll die große<br />
Party aussehen?<br />
Hesselschwerdt: Wir sind ja noch<br />
mitten im Entwicklungsprozess für das<br />
neue Corporate Design. Dafür haben<br />
wir uns bewusst Zeit genommen, damit<br />
wir das auf eine solide Basis stellen<br />
können. Der Geschäftsbericht wird<br />
der erste Aufschlag sein, bei dem die<br />
Leute erkennen, in welche Richtung<br />
der ‚Tanker VOWO‘, wie es einer in der<br />
Umfrage beschrieben hat, sich bewegen<br />
wird. Auf dieser Basis möchten<br />
wir im Jubiläumsjahr unterschiedliche<br />
Aktionen und Angebote schaffen, die<br />
über das Jahr 2022 hinaus wirken und<br />
Bestand haben. Im Fokus steht dabei<br />
immer der Mehrwert für unsere Mieterschaft.<br />
Aber auch das Thema Corporate<br />
Citizenship ist Teil unserer Überlegungen<br />
– wie können wir unseren 100.<br />
Geburtstag proaktiv nutzen, um uns<br />
auch in der Stadtgesellschaft als ,guter<br />
Bürger‘ zu engagieren?<br />
Storz: Was unseren Kernauftrag angeht,<br />
also die Schaffung von bezahlbarem<br />
Wohnraum, haben wir auch noch viel<br />
vor. Wir sind in Durlach gerade dabei,<br />
ein Projekt mit 54 Wohneinheiten zu<br />
realisieren. Ganz aktuell ist auch die<br />
Entwicklung des August-Klingler-Areals<br />
in Daxlanden. Hier entstehen etwa 360<br />
Wohneinheiten: Ein- bis Fünf-Zimmer-<br />
Wohnungen, darunter auch barrierearme<br />
Einheiten für ältere Menschen,<br />
eine Tagespflege-Einrichtung, eine Kindertagesstätte,<br />
zwei Gewerberäume und<br />
ein Mieterservice-Büro. Die Liste lässt<br />
sich weiterführen. Außerdem nehmen<br />
wir uns die energetische Sanierung der<br />
Bestandsimmobilien vor und schreiben<br />
unsere Klimastrategie fort. Dann stehen<br />
noch einige Ideen und Projekte bezüglich<br />
mehr Nachhaltigkeit beim Bau im<br />
Raum, über die wir uns noch Gedanken<br />
machen werden. Auch im 100. Jahr<br />
unseres Bestehens wird uns alles andere<br />
als langweilig! (lacht)<br />
AUFBRUCH<br />
Zugegeben, der Titel kommt etwas lustig daher, der Hintergrund ist aber alles andere als zum Lachen. Denn<br />
was Dirk Scherer, Geschäftsführer der Medical Protection Equipment GmbH, kurz Medpe, mit seinen<br />
Geschäftspartnern, IMSTec GmbH und Admedes GmbH, binnen kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, ist<br />
eine echte Meisterleitung. Von der Idee bis zur Produktion der ersten FFP2-Masken „Made in Germany“, sind<br />
gerade einmal sechs Monate vergangen.<br />
TAG 0<br />
Alles begann mit einem Aufruf von<br />
Gesundheitsminister Jens Spahn,<br />
aufgrund des Mangels an medizinischen<br />
Mund-Nasen-Masken, Produktionsstätten<br />
lokal in Deutschland<br />
zu errichten. „Nach einem kurzen<br />
Gespräch mit meinem damaligen Chef,<br />
Markus Spanner, Geschäftsführer der<br />
Physik Instrumente (PI) GmbH, und<br />
10 Sekunden Bedenkzeit war klar, ich<br />
mach es“, erinnert sich Dirk Scherer.<br />
Und dann ging alles ganz schnell.<br />
JUNI 2020<br />
Nach und nach wurden die<br />
technischen Anlagen aufgebaut<br />
und in Betrieb genommen. Parallel<br />
wurde nach geeignetem Personal<br />
gesucht. Qualifiziertes Fachpersonal<br />
war – natürlich – schnell eingestellt,<br />
ebenso die Aushilfen, die Scherer<br />
überwiegend aus von der Pandemie<br />
betroffenen Branchen gewinnen<br />
konnte. Darunter Mitarbeiter aus<br />
dem Wellnessbereich und aus dem<br />
Gastronomiegewerbe.<br />
HEUTE<br />
Aktuell wird mit 160 Mitarbeitern<br />
an fünf Anlagen auf einer Fläche von<br />
3.000 Quadratmetern produziert.<br />
Wöchentlich können so rund 1,5<br />
Millionen Masken ausgeliefert werden.<br />
Bei jeder Maske mit dabei: ein Clip<br />
zur Befestigung der Maske hinter dem<br />
Kopf, sowie ein zusätzliches Kopfbändchen<br />
– schließlich gleicht kein Kopf<br />
dem anderen. Kleinigkeiten, die die<br />
Qualität von Medpe unterstreichen, so<br />
der Geschäftsführer.<br />
MAULTÄSCHLE<br />
MADE IN BADEN<br />
„WIE HEISST DER MUNDSCHUTZ<br />
AUF SCHWÄBISCH?“<br />
Foto pexels.com/Griffin Wooldridge<br />
APRIL 2020<br />
Nach Gesprächen mit dem Rechtsanwalt<br />
und dem Notar folgte das Thema<br />
Finanzierung. Auch diese war schnell<br />
geregelt – Scherer setzte sein privates<br />
Kapital ein und konnte auch hier auf<br />
die Unterstützung der Familie Spanner<br />
setzen, die als Gesellschafter mit an<br />
Bord war. Unternehmensgründung<br />
ganz ohne Subventionen - nur dadurch<br />
gelang es Scherer, in gerade einmal 10<br />
Tagen Medpe zu gründen.<br />
MAI 2020<br />
Anfang Mai folgte dann die Einstellung<br />
des ersten Mitarbeiters und die Suche<br />
nach einer Produktionsstätte. Wie<br />
könnte es anders sein – schnell gefunden<br />
– Siemensallee 84, Karlsruhe. „Ich<br />
habe den Mietvertrag für eine Fläche<br />
von 1.500 Quadratmetern unterschrieben.<br />
Dann haben wir drei Bierbänke<br />
reingestellt, ein paar Laptops dazu und<br />
uns an die Arbeit gemacht“, so der<br />
Medpe-Geschäftsführer im Gespräch<br />
mit dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
SEPTEMBER 2020<br />
Genau ein halbes Jahr nach Firmengründung<br />
startete die Produktion<br />
der FFP2-Masken – zertifiziert nach<br />
DIN-Norm, anders als dies bei vielen<br />
Mitbewerbern der Fall ist, die ihre<br />
Produkte im europäischen Ausland<br />
oder der Türkei zertifizieren lassen.<br />
Und auch bei den Materialien wie<br />
dem Filtervlies setzt Medpe auf den<br />
deutschen Standard.<br />
OKTOBER 2020<br />
Von der Fächerstadt aus geht die<br />
erste Lieferung an öffentliche Einrichtungen<br />
in Deutschland und Europa.<br />
Wohin genau, das verwaltet die Firma<br />
IMSTec – Medpe agiert als Produzent.<br />
Ab sofort werden am Standort Karlsruhe<br />
rund um die Uhr FFP2-Masken<br />
produziert, nicht einmal an Weihnachten<br />
und Silvester wurde pausiert.<br />
„Seit wir das Unternehmen gegründet<br />
haben, hatte ich gerade mal vier Tage<br />
frei“, so Scherer weiter. Trotzdem<br />
bereut er diesen Schritt nicht.<br />
UND IN ZUKUNFT?<br />
Dirk Scherer sieht Medpe keinesfalls<br />
als One-Hit-Wonder und nur für die<br />
Zeit der Pandemie als wettbewerbsfähig,<br />
ganz im Gegenteil. Er und seine<br />
Kooperationspartner tüfteln bereits<br />
an Masken speziell für betagte Senioren<br />
– geringerer Atemwiderstand bei<br />
hoher Filtrationsleistung. Oder aber<br />
spezielle Masken für Kinder. Auch das<br />
Thema Nachhaltigkeit bewegt Scherer.<br />
Bislang haben die FFP2-Masken eine<br />
Lebensdauer von drei Jahren. Deshalb<br />
müssen große Lager, zum Beispiel<br />
von Krankenhäusern und Regierungen,<br />
nach dieser Zeitspanne entsorgt<br />
werden. „Wir möchten erreichen, dass<br />
unsere Masken langlebiger werden und<br />
auch nach fünf Jahren oder mehr ihre<br />
Funktionalität behalten“, lautet Scherers<br />
Vision. Zudem gibt es Ideen für<br />
eine Erweiterung des Sortiments – alles<br />
noch streng geheim.<br />
CAROLINE CARNEVALE<br />
www.wvs.de<br />
20 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
21
KARLSRUHE BAUT SEINE<br />
STÄRKEN WEITER AUS<br />
Wirtschaft und Wissenschaft sind auch in herausfordernden Zeiten starke Eckpfeiler des attraktiven<br />
Investitionsstandorts. Als Zentrum für Innovation ist Karlsruhe mit seinen renommierten Hochschulen und<br />
Forschungseinrichtungen, den dynamischen Unternehmen und Netzwerken zukunftsfähig aufgestellt.<br />
Ein überdurchschnittlicher Anteil an Zukunftsbranchen wie<br />
Informationstechnologie (IT), künstliche Intelligenz (KI),<br />
Mobilität sowie Energie, Handel und Kreativwirtschaft sorgt<br />
für hohe Resilienz. Folglich sprechen die ökonomischen Zahlen<br />
für sich: Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg<br />
lag die Bruttowertschöpfung in Karlsruhe im Jahr 2018<br />
bei 18,4 Mrd. Euro, über 14 Mrd. Euro erwirtschaftete allein<br />
der Dienstleistungssektor. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in<br />
der Fächerstadt in den vergangenen zehn Jahren um 20.000<br />
auf rund 240.000.<br />
Derzeit arbeiten rund 30.000 Menschen in 4.400 IT-<br />
Unternehmen. Diese zukunftsweisende Branche macht bereits<br />
heute etwa 45 Prozent des Karlsruher Gewerbesteueraufkommens<br />
aus. Und gerade für diese Branche könnte die<br />
Corona-Krise einen weiteren Schub bedeuten, denn digitale<br />
Lösungen und IT-Fachkräfte werden verstärkt nachgefragt.<br />
Mut zu neuen Geschäfts modellen, die schnell und unkonventionell<br />
umgesetzt werden, sowie ein flexibles Arbeitsumfeld<br />
sind erforderlich, um am Markt bestehen zu können.<br />
PRINZIP DER KURZEN WEGE<br />
ALS ERFOLGSFAKTOR<br />
Das Karlsruher Prinzip der kurzen Wege ermöglicht genau<br />
solche direkten Abstimmungsprozesse zwischen den Akteuren.<br />
Diese Stärke Karlsruhes ist zugleich ein Erfolgsfaktor bei der<br />
Bewerbung für den Landeswettbewerb Innovationspark KI<br />
Baden-Württemberg: Innerhalb weniger Wochen konnte auf<br />
dieser Grundlage, gemeinsam mit den Regionen Stuttgart und<br />
Neckar-Alb, ein KI-Gesamtkonzept erarbeitet, eine Genossenschaft<br />
ins Leben gerufen und eine beeindruckende Zahl an<br />
Unterstützern aus Karlsruhe und der Region gewonnen werden.<br />
GRÜNDUNGSSTANDORT:<br />
INNOVATIONEN VORANBRINGEN<br />
Die Karlsruher Hochschulen und Forschungseinrichtungen<br />
sind Innovationsmotoren und bilden das Fundament für eine<br />
lebendige Gründungskultur. Denn wo nachhaltig geforscht<br />
wird, können zukunftsweisende Ideen entstehen. Gründungswilligen<br />
steht in der Fächerstadt ein breites Beratungs-Netzwerk<br />
zur Verfügung.<br />
Ein aktuelles Leuchtturmprojekt ist das Gründungszentrum<br />
Smart Production Park für digitale Produktion, das an der<br />
Technologieachse in der Karlsruher Oststadt auf dem<br />
Hoepfner-Areal entsteht. An diesem neuen Ort der Möglichkeiten<br />
können Start-ups experimentieren, Kontakte herstellen<br />
und die moderne Infrastruktur nutzen. Die Stadt beteiligt<br />
sich mit 2,2 Mio. Euro, eine weitere Million steuert das Land<br />
Baden-Württemberg bei. Betrieben wird das Zentrum von der<br />
Wirtschaftsförderung Karlsruhe und dem CyberForum e.V.<br />
Das Thema Gründung spielt auch beim Aktionsprogramm<br />
Handwerk eine wichtige Rolle. Hier wird derzeit eine Bedarfsanalyse<br />
für ein Gründungszentrum Handwerk sowie ein<br />
Gewerbezentrum erstellt. Ebenfalls im Fokus: Nachwuchskräfte<br />
für das Handwerk zu begeistern. Darauf zielt die craft.<br />
ROADSHOW ab, die zusammen mit der Kreishandwerkerschaft<br />
Karlsruhe entwickelt wurde. Da das erfolgreiche Konzept<br />
derzeit corona-bedingt nicht vor Ort an den Schulen<br />
stattfinden kann, sind Infos über die craft.ROADSHOW-<br />
App und -Website abrufbar. Seit Beginn des Jahres wurden<br />
bereits mehrere Praktikumsanfragen über die App vermittelt.<br />
Um das Angebot weiter zu verbessern, wird es von der Pädagogischen<br />
Hochschule evaluiert.<br />
Foto @FC-Gruppe/Marquardt<br />
KREATIVPARK IN DER KRISE STABIL<br />
Die Nachfrage nach Räumen im Kreativpark Alter Schlachthof<br />
ist ungebrochen. Ende <strong>2021</strong> wird das Kreativwirtschaftszentrum<br />
für etablierte Firmen mit einem höheren Flächenbedarf<br />
von 150 bis 650 Quadratmetern eröffnen. Bis zum<br />
Herbst wird die Zahl der Arbeitsplätze im Kreativpark nochmals<br />
um 200 auf rund 1.200 steigen, die Zahl der Unternehmen<br />
und Institutionen von 150 auf rund 160. Darunter<br />
sind wachstumsstarke Firmen wie die netzstrategen mit<br />
inzwischen über 70 Beschäftigten. Auch das neue Gebäude<br />
der Verkehrsbetriebe Karlsruhe an der Durlacher Allee zieht<br />
junge Firmen auf Wachstumskurs an: Hier ist kürzlich das in<br />
Karlsruhe gegründete Unternehmen echobot mit fast 100<br />
Mitarbeitenden eingezogen.<br />
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT<br />
Mit dem Erwerb von Flächen und bebauten Grundstücken<br />
erweitert die Stadt Karlsruhe ihre Handlungsspielräume für<br />
eine strategische Gewerbeflächenentwicklung. Dazu übt<br />
die Stadt in vielen Fällen ihr Vorkaufsrecht aus, kauft aber<br />
auch am freien Markt. Allein im vergangenen Jahr wurden<br />
Im Nordosten Karlsruhes setzt der FC-Campus<br />
der FC-Gruppe neue Maßstäbe.<br />
nahezu 200 Mio. Euro investiert und u.a. das Pfizer-Areal im<br />
Nordosten sowie das Rotag-Areal im Westen der Stadt erworben.<br />
Das ermöglicht eine nachhaltige Wachstums- und<br />
Ansiedlungspolitik. Auch der Breitbandausbau zielt darauf ab,<br />
die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Karlsruhe zu erhöhen.<br />
MARKANTE STADTEINGÄNGE<br />
Große Fortschritte gibt es im Entwicklungsquartier Hauptbahnhof<br />
Süd: Am südlichen Stadteingang sind rund 27.000<br />
Quadratmeter Fläche neu entstanden. Im Sommer 2020<br />
bezogen der Internetanbieter 1&1 mit rund 1.800 Mitarbeitenden<br />
und die Deutsche Bahn mit 500 Beschäftigten<br />
die modernen Räumlichkeiten. Die Kantine im denkmalgeschützten<br />
Gebäude des ehemaligen Heizkraftwerks<br />
wurde im Frühjahr <strong>2021</strong> in Betrieb genommen.<br />
>><br />
22 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
23
Östlich der bereits errichteten Gebäude werden nun<br />
die Planungen für ein 18-stöckiges Hochhaus für Büros und<br />
temporäres Wohnen vorangetrieben.<br />
Die Entwicklung im Westen des Areals schreitet mit dem<br />
Abschluss des Architektenwettbewerbs des Kölner Projektentwicklers<br />
Kreer Development ebenfalls weiter voran: Der<br />
Sieger entwurf des Büros ASTOC Architekten überzeugte<br />
mit seinem qualitativ hochwertigen Gebäudeensemble mit<br />
breitem Nutzungsmix.<br />
An der Durlacher Allee eröffnete im Herbst 2020 das fünfstöckige<br />
IKEA-Einrichtungshaus in innenstadtnaher Lage. Das<br />
schwedische Möbelhaus legte viel Wert auf Nachhaltigkeit und<br />
investierte insgesamt 100 Mio. Euro. In direkter Nachbarschaft<br />
entsteht am Großmarkt ein siebenstöckiger Bürokomplex:<br />
Das Projekt „Carls Cube“, mit einem Investitionsvolumen von<br />
rund 30 Mio. Euro, wird künftig rund 9.000 Quadratmeter<br />
Fläche und Raum für 600 Beschäftigte bieten. Die Rastatter<br />
Niederlassung der Bauherrin Dreßler Bauträger GmbH wird<br />
hier einziehen, ebenso das städtische Marktamt.<br />
Im Nordosten Karlsruhes setzt der FC-Campus der FC-<br />
Gruppe neue Maßstäbe. Das Unternehmen, das selbst<br />
Baumaßnahmen plant und steuert, hat im Hinblick auf<br />
Nachhaltigkeit und New Work ein Best-Practice-Gebäude<br />
realisiert und Raum für 200 Arbeitsplätze geschaffen. Für<br />
Karlsruhe ist dies ein echter Gewinn, auch weil das 1999 hier<br />
gegründete Unternehmen damit wieder an seinen ursprünglichen<br />
Standort zurückkehrt.<br />
AUSGEZEICHNET:<br />
KARLSRUHE PUNKTET IN RANKINGS<br />
Dass Karlsruhe ein starker Wirtschafts-, Wissenschafts- und<br />
Innovationsstandort ist, zeigt erneut das Städteranking der<br />
Wirtschaftswoche: Karlsruhe belegt auch im Jahr 2020 eine<br />
gute Platzierung im oberen Drittel. Die Wirtschaftswoche<br />
verglich dazu 71 deutsche Großstädte in den drei Kategorien<br />
Niveau, Dynamik und Nachhaltigkeit.<br />
Als einzige deutsche Stadt ist Karlsruhe in der G20 Global<br />
Smart Cities Alliance vertreten. Das Weltwirtschaftsforum<br />
will hier unter suchen, wie Smart Cities ihre Standards<br />
gestalten. Die 35 ausgewählten Pionierstädte entwickeln<br />
Verfahren als Grundlagen für Kommunen weltweit.<br />
Für den neuen Smart City Index durchleuchtete der Digitalverband<br />
Bitkom 81 Städte. Karlsruhe schaffte es auf einen<br />
ausgezeichneten 5. Platz, in einer wichtigen Kategorie sogar<br />
auf Platz 1: In keiner anderen deutschen Großstadt ist die<br />
Verwaltung so smart.<br />
In der weltweiten Corona-Krise ist es derzeit für keinen<br />
Standort leicht, einen fruchtbaren Nährboden für Investitionen<br />
zu bieten. Jedoch wird die Stadt gemeinsam mit Wirtschaft<br />
und Wissenschaft weiter daran arbeiten, dass Karlsruhe<br />
seine Position als attraktives, zukunftsfähiges und innovatives<br />
Zentrum in einer leistungsfähigen Region ausbauen kann.
WIE DIGITAL<br />
KÖNNEN MESSEN<br />
WERDEN?<br />
1<br />
Fotos Messe Karlsruhe<br />
3<br />
Die Messe offerta lebt davon, dass Besucher in die Hallen der Messe Karlsruhe strömen und sich den ganzen<br />
Tag dort verweilen. Bei Fachmessen wie der IT-Trans oder der LEARNTEC stehen die Workshops und das<br />
Netzwerken im Mittelpunkt. Wie kann der Austausch mit dem Besucher gelingen, wenn analoge Messen nicht<br />
2<br />
1 IT-Trans per Livestream in die Welt, statt die<br />
Welt zu Gast in den Messehallen.<br />
2 Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe,<br />
blickt optimistisch in die Messe-Zukunft.<br />
3 Aus Messehallen wurde das Kreisimpfzentrum –<br />
Hallen stehen also nicht leer.<br />
stattfinden dürfen?<br />
Die art KARLSRUHE war die letzte Publikumsmesse, die<br />
2020 noch in der Messe Karlsruhe durchgeführt werden<br />
konnte und durfte. Dann kam der erste Lockdown und die<br />
Pforten der dm-Arena haben sich vorerst geschlossen.<br />
Ständig kamen neue Verordnungen, mal konnte die offerta<br />
im Herbst stattfinden, dann wieder nicht und schlussendlich<br />
wurde sie doch abgesagt. Schwere Zeiten für die Geschäftsführerin<br />
der Messe Karlsruhe, Britta Wirtz. „Anfangs war es<br />
ein dynamisches ‚von Tag zu Tag‘-Arbeiten, dann ein von Verordnung<br />
zu Verordnung-Arbeiten, alles ständig neu beurteilen<br />
und entscheiden“, sagt Britta Wirtz gegenüber dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
„Wir haben in gewohnt strukturierter Weise<br />
unsere Veranstaltungen vorbereitet bzw. Gastveranstaltungen<br />
begleitet – immer mit dem Blick auf das Pandemie-Geschehen<br />
und damit einhergehenden Deadlines und Go- oder No-<br />
Go-Entscheidungen.“<br />
Das Team der Messe habe stets versucht, das Mögliche möglich<br />
zu machen. Doch abgesagt ist abgesagt. Statt tatenlos<br />
zuzuschauen haben die Veranstalter der offerta, die jährlich<br />
über 140.000 Besucher anlockt, die Publikumsmesse in den<br />
digitalen Raum verlegt. „Wir haben die Plattform offerta.de<br />
gelauncht, wo sich offerta-Fans ganzjährig ausgewählte Produkte<br />
der Aussteller aussuchen können“, erklärt Wirtz. „Die<br />
Fachmesse LEARNTEC haben wir im Januar an ihrem angestammten<br />
Termin als einen dreitätigen digitalen Workshop<br />
angeboten. Die Resonanz war positiv: Fast 7.000 Interessierte<br />
hatten sich angemeldet.“<br />
Die Veranstalter haben in den schweren Pandemie-Monaten<br />
den Kontakt zum Besucher gesucht statt komplett zu schließen.<br />
„Wir haben viel Erfindungsreichtum in unsere Ideen und<br />
Formate gesteckt“, so Wirtz weiter. „Das ist ein besonderes<br />
Merkmal unseres Hauses.“<br />
Dabei ist für die Messelandschaft in Deutschland und in<br />
Karlsruhe nichts wichtiger als der direkte Kontakt zum Kunden<br />
oder zum Business. Digitale Nähe kann kaum entstehen,<br />
Netzwerken am Rande der Veranstaltung entfällt. „Die<br />
Pandemie hat der Digitalisierung einen großen Schub gegeben<br />
– und so waren auch wir Messe-Macher gefragt, digitale<br />
Formate auf Sinnhaftigkeit für unser Business zu prüfen. Die<br />
gemachten Erfahrungen zeigen, dass Wissenstransfer und<br />
Austausch sehr gut digital abzubilden sind und dadurch Reichweiten<br />
unserer Veranstaltungen noch erhöht werden können“,<br />
sagt die Messe-Chefin. „Jedoch ist tatsächliche Leadgenerierung<br />
für Aussteller in der virtuellen Welt schwierig, weshalb<br />
unsere Aussteller uns auch drängen, so bald wie möglich<br />
wieder analoge Veranstaltungen anzubieten.“<br />
Wann es so weit ist, dass wieder tausende Besucher durch<br />
die vier Hallen am Standort in Rheinstetten oder die<br />
Schwarzwaldhalle schlendern, ist ungewiss. Die Hoffnung<br />
von Britta Wirtz: Mitte des Jahres <strong>2021</strong> sollte das Geschäft<br />
wieder anlaufen. „Wir können aber nur dann veranstalten,<br />
wenn wir möglichst schnell Perspektiven durch die Politik<br />
aufgezeigt bekommen. Messen brauchen Vorlaufzeit und<br />
Planungssicherheit.“<br />
Schon im ersten Quartal <strong>2021</strong> steht fest, dass manche Messen<br />
auf 2022 verschoben werden. Das betrifft die INVENTA &<br />
RendezVino und die art KARLSRUHE. Absagen bedeuten<br />
finanzielle Einbußen, die die Messe Karlsruhe nicht mehr<br />
aufholen kann. „Der Branchenverband AUMA gibt einen<br />
Geschäftseinbruch von 70 Prozent an. Wir sind etwas glimpflicher<br />
davongekommen“, sagt Britta Wirtz. „Unser Umsatz<br />
ist ‚nur‘ um 50 Prozent eingebrochen. Das haben wir einem<br />
außergewöhnlich starken Start ins Jahr 2020 zu verdanken,<br />
der weit über dem Plan lag. So gesehen sind wir ganz gut<br />
durch das Corona-Jahr gekommen.“<br />
Ein Grund ist die Verlagerung in den digitalen Raum. Gänzlich<br />
digital können Messen jedoch nicht werden, oder doch? „Es<br />
wird sicher bei unterschiedlichen Formaten in der Veranstaltungswirtschaft<br />
Tendenzen zu rein digitaler Abbildung<br />
geben – ich kann mir hier kleinere Tagungen, Seminare oder<br />
Workshops vorstellen. Eine generelle Verdrängung analoger<br />
Veranstaltungen sehe ich aber nicht. Befragungen zeigen, dass<br />
Aussteller keine dauerhafte digitale Ausweichstrategie haben<br />
wollen.“ Messen werden auch keine aus dem Portfolio genommen,<br />
nur weil sie ein oder zwei Mal verschoben wurden.<br />
In Zukunft sollen wieder analoge Messen und Kongresse an<br />
den Standorten der Messe Karlsruhe durchgeführt werden.<br />
„Aber mit den Learnings aus der Zeit der Lockdowns. Das wird<br />
unser Angebot nachhaltig verbessern im Sinne der Kunden-<br />
Fokussierung“, so Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe<br />
Karlsruhe, abschließend.<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
26 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
27
Landau in der Pfalz -<br />
Einkaufsstadt und Südpfalzmetropole<br />
Anzeige<br />
Landau ist Lebensfreude!<br />
PREISJOJO<br />
WAS MACHT CORONA MIT DEN IMMOBILIENPREISEN?<br />
Wer kann, zieht in die Stadt. Also wer es sich leisten kann. Das Phänomen<br />
lässt sich schon viele Jahre beobachten. Corona hat da nur einen<br />
unwesentlichen Teil beigetragen, trotz das viele Menschen im Homeoffice<br />
arbeiten können. Wie verändert sich der Immobilienmarkt durch<br />
die Pandemie? Der <strong>Wirtschaftsspiegel</strong> im Gespräch mit einem Makler<br />
aus der TechnologieRegion.<br />
Unsere pulsierende Innenstadt bietet<br />
beste Bedingungen für ein ausgiebiges<br />
Shoppingerlebnis, das durch vielfältige<br />
kulinarische Angebote inmitten eines<br />
historischen Geschäftskerns gekrönt<br />
wird.<br />
MICHAEL HUST<br />
Seit über 16 Jahren ist der Diplom-<br />
Immobilienwirt in Karlsruhe mit<br />
seinem Unternehmen selbständig.<br />
Er und sein Team vermitteln<br />
Immobilien von Baden-Baden bis<br />
Bruchsal, Pforzheim bis Landau.<br />
Aktuell zählt sein Maklerbüro 14<br />
Mitarbeitende an vier Standorten<br />
in der Region.<br />
www.hust-immobilien.de<br />
Foto pexels.com /Jovydas Pinkevicius<br />
2020 war kein normales Jahr, auch<br />
nicht bei Michael Hust, Immobilienmakler<br />
aus Karlsruhe. „Im ersten<br />
Lockdown, also von März bis etwa Mai<br />
oder Juni, war es sehr ruhig bei uns,<br />
wir waren teilweise in Kurzarbeit. Doch<br />
seit dem Sommer lief das Geschäft<br />
wieder normal“, so Hust.<br />
Ein Jahr nach dem Beginn der<br />
Pandemie sieht der Immobilienmakler<br />
erste Veränderungen. „Die Leute<br />
werden vorsichtiger, gerade beim<br />
Verkauf von Immobilien ist es etwas<br />
ruhiger geworden.“<br />
Schon bei der Wirtschaftskrise 2008<br />
hat sich gezeigt: Auf dem Immobilienmarkt<br />
kommen die Auswirkungen<br />
erst später. So auch <strong>2021</strong>. Die Preise<br />
sinken teilweise leicht. „Einbrechen<br />
werden die Verkaufspreise jedoch<br />
nicht“, ist sich der Diplom-Immobilienwirt<br />
sicher.<br />
STADT NACH WIE VOR BELIEBT<br />
„Wer es sich weiterhin leisten kann,<br />
zieht in die Stadt – hier ist für viele<br />
Menschen mehr geboten, das macht<br />
die Stadt so attraktiv.“ Wer sein Geld<br />
lieber in ländlichen Gebieten investiert,<br />
bekommt fürs gleiche Geld aber<br />
kein Abrisshaus.<br />
„Da sind immer schöne Angebote<br />
dabei, nur eben günstiger, weil die<br />
Infrastruktur nicht für jeden Anspruch<br />
die richtige ist“, so Michael Hust<br />
gegenüber dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
MEHR ANGEBOT ALS<br />
NACHFRAGE<br />
Im Bereich der Gewerbeimmobilien,<br />
so Hust, sehe es schlechter aus. „In<br />
Karlsruhe wurde in den letzten Jahren<br />
viel Gebaut, hinter dem Hauptbahnhof<br />
zum Beispiel sind große Büroflächen<br />
entstanden. Das hat den Markt sehr<br />
durcheinandergewirbelt. Es gibt mehr<br />
Angebot als Nachfrage, das war schon<br />
vor Corona so – diese Flächen jetzt zu<br />
verkaufen ist schwerer als 2019.“<br />
DIGITALE EXPOSÉS<br />
Was der Makler der Krise abgewinnen<br />
konnte: Homeoffice für die Mitarbeitenden<br />
und mehr Online-Services. „Wir<br />
bieten schon seit Langem 3D-Besichtigungen<br />
an, das wird gut angenommen<br />
von unseren Kunden und das wird in<br />
Zukunft auch noch zunehmen“, ist sich<br />
Michael Hust sicher. „Die Interessenten<br />
möchten alle relevanten Infos vorab,<br />
uns spart das auch Zeit, denn durch den<br />
ersten Look weiß der Kunde bereits<br />
vorher, ob sich eine Besichtigung für ihn<br />
in Frage kommt.“ Voraussetzung dafür:<br />
Perfektes Bildmaterial, nicht nur Fotos,<br />
die aus einer Ecke mit dem Smartphone<br />
gemacht werden. „Das ist etwas mehr<br />
Aufwand, der sich lohnt. Der virtuelle<br />
Rundgang ersetzt aber niemals eine Besichtigung<br />
vor Ort“, so Hust gegenüber<br />
dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
Überzeugen Sie sich von dem Flair und<br />
der Vielfalt in unserer Stadt. Die seit<br />
Jahren wachsende Südpfalzmetropole<br />
lädt ein zum Shoppen, zum Genießen,<br />
zum Verweilen, zum Leben - wir freuen<br />
uns auf Sie!<br />
Gerne steht Ihnen die städtische Wirtschaftsförderung<br />
für Fragen rund um<br />
den (Wirtschafts-)Standort Landau zur<br />
Verfügung.<br />
www.unserlandau.app<br />
28 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
Stadtverwaltung Landau in der Pfalz<br />
Marktstraße 50, 76829 Landau in der Pfalz<br />
Fon 06341 13-2000<br />
info@landau.de<br />
www.landau I www.gewerbepark-landau.de
AUFBRUCH<br />
MIT DEM „KARLSRUHER<br />
WERKZEUGKOFFER“ ZUM<br />
RE-START<br />
DIE KARLSRUHE MARKETING UND EVENT<br />
GMBH KOORDINIERT ÖFFNUNGSSTRATEGIEN<br />
Steigende und fallende Infektionszahlen, Corona-Maßnahmen, die sich<br />
dadurch mitunter wöchentlich ändern, „Notbremse“, Vorgaben des<br />
Landes Baden-Württemberg, Beschränkungen: Doch auch in diesen<br />
Fotos Race Result; Andreas Arndt<br />
„Es ist eine schwierige Zeit – auch<br />
für die Planung“, betont KME-<br />
Geschäftsführer Martin Wacker,<br />
doch das mehrgleisige Planen sei in<br />
Kooperation mit den richtigen Partnern<br />
umsetzbar: „Wichtig ist, bei allen Veranstaltungen<br />
und Formaten aufzuzeigen,<br />
dass man auch in Zeiten der Pandemie<br />
mit Systemen und kluger Technologie<br />
etwas umsetzen und erreichen kann.“<br />
WELTWEIT BEACHTETES ZEICHEN<br />
Das INDOOR MEETING fand in<br />
diesem Jahr in der Karlsruher Europahalle<br />
als reines TV Meeting statt, hat<br />
aber ein weltweit beachtetes Zeichen<br />
gesetzt, dass solche Sport-Events auch<br />
in Zeiten der Pandemie funktionieren.<br />
Damit wurde auch der Ruf von Karlsruhe<br />
als innovative Sportstadt in die<br />
Welt getragen. „Das ging aber nur mit<br />
einem starken und engen Testsystem,<br />
IT-gestützten Prozessen und mit einem<br />
Transponder-System“, so Wacker.<br />
Über einen Badge, den jeder der über<br />
600 internationalen Teilnehmer und<br />
Mitwirkenden trug, konnte genau<br />
ermittelt werden, wer wo zu welcher<br />
Sekunde an welcher Stelle stand. Dazu<br />
sind die Systeme räumlich abgrenzbar,<br />
zeitlich abbildbar und auch vernetzt<br />
mit dem Gesundheitsamt: Hier setzen<br />
neue Technologien an, wie zum Beispiel<br />
die „Luca App“. Diese bildet, wie der<br />
Transponder, den Aufenthaltsort der<br />
Menschen mittels Mobiltelefonen ab.<br />
RE-START-SZENARIEN IM BLICK<br />
„Das sind Grundvoraussetzungen, mit<br />
denen wir uns in Sachen Öffnungsstrategien<br />
für Re-Starts bei Veranstaltungen<br />
beschäftigen“, so Wacker. Dass die<br />
KME mit ihren Partnern fundierte<br />
Expertisen in Sachen Sicherheit,<br />
Einlass- und Crowdmanagement hat,<br />
ist gerade in der aktuellen Situation<br />
sehr hilfreich. Schließlich geht bei<br />
Veranstaltungsplanung nichts über<br />
Erfahrungswissen – unterstützt auch<br />
durch Simulation zum Beispiel in Sachen<br />
Gehverhalten und Laufwege von<br />
Besuchern. „Wir haben PTV Viswalk<br />
um mehrere Funktionen erweitert, die<br />
erlauben, die besonderen Bedingungen<br />
einer Pandemie für Veranstaltungen zu<br />
berücksichtigen“, so Dr. Tobias Kretz,<br />
Chief Technical Product Manager bei<br />
der PTV Group aus Karlsruhe.<br />
Dazu kommt mit race result aus<br />
Pfinztal ein technischer Partner, der<br />
seine Kompetenz mit einem weiteren<br />
Sicherheitsfeature bei der Nachverfolgung<br />
ergänzend einbringt. Ob Track<br />
Box, Transponder oder Server: „Mit<br />
der Anwendung lassen sich Öffnungsstrategien<br />
geplant umsetzen“, erläutert<br />
Sascha Hornung, International Sales<br />
Manager von race result.<br />
Zudem wurde die erfolgreiche Umsetzbarkeit<br />
schon mehrfach bewiesen.<br />
Wichtig ist den Partnern dabei, dass<br />
technische Innovation aus der<br />
TechnologieRegion in die Prozesse<br />
implementiert wird. Diese wurde zum<br />
Beispiel auch erfolgreich eingesetzt bei<br />
der dezentralen Eröffnung des Marktplatzes<br />
mit der Tunnelbesichtigung, bei<br />
der 8.000 Menschen – entsprechend<br />
geleitet – in der neuen Haltestelle<br />
Marktplatz unterwegs waren.<br />
„KARLSRUHER WERKZEUG-<br />
KOFFER“ IM EINSATZ<br />
Schnelltests, Transponder-Technik,<br />
Zugangskriterien, „Luca App“: „Wir<br />
sehen das als eine Art ‘Karlsruher<br />
Werkzeugkoffer‘, der für Öffnungsstrategien<br />
einheitlich in allen Bereichen<br />
in der Stadt eingesetzt werden muss“,<br />
erläutert Wacker. Ob für Kulturelles,<br />
Sport und Jugend, Handel, Gastronomie<br />
oder Hotellerie – stets in Zusammenarbeit<br />
mit den zuständigen Stellen.<br />
Wenn die einzelnen Faktoren ineinandergreifen,<br />
kann das zu Öffnungsstrategien<br />
führen, ist sich der KME-Chef<br />
sicher: „Es ist eine herausfordernde<br />
Aufgabe, doch wir koordinieren diese<br />
Prozesse und stellen die nötigen<br />
Werkzeuge zur Öffnung bereit.“<br />
Denn genaues Tracking, Steuern<br />
und Nachverfolgen von Besuchern<br />
sind Voraussetzungen für mögliche<br />
Öffnungsschritte. Es wäre dann eine<br />
schrittweise Rückkehr zu einer ansatzweisen<br />
Normalität.<br />
www.karlsruhe-event.de<br />
Zeiten müssen die Experten der KME Karlsruhe Marketing und Event<br />
GmbH mit ihren Partnern planerische Weitsicht in Sachen Öffnungsstrategien,<br />
sichere Rahmenbedingungen und Hygienekonzepte zeigen.<br />
Foto XXX<br />
Foto XXX<br />
30 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
31
ZWISCHEN TRK<br />
UND SCHWARZWALD<br />
BAD HERRENALB IM BLICK<br />
Über 8.000 Einwohner zählt Bad Herrenalb, die Kurstadt vor den Toren<br />
der TechnologieRegion Karlsruhe ist alles andere als ein verschlafenes<br />
Dorf. Es tut sich was in diesem beschaulichen Städtchen am Ende des<br />
Albtals. Bürgermeister Klaus Hoffmann steht Rede und Antwort.<br />
Ruhig, idyllisch und malerisch liegt die<br />
Kleinstadt Bad Herrenalb im westlichen<br />
Nordschwarzwald. Jenseits<br />
der Grenzen der TechnologieRegion<br />
Karlsruhe (TRK) bildet das Örtchen die<br />
Schnittstelle zwischen den Landkreisen<br />
Karlsruhe und Calw. „Wir mögen eine<br />
politische Grenze sein, aber es gibt viele<br />
Verbindungen in die Rheinebene, die<br />
sichtbarste ist die Straßenbahn nach<br />
Ettlingen und Karlsruhe“, sagt Bürgermeister<br />
Klaus Hoffmann im Gespräch<br />
mit dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>. „Daher<br />
lohnt sich ein genauer Blick auf unsere<br />
schöne Stadt!“<br />
VIEL GESCHICHTE,<br />
VIELE ZUKUNFTSPLÄNE<br />
Auf das Jahr 1149 geht die Gründungsgeschichte<br />
des Klosters in Bad Herrenalb<br />
zurück und ist eine europäische<br />
Geschichte, denn die Mönche, die<br />
hier siedelten, kamen aus dem Elsass.<br />
„Wir haben eine spannende Historie,<br />
und wenn wir nach vorne blicken, dann<br />
sehen wir, dass sich die Stadt weiterentwickeln<br />
wird.“ Bad Herrenalb hat<br />
viel vor, um weiter zu wachsen. Schon<br />
optisch hat sich die Kurstadt verändert,<br />
der Startschuss dazu fiel mit der kleinen<br />
Landesgartenschau im Jahr 2017. „Wir<br />
haben prognostiziert, dass wir in den<br />
nächsten zehn Jahren weiterhin ein Bevölkerungswachstum<br />
erleben werden –<br />
langsam, aber sicher wächst die Stadt“,<br />
so der Bürgermeister weiter. „Vor ein<br />
paar Jahren haben wir ein Neubaugebiet<br />
erschlossen, da gibt es noch ein<br />
freies Grundstück, daher machen wir<br />
den Weg frei für mehr Wohnraum.<br />
Deswegen haben wir ein Grundstück<br />
in der Kernstadt verkauft, das Lacher-<br />
Carré. Hier werden 25 Wohneinheiten<br />
errichtet.“<br />
Insgesamt sollen auf drei ehemals städtischen<br />
Flächen knapp 75 Wohnungen<br />
entstehen. „Wir schauen zudem in den<br />
Ortsteilen nach Baufläche, denn der<br />
Druck aus den Großstädten ist da, die<br />
Menschen suchen Wohnraum.“<br />
Foto Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb<br />
Damit sich vor allem Familien und Jüngere<br />
niederlassen, richtet die Stadt einen<br />
neuen Kindergarten ein. „Der alte<br />
Kindergarten war in die Jahre gekommen,<br />
deswegen gibt es einen Neubau.<br />
Ich gehe davon aus, dass wir noch mehr<br />
Plätze anbieten müssen, deswegen<br />
sind wir schon jetzt auf der Suche nach<br />
einem geeigneten Ort für eine weitere<br />
Kindertagesstätte“, sagt Hoffmann.<br />
Die Stadt am Rande des Schwarzwaldes<br />
hat in den letzten Jahren einen großen<br />
Schub nach vorne gemacht, sehr zur<br />
Freude des Bürgermeisters.<br />
AUFBRUCHSTIMMUNG<br />
Bad Herrenalb befindet sich in einem<br />
<strong>Aufbruch</strong>, viele Veränderungen sind<br />
bereits erfolgt oder in Planung. „Wir<br />
stecken mitten im Stadtentwicklungsprozess,<br />
den wir im Sommer 2020<br />
gestartet haben“, so Hoffmann. Dafür<br />
wurde im März eine Bürgerbeteiligung<br />
gestartet, zunächst schriftlich. „Corona<br />
lässt einen Info-Abend oder Workshop<br />
nicht zu, aber wir möchten nicht länger<br />
warten, sondern Ergebnisse erzielen<br />
und vorankommen.“<br />
Die Themen auf der Agenda: Gesundheit,<br />
Klosterkultur und Innovation sowie<br />
Wohnraum. „Der Gemeinderat hat die<br />
Entscheidung getroffen, in die Therme<br />
zu investieren, die feiert in diesem Jahr<br />
das 50-jährige Bestehen. Dann kümmern<br />
wir uns um ein Nahwärmekonzept<br />
in der Stadt, um Energie zu sparen und<br />
um ein Entwicklungskonzept für das<br />
Kloster. In all diesen Bereichen wollen<br />
wir innovativ sein und uns entwickeln“,<br />
erklärt Klaus Hoffmann im Gespräch<br />
mit dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
STÄRKEN<br />
Mit dem Stadtentwicklungskonzept<br />
möchte die Stadtverwaltung die Stärken<br />
der Kleinstadt herausstellen. Bisher<br />
mit großem Erfolg.<br />
Zur TechnologieRegion und dem Landkreis<br />
Karlsruhe hat die Kurstadt eine<br />
feste Verbindung. „Die größte Verbindung<br />
ist die offensichtlichste“, sagt<br />
Hoffmann und ergänzt: „Die Straße<br />
und die Bahn raus aus dem Albtal runter<br />
in die Rheinebene. Außerdem sind<br />
wir Partner der Initiative Breitbandkabel<br />
Landkreis Karlsruhe. Es gibt also<br />
direkte Verbindungen in die TRK.“<br />
Der Wunsch des Bürgermeisters: Dass<br />
diese Zusammenarbeit noch weiter<br />
intensiviert wird. „Der Landkreis Karlsruhe<br />
hört nicht hinter Marxzell auf,<br />
sondern dahinter ist noch was – Bad<br />
Herrenalb“, sagt er und lacht. „Wir sind<br />
kein verschlafener Ort, sondern hier<br />
tut sich mächtig was. Wir sind nicht<br />
nur touristisch reizvoll, sondern auch<br />
für Investoren“, so Klaus Hoffmann<br />
abschließend.<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
32 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
33
DIE KRISE<br />
ALS CHANCE<br />
1<br />
2<br />
3<br />
AUFBRUCH IN EINE NEUE,<br />
NACHHALTIGE ARBEITSWELT<br />
Das Corona-Virus hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt und inzwischen ist klar: ein „Weiterso“ wie vor<br />
der Pandemie wird es nicht geben. In vielen Unternehmen hat ein Umdenken stattgefunden. Sie begreifen<br />
die Krise als Chance und sind offen für Veränderung. Ein Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft.<br />
Fotos/Visualissierungen Vollack Gruppe<br />
1 Vollack realisiert Bürogebäude in Holzhybrid-Bauweise<br />
(Visualiserung generic.de).<br />
2 Arbeitswelten haben viele Facetten: offene Flächen für<br />
Kollaborationen (Visualierung Stadtwerke) und ...<br />
3 Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten<br />
oder Videokonferenzen (Vollack Passivhaus im Kreativpark).<br />
Werden wir in der Welt von morgen nur noch zu Hause arbeiten?<br />
Werden Büros verschwinden? Schon heute wissen wir:<br />
Die Arbeitswelt ist zu komplex, als dass es die eine Antwort<br />
auf alle Fragen geben könnte. Auch wenn das Homeoffice Teil<br />
unseres Arbeitsalltags bleiben wird – das Büro stirbt nicht aus,<br />
und zudem gibt es eine Fülle von Tätigkeiten, die gar nicht in<br />
Büros erbracht werden. Doch eine Kernfrage hat sich vor dem<br />
Hintergrund der Pandemie tatsächlich herauskristallisiert: Was<br />
müssen Gebäude leisten, damit sich Menschen (wieder) gerne<br />
dort aufhalten?<br />
Für das neue Normal in der Arbeitswelt gilt: Ein Patentrezept<br />
für den perfekten Arbeitsplatz gibt es nicht. Zukunftsweisende<br />
Arbeitswelten sind so vielfältig wie die Aufgaben und<br />
Prozesse innerhalb der Organisation und sollten die jeweilige<br />
Unternehmenskultur widerspiegeln. Für Vollack als Experte für<br />
methodische Gebäudekonzeption bestätigt sich in der Krise die<br />
Haltung, dass Arbeitswelten in intensiver Zusammenarbeit mit<br />
dem Bauherrn konzipiert werden müssen – individuell an seiner<br />
Strategie, seinen Bedarfen und Prozessen ausgerichtet.<br />
PLANEN UND BAUEN MIT METHODE<br />
„Die Zukunftserwartung und -vision unserer Kunden ist für uns<br />
auch weiterhin der Motor für die Planung und Konzeption ihrer<br />
neuen oder veränderten Arbeitswelt. Mit künftigen Bauherren<br />
sprechen wir darum erst einmal nicht übers Bauen, sondern<br />
über ihre Zukunftsstrategie“, sagt Reinhard Blaurock,<br />
Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe.<br />
Maßgeschneiderte Gebäudelösungen entstehen bei Vollack<br />
nach der eigenen Methode und als „Design + Build“. Die Kompetenz<br />
der Generalplanung und der Bauausführung ergänzen<br />
sich und wie so oft ist das Ganze mehr als die Summe seine<br />
Teile. Projekte werden von Anfang an kundenindividuell, qualitativ<br />
hochwertig, termin- und kostensicher geplant. In Corona-<br />
Zeiten beweist sich die Methodenkompetenz umso mehr, weil<br />
Arbeitswelten individuell und in hohem Maße wandlungsfähig<br />
sein müssen. Vollack Kunden wissen unter Umständen heute<br />
noch nicht, was ihre Kunden oder auch die Erfordernisse der<br />
Umwelt morgen von ihnen erwarten. Damit Unternehmen<br />
schnell auf geänderte Anforderungen reagieren können,<br />
müssen Büros, Industrie- und Gesundheitsimmobilien flexibel<br />
angepasst werden können.<br />
GEBÄUDE ALS ERLEBNIS-, RÜCKZUGS-<br />
UND SCHUTZRAUM<br />
Die Digitalisierung schafft es, Menschen an verschiedenen<br />
Orten miteinander zu verbinden – Kreativität und Stimulanz<br />
entstehen aber ganz besonders dort, wo sich Menschen physisch<br />
treffen. In einer Zeit, in der die Gebäude teilweise menschenleer<br />
geworden sind, rücken die Menschen noch stärker in<br />
den Mittelpunkt. Die Arbeitswelt wird sich daher künftig noch<br />
mehr mit den Bedürfnissen ihrer Nutzer beschäftigen: Wer<br />
konzentriert arbeiten oder an einer Videokonferenz teilnehmen<br />
möchte, braucht Rückzugsmöglichkeiten. Gleichzeitig muss<br />
es offene Flächen geben, die Platz für Kollaboration, spontane<br />
Begegnungen, Kommunikation und kreativen Austausch bieten.<br />
Manche Flächen werden also nicht kleiner, sondern großzügiger<br />
werden. Und Arbeitswelten werden hochflexibel, also jederzeit<br />
veränderbar, sein. So können sie beispielsweise im Fall einer<br />
Pandemie schnell umgestaltet werden, um Produktivität zu<br />
sichern. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat sich auch<br />
das Bedürfnis nach Sicherheit am Arbeitsplatz verstärkt: Arbeitswelten<br />
müssen für Gesundheit und Wohlbefinden sorgen.<br />
NACHHALTIGKEIT IM FOKUS<br />
Das Umdenken in vielen Unternehmen ist mit einem verstärkten<br />
Umweltbewusstsein und dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit<br />
verbunden. Das gilt auch, wenn Firmen in ihre Gebäude<br />
investieren. Insbesondere mittelständische Unternehmen<br />
benötigen die bestmögliche Immobilie nicht nur zum Zeitpunkt<br />
der Schlüsselübergabe, sondern über den gesamten Lebenszyklus<br />
des Gebäudes hinweg. Sie sind nachfolgenden Generationen<br />
verpflichtet und brauchen enkeltaugliche Investments. Mehrere<br />
energieeffiziente Gebäude und zertifizierte Passivhäuser unterstreichen,<br />
dass Vollack gemeinsam mit seinen Kunden nachhaltig<br />
in die Zukunft denkt. Ein aktuelles Beispiel ist die neue<br />
Arbeitswelt für den IT-Dienstleister generic.de im Karlsruher<br />
Stadtteil Neureut. Hier entsteht ein Bürogebäude in fortschrittlicher<br />
Holzhybrid-Bauweise. Es ist energetisch optimiert<br />
und wird im Passivhaus-Standard errichtet. Neu bauen muss<br />
jedoch nicht immer sein: Für viele Unternehmen, die ihre Arbeitswelt<br />
verändern möchten, lohnt es sich, über die Revitalisierung<br />
ihrer Immobilie nachzudenken. Im Auftrag der Stadtwerke<br />
Karlsruhe plant Vollack derzeit die energetische Sanierung eines<br />
1976 errichteten Bürohauses. Das viergeschossige Hauptgebäude<br />
mit zweigeschossigem Anbau wird vollständig entkernt.<br />
Die freigewordenen Flächen gestalten die Gebäudeexperten<br />
als innovative, flexible Arbeitswelten um. Künftige Mieter sind<br />
insbesondere Gründer und junge Unternehmen. Einen Teil der<br />
Räume werden die Stadtwerke Karlsruhe selbst nutzen. Das<br />
Technologieunternehmen Starface wird 2022 ebenfalls in einer<br />
revitalisierten Bestandsimmobilie in Karlsruher Innenstadtlage<br />
eine neue Arbeitswelt beziehen. Nachhaltiges Bauen heißt<br />
allerdings nicht nur, ökologische Materialien einzusetzen und<br />
eine möglichst positive Energiebilanz zu erzielen, sondern auch<br />
ein gesundes, behagliches Umfeld zu schaffen, in dem Menschen<br />
gern arbeiten.<br />
Reinhard Blaurock: „Die Corona-Krise bedeutet Veränderungen,<br />
bietet Chancen und sorgt in vielen Unternehmen für eine<br />
positive <strong>Aufbruch</strong>stimmung. Wir bei Vollack verstehen das als<br />
Ansporn, das neue Normal für unsere Kunden in Gebäudesprache<br />
zu übersetzen. Die richtige Zeit für den <strong>Aufbruch</strong> in<br />
eine neue, nachhaltige Arbeitswelt ist jetzt.“<br />
Arbeitswelten live zeigt der Vollack-Film<br />
„Perspektiven“ auf YouTube.<br />
VOLLACK GRUPPE<br />
www.vollack.de<br />
34 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
35
AUFBRUCH<br />
GANZ NACKT?<br />
Aufklärungsunterricht, 5. Klasse, Gymnasium. Nach der<br />
Stunde stolzieren mein Kumpel Wigbert und ich weltmännisch<br />
durch die Pausenhalle: „Ganz nackt?! Nee, dann<br />
mach ich das nicht!“<br />
Foto stock.adobe.com – Lilanakani<br />
Mittlerweile sind wir deutlich älter geworden und<br />
jeder von uns hat Kinder, was beweist: Man kann<br />
sich mit der Zeit auch an die vermeintlich abstrusesten<br />
Dinge gewöhnen und womöglich sogar etwas Angenehmes<br />
dabei empfinden.<br />
Vor einem Jahr noch glaubten wir, die Welt würde untergehen,<br />
wenn Geschäfte und Kultureinrichtungen für ein paar Wochen<br />
geschlossen werden würden. Wir hofften auch glauben zu dürfen,<br />
dass das Virus ein Einsehen hätte und sich ab Ostern 2020 wieder<br />
ausschließlich den Fledermäusen widmen würde.<br />
Ein bekannter deutscher Zukunftsforscher veröffentlichte seine<br />
beinah romantische Version, wie im Herbst desselben Jahres der<br />
Rückblick auf die Pandemie sein könnte. Leider hatte er sich<br />
einmal mehr deutlich geirrt.<br />
Und dann Weihnachten – bleiben wir beim Beispiel mit dem Aufklärungsunterricht<br />
– das ganze Jahr über Safer Sex, weil es sicherer<br />
ist, nur Weihnachten, da lassen wir die Lümmeltüte weg, ist doch<br />
schöner! Das Christuskind wird’s schon richten!<br />
Hat es aber nicht. Wieder verrechnet. Genau wie beim Ordern<br />
von Masken, Schnelltest, Impfstoff und Hilfen für gefährdete<br />
Unternehmer. Was anfangs wie ein guter Plan anmutete<br />
endete im Fiasko und mit dem Gesichtsverlust der Marke<br />
„Made in Germany“. Statt mal fünfe grade sein zu lassen und sich –<br />
wie im wirklichen Leben – mit dem kleineren Übel zufrieden<br />
zu geben, demokratisieren wir uns einen Wolf und fürchten die<br />
Menschen, die seit März 2020 verkünden, wir würden in einem<br />
totalitären Regime leben. Kultusministerien schaffen es nicht<br />
binnen von 6 Monaten ein wirklich funktionierendes einheitliches<br />
Bildungssystem auf die Beine zu stellen, dass wirklich alle Schüler<br />
und alle Lehrer mitnimmt. Stattdessen nimmt der ein oder andere<br />
Politiker was mit, weil die Gelegenheit bekanntlich Diebe macht.<br />
Vor einem Jahr noch war ich begeistert, wie leichtgängig sich<br />
unser Staat als riesiger Dampfer in den tosenden Gewässern bewegt.<br />
Heute scheint es eher, als hätte man dem Smutje das Steuer<br />
überlassen, der übt halt noch, und wir resümieren: Politiker sind<br />
eben keine Projektmanager. Hätte man wissen müssen, wollte aber<br />
wohl keiner hören.<br />
Derweil tun sich neue Formen der Kommunikation auf, Start-ups<br />
gründen sich mit innovativen Ideen und Corona im angenehmen<br />
Nebeneffekt hat der Digitalisierung und der Klima-Sensibilität<br />
in Deutschland einen gewaltigen Boost verschafft, der sonst wohl<br />
noch zig Jahre hätte auf sich warten lassen. Also blicken wir positiver<br />
und neugieriger in die Zukunft, als Wigbert und ich damals:<br />
„Ganz nackt? Wer weiß, wofür das gut ist!“<br />
ANDREAS LÜTKE www.wvs.de<br />
36 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
37
AUFBRUCH<br />
WELTWEIT<br />
VERNETZT<br />
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN IN DER TRK<br />
Entre Rios, Sha’ar Hanegev, Cyeru, Nottingham. Wenn wir schon nicht reisen<br />
können, blicken wir wenigstens in die Ferne. Die TechnologieRegion Karlsruhe ist<br />
durch Städtepartnerschaften in der ganzen Welt vernetzt.<br />
Foto pexels.com/Anna Shvets<br />
Eines hat die Pandemie mehr als<br />
deutlich gezeigt: Ländergrenzen allein<br />
halten ein Virus nicht auf. Ein Grund<br />
mehr, grenzübergreifend zusammenzuhalten.<br />
Die TechnologieRegion<br />
Karlsruhe (TRK) pflegt Kontakte in<br />
der ganzen Welt. Partnerschaften gibt<br />
es nicht nur mit den direkt angrenzenden<br />
Nachbarn wie dem Elsass, das seit<br />
2020 Mitglied der TRK ist, sondern<br />
unter anderem auch mit Städten und<br />
Gemeinden in England, Brasilien,<br />
Israel und Ruanda.<br />
BREXIT? GAR KEIN THEMA<br />
2019 feierten Karlsruhe und Nottingham<br />
„Goldene Hochzeit“: Seit 50<br />
Jahren sind die beiden Städte schon<br />
Partner. Bei dem Jubiläums-Treffen<br />
waren Stadtplanung und Klimawandel<br />
wichtige Themen. Nottingham arbeitet<br />
daran, bis 2028 klimaneutral zu werden<br />
und experimentiert mit Energie-,<br />
Mobilitäts- und digitalen Lösungen,<br />
um dieses Ziel zu erreichen. Zudem<br />
steht die Überlegung im Raum, ein<br />
gemeinsames Medizinstudienangebot<br />
Karlsruhe-Nottingham zu schaffen.<br />
Einigkeit herrscht außerdem beim<br />
Thema Brexit: Dieser spielt für die<br />
Partnerschaft der beiden Städte keine<br />
Rolle. Die Freundschaft der beiden<br />
Städte werde er jedenfalls nicht beeinträchtigen.<br />
„Wir werden an dieser<br />
Freundschaft festhalten, ja, sie gar<br />
vertiefen, ganz gleich, wer hier wen<br />
verlässt“, sagte Oberbürgermeister<br />
Dr. Frank Mentrup anlässlich des 50-<br />
jährigen Jubiläums.<br />
Auch Corona wird daran nichts ändern,<br />
im Gegenteil. Im Dezember 2020<br />
haben das Jugendorchester Stadt<br />
Karlsruhe e.V. zusammen mit dem<br />
Robin Hood Youth Orchestra an dem<br />
digitalen Weihnachtskonzert „Christmas<br />
in the City“ teilgenommen.<br />
Die Jugendlichen sind schon seit<br />
vielen Jahren durch die Musik miteinander<br />
verbunden.<br />
ENTRE RIOS:<br />
FACHWERK UNTER<br />
BRASILIANISCHER SONNE<br />
Im Süden Brasiliens, im Bundesstaat<br />
Paraná, liegt der Distrikt Entre Rios.<br />
Er umfasst fünf Dörfer mit knapp<br />
9.000 Einwohnern. Rund ein Drittel<br />
der Bevölkerung ist donauschwäbischer<br />
Abstammung. Im Zuge der<br />
Nachkriegswirren verließen etwa<br />
500 Familien das Gebiet im heutigen<br />
Ungarn, Rumänien und Jugoslawien,<br />
um in Brasilien eine neue Heimat zu<br />
finden. So kommt es, dass Fachwerkhäuser<br />
die Architektur der Gegend<br />
prägen. Es gibt einen deutschsprachigen<br />
Radiosender, der die Gemeinde<br />
mit überwiegend volkstümlicher<br />
Musik, Lokalnachrichten und Wissenswertem<br />
zu Tradition und Brauchtum<br />
versorgt.<br />
Seit 1988 besteht eine Partnerschaft<br />
zu Rastatt. Der Kontakt kommt über<br />
die Donauschwaben zustande, die sich<br />
in Rastatt niedergelassen hatten.<br />
Bei den Feierlichkeiten anlässlich<br />
des 30-jährigen Bestehens der<br />
Freundschaft 2018 zeigte die donauschwäbische<br />
Trachtentanzgruppe der<br />
deutschen Delegation um Oberbürgermeister<br />
Hans Jürgen Pütsch<br />
wie donauschwäbisch-brasilianisch<br />
gefeiert wird.<br />
Coronaschutzmaßnahmen traf der<br />
Gesamtbezirk Guarapuava wesentlich<br />
früher als der Rest Brasiliens. Es<br />
herrscht Mundschutzpflicht und die<br />
Schulen sind seit März 2020 geschlossen.<br />
In Entre Rios findet jedoch<br />
Online-Unterricht statt.<br />
ZWISCHEN KRISENBE-<br />
WÄLTIGUNG UND KULTUR-<br />
AUSTAUSCH<br />
Seit fast 30 Jahren verbindet den<br />
Landkreis Karlsruhe eine Partnerschaft<br />
mit Sha‘ar Hanegev in Israel. Die Region<br />
nordöstlich des Gazastreifens ist<br />
wirtschaftlich und infrastrukturell gut<br />
vernetzt. Die Verwaltungen beider Regionen<br />
stehen in regem Austausch und<br />
profitieren in gemeinsamen Projekten<br />
voneinander.<br />
2012 wurde das Projekt „Umgang mit<br />
Krisen im internationalen Vergleich“<br />
zum Thema Bevölkerungsschutz<br />
mit der „Medaille für Internationale<br />
Zusammenarbeit“ des Deutschen<br />
Feuerwehrordens ausgezeichnet. Das<br />
israelische Gebiet war in der Vergangenheit<br />
mehrfach das Ziel von<br />
Raketenangriffen geworden. Bevölkerungsschutz<br />
spielt dort daher eine<br />
zentrale Rolle. Das Projekt zeigte die<br />
unterschiedlichen Erfahrungen und<br />
Herangehensweisen in Krisensituationen<br />
auf, wovon beide Seiten profitierten.<br />
Der aktuelle Themenschwerpunkt<br />
liegt auf Schule und Bildung.<br />
Der „Deutsch-Israelische Freundeskreis<br />
im Stadt- und Landkreis<br />
Karlsruhe“ bietet mit regelmäßigen<br />
Vorträgen, Seminaren und Gesprächsstunden<br />
Einblick in die israelische Politik,<br />
Geschichte und Kultur. Außerdem<br />
findet seit 1996 jährlich ein deutschisraelischer<br />
Jugendaustausch statt, der<br />
in den drei Schulen des Beruflichen<br />
Bildungszentrums Ettlingen fest verankert<br />
ist.<br />
TATEN STATT WORTE: SOZIALES<br />
ENGAGEMENT IN RUANDA<br />
Die Partnerschaft zwischen dem<br />
Landkreis Südliche Weinstraße und<br />
der Gemeinde Cyeru in Ruanda >><br />
38<br />
39
Carina Harders<br />
Elektronikerin<br />
HA Car<br />
Ele<br />
Foto LRA KA Foto Heimatmuseum Entre Rios<br />
1<br />
3<br />
Foto Fränkle<br />
>> besteht schon seit 1985.<br />
Inzwischen wurde aus Cyeru der<br />
Distrikt Burera, der sich in 17 Sektoren<br />
aufteilt. Fünf dieser Sektoren<br />
sind offizielle Partner des Landkreises.<br />
Das Engagement reicht jedoch über<br />
die Sektorgrenzen hinaus. Es werden<br />
Schulen und Krankenstationen gebaut,<br />
Witwen, Waisen und sozial Schwache<br />
unterstützt.<br />
Zum 35-jährigen Jubiläum der Partnerschaft<br />
2020 begann der Bau von<br />
zehn Häusern, um Batwa-Familien ein<br />
neues Zuhause zu geben. Geplant war<br />
außerdem, die Partnerschaft anlässlich<br />
des Jubiläums ins Zentrum des Kreisempfanges<br />
der Südlichen Weinstraße<br />
zu stellen. Dies musste aufgrund der<br />
Pandemie ausfallen. „Wir wollten<br />
damit auf die Partnerschaft aufmerksam<br />
machen, um weitere Mitstreiter<br />
für die Vereinsarbeit zu gewinnen“,<br />
erklärt Landrat Dietmar Seefeldt.<br />
Der Freundschafts- und Förderkreis<br />
Cyeru/Ruanda e.V. engagiert sich seit<br />
Beginn der Partnerschaft intensiv in<br />
2<br />
1 Siedlerchor der Donuaschwäbischen-Brasilianischen<br />
Kulturstiftung in Rastatt.<br />
2 Baumpflanzaktion der badischen Delegation in<br />
Sha‘ar Hanegev, Israel.<br />
3 Geschenk aus GB: Einen grünen Robin Hood in Vogelform aus<br />
Nottingham zum 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft.<br />
dem Gebiet. Dabei sind auch echte<br />
Freundschaften entstanden. Bei<br />
Besuchen in Ruanda wird gemeinsam<br />
gelacht, gefeiert und getanzt. Zum<br />
Beispiel weil die letzte Sandflohplage<br />
überstanden ist oder einfach nur so.<br />
KONKURRENTEN NUR BEIM<br />
SPORT: CONDEIXA-A-NOVA<br />
UND BRETTEN<br />
Seit 1985 besteht die Partnerschaft<br />
zwischen der portugiesischen Kleinstadt<br />
Condeixa und Bretten. Einmal<br />
im Jahr wird eine Konferenz der Partnerstädte<br />
veranstaltet, verbunden mit<br />
einem internationalen Jugendtreffen,<br />
bei dem je zehn Jugendliche ihre Stadt<br />
vertreten.<br />
Ein anderer Anknüpfungspunkt, bei<br />
dem es auch mal laut werden darf, ist<br />
der Sport. Die beiden Fußballvereine<br />
SV Kickers Büchig und der JDR-<br />
Arziale Coimbra Condeixa-a-Nova<br />
pflegen eine enge Beziehung, die,<br />
wenn man sich trifft, auch in spontanen<br />
Freundschaftsspielen gipfeln kann<br />
– inklusive portugiesischer Tanzeinlage<br />
während der Halbzeitpause.<br />
Aufgrund der aktuellen Situation<br />
musste das alles 2020 ausfallen.<br />
Vertreter der einzelnen Städte kamen<br />
jedoch online im kleinen Kreis zusammen<br />
und tauschten sich aus.<br />
Portugal wurde von der Pandemie<br />
besonders schwer getroffen. Impfungen<br />
sind angelaufen, die Gemeinde<br />
verteilt Masken und unterstützt<br />
bedürftige Familien mit Essen.<br />
„Die Coronapandemie hat uns vor<br />
Augen geführt, wie sehr wir alle über<br />
Ländergrenzen hinaus miteinander<br />
verbunden sind. Gerade in solch<br />
schwierigen Zeiten, ist es wichtig füreinander<br />
da zu sein. Deshalb bleiben<br />
wir weiter in engem Kontakt mit unseren<br />
Partnerstädten und stehen ihnen<br />
über die Distanz hinweg unterstützend<br />
bei“, so Brettens Oberbürgermeister<br />
Martin Wolff.<br />
„EIGENTLICH<br />
WOLLTE ICH SCHAU-<br />
SPIELERIN WERDEN!“<br />
„ZU STARRE<br />
VORSTELLUNGEN<br />
VERSPERREN DEN<br />
BLICK AUF CHANCEN“<br />
NATALIE LUMPP<br />
Weinexpertin, Autorin und Sommelière<br />
HANS BRETZ<br />
Unternehmer<br />
Foto Klaus H. Damasko<br />
Was macht Ihren Job zum schönsten Job der Welt?<br />
Als Weinexpertin habe ich eigentlich fast ausschließlich mit<br />
Genussmenschen zu tun – und ich sage Ihnen, die sind immer<br />
sympathisch! Zudem darf ich zu normalen Zeiten weltweit viel<br />
reisen – so war ich schon in jeder Weinregion der Welt – bis auf<br />
Rumänien und Israel… und last but not least - ich darf immer<br />
wieder wunderbare Weine und exzellentes Essen genießen!<br />
<strong>Aufbruch</strong> in eine neue Zeit - was hat sich oder was wird sich<br />
durch die Corona-Krise für Sie verändern?<br />
Wie bei so vielen anderen war die größte Umstellung, jetzt<br />
komplett von zu Hause aus zu arbeiten. Statt Events zu moderieren,<br />
mache ich jetzt zwischen drei und fünf virtuelle Weinproben<br />
pro Woche – von zu Hause aus. Ich gestehe, ich finde es nicht<br />
unangenehm – es hat auch viele Vorteile. Zudem wurde mir im<br />
ersten Lockdown ein wirklich tolles, neues Projekt angeboten, das<br />
ist wirklich sehr spannend!<br />
Woher schöpfen Sie Kraft, was sind Ihre Energiequellen, wenn<br />
Sie den Weg aus der Krise gehen müssen?<br />
Seien wir ehrlich – nur steil bergauf kann es im Leben nicht immer<br />
gehen. Durch Rückschläge weiß man das Positive wieder umso<br />
mehr zu schätzen, und man wird auch wieder geerdet. So muss<br />
man auch Rückschläge zu schätzen wissen. Seit vielen Jahren<br />
helfen mir die „drei G’s – ganz – gerne – gleich“ – mit dieser<br />
Strategie fahre ich seit vielen Jahren hervorragend!<br />
Von welchem Beruf haben Sie als Kind immer geträumt?<br />
Da mein Papa Opernsänger am Freiburger Stadttheater war, bin<br />
ich dort auch groß geworden. Am Stadttheater hatte ich zwölf<br />
Jahre klassisches Ballett getanzt, Stepptanz und Klavier spielen<br />
gelernt. Ursprünglich wollte ich Schauspielerin werden. Schon sehr<br />
früh habe ich die Faszination des Weins für mich entdeckt. Bei<br />
meinen Eltern durfte ich immer mal wieder am Weinglas nippen,<br />
und hatte schnell festgestellt, dass jeder Wein anders schmeckt.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder<br />
würden Sie mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Meine größte Bewunderung gilt immer den Menschen, die etwas<br />
bewirkt haben – etwas für andere Menschen geschaffen haben<br />
oder etwas Nachhaltiges bewirkt haben. Ich bin großer Fan von<br />
Hans Bretz! Wenn ich etwas von ihm erlernen kann, dann etwas<br />
zu schaffen, wovon viele Menschen profitieren können – und dass<br />
alles auch noch in der Verbindung mit Genuss.<br />
Haben Sie auch das Gefühl, dass wir immer häufiger mit<br />
Krisen (Coronakrise, Wirtschaftskrise) konfrontiert werden?<br />
Wenn man keinen Kompass hat, machen solche Einflüsse nervös<br />
und schränken ein.<br />
Was sind Ihre Energiequellen, wenn Sie den Weg aus der<br />
Krise gehen müssen?<br />
Wenn man sich zutraut, dass man alles schafft, regeneriert man<br />
seine Kräfte.<br />
<strong>Aufbruch</strong> in eine neue Zeit - was hat sich durch die<br />
Corona-Krise für Sie verändert?<br />
Diese Krise ist schon lästig und es haben sich einige „großartige<br />
Akteure“ kräftig profiliert und/oder blamiert.<br />
Die Ruhe vor dem Sturm: Wie bereiten Sie sich, Ihre<br />
Mitarbeiter und Kollegen auf Neues vor?<br />
Da gibt es keine großartige Vorbereitung, das ist Tagesgeschäft,<br />
für Neues sollte man schon von Haus aus fit sein.<br />
Neues Jahr, neues Glück. Wie haben Sie sich beruflich<br />
auf <strong>2021</strong> eingestimmt?<br />
Es ist ein ständiger Prozess. Ich suche immer nach neuen<br />
Möglichkeiten für „Ereignissprünge“.<br />
Mussten Sie in Ihrem Leben schon einmal einen beruflichen<br />
Neuanfang wagen?<br />
Wenn man jeden neuen Tag als Anfang sieht, schreckt einen<br />
Neues nicht.<br />
Wenn Sie die Chance hätten, Ihr Leben noch einmal von<br />
vorne zu beginnen, was würden Sie anders machen?<br />
Ich möchte noch einmal von vorne anfangen, dann würde ich<br />
meine Lebenszeit noch mehr ausschöpfen.<br />
Was macht Ihren Job zum schönsten Job der Welt?<br />
Das tägliche Beschäftigen damit.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder<br />
würden Sie mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Ein Perspektivwechsel würde mich noch reizen.<br />
Foto Sandra Beuck<br />
42 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
43
DIGITALISIERUNG<br />
BÜHL GRÜNDET DIGITALES INNOVATIONSZENTRUM<br />
NIEMAND<br />
KOMMT AN DER<br />
DIGITALISIERUNG<br />
VORBEI<br />
Wer braucht schon das weitentfernte Silicon Valley, um die Digitalisierung in der TechnologieRegion<br />
Karlsruhe voranzubringen? Knapp 50 Kilometer südlich von Karlsruhe, in der Zwetschgenstadt Bühl, entsteht<br />
das Digitale Innovationszentrum. Dort sollen Bürgern und mittelständischen Unternehmen Digitalisierungsinhalte<br />
vermittelt werden und ein digitales Ökosystem entstehen.<br />
Foto pexels.com/Markus Spiske<br />
Gerade die Coronapandemie hat gezeigt,<br />
wie wichtig das Thema Digitalisierung<br />
für die Menschen ist: Wir arbeiten<br />
im Homeoffice, greifen auf Daten im<br />
Büro zu. Oder das wöchentliche<br />
Videotelefonat mit der Familie sowie<br />
der Shoppingtrip in der Lieblingsboutique,<br />
die jetzt einen Online-Shop hat.<br />
Digitalisierung ist aus unserem (Arbeits-)Leben<br />
nicht mehr wegzudenken.<br />
Ein Grund mehr, sich noch genauer mit<br />
der Technik zu beschäftigen. Da greift<br />
das Digitale Innovationszentrum in Bühl<br />
ein, das im Sommer 2020 gegründet<br />
wurde. „Wir müssen noch ein Jahr weiter<br />
zurück gehen“, sagt Corina Bergmaier<br />
von der Wirtschaftsförderung<br />
der Stadt Bühl. „2019 haben wir das<br />
‚Netzwerk Industrie 4.0‘ gegründet, das<br />
von der TRK unterstützt wurde. Schon<br />
früh kam der Wunsch der Teilnehmer<br />
auf, die Themenfelder der Digitalisierung<br />
gemeinsam anzugehen, mit den<br />
neuen Technologien zu experimentieren<br />
und das am besten vor Ort. Die<br />
Notwendigkeit eines solchen Zentrums<br />
war also schon vor Corona bekannt“,<br />
so Bergmaier über die Entstehungsgeschichte<br />
des Innovationszentrums.<br />
Die Stadt Bühl war zudem auch in<br />
der Regionalen Entwicklungsstrategie<br />
„TechnologieRegion Karlsruhe 2030“<br />
involviert. Dabei wurde der Ausbau<br />
eines „Innovation Hubs“ im Süden der<br />
TRK zur Erschließung neuer Innovationsfelder<br />
definiert. Jetzt treiben Stadt<br />
und TRK die Idee des Zentrums mit<br />
voller Kraft voran.<br />
SPIELERISCH DIGITALISIERUNG<br />
VERSTEHEN UND ANWENDEN<br />
Das Ziel: Durch das Digitale Innovationszentrum<br />
können sich Bürger<br />
und Unternehmen spielerisch mit den<br />
Herausforderungen der Digitalisierung<br />
auseinandersetzen. „Wir haben in den<br />
letzten Monaten alle erkannt, dass<br />
niemand an der Digitalisierung vorbeikommt!“,<br />
sagt Corina Bergmaier<br />
von der Wirtschaftsförderung der<br />
Stadt Bühl. „Videokonferenzen am<br />
Arbeitsplatz und Homeoffice allgemein<br />
waren vor einem Jahr noch – nicht<br />
nur im öffentlichen Dienst – in weiter<br />
Ferne. Die Reise in die Zukunft hat also<br />
begonnen, das Digitalisierungszentrum<br />
bietet uns eine Spielwiese, um Neues<br />
auszuprobieren.“<br />
„SIND NICHT IN DER 1. LIGA“<br />
Ein weiterer Grund, beim Thema Digitalisierung<br />
aufs Gaspedal zu treten, da<br />
ist sich Corina Bergmaier sicher: „Die<br />
Pandemie-Zeit hat uns die Vorteile<br />
aufgezeigt und vieles beschleunigt. Sie<br />
hat aber auch aufgedeckt, dass wir in<br />
Deutschland nicht in der 1. Liga sind –<br />
im Gegenteil. Durch die Krise ist das<br />
Interesse für ein Digitalisierungszentrum<br />
also noch größer geworden!“<br />
Gemeinsam mit dem Karlsruher<br />
Institut für Technologie (KIT) und der<br />
TRK will die Stadt Bühl ein „Digital<br />
Ecosystem“ aufbauen, das die lokale<br />
Wirtschaft, Wissenschaft und die<br />
Kommune(n) lückenlos vernetzt. Das<br />
geplante Leuchtturmprojekt trägt den<br />
Titel „Regionales Mittlerer-OberRhein<br />
Digital Ecosystem (RegioMORE)“.<br />
In diesem digitalen Innovationszentrum<br />
soll die nötige Infrastruktur geschaffen<br />
werden, um zu experimentieren, neue<br />
Technologien und Geschäftsmodelle<br />
zu entwickeln und auszuprobieren, gemeinsam<br />
zu denken, sich auszutauschen<br />
und letztlich auch Geld zu verdienen,<br />
indem das Wissen zeitnah in der<br />
Foto Markus Mäder<br />
regionalen Wirtschaft umgesetzt<br />
wird. In diesem offenen Raum der<br />
Begegnung von Wissenschaft und<br />
Unternehmertum, unterstützt von der<br />
öffentlichen Hand, sollen auf diese<br />
Weise Mehrwerte für alle Beteiligten<br />
entstehen, letztlich auch für die Bürger.<br />
Das Digitale Innovationszentrum im<br />
Süden der TRK soll nicht nur lokale<br />
Unternehmen vernetzen, sondern die<br />
gesamte Region. „Ein Hauptgedanke<br />
ist, die Stärken und die Vielfalt der<br />
TRK zu bündeln. Ein Zentrum nur für<br />
Bühl wäre nicht zielführend. Selbstverständlich<br />
sollen auch die Digitalisierungszentren<br />
und Netzwerke der<br />
TRK miteinander vernetzt werden“,<br />
so Bergmaier weiter.<br />
ALLE SOLLEN PROFITIEREN<br />
Das Angebot des Digitalen Innovationszentrums<br />
in Bühl richtet sich an<br />
alle, ob junges Start-up oder familiengeführtes<br />
Unternehmen. „Gerade die<br />
KMUs werden von der Digitalisierung<br />
überrollt“, erklärt Corina Bergmaier<br />
von der Wirtschaftsförderung, „sie<br />
können nicht von heute auf morgen in<br />
neue Technologien investieren, ohne<br />
vom Mehrwert überzeugt zu sein.“<br />
Daher sei ausprobieren, austauschen<br />
und Kontakte zu Hochschulen zu<br />
nutzen und gemeinsam zu lernen sehr<br />
wichtig, dafür möchte das Zentrum ein<br />
breites Angebot bieten. „Aber auch der<br />
Einzelhandel und Privatpersonen sollen<br />
davon profitieren!“<br />
Abseits dieser Plattform für den Austausch<br />
hat die Stadt Bühl ein eigenes<br />
Tool für Videokonferenzen aufgebaut:<br />
„Palim! Palim“ verbindet Familien,<br />
Vereine und Freunde miteinander. Das<br />
ist ein kostenfreies Angebot der Stadtverwaltung<br />
Bühl, um auch in Zeiten der<br />
Coronapandemie digitale Nähe trotz<br />
physischer Distanz zu schaffen.<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
Corina Bergmaier vertritt die<br />
Wirtschaftsförderung der Stadt Bühl.<br />
44 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
45
DIE WELT NACH<br />
CORONA<br />
„Es ist wichtig, dass wir uns jetzt schon für den <strong>Aufbruch</strong> nach der<br />
Coronapandemie vorbereiten. Ziel ist es, Gründer & Gründerinnen<br />
gemeinsam mit den wirtschaftsfördernden Einheiten noch intensiver<br />
bei ihren innovativen Geschäftsideen zu begleiten und zu unterstützen.<br />
Als gründungsfreundliche Kommune hat Baden-Baden schon ideale<br />
Voraussetzungen, die wir derzeit sukzessive erweitern“, sagt OB<br />
Margret Mergen.<br />
Die Coronapandemie und die Maßnahmen<br />
zu ihrer Bekämpfung beschäftigen<br />
uns nun bereits seit über<br />
einem Jahr. Bei den bisweilen nicht<br />
absehbaren Folgen für die Wirtschaft<br />
und Gesellschaft, birgt eine wirtschaftliche<br />
Krise neben ihren dämpfenden<br />
Auswirkungen häufig auch<br />
einen antreibenden Effekt. Der Weg<br />
in die Post-Corona-Ökonomie lässt<br />
sich mit dem Modell der Lazy Eight<br />
beschreiben. Darin stehen für Unternehmen<br />
Improvisation, Rollenfindung<br />
und das Loslassen alter Routinen auf<br />
der Tagesordnung. Am kritischen<br />
Punkt einer möglichen Strukturänderung<br />
gibt es zwei Entscheidungsmöglichkeiten:<br />
entweder das Festhalten<br />
am Status quo, das Zurück ins „alte<br />
Spiel“ – oder der Sprung in die Innovation,<br />
hin zu einem Neustart.<br />
Neustart ist auch das aktuelle Motto,<br />
mit dem die wirtschaftsfördernden<br />
Einheiten (Wirtschaftsförderung,<br />
Gewerbeentwicklung Baden-Baden<br />
GmbH, Gesellschaft für Stadterneuerung<br />
und Stadtentwicklung<br />
Baden-Baden mbH und das ELAN<br />
Gründerzentrum) in Baden-Baden<br />
die Gründer und Unternehmern vor<br />
Ort begleiten und unterstützen. Es<br />
kann davon ausgegangen werden,<br />
dass die weltweite Pandemie auch<br />
in der internationalen Kultur- und<br />
Bäderstadt wirtschaftliche Spuren<br />
hinterlassen wird. Dabei geht es nicht<br />
nur um drohende Insolvenzen. Das<br />
unter den Bedingungen der Pandemie<br />
veränderte Einkaufsverhalten,<br />
innovative Kommunikationsformen<br />
und die zunehmende Akzeptanz von<br />
Homeoffice-Angeboten werden auch<br />
das Wirtschaftsleben in Baden-Baden<br />
nachhaltig verändern. Andererseits ist<br />
zu beobachten, dass sich gerade unter<br />
den Bedingungen der Krise und des<br />
NEUE ERFAHRUNGS-<br />
HORIZONTE ODER<br />
BUSINESS AS USUAL?<br />
damit einhergehenden Veränderungsund<br />
Anpassungsdruckes Chancen<br />
für neue Geschäftsmodelle und somit<br />
Potenziale für Gründer ergeben.<br />
Deshalb wird die Stadt gerade auf<br />
diese Zielgruppe auch künftig ihr<br />
Augenmerk richten.<br />
Bereits in den letzten Jahren belegte<br />
Baden-Baden immer wieder einen der<br />
Spitzenplätze in Baden-Württemberg<br />
bei der Gründungsintensität pro<br />
100.000 Einwohner. Dabei wurden<br />
in Baden-Baden zuletzt die meisten<br />
Neugründungen in der Gastronomie<br />
verzeichnet, gefolgt von Finanzund<br />
Versicherungsdienstleistern,<br />
Unternehmen mit freiberuflichen,<br />
technischen und wissenschaftlichen<br />
Dienstleistungen sowie im Handel.<br />
Außerdem hat sich Baden-Baden<br />
2020 erneut beim Landeswettbewerb<br />
Start-up BW Local beteiligt<br />
und wurde zum zweiten Mal in Folge<br />
als gründungsfreundliche Kommune<br />
ausgezeichnet. Das Wettbewerbsformat<br />
Start-up BW Local wurde als<br />
nationaler Gewinner des Europäischen<br />
Unternehmensförderpreises (EEPA)<br />
ausgezeichnet und von einer renommierten<br />
internationalen Jury zu den<br />
drei besten Initiativen Europas gekürt.<br />
Die Stadt Baden-Baden unterstützt<br />
mit ihren Angeboten Gründer und<br />
Unternehmer entlang der Entwicklung<br />
eines Unternehmens und setzt<br />
dabei ganz vorne an. Dazu wurde im<br />
Rahmen des Landeswettbewerbs ein<br />
Co-Working-Space im ELAN Gründerzentrum<br />
eingerichtet, der sich an<br />
Gründer in der Vorgründungsphase<br />
richtet und sechs flexible Arbeitsplätze<br />
anbietet. Flexibel im Sinne von<br />
Mietdauer und Kündigungsfrist, denn<br />
die Mindestmietdauer beträgt nur<br />
einen Monat, die Kündigungsfrist 14<br />
Tage zum Monatsende. Das Angebot<br />
geht aber darüber hinaus und umfasst<br />
eine kostenlose branchenoffene<br />
Gründungsberatung im Rahmen<br />
des EXI-Gründungsgutschein, den<br />
Austausch mit anderen Gründern und<br />
Start-ups im ELAN Gründerzentrum<br />
sowie die Anbindung an das größte<br />
regional agierende Unternehmernetzwerk<br />
Europas, dem CyberForum e.V.,<br />
das als Kooperationspartner der Stadt<br />
Baden-Baden sowohl Gründern als<br />
auch Unternehmern aus der IT- und<br />
Hightech-Branche, der Finanztechnologie<br />
und der Kreativwirtschaft<br />
unterstützt. Das Angebot soll aber<br />
auch bewusst Gründer bzw. Restarter<br />
ansprechen, die aufgrund mangelnder<br />
oder unattraktiver Erwerbsalternativen<br />
gerade in Krisenzeiten den<br />
Schritt in die Selbständigkeit wagen.<br />
Sie möchte die Stadt Baden-Baden<br />
bestmöglich dabei unterstützen,<br />
erfolgreich, nachhaltig und mittelbis<br />
langfristig existenzsichernd<br />
zu gründen.<br />
Wenn die ersten Schritte hin zur<br />
Unternehmensgründung getan sind<br />
bzw. die Gründung vollzogen ist,<br />
besteht für die frischegebackenen<br />
Gründer im Gründerzentrum ELAN<br />
die Möglichkeit, die erste eigene<br />
Büroeinheit mit einer längerfristigen<br />
Perspektive anzumieten, weiterhin im<br />
Netzwerk aktiv zu bleiben und Unterstützungsangebote<br />
wie die Auszubildenden-<br />
und Fachkräftevermittlung,<br />
die Vermittlung unternehmerischen<br />
Wissens oder im Bereich Innovation<br />
und Digitalisierung vor Ort zu nutzen.<br />
Wenn aus dem Start-up ein Wachstumsunternehmen<br />
geworden ist,<br />
dann wächst es folglich auch aus<br />
dem Gründerzentrum heraus. Allein<br />
gelassen werden die Jungunternehmer<br />
dann dennoch nicht. Nahtlos<br />
übernehmen die Mitarbeitenden der<br />
städtischen Wirtschaftsförderung und<br />
Gewerbeentwicklung Baden-Baden<br />
GmbH und helfen dabei, Kontakte<br />
zu knüpfen und passende Gewerbegrundstücke<br />
oder Gebäude für das<br />
junge Unternehmen zu finden.<br />
Es wird interessant und spannend<br />
bleiben, wie sich im Kontext der<br />
Corona-Krise die Gründerszene in<br />
Baden-Baden entwickeln wird. Dabei<br />
gibt es berechtigte Hoffnungen, dass<br />
die Krise innovative und zukunftsweisende<br />
Geschäftsmodelle in ihrer<br />
Entwicklung beschleunigen wird. Hier<br />
sieht auch die Stadt Baden-Baden<br />
ihre Chance.<br />
„Dank dem ELAN Gründerzentrum<br />
konnten wir als Gründer unser Unternehmen<br />
avocado software engineering<br />
aufbauen und kontinuierlich<br />
weiterentwickeln. Dabei konnten wir<br />
auch Angebote zur Gründungsunterstützung<br />
des CyberForum e.V. für uns<br />
nutzen. Jetzt wagen wir den nächsten<br />
Schritt raus aus dem Gründerzentrum<br />
hinein in unsere neuen Geschäftsräume,<br />
wobei wir der Baden-Badener<br />
Cité treu bleiben“, berichten Daniel<br />
Höllig und Simon Echle.<br />
Das ELAN Gründerzentrum in der<br />
Kurstadt Baden-Baden unterstützt<br />
Gründer beim Schritt in die berufliche<br />
Selbständigkeit. Als zentraler Baustein<br />
der Wirtschaftsförderung Baden-<br />
Badens werden jungen Start-ups ein<br />
Co-Working-Space, Büroflächen,<br />
Beratungen in Kooperation mit dem<br />
CyberForum e.V. und Zugang zum<br />
Netzwerk angeboten.<br />
DR. CHRISTIANE KLOBASA, FABIO CUSIN<br />
www.elan-baden-baden.de<br />
Foto Wikimedia Commons/ A. Savin<br />
Interesse? Jetzt einen<br />
Co-Working-Platz sichern!<br />
coworking@elan-baden-baden.de<br />
www.elan-baden-baden.de<br />
Ansprechpartnerin<br />
Dr. Christiane Klobasa<br />
07221 403857-4<br />
46 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
47
DIGITALISIERUNG<br />
KI MADE<br />
IN KA<br />
DAS STARKE KI-ÖKOSYSTEM<br />
DER FÄCHERSTADT WIRKT:<br />
LOKAL, REGIONAL UND<br />
INTERNATIONAL<br />
Karlsruhe ist einer der wichtigsten Digitalstandorte Europas für die<br />
Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Bestehende<br />
Kompetenzen finden in diesem Zukunftsthema auf ideale Weise zusammen.<br />
Als wichtiger Treiber für Innovation fördert KI Unternehmenswachstum<br />
und lässt neue Arbeitsplätze entstehen.<br />
Foto unsplash.com/Possessed Photography<br />
KI-KOMPETENZEN BESTÄTIGT<br />
Bereits 2017 wurde Karlsruhe im<br />
Rahmen der Digital-Hub-Initiative des<br />
Bundesministeriums für Wirtschaft<br />
und Energie als Digital Hub für Angewandte<br />
KI (de:hub AI) ausgezeichnet.<br />
Koordiniert vom DIZ | Digitales<br />
Innovationszentrum entstand daraus<br />
ein Zusammenschluss von Akteuren,<br />
zu denen Netzwerke wie das Cyber-<br />
Forum ebenso wie Unternehmen und<br />
wissenschaftliche Einrichtungen sowie<br />
die Initiative karlsruhe.digital zählen.<br />
Ziel des de:hub Karlsruhe ist es, die<br />
Infrastruktur rund um KI weiter auszubauen,<br />
die Akteure aus Forschung<br />
und Wirtschaft zusammenzubringen<br />
und vor allem die KI-Methoden und<br />
-Technologien in die Anwendung bei<br />
den Unternehmen zu bringen.<br />
WISSENSCHAFT SETZT<br />
KI-SCHWERPUNKTE<br />
Auch die Forschung und Lehre rund<br />
um KI ist exzellent. So realisieren das<br />
Fraunhofer IOSB und das Fraunhofer<br />
ICT gemeinsam mit dem Karlsruher<br />
Institut für Technologie (KIT) die<br />
Forschungsfabrik für KI-integrierte<br />
Produktion sowie Technologietransfer<br />
auf dem Campus Ost. Das KIT, das<br />
Forschungszentrum Informatik FZI<br />
sowie die Fraunhofer Institute kooperieren<br />
zudem beim neuen KI-Kompetenzzentrum<br />
CC-KING. Dieses soll<br />
KI-Spitzenforschung und Ingenieurdisziplinen<br />
verbinden und den Einsatz<br />
von KI in der Praxis erleichtern.<br />
Darüber hinaus möchte das KIT mit<br />
seinem Reallabor „Robotische KI“<br />
den Austausch zwischen Forschung<br />
und Gesellschaft fördern. Auch der<br />
Campus „Hochschule Karlsruhe<br />
2030+“ mit dem Zentrum für Robotik<br />
und intelligente Systeme weitet seine<br />
KI-Forschungs- und Transferaktivitäten<br />
aus. Weitere Hochschulen und<br />
Einrichtungen treiben das Thema<br />
KI voran, wie die Hochschule für<br />
Gestaltung mit ihrer interdisziplinären<br />
Forschungsgruppe „KI und<br />
Medienphilosophie“ oder das ZKM,<br />
das gemeinsam mit dem Deutschen<br />
Museum in München und dem<br />
Fraunhofer IOSB das KI-unterstützte<br />
Ausstellungskonzept „Das intelligente<br />
Museum“ entwickelt.<br />
WICHTIGE ETAPPEN<br />
AUF DEM WEG ZUM<br />
INNOVATIONSPARK KI<br />
Karlsruhe, die Stadt der kurzen<br />
Wege, konnte auch beim aktuellen<br />
Wettbewerb für einen Innovationspark<br />
KI Baden-Württemberg die<br />
vielfach erprobte Kultur der institutionsübergreifenden<br />
Zusammenarbeit<br />
nutzen, die sich durch die Initiative<br />
karlsruhe.digital etablierte. Zehn Hochschulen,<br />
25 Forschungseinrichtungen,<br />
rund 100 KI-Unternehmen und starke<br />
Netzwerke bilden eine hervorragende<br />
Ausgangsbasis für die Teilnahme am<br />
Landeswettbewerb. Mit den Regionen<br />
Stuttgart und Neckar-Alb bündelte<br />
Karlsruhe seine KI-Kompetenzen mit<br />
dem Ziel, ein europaweit und international<br />
wettbewerbsfähiges und sichtbares<br />
Zentrum und KI-Ökosystem für<br />
Baden-Württemberg zu schaffen.<br />
So kann ein KI-Experimentier- und<br />
Datenraum durch miteinander vernetzte<br />
Standorte entstehen. Dabei<br />
wird auch der europäische Ansatz vorangetrieben,<br />
der ethische Grundsätze<br />
wie die digitale Souveränität miteinbezieht,<br />
und eine höhere Akzeptanz<br />
von KI in der Gesellschaft erzielt.<br />
Im zweiten Quartal <strong>2021</strong> wird das<br />
Land entscheiden, wer das beste Konzept<br />
eingebracht hat und die mindestens<br />
47,5 Millionen Euro Fördermittel<br />
des Landes Baden-Württemberg<br />
erhält. Am Standort Karlsruhe<br />
bietet – trotz knapper Flächen – der<br />
TechnologiePark Karlsruhe (TPK)<br />
Entwicklungsmöglichkeiten für den<br />
Innovationspark KI. Insgesamt sollen<br />
hier 5,85 Hektar Fläche an städtischen<br />
Grundstücken bereitgestellt<br />
werden, auf denen sich langfristig<br />
auf bis zu 160.000 Quadratmetern<br />
Bruttogeschossfläche Firmen aus dem<br />
Bereich KI ansiedeln können. Bereits<br />
heute sind rund 65 technologie-<br />
orientierte Unternehmen – viele mit<br />
hoher KI-Affinität – mit rund 4.000<br />
Beschäftigten im TPK beheimatet. Das<br />
von der Wirtschaftsförderung für den<br />
Raum Karlsruhe koordinierte Projekt<br />
findet breite Unterstützung. Rund 130<br />
Unternehmen und Institutionen haben<br />
den Letter of Intent mitgezeichnet<br />
und eigene Ideen eingebracht. Rund<br />
70 Prozent davon stammen aus der<br />
Wirtschaft, darunter Global Player,<br />
aber auch viele mittelständische<br />
Unternehmen. Ein starkes Signal, das<br />
sowohl die Expertise Karlsruhes und<br />
der Region als auch die Relevanz von<br />
KI für die Wirtschaft verdeutlicht. Mit<br />
der Teilnahme am Landeswettbewerb<br />
setzt Karlsruhe ein wichtiges Signal für<br />
die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts,<br />
der auch für internationale<br />
Sichtbarkeit sorgt.<br />
Es wird deutlich, KI wirkt in den<br />
unterschiedlichsten Bereichen. Der<br />
Innovationsstandort Karlsruhe mit seiner<br />
Offenheit für neue Themen zeigt, dass<br />
er den entscheidenden Schritt voraus ist.<br />
Das macht ihn auch im Bereich der KI<br />
zu einem Ort der Möglichkeiten für Unternehmen,<br />
Forschungseinrichtungen,<br />
Fachkräfte und die Stadtgesellschaft.<br />
GABRIELE LUCZAK-SCHWARZ<br />
Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe<br />
und verantwortlich für Wirtschaft,<br />
Wissenschaft und Finanzen<br />
Weitere Informationen:<br />
digitalhub-ai.de/<br />
Foto raumkontakt<br />
48 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
49
DIGITALISIERUNG<br />
ZAHNTECHNIK IM WANDEL:<br />
DIGITALES ARBEITEN IM HANDWERK<br />
Früher war Zahnersatz aus Elfenbein oder Horn, heute sind es Kunststoff,<br />
Titan oder Keramik. Die Materialien, die für Prothesen und<br />
Brücken eingesetzt werden, sind moderner und langlebiger geworden.<br />
Dabei ist genaues Arbeiten unabdingbar. Die heutige Zahntechnik<br />
verbindet handwerkliches Arbeiten mit modernster Frästechnik. Die<br />
Bildungsakademie der Handwerkskammer Karlsruhe (HWKKA) bildet<br />
die Azubis überbetrieblich weiter.<br />
Fotos Ingrid Lehr-Binder<br />
Zahntechniker fertigen einen individuellen<br />
Ersatz für fehlende oder kranke<br />
Zähne der Patienten. Dreieinhalb Jahre<br />
dauert die Ausbildung, an deren Ende<br />
die Gesellenprüfung steht.<br />
Die Anfertigung von Zahnersatz bedarf<br />
zahlreicher Arbeitsgänge und fordert<br />
sowohl naturwissenschaftliche Kenntnisse<br />
als auch gestalterische Fähigkeiten.<br />
In diesem Beruf ist ein breites<br />
technisches und medizintechnisches<br />
Wissen gefragt sowie die Bereitschaft,<br />
sich immer wieder mit neuen Technologien<br />
und Arbeitsmethoden auseinanderzusetzen.<br />
VERSCHIEDENE THEMENGEBIETE<br />
Bei der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung<br />
(ÜLU) – sie ergänzt<br />
die Ausbildung im Betrieb und in der<br />
Berufsschule – für die Handwerkskammern<br />
Karlsruhe und Mannheim wurden<br />
2020 215 Teilnehmer in verschiedenen<br />
Schwerpunkten weitergebildet.<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
Herstellen von totalen Unter- und<br />
Oberkieferprothesen nach System<br />
(Wahlkurs)<br />
Herstellen von herausnehmbarem<br />
Zahnersatz als Modellgussprothese<br />
(Wahlkurs)<br />
Herstellen von kieferorthopädischen<br />
Geräten (Pflichtkurs)<br />
Angewandte CAD-/CAM-Technik<br />
(Pflichtkurs)<br />
Angewandte Frästechnik und Verarbeiten<br />
von Geschieben (Wahlkurs)<br />
Das Schulungskonzept der Bildungsakademie<br />
(BIA) der Handwerkskammer<br />
ist auf das moderne<br />
Zahntechniker-Handwerk ausgerichtet,<br />
bei der die persönliche Kreativität<br />
gefordert und gefördert wird. Denn<br />
eine zahntechnische Aufgabenstellung<br />
eröffnet immer auch ganz individuelle<br />
Lösungsansätze, die dann in<br />
einer kommunikativen Atmosphäre<br />
im Unterricht fachlich diskutiert und<br />
erörtert werden. In der Meisterausbildung<br />
werden die Teilnehmenden in die<br />
Lage versetzt, ihre bereits erworbenen<br />
zahntechnischen Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
auf ein prüfungsrelevantes und<br />
meisterliches Niveau zu steigern. Da das<br />
Meisterprüfungsprojekt einem gedachten<br />
Kundenauftrag entspricht, wird<br />
dazu vorab ein Umsetzungskonzept mit<br />
einer Kalkulation sowie einer Zeit- und<br />
Materialbedarfsplanung erstellt. Für die<br />
praktische Umsetzung steht ein modern<br />
ausgestattetes Schulungslabor bereit.<br />
NEUESTE TECHNIK FÜR BESTE<br />
AUSBILDUNG<br />
Die Handwerkskammer Karlsruhe hat<br />
dafür in die Digitalisierung investiert<br />
und moderne CAD/CAM-Anlagen<br />
angeschafft. „Damit werden die Zahnprothesen<br />
noch genauer und schneller<br />
hergestellt, so muss kein Patient länger<br />
als nötig auf den Zahnersatz warten“,<br />
erklärt Ingrid Lehr-Binder, Leiterin<br />
der Bereiche überbetriebliche Lehrlingsunterweisung<br />
sowie Fort- und<br />
Weiterbildung, im Gespräch mit dem<br />
<strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
Dank computerbasierter Unterstützung<br />
wird die Zukunft der Zahntechnik noch<br />
digitaler, ist sich Lehr-Binder sicher. „Es<br />
findet ein Umdenken statt von Handarbeit<br />
hin zum digitalen Arbeiten. Auch<br />
die Zahnärzte, die Auftraggeber der<br />
Zahntechniklabore, setzen verstärkt auf<br />
Digitalisierung, schicken die Werte an<br />
die Labore, während der Patient noch<br />
auf dem Behandlungsstuhl sitzt. Das hat<br />
den Datenaustausch beschleunigt.“<br />
BERUFSBILD ZAHNTECHNIKER<br />
BLEIBT INTERESSANT<br />
Davon profitiert auch der Patient.<br />
„Jeder Zahnersatz ist ein Unikat, die<br />
Ansprüche an die Passgenauigkeit und<br />
die natürliche Wirkung werden immer<br />
größer. Zudem wird die Prothese, ob<br />
Brücke oder Vollprothese, durch den<br />
Einsatz von Maschinen günstiger. Die<br />
digitale Entwicklung kommt auch dem<br />
Patienten zugute“, so Ingrid Lehr-<br />
Binder von der BIA weiter.<br />
Dabei hat die BIA der Handwerkskammer<br />
Karlsruhe auch zukünftige Lehrlinge<br />
im Blick. „Wir müssen die Ausbildung<br />
und den Berufszweig allgemein interessant<br />
gestalten, damit wir die Fachleute<br />
binden und Nachwuchs finden“, erklärt<br />
Ingrid Lehr-Binder. In der BIA werden<br />
nicht nur die Lehrlinge und die Meister<br />
weitergebildet, auch die Mitarbeitenden<br />
nehmen an regelmäßigen Fortbildungen<br />
teil. „Wir investieren nicht nur in deren<br />
Know-how, sondern auch in die Ausstattung<br />
in unseren hauseigenen<br />
Laboren. Einerseits in die Technik, wie<br />
die neuen CAD/CAM-Anlagen, andererseits<br />
auch in neue Möbel oder aktuelles<br />
Zubehör. Das erhöht den Komfort<br />
beim Arbeiten und eine gut aufgestellte<br />
Umgebung wird ganz anders und vor<br />
allem motivierend von den Schulungsteilnehmern<br />
wahrgenommen.“<br />
Mit den Angeboten der überbetrieblichen<br />
Lehrlingsunterweisung werden<br />
nicht nur Auszubildende ab dem 2.<br />
Lehrjahr angesprochen. Die BIA bietet<br />
auch Kurse zur Meistervorbereitung<br />
Zahntechnik als berufsbegleitenden<br />
Wochenendlehrgang an.<br />
Es besteht die Möglichkeit, finanzielle<br />
Fördermittel, beispielsweise das<br />
Aufstiegs-BaföG, zu beantragen.<br />
INGRID LEHR-BINDER<br />
www.bia-karlsruhe.de/mv-zahntechnik<br />
50 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
51
RUBRIK<br />
TECHNOLOGIETRANSFER<br />
MIT GENUSSFAKTOR<br />
Gelungene Netzwerkarbeit verbindet die richtigen Partner und schafft<br />
Raum für Innovation in der Fächerstadt. Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie<br />
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit ein beeindruckendes Ergebnis<br />
erzielt werden kann.<br />
In Karlsruhe kennt zwar nicht jeder<br />
jeden – aber der richtige Geschäftsoder<br />
Projektpartner ist in der Regel<br />
nur ein Netzwerk weit entfernt. Darum<br />
kümmert sich auch die Wirtschaftsförderung<br />
Karlsruhe. Das Herz Karlsruhes<br />
schlägt im Mittelstand – Unternehmer<br />
wissen, wie wichtig Branchennetzwerke<br />
und Projektpartnerschaften sind. Agilität,<br />
Entscheidungsfreude, Innovationsgeist<br />
und der Wille zur Transformation<br />
sind wichtig für diejenigen, die ganz<br />
vorne mit dabei sein wollen.<br />
Ein Beispiel für eine hervorragende<br />
Netzwerkarbeit ist ein aktueller<br />
gastro nomischer Coup, der Kaffeeroboter<br />
MyAppCafé. (Mehr dazu<br />
auf der gegenüberliegenden Seite.)<br />
Von der Vision zum Produkt in 12<br />
Monaten – das geht nur auf kurzen<br />
Wegen. Und diese gibt es in der Stadt<br />
Karlsruhe: Denn Wirtschaft und<br />
Wissenschaft sind hier hervorragend<br />
miteinander verzahnt.<br />
KARLSRUHER NETZWERKE:<br />
WISSEN, WER WAS KANN<br />
Auf der Seite der Wissenschaft<br />
zählen neben dem Karlsruher Institut<br />
für Technologie zahlreiche weitere<br />
renommierte Hochschulen und<br />
Forschungseinrichtungen zu den<br />
Impulsgebern. Gebündeltes Knowhow<br />
sowie die hohe Kompetenz der<br />
akademischen Absolventen treffen<br />
auf der anderen Seite auf motivierte<br />
und innovative Unternehmen in<br />
mehreren großen Branchen- und<br />
Kompetenzclustern.<br />
Dazu zählen unter anderem das<br />
EnergieForum Karlsruhe, die Gründerallianz<br />
Karlsruhe oder das K3 Kulturund<br />
Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe.<br />
Auch das vor 20 Jahren gegründete<br />
CyberForum, mit rund 1.200 Mitgliedern<br />
Deutschlands größtes Hightech.<br />
Unternehmer.Netzwerk sowie das<br />
Automotive Engineering Network,<br />
kurz aen, gehören dazu.<br />
Fotos MyAppCafé<br />
IT’S A MATCH: DREI KARLS-<br />
RUHER FIRMEN ZEIGEN, WIE<br />
INNOVATION GEHT<br />
Von außen betrachtet ist MyAppCafé<br />
ein rund neun Quadratmeter großer<br />
Container, der mit einem Roboterarm<br />
Kaffee ausgibt. 120 Becher pro Stunde<br />
kann der Kaffeeautomat produzieren.<br />
Derzeit stehen drei der Street Baristas<br />
im Ländle: In der Postgalerie Karlsruhe,<br />
in den Mercaden Böblingen und in der<br />
Stadtgalerie Heilbronn. Die Kunden<br />
ordern und bezahlen mithilfe einer<br />
App und erhalten dann vor Ort ihr<br />
frisch zubereitetes Getränk – mit Verpackungsmaterialien<br />
aus nachhaltigen<br />
Rohstoffen. Die Idee hinter MyApp-<br />
Café ist es, leckeren Kaffee auch in<br />
den Randstunden oder als Ergänzung<br />
zur klassischen Gastronomie anzubieten:<br />
auf Messen, Flughäfen oder in<br />
Einkaufszentren zum Beispiel.<br />
MyAppCafé zeigt, wie technische<br />
Innovation und Transformation innerhalb<br />
von Unternehmen auf der Basis<br />
erfolgreichen lokalen Netzwerkens gelingen<br />
kann. Die beteiligten Unternehmen<br />
Rothweiler Feinwerkmechanik,<br />
ROCK5 und das IBS Ingenieurbüro<br />
haben 2018 bei Veranstaltungen der<br />
Karlsruher Wirtschaftsförderung zusammengefunden.<br />
Auch das Netzwerk<br />
aen bringt seine Kompetenz mit ein.<br />
ANFRAGEN AUS ALLER WELT<br />
FÜR MYAPPCAFÉ<br />
An der Verbreitung des Franchise-<br />
Konzepts wird intensiv gearbeitet. Die<br />
nächsten Standorte für MyAppCafés<br />
stehen mit Saarbrücken, Frankfurt und<br />
Hamburg fest. „Das Interesse ist groß“,<br />
so Gastronom und Ideengeber Michael<br />
Stille: „Wir haben Anfragen aus aller<br />
Welt, aus Israel, Schweden, Dubai,<br />
Frankreich oder Polen.“ Für die USA<br />
hat sich bereits ein Master Franchisenehmer<br />
gefunden.<br />
Und besonders vor dem Hintergrund<br />
der Coronapandemie könnte das<br />
Timing nicht besser sein. Kontaktloses<br />
Bestellen, Bezahlen und Entgegennehmen<br />
der Ware kann das Infektionsrisiko<br />
auf ein Minimum reduzieren.<br />
Dirk G. Rothweiler, Geschäftsführer<br />
von Rothweiler Feinwerkmechanik,<br />
blickt positiv auf die weitere Entwicklung.<br />
„Wir stehen erst am Beginn einer<br />
Transformation aller Betriebe unabhängig<br />
von der Betriebsgröße. Ich sehe<br />
die Firmen der Region Karlsruhe und<br />
die Netzwerke stark aufgestellt.“ Dirk<br />
G. Rothweiler ist übrigens seit Kurzem<br />
Vorstand für Innovation und Transformation<br />
im Handwerk beim aen. Ohne<br />
die Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung<br />
Karlsruhe wäre dieses Kräftebündeln<br />
nicht möglich gewesen – ein<br />
Gewinn für beide Seiten.<br />
OLIVER WITZEMANN<br />
Wirtschaftsförderung Karlsruhe,<br />
Unternehmensservice und Handwerk<br />
Netzwerke und Branchencluster der<br />
Wirtschaftsförderung Karlsruhe:<br />
karlsruhe.de/b2/wifoe/netzwerke.de<br />
Alles über das Projekt MyAppCafé<br />
Street Barista sowie Links zur<br />
App unter: my-app-cafe.com<br />
Foto Stadt Karlsruhe Monika Müller-Gmelin<br />
52 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
53
„ICH INSZENIERE<br />
IMMER EINE NEUE<br />
GESCHICHTE“<br />
„ICH LIEBE ES,<br />
STÄNDIG NEUES TER-<br />
RAIN ZU ENTDECKEN“<br />
ENNO-ILKA UHDE<br />
Künstler & Regisseur<br />
FRANCESCA ESPOSITO<br />
Eventmanagerin und Betreiberin der Palazzo Halle<br />
in Karlsruhe<br />
54 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
Foto Tanja Dammert<br />
Wie motivieren Sie Ihr Team für einen <strong>Aufbruch</strong>, also ein<br />
neues Projekt?<br />
Wir sind als Team sehr eng, reden viel miteinander. Daher muss<br />
ich niemanden überzeugen. Es gibt nur einen Weg und der führt<br />
Richtung Zukunft, das wissen wir alle: Keine Inszenierung ist wie<br />
die andere, ich mache immer eine neue Geschichte – das kann<br />
man nur, wenn man neue Wege geht.<br />
Wenn Sie im Leben nochmal die Chance hätte, von vorne<br />
anzufangen, was würden Sie anders machen?<br />
Ich habe in meinem Leben immer versucht, dass mir nicht die<br />
Möglichkeitsräume eingeschränkt werden, so dass ich keine Wahl<br />
mehr habe, etwas zu tun. Ich habe immer so gehandelt, wie ich<br />
gehandelt habe und es ist so geworden, wie es geworden ist. Hätte<br />
ich etwas anders gemacht, wäre es anders geworden. Es ist also<br />
alles so wie es ist und das ist okay. Daher kann ich diese Frage gar<br />
nicht richtig beantworten.<br />
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmen Sie dem zu?<br />
Was heißt das, ein Wagnis. Und was heißt gewinnen? Das muss<br />
jeder erstmal für sich selbst definieren. Wagnis heißt, man muss<br />
seine Wege immer mit Mut gehen, weil man nicht weiß, was einen<br />
erwartet. Wir wissen nicht, was passiert, aber wir machen alles,<br />
was wir tun, mit Hoffnung – mehr kann der Mensch nicht machen.<br />
Aber Wagen und Gewinnen passt nicht zusammen, das ist nur ein<br />
Sprichwort, mehr nicht.<br />
Was wollten Sie als Kind werden?<br />
Ich wollte entweder Flugkapitän werden oder, das hört sich<br />
jetzt vielleicht doof an: Studienrat, also Lehrer. Das war in den<br />
68ern so.<br />
Was macht Ihren Job zum schönsten Job der Welt?<br />
Das hört man immer von anderen, aber mein Job ist nicht der<br />
schönste Job der Welt. Es ist vielmehr eine schöne Arbeit, die<br />
wir machen, wenn Sie sich das Opening eines großen Fußball-<br />
Endspiels oder der Inneneinrichtung eines Bürogebäudes ansehen,<br />
das ich entworfen habe.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder in<br />
welchen Bereichen mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Wir verfolgen zwei verschiedene Ansätze: Das Palazzo ist eine<br />
feste Institution und ich finde es toll, dass sie es geschafft hat,<br />
in der Region eine feste Kulturnummer zu sein. Sie hat einen<br />
verlässlichen Ort geschaffen, wo ich hingehen kann, und das<br />
finde, was ich mir erhoffe: Kultur.<br />
Ich persönlich suche die Freiheit.<br />
Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen –<br />
erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie genau das<br />
tun mussten?<br />
Ich bin in der Eventbranche tätig, daher brauche ich gar nicht<br />
lange zurückzublicken. Seit Beginn der Coronapandemie vergeht<br />
kein Monat, in dem ich nicht genau das tue. Nach jeder neuen<br />
Regelung, die mir meinen Weg versperrt, baue ich mir die nächste<br />
Brücke.<br />
<strong>Aufbruch</strong> in eine neue Zeit – was hat sich durch die Corona-<br />
Krise für Sie verändert?<br />
Vor 19 Jahren habe ich die Palazzo Halle als Eventlocation gegründet.<br />
Das ist einer der Orte, an dem ich meine Veranstaltungsideen<br />
umsetze, Menschen inspiriere, und wo unvergessliche<br />
Erlebnisse geschaffen werden. Seit Corona geht es jedoch nicht<br />
nur um Live-Events. Hybrid- und Digitalevents haben sich dazu<br />
gesellt. Wir haben inzwischen Event-Konzepte entwickelt, die alle<br />
aktuellen Anforderungen erfüllen und unseren Gästen ein gutes<br />
Gefühl und Sicherheit vermitteln. An weiteren neuen Lösungen<br />
und Veranstaltungs-Konzepten wird gefeilt – all dies lässt uns<br />
optimistisch in die Zukunft blicken.<br />
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmen Sie dem zu?<br />
Ja. Wer nicht den Mut hat, neue Wege zu gehen, bleibt stehen<br />
und geht letzten Endes rückwärts. Als Unternehmerin liebe ich<br />
es, stets neues Terrain zu entdecken, zu beschreiten und so mein<br />
Unternehmen voranzubringen. Die angeordnete Vollbremsung<br />
tut zwar weh, war aber auch gleichzeitig eine Art Beschleuniger<br />
für neue Ideen. Konzepte wie die Palazzo Gourmet Dinner Show,<br />
die regionalen Künstlern eine Bühne gibt, die Eröffnung des<br />
Restaurants Palazzo Gourmet, ebenso der Online-Shop Palazzo<br />
Gourmet Slow-Food-To-Go aus unserer Gourmet-Küche, sind<br />
daraus entstanden.<br />
Was macht Ihren Job zum schönsten Job der Welt?<br />
Ich liebe es, Räume – im Sinne von Erlebniswelten – zu schaffen.<br />
Ein Raum kann auch ein Gegenstand oder eine Idee sein, der die<br />
Menschen emotional berührt und bewegt. Solche „Räume“ zu<br />
schaffen, macht für mich meinen Job zum schönsten der Welt.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder in<br />
welchen Bereichen mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Enno Uhdes großen Erfahrungsschatz und die Darstellung<br />
seiner „Raum“-Welt finde ich sehr spannend. Ich brenne für das<br />
was ich tue und würde mich gerne mit ihm austauschen, statt<br />
zu tauschen.<br />
Foto Andrea Fabry<br />
55
DIGITALISIERUNG<br />
Foto Volksbank Karlsruhe<br />
Von Jahr zu Jahr gewinnt Online-Banking mehr an Bedeutung,<br />
dieser Trend lässt sich schon seit 15 Jahren beobachten.<br />
Ganz besonders war das 2020 zu spüren, ausgelöst durch die<br />
Pandemie und die damit einhergehenden Schließungen von<br />
Bank-Filialen während der Lockdowns. Laut Bitkom, dem<br />
Digitalverband Deutschlands, nutzten im Jahr 2020<br />
76 Prozent der Deutschen Online-Banking (2019 70 %).<br />
Laut Umfrage könnten sich weitere 10 Prozent vorstellen,<br />
künftig Online-Banking zu nutzen oder haben es konkret vor.<br />
Dabei sind vor allem die 30 bis 49 Jahre alten Bankkunden<br />
onlineaffin: 96 Prozent machen ihre Bankgeschäfte bequem<br />
von zuhause aus oder unterwegs.<br />
DIGITALE WENDE<br />
Auch den Banken und Finanzdienstleistern in der TechnologieRegion<br />
Karlsruhe (TRK) sind die Veränderungen nicht<br />
entgangen. Um nicht von der Digitalisierungswelle überrollt<br />
zu werden, wollen und müssen die Banken ihre Dienstleistungen<br />
weiter dem digitalen Orbit anpassen. Das eine oder<br />
andere Finanzinstitut träumt gar von Online-Beratungen mit<br />
virtuellem Assistenten bei längerfristigen Finanzierungsvorhaben,<br />
wie z.B. dem Kauf einer Immobilie. Vielleicht gibt es<br />
demnächst auch nur noch einen Geldautomaten mit integriertem<br />
Kontoauszugsdrucker und einem schicken Telefon mit<br />
Retina-Display, um nach dem Einkaufen noch schnell einen<br />
CORONA LÄSST<br />
ONLINE-BANKING<br />
WACHSEN<br />
Der schnelle Blick auf den Kontostand oder am Wochenende eine<br />
Überweisung bequem vom Sofa aus erledigen: Immer mehr Menschen<br />
nutzen Online-Banking. Einige, weil sie bei einer Direkt-Bank sind<br />
und es müssen, andere weil sie flexibel sein möchten. Die Tendenz zum<br />
Online-Banking steigt. Hat die Coronapandemie darauf Einfluss? Der<br />
<strong>Wirtschaftsspiegel</strong> hat nachgefragt.<br />
Beratungstermin zu vereinbaren. Ob sich der Bankkunde in<br />
den Sechzigern mit solchen Innovationen sofort anfreunden<br />
kann, bleibt abzuwarten. Für die jüngeren Generationen der<br />
18- bis 45-Jährigen ist das sicher kein Thema mehr.<br />
Da gehört es schon zum guten Ton, das tägliche Leben rund<br />
um die Uhr online zu verwalten.<br />
Diese beiden Welten zusammenzubringen ist die Herkulesaufgabe<br />
der Bankinstitute von Heute und langfristig gesehen<br />
sind den zahlreichen Möglichkeiten des Online-Bankings von<br />
Morgen zweifellos keine Grenzen gesetzt.<br />
EASY BANKING<br />
Als einer der größten IT-Dienstleister für Volks- und Raiffeisenbanken<br />
hat die Fiducia & GAD IT AG aus Karlsruhe ihre<br />
technischen Plattformen aufgerüstet, um eine mühelose Abwicklung<br />
beim Online-Banking und dem kontaktlosen Bezahlen<br />
zu gewährleisten. „Die Pandemie hat auf jeden Fall die Digitalisierung<br />
im Bankenwesen beschleunigt“, ist Martin Beyer,<br />
Vorstandssprecher der Fiducia & GAD IT AG, überzeugt. So<br />
flexibel wie das Leben reagiert auch die Volksbank Karlsruhe<br />
auf den Wandel zwischen dem Betreiben der Filialen und den<br />
Dienstleistungen des Online-Bankings. „Wir haben während<br />
der Pandemie verstärkt beobachtet, dass sich Kunden entweder<br />
telefonisch oder via Internet-Meeting beraten lassen“, erzählt<br />
Thomas Nusche, Pressesprecher der Volksbank Karlsruhe.<br />
Corona hält uns immer noch auf Trab,<br />
viele Geschäfte haben geschlossen, lange<br />
waren auch die Bankfilialen dicht. Wie<br />
haben die Fiducia & GAD IT AG und die<br />
Volksbank Karlsruhe die Pandemie-Zeit<br />
bisher gemeistert?<br />
Beyer: Die Fiducia & GAD ist bisher<br />
gut durch die Krise gekommen. Wir<br />
konnten sehr schnell fast alle Mitarbeiter<br />
ins Homeoffice schicken und auch<br />
die Banken entsprechend unterstützen:<br />
Wir haben Antragsstrecken für KfW-<br />
Kredite zur Verfügung gestellt und beispielsweise<br />
das Limit für kontaktloses<br />
Bezahlen von 25 auf 50 Euro erhöht.<br />
Grundsätzlich gab und gibt es für die<br />
Fiducia & GAD nicht weniger zu tun,<br />
sondern es kamen neue Herausforderungen<br />
hinzu, die es zu meistern galt.<br />
Nusche: Trotz der äußerst schwierigen<br />
Rahmenbedingungen blickt die<br />
Volksbank Karlsruhe zufrieden auf das<br />
abgelaufene Geschäftsjahr 2020 zurück.<br />
Zwar liegt das Teilbetriebsergebnis<br />
als wichtigster Erfolgsindikator mit 23<br />
Millionen Euro rund 1,8 Millionen Euro<br />
unter dem Vorjahreswert, dennoch<br />
konnten wir die zu Jahresbeginn festgelegte<br />
Plangröße nahezu punktgenau<br />
erreichen. In einem Jahr, das uns aufgrund<br />
der Pandemie stets in Erinnerung<br />
bleiben wird, sind wir sehr froh<br />
über dieses Ergebnis, denn vor allem die<br />
Halbjahresbilanz hatte das Schlimmste<br />
befürchten lassen.<br />
So war unser Provisionsergebnis aus der<br />
Vermittlung von Bank- und Versicherungsleistungen<br />
im Frühjahr 2020<br />
komplett eingebrochen, als die Filialen<br />
über sechs Wochen lang von den Kunden<br />
nur noch mit zuvor vereinbarten<br />
Beraterterminen betreten werden durften.<br />
Das Kreditgeschäft stagnierte, und<br />
der Kurssturz im März versetzte viele<br />
Anleger in einen regelrechten Schockzustand.<br />
In der zweiten Jahreshälfte<br />
normalisierte sich das Geschäft wieder,<br />
die Kreditnachfrage zog spürbar an.<br />
Ebenso konnten die Berater viele Anleger<br />
davon überzeugen, die niedrigen<br />
Foto stock.adobe.com – ipopba<br />
Börsenkurse des Frühjahrs als Chance<br />
für den Neueinstieg zu nutzen, was<br />
sich als sehr gute Strategie erwiesen<br />
hat. Der Blick auf den Jahresstart <strong>2021</strong><br />
zeigt eine vielversprechende Tendenz.<br />
Stichwort Online: Die Menschen haben<br />
online viel bestellt, die Zahlen der<br />
ausgelieferten Pakete ist steil nach oben<br />
gegangen. Analog dazu: Wie war das<br />
bei der Fiducia & GAD IT AG und der<br />
Volksbank Karlsruhe? Mehr Online-<br />
Banking-Nutzer = mehr IT-Infrastruktur<br />
für die Banken auf- und ausbauen?<br />
Beyer: Beim Stichwort IT-Infrastruktur<br />
und Corona fällt mir zunächst etwas<br />
anderes ein: Zu Beginn des ersten<br />
Lockdowns 2020 mussten wir in<br />
kürzester Zeit die technischen Voraussetzungen<br />
dafür schaffen, dass<br />
eine exponentiell steigende Anzahl<br />
von Bankmitarbeitern sicher aus dem<br />
Homeoffice arbeiten konnte. Dafür<br />
war es notwendig, schnell die notwendige<br />
VPN-Infrastruktur zu skalieren<br />
und über unsere Tochtergesellschaft<br />
Ratiodata die benötigten mobilen<br />
Arbeitsplätze in Form von Laptops zu<br />
beschaffen.<br />
Nusche: Die Frage, ob es einen Zusammenhang<br />
gibt zwischen der steigenden<br />
Zahl an Online-Bestellungen während<br />
der Pandemie und einer höheren<br />
Nutzungsquote beim Online-Banking,<br />
kann so nicht beantwortet werden. Denn<br />
das reine Online-Banking spielt bei<br />
Bezahlvorgängen im Internet eine eher<br />
untergeordnete Rolle. Es sei denn, Käufe<br />
werden auf Rechnung bestellt und diese<br />
dann per Online-Überweisung beglichen.<br />
Dies ist aber nur in Einzelfällen der Fall.<br />
Meist werden die Anbieter wie Paydirekt,<br />
Paypal, Giropay oder die Kreditkarte fürs<br />
Bezahlen im Internet genutzt.<br />
Hat Corona und die damit verbundenen<br />
Einschränkungen der digitalen<br />
Bank und dem Onlinebanking einen<br />
Schub verpasst? >><br />
56 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
57
Foto fiducia & GAD IT AG<br />
Foto: BAW Karlsruhe<br />
Martin Beyer,<br />
Vorstandssprecher der Fiducia & GAD IT AG<br />
>><br />
Beyer: Tatsächlich ist die Anzahl der<br />
Nutzer von digitalen Lösungen im<br />
vergangenen Jahr signifikant gestiegen.<br />
Hier spielt die Pandemie sicher eine<br />
Rolle. Unabhängig davon schreitet die<br />
Digitalisierung von Banking aber bereits<br />
seit einigen Jahren in einem enormen<br />
Tempo voran.<br />
Nusche: Grundsätzlich ist die Quote<br />
unserer Kunden, die das Online-Banking<br />
nutzen oder sich für die Nutzung<br />
zumindest haben freischalten lassen, im<br />
Vergleich zu anderen Genossenschaftsbanken<br />
schon seit längerem recht<br />
hoch und liegt bei rund 50 Prozent.<br />
Eine wirklich signifikante Zunahme an<br />
reinen Online-Banking Transaktionen<br />
seit Ausbruch der Pandemie haben<br />
wir bisher nicht feststellen können.<br />
Interessant ist jedoch der Blick auf die<br />
Zahlen bei unseren Bank- und Kreditkarten.<br />
Stellen wir etwa die Werte der<br />
beiden Oktober-Monate aus dem Jahr<br />
2019 und 2020 gegenüber, so zeigt<br />
sich ein eindeutiger Trend: Die Zahl der<br />
Kartenverfügungen mit der Girocard<br />
lag 2020 um rund 42 Prozent über<br />
dem vergleichbaren Vorjahresmonat.<br />
Die Anzahl der Kreditkartenverfügungen<br />
zeigt für 2020 gegenüber 2019<br />
eine Steigerung um über 10 Prozent.<br />
Ebenfalls interessant ist der Blick auf<br />
das kontaktlose Bezahlen: So zeigt<br />
unsere Girocard-Statistik, dass etwa im<br />
Dezember 2020 von insgesamt 320.000<br />
Verfügungen rund 194.000 kontaktlos<br />
erfolgten (rund 60 %). Im Dezember 2019<br />
waren von insgesamt 252.000 Transaktionen<br />
erst 92.000 (36,5 %) kontaktlos.<br />
58 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
Müssen sich eventuell Menschen auf<br />
dem Land nun auf geschlossene Filialen<br />
einstellen, weil mehr in den digitalen<br />
Raum verlagert wird?<br />
Nusche: Die Volksbank Karlsruhe ist<br />
ein städtisch orientiertes Institut, die<br />
Filialen befinden sich allesamt in der<br />
Kernstadt sowie den umliegenden<br />
Stadtteilen. Bei uns jedenfalls sind<br />
Filialschließungen derzeit nicht geplant.<br />
Im Gegenteil: Mit unserer Campus-<br />
Filiale auf dem Gelände des KIT haben<br />
wir im vergangenen Jahr einen weiteren<br />
Standort eingerichtet, wenngleich<br />
dieser – pandemiebedingt – bisher<br />
noch nicht besetzt war. Denn der<br />
Hochschulbetrieb findet ja fast nur<br />
noch online statt.<br />
Das Thema Online-Beratung wird zunehmen.<br />
Denn nachdem sich während<br />
der ersten bundesweiten Schließungen<br />
im Frühjahr 2020 die Türen unserer<br />
Filialen für sechs Wochen nur noch<br />
nach telefonischer Terminvereinbarung<br />
öffneten, nutzen viele Kunden bis<br />
heute die Möglichkeit, sich entweder<br />
telefonisch oder via Internet-Meeting<br />
beraten zu lassen. Sowohl auf Seiten<br />
der Berater als auch auf Kundenseite<br />
wurden in kaum vorhersehbaren<br />
Dimensionen bisher ungenutzte Wege<br />
der Interaktion gegangen. Waren Web-<br />
Meetings auch aus dem Homeoffice<br />
bisher eher die Ausnahme, so sind sie<br />
im Nullkommanichts auch für unsere<br />
Kunden salonfähig geworden. Ob und<br />
wie sich das mittelfristig auf den Besuch<br />
der Filialen auswirkt, müssen wir<br />
abwarten und fortlaufend analysieren.<br />
Wie digital kann Bank werden,<br />
so ganz allgemein gesehen?<br />
Beyer: Pauschal lässt sich das schwer<br />
beantworten. Das hängt immer davon<br />
ab, um welche Art von Bankgeschäft<br />
es sich handelt. Für große, beratungsintensive<br />
Themen wie eine Baufinanzierung<br />
wird der Bankberater auch in<br />
Zukunft eine zentrale Rolle spielen.<br />
Andere Bankgeschäfte verlagern sich<br />
dagegen immer mehr in den digitalen<br />
Raum. Ein grundsätzlicher Trend ist<br />
auch, dass die Anzahl der Kunden, die<br />
ihre Bankgeschäfte auf dem Smartphone<br />
erledigen, deutlich ansteigt.<br />
Einfaches, intuitives Banking ist gefragt<br />
– am besten per App. Dem wollen auch<br />
wir mit einer neuen Banking-App und<br />
einem neuen Online-Banking Rechnung<br />
tragen. Beides wird im Laufe des<br />
Jahres ausgerollt werden.<br />
Nusche: Ganz allgemein formuliert,<br />
kann eine Bank natürlich zu 100<br />
Prozent digital sein, Beispiele hierfür<br />
gibt es ja bereits viele. Als in der Region<br />
verwurzelte Genossenschaftsbank mit<br />
einer über 160-jährigen Tradition am<br />
Bankenplatz Karlsruhe leben wir unsere<br />
Mitglieder- und Kundenbeziehung<br />
auch dadurch, dass wir mit unseren<br />
17 Filialen direkt bei den Menschen<br />
vor Ort sind. Unsere Kollegen in den<br />
Stadtteilen sind für viele Menschen<br />
das Gesicht unseres Hauses und vor<br />
allem wichtige persönliche Ansprechpartner.<br />
Dennoch können und wollen<br />
wir uns den technischen Möglichkeiten<br />
nicht verschließen, denn viele unserer<br />
Kunden wollen ihre Bankgeschäfte<br />
natürlich auch online und mobil über<br />
die verschiedenen Kanäle erledigen.<br />
Wir sind daher gefordert, den Spagat<br />
zu bewältigen zwischen einer Filialbank<br />
auf der einen Seite und einer Internetoder<br />
Direktbank auf der anderen Seite.<br />
Das ist unser Geschäftsmodell, und wir<br />
sind davon überzeugt, dass wir hier auf<br />
einem sehr guten Weg sind.
ENERGIE<br />
ENERGIEWENDE ANPACKEN<br />
SMART EAST – DAS INTELLIGENTE QUARTIER IM KARLSRUHER OSTEN<br />
Karlsruhes Klimaschutzziele sind ambitioniert: Bis zum Jahr 2050 strebt die Stadt Klimaneutralität an. Aber<br />
wie können wir die Energiewende vor Ort vorantreiben? Im gemischtgenutzten Bestandsquartier „Smart East“<br />
in der Karlsruher Oststadt werden die Potenziale einer klimaneutralen Energieversorgung in der Praxis<br />
evaluiert. Das Versuchsfeld ist das Gelände entlang der „IT- und Technologieachse“ Haid-und-Neu-Straße vom<br />
FZI „House of Living Labs“ über die Technologiefabrik Karlsruhe bis zum Hoepfner-Areal.<br />
Ein Verbund aus Unternehmen und<br />
Forschungseinrichtungen hat sich zum<br />
Ziel gesetzt, dieses Leuchtturmprojekt<br />
als Teil der Energiestrategie der TechnologieRegion<br />
Karlsruhe zu realisieren.<br />
Der Oberbürgermeister der Stadt<br />
Karlsruhe Dr. Frank Mentrup begleitet<br />
das vom Ministerium für Umwelt,<br />
Klima und Energiewirtschaft Baden-<br />
Württemberg mit knapp 1 Million Euro<br />
geförderte Projekt als Schirmherr.<br />
Hervorzuheben ist die Mitwirkung aller<br />
Beteiligten: Mieter, Energieversorger,<br />
Immobilienbetreiber und -besitzer<br />
können im Projekt Smart East neue<br />
Geschäftsmodelle zur smarten Energieversorgung<br />
im Bestandsquartier erproben.<br />
Von Anfang an werden weitere<br />
potenzielle Anwender wie Kommunen,<br />
Wohnungswirtschaft, Immobilienentwickler,<br />
Gewerbeparks oder öffentliche<br />
Liegenschaftsbetreiber das Projekt in<br />
einem Anwenderkreis begleiten.<br />
Initiatoren von Smart East sind Dr.-Ing.<br />
Christoph Schlenzig, Geschäftsführer<br />
der Seven2one Informationssysteme<br />
GmbH und Manuel Lösch, Abteilungsleiter<br />
am FZI Forschungszentrum<br />
Informatik. Gemeinsam mit<br />
Dr. Friedrich Hoepfner, Geschäftsführer<br />
des Immobilienunternehmens Hoepfner<br />
Bräu, geben sie erste Einblicke:<br />
Wieso handelt es sich bei Smart East<br />
um ein Leuchtturmprojekt?<br />
Dr. Schlenzig: Mit Smart East wollen<br />
wir die Energiewende in die Stadt<br />
bringen und leisten damit einen Beitrag<br />
zum Klimaschutz in Karlsruhe. Wir<br />
wollen zeigen, dass die Vernetzung und<br />
Optimierung der Energieversorgung<br />
eines Quartiers im großen Maßstab<br />
auch in der Praxis funktioniert. Aktionsfelder<br />
im Projekt sind: Klimaschutz,<br />
Digitalisierung, Geschäftsmodelle und<br />
Partizipation.<br />
Welche Potenziale bietet die Digitalisierung<br />
der Energieversorgung<br />
im Quartier?<br />
Lösch: Durch den steigenden Anteil<br />
erneuerbarer Stromerzeugung muss<br />
man Strom auch dann verbrauchen,<br />
wenn er abhängig von Sonne und Wind<br />
zur Verfügung steht. Hierzu bietet die<br />
Kopplung der Sektoren Strom, Wärme,<br />
Kälte und Mobilität ein großes Potenzial.<br />
Die Digitalisierung der Energieversorgung<br />
im Quartier ermöglicht es,<br />
den Anteil selbst erzeugter Energie zu<br />
erhöhen, das öffentliche Stromnetz zu<br />
unterstützen, Kosten zu senken und<br />
damit letztendlich die Energiewende<br />
„von unten” zu fördern. Hierzu müssen<br />
die Akteure im Quartier kooperieren.<br />
Genau dafür möchten wir im Projekt<br />
Smart East neue digitale Geschäftsmodelle<br />
entwickeln. Beispiele hierfür<br />
sind vielfältig und reichen von Mieterstrommodellen,<br />
bei denen Eigentümer<br />
von Photovoltaikanlagen den Strom<br />
direkt an ihre Mieter verkaufen, über<br />
den optimierten Betrieb gemeinsamer<br />
Ladeinfrastruktur, bis hin zur stromnetzdienlichen<br />
Koordination von<br />
Energieverbrauch und -erzeugung.<br />
Welche Mehrwerte entstehen<br />
für die TRK?<br />
Dr. Schlenzig: Die TRK hat sich in<br />
ihrer Energiestrategie das Ziel gesetzt,<br />
die Forschungsschwerpunkte Energie,<br />
Mobilität und IT zu einem neuen Wirtschaftsschwerpunkt<br />
„Energieinformatik“<br />
zu bündeln und so zur Modellregion<br />
für Energiewende und Klimaschutz zu<br />
werden. Mit Smart East entsteht ein<br />
weiterer Leuchtturm für diese Strategie.<br />
Mit diesem Projekt macht Karlsruhe<br />
außerdem einen weiteren Schritt zur<br />
Smart City, durch die Digitalisierung<br />
der Energie-Infrastruktur der Oststadt.<br />
Und letztendlich bekommt die TRK mit<br />
Smart East eine Vorbildfunktion für<br />
moderne, praxistaugliche Konzepte für<br />
die Energiewende in Städten.<br />
Welchen Mehrwert sieht das Land<br />
Baden-Württemberg in diesem Projekt?<br />
Lösch: Smart East soll zeigen, dass die<br />
Ideen, Konzepte und Geschäftsmodelle<br />
aus der Forschung auch in der Praxis<br />
technisch umsetzbar und wirtschaftlich<br />
sind. Ziel ist es auch, Schwierigkeiten bei<br />
der praktischen Umsetzung und Hürden<br />
der Regulierung zu erkennen und<br />
Lösungen aufzuzeigen. Die Ergebnisse<br />
sollen baden-württembergischen<br />
Kommunen sowie auch über den<br />
Südwesten hinaus als Blaupause und<br />
Inspiration dienen. Erfolgreiche Vorbilder<br />
für smarte Quartiere gibt es bisher<br />
hauptsächlich in Neubauquartieren. Bei<br />
Smart East handelt es sich jedoch um<br />
ein Quartier, das aus teils über 100 Jahre<br />
alten Bestandsgebäuden besteht. Wir<br />
wollen zeigen, wie Bestandsgebäude in<br />
den Städten in smarte energieoptimierte<br />
Quartiere verwandelt werden können.<br />
Wie profitieren Bürger<br />
von Smart East?<br />
Dr. Schlenzig: Partizipation ist das<br />
vierte Aktionsfeld von Smart East –<br />
deswegen wollen wir die beteiligten<br />
Menschen eng in das Projekt einbeziehen.<br />
Zunächst einmal leistet Smart East<br />
einen direkten Beitrag zum Klimaschutz<br />
vor Ort. Energiewende-Aktivist*innen<br />
können stolz darauf sein, dass in ihrem<br />
regionalen Umfeld ein Vorzeigeprojekt<br />
wie Smart East entsteht. Wir wollen<br />
neugierig machen! Smart East soll –<br />
vereinfacht gesagt – erlebbare Werbung<br />
für die Energiewende sein.<br />
Warum macht die Hoepfner Bräu<br />
beim Projekt mit?<br />
Dr. Hoepfner: Hoepfner hat Tradition.<br />
Mit Innovationen wollen wir<br />
zukunftsfähig bleiben. Unter unserem<br />
Logo „Häuser zum Wohlfühlen“<br />
Foto Baden TV<br />
schaffen wir hier ein Areal, wo man<br />
gerne lebt und arbeitet.<br />
Bei Smart East beteiligen wir uns, weil<br />
wir das Hoepfner Areal langfristig zu<br />
einem Smart Quarter entwickeln.<br />
Leben, Arbeiten und Wohnen in einem<br />
sorgfältig entwickelten Quartier – das<br />
ist die Zukunftsvision. Deshalb schaffen<br />
wir mit dezentraler Energieerzeugung<br />
ein vernetztes System zum nachhaltigen<br />
Energie-Einsatz und parallel dazu<br />
sinkt die Verkehrsbelastung durch<br />
räumliche Nähe aller Objekte – hier<br />
kann man zu Fuß von der Wohnung<br />
in die Kita und dann ins Büro! Die<br />
Synergien zwischen unseren Mietern<br />
werden gefördert z.B. mit Kooperationen,<br />
gemeinsamer Ressourcennutzung<br />
und Marketing. Und wir setzen uns für<br />
eine hohe Lebens- und Wohnqualität<br />
ein - eben „Häuser zum Wohlfühlen“!<br />
Für diese anspruchsvollen Ziele stellen<br />
wir das Hoepfner- Areal als Real-Labor<br />
kostenlos zur Verfügung.<br />
Was ist das Besondere<br />
am Hoepfner-Areal?<br />
Dr. Hoepfner: Das ist das ideale<br />
Versuchsfeld: Neben der Brauerei,<br />
dem Pflegeheim, der Kita und dem<br />
Hightech-Unternehmer-Netzwerk<br />
CyberForum befinden sich Wohnungen,<br />
Büros, Werkstätten, sogar ein<br />
Fernseh- und ein Fotostudio auf dem<br />
Gelände. Hier werden an Ladesäulen<br />
Elektrofahrzeuge mit Strom versorgt<br />
und die großen Maschinen auf<br />
dem Gelände haben einen hohen<br />
3<br />
Energieverbrauch. Für die Zukunft<br />
planen wir, Solarstrom zu produzieren<br />
und auch das im Bau befindliche iWerkx<br />
wird als agiles Bauwerk für Industrie<br />
4.0 eine hauseigene Stromversorgung<br />
haben. Hoepfner Bräu will aktiv an<br />
der Umsetzung der Energiewende in<br />
Karlsruhe mitwirken und helfen, die<br />
vielen guten theoretischen Ansätze in<br />
die Praxis zu überführen.<br />
1 Die Trafostation im iWerkx.<br />
2 E-Mobilität auf dem Vormarsch.<br />
3 Das Smart-East-Areal um die Hoepfner-<br />
1<br />
2<br />
Burg aus der Vogelperspektive.<br />
HOEPFNER BRÄU<br />
www.hoepfner-braeu.de | www.smart-east-ka.de<br />
Foto Ras Rotter<br />
Foto Ras Rotter<br />
60 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
61
GRÜNES LICHT<br />
FÜR SAUBERE<br />
POWER<br />
Für die Produktion von wiederaufladbaren<br />
Akkus und Batterien werden<br />
jedes Jahr Millionen Tonnen Lithium<br />
gefördert – bislang meist außerhalb<br />
Europas unter ökologisch fragwürdigen<br />
Bedingungen. Neu entwickelte Verfahren<br />
– mit einer erheblich besseren<br />
CO2-Bilanz – können in absehbarer<br />
Zeit nun aber auch hierzulande einen<br />
wirtschaftlichen Abbau möglich<br />
machen. Lithium soll dabei in Geothermieanlagen<br />
aus den Tiefen des<br />
Oberrheingrabens gefördert werden.<br />
Aktuell importiert Deutschland den<br />
begehrten Rohstoff, der vor allem für<br />
die Produktion von Batteriezellen für<br />
Elektrofahrzeuge gebraucht wird, aus<br />
den typischen Förderländern Chile,<br />
Argentinien und Australien. Das soll<br />
sich ändern. Für das Klimaschutzprogramm<br />
der Bundesregierung stehen<br />
innovative Verfahren zur Herstellung<br />
E-MOBILITÄT WIRD<br />
NACHHALTIGER<br />
Lithium-Ionen-Akkus sind aus dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken. Aber wie klimafreundlich sind<br />
die Lithium-Batterien, die in Autos, Fahrrädern & Co. verbaut sind? Fakt ist: Die Umweltbilanz beim Lithiumabbau<br />
hängt massiv davon ab, wo und wie das Metall abgebaut wird.<br />
dringend benötigter Rohstoffe in<br />
Europa ganz oben auf der Liste.<br />
WEISS WIE SCHNEE –<br />
DER ROHSTOFF LITHIUM<br />
Das leichteste Metall der Welt<br />
gehört zu den „nicht nachwachsenden“<br />
Rohstoffen. Auffinden lässt sich<br />
die seltene Erde in mineralischem<br />
Gestein und Salzwüsten. Im „Lithium-<br />
Dreieck“ – eine Grenzregion zwischen<br />
Argentinien, Bolivien und Chile – sind<br />
große Lithium-Vorkommen von weltweiter<br />
Bedeutung in ausgetrockneten<br />
Salzseen zu finden.<br />
Mehrere Studien belegen, dass in<br />
einigen mitteleuropäischen Thermalwasserreservoiren<br />
beachtliche Anteile<br />
an Lithium im Tiefenwasser zu finden<br />
sind – die Frage ist, wie es aufbereitet<br />
werden kann. Ein Pilotprojekt des<br />
Karlsruher Instituts für Technologie<br />
(KIT) beschäftigt sich ausführlich damit,<br />
die notwendigen technischen und<br />
wirtschaftlichen Grundlagen für eine<br />
Lithiumproduktion aus heißem Thermalwasser<br />
in Deutschland zu schaffen.<br />
DIE GEWINNUNG<br />
Das lithiumhaltige Grundwasser in den<br />
salzhaltigen Wüstengebieten wird in<br />
extra angelegte Becken hochgepumpt.<br />
Durch Verdunstung des Grundwassers<br />
über mehrere Monate gewinnt man<br />
Lithium-Karbonat, das dann weiterverarbeitet<br />
wird. Das belastet nicht nur<br />
die Umwelt, sondern wirkt sich auch<br />
negativ auf die Lebensbedingungen der<br />
lokalen Bevölkerung aus.<br />
LITHIUM AUS<br />
THERMALWÄSSERN<br />
In der Geothermieanlage Bruchsal,<br />
die das Energieunternehmen EnBW<br />
gemeinsam mit den Stadtwerken<br />
Foto stock.adobe.com – Matyas Rehak<br />
Bruchsal seit 2010 betreibt, wird<br />
Tiefenwasser für Wärme und Strom<br />
gefördert und nach der thermischen<br />
Nutzung wieder zurückgeführt. Dabei<br />
werden rund 800 Tonnen Lithiumchlorid<br />
pro Betriebsjahr ungenutzt wieder<br />
ins Erdreich gefördert. Um den Lithiumgehalt<br />
in Thermalwässern effizient zu<br />
nutzen, entwickelte die EnBW gemeinsam<br />
mit dem KIT ein Verfahren, mit<br />
dem sich das im Tiefenwasser gelöste<br />
Lithium nachhaltig gewinnen lässt.<br />
Aus Schichten zwischen 3.000 und<br />
5.000 Metern Tiefe wird das zwischen<br />
160 und 180 Grad Celsius heiße Thermalwasser<br />
an die Oberfläche befördert,<br />
das dann durch einen Wärmetauscher<br />
geht. Parallel zum regulären Geothermiebetrieb<br />
setzen Wissenschaftler ein<br />
Ionensieb ein, um den Rohstoff Lithium<br />
zu isolieren. Eine echte Chance also,<br />
der Elektromobilität zu einem wirklich<br />
grünen Fußabdruck zu verhelfen und<br />
die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen<br />
zu steigern.<br />
BATTERIE RECYCLING –<br />
GEHT DAS?<br />
Zukünftig sollen die äußere Form,<br />
optimierte Rohstoffkreisläufe und eine<br />
Mehrfachnutzung die Lithium-Ionen-<br />
Batterien nachhaltiger und sicherer<br />
machen. Wichtige Grundlagen dafür<br />
schaffen Wissenschaftler des Bereichs<br />
Verfahrenstechnik und Materialwissenschaft<br />
am KIT mit ihrer Forschung<br />
zum Batterielebenszyklus.<br />
Batteriezellen mit einer dauerhaft<br />
hohen Leistungsfähigkeit können den<br />
ökologischen Fußabdruck z.B. in der<br />
Elektromobilität erheblich verringern.<br />
Denkbar ist auch, solche Zellen nach<br />
Gebrauch weiter zu nutzen, etwa in<br />
großen Netzspeichern. Doch nicht<br />
alle Zellen sind für solche „Second-<br />
Life-Szenarien“ geeignet, der Langzeitbetrieb<br />
erfordert das perfekte<br />
Zusammenspiel zahlreicher Komponenten<br />
und Materialien: „Beim<br />
dauerhaften Laden und Entladen einer<br />
Batterie finden unweigerlich auch<br />
unerwünschte Reaktionen statt“, sagt<br />
Professor Hans Jürgen Seifert vom<br />
Institut für Angewandte Materialien –<br />
Angewandte Werkstoffphysik des KIT.<br />
„Wenn das ihr Verhalten nachteilig<br />
beeinflusst, spricht man von Degradation<br />
oder Alterung. Man kann sie<br />
nicht ganz verhindern, aber durch ein<br />
entsprechendes Zelldesign verzögern<br />
und abmildern.“<br />
Seifert und sein Team analysieren<br />
zudem die Zersetzungsmechanismen<br />
der Batterieflüssigkeiten (Elektrolyt).<br />
Dazu müssen hochpräzise Messungen<br />
durchgeführt werden. Ziel des<br />
Projektes sind präzise Vorhersagen<br />
zum Zellverhalten bei der Nutzung,<br />
erklärt Seifert: „Mit unseren Modellen<br />
können dann sichere und nachhaltige<br />
Batterien entwickelt und zügig auf den<br />
Markt gebracht werden.“<br />
ANGELIKA SCHMIED<br />
www.wvs.de<br />
ZERO CARBON LITHIUM®<br />
PRODUKTION – VULCAN<br />
ENERGIE RESSOURCEN GMBH<br />
DR. HORST KREUTER,<br />
GRÜNDER UND<br />
GESCHÄFTSFÜHRER<br />
Heißer Rohstoff auf dem Weg<br />
zum Erfolg: Bei Vulcan werden die<br />
sehr warmen Thermalwässer des<br />
Oberrheingrabens zur Herstellung<br />
des hochwertigen Zero Carbon<br />
Lithium® genutzt und die nebenbei<br />
erzeugte, überschüssige Energie<br />
in das öffentliche Wärme- und<br />
Stromnetz eingespeist. Durch die<br />
Stromproduktion aus erneuerbarer<br />
Energie ist der gesamte Prozess unabhängig<br />
von fossilen Brennstoffen<br />
und verbraucht nur wenig Wasser<br />
und Fläche. Schon in drei bis vier<br />
Jahren könnte das Unternehmen<br />
erhebliche Mengen Zero Carbon<br />
Lithium® für die Herstellung von<br />
nachhaltigeren Batterien liefern.<br />
www.v-er.eu<br />
Oberfläche der größten Salzebene<br />
der Welt, Salar de Uyuni, Bolivien.<br />
62 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
63
ENERGIE<br />
Auf dem Dach des neuen Quartiers wird Strom erzeugt, unter anderem für die<br />
Wallboxen in der Tiefgarage. Diese gehören in den Wohnvierteln immer dazu,<br />
so dass jeder Bewohner für sein Elektromobil eine Lademöglichkeit hat.<br />
STROM<br />
CLEVER<br />
STEUERN<br />
SCHLAUE WÄRMEWENDE<br />
MIT ENOCOO<br />
Wenn ganze Wohnviertel, Städte oder gar Regionen wie die TRK ihre<br />
Energie aus regenerativen Quellen selbst erzeugen und den Verbrauch<br />
Foto evohaus GmbH<br />
Foto Stephan Baumann<br />
schlau steuern könnten, dann wäre das ein großer Schritt zu einer CO2-<br />
freien Gesellschaft. Doch dazu ist im Kampf gegen die heraufziehende<br />
Klimakatastrophe eine „Wärmewende“ im Immobiliensektor notwendig.<br />
Neben Verkehr und Industrie ist vor<br />
allem die Wärmeversorgung von Gebäuden<br />
für die Kohlendioxid-Emissionen<br />
verantwortlich, weltweit für etwa 40<br />
Prozent. Allein in Deutschland werden<br />
durch rund 18,8 Millionen Wohngebäude<br />
und rund 2,7 Millionen andere<br />
Bauten jährlich ca. 120 Millionen<br />
Tonnen des Treibhausgases CO2 in die<br />
Atmosphäre geblasen. Das sind ca. 36<br />
Prozent der Emissionen und davon gehen<br />
wiederum etwa 90 Prozent auf das<br />
Konto von Heizungen und Warmwasser.<br />
Angesichts des drohenden Klimakollaps<br />
hat der Bund beschlossen, den Gebäudebestand<br />
bis allerspätestens 2050<br />
klimaneutral mit Wärme zu versorgen.<br />
Knapp über die Hälfte der in Deutschland<br />
verbrauchten Energie wird für<br />
die Erzeugung von Wärme und Kälte<br />
verwendet, wie etwa für Heizungen,<br />
Kühlschränke, Warmwasser, Prozesswärme<br />
oder Klimaanlagen.<br />
Kaum zu glauben, aber die dafür benötigte<br />
Energie wird nach einem Bericht<br />
des „Handelsblatt“ zu fast 85 Prozent<br />
immer noch aus Kohle, Öl und Gas<br />
gewonnen. Gerade einmal 14,5 Prozent<br />
stammten 2019 aus erneuerbaren<br />
Quellen. Fast genauso hoch war ihr<br />
Anteil schon vor sieben Jahren.<br />
Das zeigt deutlich, der Wärmebereich<br />
wurde bislang vernachlässigt. „Im Wärmesektor<br />
besteht der größte Nachholbedarf<br />
bei der CO2-Einsparung“, sagt<br />
Professor Dr. Gerd Hager.<br />
Die „Wärmewende“, fordert der<br />
Direktor des Regionalverbands Mittlerer<br />
Oberrhein, solle „im Mittelpunkt<br />
jeder modernen kommunalen Klimastrategie“<br />
stehen.<br />
Was ist damit gemeint? Die Wärmeversorgung<br />
muss von fossilen Energieträgern<br />
wie Kohle, Erdöl und Erdgas<br />
auf erneuerbare Energien umgestellt<br />
werden. Ohne diesen Schritt gelingt<br />
die Energiewende nicht. Die Karlsruher<br />
evohaus GmbH ist seit vielen Jahren<br />
in diesem Bereich eines der führenden<br />
Unternehmen Deutschlands. „In unseren<br />
Quartieren gehört der ausschließliche<br />
Einsatz erneuerbarer Energien zur<br />
Wärmegewinnung zum Standard“, sagt<br />
Geschäftsführer Heinz Hanen.<br />
DER WILLE ZUM HANDELN<br />
Wie bedeutsam die Erneuerbaren Energien<br />
bereits heute sind, zeigen Zahlen<br />
für das vergangene Jahr. 2020 wurde<br />
durch ihren Einsatz der Ausstoß von<br />
rund 227 Millionen Tonnen Treibhausgasen<br />
vermieden. Mit anderen Worten:<br />
ohne diese hätte der Treibhausgasausstoß<br />
in Deutschland im Jahr 2020<br />
um rund 227 Millionen Tonnen CO2-<br />
Äquivalente höher gelegen. Rund drei<br />
Viertel der vermiedenen Emissionen<br />
(fast 181,1 Mio. Tonnen) entfielen dabei<br />
auf den Stromsektor.<br />
Bei der Wärmeversorgung wurden<br />
lediglich rund 36,3 Millionen Tonnen<br />
CO2 eingespart. „Entscheidend sind<br />
der Wille zum Handeln und die konsequente<br />
Beschäftigung mit dem Thema<br />
vor Ort“, sagt Professor Gerd Hager.<br />
Die kommunale Wärmeplanung habe<br />
zwar in Pilotprojekten begonnen, doch<br />
„auf Grundlage des Klimaschutzgesetzes“<br />
werde sie nun „in der gesamten Region<br />
ausgerollt“. Die baden-württembergische<br />
Landesregierung will, dass künftig<br />
alle von ihrer Ausrichtung und Beschaffenheit<br />
her geeigneten Dachflächen mit<br />
Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen<br />
ausgestattet werden müssen. Sie dienen<br />
der Selbstversorgung oder speisen<br />
Strom und Wärme in die entsprechenden<br />
Netze ein. „Bei Neubauten gilt:<br />
so wenig Energie (Strom, Wärme) wie<br />
nötig verbrauchen, so viel Energie wie<br />
möglich selbst erzeugen“, sagt Hager.<br />
VORAUSSETZUNG FÜR<br />
CO2-FREIES LEBEN<br />
In Zukunft wird die Wärmeversorgung<br />
auf dem Zusammenspiel verschiedener<br />
erneuerbarer Wärmetechnologien<br />
sowie einer effizienten Kopplung mit<br />
dem Stromsektor basieren. In evohaus-<br />
Quartieren wird bereits heute für Heizung,<br />
Warmwasser und alle anderen<br />
Energiebedarfe einschließlich der<br />
Wallboxen für Elektromobile nur Strom<br />
eingesetzt. „Das ist eine Voraussetzung<br />
für ein CO2-freies Leben“, sagt Hanen.<br />
Für die aufwändige, technische Umsetzung<br />
wurde das digitale Energiemanagement<br />
enocoo entwickelt. enocoo<br />
steht für „energy no CO2“, übersetzt<br />
„Energie ohne CO2“. Das digitale<br />
selbst lernende Steuerungssystem<br />
übernimmt das komplette Energiemanagement.<br />
Es steuert den Einsatz der<br />
Energie, vergleicht den Bedarf mit dem<br />
bereitgestellten Strom und leitet den<br />
nicht benötigten in Batteriespeicher.<br />
„Letztendlich kommt es darauf an, wie<br />
wir den Einsatz und die Speicherung von<br />
Strom schlau steuern, denn nur dadurch<br />
können wir die lebenswichtige Energiesicherheit<br />
für unsere Gesellschaft<br />
gewährleisten“, erklärt Hanen.<br />
Schlaues Energiemanagement sorgt<br />
noch für einen weiteren Vorteil. In<br />
evohaus-Quartieren müssen sich die<br />
Bewohner nicht vor Energiepreiserhöhungen<br />
fürchten. Im Gegenteil.<br />
Je höher der Eigenverbrauch des selbst<br />
erzeugten Stroms, um so günstiger wird<br />
der Kilowattpreis.<br />
FELIX KURZ<br />
www.evohaus.com<br />
64 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
65
START-UPS<br />
UFO GESICHTET<br />
Nachhaltig, ökologisch und dynamisch –<br />
dafür steht die h-aero® Produktfamilie der Hybrid-Airplane<br />
Technologies GmbH (HAT) aus Baden-Baden. Das Hybridflugzeug<br />
soll sich zunächst als das innovativste, umweltfreundlichste<br />
luftgestützte Trägermedium für Beobachtungs-, Forschungsund<br />
Kommunikationsanwendungen und nachgelagert für<br />
Mobilitäts- und Transportanwendungen etablieren. Die wichtigsten<br />
Kundennutzen bestehen in der Flugdauer (bis zu mehreren<br />
Tagen, perspektivisch 24/7) und der ausgeprägten Sicherheit<br />
und Umweltfreundlichkeit des neuartigen Flugkonzepts,<br />
das eine Kombination aus Flugzeug, Hubschrauber<br />
und Ballon ist.<br />
www.h-aero.com<br />
CLUB LIFE<br />
NEUES AUS<br />
DER GRÜNDERSZENE<br />
Zwischen Bruchsal und Bühl, Ettlingen und Landau in der Pfalz<br />
gibt es viele geniale und innovative Köpfe. Mit seinen kreativen und<br />
erfolgreichen Start-ups kann sich die TechnologieRegion Karlsruhe<br />
sehen lassen.<br />
KNIGHT RIDER<br />
PER STECKER<br />
Ein altes Auto einfach smart machen –<br />
das macht PACE Link. Zusammen mit der<br />
App für iOS oder Android kann der Fahrer<br />
10 smarte Funktionen nutzen, etwa ein<br />
Fahrtenbuch, Fehlercodes auslesen, das<br />
Auto orten, einen Notruf absenden oder<br />
die günstigste Tankstelle im Umkreis<br />
finden. Einfach den OBD2-Stecker<br />
einstecken und schon wird das Auto zum<br />
Smartcar. Die Schnittstelle ist bei allen<br />
Autos ab 2001 (Benziner) und 2004<br />
(Diesel) vorgeschrieben. Ob das Auto mit<br />
dem PACE Link kompatibel ist, lässt sich<br />
mit wenigen Klicks ermitteln.<br />
www.pace.car<br />
Illustration Felicitas Riffel – Werbeagentur von Schickh<br />
Das Vereinsleben in den digitalen<br />
Raum verlagern, das kann nicht<br />
funktionieren, denn ein Verein<br />
lebt vom Zusammenkommen der<br />
Mitglieder. Das zu koordinieren ist<br />
mitunter gar nicht so einfach. Da<br />
kommt die in Karlsruhe entwickelte<br />
App Klubraum ins Spiel. Als eine<br />
Art privates soziales Netzwerk,<br />
bietet die App eine Plattform,<br />
die genau auf die Bedürfnisse von<br />
größeren Gruppen und Vereinen<br />
zugeschnitten ist. Immer im Fokus:<br />
einfache Kommunikationswege<br />
und das soziale Miteinander, das<br />
Vereine so wertvoll macht. Ob die<br />
Bildung von Fahrgemeinschaften<br />
zum Treffpunkt, schnelle Absprachen<br />
mit dem Kursleiter oder<br />
Kalender – ein Tool für den gesamten<br />
Verein. Kostenlos und für iOS<br />
und Android.<br />
www.klubraum.com<br />
67<br />
66 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
67
„VERLASSE DIE WELT<br />
EIN BISSCHEN BES-<br />
SER, ALS DU SIE VOR-<br />
GEFUNDEN HAST“<br />
„CHANCEN ERKENNEN<br />
UND ETWAS<br />
DARAUS MACHEN“<br />
CORNELIA PETZOLD-SCHICK<br />
Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal<br />
MARGRET MERGEN<br />
Oberbürgermeisterin der Stadt Baden-Baden<br />
68 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
Foto Simone Staron<br />
Mussten Sie in Ihrem Leben schon einmal einen beruflichen<br />
Neuanfang wagen?<br />
Ich sage Kindern und Jugendlichen immer, ich bin nicht als<br />
Oberbürgermeisterin auf die Welt gekommen. Ich habe in<br />
meinem Leben mehr als einen beruflichen Neuanfang gewagt.<br />
Begonnen habe ich meine berufliche Karriere nach dem Abitur<br />
mit einer Banklehre. Danach habe ich beim Landeskriminalamt<br />
Wirtschaftskriminalitätsdelikte bearbeitet. Parallel dazu habe ich<br />
Jura studiert und erst danach die kommunalpolitische Laufbahn<br />
eingeschlagen. Für mich bedeutete beruflicher Neuanfang immer<br />
neue Chancen und Potenziale, insofern war es immer auch ein<br />
Wagnis, das ich wegen der Visionen und den damit verbundenen<br />
Gestaltungsmöglichkeiten eingegangen bin. Dies galt auch für die<br />
Entscheidung für das Amt der Oberbürgermeisterin zu kandidieren.<br />
Da es ein Wahlamt ist, war es im Vorfeld mit einem schwer zu<br />
kalkulierenden Unsicherheitsfaktor verbunden.<br />
Was macht Ihren Job zum schönsten Job der Welt?<br />
Ich habe viele Gestaltungsmöglichkeiten. Zusammen mit den<br />
verschiedenen städtischen Akteuren wie Unternehmen, Vereinen,<br />
caritativen Institutionen, Kirchen, von denen ich viele Impulse<br />
erhalte, kann ich meine Visionen von einer modernen Stadt umsetzen.<br />
Mit den Menschen dazu ins Gespräch zu gehen, ihre Ideen<br />
zu hören und aufzunehmen, sie zu überzeugen, zu begeistern und<br />
mitzuziehen, das ist das, was meinen Job zum schönsten Job der<br />
Welt macht.<br />
Was hat Sie in Ihrem Leben inspiriert oder motiviert?<br />
Das pfadfinderische Leitmotiv „Verlasse die Welt ein bisschen<br />
besser, als du sie vorgefunden hast“ ist für mich in meinem Leben<br />
handlungsleitend. Außerdem sind Menschen mit großen Visionen,<br />
die diese gelebt und sich auch gegen Widerstände durchgesetzt<br />
haben, für mich inspirierend, wie zum Beispiel Nelson Mandela.<br />
Ich bewundere, dass er nach dreißig Jahren Gefängnis noch Kraft<br />
für weitere politische Aktionen hatte.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder in<br />
welchen Bereichen mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Margret Mergen ist eine sehr gut strukturierte Oberbürgermeisterin<br />
mit einem hohen Finanz- und Wirtschaftssachverstand und<br />
viel Freude an neuen Herausforderungen. Ihre Stärke ist, dass<br />
sie die Themen systematisch aufarbeitet, von den verschiedenen<br />
Perspektiven aus beleuchtet und dadurch richtungsweisende<br />
Innovationen, gerade für die TechnologieRegion, angestoßen hat.<br />
Das schätze ich sehr an ihr. Im Übrigen ist Baden-Baden natürlich<br />
eine Stadt, die mit einem ganz besonderen Charme lockt. Das<br />
passt gut zu ihr.<br />
Haben Sie auch das Gefühl, dass wir immer häufiger mit<br />
Krisen konfrontiert werden und uns deshalb auch beruflich<br />
immer häufiger neu orientieren müssen?<br />
Es scheint tatsächlich, dass schwierige Situationen wie etwa die<br />
Finanz- oder die Flüchtlingskrise, aber auch die Klima- und jetzt<br />
die Corona-Krise, immer häufiger zu ganz besonderen Herausforderungen<br />
für uns werden. Zudem wächst die Innovationsgeschwindigkeit<br />
exponentiell: Wissen und Austausch in Echtzeit durch die<br />
Digitalisierung ist längst zur Normalität geworden. Das Positive<br />
dabei ist, dass immer mehr Menschen jederzeit über alles im Bilde<br />
sein und im Grunde weltweit kommunizieren können. Bei alledem<br />
immer die nötige Balance zu finden und angemessen zu reagieren,<br />
erfordert auch von mir Gelassenheit und Fingerspitzengefühl.<br />
Woher schöpfen Sie Kraft, was sind Ihre Energiequellen,<br />
wenn Sie den Weg aus der Krise gehen müssen?<br />
Für mich ist der aktuelle Augenblick immer der Wichtigste: also<br />
der Mensch, der mir gerade gegenübersteht, ist für mich in dem<br />
Moment der Wichtigste. Zudem lege ich Freude über gelungene<br />
Dinge immer doppelt, und Dinge, die nicht so optimal liefen, nur<br />
zur Hälfte auf die Waage, getreu dem Motto „Geteilte Freude ist<br />
doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid“. Das hat mir<br />
in meinem bisherigen Leben ganz gut geholfen und wird es sicher<br />
auch künftig.<br />
Welchen Beruf haben Sie sich als Kind immer gewünscht?<br />
Schon als kleines Mädchen war mein Berufswunsch, am liebsten<br />
gleichzeitig Meeresforscherin und Weltraumforscherin zu werden.<br />
Den Dingen auf den Grund zu gehen und etwas zu bewegen – ja,<br />
das hat mich schon immer fasziniert.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder in<br />
welchen Bereichen mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Ich lerne gerne vom Erfolg angesehener und in der Bürgerschaft<br />
fest verankerter Kolleginnen und Kollegen. Ich erlebe Kollegin<br />
Cornelia Petzold-Schick als innovationsorientierte und experimentierfreudige<br />
OB. Deswegen würde ich gerne Innovationen<br />
ausprobieren, etwa in Kooperation mit der Wirtschaft, beispielsweise<br />
mit dem Unternehmen SEW Eurodrive in Bruchsal. Mit<br />
dem Installieren induktiver Elektrolademöglichkeiten auf unseren<br />
öffentlichen Parkplätzen hätten wir keine Probleme mehr mit<br />
Ladesäulen und Ladekabeln. Das wäre ein herausforderndes Ziel.<br />
Foto Christine Haumann-Frietsch<br />
69
MOBILITÄT<br />
INITs Systeme zur Auslastungsprognose ermöglichen Abstandhalten im ÖPNV.<br />
#INITTOGETHER<br />
ZUSAMMENSTEHEN IN PANDEMIEZEITEN<br />
Gemeinsam sind wir stärker: Dafür steht #INITtogether. Es ist der Leitspruch von INIT in dieser so besonderen<br />
Zeit, die sich in zahlreichen Branchen verheerend auswirkt. Als IT-Lieferant von Verkehrsunternehmen,<br />
die weltweit mit einem drastischen Rückgang der Fahrgastzahlen zu kämpfen haben, sieht sich INIT<br />
derzeit noch mehr als sonst gefordert, mithilfe von neuen Technologien zur Bewältigung dieser Krise beizutragen.<br />
Schnell wurden deshalb Lösungen entwickelt, die das Abstandhalten im öffentlichen Nahverkehr<br />
ermöglichen und so das Vertrauen der Fahrgäste in die Sicherheit des ÖPNVs stärken. Denn bei INIT sind<br />
wir überzeugt: Die COVID-19-Pandemie wird den Trend zu einer nachhaltigen Mobilität nur kurzfristig<br />
unterbrechen.<br />
Foto iStock.com/Adrian Selige<br />
Foto © INIT<br />
Kreditkarte am Bordrechner: Die INIT Lösungen für kontaktloses Bezahlen sind weltweit im Einsatz.<br />
#INITTOGETHER: INNOVATIVE<br />
IT-LÖSUNGEN FÜR HERAUS-<br />
FORDERNDE ZEITEN<br />
Überfüllte Busse und Bahnen zu vermeiden<br />
ist das Gebot der Stunde – und<br />
INIT bietet seit 2020 die passenden<br />
Systeme an, um den Besetztgrad von<br />
Bussen und Bahnen in Echtzeit zu ermitteln<br />
und zu steuern. Erfasst werden<br />
die ein- und aussteigenden Fahrgäste<br />
mittels des Sensors eines INIT Tochterunternehmens,<br />
der in seiner Genauigkeit<br />
weltweit einzigartig ist. Durch<br />
INIT Software wird die Auslastung der<br />
Fahrzeuge dann präzise berechnet.<br />
So werden die Mitarbeitenden in der<br />
Leitstelle in der Folge dabei unterstützt,<br />
volle Fahrzeuge zu identifizieren<br />
und entsprechend gegenzusteuern.<br />
Die Informationen über die Auslastung<br />
einzelner Fahrzeuge können<br />
Verkehrsunternehmen auch ihren<br />
Fahrgästen zur Verfügung stellen –<br />
z.B. über Apps oder andere Medien<br />
der Fahrgastinformation – und es<br />
ihnen so erleichtern, auf weniger volle<br />
Verkehrsmittel auszuweichen. Auch<br />
beim Fahrscheinkauf gilt es Abstand zu<br />
halten. Aus diesem Grund bietet INIT<br />
den Verkehrsunternehmenneben ihren<br />
Verkaufs- und Fahrgastterminals verschiedene<br />
Lösungen für kontaktloses<br />
Bezahlen beim Fahrer oder an Vorverkaufsstellen<br />
an, z. B. über modernste<br />
Fahrscheindrucker und Kartenlesegeräte.<br />
Alle Varianten reduzieren den<br />
Kontakt im Vergleich zur Barzahlung.<br />
Und diese Lösungen kommen an: Weltweit<br />
sind zahlreiche INIT Systeme für<br />
kontaktloses Ticketingim Einsatz.<br />
So zählen beispielsweise die Verkehrsunternehmen<br />
aus Nottingham,<br />
Portland, Turku und seit Kurzem auch<br />
Oldenburg zu INITs Kunden.<br />
#INITTOGETHER: NEUE WEGE<br />
ZUR PFLEGE DER KUNDENBE-<br />
ZIEHUNGEN<br />
Die engen Beziehungen zu den Kunden<br />
trotz erschwerter Bedingungen pflegen<br />
und ausbauen und Projekte termingerecht<br />
abschließen: Das hat für INIT<br />
auch in Zeiten von Corona höchste<br />
Priorität. Auch dann, wenn der Kunde<br />
auf der anderen Seite des Erdballs sitzt.<br />
So wurden für das Verkehrsunternehmen<br />
ORCA in Seattle, USA, mithilfe<br />
von acht Kameras die Funktionen<br />
der beauftragten Ticketinggeräte live<br />
demonstriert und ein aus mehr als<br />
100 Punkten bestehender Testplan<br />
erfolgreich absolviert. Denn wo kein<br />
persönliches Zusammentreffen möglich<br />
ist, findet INIT andere Formen der<br />
Interaktion. Das galt auch für die von<br />
den Vertretern der Verkehrsunternehmen<br />
sehr geschätzte Anwendertagung,<br />
die kurzerhand in den virtuellen<br />
Raum verlegt wurde. Live-Streams in<br />
Deutsch und Englisch versorgten die<br />
Teilnehmenden mit aktuellen Informationen<br />
über neuste INIT Technologien;<br />
virtuelle Meetingräume boten anschließend<br />
die Gelegenheit zum fachlichen<br />
Austausch.<br />
#INITTOGETHER: WEITERHIN<br />
MIT VOLLEM EINSATZ FÜR<br />
NACHHALTIGE MOBILITÄT<br />
Schnell und flexibel auf die neue Situation<br />
reagiert hat INIT auch in Bezug<br />
auf die Belegschaft: Bereits seit einem<br />
Jahr arbeiten die Angestellten weltweit<br />
größtenteils aus dem Homeoffice –<br />
eine hochmoderne und selbstverständlich<br />
den höchsten Sicherheitsstandards<br />
angepasste IT-Infrastruktur macht das<br />
möglich. So konnte, anders als in vielen<br />
anderen Branchen, effizient weitergearbeitet<br />
werden.<br />
Damit blieb es den INIT Mitarbeitenden<br />
weiterhin möglich, sich mit ganzer<br />
Leidenschaft für eine nachhaltige Mobilität<br />
einzusetzen und den ÖPNV mit<br />
kreativen und innovativen IT-Lösungen<br />
voranzubringen. Dieses Engagement<br />
und diese Begeisterung sind, ebenso<br />
wie Teamgeist, flache Hierarchien und<br />
Agilität, integraler Bestandteil der INIT<br />
Unternehmenskultur. Auch dafür steht<br />
#INITtogether.<br />
ANETTE AUBERLE<br />
www.initse.com<br />
70 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
71
Anzeige<br />
Stadt Karlsruhe<br />
Wissenschaftsbüro<br />
MOBILITÄTS-<br />
Mehr Mobilität und zeitgleich weniger Verkehr, wer wünscht sich das<br />
nicht. Aber wie lässt sich Mobilität im Alltagsleben umsetzen, ohne dass<br />
die mittlerweile vielmals außer Rand und Band geratenen Verkehrsflüsse<br />
Mensch und Umwelt komplett überfordern und zum Kollaps bringen?<br />
Kostenfreies<br />
WLAN<br />
Unbegrenzt im<br />
Internet surfen?<br />
MACHER<br />
MODERNE VERKEHRSKONZEPTE KOMMEN IN<br />
ZUKUNFT AUS KARLSRUHE<br />
Foto pexels.com/Zhang Kaiyv<br />
Mit dieser und ähnlichen Fragen beschäftigt sich das im Oktober 2020<br />
neu eröffnete und deutschlandweit einmalige „Baden-Württemberg<br />
Institut für Nachhaltige Mobilität“ (BWIM) in Karlsruhe.<br />
Liefern soll die funkelnagelneue<br />
Institution relevante, wissenschaftliche<br />
Grundlagen für ansprechende<br />
und nachhaltige Mobilitätskonzepte,<br />
insbesondere für den öffentlichen<br />
Nahverkehr wie Bus und Bahn. Dazu<br />
werden die Kompetenzen sämtlicher<br />
Hochschulen in Baden-Württemberg<br />
gebündelt und zentral von der Hochschule<br />
Karlsruhe - Technik und<br />
Wirtschaft gesteuert. Das Umsetzen<br />
der kreativen Projekte ist der Motor,<br />
die Folgen des Klimawandels möglichst<br />
rasch in den Griff zu bekommen.<br />
Städte, Kommunen und Verkehrsbetriebe<br />
aus dem ganzen Land können<br />
sich also auf Unterstützung der<br />
Mobilitäts-Ideenschmiede für originelle<br />
Verkehrslösungen freuen.<br />
Dafür investiert die Landesregierung<br />
650.000 Euro bis Anfang 2022,<br />
danach soll es eine dauerhafte Förderung<br />
geben. Der Klimaschutz ist eine<br />
der zentralen Aufgaben in Zeiten wie<br />
diesen, und auch das Land Baden-<br />
Württemberg will sich natürlich nicht<br />
vor der Verantwortung drücken,<br />
seinen Beitrag dazu zu leisten. „Es ist<br />
ein entscheidender Schritt bei der<br />
Bekämpfung der Folgen des Klimawandels,<br />
und dabei vorauszudenken<br />
und nachhaltige und innovative Konzepte<br />
für Mobilität im Sinne<br />
des Klimaschutzes zu entwickeln,“ sagte<br />
Wissenschaftsministerin Theresia<br />
Bauer bei der Institutseröffnung.<br />
NETWORKING<br />
Das BWIM (Baden-Württemberg<br />
Institut für Nachhaltige Mobilität)<br />
ist eine Fortführung des Reallabors<br />
„GO Karlsruhe!“ und hat Rückendeckung<br />
vom Verkehrsministerium<br />
Baden-Württemberg. Ziel ist, relevantes<br />
Know-how in einer „Kompetenzlandkarte“<br />
aus den Bereichen<br />
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und<br />
Verwaltung zusammenzubringen.<br />
Seit dem Start wird unter Hochdruck<br />
an einer Aufstellung der vorhandenen<br />
Professuren aller staatlichen Hochschulen<br />
gearbeitet.<br />
Die ersten Kontakte im Rahmen einiger<br />
Projektideen sind schon geknüpft<br />
und Prof. Dr. Christoph Hupfer,<br />
Institutsleiter und Studiendekan des<br />
Bachelorstudiengangs Verkehrssystemmanagement<br />
an der Hochschule<br />
Karlsruhe, ist sich sicher: „Wir werden<br />
nicht nur darüber reden, wie nachhaltige<br />
Mobilität geht, sondern diese<br />
auch auf die Straße bringen, auch in<br />
neuen Konstellationen und mit unkonventionellen<br />
Ideen. Wir müssen jetzt<br />
etwas tun – für den Klimaschutz und<br />
die Lebensqualität in der Stadt und<br />
auf dem Land.“ >><br />
In Karlsruhe mit KA-WLAN –<br />
in der Region mit BADEN-WLAN.<br />
Verfügbar an immer mehr Orten.<br />
Nutzen Sie nach einmaliger<br />
Registrierung KA-sWLAN<br />
und BADEN-sWLAN sogar<br />
verschlüsselt!<br />
Sicher surfen mit<br />
KA-sWLAN und<br />
BADEN-sWLAN!<br />
© Stadt Karlsruhe | Layout: Streeck |<br />
Bild: Dennis Dorwarth Photographie<br />
Alle Informationen<br />
und Hotspots unter:<br />
www.ka-wlan.de<br />
72 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL
Foto Tobias Schwerdt<br />
>><br />
WISSEN IST MACHT<br />
Auch Weiterbildung in nachhaltigen<br />
Disziplinen ist gefragt wie nie, deshalb<br />
ist mit der Mobilitätszentrale<br />
Baden-Württemberg ein zertifiziertes<br />
Weiterbildungsangebot im Mobilitätsmanagement<br />
für die Landesverwaltungen<br />
entwickelt worden. Die Chancen<br />
stehen gut, dass wir in absehbarer<br />
Zeit auf einen „Nachhaltigkeitslehrer“<br />
treffen oder die Hilfe eines Mobilitätsbeauftragten<br />
in Anspruch nehmen<br />
können. Dazu wird ein Pilotlehrgang in<br />
der ersten Jahreshälfte <strong>2021</strong> gestartet.<br />
Auch der Landeselternverband<br />
und Mitglieder der „fridays for future“<br />
Bewegung haben sich zusammengetan<br />
und basteln derzeit an einem Weiterbildungskonzept<br />
mit dem humorvollen<br />
Arbeitstitel „Mobilitätskäpsele“.<br />
SPEED-DATING FÜR NACH-<br />
HALTIGE MOBILITÄTSIDEEN<br />
SPEED-DATING FÜR NACH-<br />
HALTIGE MOBILITÄTSIDEEN<br />
Schon zum Einstand des neuen Instituts<br />
wurden bei einem Speed-Dating<br />
die neuesten Ideen für nachhaltige<br />
Mobilität gesammelt. An mehreren<br />
Treffpunkten konnten je zwei Teilnehmer<br />
ihre Ideen unter dem Motto<br />
„Gemeinsam sind wir einfach besser<br />
unterwegs!“ diskutieren. In einem<br />
abschließenden Pitch wurden die<br />
verschiedenen Projekte vorgestellt, die<br />
mithilfe des BWIM umgesetzt werden<br />
sollen. Verkehrsministerin Theresia<br />
Bauer möchte die Wartezeit des Weges<br />
in ländlicheren Gebieten zur ÖPNV-<br />
Haltestelle deutlich verringern und<br />
träumt davon, „dass wir individuellere,<br />
kleinere, sauberere Fahreinheiten auf<br />
die Straße bringen und diese werden<br />
wohl autonom sein müssen“. Sie<br />
möchte, „dass jeder Campus, der<br />
über 50 Hochschulen im Land in<br />
Zukunft Vorzeigeräume werden,<br />
Zukunftslabore für emissionsfreie<br />
Mobilität, an denen man erleben<br />
kann, wie nachhaltige Mobilität<br />
funktionieren kann, um Begeisterung<br />
bei der Bevölkerung zu wecken.“<br />
Minister Hermann macht sich stark<br />
dafür, Übergangsräume zu schaffen<br />
zwischen der Stadt und dem ländlichen<br />
Raum in Form von Co-Working-<br />
Stations, um Berufspendeln zu verringern<br />
oder ganz zu vermeiden,<br />
„die öffentliche Versorgung der<br />
kurzen Wege führt zu weniger<br />
Emissionen und vermeidet Stress“.<br />
FAHRRAD-RALLYE ZUM START<br />
DER STIFTUNGSPROFESSUR<br />
RADVERKEHR<br />
Anfang März hatte die Hochschule<br />
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft<br />
unter dem Motto „Auf dem Weg zur<br />
Radprof.“ ein breites Publikum zu<br />
einer Fahrrad-Rallye eingeladen.<br />
Mit einem funktionstüchtigen Fahrrad<br />
und einem Smartphone konnte sich<br />
jeder Interessierte daran beteiligen.<br />
Erstmals fördert das Bundesministerium<br />
für Verkehr und digitale Infrastruktur<br />
(BMVI) an sieben Hochschulen<br />
Professuren für den Radverkehr. Ziel<br />
ist es, die Wünsche von Radfahrern<br />
in einem nachhaltigen Mobilitätsmix<br />
unter einen Hut zu bringen – von der<br />
Infrastrukturplanung über Mobilitätsmanagement<br />
bis zur fahrradfreundlichen<br />
Gesetzgebung.<br />
MOBILITÄT<br />
BRUCHSAL<br />
INNOVATIONSSTANDORT<br />
MIT HOHER LEBENSQUALITÄT<br />
„Kennzeichnend für Bruchsal ist sein dynamisches Wachstum. Bruchsal hat sich in den vergangenen<br />
Jahren zu einem bedeutenden Mittelzentrum und Innovationsstandort innerhalb der Technologie-<br />
Region Karlsruhe entwickelt“, sagt Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick.<br />
Bruchsal beheimatet neben zahlreichen<br />
innovativen Unternehmen einen der<br />
größten Global Player der Antriebstechnik.<br />
Um den Bruchsaler Bahnhof<br />
herum entwickelt sich westlich der<br />
Gleise mit der Bahnstadt ein modernes,<br />
urbanes Wohnumfeld, während östlich<br />
eine lebendige Innenstadt nur wenige<br />
Gehminuten entfernt ist.<br />
Es ist genau diese Mischung, die<br />
Bruchsal ausmacht. „Nicht ohne Stolz<br />
können wir heute sagen, dass es sich in<br />
Bruchsal gut leben und arbeiten lässt.<br />
Dafür haben wir uns als Stadt schon<br />
früh den Herausforderungen gestellt<br />
und mutig den <strong>Aufbruch</strong> in das digitale<br />
Zeitalter gewagt“, so Cornelia Petzold-<br />
Schick. Transformationsprozesse aktiv<br />
zu gestalten, genau das ist das Credo<br />
der Politik in Bruchsal. Dabei geht es<br />
konkret darum, gute Rahmenbedingungen<br />
für den Ausbau und die Ansiedelung<br />
innovativer Unternehmen zu schaffen<br />
und den Bürgern sowie den Fach- und<br />
Nachwuchskräften, die mit ihren Familien<br />
nach Bruchsal kommen, ein gutes<br />
Lebensumfeld zu bieten. „Dazu haben<br />
wir mit allen Akteuren vor Ort die Vision<br />
einer wirtschaftlich kraftvollen und<br />
von gemeinschaftlichen Innovationen<br />
geprägten Zukunft entwickelt“, ist die<br />
Oberbürgermeisterin überzeugt.<br />
Schon heute ist in Bruchsal die Zukunft<br />
an vielen Orten erlebbar. Sie trägt<br />
dabei Namen wie Zeo, Max und Moritz.<br />
46 „Zeos“ sind als Baden-Württembergs<br />
größte ländliche Elektro-<br />
Car sharingflotte seit vier Jahren in<br />
Bruchsal unterwegs. Sie werden ergänzt<br />
durch die Flotte des kommunalen<br />
E-Roller sharings Moritz. Für die letzte<br />
Meile stehen das Fahrradverleihsystem<br />
„KVV.nextbike“ und der MaxBus<br />
der Stadtwerke Bruchsal zur Verfügung.<br />
Zusammen mit dem Bahn- und<br />
Busangebot des Karlsruher Verkehrsverbundes<br />
KVV verknüpfen sie das<br />
Mittelzentrum mit der Region. Die<br />
Foto Hans-Peter Safranek<br />
verkehrsgünstige Lage mit Anschluss<br />
an den Bahn-Fernverkehr und die<br />
Bundesfernstraßen machen Bruchsal zu<br />
einem attraktiven Standort für Neuansiedlungen<br />
jeder Größenordnung.<br />
„Wenn wir heute ein zukunftsweisendes<br />
Mobilitätskonzept realisieren wollen,<br />
brauchen wir einen in der Region aufeinander<br />
abgestimmten ÖPNV-Ausbau.<br />
Unseren Bahnhof zu einem echten<br />
Mobilitätsdrehkreuz auszubauen, sehe<br />
ist als eine unserer wichtigsten, städtischen<br />
Aufgaben, um die Mobilität der<br />
Zukunft Realität werden zu lassen. Mit<br />
der Verlegung und Neugestaltung des<br />
zentralen Busbahnhofs gehen wir hier<br />
die ersten Schritte“, sagt die Bruchsaler<br />
Oberbürgermeisterin.<br />
EFEUCAMPUS UND HUBWERK01 –<br />
PROJEKTE „MADE IN BRUCHSAL“<br />
Anfang dieses Jahres wurde in Bruchsal<br />
Deutschlands erster autonom fahrender<br />
Roboter zur Paketauslieferung<br />
vorgestellt. Dies ist der erste große<br />
Meilenstein des Leuchtturmprojektes<br />
EfeuCampus, das durch das Land<br />
Baden-Württemberg und die Europäische<br />
Union gefördert wird.<br />
Als nächster Schritt dieses Projektes<br />
wird auf dem ehemaligen Kasernengelände<br />
die erste urbane, autonome<br />
Güterlogistik der letzten und vorletzten<br />
Meile in Echtzeit realisiert, ein<br />
wichtiger Schritt zum LastMileCityLab.<br />
Künftig werden weitere Logistik-<br />
Lösungen gemeinsam mit Projektpartnern<br />
wie SEW-Eurodrive, Volocopter,<br />
der PTV Group, big. bechtold-gruppe,<br />
dem FZI Forschungszentrum Informatik,<br />
der Hochschule Karlsruhe und dem<br />
Karlsruher Institut für Technologie<br />
entwickelt.<br />
„Innovation gepaart mit Pragmatismus,<br />
das zeichnet uns hier in Bruchsal aus.<br />
Wir probieren es aus und bringen es<br />
dann weiter hinaus in die Welt —<br />
ganz in der Tradition von Bertha<br />
Benz“, sagt Oberbürgermeisterin<br />
Cornelia Petzold-Schick.<br />
Die elektrisch angetriebenen Lastendrohnen<br />
der ebenfalls hier ansässigen<br />
Firma Volocopter sollen zukünftig<br />
ebenso ein Teil des Reallabors sein<br />
und damit auch die vorletzte Meile im<br />
Logistikprozess einschließen.<br />
„Um die Mobilität der<br />
Zukunft zu realisieren, ist<br />
eine unserer wichtigsten<br />
Aufgabe, unseren Bahnhof<br />
zum Mobilitätsdrehkreuz<br />
auszubauen.“<br />
Fast zeitgleich mit dem EfeuCampus<br />
hat Bruchsal den Zuschlag für die<br />
Landesförderung des HubWerk01<br />
erhalten, eines von zehn Digitalisierungszentren<br />
in Baden-Württemberg.<br />
80 Unternehmen, Start-ups,<br />
Hochschulen und weitere Organisationen<br />
haben sich im HubWerk01<br />
bisher zu einem starken Netzwerk<br />
zusammengefunden.<br />
Es unterstützt Start-ups, Industriepartner<br />
und Kommunen als Innovation<br />
Lab mit seinem Angebot Tomorrow<br />
Camp. Das Format dient dazu schneller<br />
und umfassender in Richtung<br />
Smart City, Smart Mobility oder<br />
Industrie 4.0 zu gelangen. Im Rahmen<br />
eines Tomorrow Camps zeichnen Unternehmen<br />
und Kommunen mit ihren<br />
Mitarbeitenden, Bürgern und weiteren<br />
Stakeholdern ein gemeinsames, konkretes<br />
Zielbild 2050.<br />
TRANSFORMATION BRAUCHT<br />
SOZIALE DIMENSION<br />
„Nur, wenn wir neben den ökonomischen<br />
Aspekten gleichermaßen auch<br />
die soziale Dimension von Nachhaltigkeit<br />
in den Blick nehmen, können<br />
wir die Transformationsprozesse<br />
erfolgreich gestalten“, sagt Oberbürgermeisterin<br />
Cornelia Petzold-Schick.<br />
Bruchsal wächst und zählt aktuell<br />
bereits über 45.000 Einwohner. Das<br />
Foto Simone Staron<br />
stellt für die Stadt eine große Herausforderung<br />
dar - ist sie doch gefordert<br />
ausreichend bedarfsgerechten und<br />
bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten.<br />
Innovative Stadtquartiere, wie sie<br />
derzeit mit der Bahnstadt realisiert<br />
werden, sowie Umlegungs- und<br />
Erschließungsmaßnahmen an verschiedenen<br />
Standorten stellen dazu<br />
die städtebauliche Entwicklung<br />
sicher. „Ein wichtiger Standortfaktor<br />
ist eine verlässliche, soziale Infrastruktur,<br />
die Eltern wie Alleinerziehenden<br />
die Vereinbarkeit von Familie<br />
und Beruf ermöglicht. Darin investieren<br />
wir seit Jahren viel“, erläutert die<br />
Oberbürgermeisterin.<br />
Mit Erfolg, denn nach 2015 wurde die<br />
Stadt 2020 bereits zum zweiten Mal<br />
mit dem Prädikat „Familienbewusste<br />
Kommune plus“ ausgezeichnet.<br />
Bruchsal überzeugt dabei mit einem<br />
vorbildlichen System der Kinder- und<br />
Schulkindbetreuung, vielen Angeboten<br />
für Jugendliche und für Senioren.<br />
„Gerade in Corona-Zeiten wird wie<br />
im Brennglas deutlich, wie bedeutsam<br />
ein familienfreundliches Umfeld nicht<br />
nur für die Entwicklung des Innovationsstandortes<br />
ist, sondern gerade für<br />
die Menschen, die in Bruchsal leben“,<br />
betont die Oberbürgermeisterin.<br />
www.bruchsal.de<br />
76 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
77
MOBILITÄT<br />
INNOVATIVES LOGISTIK- UND LIEFERKONZEPT:<br />
GÜTERTRANSPORT PER STADTBAHN<br />
Der stetig wachsende Lieferverkehr stellt Kommunen, Bürger und Logistikunternehmen vor große Herausforderungen.<br />
Haupttreiber dieser Logistik sind die rasante Dynamik des Online-Handels, die Individualisierung<br />
und eine stärker werdende Differenzierung des Angebots insbesondere für die urbane Bevölkerung.<br />
Das führt zu einem sichtbaren „Alltag“ in Karlsruhe: Straßen<br />
sind verstopft, Fahrradspuren werden durch Lieferdienste<br />
blockiert, Lieferantenfahrzeuge stehen in zweiter Reihe und<br />
sorgen für Staus im innerstädtischen Verkehr. Hier will die<br />
Gesamt initiative „regioKArgo“ künftig mit einer speziell<br />
umgerüsteten Stadtbahn Abhilfe schaffen. Güter könnten<br />
auf der Schiene in die Karlsruher Innenstadt transportiert<br />
und von dort aus klimafreundlich an die Kunden ausgeliefert<br />
werden. Unter der Federführung des Automotive Engineering<br />
Network (aen) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG)<br />
haben sich zahlreiche Partner zusammengefunden, um diese<br />
gemeinsame Vision Wirklichkeit werden zu lassen.<br />
MASSIV ANSTEIGENDE LIEFERFAHRTEN IN DER CITY<br />
Die Zunahme der Kurier-Express-Paket-Dienste (KEP) ist<br />
deutlich: Waren zum Beispiel 2018 in Karlsruhe noch täglich<br />
rund 315 Sprinter von sämtlichen Dienstleistern unterwegs,<br />
gehen Prognosen für die kommenden zwei Jahre von einer<br />
Zunahme auf rund 370 Sprinter aus, die jeden Tag in der<br />
Stadt unterwegs sein werden, um pro Einwohner im Schnitt<br />
dann jährlich 50 Pakete zuzustellen. „Hier müssen wir<br />
ansetzen“, betont Waldemar Epple, Vorstandsvorsitzender<br />
Waldemar Epple, aen (l.),<br />
und Ascan Egerer, AVG,<br />
demonstrieren symbolhaft<br />
das Vorhaben.<br />
des aen: „Wir wollen eine nachhaltige Logistik in der Region<br />
schaffen – unter Berücksichtigung sozialer, ökonomischer<br />
und ökologischer Ziele.“ Dabei sei der Ansatz klar: Es müsse<br />
ein zukunftsorientiertes, ganzheitliches und kundenzentriertes<br />
Logistikkonzept für Stadt und Region sein.<br />
„Wir wollen bereits in naher Zukunft die Technik für eine<br />
neuartige Güterstadtbahn entwickeln, welche die Kisten und<br />
Pakete mit Ökostrom und damit umweltfreundlich in das<br />
Karlsruher Stadtgebiet fahren soll“, sagt Ascan Egerer,<br />
technischer Geschäftsführer der AVG. Er ergänzt: „Wir<br />
wollen in den kommenden Monaten gemeinsam mit unseren<br />
Partnern einen ersten Prototypen einer solchen Bahn<br />
entwickeln und diesen dann ausgiebig testen.“ Das Nahverkehrsunternehmen<br />
hat jahrzehntelange Erfahrung im<br />
Stadtbahnbetrieb und genießt mit dem vor Ort erfundenen<br />
„Karlsruher Modell“ weltweites Renommee.<br />
Die Probleme des Status quo sind vielfältig und bieten viele<br />
interessante Ansatzpunkte: Immer mehr Bürger sind von<br />
Lärm und Emission des Verkehrs genervt, wertvolle Verkaufsflächen<br />
werden als Lager „entfremdet“ und KEP-Dienstleister<br />
Foto pixelgrün/aen<br />
Foto Uli Deck / dpa<br />
beliefern deckungsgleiche Gebiete. Zudem wird die knappe<br />
Infrastruktur oftmals nicht entsprechend genutzt. Es geht um<br />
Fahrzeugverfügbarkeit, Gewinnung von Personal, Mehrfachbelieferungen<br />
bei abwesenden Empfängern oder ungünstige<br />
Lieferzeitpunkte. Das aen ist hier zugleich Initiator, Vermittler<br />
und Beschleuniger von Innovation – und betont den Netzwerkgedanken,<br />
denn nur gemeinsam lassen sich diese Herausforderungen<br />
meistern. „Wir wollen dazu Anforderungen und<br />
Bedürfnisse der Anbieter und Nutzer ins Konzept einbinden“,<br />
so Epple. Dazu gelte es, technische Innovation einzubinden in<br />
effizientere Prozesse, individuelle Lösungen und ökologische<br />
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, bei denen nichtproprietäre<br />
Lösungen wichtig sind.<br />
Daher haben sich mehrere Projektpartner zusammengefunden,<br />
um mit „regioKArgo“ neue Formen des Warenladungs- und<br />
Lieferverkehrs zu untersuchen – und dann umzusetzen. „Wir<br />
wollen verstärkt den Lieferverkehr von der Straße auf die<br />
Schiene verlagern, Prozesse automatisieren, die Verteilung<br />
bündeln und die so genannte letzte Meile der Belieferung<br />
emissionsfrei gestalten“, so Epple. Hier dockt das Projekt „LogIKTram“<br />
unter der Federführung des KIT an, eine Stadtbahnbasierte<br />
Logistik, die bestehende Infrastruktur nutzt. Ein<br />
Baustein auf dem Weg, Verkehr vor Ort zu entlasten und<br />
Klima zu schützen.<br />
Dabei könnten unter anderem entsprechend umgerüstete<br />
Stadtbahnen neben dem Personentransport auch für die<br />
Beförderung von Waren eingesetzt werden. „Das vom öffentlichen<br />
Personennahverkehr bekannte und von VBK und AVG<br />
seit vielen Jahren erfolgreich betriebene ‚Karlsruher Modell‘<br />
bietet auch für diese Anwendung beste Voraussetzungen,<br />
um die Verkehrswende auch im Güter- und Warentransport<br />
zu ermöglichen – in Stadt und Region“, so Ascan Egerer,<br />
technischer Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe<br />
und der AVG.<br />
INNOVATIVE LOGISTIK- UND LIEFERKONZEPTE<br />
Bei einer Neuausrichtung des Güterverkehrs geht es unter<br />
anderem im Verbund um elektrische Zustellung, das Ausnutzen<br />
Alltag in Karlsruhe:<br />
ÖPNV, individuelle<br />
Mobilität und KEP-<br />
Dienstleister nutzen<br />
die weniger werdenden<br />
Flächen im öffentlichen<br />
Raum. Smarte Lösungen<br />
sind für eine nachhaltige<br />
Logistik in der<br />
Region nötig.<br />
verkehrsschwächerer Zeiten, die Bündelung von Prozessen,<br />
die Einbindung geeigneter IT-Werkzeuge, Mikro depots, Güter<br />
per Straßenbahn, eine effizientere Auslastung, Nachhaltigkeit,<br />
Kosten und die Nutzung von alternativen „Last mile“-<br />
Angeboten: Citylogistik muss effizienter und verträglicher<br />
werden. Es geht um einen Prozess, der alle Partner auf dem<br />
Weg mitnehmen muss, dabei aber individuelle Lösungen bietet,<br />
denn es muss eben nicht sein, dass jeder Dienstleister parallel in<br />
die Stadt liefert.<br />
Innovative Logistik- und Lieferkonzepte können einen<br />
wichtigen Beitrag dazu leisten, Verkehrsbelastungen in<br />
Städten zu reduzieren – und die fachliche Expertise ist in der<br />
Technologie Region Karlsruhe vorhanden. Deshalb sind bei<br />
„regioKArgo“ namhafte Partner mit von der Partie – ob aus<br />
dem Bereich der Mobilität, Kommunen, Forschungseinrichtungen,<br />
Logistik und andere Dienstleistungsunternehmen.<br />
Das Mobilitätsnetzwerk der Region, „Automotive Engineering<br />
Network“ (aen) bündelt dabei diese Aktivitäten.<br />
2022 SOLL EIN REALLABOR STARTEN<br />
„Das Gesamtprojekt bietet eine große Chance, die Klimawende<br />
für die TRK durch nachhaltige Konzepte als Alternative<br />
zur bisherigen Form des Gütertransports zu beschleunigen“,<br />
so Waldemar Epple, denn bei „regioKArgo“ beliefern die<br />
verschiedenen KEP-Dienstleister außerhalb der Stadt<br />
Konsolidierungscenter an Gleistrassen, automatisiert werden<br />
die Waren mit Trams gebündelt in die Stadt zu City-Hubs<br />
gebracht, von denen aus die Waren dann innerhalb der Stadt<br />
in der Feinverteilung zum Beispiel mit Lastenrädern oder<br />
autonomen Paketrobotern ausgeliefert werden können.<br />
„Die Bündelung von Logistikströmen in jeder Stufe spart<br />
deutlich Lieferverkehr“, sind sich Epple und Egerer einig –<br />
und macht die Wichtigkeit eines hohen Automatisierungsgrads<br />
im Prozess deutlich. Bereits 2022 könnte ein erster<br />
Prototyp in einem Reallabor auf die Strecke gebracht werden.<br />
JO WAGNER & MICHAEL KRAUTH<br />
www.ae-network.de<br />
78 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
79
„JEDER NEUSTART<br />
BIETET NEUE<br />
MÖGLICHKEITEN“<br />
„DER UMGANG<br />
MIT KRISEN MUSS<br />
ERLERNT WERDEN“<br />
PROF. ECKART KÖHNE<br />
Direktor Badisches Landesmuseum Karlsruhe<br />
MARTIN WACKER<br />
Geschäftsführer Karlsruhe Marketing und<br />
Event GmbH (KME)<br />
80 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
Foto ARTIS – Uli Deck<br />
Wenn Sie die Chance hätten, ihr Leben nochmal von vorne zu<br />
beginnen, was würden Sie anders machen?<br />
Ich würde versuchen, als junger Mensch noch viel mehr zu lernen,<br />
vor allem Sprachen, aber auch viel mehr Wissen. Selber etwas<br />
können bringt einen weiter, man kann schließlich nicht alles<br />
Google und künstlicher Intelligenz überlassen.<br />
Mussten Sie schon mal einen beruflichen Neuanfang wagen?<br />
Ja, mehrmals – und ich habe immer gerne neu angefangen. Ein<br />
neuer Start bietet immer viele neue Chancen und Möglichkeiten.<br />
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – stimmen Sie dem zu?<br />
Unbedingt. Wir erleben beispielsweise gerade an den Museen den<br />
digitalen Wandel, der uns viel abverlangt. Dabei wirklich Neues<br />
zu schaffen, bedeutet, ins Risiko zu gehen. Das gilt auch für viele<br />
andere Arbeitsbereiche.<br />
Woher schöpfen Sie Kraft, was sind Ihre Energiequellen,<br />
wenn Sie den Weg aus der Krise gehen müssen?<br />
Ich trenne Arbeit und Privatleben, soweit es nur möglich ist.<br />
Im Privaten das Leben zu genießen, schafft neue Energie.<br />
Carpe Diem!<br />
Was darf für Sie in einer Zusammenarbeit nicht fehlen?<br />
Zuverlässigkeit, Vertrauen und ein gemeinsames Verständnis von<br />
den Zielen, die es zu erreichen gilt. Wenn man dann noch menschlich<br />
auf einer Wellenlänge ist, kann man Großes erreichen.<br />
Was macht Ihren Job zum schönsten Job der Welt?<br />
Der Umgang mit Geschichte, Kultur und Kunst, vor allem aber<br />
mit faszinierenden Stücken aus tausenden von Jahren.<br />
Außerdem ist das Schloss sicher einer der schönsten Arbeitsplätze<br />
in Karlsruhe.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder in<br />
welchen Bereichen mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Als Künstler kreativ zu sein, darüber hinaus die kreative Energie<br />
in Ideen für Events umzusetzen und die dann perfekt zu organisieren<br />
– diese ganz verschiedenen Schritte selbst verbinden zu<br />
können, ist bewundernswert. Und dann auch noch so vieles zu<br />
realisieren – zum Staunen! Wenn man das lernen könnte, wäre<br />
ich gerne dabei.<br />
Was bedeutet für Sie <strong>Aufbruch</strong>/Neustart?<br />
<strong>Aufbruch</strong> muss nicht immer ein Neustart sein. Auch in laufenden<br />
Projekten kann es einen <strong>Aufbruch</strong> geben, denn Veränderung<br />
ist <strong>Aufbruch</strong> und damit der permanente Weg zur Verbesserung.<br />
Einen Neustart muss man hinlegen, wenn das Existierende grundsätzlich<br />
nicht mehr funktioniert. Dann lieber ein Ende mit Schrecken<br />
als ein Schrecken ohne Ende. Dazu gehört auch Ehrlichkeit.<br />
Was hat sich oder was wird sich durch die Krise verändern?<br />
Unsere Reaktionszeit MUSS sich verändern, wir müssen viel schneller<br />
reagieren. Beispielsweise hatten wir Ende März vier Tage (!) nach<br />
dem ersten Lockdown unsere Online-Plattform für Gastronomie<br />
und Handel online, gemeinsam mit Tourismus, Wirtschaftsförderung<br />
und der Handelsvertretung CIK. So muss das sein!<br />
Mussten Sie schon einmal einen Neuanfang wagen?<br />
Ja, nach dem überraschenden Ende des erfolgreichen Regionalsenders<br />
Welle Fidelitas. Von heute auf morgen standen 33 Redakteure<br />
und Mitarbeiter auf der Straße – aber viele haben dieses unschöne<br />
Ende einer Ära für einen Neuanfang genutzt. Ich wechselte die<br />
Seiten und ging in die Kommunikation und ins Event-Management,<br />
das hat mich im Nachhinein unglaublich vorangebracht.<br />
Durch Corona haben sich viele Menschen wieder auf<br />
Altbewährtes zurückbesinnt – Sie auch? Auf was?<br />
Der ausführliche Spaziergang am Wochenende und die Ruhe auf<br />
dem Weg von A nach B. Mein alter R4 von 1974 ist da das ideale<br />
Fortbewegungsmittel.<br />
Wie haben Sie sich beruflich auf <strong>2021</strong> eingestimmt?<br />
Mit meinem Team habe ich bereits 2020 den Grundstein gelegt<br />
für unsere Herangehensweise in diesem Jahr: ermöglichen, was<br />
möglich ist. Mutig bleiben und in Lösungen denken. Der Erfolg<br />
der digitalen Schlosslichtspiele und des Indoor-Meetings als reines<br />
TV-Event hat uns recht gegeben.<br />
Was würden Sie noch von dem anderen lernen wollen oder in<br />
welchen Bereichen mit dem anderen gerne einmal tauschen?<br />
Klassische Archäologie und Geschichte faszinieren mich schon immer,<br />
von daher würde ich als interessierter Laie den Wissensschatz<br />
des Wissenschaftlers im Austausch sehr genießen. Als derjenige, der<br />
aktuell die großen Erlebnisse für die Menschen in Karlsruhe koordiniert<br />
und gestaltet ist die Buchveröffentlichung von Eckart Köhne<br />
„Die Macht der Unterhaltung im antiken Rom“ hochspannend. Bei<br />
den Schlosslichtspielen sind er als Hausherr und ich als Produzent ja<br />
schon intensiv in einer erfolgreichen Kooperation, für den Standort<br />
ist die Bedeutung des Landesmuseums herausragend.<br />
Foto Jürgen Rösner<br />
81
Gemeinsam Heimat stärken<br />
Die Kraft des WIR – Chancen ergreifen<br />
Die Medienbranche gehört schon lange zu<br />
den Wirtschaftsbereichen, die von der Digitalisierung<br />
am stärksten beeinflusst werden.<br />
Der Zwang, das Geschäfts modell an die sich<br />
schnell verändernden Rahmenbedingungen<br />
anzupassen, hat sich durch die Corona-<br />
Pandemie weiter beschleunigt.<br />
Nussbaum Medien nimmt in seinem Umfeld<br />
viele Verlage wahr, die auf die zunehmenden<br />
Herausforderungen mit Optimierungsmaßnahmen<br />
ihres klassischen Geschäfts<br />
reagieren. Aus Sicht von Klaus Nussbaum<br />
reicht dies aber nicht aus. Klaus Nussbaum<br />
denkt schon immer langfristig. Da er das Ziel<br />
hat, sein Familienunternehmen in einigen<br />
Jahren an die dritte Generation zu übergeben,<br />
denkt er sogar generationenübergreifend.<br />
Dafür reicht es aber nicht aus, an der<br />
Effizienz zu arbeiten.<br />
Das Ziel von Klaus Nussbaum ist es daher,<br />
sein Medienunternehmen nochmals<br />
komplett neu zu erfinden.<br />
Darüber hinaus sollen die Chancen genutzt werden,<br />
die sich durch die Digitalisierung der Mediennutzung<br />
bzw. der gesamten Wirtschaftsprozesse<br />
ergeben. Dazu gehören nicht nur die<br />
Digitalisierung von Inhalten, sondern auch die<br />
neuen Möglichkeiten rund um die Kommunikation,<br />
digitale Transaktionen und die intelligente<br />
Personalisierung von Inhalten zu nutzen.<br />
Seit Januar 2017 ist Klaus Nussbaum alleiniger<br />
Inhaber der Verlagsgruppe Nussbaum<br />
Medien, die zu den größten Medienunternehmen<br />
im Südwesten gehört. Seitdem hat<br />
sich bei Nussbaum Medien vieles verändert.<br />
In den zurückliegenden vier Jahren wurde<br />
unter Hochdruck die „Digitale Transformation“<br />
von Nussbaum Medien eingeleitet, was<br />
im Jahr 2019 zusätzlich durch die Neugestaltung<br />
des Unternehmenslogos zum Ausdruck<br />
gebracht wurde. Das bislang Erreichte<br />
ist jedoch nur eine erste Zwischenstation;<br />
Die Veränderung der Organisation und die<br />
Entwicklung neuer digitaler Angebote hat<br />
erst begonnen.<br />
Der eingeleitete Veränderungsprozess<br />
zum datengetriebenen und transaktionsorientierten<br />
Medienunternehmen ist kein<br />
Sprint, sondern ein Marathon, der die<br />
nächsten Jahrzehnte bestimmen wird.<br />
Das Leitbild von Nussbaum Medien besteht darin,<br />
Mehrwerte für alle lokalen Geschäftspartner<br />
und gesellschaftlichen Anspruchsgruppen<br />
zu schaffen. Wenn dies zum gegenseitigen<br />
Vorteil aller erfolgt, bestehen gute Chancen<br />
auf einen nachhaltigen Erfolg. Es gilt, die Probleme<br />
der Kunden und Partner zu lösen und<br />
das Leben im Lokalen zu verbessern bzw. zu<br />
erleichtern. Zur Zielgruppe gehören praktisch<br />
alle lokalen Akteure innerhalb einer Kommune:<br />
Die Menschen (Leser, Nutzer), Verwaltungen,<br />
Vereine, Kirchen, Gewerbetreibende und viele<br />
weitere lokale/regionale Institutionen.<br />
Im Kern geht es darum, den Unternehmenszweck<br />
von Nussbaum Medien an die neuen<br />
digitalen Möglichkeiten anzupassen und<br />
dadurch den Raum an Möglichkeiten für alle<br />
zu erweitern. Mit dem angestoßenen Veränderungsprozess<br />
verändert sich auch die<br />
Rolle von Nussbaum Medien. Vom Amtsblattverlag<br />
hin zu einem aktiven Treiber<br />
und Gestalter der Digitalisierung im Lokalen.<br />
Nussbaum Medien bringt eine Vielzahl<br />
an Stärken und Kernkompetenzen mit, die<br />
es ermöglichen, eine deutlich aktivere Rolle<br />
im Stadtmarketing einzunehmen. Damit wird<br />
die Nussbaum Medien zu einem der Schlüsselakteure,<br />
der die vielen unterschiedlichen Akteure<br />
und Interessen miteinander verbindet.<br />
„Wir arbeiten an der engen Vernetzung aller Akteure zur<br />
Stärkung des Gesamtsystems. Von der wachsenden digitalen Reichweite<br />
können alle unsere Partner und Kunden profitieren.“<br />
Klaus Nussbaum<br />
Nussbaum Medien ist dabei, eine digitale<br />
Plattform aufzubauen, deren Stärke in der Vernetzung<br />
liegt. Der Vernetzung von Menschen<br />
und Institutionen, aber auch der Vernetzung<br />
unterschiedlichster Inhaltsformate und medialer<br />
Funktionalitäten. Dafür werden die<br />
umfangreichen Kernkompetenzen in den Bereichen<br />
Technologie, Content-Management<br />
und Marketing genutzt. Nunmehr geht es<br />
darum, weitere Verbündete zu finden, die<br />
die Chancen nutzen wollen, die sich über<br />
die analogen und digitalen Reichweiten der<br />
Plattformen ergeben, um damit die Chancen<br />
eines Netzwerks zu nutzen, das kontinuierlich<br />
an Attraktivität gewinnt. Denn in einem Netzwerk<br />
steigt mit jedem zusätzlichen Teilnehmer<br />
(Anbieter oder Nachfrager) der Nutzen für alle<br />
Teilnehmer exponentiell an.<br />
Das Netzwerk wächst ständig und besteht<br />
bereits aus 390 kommunalen Partnern,<br />
über 40.000 Nutzern des Redaktionssystems<br />
„Artikelstar“, über 30.000 aktiven Gewerbekunden<br />
und einer ständig wachsenden<br />
Zahl an Lesern und Nutzern.<br />
Nussbaum Medien hat das Ziel, zusammen<br />
mit möglichst vielen lokalen und regionalen<br />
Verbündeten, ein technologisches und inhaltliches<br />
Ökosystem zu schaffen, das die Region<br />
und damit den lokalen Lebensraum stärkt. Mit<br />
der „Kraft des Wir“ ist vieles möglich; eine Plattform,<br />
die das Vereinsleben und das Ehrenamt<br />
ebenso unterstützt wie das lokale Gewerbe.<br />
Die Stärkung des Gemeinwohls und der Demokratie<br />
gehört zu den zentralen Werten von<br />
Nussbaum Medien. Daher lautet der Claim:<br />
„Nussbaum – gemeinsam Heimat stärken“.<br />
Amtsblätter und lokale Wochenzeitungen<br />
Marktführer in Baden-Württemberg und<br />
Nr. 2 in Deutschland mit einer wöchentlichen<br />
Printauflage von über 1,1 Mio. Exemplaren in<br />
mehr als 380 Kommunen.<br />
Lokalmatador<br />
Aktuelles Themen- und Freizeitportal. Baustein<br />
für regionales Content-Marketing von<br />
Kommunen, Vereinen und Gewerbetreibenden.<br />
Das Portal soll langfristig zum führenden<br />
Freizeitportal für Baden-Württemberg<br />
ausgebaut werden.<br />
Im Aufbau Nussbaum App<br />
Die ganze lokale Welt in einer App. Mit personalisiertem<br />
Zugriff auf die lokalen Inhalte aus<br />
dem eigenen Wohnort und dem Umland. Für<br />
lokale Informationen, Kommunikation und<br />
Transaktionen.<br />
kaufinBW<br />
Regionaler Online-Marktplatz mit integriertem<br />
Cashback-System. Baustein für die Digitalisierung<br />
des lokalen Gewerbes und damit<br />
der Bindung regionaler Kaufkraft.<br />
Im Aufbau kaufinBW-DealApp<br />
als Basis für Nussbaum Shopping Weeks.<br />
jobsucheBW und azubiBW<br />
Portale für eine bessere Sichtbarkeit lokaler<br />
Job- und Ausbildungsplatzangebote und für<br />
das Employer Branding regionaler Arbeitgeber.<br />
Virtuelle Veranstaltungen<br />
Im März <strong>2021</strong> wurde mit den „Nussbaum<br />
Innovationstagen“ erstmals ein digitaler<br />
Kongress für kommunale Entscheider durchgeführt.<br />
Der Kongress wurde durch eine digitale<br />
Hausmesse begleitet. Dieses Angebotsformat<br />
soll weiter ausgebaut werden.<br />
Nussbaum Club<br />
Das Kundenbindungsprogramm für die Abonnenten<br />
der Nussbaum Medien-Angebote mit<br />
über 5.000 Vorteilen.<br />
gemeinsamhelfen.de<br />
Digitaler Spendenmarktplatz, bei dem 100 %<br />
der Spenden bei den lokalen Projekten ankommen.<br />
Nussbaum Stiftung<br />
Die Nussbaum Stiftung fördert Initiativen, die<br />
zukunftsorientiert das Gemeinwohl der Gesellschaft<br />
festigen und entwickeln – mit dem<br />
Ziel „Gemeinsam Heimat stärken".<br />
„Zukunftswald“ ist ein wichtiges Projekt,<br />
bei dem innerhalb der nächsten zehn Jahre<br />
100.000 Bäume für Baden-Württemberg gespendet<br />
werden sollen.<br />
Zukunftswerkstatt<br />
Digital- und Marketing-Unit für crossmediale<br />
Angebote mit Content-Management, Online-Marketing-Management<br />
und Prozess-<br />
Management. Enge Zusammenarbeit mit der<br />
internen IT-Unit „Lokalmatador Media Systems“<br />
(verantwortlich für die Lizenzierung<br />
von IT-Eigenentwicklungen wie bspw. dem<br />
Redaktionssystem „Artikelstar“) und externen<br />
IT-Partnern.<br />
Nussbaum Akademie<br />
Weiterbildungsinitiative, die die Mitarbeiter-<br />
Innen von Nussbaum Medien fit für die „Digitale<br />
Transformation“ macht. Die Akademie<br />
entwickelt aber auch Angebote für ihre Kunden<br />
und Partner.<br />
Nussbaum Gesundheitsmanagement<br />
Mit 4-Säulen-Modell aus den Bausteinen Gesundheitskurse<br />
+ Active Days + Dienstrad +<br />
Aktivurlaub.<br />
Weitere Bausteine<br />
• Selbstverpflichtung zur „Digitalen Ethik“<br />
• Geplant bis Ende <strong>2021</strong>: Beteiligung an<br />
der WIN-Charta, einem Instrument für<br />
nachhaltig wirtschaftende kleinere und<br />
mittlere Unternehmen (KMU) im Rahmen<br />
der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes<br />
Baden-Württemberg.<br />
• Nussbaum Kunstkonzept zur Schaffung<br />
einer Wohlfühlatmosphäre im Unternehmen<br />
und zur Steigerung der Identifikation<br />
mit den Unternehmenszielen.<br />
Aktuelle Auszeichnungen<br />
• 2017<br />
Nussbaum Medien erhält das familyNET-Prädikat<br />
„Familienbewusstes Unternehmen“<br />
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und<br />
Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie<br />
den beteiligten Arbeitgeberverbänden und<br />
dem Landesfamilienrat.<br />
• 2019<br />
Auszeichnung zum UnternehmerSTAR 2019<br />
in der Kategorie „Digitalisierung & Industrie<br />
4.0“ durch den Bundesverband der Mittelständischen<br />
Wirtschaft (BVMW).<br />
• 2020<br />
Nominierung für den „Mittelstandspreis für<br />
soziale Verantwortung in Baden-Württemberg“.<br />
Wahl unter die Top 5 beispielhaften<br />
Unternehmen in Baden-Württemberg.<br />
• <strong>2021</strong><br />
Verleihung des „Ehrenpreises für besondere<br />
Leistungen im Wald- und Naturschutz“ durch<br />
die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW).
REGION<br />
Visualisierung KREER Development GmbH, Köln, Entwurf: ASTOC Architects and Planners, Köln<br />
AKTIVE<br />
FLÄCHENPOLITIK<br />
STÄRKT DEN<br />
WIRTSCHAFTSSTANDORT<br />
Das Interesse der Unternehmen an Flächen in Karlsruhe ist groß.<br />
Mit Blick auf die Zukunft und gezielten Ankäufen erweitert die Stadt<br />
ihre Handlungsspielräume.<br />
Foto Stadt Karlsruhe Monika Müller-Gmelin<br />
Um dem steigenden Bedarf von Unternehmen<br />
nach Flächen entsprechen zu<br />
können, ist die Fächerstadt schon seit<br />
vielen Jahren im Bereich Immobilienentwicklung<br />
sehr aktiv. Bereits 2011<br />
legte sie in ihrem Leitbild eine nachhaltige<br />
Flächenentwicklung mit Fokus auf<br />
Innenentwicklung fest, mit dem Ziel,<br />
handlungsfähig zu sein und vor allem<br />
auch in Zukunft zu bleiben, wenn es um<br />
die Ansiedlung und Entwicklungsmöglichkeiten<br />
von Unternehmen geht. Und<br />
die Dynamik ist hoch: In den vergangenen<br />
Jahren wurden im Durchschnitt<br />
4,4 Hektar städtische Flächen pro<br />
Jahr für die Unternehmensentwicklung<br />
verschiedener Branchen verkauft.<br />
STADTBILDPRÄGEND: ENTWICK-<br />
LUNG AM HAUPTBAHNHOF SÜD<br />
Positiv zeigt sich der Verlauf auf dem<br />
Gelände südlich des Hauptbahnhofs.<br />
Nachdem der Internetanbieter 1&1 mit<br />
rund 1.800 Mitarbeitenden seine neuen<br />
Bürogebäude bezogen hat, erreichte<br />
das durch die Wirtschaftsförderung<br />
moderierte und koordinierte Leitprojekt<br />
„Entwicklungsquartier Hauptbahnhof<br />
Süd“ den nächsten Meilenstein. Derzeit<br />
liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung<br />
des städtischen Grundstücks im<br />
Westen des Areals. Bei einem Architektenwettbewerb<br />
entschied sich die Jury<br />
für den stadtbildprägenden Entwurf des<br />
Büros ASTOC Architekten.<br />
Mit dem damit verbundenen städtebaulichen<br />
Entwicklungskonzept entsteht<br />
hier ein neuer Ort der Möglichkeiten<br />
für den Standort Karlsruhe.<br />
GROSSFLÄCHEN: VORKAUFS-<br />
RECHT UND FREIER MARKT<br />
Für die Entwicklung gewerblicher<br />
Flächen bestehen allerdings auch einige<br />
Herausforderungen: Viele Potenziale<br />
sind bereits entwickelt, so zum Beispiel<br />
das ehemalige IWKA-Gelände an der<br />
Brauerstraße, das Pfaff-Gelände in<br />
Durlach oder viele Flächen auf dem<br />
ehemaligen Schlachthofgelände und<br />
heutigen Kreativpark Alter Schlachthof.<br />
Zudem konkurrieren Wohnungsmarkt<br />
mit Gewerbe und Industrie um den<br />
wertvollen Grund. Der Druck auf den<br />
Markt wächst also. Um handlungsfähig<br />
zu bleiben, agiert die Stadt Karlsruhe<br />
hier in zwei Richtungen: die Akquise<br />
von Entwicklungspotenzialen einerseits<br />
und die Arbeit im Bestand andererseits.<br />
Dazu verfolgt die Stadt bzw. die<br />
städtischen Gesellschaften eine aktive<br />
Ankaufstrategie großer Flächen für<br />
Gewerbe und Industrie. Einige Beispiele<br />
sind die Firmengelände von L’Oréal mit<br />
rund 5,5 Hektar sowie von Pfizer mit 20<br />
Hektar im Nordosten Karlsruhes. Auf<br />
dem 3 Hektar umfassenden Rotag-<br />
Areal in Grünwinkel soll Ende <strong>2021</strong> eine<br />
detaillierte Bestandsaufnahme erfolgen.<br />
Bei strategischen Flächen übt die<br />
Stadt ihr Vorkaufsrecht aus, teilweise<br />
erwirbt sie diese Flächen aber auch auf<br />
dem freien Markt.<br />
ANSPRUCHSVOLL:<br />
ARBEITEN IM BESTAND<br />
Aufwändiger und anspruchsvoller ist<br />
die Flächenentwicklung im Bestand.<br />
Hier gibt es wertvolle Erfahrungswerte<br />
aus dem REGEKO-Prozess – der<br />
Flächenaktivierung im Gewerbegebiet<br />
Grünwinkel. REGEKO steht für Ressourcenoptimiertes<br />
Gewerbeflächenmanagement<br />
durch Kooperation.<br />
Unter Einbeziehung der dort ansässigen<br />
Unternehmen wurden mittel- und<br />
langfristige Konzepte entwickelt, um<br />
Flächen unter Gesichtspunkten der<br />
Nachhaltigkeit zu revitalisieren. Aus<br />
den Erfahrungen in diesem Prozess hat<br />
sich ein interdisziplinäres städtisches<br />
Team zur Flächenentwicklung gebildet.<br />
Beteiligt sind die Wirtschaftsförderung,<br />
das Stadtplanungsamt sowie das<br />
Umweltamt. In dieser Zusammensetzung<br />
soll die Arbeit an bestehenden<br />
Arealen erfolgen.<br />
JEDER ARBEITSPLATZ IST EIN<br />
GEWINN FÜR DIE STADT<br />
Laut einer Analyse der Prognos AG von<br />
2019 im Auftrag der Stadt zahlt sich<br />
die Investition und der Aufwand, den<br />
die Stadt derzeit im Zuge der Immobilienentwicklung<br />
betreibt, spürbar aus.<br />
Jeder Arbeitsplatz spült jährlich bis zu<br />
3.300 Euro in die Stadtkasse zurück –<br />
abhängig davon, wo der Arbeitnehmer<br />
oder die Arbeitnehmerin wohnt. Neue<br />
Unternehmen ziehen zudem indirekte<br />
und induzierte Arbeitsplätze mit sich,<br />
die wiederum fiskalisch positiv wirken.<br />
Die Planungshorizonte im Bereich der<br />
Immobilienentwicklung sind lang. Das<br />
macht eine vorausschauende Flächenpolitik<br />
auf der Grundlage langfristiger<br />
strategischer Überlegungen unabdingbar.<br />
Wie die Auswirkungen von<br />
Covid19 auf die Weltwirtschaft und<br />
den Bedarf an Immobilien sein werden,<br />
bleibt abzuwarten. Das Ziel ist und<br />
bleibt es, auch in Zukunft handlungsfähig<br />
zu sein, um aktiv und gestaltend<br />
für die in der Fächerstadt ansässigen<br />
Unternehmen sowie die ansiedlungswilligen<br />
Unternehmen und Investoren<br />
tätig sein zu können.<br />
ANDREA SCHOLZ<br />
Stellvertretende Leiterin der<br />
Wirtschaftsförderung Karlsruhe<br />
84 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
85
Foto Jana Marzinkowski<br />
DIE NEUE FRAU AN<br />
DER AOK-SPITZE<br />
Seit Dezember 2020 hat der größte Versicherer in der Region,<br />
die AOK Mittlerer Oberrhein, eine neue Geschäftsführung.<br />
Petra Spitzmüller leitet nun die Geschicke der Krankenversicherung.<br />
Sie waren 13 Jahre in der Ortenau und<br />
am südlichen Oberrhein stellvertretende<br />
AOK Geschäftsführerin, haben auch dort<br />
Ihre Ausbildung gemacht: Warum sind<br />
Sie der AOK so treu verbunden?<br />
Zunächst ist die AOK ein attraktiver<br />
Arbeitgeber und es gibt immer neue<br />
Herausforderungen, die die Arbeit so<br />
abwechslungsreich machen, denn das<br />
Gesundheitswesen ist ein sehr dynamischer<br />
Zweig. Außerdem ist mein Beruf<br />
sehr sinnstiftend: Was ist wichtiger, als<br />
im Gesundheitswesen dazu beizutragen,<br />
dass die Mitglieder gesund bleiben?<br />
Der dritte Punkt: Ich konnte Familie<br />
und Beruf sehr gut unter einen Hut<br />
bringen, auch mit zwei Kindern.<br />
Warum passt das Leitmotiv<br />
<strong>Aufbruch</strong> so gut zur AOK?<br />
Die Identität der AOK setzt sich aus<br />
den Worten Gesundheit und Nähe<br />
zusammen: „Gesundnah“ lautet das<br />
Motto. Das leitet uns und bringt auch<br />
zeitgleich ganz neue Herausforderungen<br />
mit sich: Die Menschen werden älter,<br />
der technische Fortschritt wird rasanter<br />
und die Digitalisierung immer wichtiger.<br />
Diese Facetten müssen wir mit unserer<br />
Identität in Einklang bringen, damit wir<br />
uns zukunftsfähig aufstellen können.<br />
Wir sind also auch im <strong>Aufbruch</strong>, ständig<br />
im Wandel und deswegen passt das<br />
Thema so gut zu uns. (lacht)<br />
Als Arbeitgeber haben wir es geschafft,<br />
angetrieben durch Corona, größtenteils<br />
auf Homeoffice umzustellen.<br />
Über 50 Prozent der Mitarbeitenden<br />
arbeiten von zuhause aus. Wir möchten<br />
uns aber noch besser aufstellen: Wie<br />
funktioniert Leadership im Homeoffice,<br />
welche neuen Tools gibt es, um<br />
noch flüssiger von zuhause arbeiten zu<br />
können? Und vor allem stellen wir uns<br />
tagtäglich die Frage: Wie können wir<br />
unsere Kunden sicher durch die Krise<br />
bringen? Daran arbeiten wir derzeit und<br />
das wird uns noch eine Weile begleiten.<br />
Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?<br />
Ich möchte die AOK in der Region noch<br />
mehr vernetzen, in die Firmen gehen<br />
und uns dort mit unseren Kompetenzen<br />
einbringen. Betriebliche Gesundheit<br />
ist ein großes Thema. Ich wünsche mir,<br />
dass wir voneinander lernen in allen<br />
Bereichen. Ich möchte mich verstärkt<br />
in politische Themen einbringen und<br />
mitdiskutieren. Nehmen wir beispielsweise<br />
den Ärztemangel. Hier möchte<br />
ich mehr bewegen in der Region.<br />
Eine große Vision ist die Digitalisierung.<br />
Unser Motto „Gesundnah“ muss auch<br />
digital von unseren Kunden erfahrbar<br />
gemacht werden. Es muss nicht nur<br />
menschliche, sondern auch digitale<br />
Nähe gelebt werden. Heißt konkreter:<br />
Noch beim Menschen sein durch unsere<br />
Kundencenter und unsere gute Telefonhotline<br />
und zeitgleich die Generation<br />
mitnehmen, die Tag und Nacht online<br />
unterwegs ist. Da habe ich zuhause<br />
auch das passende Testpublikum: Meine<br />
beiden Söhne, die in jeder Lebenslage<br />
testen, was sie digital erledigen können.<br />
Erst wenn es komplizierter wird, suchen<br />
sie den persönlichen Kontakt. Der wird<br />
also nie ganz wegfallen. Es gibt kein<br />
„entweder - oder“, sondern ein „sowohl<br />
als auch“. Digitalisierung und Kundennähe<br />
gehen weiterhin Hand in Hand.<br />
Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?<br />
In Corona-Zeiten: Von einer Videokonferenz<br />
in die nächste. Die Themen sind<br />
da höchst unterschiedlich: Vertragsverhandlungen<br />
mit Krankenhäusern oder<br />
Personalthemen intern, Kultur und<br />
Digitalisierung, Gespräche mit Ärzten<br />
oder Kommunen über die Gesundheitsversorgung<br />
in der Region. Ich komme<br />
also von einem Thema ins andere und<br />
das ist gut so, das habe ich so gewollt.<br />
Was macht Ihren Job zum<br />
schönsten Job der Welt?<br />
Genau diese Abwechslung, von der ich<br />
gerade gesprochen habe. Das motiviert<br />
mich jeden Tag aufs Neue.<br />
Mit der AOK Mittlerer Oberrhein<br />
auf Tuchfühlung: Gemeinsam<br />
Netzwerken und Kontakte ausbauen,<br />
das ist das Ziel von Geschäftsführerin<br />
Petra Spitzmüller.<br />
Sie wollen Ihr Unternehmen mit der<br />
AOK zusammenbringen?<br />
Melden Sie sich bei uns unter<br />
petra.spitzmueller@bw.aok.de<br />
Hier hat die Zukunft<br />
ein Zuhause.<br />
Karlsruhe ist das Technologiezentrum am Oberrhein und ein starker Messe-, Kongress- und Tourismusstandort.<br />
Das IQ-Korridorthema „Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt“ fördert diese Stärken über ausgewählte Leitprojekte<br />
sowie eine effi ziente Verzahnung von Politik, Verwaltung, Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft.<br />
Zusammen eine starke Basis für Ideen und Erfolgsgeschichten schaffen.<br />
Für einen innovativen Standort mit hoher Lebensqualität. Karlsruhe – Ort der Möglichkeiten.<br />
Das Interview führte<br />
86 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
Entdecken Sie die Wirtschaftsund<br />
Wissenschaftsstadt Karlsruhe<br />
odm-ka.de
REGION<br />
Foto HWKKA<br />
DIE BESTE ZEIT<br />
IST JETZT<br />
WARUM BETRIEBE TROTZ KRISE<br />
INVESTIEREN SOLLTEN<br />
Mitten in der Krise Geld in die Hand nehmen und großzügig in neue Geräte und Maschinen investieren?<br />
Genau jetzt ist ein guter Zeitpunkt und damit auch alle Fördertöpfe von Bund und Land richtig angezapft<br />
werden können helfen die Berater der Handwerkskammer Karlsruhe.<br />
„Unternehmen<br />
müssen<br />
nicht nur<br />
das ‚Jetzt‘,<br />
sondern auch<br />
das ‚Morgen‘<br />
im Auge<br />
haben“, sagt<br />
Klaus Günter,<br />
Berater und<br />
Beauftragter<br />
für Innovation<br />
und Technologie (BIT) bei der Handwerkskammer<br />
Karlsruhe. „Es ist zugegebenermaßen<br />
zurzeit nicht einfach,<br />
ein Unternehmen zu führen und es auf<br />
‚Kurs‘ zu halten, aber die Grundlagen<br />
für die Zukunft des Unternehmens werden<br />
jetzt durch Investitionen gelegt.“<br />
Diese sind seiner Meinung wichtig, um<br />
das Unternehmen effizienter, umweltfreundlicher<br />
oder für Mitarbeitende<br />
attraktiver machen und um im Wettbewerb<br />
bestehen zu können.<br />
Gerade in ruhigeren Zeiten, die einige<br />
Betriebe pandemiebedingt erleben,<br />
sind Ressourcen frei und Mitarbeitende<br />
können mit den Planungen beginnen.<br />
„Dazu kommt, dass die Fördermittel<br />
noch nie so zahlreich waren wie bisher“,<br />
so Günter weiter. Nach dem Lockdown,<br />
wenn die Unternehmen wieder alle<br />
Kapazitäten hochfahren können, könnte<br />
sich das Investment schnell auszahlen.<br />
Er versteht auch die Mitglieder der<br />
Handwerkskammer, die sich vor<br />
(hohen) Investitionen scheuen: „Die<br />
unsichere wirtschaftliche Lage, ohne<br />
zu wissen, wann die Umsätze wieder<br />
steigen – natürlich überlegen sich die<br />
Firmen zweimal, ob sie das Geld in die<br />
Handnehmen“, so Klaus Günter gegenüber<br />
dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
UMFASSENDE VORAB -<br />
PLANUNG WICHTIG<br />
Wenn Investitionen getätigt werden<br />
sollen, muss immer deren Finanzierbarkeit<br />
betrachtet werden. Deshalb ist<br />
es wichtig, so Günter, den notwendigen<br />
Umfang der Investitionen festzustellen.<br />
Sein Beispiel: Zur Steigerung der<br />
Produktivität möchte der Unternehmer<br />
eine neue Produktionsmaschine<br />
anschaffen. Aber damit könnten die<br />
Überlegungen des Unternehmers noch<br />
nicht abgeschlossen sein.<br />
„Jetzt muss betrachtet werden, was alles<br />
benötigt wird, um diese Maschine in den<br />
Produktionsprozess einzubinden. Sind<br />
dafür zusätzlich Investitionen für Software,<br />
Hardware, Mitarbeiterschulungen<br />
oder Gebäudeveränderungen notwendig?<br />
Sollten zusätzlich Investitionen in<br />
den Umweltschutz gemacht werden?<br />
Wie müssen zukünftig die Arbeitsprozesse<br />
im Unternehmen angepasst<br />
werden, damit die Maschine optimal<br />
eingesetzt werden kann?“ Diese Fragen<br />
gelte es individuell zu beantworten,<br />
bevor dann der eigentliche Investitionsbedarf<br />
ermitteln werden kann.<br />
Foto stock.adobe.com – StockPhotoPro<br />
FINANZIERUNGSPLAN<br />
ERSTELLEN<br />
Nachdem der Investitionsbedarf<br />
ermittelt wurde, muss der mögliche<br />
Finanzierungsplan erstellt werden.<br />
Bei diesem Plan sollten unbedingt die<br />
möglichen Förderungen berücksichtigt<br />
werden. „Um die zur Verfügung<br />
stehenden Fördermittel kennen zu<br />
lernen, sollten Sie einen Berater der<br />
Handwerkskammer hinzuziehen“,<br />
empfiehlt der Fachmann.<br />
Bei der Handwerkskammer Karlsruhe<br />
sind die Mitarbeitenden allesamt fachlich<br />
kompetente Berater. Die Berater<br />
haben alle ein Studium in ihrem Fachbereich<br />
absolviert und haben zusätzlich<br />
jahrelange Berufserfahrung in diesem<br />
Bereich. Ein weiteres Plus für die<br />
Firmen, die sich beraten lassen wollen:<br />
„Wir sind unabhängig und schauen,<br />
was den Betrieb weiterbringt, nicht,<br />
was uns am meisten Geld bringt –<br />
denn die Beratungen sind kostenlos<br />
für unsere Mitglieder.“<br />
Zehn Mitarbeitende der HWK<br />
beraten, etwa 2.400 telefonische<br />
oder persönliche Kontakte gibt es pro<br />
Jahr. Wenn ein hausinterner Berater<br />
erkennt, dass die „Begleitzeit“ höher<br />
sein wird als seine förderbedingt zulässige<br />
Zeit, werden externe Berater hinzugezogen.<br />
„Alle unsere Berater sind<br />
zusätzlich auch Fördermittelberater in<br />
ihrem Bereich“, sagt Klaus Günter.<br />
GANZHEITLICHE BETRACH-<br />
TUNG DER UNTERNEHMEN<br />
Welche verschiedenen Fördermittel<br />
für die geplante Investition können<br />
Betriebe nutzen und in welcher Kombination<br />
können sie zur Anwendung<br />
kommen? Dafür sind die Ansprechpartner<br />
der HWK da und helfen<br />
weiter. Die derzeit meistgenutzten<br />
Fördermittel sind:<br />
– die Ressourceneffizienz<br />
(Energie, Material)<br />
– die Innovationsfinanzierung 4.0<br />
– Invest BW-Investition<br />
– Digitalisierungsprämie plus<br />
– Digital Jetzt<br />
– Go-Digital<br />
Abhängig vom Anwendungsfall und<br />
den Randbedingungen kann eines<br />
oder eine Kombination verschiedener<br />
Fördermittel zum Einsatz kommen.<br />
Günter weiter: „Die Förderungen<br />
‚Invest BW-Innovation‘, ‚Invest BW-<br />
Investition‘ und das Fördermittelprogramm<br />
‚Digitalisierungsprämie plus‘<br />
wurden gerade überarbeitet.“<br />
Um das Beste aus der Vielzahl an<br />
Fördermitteln und Unterstützungen<br />
zu erhalten sei es wichtig, das große<br />
Ganze im Blick zu behalten. „Bei<br />
Bedarf führen wir daher interdisziplinäre<br />
Beratungen durch, damit das<br />
Unternehmen aus verschiedenen<br />
Blickwinkeln betrachtet werden kann“,<br />
erklärt Klaus Günter, Beauftragter für<br />
Innovation und Technologie (BIT) bei<br />
der Handwerkskammer Karlsruhe.<br />
„Somit ergänzen sich die verschiedenen<br />
Beratungsleistungen zu einer ganzheitlichen<br />
Unternehmensbetrachtung.<br />
Um die für das Unternehmen beste<br />
Beratung zu gewährleisten, werden die<br />
hausinternen Beraterressourcen sowie<br />
bei Bedarf auch das Fachwissen unseres<br />
großen Netzwerks herangezogen.“<br />
Die Beratungsleistungen der Handwerkskammer<br />
sind für Mitgliedsbetriebe<br />
und Existenzgründer kostenlos. Da<br />
die persönlichen Kontakte aufgrund<br />
von Corona minimiert werden müssen,<br />
bietet die Unternehmensberatung der<br />
Handwerkskammer Karlsruhe Videoberatungen<br />
an, bei denen man alle<br />
Themen gemeinsam besprechen kann.<br />
KLAUS GÜNTER<br />
www.handwerkskammer-karlsruhe.de<br />
88 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
89
BADENS BESTE BANK –<br />
DREIFACH<br />
AUSGEZEICHNET.<br />
Die Beratung der Sparkasse Karlsruhe ist auf<br />
TOP-Niveau. Seit 2015 prüft das Deutsche Institut<br />
Foto Vera Becker<br />
für Bankentests in Kooperation mit der Zeitschrift<br />
„DIE WELT“ die Qualität der Bankberatung<br />
von knapp 1.500 deutschen Geldhäusern.<br />
Aus diesen Untersuchungen gehen die besten<br />
Banken Deutschlands hervor – ganz vorne dabei:<br />
die Sparkasse Karlsruhe.<br />
Mit Freude und Stolz hält Lutz Boden, Mitglied des Vorstands der<br />
Sparkasse Karlsruhe, die WELT-Kugel in Händen.<br />
Badens beste Bank –<br />
dreifach ausgezeichnet.<br />
Sie belegte in diesem Jahr erneut<br />
Spitzenplatzierungen in Deutschland<br />
und Baden-Württemberg bei der<br />
Beratung von Privatkunden und darf<br />
sich zurecht auch weiterhin „Badens<br />
beste Bank“ nennen.<br />
„Die erneute Auszeichnung unserer<br />
Beratungsleistungen ist eine schöne<br />
Bestätigung unserer hohen Qualitätsansprüche<br />
und honoriert die tollen<br />
Leistungen unserer Mitarbeiter in<br />
beeindruckender Weise“, freut sich<br />
Michael Huber, Vorstandsvorsitzender<br />
der Sparkasse Karlsruhe. „Diese<br />
wertvolle Auszeichnung durch ein<br />
renommiertes Institut ist für uns alle<br />
ein enormer Ansporn, unseren Kunden<br />
auch künftig die gewohnte, herausragende<br />
Beratung anzubieten und diese<br />
Spitzenposition zu verteidigen“, so<br />
Vorstandsmitglied Lutz Boden.<br />
Die Sparkasse Karlsruhe belegt beim<br />
bundesweiten Qualitäts-Bankentest<br />
nicht nur Platz 1 in Karlsruhe, sondern<br />
auch Platz 3 in ganz Deutschland bei<br />
der Beratung von Privatkunden.<br />
Bei der Beratung von vermögenden<br />
Privatkunden (Private Banking) erreichte<br />
sie sogar den 1. Platz in Deutschland.<br />
Darüber hinaus belegte sie Platz 2 bei<br />
der Beratung zur Baufinanzierung in<br />
Baden-Württemberg.<br />
Als regionales Kreditinstitut ist die<br />
Sparkasse Karlsruhe sehr stolz auf diese<br />
herausragenden Ergebnisse. Die Serie<br />
an Auszeichnungen bei anonymen<br />
Qualitätstests hält bereits seit mehreren<br />
Jahren an und beweist die dauerhaft<br />
hohe, verlässliche Qualität der Sparkasse.<br />
Dreifach-Auszeichnung mit Gold, Silber und Bronze für<br />
Privatkunden-Beratung. #BesteBankInBaden<br />
www.sparkasse-karlsruhe.de<br />
sparkasse-karlsruhe.de<br />
90 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
91
REGION<br />
FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION<br />
UND BLICK FÜR DIE ZUKUNFT<br />
1919 BIS 2019 – 100 JAHRE EHLGÖTZ KOMPRESSOREN + MOTOREN<br />
Die Geschichte des Karlsruher Unternehmens war immer wieder geprägt von Aufbrüchen und Neustarts.<br />
Auch nach über 100 Jahren ist der Betrieb ein Familienbetrieb mit einer spannenden Historie – und einer<br />
ebenso spannenden Zukunft. Im Gespräch mit dem <strong>Wirtschaftsspiegel</strong> wirft Inhaber Thorsten Ehlgötz einen<br />
Blick zurück und vor allem nach vorne.<br />
Den Ursprung hat die Firma Ehlgötz in<br />
der Karlsruher Oststadt; alles fing mit<br />
der mechanischen Fertigung von Motorenteilen<br />
an. 100% der Teile wurden im<br />
eigenen Betrieb gefertigt. Über 1.500<br />
Zwei- und Motorräder baute Julius<br />
Ehlgötz, Gründer des Betriebes, die<br />
heute noch als Sammlerstücke sehr<br />
begehrt sind. „Nach dem Ende des<br />
Zweiten Weltkriegs waren die meisten<br />
Aufträge Reparaturarbeiten für Motoren<br />
und Kompressoren“, erzählt Thorsten<br />
Ehlgötz, Urenkel des Gründers. Er führt<br />
das Familienunternehmen in der 4. Generation.<br />
„Das Besondere: Motorenbau<br />
und Druckluftbau sind identisch. In den<br />
1950er Jahren, die Jahre des Wiederaufbaus<br />
und des Wirtschaftswunders,<br />
wurde immer mehr Kompressorentechnik<br />
gebraucht. Daher entschieden mein<br />
Urgroßvater und mein Großvater den<br />
Betriebszweig Kompressoren als neue<br />
Sparte aufzunehmen und den Kunden<br />
anzubieten.“ Der Grundstein für den<br />
heutigen Erfolg wurde gelegt.<br />
WICHTIGER ENERGIETRÄGER<br />
IN VIELEN BRANCHEN<br />
Nach Strom ist Druckluft eine der<br />
wichtigsten Energieformen, viele<br />
Fotos jodo-photo/Jörg Donecker Karslruhe<br />
Branchen brauchen Druckluft. Der<br />
Bohrer beim Zahnarzt, der Drucklufthammer<br />
auf der Autobahnbaustelle, die<br />
Druckluftbremse beim Lastwagen, das<br />
Beatmungsgerät im Krankenhaus oder<br />
zum Entfernen kleinster Partikel von<br />
Oberflächen. Die Liste der Anwendungen<br />
ist lang.<br />
Das Karlsruher Traditionsunternehmen<br />
vermietet und verkauft seit den<br />
1970ern Kompressoren, Ehlgötz hat<br />
sich darauf spezialisiert. Nach über<br />
35 Jahren im Familienbetrieb und seit<br />
acht Jahren in der Geschäftsführung,<br />
ist Thorsten Ehlgötz heute noch davon<br />
fasziniert, wo überall Druckluft und die<br />
Kompressorentechnik dahintersteckt.<br />
„Wir begegnen dieser Technologie<br />
jeden Tag in unserem Alltag, sie ist<br />
fast überall“, sagt er. Gerade im neuen<br />
Corona-Alltag wird ihm das täglich vor<br />
Augen geführt: In der Herstellung von<br />
Schutzmasken braucht es ebenfalls<br />
Druckluft, um die Geräte zu kühlen.<br />
KRISEN GAB ES IMMER WIEDER<br />
Die Pandemie-Zeit ist auch für das<br />
Familienunternehmen eine Herausforderung.<br />
„Ich leite das Geschäft in<br />
der vierten Generation und in jeder<br />
Generation gab es Hindernisse: Kriege,<br />
die Ölkrise – heute ist es Corona“,<br />
sagt Thorsten Ehlgötz. Das erfordert<br />
eine besondere Weitsicht. „Jedes<br />
Unternehmen, auch wir, muss schon<br />
heute die Entscheidungen treffen, wie<br />
die Weichen für die Zukunft gestellt<br />
werden. Wenn man als Firma weiß, wo<br />
man herkommt, dann kann man auch<br />
das Morgen für die nächste Generation<br />
bestmöglich gestalten.“<br />
Noch steht die nächste Generation<br />
nicht ganz in den Startlöchern, aber die<br />
beiden Töchter von Thorsten Ehlgötz<br />
wollen nach der Ausbildung und dem<br />
1 Manfred Hummel (l.), Günter und Thorsten Ehlgötz<br />
bilden die Geschäftsführung des Familienbetriebes.<br />
2 Druckluft braucht man auch auf Baustellen, wie hier<br />
auf der Rheinbrücke bei Karlsruhe.<br />
3 Blick ins Lager: Kompressoren werden hier für die<br />
Kunden vorbereitet.<br />
1 2<br />
3<br />
Studium in den Familienbetrieb einsteigen.<br />
„Die beiden haben ja von klein auf<br />
mitbekommen, dass das Unternehmen<br />
ein Stück unseres Lebens ist, daher erfüllt<br />
es uns selbstverständlich mit Stolz,<br />
wenn eine 5. Generation anfängt“,<br />
sagt Thorsten Ehlgötz gegenüber dem<br />
<strong>Wirtschaftsspiegel</strong>.<br />
SOZIALE VERANTWORTUNG<br />
FÜR MENSCH UND UMWELT<br />
Ein Erfolgsgeheimnis für über 100<br />
Jahre Bestehen hat Thorsten Ehlgötz<br />
nicht. Vielleicht eher einen Ratschlag.<br />
„Nutze den Tag, so würde ich unser<br />
Erfolgsgeheimnis in drei Worten beschreiben“,<br />
sagt er und ergänzt: „Viele<br />
Großunternehmen haben in der heutigen<br />
Zeit vergessen, dass sie eine soziale<br />
Verantwortung haben. Wenn man das<br />
jedoch fest im Betrieb verankert, dann<br />
hat man Erfolg. In der Geschäftsführung<br />
sind wir immer für die Kollegen<br />
ansprechbar – keine Zeit gibt’s bei uns<br />
nicht. Das wissen die Mitarbeitenden zu<br />
schätzen!“, berichtet Thorsten Ehlgötz.<br />
Die langjährige Betriebszugehörigkeit<br />
gibt ihm Recht: Einige Mitarbeitende<br />
seien schon seit 35 Jahren in der Firma,<br />
etwa die Hälfte der über 60 Angestellten<br />
sei seit über 20 Jahren dabei.<br />
Über 100 Jahre gibt es die Firma bereits,<br />
für Thorsten Ehlgötz nicht selbstverständlich.<br />
„Das ist nicht mehr an der Tagesordnung,<br />
so ein tolles Jubiläum zu feiern.“ Wo<br />
der Karlsruher Traditionsbetrieb in den<br />
nächsten 100 Jahren stehen wird? „Wenn<br />
ich das wüsste“, sagt er lachend. „Was ich<br />
weiß: Ich versuche schon heute die Basis<br />
für die Zukunft zu legen, daran werde ich<br />
in den kommenden zwei Jahrzehnten arbeiten<br />
müssen und den Generationswechsel<br />
vorzubereiten.“ Und dann? „Dieser<br />
Wechsel wird nur gelingen, wenn man den<br />
Grundstein gelegt hat und sich rechtzeitig<br />
zurückzieht, denn die Jungen sollen ihre<br />
eigenen Erfahrungen machen und aus<br />
ihren Entscheidungen lernen.“<br />
ANYA BARROS<br />
www.wvs.de<br />
92 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
93
Foto: IStock<br />
GEMEINSAM FÜR<br />
GLASFASER<br />
Weitere Informationen unter<br />
breitbandkabel-karlsruhe.de<br />
Foto pexels.com/Brett Sayles<br />
Foto unsplash.com/Umberto<br />
Am 4. November 2020 erreichte der größte Internetknoten der Welt,<br />
der DE-CIX in Frankfurt, einen neuen Rekorddatendurchsatz von<br />
10 Terabit pro Sekunde, was die zunehmende Digitalisierung deutlich<br />
sichtbar macht. Das ortsunabhängige Arbeiten wird immer mehr<br />
Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Geschäftsbetrieb.<br />
Von Videokonferenzen über Homeschooling bis zur Nutzung von<br />
Streamingdiensten: Auch im privaten Bereich ist eine schnelle und<br />
verlässliche Internet-Verbindung von immenser Bedeutung.<br />
VORREITER BEI DER<br />
DIGITALISIERUNG<br />
Bei der Entscheidung für ein neues<br />
Zuhause wie auch für einen neuen<br />
Firmenstandort kommt einer schnellen<br />
Internetverbindung eine immer<br />
größer werdende Bedeutung zu. Dies<br />
gilt sowohl für Privatpersonen, als<br />
auch für Unternehmen, Institutionen<br />
oder Organisationen.<br />
Das Ziel der BLK (=Breitbandkabel<br />
Landkreis Karlsruhe) ist eine flächendeckende<br />
Internetverbindung<br />
im Gebiet des Landkreis Karlsruhe zu<br />
schaffen. So schafft die BLK die Voraussetzung<br />
für eine Grundversorgung<br />
mit Glasfaseranschlüssen mit mindestens<br />
50 Mbit/s Datengeschwindigkeit.<br />
Damit sind die Gesellschafter Vorreiter<br />
bei der Digitalisierung und dadurch<br />
anderen Standorten einen entscheidenden<br />
Schritt voraus.<br />
AUS DER REGION<br />
FÜR DIE REGION<br />
Hinter der BLK steht ein Gemeinschaftsprojekt,<br />
das 30 Städte und<br />
Gemeinden des Landkreises Karlsruhe<br />
sowie die Städte Bad Herrenalb und<br />
Karlsruhe zusammenführt. Gesellschafter<br />
sind der Landkreis Karlsruhe und die<br />
TelemaxX Telekommunikation GmbH.<br />
Durch das Zusammenspiel der Partner<br />
kann die bereits vorhandene Infrastruktur<br />
genutzt, fehlende Trassen gebaut<br />
und ein durchgängiges Backbone-<br />
Netz zur Verfügung gestellt werden.<br />
Dadurch wird es vermieden, unnötige<br />
und kostspielige Doppelstrukturen auszubauen.<br />
Diese entstandene Datenautobahn<br />
dient zum einen den Kommunen,<br />
die ihr Access-Netz anschließen<br />
können, zum anderen dem eigentlichen<br />
Betreiber, der Inexio GmbH.<br />
Die Zukunft<br />
der Mobilität gestalten.<br />
Mit innovativen IT-Lösungen unterstützt INIT den öffentlichen Nahverkehr – auch<br />
und gerade in herausfordernden Zeiten. Unsere Systeme für kontaktloses Bezahlen<br />
und zur Steuerung von Besetztgraden ermöglichen Abstandhalten in Bus und Bahn.<br />
Und erhöhen so die Sicherheit im ÖPNV.<br />
Damit setzen wir Zeichen und stellen die Weichen dafür, dass der ÖPNV auch in<br />
Zukunft gewinnen kann. Denn Vertrauen schafft Vertrauen und weckt Begeisterung<br />
– bei immer mehr Menschen. Das zahlt sich aus: Aktionäre der<br />
init SE investieren in eine nachhaltig mobile Zukunft.<br />
94 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
DE0005759807 | IXX<br />
sales@initse.com | www.initse.com | INIT Group<br />
The Future of Mobility
REGION<br />
KARLSRUHE PROFILIERT SICH ALS<br />
WISSENSCHAFTSSTADT<br />
Weitere Informationen:<br />
www.karlsruhe.de/wissenschaftsbuero<br />
www.effekte-karlsruhe.de<br />
www.karlsruhe.digital<br />
www.scienceweek.kit.edu<br />
www.triangel.space<br />
InnovationFestival@karlsruhe.digital: Hochkarätige Keynotes<br />
und kurzweilige Impulsvorträge machen digitale<br />
Innovationen aus Karlsruhe und der Region sichtbar.<br />
Im Wissenschaftsjahr <strong>2021</strong> feiert die Fächerstadt gemeinsam mit<br />
den Akteuren der Wissenschaft sowie der Stadtgesellschaft an<br />
unterschiedlichen „Orten der Möglichkeiten“.<br />
Wissenschaft, Hochschulen und<br />
innovative Technologien sind wesentliche<br />
Faktoren im Wettbewerb der<br />
Standorte. Das Wissenschaftsbüro der<br />
Stadt Karlsruhe, das bei der Wirtschaftsförderung<br />
angesiedelt ist, bildet<br />
eine Schnittstelle zwischen Akteuren<br />
der Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen,<br />
der Wirtschaft, den<br />
Kulturbetrieben sowie der Politik und<br />
der breiten Öffentlichkeit. Es setzt als<br />
Vermittler zwischen Wissenschaft und<br />
Öffentlichkeit Impulse für die Profilie-<br />
rung Karlsruhes als Innovationsmagnet<br />
und plant zahlreiche Veranstaltungen,<br />
um Karlsruhes Position in diesem Bereich<br />
weiter zu festigen.<br />
FESTIVAL EFFEKTE: WISSEN-<br />
SCHAFT ZUM ANFASSEN UND<br />
MITERLEBEN<br />
Für Juni <strong>2021</strong> plant das Wissenschaftsbüro<br />
bereits zum fünften Mal das<br />
Wissenschaftsfestival EFFEKTE. Alle<br />
zwei Jahre verwandelt sich hierbei die<br />
Fächerstadt in ein riesiges Mitmach-<br />
und Erlebnislabor: Auch vom 12. bis<br />
20. Juni <strong>2021</strong> gibt es faszinierende<br />
und einmalige Einblicke in die hiesige<br />
Wissenschaftslandschaft, natürlich alles<br />
corona-konform.<br />
Das Festival unter dem Motto „Science<br />
in the City“ belebt mit verschiedenen<br />
Formaten die Innenstadt. Spannende<br />
Veranstaltungen rund um Zukunftsund<br />
Innovationsthemen sowie die<br />
Megatrends von morgen informieren<br />
und überraschen Besucherinnen und<br />
Besucher. Durch die aktuelle Corona-<br />
Lage sind in diesem Jahr kleinere<br />
analoge, digitale sowie hybride Veranstaltungsformate<br />
über die ganze Stadt<br />
verteilt geplant. Vorträge, Podiumsdiskussionen<br />
und Bürgerdialogformate,<br />
unter anderem im TRIANGEL Open<br />
Space und an zentralen Plätzen in der<br />
Karlsruher Innenstadt, „Science Shopping“<br />
im Einzelhandel sowie dezentrale<br />
Ausstellungen und Führungen.<br />
INNOVATIONFESTIVAL@KARLS-<br />
RUHE.DIGITAL: INNOVATIONEN<br />
MADE IN KARLSRUHE<br />
Zu den Projekten des Wissenschaftsbüros<br />
zählt auch karlsruhe.digital,<br />
ein Leitprojekt im Rahmen des IQ-<br />
Foto Dennis Dorwarth<br />
Korridorthemas „Wirtschafts- und<br />
Wissenschaftsstadt“. IQ steht dabei<br />
für innovativ und quervernetzt und so<br />
vereint karlsruhe.digital Akteure aus<br />
Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und<br />
Verwaltung mit dem Ziel, Karlsruhe als<br />
Motor der Digitalisierung voranzutreiben.<br />
Die Initiative bündelt Expertenwissen,<br />
fördert Vernetzung und sorgt dafür,<br />
dass Themen wie Digitale Souveränität,<br />
Künstliche Intelligenz, Smart City oder<br />
IT-Sicherheit ganzheitlich bearbeitet<br />
werden, um die digitale Zukunft der<br />
Stadt aktiv zu gestalten und Karlsruhe<br />
als nationalen und internationalen Digitalstandort<br />
zu positionieren.<br />
Pandemiekonform wurde 2020 das<br />
hybride Veranstaltungsformat<br />
InnovationFestival@karlsruhe.digital<br />
entwickelt, um digitalen Innovationen<br />
eine Bühne zu geben – live gestreamt<br />
aus dem ZKM | Zentrum für Kunst und<br />
Medien. Mit über 2.000 Zuschauern<br />
aus 16 Ländern war das Format sehr<br />
erfolgreich. Auch in diesem Jahr ist<br />
deshalb für den 8. Oktober <strong>2021</strong> ein<br />
InnovationFestival, im Rahmen der<br />
neuen KIT Science Week, geplant.<br />
Mit hochkarätigen Keynotes und<br />
kurzweiligen Impulsvorträgen werden<br />
digitale Innovationen aus Karlsruhe<br />
und der Technologie Region Karlsruhe<br />
erlebbar und live gestreamt.<br />
Bewerbungen für Beiträge sind bis<br />
zum 11. Juni <strong>2021</strong> willkommen.<br />
Übrigens: Die nächste Bunte<br />
Nacht der Digitalisierung findet<br />
am 1. Juli 2022 statt.<br />
KIT SCIENCE WEEK: CHANCEN,<br />
RISIKEN UND NUTZEN KÜNSTLI-<br />
CHER INTELLIGENZ<br />
Als größte Forschungs- und Lehreinrichtung<br />
steht das Karlsruher Institut für<br />
Technologie (KIT) im Dialog mit seinen<br />
Stakeholdern in Politik, Wissenschaft,<br />
Wirtschaft und Öffentlichkeit. Die erstmalig<br />
stattfindende KIT Science Week<br />
beleuchtet vom 5. bis 10. Oktober <strong>2021</strong><br />
das Thema: „Der Mensch im Zentrum<br />
lernender Systeme“. Politik, Wirtschaft<br />
und Teilnehmende diskutieren die<br />
Chancen und Risiken von künstlicher<br />
Intelligenz (KI) sowie deren Nutzen für<br />
die Gesellschaft.<br />
Die KIT Science Week kombiniert eine<br />
hochrangige, internationale, wissenschaftliche<br />
Konferenz mit Dialogformaten<br />
für die Öffentlichkeit und<br />
bezieht dabei Partner aus Stadt und<br />
Region mit ein. Das Wissenschaftsbüro<br />
als städtischer Netzwerkpartner beteiligt<br />
sich mit einem eigenen Format<br />
gemeinsam mit weiteren Hochschulen<br />
und Forschungseinrichtungen.<br />
TRIANGEL OPEN SPACE: EIN<br />
ORT FÜR KOMMUNIKATION,<br />
KREATIVITÄT UND TRANSFER<br />
AUS DER WISSENSCHAFT<br />
Im zweiten Quartal <strong>2021</strong> eröffnet das<br />
KIT das neue TRIANGEL Open Space.<br />
Zentrumsnah am Kronenplatz gelegen<br />
soll das TRIANGEL Open Space die<br />
Innenstadt weiter beleben und Raum<br />
für Austausch und Zusammenarbeit,<br />
Inspiration und Kreativität an der<br />
Schnittstelle zur Wissenschaft bieten.<br />
Ein Jahresprogramm greift aktuelle<br />
Themen auf, flexibel nutzbare Räume<br />
sowie ein Café ermöglichen kreatives<br />
Arbeiten. TRIANGEL Open Space<br />
ist offen für alle, die sich für Wissenschaft<br />
und Innovation begeistern –<br />
ob als Veranstaltungsgast oder für<br />
eigene Formate.<br />
CLAS MEYER<br />
Leiter des Wissenschaftsbüros Karlsruhe<br />
Foto Stadt Karlsruhe Monika Müller-Gmelin<br />
96 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
97
REGION<br />
Foto @5ascha<br />
PASSGENAU<br />
DER KREATIVE FRANZOSE<br />
BENJAMIN BIGOT ZAUBERT<br />
KUNSTWERKE AUS LEDER<br />
Dieser Schuhmacher hat schon viele<br />
Leisten gesehen und ist dabei geblieben.<br />
Lederkunstwerke versus Schuhe von der<br />
Stange – was ist der Unterschied? Wir<br />
haben dem Schuhkünstler aus Karlsruhe<br />
auf die Füße geschaut – und nachgefragt.<br />
Benjamin, wie bist du zu dem Beruf des<br />
Maßschuhmachers gekommen?<br />
Mit 15 ist mir ein Bild in einer Zeitung<br />
aufgefallen. Da hat ein Schuhmacher<br />
an einem Fuß einer hübschen jungen<br />
Frau mit langen Beinen Maß genommen.<br />
Da stand für mich fest, dieses<br />
Handwerk will ich erlernen. Für zwei<br />
Jahre bin ich nach Marseille auf eine<br />
Schule für Schuhmacher. Als Mitglied<br />
der Compagnons du Devoir (französische<br />
Handwerksorganisation) war ich<br />
dann für mehrere Jahre auf der Walz.<br />
Ich wollte immer einen ausgefallenen<br />
Beruf, etwas was nicht jeder macht.<br />
Die Rückmeldungen der Menschen<br />
sind für mich wichtig. Als Schumacher<br />
habe ich die Möglichkeit, Menschen<br />
glücklich machen.<br />
Was genau macht für dich<br />
einen originellen Schuh aus?<br />
Ich fertige nicht nur ein Paar Schuhe.<br />
Wenn ich einen Auftrag annehme,<br />
gehe ich etwas tiefer in die Materie,<br />
beschäftige mich auch mit dem Menschen,<br />
der später den Schuh trägt. Die<br />
Persönlichkeit soll mit einfließen in das<br />
Design. Mit Farben, Design, Farbkombinationen<br />
und Materialien kann man<br />
spielen, allerdings arbeite ich nicht<br />
so gern mit exotischen Lederarten.<br />
Originalität in Form und Design ist<br />
mein Credo, ich möchte keine alten<br />
Modelle nachmachen. Wenn ich<br />
eine Idee habe, dann schlage ich das<br />
meinen Kunden vor und zeige einen<br />
ausgearbeiteten Entwurf.<br />
Ist für dich persönlich das Thema<br />
Nachhaltigkeit wichtig?<br />
Für mich ist Nachhaltigkeit sehr<br />
wichtig, schon allein wegen meiner<br />
Kinder. Mit umweltbewusst hergestellten<br />
Materialien arbeiten ist für mich<br />
Alltag, seit ich mein eigenes Geschäft<br />
habe. In meinem Atelier verarbeite ich<br />
nur gegerbte Ledersorten, bei denen<br />
keine Schwermetalle wie z.B. Chrom<br />
oder giftige Chemikalien im Produktionsprozess<br />
zum Einsatz gekommen<br />
sind. Die beliebten „Ökoschuhe“<br />
bestehen leider sehr oft aus dem nicht<br />
sehr umweltbewusst hergestellten<br />
Leder. Meine Leidenschaft ist das<br />
Fertigen von Kinderschläppchen aus<br />
biozertifiziertem Leder, die können die<br />
Kids auch unbedenklich in den Mund<br />
nehmen. Dazu kommt noch, dass ein<br />
nach Maß gefertigter Schuh ungefähr<br />
15 Jahre hält. Das ist für mich das Argument<br />
schlechthin was Nachhaltigkeit<br />
betrifft, lieber so einen Schuh zu<br />
tragen, als einen klassisch hergestellten.<br />
Der Sinn eines Maßschuhes ist,<br />
dass man ihn immer wieder reparieren<br />
kann. Bei der Herstellung der Schuhe<br />
achte ich darauf, so wenig Kleber wie<br />
möglich für die Sohle zu verwenden.<br />
Da gibt es eine tolle Alternative, lieber<br />
mehr Nähte, da kann ich auch mehr<br />
auf Tradition achten.<br />
Ich bemühe mich, alles mehr als einmal<br />
zu verwenden, sowohl Materialien als<br />
auch Alltagsgegenstände im täglichen<br />
Leben. Falls ich tatsächlich mal<br />
Maßschuhe nicht selbst liefern kann,<br />
werden Kartons beim Versand der<br />
Schuhe wiederverwendet, was nicht<br />
sehr oft vorkommt.<br />
Woher bekommst du deine Materialien<br />
für deine Schuhe?<br />
Für die Brandsohle an den Schuhschichten<br />
habe ich eine Gerberei in<br />
Tuttlingen, die naturgerben, also das<br />
Leder mit Holz bearbeiten. Alle anderen<br />
Ledersorten beziehe ich von einem<br />
Lieferanten aus Lahr.<br />
Wem würdest du gerne mal<br />
ein Paar Schuhe machen?<br />
Da muss ich mal überlegen, ich fertige<br />
ja schon Schuhe für Schauspieler und<br />
Tänzer. Sehr beeindruckend finde ich<br />
den französische Schauspieler Omar Sy<br />
(„Ziemlich beste Freunde“). Für mich<br />
hat der Mann Charakter und ich wäre<br />
sehr stolz, wenn ich einmal Schuhe für<br />
ihn entwerfen könnte. Eine Schauspielerin<br />
fällt mir im Moment nicht ein. Am<br />
liebsten möchte ich schöne Schuhe für<br />
alle Frauen machen. (lacht)<br />
Trägst du selbst auch Maßschuhe?<br />
Ich trage meine Schuhe, aber noch<br />
keinen Schuh nach Maß. Es gibt noch<br />
keine Leisten, die an meine Füße<br />
angepasst sind. Für Ausstellungsstücke<br />
stelle ich immer alle Schuhe in meiner<br />
Größe her, die ich dann anziehen<br />
kann. Tatsächlich gibt es schon rahmengenähte<br />
Schuhe aus dem Material<br />
Cordovan, also Pferdeleder, die ich für<br />
mich persönlich ausgesucht habe: eine<br />
Mischung aus einem traditionellen<br />
Modell und modernem Design. Das<br />
gibt Stabilität und Basis und die Sohle<br />
ist weich und leicht. Ich mag sehr hartes<br />
Leder nicht so gerne.<br />
Was ist dein ausgefallenstes/<br />
schönstes Maßschuhprojekt?<br />
Ich habe einen Kunden, der schon<br />
mehrmals Schuhe bestellt hat.<br />
Am Anfang hat er eigentlich gar nichts<br />
ausgesucht, sondern mir komplett<br />
freie Hand gelassen bei der Entwicklung<br />
eines Schuhmodells. Das war<br />
schon eine große Herausforderung,<br />
was die Verarbeitung angeht, und ich<br />
musste komplett meine Designerkenntnisse<br />
auspacken. Das Entwickeln<br />
einer Idee und Machart war unheimlich<br />
befriedigend. Jeder Mensch hat<br />
einen anderen Fuß, und jeder Kunde<br />
sucht nicht dieselben Modelle aus.<br />
So variieren auch immer die Arbeitsschritte.<br />
Modelle, die ich entwickle,<br />
gibt es sonst nirgendwo.<br />
Wie viel Zeit braucht es von Anprobe<br />
bis zur Fertigstellung der Schuhe?<br />
Professionell gefertigte Maßschuhe<br />
brauchen ihre Zeit: Wartezeit etwa 7<br />
Monate, 50 Arbeitsstunden und 200<br />
Arbeitsprozesse pro Schuh im Durchschnitt.<br />
Wenn auf ein Schuhmodell<br />
eine Sohle geklebt wird, ist das weniger<br />
Arbeit, dafür muss ich dann oft mehr<br />
Zeit in das gesamte Modell stecken.<br />
Die Wartezeit kann sich auch >><br />
98 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
99
Echt schöner<br />
Kinderschmuck<br />
Modern, stylisch und nachhaltig – der Maßschuh-Sneaker.<br />
Mit seinem Hund auf leisen Sohlen: der Meister in seinem Atelier.<br />
>> durchaus mal verlängern, je nachdem<br />
wie viele Aufträge dazukommen.<br />
Was kostet denn ein Paar Maßschuhe?<br />
So ein traditionell gefertigter Schuh mit<br />
Charakter hat natürlich seinen Preis:<br />
Für das erste Paar Maßschuhe muss<br />
man um die 4.000 Euro rechnen. Das<br />
zweite Paar ist schon etwas günstiger,<br />
knapp 600 Euro weniger, weil ich<br />
da keine Leisten und Probeschuhe<br />
mehr herstellen muss. Meine Kunden<br />
kommen aus allen Schichten, die einen<br />
sparen, die anderen haben das Geld und<br />
wieder andere brauchen Maßschuhe<br />
aus gesundheitlichen Gründen. Ich<br />
habe es geschafft, Menschen aus allen<br />
Schichten für meine Schuhdesigns zu<br />
begeistern, nicht nur diejenigen, die es<br />
sich leisten können. Das macht mich<br />
sehr stolz. Zu mir kommen übrigens vor<br />
allem Menschen, die noch nie einen<br />
maßgefertigen Schuh hatten.<br />
Welche Schritte sind notwendig,<br />
bis ein Maßschuh fertiggestellt ist?<br />
Insgesamt gibt es 3 Termine bis die<br />
Maßschuhe fertig zum Anziehen und<br />
Ausführen sind. Für mich zu Beginn<br />
am Wichtigsten: Maßnehmen am Fuß<br />
und das Gegenüber kennenlernen. Ich<br />
beobachte das Gegenüber, damit ich<br />
weiß, welche Schuhe ich machen soll.<br />
Dann wird diskutiert – über Schuhe und<br />
Gott und die Welt. Die Entscheidung<br />
über Farbe, Modell und Ledermaterial<br />
fällt dann nach ein paar Wochen bei der<br />
ersten Anprobe mit dem Probeschuh.<br />
Da schlage ich dann auch ein Modell<br />
und Form vor. Es gibt Leute, die wissen<br />
schon genau, was sie haben wollen. Den<br />
Kunden, die noch nicht sicher sind, wie<br />
ihre Schuhe aussehen sollen, lasse ich<br />
genug Zeit, sich Gedanken zu machen.<br />
Der dritte Termin ist dann die Abnahme<br />
und Abgabe des Schuhs.<br />
Wie bist du letztes Jahr durch<br />
die Coronazeit gekommen?<br />
Mein Schuhgeschäft hatte 10-jähriges<br />
Jubiläum mitten in der Coronakrise.<br />
Staatshilfen wollte ich im ersten Lockdown<br />
nicht beantragen. Ganz zufällig<br />
hatte ich von einer Crowdfunding<br />
Plattform gehört, die Coronahilfen<br />
anbietet. Ich wollte damals lieber diesen<br />
Weg gehen, als den üblichen Antrag zu<br />
stellen. Das hat toll geklappt, es sind<br />
mehr als 3.000 Euro zusammengekommen,<br />
damit konnte ich drei Monate lang<br />
die Ateliermiete bezahlen. Dazu kamen<br />
noch Aufträge für Maßschuhe von Leuten,<br />
die mich unterstützen wollten. Im<br />
Sommer nach dem Lockdown musste<br />
ich leider doch noch Coronahilfen beantragen,<br />
weil es nicht ganz gereicht hat.<br />
Seit November 2020 läuft es wieder,<br />
ich brauche keine finanzielle Unterstützung<br />
mehr, zum Glück. Ich habe genug<br />
Aufträge und es geht mir gut, dafür bin<br />
ich sehr dankbar.<br />
Stichwort <strong>Aufbruch</strong>: Worauf kommt es<br />
an, damit Wanderer lange durchhalten?<br />
Das Wichtigste für mich ist nicht,<br />
möglichst weit voranzukommen. Ich<br />
freue mich über jede Überraschung und<br />
nehme alle Herausforderungen an. Und<br />
versuche nicht, zu weit nach vorne zu<br />
schauen, mache einen Schritt nach dem<br />
anderen und genieße die Zeit während<br />
des Voranschreitens. Mit jedem Schritt<br />
bin ich mal mehr, mal weniger zufrieden.<br />
Wenn ich mich umdrehe, sehe ich<br />
welchen Weg ich geschafft habe. Das ist<br />
gerade in diesen Zeiten ein spannendes<br />
Thema, weil ich glaube, dass der Mensch<br />
das jetzt braucht. Hey, auf dem Boden<br />
bleiben und eins nach dem anderen. Das<br />
gibt mir eine gewisse Sicherheit, gerade<br />
weil ich viele Baustellen um mich herum<br />
habe. Ich kann mit meinen „Wanderstiefeln“<br />
nur weiterkommen, wenn<br />
ich meiner selbst sicher und glücklich<br />
bin. Dann stimmt die Verbindung von<br />
Mensch zu Boden.<br />
HIER VERWURZELT<br />
PRODUKTE AUS KARLSRUHE UND DER REGION<br />
Foto Phoenix Coffee<br />
NUR NET HUDDLE<br />
Schön langsam, das ist<br />
das Credo vom Chef,<br />
wenn er die Rohkaffees röstet. Nur so kann sich das volle Aroma entfalten. Alle Kaffees<br />
werden von Röstmeister Patrick Crocoll im Bruchsaler Laden geröstet und nur ins<br />
Sortiment übernommen, wenn Qualität und Geschmack den Ansprüchen entsprechen.<br />
Was als Idee, eine kleine private Rösterei mit einigen wenigen Sitzplätzen im Café zu<br />
eröffnen angefangen hat, ist nun ein Coffee Shop mit Konditorei geworden. Wer den<br />
Kaffee von Phoenix Coffee lieber zuhause genießen möchte, kann sich ein Päckchen<br />
der gemahlenen Kaffeebohnen – teilweise in Bio-Qualität – online bestellen und<br />
liefern lassen oder im Café abholen.<br />
www.phoenixcoffee.de<br />
C<br />
M<br />
INNERE WERTE<br />
Anfang des Jahres 2020 wurde HÜLLE & FÜLLE von drei Gründern<br />
zum Leben erweckt. Die Mission: ehrliche Maultaschen. Nach ausgiebiger<br />
Verfeinerung der Rezeptur können die handgemachten Leckerbissen nun<br />
im Online-Shop bestellt und in Ettlingen im Baggerloch abgeholt werden.<br />
Besonders wichtig sind den Gründern und Köchen von HÜLLE & FÜLLE<br />
regionale und frische Zutaten. Außerdem verzichten sie auf Geschmacksverstärker<br />
und künstliche Konservierungs- und Zusatzstoffe. Damit wollen<br />
Sie eine bewusstere Alternative zu Massenproduktion und maschineller<br />
Fertigung bieten. Diese inneren Werte machen die badischen Maultaschen<br />
von HÜLLE & FÜLLE besonders hochwertig und nachhaltig.<br />
www.hf-maultaschen.de<br />
Foto HÜLLE & FÜLLE Maultaschen<br />
Y<br />
CM<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
Foto Uli Hochreither<br />
LIGHT MY FOTO<br />
Ein Foto an die Wand hängen kann jeder. Was wäre, wenn das Lieblingsbild<br />
zeitgleich leuchten würde? Lumitrast, aus Ettlingen, stellt 3D-Leuchtbilder aus<br />
recyceltem Kunststoff her. Einfach Motiv aussuchen oder Lieblingsfoto hochladen<br />
und das Motiv wird Pixel für Pixel in die Platte gefräst und von hinten beleuchtet.<br />
Je mehr Material abgetragen wird, desto mehr Licht kommt durch und umso<br />
heller das Pixel. Die zuvor unscheinbare Platte erwacht beim Einschalten der<br />
Beleuchtung zum Leben und zeigt nun das zuvor versteckte Motiv in seiner<br />
ganzen Pracht.<br />
www.lumitrast.de<br />
102 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL
UNTERNEHMENSPROFILE<br />
Hoepfner Bräu – Häuser zum Wohlfühlen<br />
Die Hoepfner Bräu Friedrich Hoepfner Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG betreibt ein<br />
aktives Immobilienmanagement mit gemischt genutzten Objekten. Im Jahre 1798 gegründet,<br />
beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verwaltung und Entwicklung eigener Immobilien.<br />
In vielfältigen Projekten setzt die Hoepfner Bräu immer wieder auf den behutsamen Erhalt des<br />
Schönen und Althergebrachten, gleichzeitig verbunden mit modernster Ausstattung. Besonders<br />
gut erkennt man dies an Objekten wie dem „Alten Malzwerk“, einem Teil der Hoepfner-<br />
Burg in Karlsruhe. An Top-Standorten in Süddeutschland wie Karlsruhe, Heidelberg und in der<br />
Hauptstadt Berlin wird für den eigenen Bestand gebaut. Die Tochtergesellschaft Hoepfner<br />
HI-TECH Beteiligungsgesellschaft mbH arbeitet als Business Angel zur Unterstützung junger<br />
Hightech-Unternehmen, die Hoepfner BauInvest Plus GmbH & Co. KG als Immobilienentwickler<br />
für anspruchsvolle Kunden.<br />
www.hoepfner-braeu.de<br />
STOBER<br />
MEDIEN<br />
STOBER MEDIEN GmbH<br />
Industriestraße 12, 76344 Eggenstein<br />
HOEPFNER BRÄU Friedrich Hoepfner<br />
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG<br />
Haid-und-Neu-Str. 18-20, 76131 Karlsruhe<br />
Fon 0721 480886-66<br />
presse@hoepfner-braeu.de<br />
www.hoepfner-braeu.de<br />
Ihren Ideen Ausdruck geben<br />
„Sicher und auf kurzem Weg, mit Fingerspitzengefühl und Freude an der richtigen Lösung,<br />
einfach und kompakt.“ 30 Fachleute bringen Ideen ins Ziel. Von der Beratung und Produktentwicklung<br />
bis zur Herstellung über alle Etappen.<br />
Ihr Partner für Unternehmen, Agenturen und Kultur<br />
Ihre Anforderungen finden bei uns praktikable Lösungen. Partnerschaftlich stehen wir<br />
Ihnen mit zukunftsorientiertem Know-how bei Satz, Gestaltung, Digital- und Offsetdruck,<br />
Weiterverarbeitung sowie Letterpress und Konfektionierung zur Seite. Sprechen Sie uns an!<br />
www.stober.de<br />
Die beste Bank der Stadt<br />
Zum fünften Mal in Folge hat sich die Volksbank Karlsruhe 2020 beim größten Verbrauchertest<br />
nach DIN-Norm der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH durchgesetzt. Als Seriensiegerin<br />
darf sie sich weiterhin in den Sparten Privatkundenberatung, Gewerbekundenberatung<br />
und Baufinanzierung als die „Beste Bank vor Ort“ bezeichnen. Und auch beim unabhängigen<br />
City Contest in Zusammenarbeit mit dem Magazin Focus-Money geht die Volksbank Karlsruhe<br />
2020 zum wiederholten Mal als Testsieger ihrer Stadt hervor und hat in allen Kategorien<br />
Spitzenwerte erzielt. „Die Volksbank Karlsruhe hat den Beratungsprozess in Karlsruhe hervorragend<br />
umgesetzt“, lautet das Fazit der Tester.<br />
Besonders der Vergleich auf Basis von DIN-Normen liefert die im Sinne des Verbraucherschutzes<br />
verlässlichste Beurteilung der Beratungsqualität. Darüber hinaus lässt die Volksbank<br />
Karlsruhe ihre Beratungsleistungen über das Portal des Anbieters eKomi ungefiltert durch ihre<br />
Kunden beurteilen. Und auch hier wird ihr eine herausragende Beratungsqualität attestiert: Von<br />
maximal 5 möglichen Sternen vergeben die Kunden 4,9 Sterne.<br />
www.volksbank-karlsruhe.de<br />
VOLKSBANK KARLSRUHE eG<br />
Ludwig-Erhard-Allee 1<br />
76131 Karlsruhe<br />
Telefon 0721 9350-0<br />
E-Mail: info@volksbank-karlsruhe.de<br />
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern<br />
in diesem Magazin die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der<br />
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle<br />
Gründe und beinhaltet keine Wertung.<br />
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Baden TV GmbH<br />
Haid-und-Neu-Str. 18<br />
76131 Karlsruhe<br />
Telefon: 0721 989773-500<br />
Fax: 0721 989773-501<br />
Geschäftsführer Bernd Gnann<br />
Gesamtproduktion, Copyright:<br />
WERBEAGENTUR VON<br />
SCHICKH GmbH<br />
Pforzheimer Str. 134<br />
76275 Ettlingen<br />
Telefon: 07243 71100-0<br />
info@wvs.de, www.wvs.de<br />
Redaktionsleitung, Konzeption:<br />
Sabine Edle von Schickh<br />
Redaktion: Anya Barros,<br />
Angelika Schmied, Caroline<br />
Carnevale, Andreas Lütke, Julia Wolf<br />
Layout, Illustration:<br />
Felicitas Riffel, Adelina Apostolova<br />
Produktion:<br />
Felicitas Riffel<br />
Koordination: Anya Barros<br />
Titelbild:<br />
rdnzl – www.stock.adobe.com<br />
Anzeigen:<br />
Baden TV GmbH, Susanne Sauer<br />
Haid-und-Neu-Str. 18<br />
76131 Karlsruhe<br />
Telefon: 0721 989773-500<br />
Fax: 0721 989773-501<br />
wirtschaftsspiegel@baden-tv.com<br />
Druck:<br />
Stober Medien GmbH, Eggenstein<br />
Der „<strong>Wirtschaftsspiegel</strong> der<br />
TechnologieRegion Karlsruhe” ist<br />
direkt über den Herausgeber oder<br />
über ausgewählte Vertriebspartner<br />
zu beziehen.<br />
104 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
105
STANDORTINFORMATIONEN<br />
DIE TECHNOLOGIEREGION KARLSRUHE IM ÜBERBLICK<br />
Merkmal Maßeinheit Stadtkreis Landkreis<br />
Stadtkreis<br />
Landkreis<br />
Landkreis<br />
Landkreis Stadtkreis<br />
Departement<br />
TechnologieRegion<br />
Karlsruhe Karlsruhe Baden-Baden<br />
Rastatt<br />
Germersheim Südliche Weinstraße Landau<br />
Bas-Rhin 7<br />
insgesamt<br />
Fläche 2 km 2 173,42 1.084,97 140,19 738,44 463,32 639,95 82,94 4.755,03 8.078,26<br />
Bevölkerung am 30.09.2020 2, 3 Anzahl 308.530 447.120 55.345 232.481 128.870 110.672 46.627 1.133.552 2.463.197<br />
Kaufkraftkennziffer <strong>2021</strong> 1 je Einwohner 101,2 108,8 116,7 106,9 101,9 103,4 98,7 · 105,5 6<br />
(Bundesgebiet = 100)<br />
Einzelhandelsumsatz <strong>2021</strong> 1 je Einwohner 121,0 87,6 114,2 77,6 68,2 82,9 139,4 · 94,4 6<br />
(Bundesgebiet = 100)<br />
Zentralitätsindex <strong>2021</strong> 1 je Einwohner 119,6 80,5 97,9 72,6 66,9 80,2 141,2 · 89,5 6<br />
Bruttoinlandsprodukt 2018 2 in Euro 85.070 78.513 70.948 84.908 80.906 65.833 59.334 · 79.770 6<br />
(je Erwerbstätigen)<br />
Erwerbstätige 2018 2 in Tausend 240,7 213,9 42,2 120,3 59,7 46,3 33,4 481,6 1.238,1<br />
Versicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 179.534 158.734 31.343 92.965 46.072 31.611 23.686 467.919 1.031.864<br />
am Arbeitsort am 30.06.2020 2, 4<br />
darunter<br />
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Anzahl 101 573 . 452 480 903 71 6.901 9.481 8<br />
Produzierendes Gewerbe Anzahl 27.494 56.100 7.427 48.000 20.886 9.645 4.257 75.377 249.186<br />
Handel, Verkehr und Gastgewerbe Anzahl 38.663 32.746 6.710 16.124 11.297 8.377 5.346 215.362 334.625<br />
Sonstige Dienstleistungen Anzahl 113.275 69.312 17.099 28.388 13.509 12.686 14.012 140.794 409.075<br />
Verarbeitendes Gewerbe am 30.09.2019 2<br />
Betriebe (mit 20 und mehr Beschäftigten) Anzahl 98 309 31 173 77 57 30 568 1.343<br />
Beschäftigte Anzahl 18.672 39.611 4.563 40.411 17.135 6.523 2.708 65.683 195.306<br />
Umsatz 2019 in Mrd. Euro 10,6 11,0 0,9 22,1 13,0 1,7 0,6 . 59,9 6<br />
Arbeitslosenquote am 30.06.2020 5 % 5,2 3,9 6,0 4,0 4,8 4,6 6,3 7,8 (p) 4,5 6<br />
(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)<br />
STUDIERENDE AUSGEWÄHLTER FACHRICHTUNGEN IN KARLSRUHE<br />
Fakultät / Fachrichtungen (WS 2020/21) KIT Hochschule Karlsruhe – Duale zusammen<br />
Technik und Wirtschaft Hochschule<br />
Anzahl Anzahl %<br />
Elektro- und Informationstechnik 2.027 831 109 2.967 8,7<br />
Maschinenbau und Mechatronik 5.424 1.360 563 7.347 21,5<br />
Informatik und Wirtschaftsinformatik 2.785 1.101 967 4.853 14,2<br />
Wirtschaftswissenschaften 3.436 2.357 1.247 7.040 20,6<br />
Architektur, Bauwesen, Geo- und Umweltwissenschaften 3.073 1.665 - 4.738 13,9<br />
Mathematik 662 - - 662 1,9<br />
Physik, Chemie und Biowissenschaften 4.153 - - 4.153 12,2<br />
Studierende der ausgewählten Fachrichtungen zusammen 21.560 7.314 2.886 31.760 93,0<br />
Studierende insgesamt 23.321 7.602 3.190 34.113 100,0<br />
STUDIERENDE IN KARLSRUHE<br />
WS 2020/21 %<br />
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 23.321 58,1<br />
Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 7.602 18,9<br />
Pädagogische Hochschule 3.711 9,2<br />
Duale Hochschule Baden-Württemberg 3.190 7,9<br />
Hochschule für Musik 568 1,4<br />
Staatliche Akademie der Bildenden Künste 343 0,9<br />
Staatliche Hochschule für Gestaltung 408 1,0<br />
Karlshochschule International University (privat) 406 1,0<br />
EC Europa Campus (privat) * 350 0,9<br />
FOM Hochschule für Ökonomie & Management (privat) 262 0,7<br />
Insgesamt 40.161 100<br />
FernUniversität Hagen (Studierende im Stadtgebiet KA) 515<br />
1<br />
Quellen GfK, Nürnberg; Amt für Stadtentwicklung, Karlsruhe<br />
2<br />
Quellen Statistische Landesämter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz;<br />
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) Direction Régionale de Strasbourg<br />
3<br />
Städte in Rheinland-Pfalz Stand: 30.06.2020<br />
4<br />
Städte in Rheinland-Pfalz Stand: 30.06.2019<br />
5<br />
Quellen Bundesagentur für Arbeit; Insee<br />
6<br />
Ohne Departement Bas-Rhin<br />
7<br />
Stand: 31.12.2017 bzw. Volkszählung 2017, (p) = vorläufig zum Stand 3. Trimester 2020<br />
8<br />
Summe ohne Stadtkreis Baden-Baden<br />
106 NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
Quelle Amt für Stadtentwicklung, Karlsruhe<br />
*Schätzwert<br />
Quelle Amt für Stadtentwicklung, Karlsruhe<br />
107
DATEN UND FAKTEN ZUM WIRTSCHAFTSSTANDORT KARLSRUHE<br />
IM VERGLEICH ZU DEN STÄDTEN MANNHEIM UND STUTTGART<br />
Karlsruhe Mannheim Stuttgart<br />
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung*<br />
Bevölkerung am 30.09.2020 308.530 310.121 631.688<br />
Veränderung 12/2015 - 09/2020 in % 0,3 1,4 1,3<br />
Hallo, wir wohnen auch hier.<br />
Erwerbstätige am Arbeitsort**<br />
Erwerbstätige im Jahr 2019 (Jahresdurchschnitt, Berechnungsstand August 2020) 240.000 242.400 546.200<br />
Veränderung 2015 - 2019 in % 1,6 2,4 5,5<br />
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort*<br />
SV-Beschäftigte am 30.06.2020 179.534 189.353 423.052<br />
Veränderung 2015 - 2020 in % 5,1 5,1 8,6<br />
Betriebe*<br />
Betriebe 2019 15.191 15.724 33.315<br />
Anteil kleiner und mittlerer Betriebe in % 99,3 99,2 99,3<br />
(Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten. SV-Beschäftigte am 31.12.2019)<br />
Arbeitslose***<br />
Arbeitslose am 30.06.2020 8.978 13.074 20.047<br />
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) 5,2 7,5 5,7<br />
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen*<br />
Euro je Erwerbstätigen 2018 (Berechnungsstand August 2019) 85.070 86.269 105.982<br />
Veränderung 2015 - 2018 in % 6,7 8,9 4,4<br />
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen*<br />
Bruttowertschöpfung 2018 (in Millionen Euro) 18.442 18.844 51.673<br />
darunter Anteil in %<br />
Produzierendes Gewerbe 22,8 37,0 34,3<br />
Dienstleistungsbereiche 77,1 63,0 65,6<br />
Gewerbesteuer*<br />
Hebesatz 2020 in % 430 430 420<br />
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern****<br />
Kaufkraft je Einwohner <strong>2021</strong> (Bundesdurchschnitt = 100) 101,2 99,1 112,5<br />
Umsatzkennziffer je Einwohner <strong>2021</strong> (Bundesdurchschnitt = 100) 121,0 146,5 127,0<br />
Zentralitätskennziffer <strong>2021</strong> (Umsatzkennziffer je EW/Kaufkraft je EW) 119,6 147,8 112,9<br />
Quellen<br />
* Statistisches Landesamt Baden-Württemberg<br />
** Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (vorläufige Ergebnisse)<br />
*** Bundesagentur für Arbeit<br />
**** GfK, Nürnberg<br />
Wir sind ein Unternehmen,<br />
von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben.<br />
Denn von uns können Sie gar nichts kaufen.<br />
Wir machen nämlich Banken-IT.<br />
Aber wir sind da.<br />
Als Arbeitgeber. Als Steuerzahler.<br />
Oder einfach bloß als Nachbar.<br />
Als guter Nachbar.<br />
Indem wir helfen, wo wir können.<br />
In der Bildung genauso wie beim Sport,<br />
in der Kunst oder in sozialen Einrichtungen.<br />
„Zukunftserfahren“ soll nicht nur ein Wort sein,<br />
das wir unter unser Logo drucken.<br />
Es ist unser Selbstverständnis, dass man<br />
Zukunft aktiv gestalten kann.<br />
Vor Ort. In der eigenen Stadt. Mit den eigenen Nachbarn.<br />
Und damit haben wir Erfahrung.<br />
108<br />
NR 64 <strong>2021</strong> WIRTSCHAFTSSPIEGEL<br />
5
Wohnung gesucht –<br />
Zuhause gefunden!<br />
Wir schaffen und erhalten bezahlbaren Wohnraum. Mit über<br />
13.350 Mietwohnungen sind wir der größte Vermieter in<br />
Karlsruhe. Wir bemühen uns um soziale Ausgewogenheit<br />
und setzen uns für Nachhaltigkeit ein.<br />
6<br />
www.volkswohnung.com