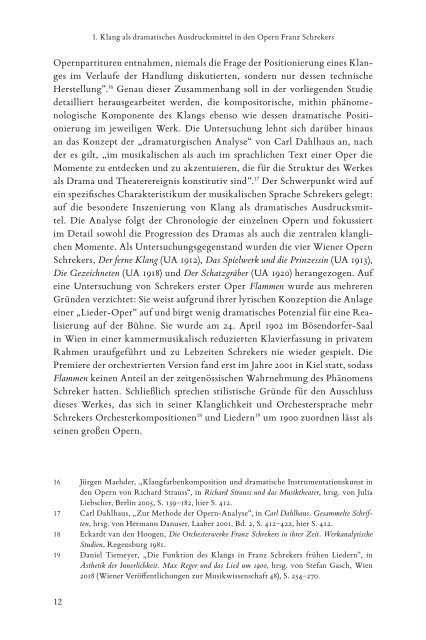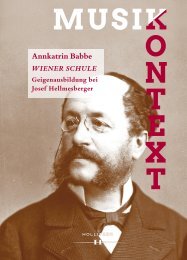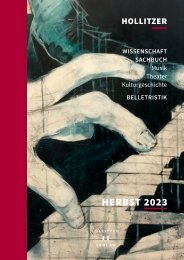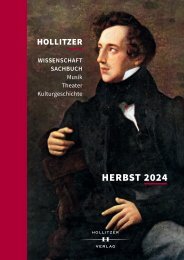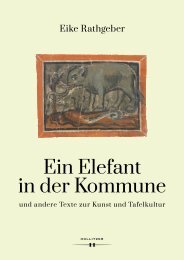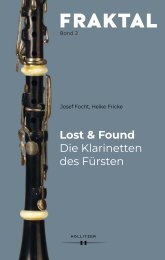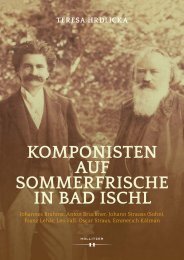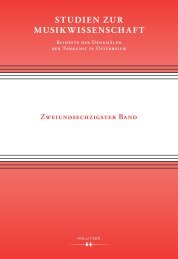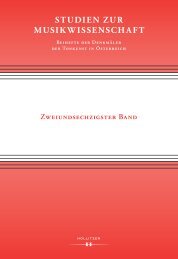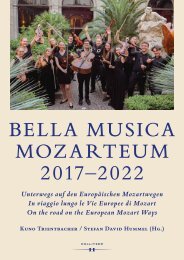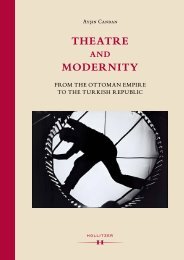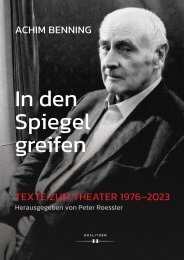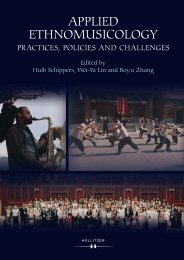Leseprobe_Tiemeyer_Schreker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Klang als dramatisches Ausdrucksmittel in den Opern Franz <strong>Schreker</strong>s<br />
Opernpartituren entnahmen, niemals die Frage der Positionierung eines Klanges<br />
im Verlaufe der Handlung diskutierten, sondern nur dessen technische<br />
Herstellung“. 16 Genau dieser Zusammenhang soll in der vorliegenden Studie<br />
detailliert herausgearbeitet werden, die kompositorische, mithin phänomenologische<br />
Komponente des Klangs ebenso wie dessen dramatische Positionierung<br />
im jeweiligen Werk. Die Untersuchung lehnt sich darüber hinaus<br />
an das Konzept der „dramaturgischen Analyse“ von Carl Dahlhaus an, nach<br />
der es gilt, „im musikalischen als auch im sprachlichen Text einer Oper die<br />
Momente zu entdecken und zu akzentuieren, die für die Struktur des Werkes<br />
als Drama und Theaterereignis konstitutiv sind“. 17 Der Schwerpunkt wird auf<br />
ein spezifisches Charakteristikum der musikalischen Sprache <strong>Schreker</strong>s gelegt:<br />
auf die besondere Inszenierung von Klang als dramatisches Ausdrucksmittel.<br />
Die Analyse folgt der Chronologie der einzelnen Opern und fokussiert<br />
im Detail sowohl die Progression des Dramas als auch die zentralen klanglichen<br />
Momente. Als Untersuchungsgegenstand wurden die vier Wiener Opern<br />
<strong>Schreker</strong>s, Der ferne Klang (UA 1912), Das Spielwerk und die Prinzessin (UA 1913),<br />
Die Gezeichneten (UA 1918) und Der Schatzgräber (UA 1920) herangezogen. Auf<br />
eine Untersuchung von <strong>Schreker</strong>s erster Oper Flammen wurde aus mehreren<br />
Gründen verzichtet: Sie weist aufgrund ihrer lyrischen Konzeption die Anlage<br />
einer „Lieder-Oper“ auf und birgt wenig dramatisches Potenzial für eine Realisierung<br />
auf der Bühne. Sie wurde am 24. April 1902 im Bösendorfer-Saal<br />
in Wien in einer kammermusikalisch reduzierten Klavierfassung in privatem<br />
Rahmen uraufgeführt und zu Lebzeiten <strong>Schreker</strong>s nie wieder gespielt. Die<br />
Premiere der orchestrierten Version fand erst im Jahre 2001 in Kiel statt, sodass<br />
Flammen keinen Anteil an der zeitgenössischen Wahrnehmung des Phänomens<br />
<strong>Schreker</strong> hatten. Schließlich sprechen stilistische Gründe für den Ausschluss<br />
dieses Werkes, das sich in seiner Klanglichkeit und Orchestersprache mehr<br />
<strong>Schreker</strong>s Orchesterkompositionen 18 und Liedern 19 um 1900 zuordnen lässt als<br />
seinen großen Opern.<br />
16 Jürgen Maehder, „Klangfarbenkomposition und dramatische Instrumentationskunst in<br />
den Opern von Richard Strauss“, in Richard Strauss und das Musiktheater, hrsg. von Julia<br />
Liebscher, Berlin 2005, S. 139–182, hier S. 412.<br />
17 Carl Dahlhaus, „Zur Methode der Opern-Analyse“, in Carl Dahlhaus. Gesammelte Schriften,<br />
hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 2001, Bd. 2, S. 412–422, hier S. 412.<br />
18 Eckardt van den Hoogen, Die Orchesterwerke Franz <strong>Schreker</strong>s in ihrer Zeit. Werkanalytische<br />
Studien, Regensburg 1981.<br />
19 Daniel <strong>Tiemeyer</strong>, „Die Funktion des Klangs in Franz <strong>Schreker</strong>s frühen Liedern“, in<br />
Ästhetik der Innerlichkeit. Max Reger und das Lied um 1900, hrsg. von Stefan Gasch, Wien<br />
2018 (Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 48), S. 254–270.<br />
12