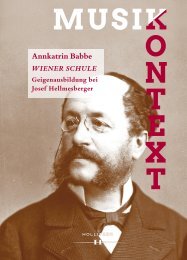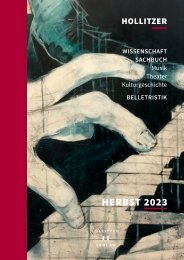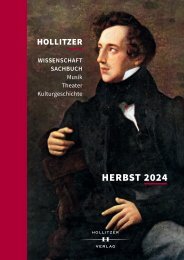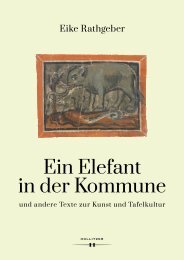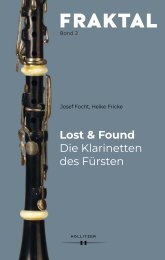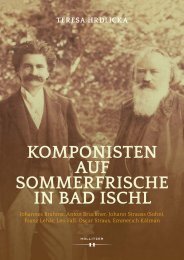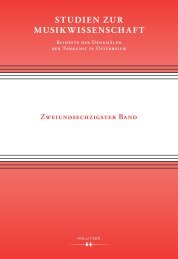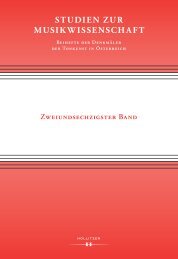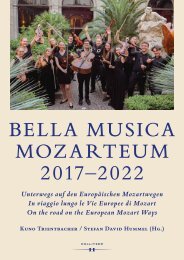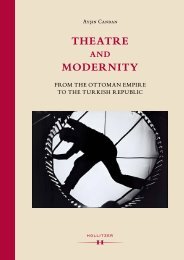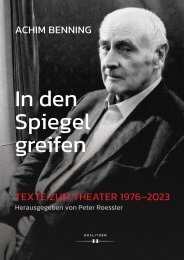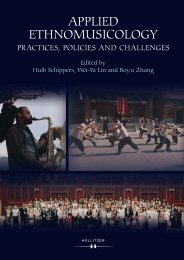Leseprobe_Tiemeyer_Schreker
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.1. Spezifische Eigenschaften des Klangs<br />
die baskische Trommel), zwei kleine Trommeln, Rührtrommel, Große Trommel<br />
und sogar ein mit Papier bespannter Holzrahmen. Eine derart reichhaltige<br />
Besetzung des Schlagwerks sowie die zusätzliche Verwendung von Harfe und<br />
Celesta findet sich jedoch auch in den Bühnenwerken von Richard Strauss oder<br />
Alexander von Zemlinsky, sodass <strong>Schreker</strong>s Orchesterbesetzung keine Besonderheit,<br />
sondern die Regel für das Musikdrama der Wiener Moderne darstellt. 6<br />
Da die Orchestersatztechnik zwischen Wagner und <strong>Schreker</strong> erheblich voranschritt,<br />
stand dem Jüngeren ein weitaus größeres Arsenal an durch Mischung<br />
erzeugten, synthetischen Klängen zur Verfügung. Während für Wagner die<br />
drei Orchesterchöre Streicher, Holzbläser und Blechbläser die Grundlage seiner<br />
Klangkonzeption darstellten, erweiterte sich die orchestrale Sprache um<br />
1900 dergestalt, dass sich zunehmend jede einzelne instrumentale Farbe miteinander<br />
kombinieren ließ. 7 Diese Freiheit in der Zusammenstellung der Instrumente<br />
führte zu einer neuen „Sensibilität gegenüber dem Klang und den<br />
Möglichkeiten seiner Veränderung und Nuancierung“. 8<br />
Die Tatsache, dass sich der <strong>Schreker</strong>-Klang wesentlich von demjenigen<br />
Wagners unterscheidet, liegt damit zum einen an der Möglichkeit der freieren<br />
Kombination von Individualklängen. Zum anderen ist <strong>Schreker</strong>s prononcierte<br />
Verwendung der Celesta maßgeblich für die Klanggestalt seiner Opern<br />
verantwortlich. Diese zählt durch ihre schillernde, gläserne Farbe und ihren<br />
spezifisch obertonreichen, funkelnden Klang zu dem markantesten Instrument<br />
in <strong>Schreker</strong>s Partituren. Die Celesta gehört mit den zwei Harfen zur Standardbesetzung<br />
von <strong>Schreker</strong>s Opernorchester und wird immer dann gezielt<br />
eingesetzt, wenn ein klangliches Ereignis im Zentrum der musikalischen<br />
Darstellung steht: „Spielt der Klang als solcher eine Rolle, so bedarf das<br />
Orchester einer grundsätzlichen Erweiterung, und zwar um Tasten- und<br />
Zupfinstrumente.“ 9<br />
Hebt sich also die Orchesterbesetzung bei <strong>Schreker</strong> nicht sonderlich von den<br />
Gepflogenheiten seiner Zeitgenossen ab, so nutzt er dennoch zwei spezifische<br />
Elemente, die seinen Partituren eine distinguierte Individualität verleihen:<br />
Dies ist zum einen die Verwendung von Vokalisen in hinter oder seitwärts<br />
6 Weiterführend zur Orchestertechnik in den Opern von Richard Strauss siehe Jürgen<br />
Maehder, „Klangfarbenkomposition“, S. 139–181.<br />
7 Janz, Klangdramaturgie, S. 121: „Wenn für Wagner die Chorteilung des Orchesters noch<br />
die Grundlage des orchestralen Denkens darstellt, geht der nachwagnersche Orchestersatz<br />
generell stärker auf eine kompositorische Aufhebung der Chorgrenzen, so daß<br />
schließlich virtuell jede Farbe mit jeder anderen kombinierbar wird.“ Am sinnfälligsten<br />
ereignet sich dies in Maurice Ravels Boléro aus dem Jahr 1928.<br />
8 Jost, Instrumentation, S. 59.<br />
9 Rudolf Stephan, „Franz <strong>Schreker</strong>“, in Rudolf Stephan. Vom musikalischen Denken. Gesammelte<br />
Vorträge, hrsg. von Rainer Damm und Andreas Traub, Mainz 1985, S. 162–167, hier S. 167.<br />
17