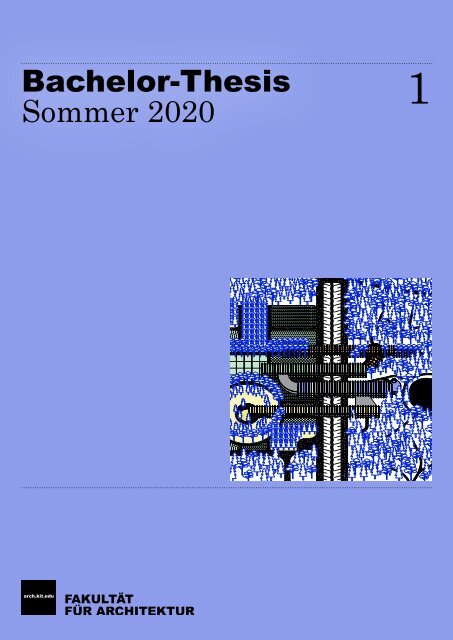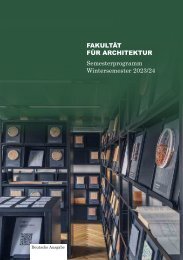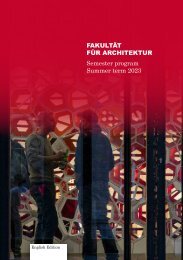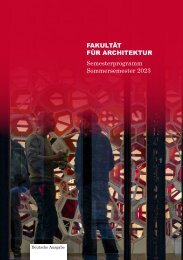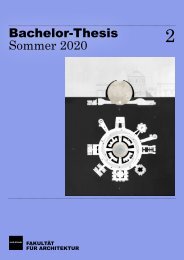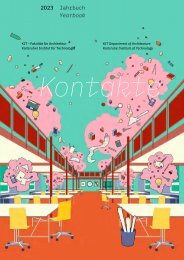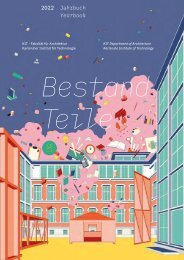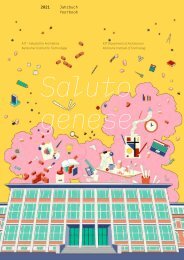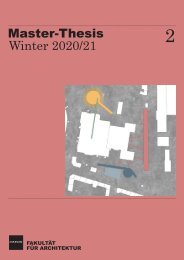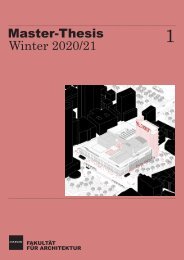KIT-Fakultät für Architektur – Bachelor-Arbeiten Sommer 2020 – Teil 1/2
Dokumentation von Bachelorabschlussarbeiten des Sommersemesters 2020 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie. Teil 1 von 2.
Dokumentation von Bachelorabschlussarbeiten des Sommersemesters 2020 an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie.
Teil 1 von 2.
- TAGS
- wwwarchkitedu
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Intermedius Waldinstitut, Campus Nord Karlsruhe<br />
Cara Hähl-Pfeifer<br />
<strong>Bachelor</strong>-Thesis<br />
<strong>Sommer</strong> <strong>2020</strong><br />
1<br />
1<br />
3 4<br />
Aktuell liegt der Campus Nord wie ein inselartiger<br />
Fremdkörper mitten im Meer der Bäume<br />
ohne jegliche Beziehung zum umgebenden<br />
Hardtwald aufzubauen. Den allgegenwärtigen<br />
Kontrast zwischen Mensch und Natur vor Ort<br />
gilt es aufzubrechen. Intermedius steht <strong>für</strong><br />
das Zwischenglied und beschreibt die Rolle des<br />
Waldinstitus, zwischen den Elementen Wald<br />
und Campus zu vermitteln, sie miteinander zu<br />
verbinden und den Campus neu zu aktivieren.<br />
Das Institut liegt direkt auf dem Hirschkanal<br />
und der Grabener Allee, die bis zum Schloss<br />
führt und baut dort entlang der Achse eine<br />
Brücke zwischen Wald und Campus auf.<br />
Die einzelnen Riegel des Gebäudekomplexes<br />
sind in die 4 Forschungsbereiche „Romantisches<br />
Ideal“, „Materielle Ressource“, „Ökologische<br />
Ressource“ und „Waldm<br />
unterteilt und ragen verschied<br />
Wälder links und rechts des K<br />
Dort gibt es einmal den weites<br />
rührten, „romantischen“ Wald<br />
der Natur und auf der andere<br />
Nutzwald, der die Campus Str<br />
det und zum Forschen und Int<br />
gedacht ist. Jedes Fachgebiet<br />
mit unterschiedlichen Aspekte<br />
denn die Forschung im Innere<br />
Außenbereich.<br />
Geforscht wird immer an den<br />
Riegel, während es in den mit<br />
über dem Kanal Gemeinschaf<br />
Strukturell werden die Riegel<br />
relemente miteinander verbun
<strong>Bachelor</strong>-Thesis<br />
<strong>Sommer</strong>semester <strong>2020</strong><br />
<strong>Teil</strong> 1<br />
Die Publikation enthält alle <strong>für</strong> die Veröffentlichung eingereichten Beiträge.
Thema<br />
Das Waldinstitut<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
Historisch als das Gegenteil der Stadt betrachtet, ist der Wald heutzutage<br />
zunehmend zu einer von Menschenhand geschaffenen Institution<br />
herangewachsen. So kann seit dem Aufkommen der modernen<br />
Forstwirtschaft im späten 18. Jahrhundert der Wald längst als<br />
künstliche Typologie betrachtet werden, mit der die Holzproduktion<br />
maximiert werden soll. Aktuell rückt speziell die hochindustrialisierte<br />
Weiterverarbeitung zum Ingenieurholz <strong>–</strong> mit dem Wald als Quelle<br />
nachwachsender Rohstoffe <strong>–</strong> verstärkt in den Fokus. Sein Gegenstück,<br />
der wilde Wald, wurde insbesondere von den Künstlern und<br />
Dichtern der Romantik thematisiert und stellt seit den 1970er Jahren<br />
ein ökologisches Symbol <strong>für</strong> Aktivisten dar.<br />
Irgendwo zwischen dem Romantischen, Rationalen, Nachhaltigen<br />
und zu Nutze Gemachten liegt ein unerforschter Raum <strong>für</strong> architektonische<br />
Interventionen. Im Studio werden vier Bedeutungen des<br />
Waldes als Produkt des Anthropozäns untersucht: Als ökologische wie<br />
materielle Ressource, romantisches Ideal und bürokratische Institution.<br />
Wir werden ein Waldinstitut entwerfen, das die Bereiche Forschung,<br />
Entwicklung und Vermittlung zu einer Reihe den Wald<br />
betreffenden Themen unterstützen soll. In zentraler Lage zwischen<br />
Schwarzwald, Pfalz und Vogesen bietet dabei der <strong>KIT</strong> Campus Nord,<br />
eingebettet in den Karlsruher Hardtwald, einen idealen Standort. Die<br />
Herausforderung wird darin bestehen, das Institutsgebäude sowie<br />
das Außenprogramm zu entwickeln und miteinander in Beziehung zu<br />
setzen, um dadurch die Außengrenze vom Campus Nord zum umgebenden<br />
Hardtwald neu zu verhandeln.
Hirschkanal<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
Grabenerallee<br />
Grabenerallee<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
Das Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Luca Diefenbacher<br />
Raum+Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Georg Vrachliotis<br />
Erschließung FORMEL<br />
FORSCHUNG<br />
Treetop<br />
Erschließung INFORMEL<br />
ÖFFENTLICHKEIT<br />
Materielle Ressource<br />
Waldmanagement<br />
Romantisches Ideal<br />
Konstruktion<br />
Grabenerallee Grabenerallee<br />
B<br />
B<br />
C<br />
A<br />
Ökologische Ressource<br />
gemeinsame Infrastruktur<br />
1 2<br />
Hirschkanal Hirschkanal<br />
B<br />
C<br />
A<br />
Organisation<br />
B<br />
C<br />
A<br />
C<br />
A<br />
3 4<br />
Das System Wald ist geprägt von ständigem<br />
Wandel und Veränderung. Bei meinem<br />
Entwurf habe ich mir die Frage gestellt , in<br />
wie weit sich die Performanz des Waldes, die<br />
durchaus menschlichen Ursprungs ist, in der<br />
<strong>Architektur</strong> eines Waldinstitutes widerspiegeln<br />
kann.<br />
Verortet ist das Waldinstitut als Solitär am<br />
nördlichen oberen Rand des Campus-Nord. Als<br />
technische Exklave befindet sich der Campus<br />
Nord inmitten des Karlsruher Hardtwalds<br />
anliegend an einem Strahl des Karlsruher<br />
Schlosses.<br />
<strong>Teil</strong> der Entwurfsidee ist der Verlauf der Tragstruktur,<br />
welcher sich nicht nur höhentechnisch<br />
Richtung Wald entwickelt, sondern auch<br />
konstruktiv. Das heißt von massiv gefassten<br />
Räumen bis hin zu immer weiter zurücktretender<br />
Tragstruktur, die sich Stück <strong>für</strong> Stück<br />
mit dem Wald verwebt. Dieser Gradient der<br />
Tragstruktur wird <strong>für</strong> die räumliche Wahrnehmung<br />
nochmals durch einen Materialwechsel<br />
hervorgehoben. Die Stützstruktur verläuft<br />
von massiven Betonpfeiler über Holzstützen<br />
bis hin zu filigranen Stahlstützen. Auch die<br />
horizontale Tragstruktur entwickelt sich von<br />
massiven Betonunterzügen bis hin zu filigranen<br />
Stahlfachwerkträgern.<br />
Im Grundriss wird weitestgehend auf durch<br />
Wände abgeschlossene Räume verzichtet.<br />
Räume die programmatischer Abgrenzungen<br />
bedürfen, wie zum Beispiel das Labor, sind<br />
durch Glas getrennt, um Einblicke <strong>für</strong> die Besucher<br />
in die Räume zu ermöglichen. Räume<br />
die baulich festgeschrieben sind, wie beispielsweise<br />
der Hörsaal, bekommen ein Rückgrat<br />
welches als optionale Fläche <strong>für</strong> angrenzende<br />
Bereiche dient, beispielsweise als Lagerfläche<br />
oder als Stuhllager.<br />
Auf dem Dach befindet sich der umlaufende<br />
„Treetop Science Lab“, der über eine Wendeltreppe<br />
vom EG zugänglich ist. Der Ring<br />
nimmt die Höhenentwicklung des Gebäudes<br />
auf, was es ermöglicht den Wald in unterschiedlichen<br />
Höhen wahrzunehmen.<br />
Die Fassade strukturiert sich durch die nach<br />
außen tretende Tragstruktur.<br />
1) Modellfoto<br />
2) Konzeptdarstellung<br />
3) Grundriss EG<br />
4) Dachaufsicht
Intermedius Waldinstitut, Campus Nord Karlsruhe<br />
Cara Hähl-Pfeifer<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1 2<br />
3 4<br />
Aktuell liegt der Campus Nord wie ein inselartiger<br />
Fremdkörper mitten im Meer der Bäume<br />
ohne jegliche Beziehung zum umgebenden<br />
Hardtwald aufzubauen. Den allgegenwärtigen<br />
Kontrast zwischen Mensch und Natur vor Ort<br />
gilt es aufzubrechen. Intermedius steht <strong>für</strong><br />
das Zwischenglied und beschreibt die Rolle des<br />
Waldinstitus, zwischen den Elementen Wald<br />
und Campus zu vermitteln, sie miteinander zu<br />
verbinden und den Campus neu zu aktivieren.<br />
Das Institut liegt direkt auf dem Hirschkanal<br />
und der Grabener Allee, die bis zum Schloss<br />
führt und baut dort entlang der Achse eine<br />
Brücke zwischen Wald und Campus auf.<br />
Die einzelnen Riegel des Gebäudekomplexes<br />
sind in die 4 Forschungsbereiche „Romantisches<br />
Ideal“, „Materielle Ressource“, „Ökologische<br />
Ressource“ und „Waldmanagement“<br />
unterteilt und ragen verschieden weit in die<br />
Wälder links und rechts des Kanals hinein.<br />
Dort gibt es einmal den weitestgehend unberührten,<br />
„romantischen“ Wald zum Erfahren<br />
der Natur und auf der anderen Seite den<br />
Nutzwald, der die Campus Struktur abbildet<br />
und zum Forschen und Intervenieren<br />
gedacht ist. Jedes Fachgebiet beschäftigt sich<br />
mit unterschiedlichen Aspekten des Waldes<br />
denn die Forschung im Inneren fließt in den<br />
Außenbereich.<br />
Geforscht wird immer an den Enden der<br />
Riegel, während es in den mittleren Bereichen<br />
über dem Kanal Gemeinschaftszonen gibt.<br />
Strukturell werden die Riegel durch Sonderelemente<br />
miteinander verbunden, in denen<br />
meist öffentliches, besonderes Raumprogramm<br />
zu finden ist wie z.B. die Galerie oder der<br />
große Kongresssaal. Auf das Dach eines der<br />
Riegel führen von beiden Seiten Treppen nach<br />
oben, die die beiden Wälder wortwörtlich miteinander<br />
verbinden.<br />
Von Außen gesehen stufen sich die Brückenbereiche<br />
über dem Kanal ab und erzeugen<br />
so einen einen betonten, gerahmten Blick.<br />
Richtung Karlsruhe.<br />
1) Grundriss<br />
2) Perspektive<br />
3) Axonometrie<br />
4) Modell
Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Georg Anton Heil<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
Fachgebiet <strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1 2 3<br />
4<br />
5 6<br />
7 8<br />
Das Waldinstitut soll vier Themenkomplexe,<br />
mit je eigenen Werten, Methoden und<br />
Traditionen fassen. Gemeinsam ist ihnen<br />
nur die Auseinandersetzung mit dem Objekt<br />
Wald. Der Wald wird zur Projektionsfläche<br />
<strong>für</strong> die eigene Betrachtung. Aber ist der Wald<br />
nicht zu komplex um ihn mit einer Lupe zu<br />
untersuchen? Aus diesem Grund sehe ich die<br />
Herausforderung in einem Institut, dass eine<br />
übergreifende Diskussion zwischen den Forschungsfokusen<br />
anregt und dem Besucher eine<br />
ganzheitliche Sicht auf den Wald vermittelt.<br />
Meine Arbeit trägt den Titel „vom Tunnelblick<br />
zum Tellerrand“.<br />
Im Sinne der Aufklärung schlage ich einen<br />
platonischen Körper vor, der als exponierter<br />
Solitär mit möglichst geringem Fußabdruck<br />
auf der Lichtung positioniert wird. Mit der<br />
Idee eines Interdisziplinären Instituts wird<br />
auch das Raumprogramm neu verknüpft<br />
und geordnet. Mit dem Ziel guter Forschung<br />
und voller Transparenz werden die Grenzen<br />
zwischen Öffentlichen Bereichen und der<br />
internen Forschung neu verhandelt. Es resultiert<br />
ein öffentliches Raumkontinuum, dass<br />
sich entlang der vier inneren Labore windet.<br />
Verbunden werden die Raumsequenzen durch<br />
programmatisch aufgeladene Tunnel. Durch<br />
die vertikale Ausrichtung der Raumspirale<br />
werden durch Tunnelblicke die Schichten<br />
des Waldes erlebbar. Von der Stammebene<br />
über die Baumkronen bis zum Blick über die<br />
Baumkronen hinweg. Der Dialog zwischen<br />
Forschung und Öffentlichkeit wird durch<br />
gezielte Einblicke und konstruierte Blickbeziehungen<br />
provoziert. Ein zentrales Element<br />
im Kern meines Entwurfs ist die Blackbox. Sie<br />
funktioniert als Fläche der Wissensvermittlung,<br />
die durch das Begehen der Raumspirale<br />
aktiviert wird. Die Kombination aus virtueller<br />
Wissensvermittlung und der unmittelbaren<br />
Wahrnehmung des Waldes soll den Besucher<br />
endautomatisieren und eine ganzheitliche<br />
Sicht auf die Thematik fördern.<br />
1) Lageplan<br />
2) Visualisierung außen<br />
3) Grundriss 2. OG<br />
4) Visualisierung innen 1<br />
5) Visualisierung innen 2<br />
6) Modellfoto 1<br />
7) Modellfoto 2<br />
8) Schnitt
GSEducationalVersion<br />
4m<br />
4,5m<br />
0 5<br />
0 5<br />
Droneport/<br />
Anlieferung<br />
10 m<br />
10 m<br />
Open Library<br />
Open Lab<br />
Open Lab<br />
Open Simulation<br />
4,8m<br />
Waldinstitut - In Between Nature and Architecture, Karlsruhe<br />
Joshua Lars Wacker<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
Fachgeiet <strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Georg Vrachliotis<br />
B<br />
A<br />
A<br />
B<br />
1 2<br />
„BAUMSTÄMME“ „BAUMKRONE“ „WALD“<br />
„DICHTE“<br />
„WALDVOLUMEN h=1m“<br />
„VERBINDUNG“<br />
„RAUM TASCHEN“<br />
„WALDVOLUMEN h=15m“<br />
„SONNENEINSTRAHLUNG“<br />
3<br />
„Forest Equations“<br />
4<br />
Open Lab<br />
5 6<br />
Ein Versuch den Dialog zwischen Natur und<br />
<strong>Architektur</strong> zu finden, war die primäre<br />
Entwurfsintention. Im Distanzraum Wald,<br />
artikuliert durch die Autonomie Verhältnisse,<br />
gibt es immer wieder kleinere Räume, die sich<br />
durch die Zwischenfelder der<br />
Baumstämme bilden. Dahingehend gibt es im<br />
Wald verschiedene Räumliche Parameter, die<br />
sich aus den primitiven gewachsenen Strukturen<br />
ergeben. Das Kulturobjekt <strong>Architektur</strong><br />
versucht sich innerhalb dieser Struktur einzubinden.<br />
Dies geschieht durch die Übernahme<br />
der räumlichen Parameter, die im Wald zu<br />
sehen sind. Die Zukunft der Waldforschung<br />
liegt im Entwurf in der Gesamtheit und der<br />
Multiflexibilität der Raumstruktur, die durch<br />
den Wald schon immer geboten wurde.<br />
Hermetische Kreise bilden <strong>für</strong> das Raumprogramm<br />
eine feste Verankerung, währenddessen<br />
die umliegende Erschließungsstruktur<br />
in einer Art Wald-Gebäude-Gefüge aufgelöst<br />
wird. Hiermit stellen sich natürlich unglaublich<br />
viele Schwellenräume ein, die immer neue<br />
Entdeckungsfelder bieten. Die Mobilität der<br />
Struktur versucht nicht dem Wald im Weg zu<br />
stehen, sondern stellt im wesentlichen<br />
ein großen Zwischenraum da, in dem Akteure<br />
der Forschung ihre Prozesse ausführen können.<br />
Die Möblierung nimmt jetzt die Hauptfunktion<br />
ein als Raumbildendes Element und<br />
verantwortet die Raumflexibilität. Ob der<br />
Raum durch Deterministische Prozesse oder<br />
Stochastische Prozesse (wie z.B.: das Simulationslabor<br />
) ausformuliert wird, liegt in der<br />
Hand der Entwicklung und Verläufe<br />
einer Alltagssituation und kann angepasst<br />
werden. Durch das öffnen der hermetischen<br />
Kreise, lässt sich die jeweilige Raumfunktion<br />
beliebig erweitern. Beispielsweise können somit<br />
Labore ausserhalb der definierten Fläche<br />
aufgebaut werden.<br />
1) Perspektive<br />
2) Grundriss<br />
3) Analyse Wald Parameter<br />
4) Ansicht, Schnitt BB<br />
5) Vertiefung<br />
6) Modell
5x5 Lichtungen (Waldinstitut), Karlsruhe<br />
Theresa Maria Klingler<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
ucationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
1<br />
ucationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
2<br />
3<br />
Im Umgang mit einem Entwurf, welcher sich<br />
in Thematik und Lage unmittelbar mit Wald<br />
auseinandersetzt, ist die architektonische Verhandlung<br />
dieses Verhältnisses essenziell.<br />
Um den sehr diversen Funktionen des Raumprogramms<br />
gerecht zu werden und ihren individuellen<br />
Umgang mit dem Wald zu bearbeiten,<br />
werden die Funktionen räumlich getrennt<br />
und einzeln als architektonische Lichtungen<br />
in den Wald gesetzt.<br />
Hierbei sind diese auf einem orthogonalen<br />
Raster angeordnet, der dort stattfindenden<br />
<strong>Architektur</strong> der Lichtungen liegt die geometrische<br />
Grundform des Quadrats zugrunde.<br />
Es steht die Rationalität der Lichtungen dem<br />
ungeordneten natürlichen Wuchs des Waldes<br />
entgegen. Durch die Opposition und das Ineinandergreifen<br />
dieser beiden Strukturen stärken<br />
sie sich gegenseitig und der Mensch erfährt in<br />
der Durchwegung den Kontrast der menschgemachten<br />
Struktur mit der ursprünglichen<br />
Natur sowie die unterschiedlich ausformulierte<br />
Kommunikation von <strong>Architektur</strong> und Wald.<br />
Um diese Erfahrung in Nuancen erfahrbar zu<br />
machen gibt die <strong>Architektur</strong> dem Wald unterschiedlich<br />
viel Raum.<br />
Die Lage des Grundstücks im Übergangsgebiet<br />
zwischen Campus Nord und Hardtwald<br />
nutzt der Entwurf um die Funktionen anhand<br />
zweier orthogonaler Achsen vermittelnd zu<br />
verteilen. Hierbei fungiert die Ost-West-Achse<br />
vermittelt zwischen der Öffentlichkeit der<br />
Grabener Allee und der nicht-öffentlichen<br />
Forschung, die Nord-Süd-Achse schafft den<br />
Übergang zwischen der Natur des Waldes und<br />
der Kultur des menschgemachten Campus.<br />
Die dadurch erreichte Struktur der Lichtungen<br />
im Wald erlaubt nun den Umgang der<br />
<strong>Architektur</strong> mit dem Wald zu verhandeln.<br />
Grundlegend hier<strong>für</strong> sind vier Arten der Beziehung<br />
von Lichtung und Wald: die komplette<br />
Abschottung, die gezielten Öffnungen, die<br />
lediglich thermische Grenze sowie das Fehlen<br />
jeglicher baulichen Grenze.<br />
1) Geländegrundriss<br />
2) Geländeübersicht<br />
3) Strukturausschnitt 9x9
GRABENER STRASSE<br />
VECTORWORKS EDUCATION<br />
Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Julius Friedrich Maisch<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
TESTING AREA<br />
GRABENER ALLEE<br />
HIRSCHKANAL HIRSCHKANAL<br />
HIRSCHKANAL<br />
GRABENER GRABENER ALLEE<br />
2 3<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
Kerngedanke meines Entwurfes war die<br />
Frage: Wie kann ich einen Übergang zwischen<br />
konzentriertem urbanen Betonmassen und<br />
umliegenden angrenzenden Waldgebieten<br />
schaffen? Gerade der hochtechnisierte Campus<br />
Nord ist zum Ausenraum sehr abgeschottet<br />
und introvertiert. Das Waldinstitut bildet<br />
<strong>für</strong> mich den Gradienten, welcher sich nun<br />
erstmals mit dem umliegenden Hardtwald<br />
auseinandersetzt. So entsteht diese diagonale<br />
Schwelle in der sich nun Wald und <strong>Architektur</strong><br />
auf wissenschaftlichem Wege begegnen.<br />
Der Gebäudekomplex gliedert sich primär in<br />
ein Hauptgebäude und die vier Forschungsbereiche:<br />
Materielle Ressource, Ökologische Ressource,<br />
Romantisches Ideal und Waldmangement.<br />
Diese lösen sich hin zu dieser Schwelle<br />
an ihren Achsen hin zu dieser Schwelle in ihre<br />
spezifischen Funktionen auf und betasten den<br />
Wald dadurch quasi mit ihren Fühlern welche<br />
zehn Meter vom Boden abgehoben wurden,<br />
um eine gleichgesinnte Gegenüberstellung<br />
mit dem Wald zu erzeugen. Diese bilden etwa<br />
Funktionen wie das Treetop Science Lab zur<br />
Baumkronenforschung, einem Droneport zur<br />
Überwachung der verschiedenen Forstgebiete<br />
oder einfach einen Viewpoint <strong>für</strong> Ornithologen<br />
oder ähnliches.<br />
Der angrenzende bildet in seiner Struktur<br />
eine Art Spiegelbild des Instituts, welcher sich<br />
aus seiner großen, wild gewachsenen Struktur<br />
hin zu kultivierten Testsfeldern und Versuchsaufbauten<br />
formt.<br />
Angebunden an die vorhandene Campus Infrastruktur<br />
ist eigentlich nur das Hauptgebäude<br />
welches technische, organisatorische und<br />
gemeinsam genutzte Funktionen enthält.<br />
Verbunden sind die dreizehn Solitäre durch<br />
ein Gängesystem im zweiten Obergeschoss,<br />
das sich aus dem Organisationsbereich des<br />
Hauptgebäudes bis in die spezifischen Bereich<br />
erschließt.<br />
1) Modell<br />
2) Schnitte<br />
3) Lageplan
Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Louisa Pape<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1<br />
A<br />
18,0<br />
17,0<br />
12,9<br />
B<br />
8,6<br />
4,3<br />
‘B<br />
-4,6<br />
-7,6<br />
2<br />
3<br />
‘A<br />
Das Campusgelände Nord soll an der östlichen<br />
Schwelle zum Hardtwald um ein weiteres<br />
Gebäude ergänzt werden. Das dort neu entstehende<br />
Waldinstitut hat sich zur Aufgabe gemacht,<br />
ungleich des bisher <strong>für</strong> die Öffentlichkeit<br />
schwer zugänglichen Campus Nord, eine<br />
breite Masse anzusprechen und somit einen<br />
transparenten Wissens- und Forschungsaustausch<br />
zu generieren.<br />
Über einen Wald-Trampelpfad werden Besucher<br />
von der Grabener Allee zum Waldinstitut<br />
umgeleitet und bekommen im Erdgeschoss<br />
erste Eindrücke der vier ausstellenden Institute.<br />
Material-Bibliothek, Black Box, Drone Port<br />
und eine Büchersammlung repräsentieren die<br />
Schwerpunkte: Material, Ökologie, Waldmanagement<br />
und Romantik. Im Erdgeschoss<br />
noch als eigenständige Bereiche ablesbar,<br />
verwachsen die Institute mit steigender<br />
Geschosszahl immer mehr und ermöglichen<br />
eine transparente Forschung unter Einbezug<br />
aller Blickwinkel. Die Entwicklung nach<br />
oben lässt sich somit zum einen als isoliert zu<br />
fachübergreifend, zum anderen als minimaler<br />
Fußabdruck zu maximalem Raumfluss<br />
beschreiben. Den Abschluss des Gebäudes<br />
bildet das 3.Obergeschoss/ Gemeinschaftsebene,<br />
welche durch durchstoßende Lichtkegel<br />
des 2.Obergeschosses/ Forschungsebene zum<br />
Dach, Einblicke in Labore und Arbeitsplätze<br />
der Wissenschaft bekommt.<br />
Die Schnittlogik verdeutlicht die zentrale<br />
Bedeutung des Innenhofs und zeigt die<br />
Organisation und Anpassung der Ringe an<br />
das Raumprogramm. Erwähnenswert ist die<br />
„hineinschwappende“ Landschaft in Form<br />
des Forschungs- und Agrarfelds, welches in<br />
dem tiefergelegenen Hof von Angestellten und<br />
Besuchern der Galerie und Werkstatt (UG) erfahrbar<br />
wird. Der Outdoorhörsaal im Kern des<br />
Forschungsfelds 15 vervollständigt die Schnittfigur<br />
und wird ähnlich einem Kuppelauge durch<br />
die kreisrunde Öffnung belichtet und in Szene<br />
gesetzt.<br />
1) Modellfoto<br />
2) Schnitt AA‘<br />
3) Grundriss 2.OG („Forschungsebene“)
B<br />
Das Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Rouven Ruppert<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliothis<br />
A<br />
C<br />
C<br />
B<br />
1<br />
A<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Die Geschichte von Mensch und Wald ist eine<br />
Geschichte der Entfremdung, sie beginnt mit<br />
der Evolution des Menschen und dem Verlassen<br />
des Waldes, eines Systems welches er<br />
nicht zu kontrollieren vermochte und welches<br />
er deshalb als Gefahr <strong>für</strong> sich und seine Spezies<br />
erachtete. Seit dem Verlassen des Waldes<br />
dehnte der Mensch über Jahrtausende hinweg<br />
seinen Einflussbereich immer weiter in die<br />
ursprünglich vorhandene Natürlichkeit hinein<br />
aus, bis er wieder vor jenem Wald stand, den<br />
er einst verlassen hatte.<br />
Betrachten wir den Menschen als unabdingbaren<br />
<strong>Teil</strong> des Gesamtsystems Mensch-Natur<br />
und betrachten wir jede seiner Handlungen<br />
als legitim zur Sicherung seines Fortbestandes<br />
und zur Verbesserung seiner Lebensbedingungen,<br />
so stellt sich die Frage was künftig die<br />
Prämissen <strong>für</strong> Interventionen des Menschen<br />
innerhalb einer „Neunatürlichkeit“ sein sollten.<br />
Dies zu klären und zu definieren ist die<br />
Aufgabe des Waldinstituts. Dazu gehört die<br />
Auseinandersetzung mit den Bedingungen<br />
einer Nutzbarmachung des Waldes innerhalb<br />
des Mensch-Wald Systems zur Begründung<br />
eines neuen Verständnisses von Natürlichkeit,<br />
der Neunatur. Es soll ein Gesamtverständniss<br />
von Wald etabliert werden, indem der Wald<br />
als Ressource in dreierlei Hinsicht verstanden<br />
wird, nämlich als kulturelle, ökologische und<br />
wirtschaftliche Ressource. Mit diesem neuen<br />
Naturverständnis soll die Geschichte der<br />
Entfremdung des Menschen vom Wald enden,<br />
indem er diesen neu entdeckt.<br />
Den Wert des Waldes zu erkennen, ihn in<br />
Gänze auf allen Ebenen erfahrbar zu machen<br />
und dadurch ein neues Waldverständnis zu<br />
etablieren, ist auch die Grundintention dieses<br />
Entwurfs. Es handelt sich um eine eindeutig<br />
menschengemachte, idealisierte Struktur in<br />
direktem Bezug zu seiner Umgebung. In drei<br />
Ebenen soll der Wald als Ganzes einerseits<br />
vermittelt andererseits zugleich zum Forschungsgenstand<br />
werden.<br />
1) Grundriss<br />
2) Perspektive<br />
3) Perspektive<br />
4) Modell
Waldinstitut Neoforst, Hardtwald<br />
Vincent Laurenz Ruffra<br />
Raum+Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Ist das romantische Ideal wie es heutzutage<br />
noch kommuniziert und idealisiert wird<br />
überhaupt noch authentisch und zeitgemäß?<br />
In meinem Entwurf Neoforst behandele ich die<br />
Etablierung eines neuen Romantischen Ideals.<br />
Das des industrialisierten Waldes.<br />
Das Gebäude gliedert sich dazu in drei Funktionsgruppen<br />
Wood/Atmos/Data. Diese werden<br />
an die öffentlichen Infrastruktur angeschlossen,<br />
die die Funktionseinheiten verbindet und<br />
versorgt. Der Besucher blickt in ein Panorama<br />
mit einem zweistufigen Aufbau. Der Blick<br />
durch die Forschung hindurch in den Wald,<br />
offenbart die neue Mensch-Wald-Beziehung<br />
und damit auch die neue Romantik, die ihr<br />
inne liegt.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt des Entwurfs war<br />
es, das moderne industrielle, also auch das<br />
maschinelle eines Gebäudes herauszuarbeiten.<br />
In diesem Entwurf, äußert sich das moderne<br />
maschinelle hauptsächlich durch die Programmierbarkeit<br />
der einzelnen Forschungsbereiche.<br />
Der Wood-Bereich des Instituts, lässt sich<br />
über seine Fassade und Freiflächen, der<br />
Atmosbereich über seine Bühnentechnik und<br />
der Databereich über seine digitale Fassade<br />
und Flexible Möbelstruktur, zu verschiedenen<br />
Forschungsschwerpunkten programmieren.<br />
Auch der Wald wird neu kultiviert angelegt<br />
und bildet eine neue Forschungsfeldstruktur<br />
aus, die verschiedene Schwerpunkte in der<br />
Forschung zulässt. Dabei kann jedes Waldfeld<br />
eine Forschungsmodul, in Form eines<br />
Waldpfadabschnitts oder beispielsweise eines<br />
Treetopsciencelabmodul angefügt werden.<br />
Durch die einzelnen Stationen, die sich auf<br />
dem Feld befinden, dreht sich die Panoramaperspektive<br />
und man erlebt die Forschung<br />
durch den Wald zum Institut hin.<br />
1) Ansicht<br />
2) Schnitt<br />
3) Perspektive
Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Niclas Fridtjof Schlötke<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Georg Vrachliotis<br />
1 2<br />
3 4<br />
DIE GRUNDFORM<br />
Der Entwurf schafft durch seine Grundform<br />
einen unmittelbaren Bezug zum Raumprogramm.<br />
Die Grundform verspricht ein gleichberechtigtes<br />
Verhältnis der vier verschiedenen<br />
Institutionen des Waldinstitutes.<br />
Die Ungerichtetheit des Kontextes - dem Wald<br />
- überträgt sich auch auf den Baukörper.<br />
Über seine gestaffelte Höhenentwicklung kreiert<br />
der Entwurf Räume mit unterschiedlichen<br />
vertikalen Dimensionen. Diese leiten sich aus<br />
den Ansprüche des Raumprogramms ab.<br />
Darüber hinaus birgt die Grundform der<br />
geschaffenen Stufenpyramide das Potenzial,<br />
als gebautes Bild ohne Weiteres vom Betrachter<br />
ergänzt werden zu können. Dies macht<br />
sich der Entwurf zu nutze, in dem er einzelne<br />
Stufen der Pyramide durch Baumreihen ersetzt.<br />
Gebaute Strukturen werden somit durch<br />
gewachsene Strukturen ergänzt. In ihrer<br />
Widersprüchlichkeit malen beide vereint ein<br />
symbolträchtiges Bild.<br />
POSITIONIERUNG<br />
Der Baukörper setzt sich auf die Grabener<br />
Alee und versperrt diese frequentierte Straße<br />
somit. Jene fräst sich vom Schloss ausgehend<br />
strahlenförmig durch den Hartwald.<br />
Der somit verbaute Weg fordert vom Besucher<br />
ein Umdenken und Umlenken ein.<br />
Der Besucher wird so aus seinem Alltagstrott<br />
gerissen - und sich auf der Suche nach einer<br />
alternativen Route - seiner Umgebung<br />
bewusst. Auf diese Weise wird die Auseinandersetzung<br />
vom Waldbesucher mit dem Wald<br />
selbst, weniger zu einer Option und mehr zu<br />
einer Unvermeidbarkeit.<br />
1) Perspektive<br />
2) Grundriss<br />
3) Perspektive<br />
4) Schnitte und Ansicht
Waldinstitut <strong>KIT</strong> Campus Nord, Karlsruhe<br />
„back to the roots“<br />
Benjamin Schönle<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen R+E<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
+4.80m<br />
+4.90m<br />
+3.70m<br />
±0.00m = 111.00müNN.<br />
-1.50m<br />
-1.50m<br />
±0.00m = 111.00müNN.<br />
1<br />
Erschließung<br />
Laboratorien<br />
Erschließung<br />
Laboratorien<br />
Hörsaal<br />
Kongresssaal<br />
Hörsaal<br />
Kongresssaal<br />
2<br />
Cafe + Service<br />
Galerie + LS + Materialbib<br />
Management Werkstatt + Workshop<br />
3 4<br />
Management Werkstatt + Workshop<br />
5<br />
“Jeder Eingriff bedingt eine Zerstörung.<br />
Zerstöre mit Verstand.“ (Luigi Snozzi)<br />
Grundansatz des Entwurfes ist eine möglichst<br />
defensive Haltung gegenüber dem Organismus<br />
Wald.<br />
Die architektonische Intervention in den Naturraum<br />
soll so gering wie möglich sein.<br />
Darüber hinaus ist es das Ziel, das Thema der<br />
Materialität herauszuarbeiten und die Welt<br />
unter dem Boden, also die Welt, die uns verborgen<br />
ist, zu entdecken und wahrzunehmen.<br />
Grundidee ist es, das Gebäudevolumen auf<br />
dem bereits vorhandenen Freiraum der Lichtung<br />
zu platzieren. Das Gebäudevolumen wird<br />
teilweise eingegraben und durch Erschließungsgräben<br />
in einzelne Schollen gegliedert.<br />
Der Wald wird in Form von grünen Versuchsanlagen<br />
auf der entstehenden Dachlandschaft<br />
im Sinne der Aufgabe neu interpretiert.<br />
In einem topografischen Spiel aus Architetur<br />
und Landschaft soll sich die <strong>Architektur</strong> dabei<br />
möglichst zurücknehmen und den Menschen<br />
als Gast im Naturraum verstehen.<br />
Im Wurzelraum des Waldrandes findet man<br />
die Grenze <strong>für</strong> den architektonsichen Eingriff.<br />
Das Projekt „Back To The Roots“ reagiert auf<br />
die Wurzelradien der umgebenden Bäume und<br />
erzeugt auf diese Weise einen amöbenartigen<br />
Rahmen <strong>für</strong> bauliche Maßnahmen.<br />
Durch die Aufnahme der priorisierten Wege<br />
auf dem Campus in das Gelände und deren<br />
Verschneidungen mit dem Freiraum der Lichtung<br />
entsteht die Form .<br />
Durch die aus dem Ort abgeleitete architektonsiche<br />
Form, reagiert der Entwurf auf den<br />
Genuis Loci.<br />
Dieser Ansatz ist eine mögliche Antwort auf<br />
die Frage nach der grundsätzlich architektonischen<br />
Aussage, über ein Gebäude mit dem<br />
Inhalt „Waldinstitut“.<br />
1) Schnitt<br />
2) Dachaufsicht<br />
3) Grundriss EG<br />
4) Grundriss UG<br />
5) Konzeptherleitung
Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Christina Specht<br />
Fachgebiet Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Dr. Georg Vrachliotis<br />
3<br />
10,32m<br />
8,55m<br />
5,50m<br />
3,66m<br />
-3,2m<br />
-4,2m<br />
4<br />
1<br />
B<br />
5<br />
A<br />
A<br />
B<br />
2 6<br />
Heutzutage steht der Wald im Forschungsfokus,<br />
denn er wird als Quelle nachwachsender<br />
Rohstoffe gesehen. Man sollte den Wald nicht<br />
unterschätzen, da er unser Klima vorteilhaft<br />
unterstützen kann. Diese wichtige Aufgabe<br />
zur Erforschung wird das Waldforschungsinstitut<br />
im Campus Nord übernehmen, welches<br />
im Hardtwald angesiedelt werden soll. Das<br />
Planungsgebiet befindet sich am nordöstlichen<br />
Bereich des Campus Nord, das momentan als<br />
Wald besteht. Eine gute Begehung <strong>für</strong> den<br />
nicht öffentlichen Campuszugang <strong>für</strong> Mitarbeiter<br />
und auch ein Zugang <strong>für</strong> Besucher<br />
außerhalb des Campusgeländes wurde berücksichtigt.<br />
Die Entwurfsidee besteht darin,<br />
das Waldforschungsinstitut als Bindeglied<br />
<strong>für</strong> Mitarbeiter und Besucher darzustellen.<br />
Das primäre Ziel war die Eingliederung des<br />
Gebäudes in die Landschaft und das Hervorheben<br />
des Waldes. Deswegen wurde ein ebenerdiges<br />
Gebäude geplant, das, mit niedrigerer<br />
Gebäudehöhe als der Wald, sich unkompliziert<br />
in die Umgebung einfügt. Die konzeptionelle<br />
Idee war, das gesamte Gebäude als Quadrat<br />
aufzubauen. In der Mitte befindet sich der<br />
gemeinschaftliche, öffentliche Bereich und in<br />
den etwas kleineren, äußeren vier Quadraten<br />
sind die unterschiedlichen Forschungsfokusse<br />
untergebracht.<br />
Ökologische Ressource (o.l.): Labor<br />
Materielle Ressource (o.r.): Werkstatt<br />
Romantisches Ideal (u.l.): Galerie & Bibliothek<br />
Waldmanagement (u.r.): offene Arbeistplätze<br />
Das ganze Gebäude ist mit einem Raster von<br />
2,5 Meter konzipiert.<br />
Das streng gerasterte Gebäude soll den Kontrast<br />
zu dem organisch gewachsenen Wald mit<br />
wenig Struktur darstellen.<br />
Das begehbare Dach, das am tiefsten Punk<br />
(Galerie) ebenerdig erschlossen ist, gibt vom<br />
höchsten Punkt (Werkstatt) einen direkten<br />
Blick in den Hardtwald.<br />
1) Lageplan<br />
2) Grundriss<br />
3) Ansicht<br />
4) Schnitt<br />
5) Modell<br />
6) Modell
+0m<br />
+0m - 3,9m<br />
- 3,9m +0m<br />
-1,2m<br />
Das Waldinstitut, Karlsruhe<br />
Clemens Urban<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
<strong>Architektur</strong>theorie<br />
Prof. Georg Vrachliotis<br />
1 2<br />
3<br />
Kongressraum Wald<br />
Urwald Versuchsfeld<br />
Englischer Garten<br />
CO2-Testfeld Wald- Arbeitszimmer<br />
Versuchsfläche<br />
Agrarfläche Treetop Sience Lab Plantage<br />
4<br />
Hardtwald<br />
5<br />
6<br />
Der Wald kann im anthropozänen Zeitalter<br />
nicht mehr dem romantischen Idealbild des<br />
natürlichen Waldes gerecht werden. Anstelle<br />
dessen rückt eine vom Menschen selbst<br />
inszenierte Darstellung der Natürlichkeit.<br />
Der Mensch erfährt nur noch eine limitierte<br />
Illusion der Natur. Diese verlorengegangene<br />
Verbindung zwischen Mensch und Natur<br />
ist nur durch die Vermittlung der Neuen<br />
Natürlichkeit wiederherzustellen. Die Aufgabe<br />
eines Waldinstituts im 21. Jahrhundert ist<br />
somit das neue und moderne Verständnis des<br />
vielschichtigen Waldes zu vermitteln.<br />
Das Waldinstitut befindet sich entlang des von<br />
Karlsruhe kommenden Strahls der Grabener<br />
Allee, und bildet die Schnittstelle zwischen<br />
Hardtwald und Campus Nord. Es verfolgt die<br />
Idee einer Wand als Grenze, die den bereits<br />
bestehenden Zaun ergänzt. Durch inszenierte<br />
Einblicke wird die Grenze theaterartig<br />
zum Schwellenraum, wodurch die Grabener<br />
Allee, als öffentlicher Weg die Rolle der Loge<br />
einnimmt, während das Gebäude selbst zur<br />
Bühne der Forschung wird und die angrenzenden<br />
Forschungsfelder den Hintergrund als<br />
Bühnenbild prägen. Die an der Grabener Allee<br />
liegende Ost- Fassade spiegelt den angrenzenden<br />
Hardtwald als Illusion wieder und lässt so<br />
das Gebäude bis auf die inszenierten Schwellenräume<br />
verschwinden. Durch das Herausdrücken<br />
der determinierenden Funktionen<br />
aus dem Riegel an der West Fassade wird ein<br />
Performativer Universalraum im Inneren<br />
geschaffen und die Ansicht von Seiten des<br />
Campus Nord geprägt. Die vier Forschungsbereiche<br />
werden entlang des Riegels gegliedert,<br />
während eine Trennung der Operativen<br />
und Repräsentativen Strukturen durch zwei<br />
Geschosse definiert wird. Die Östliche massive<br />
Außenwand beinhaltet verschiedene Schwellenräume,<br />
die Durchblicke von der Außenseite<br />
inszenieren. Durch das Spiel mit vertikalen<br />
Durchbrüchen wird der Raum gegliedert ,eine<br />
Sequenz gebildet und ein visueller Bezug<br />
zwischen Öffentlichkeit und Forschung hergestellt.<br />
1) Bildmanifest<br />
2) Perspektive Grabener Allee<br />
3) Inszenierte Einblicke/ Peep Holes<br />
4) Grundriss EG<br />
5) Grundriss OG<br />
6) Längsschnitt
Thema<br />
Haus der Gewässer<br />
Fachgebiet Entwerfen und Bauplanung<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Die <strong>Bachelor</strong>arbeit «Haus der Gewässer» bietet den Studierenden die<br />
Gelegenheit ein Infrastrukturgebäude mit unterschiedlichen Funktionen<br />
mit Bezug zum Wasser, an der Donau Mündung des Flusses Save<br />
in Belgrad zu entwerfen. Der Projektperimeter liegt am westlichen<br />
Ufer der Save, in mittelbarer Nachbarschaft zum Museum <strong>für</strong> Zeitgenössische<br />
Kunst, einem herausragenden Beispiel der jugoslawischen<br />
<strong>Architektur</strong> und ein Meilenstein im Werk des Architekt Ivan Antić in<br />
Zusammenarbeit mit Ivanka Raspopović. Der neue Gebäudekomplex<br />
soll ein alternatives Angebot der Überquerung zwischen Alt- und<br />
Neu-Belgrad auf Niveau des Wassers, statt über die hoch gelegene<br />
Branko Brücke, schaffen. Die einzelnen Programmteile sollen zu<br />
einer prägnanten neuen öffentlichen Infrastruktur entwickelt werden<br />
und den <strong>für</strong> Belgrad in den letzten Jahrzehnten so wichtig gewordenen<br />
Gewässerraum öffentlich erschließen.
House of Waters, Belgrade<br />
Jonie Benoufa<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
1<br />
VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION<br />
2 3<br />
Positioned at the confluence of Sava River and<br />
Danube, the House of Waters takes shape in<br />
the most exposed spot on the landtip of New<br />
Belgrade. Through this location the building<br />
claims its place as a reference point at the<br />
riverfront, welcomes arrivals in the name of<br />
New Belgrade and creates a public space at<br />
the end of the existing promenade. The House<br />
of Waters sits massive at the landtip and is<br />
washed around by the rivers on the one side<br />
and the park on the other, letting the tide defining<br />
its relation between the water and land.<br />
The entrance is created by the water commune,<br />
a big open space, which is also forming the<br />
centerpiece of the building and acting as a public<br />
connector between the different programs<br />
and stacks itself through all the three levels<br />
with a central atrium. Also the main access is<br />
located here, formulated by a wide linear staircase,<br />
underlining the polarity of the entrance<br />
hall between the two elements land and water.<br />
Also it leads the visitors through its center,<br />
connecting the entrance with the library and a<br />
part of the exhibition space, both found in the<br />
upper levels.<br />
In each bar is located a specific program,<br />
which are all connected to the center. The water<br />
authorities and the directorate are placed<br />
towards the confluence, to take a representative<br />
position on the water and have an guaranteed<br />
access to the water through the different<br />
tide levels over the year. The water taxi station<br />
is also located on the water, surrounded by<br />
the café and other sitting areas, to observe the<br />
docking of the boats.<br />
Through the combination of the different<br />
programs and the mostly public ground floor<br />
with the different outside areas, the building<br />
introduces a piece of urbanity at the end of the<br />
promenade.<br />
1) Floor plan ground floor<br />
2) Figure ground plan<br />
3) Perspective
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
House of Waters, Belgrad<br />
Friedhelm Christ<br />
Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Mark Frohn<br />
1<br />
3<br />
2 4<br />
Das House of Waters steht in Belgrad am Ufer<br />
der Sava, kurz vor ihrer Mündung in die Donau.<br />
An dieser exponierten Lage und in direkter<br />
Nachbarschaft zum Museum <strong>für</strong> moderne<br />
Kunst soll es verschiedenste Institutionen<br />
in Verbindung mit dem Wasser beherbergen.<br />
Das Ufer der Sava ist geprägt durch seine<br />
Topographie. Vom Wasser kommend gibt es<br />
zwei Stufen, wobei sich auf der unteren eine<br />
Promenade befindet, an der auch die Boote<br />
anlegen, während auf der oberen Stufe der<br />
dahinter gelegene Park beginnt. Diese Stufen<br />
macht sich das House of Waters zunutze<br />
und gliedert sich in die Topographie ein.<br />
Der zum Wasser ausgerichtete Grundriss des<br />
Untergeschosses gräbt sich in die Topographie<br />
des Ufers und beherbergt die großen Lagerräume<br />
und Archive. Zum Wasser hin öffnet er<br />
sich und bildet eine große Front in Richtung<br />
des Flusses. Das eingelassene Untergeschoss<br />
bildet gleichzeitig einen Sockel <strong>für</strong> die beiden<br />
darüber aufragenden Türme. In den Türman<br />
gibt es nicht nur Raum <strong>für</strong> die Büros des Ministeriums<br />
<strong>für</strong> Inlandsschifffaht sowie der<br />
Wasserpolizei, sodern im Erdgeschoss, welches<br />
der Öffentlichkeit vorbehalten ist, befinden<br />
sich zudem zwei große Sääle <strong>für</strong> Conferenzen<br />
und ander Veranstaltungen, sowie ein Café.<br />
Auch die Dächer der Türme sind zugänglich<br />
und bieten einen hervorragenden Blick, sowohl<br />
über Neu-, als auch Alt-Belgrad. Das House of<br />
Waters bildet einen neuen hybriden Stadtbaustein<br />
am Ufer der Sava, der nicht nur neuen<br />
Raum <strong>für</strong> die Bürokratie und Die Autoritäten<br />
schafft, sondern ebenso eine neuen Raum <strong>für</strong><br />
die Bewohner und Besucher der Stadt. Es bleit<br />
in seiner Form und Ausstrahlung schlicht und<br />
klar, und schafft dennoch eine neue, starke<br />
Präsenz am Flussufer. Es orientiert sich dabei<br />
an den Werken von Mies van der Rohe, dessen<br />
Vorgänger schon mit ihren Städtebaulichen<br />
Ideen die Gestalt von Neu-Belgrad prägten.<br />
1) Grundriss EG<br />
2) Perspektive<br />
3) Ansicht<br />
4) Schnitt
GSEducationalVersion<br />
77,0 m<br />
GSEducationalVersion<br />
73,30 m<br />
73,90 m<br />
69,90 m<br />
House of Waters, Belgrade<br />
Lara Verena Klein<br />
Fachgebiet Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Fachgebiet Stadt und Wohnen<br />
Prof. Christian Inderbitzin<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Situated at the Danube estuary of the Sava River<br />
in Belgrade the capitol of Serbia the House<br />
of Waters combines water related institutions<br />
and spaces for civic issues in one complex. It<br />
gives the forgotten waterfront of New Belgrade<br />
a new potential by offereing a building which<br />
is not only providing inside and outside spaces<br />
for visitors but also pleasant working spaces<br />
for the employees of the institutions.<br />
The new port at the New Belgrade shore<br />
welcomes the visitors and invites them to have<br />
a rest on the staircases leading into water and<br />
also privides new working space for the water<br />
authority.<br />
Inside the building the ramp system as main<br />
circualtion system provides the possibility to<br />
have framed views in the directions of Old<br />
Belgrade and New Belgrade. At the same time<br />
the public space in the middle of the building<br />
is the connector between the institutions and<br />
enables spaces for the interaction between<br />
visitors and employees of the House of Waters.<br />
To make sure there is a harmony between the<br />
administrative institutions and public spaces<br />
they are located in relation to each other and<br />
considered equal on all floor levels.<br />
The idea of framed views towards the important<br />
directions of Old and New Belgrade and<br />
along the Promenades is made more explicit<br />
through the transparent and semi-transparent<br />
fassade. The public core as well as the public<br />
spaces offer a lot of transparency through big<br />
openings whereas the fassade offers a litte bit<br />
more privacy for the institutions.<br />
1) Public Core Visualisation<br />
2) Ground Floor<br />
3) First Floor<br />
4) Elevation: River Side<br />
5) Elevation: Promenade
House of Water, Belgrad<br />
Merve Selin Onay<br />
Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
House of Waters ist ein wasserbezogenes<br />
Infrastrukturgebäude an der Donaumündung<br />
der Save in West Belgrad, welches sich in der<br />
Nähe des zeitgenössischen Kunstmuseums<br />
befindet.<br />
Die Einrichtung ist in drei Hauptfunktionen<br />
unterteilt:<br />
Der Exekutiven, die sich aus der Wasserschutzpolizei<br />
und Feuerwehr zusammensetzt,<br />
der Administration mit dem Wasserministerium<br />
und der Assoziation, die verschiedene<br />
Aktivitäten <strong>für</strong> die Öffentlichkeit anbietet.<br />
Um das Gebäude vor der Flut zu schützen,<br />
steht es auf einem Stützenraster, wodurch die<br />
Promenade erhalten bleibt und zusätzlicher<br />
Freiraum <strong>für</strong> Ausstellungen sowie Bootsreperaturen<br />
geschaffen wird.<br />
An die obere Promenade gekoppelt befindet<br />
sich das erste Obergeschoss, wodurch der Usče<br />
Park und das House of Waters miteinander<br />
verbunden werden. Außerdem ermöglichen die<br />
Atrien Blickbezüge auf die Promenade, sowohl<br />
bei natürlichem Wasserstand, als auch bei<br />
Überschwemmung.<br />
Des Weiteren wird im zweiten Obergeschoss<br />
ein Dachgarten mit Pergola <strong>für</strong> die Öffentlichkeit<br />
ausgebildet, damit begrünte Aufenthaltsflächen<br />
gefördert werden und um den visuellen<br />
Kontakt mit Kalamegdan im Osten Belgrads<br />
zu kreieren. Ebenfalls bietet das Wassertaxi<br />
des House of Waters eine alternative Möglichkeit<br />
die Ufer des alten und neuen Belgrads auf<br />
Wasserspiegelhöhe zu verbinden.<br />
Die einzelnen Elemente des Gebäudes sollen<br />
zu einer neuen prägnanten öffentlichen<br />
Infrastruktur ausgebaut werden. Somit kann<br />
der seit jahren wichtige Wasserraum Belgrads<br />
bewahrt werden.<br />
1) Lageplan<br />
2) Grundriss 1.OG<br />
3) Ansicht Ost<br />
4) Modell
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
Haus der Gewässer, Belgrad<br />
Simon Rieß<br />
Professur Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Professur Stadt und Wohnen<br />
Prof. Christian Inderbitzin<br />
1<br />
2<br />
3 4<br />
Das HAUS DER GEWÄSSER soll als Werkzeug<br />
zur Verbindung der beiden durch den<br />
Fluss Sava getrennten und kulturell, architektonisch<br />
und infrastrukturell unabhänigen<br />
Stadtteile Belgrads dienen.<br />
Die artifizielle Struktur überformt und ersetzt<br />
die bisherige natürliche Halbinsel an der Mündung<br />
der Sava in die Donau. Dabei verwächst<br />
sie mit der umgebenden Natur und wird zum<br />
kulturellen und infrastrukturellen Knotenpunkt.<br />
Um dem öffentlichen Charakter und dem Ziel<br />
des Verschmelzens mit der umgebenden Natur<br />
gerecht zu werden, ist das Erdgeschoss als ein<br />
offener, fluider Raum konzipiert, der durch ein<br />
klares Regelwerk geordnet wird.<br />
Entlang der zentralen Achse sind die vier massiven<br />
Kerne der Türme arrangiert. Sie definieren<br />
durch ihre transversale Positionierung<br />
den Raum. In der Konsequenz entstehen zwei<br />
Raumtypen: Zum einen der nicht-öffentliche<br />
Arbeitsbereich, welcher zusätzlich durch Glas<br />
abgetrennt ist und die Werkstatt mit Hangar,<br />
sowie die Docks von Polizei und Feuerwehr<br />
beinhaltet.<br />
Zum anderen der öffentliche Raum, welcher<br />
durch große Granitplatten markiert wird und<br />
24/7 zugänglich ist. Er beinhaltet u.a. die<br />
Eingagnshalle, das Auditorium, ein Cafe und<br />
die Wassertaxi-Station.<br />
Auch das Kassettendach übernimmt eine<br />
raumbildende Funktion im Innen- und Außenbereich.<br />
Es überspannt die drei Level Park,<br />
Promenade und Fluss und artikuliert somit<br />
den Übergang von Land zu Wasser. Außerdem<br />
trennt es den Sockel von den Türmen, welche<br />
die spezialisierten <strong>Teil</strong>e des Raumprogrammes<br />
vertikal komprimieren und auslagern.<br />
Die filigrane Fassadenkonstruktion aus Glas<br />
und Stahl umhüllt das Betonskelett der<br />
Türme und stellt deren innere Prozesse zur<br />
Schau. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen<br />
der Schwere des Daches und der Monumentatlät<br />
der Türme wird somit sichergestellt.<br />
1) Grundriss EG + Umgebung<br />
2) Schnitt<br />
3) Ansicht Süd<br />
4) Modellfoto
GSEducationalVersion<br />
GSEducationalVersion<br />
House of Water, Belgrad<br />
Lür Schäfer<br />
Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Raum und Entwerfen<br />
Prof. Marc Frohn<br />
1<br />
2<br />
3 4<br />
The Bridge, soll als Infrastrukturgebäude, das<br />
sich auf alle wasserbezogenen Institutionen an<br />
der Donaumündung der Save in Belgrad bezieht,<br />
verstanden werden.<br />
Die Brücke verbindet Kalemegdan, ein altes<br />
römisches Kastrum, welches ein strategisch<br />
wichtiger Ausgangspunkt <strong>für</strong> die Entwicklung<br />
der Stadt war, mit dem Neu - Belgrader Ufer.<br />
Das Neu- Belgrader Ufer der Save, eine etwas<br />
vernachlässigte Uferpromenade, ist die Folge<br />
eines größeren (gescheiterten) Traums, Neu<br />
Belgrad, einst Marschland, in eine moderne<br />
Hauptstadt der föderalen Volksrepublik Jugoslawien<br />
mit Verwaltungszentrum zu verwandeln.<br />
Die Brücke wird zum Haus <strong>für</strong> eine Vielzahl<br />
von wasserbezogenen kommunalen Einrichtungen<br />
von Flusspolizei und Flussfeuerwehr zu<br />
Wasserministerium und Raum <strong>für</strong> Bürgerversammlung<br />
mit Bibliothek. Des weiteren bietet<br />
sie eine alternative Möglichkeit, die Ufer von<br />
Alt- und Neu- Belgrad an einem unteren <strong>Teil</strong><br />
des Flusses anstelle der hoch gelegenen Brankow<br />
Brücke zu verbinden.<br />
Diese Brücke teilt sich erneut in eine Fußgänger-<br />
und eine funktionale Brücke auf. In der<br />
funktionalen Brücke befinden sich die verschiedensten<br />
Institutionen. An gewissen Orten<br />
weitet sich die Fußgängerbrücke in die funktionale<br />
Brücke aus. An diesen Plätzen ordnen<br />
sich öffentliche Funktionen des Programs an,<br />
sodass die Besucher der Plazas einen Blick auf<br />
die Flussmündung und die alte Festungsanlage<br />
bekommen. Von diesen Plazas, an denen<br />
sich Cafes, Ausstellungsräume, Reisezentrum<br />
etc. angliedern, gehen Treppen auf den öffentlichen<br />
Dachgarten. Dieser dient der Erholung<br />
und lädt zu einem Ausblick über ganz Neu- und<br />
Alt-Belgrad ein. Unter der Brücke befindet sich<br />
eine Werkstatt, Einsatzbereich der Polizei und<br />
eine Fährhaltestelle.<br />
1) Modellbild<br />
2) Grundrisse von oben: EG,OG, Dach<br />
3) Schnittperspektive Plaza<br />
4) Schnittperspektive Water Authority
Vectorworks Educational Version<br />
Haus der Gewässer, Belgrad<br />
Jakob Urban<br />
Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Stadt und Wohnen<br />
Prof. i.V. Christian Inderbitzin<br />
Vectorworks Educational Version<br />
1<br />
2<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
3<br />
4<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
+73.89 m High Fairway<br />
+69.90 m<br />
Low Fairway<br />
+73.30 m<br />
+76.00 m<br />
5<br />
6<br />
igh Fairway<br />
ow Fairway<br />
+73.30 m<br />
+76.00 m<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Vectorworks Educational Version<br />
7<br />
Vectorworks Educational Version<br />
Das „Haus der Gewässer“ („House of Waters“)<br />
repräsentiert aufgrund seiner Lage das Bindeglied<br />
zwischen Alt- und Neubelgrad. Gelegen<br />
am westlichen Ufer des Flusses Save, separiert<br />
als Plattform ragt es im Charakter der<br />
typischen Hausboote Belgrads in den Fluss<br />
hinein. Eine Brücke verbindet es mit dem auf<br />
dem Festland gelegenen Ušće-Park. Als direkte<br />
Referenz in unmittelbarer Nachbarschaft<br />
dient das Museum <strong>für</strong> zeitgenössische Kunst.<br />
Als Einheit kombiniert das Gebäude sämtliche<br />
Aspekte des Raumprogramms, von Taxihafen<br />
und Polizei / Feuerwehr auf Wasserebene bis<br />
hin zu Büroeinheiten in oberen Geschossen.<br />
Die Blickbezüge in Kombination mit den<br />
öffentlichen Aspekten werden durch die zentralen<br />
Bühne verwirklicht, welche die Kulisse<br />
der historischen Kalemegdan-Festung in Altbelgrad<br />
nutzt. Der Öffentlichkeitsbezug setzt<br />
sich im weiteren Erdgeschoss fort, sowohl die<br />
Ausstellungen als auch Warteraum und Café<br />
bieten hier Aufenthaltsqualität mit Ausblick.<br />
Die Trennung zwischen Hafeninstanz, Schiffswerkstatt,<br />
Wache und Behörde wird durch<br />
Höhenstaffelung der verschiedenen Bereiche<br />
erzielt, sodass mit zunehmender Gebäudehöhe<br />
mehr und mehr Privatheit entsteht.<br />
Gedrehte Boxen, Vectorworks die Großraumbüros Educational Version mit<br />
internen Atrien beinhalten, bilden die Verwaltungsebene.<br />
Den Abschluss stellt ein durch<br />
das zentrale Treppenhaus / Foyer unterbrochener<br />
Riegel dar, in welchem ebenfalls Büros<br />
untergebracht sind.<br />
Die vielen Versprünge, Atrien und begehbaren<br />
Boxen mit spannendem Ausblick auf<br />
den Fluss machen diesen Entwurf besonders<br />
außergewöhnlich. Auch in der monumentalen<br />
Eingangshalle mit Treppenhaus, welche durch<br />
die Transparenz wieder Blickbezüge auf das<br />
Ostufer liefert, finden sich Zitate des Museums<br />
wieder. Diese sind umgesetzt in der Fassade<br />
der Ausstellungen, sowie in den schrägen<br />
Atrien der beiden obersten Geschosse.<br />
1) Lageplan Belgrad<br />
2) Perspektive Fluss Save<br />
3) Grundriss EG<br />
4) Perspektive Bühne<br />
5) Querschnitt<br />
6) Ansicht Süd<br />
7) Ansicht Ost
GSEducationalVersion<br />
House of Waters, Belgrad<br />
Vincent Witt<br />
Fachgebiet Bauplanung und Entwerfen<br />
Prof. Simon Hartmann<br />
Für das House of Waters - ein Infrastrukturbau<br />
<strong>für</strong> Wasserfeuerwehr, Wasserpolizei,<br />
Wasserkommune und Schifffahrtsbehörde - ist<br />
ein Baugebiet im Ušće Park ausgewiesen. Der<br />
Park befindet sich direkt an der Mündung der<br />
Save in die Donau und ist <strong>Teil</strong> des Stadterweiterungsprojekts<br />
Neu Belgrad. Am Ufer<br />
der Save bildet der Park drei Wege aus.<br />
Der Entwurf entscheidet sich, diese wegen<br />
ihrer angestammten Nutzer unangetastet zu<br />
lassen und ergänzt sie um einen vierten, in<br />
den rückwärtigen <strong>Teil</strong> des Parks führenden<br />
Weg. Auf der Wasserseite wird der Weg durch<br />
Personenfähren erweitert und der Park so<br />
von vielen Stellen Belgrads aus zugänglich.<br />
Das Gebäude berührt an drei Stellen den<br />
Boden. Ein Volumen steht im Wasser und<br />
beherbergt die Bootswerkstätten, Bootslager<br />
sowie die Einsatzräume der Wasserfeuerwehr.<br />
Auf der Landseite befindet sich der Aussichtsturm,<br />
welcher den Blick über die Mündung<br />
ermöglicht, sowie auf dem höher gelegenen<br />
<strong>Teil</strong> des Parks die Ausstellungsflächen mit<br />
Besuchercafé der Wasserkommune. Unter dem<br />
Träger wird ein Steg ausgebildet, welcher eine<br />
Außenbühne und weitere Ausstellungsflächen<br />
bereit hält. In dem Trägervolumen, ab dem<br />
erstem Obergeschoss, reihen sich von Land<br />
zu Wasserseite: Wasserkommune mit Konferenzsälen,<br />
Bibliothek und Serviceschaltern,<br />
Schifffahrtsbehörde mit Großraumbüros,<br />
kleineren Besprechungssälen und großzügigem<br />
Mitarbeitercafé und Wasserpolizei und<br />
Wasserfeuerwehr mit Büros, Archiven und<br />
Schulungsräumen. Das Bootslager und die<br />
Einsatzräume der Wasserfeuerwehr sind auf<br />
Funktionalität ausgelegt. So lassen sich Boote<br />
mit einem Portalkran direkt aus dem Wasser<br />
in die Werkstatt oder in das Lager heben. Die<br />
Einsatzräume der Wasserfeuerwehr sind im<br />
Hinblick auf eine möglichst schnelle Einsatzbereitschaft<br />
organisiert. Die Wohnräume<br />
der Wasserfeuerwehr sind im dritten Obergeschoss<br />
angesiedelt und genießen so einen<br />
besonderen Blick über die Save ins innere von<br />
Belgrad.<br />
1) Axonometrie<br />
2) Blick von Beton Hala<br />
3) Perspektivschnitt Bootslager<br />
4) Mitarbeitercafé
Impressum<br />
<strong>Bachelor</strong>-Thesis <strong>Sommer</strong> <strong>2020</strong> <strong>Teil</strong> 1/2<br />
Die Beiträge dieser Publikation wurden von den Absolventinnen<br />
und Absolventen erstellt. Die Rechte liegen bei ihnen.<br />
Gestaltung<br />
Dipl.-Des. Frank Metzger<br />
Bildnachweis<br />
Umschlag:<br />
Vorderseite:<br />
Intermedius Waldinstitut, Campus Nord Karlsruhe<br />
Cara Hähl-Pfeifer<br />
Rückseite:<br />
Lür Schäfer<br />
House of Water<br />
Herausgeber<br />
<strong>KIT</strong>-<strong>Fakultät</strong> <strong>für</strong> <strong>Architektur</strong><br />
Englerstraße 7<br />
76131 Karlsruhe<br />
arch.kit.edu<br />
Karlsruhe, September <strong>2020</strong>