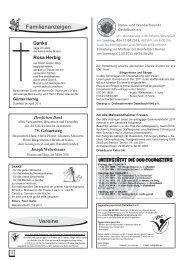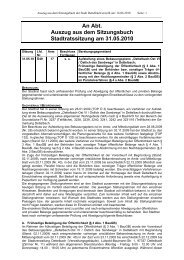Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Dettelbach
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Dettelbach
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Dettelbach
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nepomuk in<br />
<strong>Dettelbach</strong><br />
12<br />
Johannes-von-Nepomuk, <strong>der</strong> „Brückenheilige“ von Karl Uhl<br />
In vielen Städten Böhmens, Österreichs <strong>und</strong> teilweise auch Bayerns steht ein Denkmal des Heiligen Johannes von<br />
Nepomuk. Häufig steht es wie sein bekanntestes Vorbild in Prag, auf einer Brücke. Das Bespiel in <strong>Dettelbach</strong> folgt<br />
damit einer weit verbreiteten Tradition. Auch Haslau hatte seinen „Nepomuk“. Er stand jedoch nicht auf einer Brücke,<br />
son<strong>der</strong>n auf dem Marktplatz, flankiert von zwei kugelig zugeschnittenen Bäumen. Die Tschechen haben das Denkmal<br />
von seinem alten Platz entfernt <strong>und</strong> in das Innere des Kirchhofes gestellt. Der Haslauer „Nepomuk“ wurde im Jahre<br />
1720 vom damaligen Besitzer des Gutes Haslau, Freiherr von Moser, aufgestellt. Diese Adelsfamilie hatte das Gut<br />
Haslau 1683 erworben <strong>und</strong> bis 1795 besessen. Auf dem Sockel waren die Anfangsbuchstaben des Stifters<br />
eingemeißelt: MFVM - das bedeutet: Moritz Ferdinand von Moser. Er stiftete auch eine Ecce Homo-Statue (Ecce Homo<br />
= seht, welch ein Mensch!). Auch die Errichtung einer Kapelle wurde von <strong>der</strong> Familie Moser veranlasst.<br />
Was zur Popularität dieses Heiligen <strong>und</strong> zur Verbreitung des Kultes um ihn, bis in den Würzburger Raum geführt?<br />
Man kann die Errichtung <strong>der</strong> zahlreichen Johannes-von-Nepomuk-Statuen nur verstehen, wenn man einen Blick auf<br />
die historische Persönlichkeit <strong>und</strong> auf die beson<strong>der</strong>en Umstände seiner Verehrung als Heiliger während <strong>der</strong><br />
Barockzeit wirft. Johannes wurde um 1350 in dem Städtchen Pomuk in Südböhmen geboren. Sein zweiter Name<br />
Nepomuk bedeutet daher eine Herkunftsbezeichnung: Ne pomuky = <strong>der</strong> aus Pomuk Stammende. Sein Vater war dort<br />
<strong>Stadt</strong>richter <strong>und</strong> Bürgermeister, also bürgerlicher Herkunft. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit seiner<br />
grässlichen Ermordung von Bedeutung - doch davon später. Bereits im Jahre 1370 tauchte er als Bediensteter <strong>der</strong><br />
Erzdiözese Prag auf. 1380 wurde er zum Priester geweiht. Er studierte zunächst an <strong>der</strong> unter Kaiser Karl IV im Jahre<br />
1348 gegründeten Prager Universität Kirchenrecht. 1383 begann er das Studium an <strong>der</strong> neben Bologna damals<br />
bedeutendsten Universität, nämlich Padua. 1387 kehrte er als Doktor des Kirchenrechts wie<strong>der</strong> in die Erzdiözese<br />
Prag zurück. Er muss also ein hochgebildeter <strong>und</strong> hochintelligenter Mann gewesen sein, denn das Studium in Padua<br />
war für einen Kleriker bürgerlicher Abkunft absolut ungewöhnlich. Ebenso ungewöhnlich war sein weiterer Aufstieg: er<br />
wurde 1389 Generalvikar <strong>der</strong> Erzdiözese Prag <strong>und</strong> damit nach dem Bischof <strong>der</strong>en höchster Beamter.<br />
Damit nahm jedoch sein persönliches Verhängnis seinen Lauf. Auf den bedeutenden Herrscher Karl IV (1347 bis<br />
1378) folgte sein unfähiger, aber nichtsdestoweniger machtbesessener Sohn Wenzel als böhmischer König<br />
Wenzel IV. Sein Ziel war es, seine Macht in Böhmen dadurch auszudehnen, dass er kirchliche Ämter mit seinen<br />
Günstlingen besetzen wollte. Mit Johannes, dem Vertreter des Kirchenrechts, musste dies zu ständigem Streit<br />
führen. Dieser Streit eskalierte als nach dem Tode des Abtes von Kladrau <strong>der</strong> König diese Stelle mit einem seiner<br />
Vertrauten besetzen <strong>und</strong> zusätzlich durch die Errichtung eines Teilbistums Kladrau die Erzdiözese Prag<br />
schwächen wollte. Um dem König zuvor zu kommen, ließ <strong>der</strong> Erzbischof in kürzester Frist einen neuen Abt<br />
wählen <strong>und</strong> hat ihn sogleich bestätigt. Der König nahm darauf den Erzbischof, einen weiteren hohen Kleriker <strong>und</strong><br />
Johannes gefangen. Während man jedoch den Erzbischof entkommen <strong>und</strong> den an<strong>der</strong>en Kleriker nach einem<br />
Geständnis (Was sollte er denn gestehen? Es ist nichts überliefert.) wie<strong>der</strong> laufen ließ, hat man Johannes in <strong>der</strong><br />
Nacht vom 20. auf den 21. März 1393 bestialisch gefoltert, gefesselt <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Moldau ertränkt. Der König hat<br />
an dieser Folterung mitgewirkt.<br />
Das „Original“:<br />
<strong>der</strong> Nepomuk auf<br />
<strong>der</strong> Karlsbrücke<br />
in Prag<br />
Die oft zitierte Aussage, Johannes habe sich standhaft geweigert als Beichtvater <strong>der</strong> Königin das<br />
Beichtgeheimnis preiszugeben, gehört in das Reich <strong>der</strong> Legende. Es ist nicht einmal belegt, ob er Beichtvater<br />
<strong>der</strong> Königin war. Die Gründe für diesen grauenhaften Justizmord sind vielmehr politischer <strong>und</strong> sozialer Art.<br />
Politisch war es <strong>der</strong> Kampf zwischen Kirche <strong>und</strong> Staat um die Vorherrschaft in Böhmen. Der soziale Aspekt liegt<br />
darin begründet, dass <strong>der</strong> Erzbischof <strong>und</strong> <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e hochgestellte Kleriker von Adel waren. König Wenzel wäre möglicherweise in einen Konflikt mit<br />
seinen adeligen Standesgenossen geraten, wenn er gegen sie vorgegangen wäre. Deshalb fällt seine Rache auf den Vertreter <strong>der</strong> Kirche aus bürgerlicher<br />
Herkunft. Die Kirche lässt jedoch dem toten Generalvikar eine beson<strong>der</strong>e Ehre wi<strong>der</strong>fahren: sie setzt ihn im St. Veitsdom bei, eine Ehre, die sonst nur<br />
Bischöfen zuteil wurde. Von Anfang an wird er vom Volk verehrt. Liegen die Ursachen in <strong>der</strong> Vorstellung, dass hier ein schweres Unrecht geschehen ist?<br />
War es vielleicht <strong>der</strong> Vergleich mit Christus selbst? Auch <strong>der</strong> Tod Christi war ein grausamer Justizmord, verb<strong>und</strong>en mit purem Opportunismus <strong>der</strong> römischen<br />
Staatsmacht in Palästina. Möglicherweise ist auch ein aufkommen<strong>der</strong> Nationalismus mit im Spiel, denn Johannes stammte immerhin aus dem tschechischen<br />
Volke. Kurze Zeit später wird <strong>der</strong> erste tschechische Nationalismus zu einer politischen Macht. Seine<br />
Symbolfigur wird Jan Hus, <strong>der</strong> im Jahre 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Legenden bilden sich um den<br />
toten Johannes <strong>und</strong> verbreiten sich rasch im Volk. Bereits beim Ertrinken in <strong>der</strong> Moldau soll ein Sternenkranz um<br />
seinen Kopf gesehen worden sein. Man beachte in diesem Zusammenhang die häufige Darstellung auf seinen<br />
Standbil<strong>der</strong>n. Auch W<strong>und</strong>er wurden ihm zugeschrieben. 1719 wurde sein Grab im St. Veitsdom in Anwesenheit<br />
mehrerer Ärzte geöffnet. Man fand dabei ein unverwestes organisches Weichteil, das als Zunge identifiziert wurde.<br />
Dies gab <strong>der</strong> Legende vom standhaften Beichtvater <strong>der</strong> Königin neue Nahrung. 1721 wurde er selig, 1729 heilig<br />
gesprochen. Eine 1973 stattgef<strong>und</strong>ene weitere Exhumierung identifizierte den nach wie vor unverwesten <strong>und</strong><br />
ursprünglich für die Zunge gehaltenen Weichteil als Teil des Gehirns.<br />
Seligsprechung <strong>und</strong> Heiligsprechung, verb<strong>und</strong>en mit <strong>der</strong> Legendenbildung, führten zu einer spontanen Zunahme <strong>der</strong><br />
Verehrung im Lande. Die Errichtung <strong>der</strong> Statue in Haslau im Jahre 1720 ist dafür ein Beispiel. Diese Verbreitung hat<br />
wie<strong>der</strong>um einen politischen Hintergr<strong>und</strong>. In <strong>der</strong> Schlacht am Weißen Berg bei Prag im Jahre 1620 wurde <strong>der</strong> protestantisch<br />
gewordene böhmische Adel von den katholischen Habsburgern besiegt. Diese betrieben in <strong>der</strong> Folgezeit<br />
eine gezielte Rekatholisierung des Landes. Auch dafür ist Haslau wie<strong>der</strong>um ein Beispiel: es wird 1624 wie<strong>der</strong> katholisch.<br />
Zur Festigung <strong>der</strong> katholischen Lehre in <strong>der</strong> Bevölkerung brauchte man einen Heiligen, <strong>der</strong> den Glauben<br />
personifizierte. Der Johannes- bzw. Nepomukkult wurde deshalb von den Habsburgern systematisch geför<strong>der</strong>t. Mit<br />
<strong>der</strong> Selig- <strong>und</strong> Heiligsprechung 1721 bzw. 1729 erfuhr dieser Kult auch seine kirchenrechtliche Legitimation. Es<br />
mutet wie ein Treppenwitz <strong>der</strong> Geschichte an: <strong>der</strong> absolutistische Staat <strong>der</strong> Habsburger, in dem <strong>der</strong> Wille des<br />
Herrschers Gesetz war <strong>und</strong> <strong>der</strong> keinen Wi<strong>der</strong>spruch seiner Untertanen duldete, för<strong>der</strong>te den Kult um einen Heiligen,<br />
Der Haslauer „Johannes“<br />
<strong>der</strong> gerade durch seinen Wi<strong>der</strong>spruch gegenüber <strong>der</strong> Staatsmacht zu <strong>der</strong>en Opfer wurde.