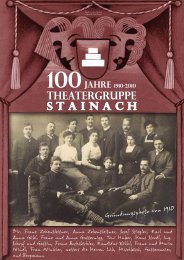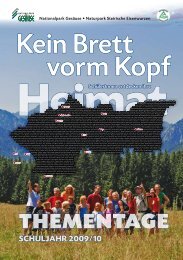Zeit1 - Regionale10
Zeit1 - Regionale10
Zeit1 - Regionale10
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
24 — 25<br />
Adam Budak<br />
Christian Philipp Müller<br />
Green Border, 1993<br />
Performance anlässlich<br />
eines weiteren Films im Kopf unter der Regie von Pawel Althamer, oder wir<br />
berühren das authentische Gewebe des ganz gewöhnlichen Lebens, oder<br />
aber wir erleben beides gleichzeitig, da wir offenbar bereits IN DIE DINGE<br />
HINEINGELAUFEN SIND… In seiner Transzendierung der Grenzen des Vertrauten<br />
und Hinterfragung des Status des Aliens ist das Projekt Things You<br />
Can Walk Into eine weitere Kritik an der Mentalität des Eigensinnigen. Der<br />
Ruf nach Zusammengehörigkeit und ein Sinn für Zugehörigkeit und<br />
Gemeinschaft, der so typisch für Althamers Künstlerethos ist, ist der Weltsicht<br />
des Homo faber ähnlich und erlaubt die Wahrnehmung des Künstlers<br />
als reine Verkörperung der Vita activa: „Die Vita activa, menschliches<br />
Leben, sofern es sich auf Tätigsein eingelassen hat, bewegt sich in einer<br />
Menschen- und Dingwelt, aus der es sich niemals entfernt und die es nirgends<br />
transzendiert. (…) Es gibt kein menschliches Leben, auch nicht das<br />
Leben des Einsiedlers in der Wüste, das nicht, sofern es überhaupt etwas<br />
tut, in einer Welt lebt, die direkt oder indirekt von der Anwesenheit anderer<br />
Menschen zeugt. Alle menschlichen Tätigkeiten sind bedingt durch die Tatsache,<br />
dass Menschen zusammenleben, aber nur das Handeln ist nicht einmal<br />
vorstellbar außerhalb der Menschengesellschaft.” 32 Genau dort sollte<br />
man Althamers Praxis ansiedeln – im Zwischenbereich zwischen Herstellen<br />
und Handeln: „Dieser besondere Bezug, der das Handeln an das menschliche<br />
Zusammen bindet, scheint es vollkommen zu rechtfertigen, dass schon<br />
sehr früh (bei Seneca) die aristotelische Bestimmung des Menschen als<br />
eines zoon politikon, eines politischen Lebewesens, im Lateinischen durch<br />
das animal socialis wiedergegeben wird, bis schließlich Thomas [von Aquin]<br />
ausdrücklich sagt: ‚homo est naturaliter politicus, id est, socialis (Der<br />
Mensch ist von Natur politisch, das heißt gesellschaftlich)’”. 33 Das ist<br />
genau die Gesamtdimension Pawel Althamers künstlerischer Praxis: Politik<br />
und Gesellschaft.<br />
der Venedig Biennale Christian Philipp Müller<br />
32<br />
Hannah Arendt: Vita activa,<br />
S. 33.<br />
33<br />
Ebda., S. 34.<br />
34<br />
James Meyer, Christian<br />
Philipp Müller: Ein Gespräch.<br />
In: Philipp Kaiser<br />
(Hrsg.): Christian Philipp<br />
Müller. Basel: Kunstmuseum<br />
Basel, Museum für<br />
Gegenwartskunst 2007,<br />
S. 41.<br />
Christian Philipp Müller<br />
„Burning Love“ oder: Das performative Porträt eines Lokalmatadors<br />
Christian Philipp Müllers kritische Kunstpraxis beschäftigt sich mit der<br />
Kartierung der institutionellen und geopolitischen Parameter des Vernakulären.<br />
Sein Werk ist die Mise-en-scène verschiedenster Wissensdisziplinen,<br />
geschaffen von einem Künstler, der in die verschiedensten Rollen<br />
schlüpft – Archivar, Forscher, Kommunikator und Performer. Dabei bleiben<br />
die Themen nationale Identität und Konstruktion von Grenzen im Zentrum<br />
von Müllers Untersuchungen der Ökonomien des jeweiligen Ortes und der<br />
Politik der Zugehörigkeit. Für die Installation Grüne Grenze, die er 1993 für<br />
den österreichischen Pavillon im Rahmen der Biennale von Venedig realisiert<br />
hat, überquerte der Künstler im Wanderer-Outfit acht Mal illegal Staatsgrenzen.<br />
„In meiner Anleitung zur Grenzüberquerung machte ich Vorschläge<br />
für das beste Outfit, um mit der Landschaft zu verschmelzen. Heutzutage<br />
ist der Tourist die unauffälligste Gestalt“ 34 , bekennt der Künstler bei der<br />
Space Rendez-Vouz,<br />
2008<br />
Manifesta 7, Rovereto<br />
Strickmuster „Brennende<br />
Liebe“<br />
35<br />
Ebda., S. 56.<br />
36<br />
James Meyer: The Functional<br />
Site. In: Platzwechsel.<br />
Ursula Biemann, Tom Burr,<br />
Mark Dion, Christian Philipp<br />
Müller, Kunsthalle Zürich<br />
1995, S. 25-29.<br />
Beschreibung seines bahnbrechenden Projekts, das mittlerweile zu einem<br />
Symbol für den künstlerischen Diskurs zur Politik nach 1989 und Themen<br />
der nationalen Repräsentation geworden ist. Das gesamte Schaffen von<br />
Christian Philipp Müller scheint ein Statement gegen den Eigensinn zu<br />
sein. In einem Gespräch mit James Meyer räumt er ein: „Ich hasse starre<br />
Identitäten. Ich glaube an multiple Identitäten (…) Wir werden alle auf Klischees<br />
reduziert. Wir werden typisiert, weil unsere Gesellschaft mit multiplen<br />
Identitäten nichts anfangen kann. Wenn ich über diesen Bach springe,<br />
dann sehen Sie mich genau im Dazwischen, an der Grenze: Das ist es vor<br />
allem, worum es in meiner Arbeit geht. Sie ist eine Hybride. Sie haben ein<br />
Bild vor sich und eine Bildunterschrift, und sie versuchen dann im Kopf eine<br />
Verbindung zwischen dem, was Sie sehen und dem was Sie lesen herzustellen.<br />
Was ich dabei erreichen möchte, ist die richtige Abstimmung. Ich<br />
versuche das geeignete Medium, den Maßstab, den Raum und die Einbeziehung<br />
meines eigenen Körpers zu finden, um meine Botschaft rüberzubringen.<br />
Zum Beispiel zeigte ich in Venedig nicht das Werk von Christian Philipp<br />
Müller. Ich präsentiere mich nicht selbst als das Produkt. Ich präsentiere<br />
Umstände. Ich orientiere mich in der Arbeit an Themen, vorgegebenen und<br />
selbst gewählten.“ 35 Seine für die Manifesta 7 (2008) konzipierte Feldarbeit/Installation/Performance<br />
Space Rendez-Vous ist ein komplexes ortsspezifisches<br />
Gebäude aus Querverweisen, in dem der Futurist Fortunato<br />
Depero auf Weltraumeroberungsträume aus der Zeit des Kalten Krieges<br />
trifft, die globale Industrie und folkloristische Allegorien. Müllers Carro<br />
Largo-Parade, die bevölkert war mit in Trachten für Deperos festa dell’uva<br />
im Jahr 1936 gekleideten Menschen war ein ehrgeiziger Versuch, unter Verwendung<br />
des kritischen Vokabulars einer globalisierten Welt die Dogmen<br />
des Regionalismus neu zu schreiben. Christian Philipp Müllers Kunstpraxis<br />
(zusammen mit dem Werk von u.a. Fred Wilson, Mark Dion, Andrea Fraser)<br />
wurde von James Meyer als Erforschung des so genannten „funktionalen<br />
Ortes“ beschrieben, einem erweiterten Ortsbegriff, der im Gegensatz zu<br />
einem (physikalischen) festen Ort als „ein Prozess, ein sich zwischen Orten<br />
vollziehender Vorgang, eine Kartierung institutioneller und diskursiver Verzweigungen<br />
und der sich dazwischen bewegenden Körper (vor allem dem<br />
des Künstlers) verstanden wird. Es ist ein Ort der Informationen, Schauplatz<br />
des Ineinandergreifens von Texten, Fotografien und Videoaufzeichnungen,<br />
physikalischen Orten und Dingen: ein allegorischer Ort (…).“ 36 Nach<br />
dieser Definition ist das Werk eine Bewegung, eine Bedeutungskette; eine<br />
Funktion erscheint in der Passage zwischen Orten und Blickwinkeln. Meyer<br />
unterstreicht die Bedeutung des Zusammentreffens zwischen dem Produzenten<br />
und dem Ort, an dem die grundlegenden Identitäten des Künstlers<br />
und einer Gemeinde zusammenfallen oder ernsthaft herausgefordert<br />
werden. Eine solche Praxis weist Züge einer „diskursiven Performativität“<br />
auf, einer bestimmten Form der sozialen Maskerade, die tiefergehende<br />
Forschung, kritisches Engagement und Identifikation mit dem Thema bzw.<br />
dem untersuchtem Subjekt erleichtert.