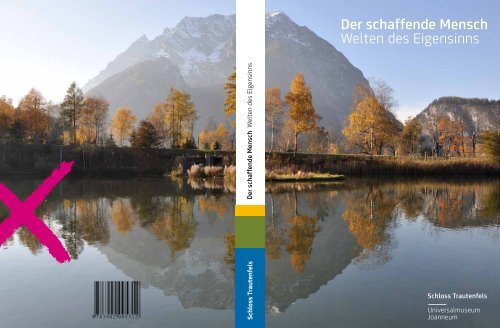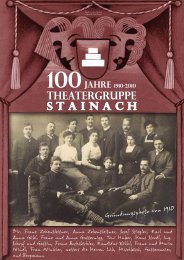Zeit1 - Regionale10
Zeit1 - Regionale10
Zeit1 - Regionale10
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der schaffende Mensch Welten des Eigensinns<br />
Schloss Trautenfels<br />
Der schaffende Mensch<br />
Welten des Eigensinns
Der schaffende Mensch<br />
Welten des Eigensinns<br />
Pawel Althamer mit seiner Klasse für Objektbildhauerei<br />
der Akademie der Bildenden Künste, Wien,<br />
Franz Kapfer, L/B, Christian Philipp Müller,<br />
Maria Papadimitriou, Kateřina Šedá<br />
3. Juni bis 31. Oktober 2010<br />
Eine Kooperation von
Inhalt<br />
1<br />
10<br />
32<br />
48<br />
64<br />
80<br />
98<br />
120<br />
Peter Pakesch, Dietmar Seiler<br />
Ein lebendes Labor<br />
oder: Die Regionale im Schloss<br />
Adam Budak<br />
Die Performance des einheimischen Lebens<br />
oder: Die Herstellung der Welt in die<br />
Landschaft der Selbstbedingtheit<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #5<br />
Christoph Doswald<br />
Simply Beautiful<br />
Über das Moment des Schönen<br />
im Werk von Lang/Baumann<br />
Kateřina Šedá<br />
Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels<br />
Tomáš Pospiszyl<br />
Ein Glashügel und<br />
beleuchtete Kreuzungen<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar<br />
Jennifer Allen<br />
Für immer Parken<br />
Christian Philipp Müller<br />
Burning Love (Lodenfüßler)<br />
Andrè Rottmann<br />
Der Stoff, aus dem die Kunst ist<br />
Christian Philipp Müllers Eigensinn<br />
Pawel Althamer mit seiner Klasse für<br />
Objektbildhauerei der Akademie der<br />
Bildenden Künste, Wien<br />
Things You Can Walk Into<br />
Franz Kapfer<br />
Sieh-Dich-Für<br />
Pierre Bourdieu<br />
Ein Zeichen der Zeit<br />
138<br />
150<br />
162<br />
190<br />
220<br />
246<br />
252<br />
258<br />
268<br />
274<br />
280<br />
Martin Prinzhorn<br />
Codename Zement<br />
Günther Marchner<br />
Peripher idyllisch<br />
Schnappschüsse einer<br />
eigensinnigen Landschaft<br />
Peter Gruber<br />
Der Autor, seine realen und<br />
fiktiven Protagonisten<br />
Wegnotizen auf einem literarischen<br />
Weitwanderweg<br />
Christof Huemer<br />
Wenn Helene kommt<br />
Hannah Arendt<br />
Das Herstellen<br />
Richard Sennett<br />
Die Hand<br />
Elke Murlasits<br />
Think Global, Fabricate Local?<br />
Auf den Spuren des „schaffenden<br />
Menschen” in der Region Liezen<br />
Gernot Rabl<br />
Glaube oder Aberglaube?<br />
Gernot Rabl<br />
Historischer Aufriss zur Geschichte von<br />
Schloss Trautenfels in Verbindung mit<br />
klassischen Architektur- und Raumfragen<br />
Gundi Jungmeier<br />
Schöne Ferienwohnung in ruhiger Lage<br />
Einblicke in die Gestaltung von Privaträumen<br />
auf der Sonnenalm in Bad Mitterndorf<br />
Gundi Jungmeier<br />
Das schlechte Gewissen des Homo faber<br />
Standpunkte zur Ausweisung von Natura<br />
2000-Schutzgebieten im steirischen Ennstal<br />
Günther Marchner<br />
Wetterfest in die Globalisierung<br />
Notizen zur unverwüstlichen<br />
Karriere des Lodens
4 — 5<br />
Vorwort<br />
Ein lebendes Labor<br />
oder: Die Regionale im Schloss<br />
Peter Pakesch im Gespräch mit Dietmar Seiler<br />
PP: Mit dieser Ausstellung befinden wir uns in einem Projekt mit einigen<br />
ungewöhnlichen und neuen Ansätzen. Wir sind dabei, aus den Perspektiven<br />
von Gegenwartskunst und kulturwissenschaftlicher Recherche<br />
einen Blick auf eine ganze Region zu werfen. Gerade die Ausstellung in<br />
Schloss Trautenfels zeigt exemplarisch viel davon auf. Wie verhält sich<br />
das für dich?<br />
DS: Für mich ist wichtig, dass ein Festival wie die regionale von der<br />
konkreten Realität einer Region und ihren echten Potenzialen ausgeht.<br />
Es wäre das Schlimmste für ein Festival, das temporär in eine Region<br />
kommt, diese Region mit mehr oder weniger beliebigen kulturellen<br />
Aktivitäten überziehen, die dann wieder vorbei sind − sozusagen<br />
ein „Festival aus der Retorte“. Das muss man dazusagen, weil das<br />
mittlerweile dauernd passiert. Gerade Festivals sind zurzeit bevorzugte<br />
Instrumente einer etwas missverstandenen Regionalentwicklung: Wenn<br />
der Tourismus nicht so gut funktioniert, wie man es gerne hätte, und<br />
die Industrie, die Wirtschaft im Umbruch sind, dann macht man Kultur,<br />
und schon hat man ein neues Standbein. Es wird bald klar sein, dass das<br />
so nicht funktioniert. Deswegen ist es für mich ganz wesentlich, dass<br />
die regionale10 dort anschließt, wo es bereits eine auffällige kulturelle<br />
Lebendigkeit gibt, und da ist das Schloss Trautenfels ein eminent wichtiger<br />
Ankerpunkt in der Region.<br />
PP: Da trifft sich natürlich etwas in unserem Interesse, denn wenn<br />
wir als Universalmuseum Joanneum gefordert sind, mit unseren verschiedenen<br />
Standorten adäquat umzugehen, ist Schloss Trautenfels<br />
natürlich etwas besonderes und spezielles. Es liegt in einer Region, die<br />
weit von den anderen Museumsstandorten entfernt und sehr spezifisch<br />
gewachsen ist. Schloss Trautenfels ist ein sehr spannendes Museum,<br />
das quasi wie eine Insel anmutet, wir bezeichnen es auch manchmal als<br />
„das Joanneum in Klein“ − es hat den selben Anspruch der Universalität<br />
innerhalb seiner eigenen Sammlung, die naturwissenschaftliche Aspekte<br />
ebenso umfasst wie Volkskunde, Archäologie oder Kunst. Dieses breite<br />
Spektrum wird in regelmäßigen Ausstellungen immer wieder neu<br />
präsentiert, aber gleichzeitig stellt sich für uns die große Frage: Wie<br />
verhalten wir uns als einer der großen kulturellen Faktoren da oben?<br />
Ich sage bewusst „da oben“, weil damit klar wird, wie weit weg es von<br />
unseren anderen Standorten großteils urbaner Kultur ist. So reflektiert<br />
Schloss Trautenfels schon rein kulturell sehr viel von den Problemstellungen<br />
seiner Region und dessen Einzugsgebiet, das vielleicht mehr<br />
nach Salzburg reicht als nach Graz. Damit will ich sagen, dass sich<br />
Region hier anders definiert. Diesen Ort als Museum nutzen zu können,<br />
ist einerseits spektakulär, erschwert aber auch den Zugang, weil dieser<br />
abgehobene Ort an der Wegkreuzung in erster Linie als Burg gesehen<br />
wird. Hier finden wir schon sehr viel symbolisches Potenzial, das wir<br />
auch nicht so einfach für uns knacken können. Schloss Trautenfels ist<br />
ein starker regionaler Faktor, aber wir können nicht davon ausgehen,<br />
dass es alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region in- und auswendig<br />
kennen, obwohl es dort sonst nicht viel anderes gibt, in diesem<br />
Gewicht bzw. in vergleichbarer Ausrichtung. Gleichzeitig merken wir<br />
an den Besucherzahlen im Sommer, welche starke Rolle der Tourismus<br />
dort spielt. Es trifft eine außergewöhnliche Museumssituation auf eine<br />
diverse, aber auch starke und motivierte Community, was eben für das<br />
Joanneum spannend ist, und für dieses konkrete Ausstellungsprojekt<br />
als Motor wirkt bzw. Beteiligung einfordert.<br />
DS: Die Community ist für dich...<br />
PP: …der stärkste Verein, den wir haben! Die Community sind die vielen<br />
Menschen, die sich im Verein Schloss Trautenfels engagieren und die<br />
teilweise auch in der REX-Initiative mitarbeiten. Das große Interesse<br />
bzw. der Wille, in einer kulturellen Entwicklung vor Ort dabei zu sein, ist<br />
dort für mich geradezu verblüffend ausgeprägt.<br />
DS: In diesen beiden Punkten, die du ansprichst, befinden sich die regionale<br />
und das Schloss Trautenfels in einer ähnlichen Ausgangsposition.<br />
Das Schloss liegt auf einem Hügel, und man stellt sich die Frage: Wer<br />
kommt denn da rauf? Das gilt auch für ein Festival, das in eine Region<br />
hineingeht und dabei Dinge passieren lässt, die womöglich nicht unbedingt<br />
selbstverständlich sind. Ebenfalls nicht ganz unwesentlich finde<br />
ich den universellen Anspruch des Museums, der trotzdem irgendwie<br />
begrenzt werden muss. Wir haben dabei dieselbe geografische Begrenzung,<br />
den Bezirk Liezen. Aber beides − der universellt Anspruch und die<br />
notwendige Abgrenzung – muss auch permament hinterfragt werden.<br />
Was heißt es eigentlich, wenn eine im Grunde nur administrative Einheit
6 — 7<br />
Vorwort<br />
sagt: Wir sind jetzt eine Region, die ein Festival macht. Und wenn genau<br />
diese Einheit nichts ist, womit sich Menschen tatsächlich identifizieren,<br />
weil der Bezirk dafür einfach zu groß ist. Identifikation findet innerhalb<br />
sehr viel kleinerer Räume statt. Also muss man sich schon fragen, was<br />
es eigentlich bedeutet, diese Grenze zu behaupten. Und das führt dann<br />
schon zum nächsten Schritt, bei dem die Ausstellung inhaltlich beginnt,<br />
nämlich überhaupt die Frage zu stellen: Was ist eigentlich „das Regionale“?<br />
Es gilt, einerseits ganz abstrakt zu betrachten, warum bestimmte<br />
Vorstellungen, Ideen und Ansichten zu dem gehören, was wir für<br />
„regional“ halten, aber andererseits auch ganz konkret zu hinterfragen,<br />
was eine Region denn von anderen Gebieten unterscheidet? Ich glaube,<br />
dass die Projekte im Rahmen dieser Ausstellung einiges dazu beitragen<br />
können.<br />
PP: Ich fand es spannend, wie unterschiedlich die Künstlerinnen und<br />
Künstler auf diese Fragen zugegangen sind. Was mich allgemein verblüfft<br />
hat – und das ist etwas, womit die Kunst heute sehr spezifisch<br />
umgehen kann – ist die Möglichkeit, die wichtigen Elemente, die eine solche<br />
Gegend auszeichnen, aufzunehmen und damit arbeiten zu können,<br />
und zwar im Kontext einer Haltung, die quasi allerorts geschehen kann.<br />
Mit diesem Spannungsfeld bewusst so umzugehen, darin sehe ich schon<br />
eine große Kraft, die weder regional noch global ist. Es sind Elemente<br />
von Narrativen, von Geschichten, die eben in nicht eindeutiger und nicht<br />
eindeutig zu trennender Art und Weise miteinander verbunden sind, und<br />
die natürlich dem Alltag an so einem Ort viel mehr entsprechen. Es gibt<br />
dort natürlich genauso eine landwirtschaftliche Produktion, die aufgrund<br />
der Produkte nur dort sein kann, aber ein paar Kilometer weiter findet<br />
man auch Einkaufszentren, die auf der ganzen Welt in haargenau derselben<br />
Form existieren können. Auch das Leitmotiv der regionale10, „In der<br />
Mitte am Rand“, greift diese Dialektik eines Ortes auf, der verkehrsmäßig<br />
enorm durchfahren ist – die nahe gelegene Phyrnautobahn zählt zu den<br />
Hauptverkehrssträngen zwischen Nord- und Südosteuropa −, in dem sich<br />
aber auch die Entlegenheit manifestiert. Ich bin froh, dass dort etwas in<br />
dieser Schärfe stattfindet, und auch darüber, dass dies von sehr unterschiedlichen<br />
Akteuren aufgezeigt wird − sowohl von jenen, die vor Ort<br />
leben, wie auch von Künstlerinnen und Künstlern. Gerade hier möchte ich<br />
zum Beispiel Papadimitriou und Althamer erwähnen, die ja beide immer<br />
sehr stark insistiert haben, eine lokale Praxis mit einem großen, global<br />
vertretbaren Anspruch zu machen. Das ist durchaus ein Spezifikum, das<br />
auch bei allen anderen deutlich wird.<br />
DS: Das heißt, du siehst hier auch eine mögliche Stoß- und Zielrichtung,<br />
um einen Gegensatz, dem man ja permanent begegnet − zwischen einem<br />
unangenehm gewendeten Regionalismus und einem alles gleichmachenden<br />
Globalismus −, vielleicht auflösen zu können?<br />
Schloss Trautenfels um 1800<br />
PP: Ja sicher, ich würde da gar nicht in der Möglichkeitsform sprechen.<br />
Ich denke, dass dies sinnvolle Strategien sind, um eine kulturelle<br />
Geschichte der nächsten Jahre zu schreiben. Ich denke, dass wir mitten<br />
in diesem Prozess stehen, wobei sich manche stärker und manche<br />
weniger stark daran beteiligen, mit diesen Diversitäten besser umzugehen<br />
und Lokalitäten umfassend verstehen zu wollen. Wir leben heute<br />
nicht mehr in einer einheitlich geformten Welt. Ich meine, in Zeiten<br />
einer bipolaren Welt gab es Orientierungspunkte, die sehr hierarchisch<br />
aufgebaut waren. Wir nehmen heute mehr und mehr wahr, dass sich<br />
geografische Hierarchien in andere Richtungen entwickeln. Es ist natürlich<br />
nicht so, dass die Welt enthierarchisiert wurde, aber wir erleben die<br />
Wirklichkeit einer multipolaren Welt, eines sehr heterogenes Europas,<br />
die wir auch begreifen lernen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir uns<br />
im Zusammenhang mit einer globalen Position thematisieren, sondern<br />
zunächst gilt es, unsere europäische Identität zu entwickeln. Das sind<br />
Prozesse, die Hand in Hand gehen. Diese zu buchstabieren, würde ich<br />
fast sagen, diese Sprache, dieses Konstrukt, zu lernen, zu formulieren,<br />
zu definieren, führt zu interessanten Ansätzen. Gleichzeitig suchen wir<br />
eine andere Reflexion, die wir im Zusammenhang der Ausstellung als<br />
eine kulturwissenschaftliche betrachten. So kann bewusst betrachtet<br />
werden, wie sich diese Kunst, die sich mit dem Alltag beschäftigt, zum<br />
Alltag der Menschen verhält, die damit umgehen.<br />
DS: Ich finde es sehr wichtig, dass es ergänzend zu den künstlerischen<br />
Positionen diese zusätzliche Ebene, diese begleitenden Projekte gibt,<br />
an denen sich die Menschen aus der Region beteiligen – das ergibt ein
8 — 9<br />
Vorwort<br />
schönes Bild, auch für das Museum. Ich denke, uns beide interessiert an<br />
dieser Ausstellung auch die Frage, wie ein regionales Museum sich in<br />
Zukunft formulieren kann, wenn es vor allem weg will von der Zuschreibung<br />
„Das ist die ‚Burg‘, die definiert und erzählt euch eure eigene<br />
Geschichte“, wenn es ein Haus sein will für die Menschen der Region.<br />
In diesem Prozess vermittelt die Vorstellung, dass Künstlerinnen<br />
und Künstler von außen gemeinsam mit Menschen aus der Region an<br />
Erzählungen und Geschichten aus der Region arbeiten, ein sehr schönes<br />
Bild von einem lebendigen Laboratorium, das dieses Museum in Zukunft<br />
vielleicht sein kann.<br />
PP: Ein wichtiges Thema und eine große Herausforderung: Wie funktionieren<br />
solche Museen, was sind ihre Aufgaben, was ist geschichtliche<br />
Repräsentation, was ist reine Information, die vorliegt und notwendig<br />
ist? Aber es stellt sich heute auch mehr und mehr die Frage nach<br />
Prozessen − danach, wie man mit Wissen umgeht, wie man dadurch<br />
Identitäten schafft, wie man mit der Verfügbarkeit von Bildern umgeht,<br />
wie sich das alles manifestiert, sowohl für innen wie für außen. Ich<br />
meine, das Spannende gerade an einem Museum wie Schloss Trautenfels<br />
ist, dass wir hier ein Haus haben, das für Touristinnen und Touristen<br />
genauso interessant ist wie für Menschen aus der Region. Die Bedeutung<br />
des vermittelten Wissens ist hier eine ganz andere, vor allem,<br />
wenn es sich um lokal konnotiertes Wissen handelt – der schöne Name<br />
des Museums ist ja Landschaftsmuseum, es wird also etwas bewahrt,<br />
an Geschichte, an Landeskunde für die lokale Bevölkerung zum einen,<br />
zum anderen werden aber auch Besucher/innen von auswärts darüber<br />
informiert, was das Ortsspezifische ausmacht. In einer Welt, die wie<br />
gesagt dabei ist, sich extrem umzugestalten, ist es spannend, inwieweit<br />
Prozesse auch so ablaufen können, dass sie nicht in einer Musealisierung<br />
im schlechten Sinn münden, die also das Klischee des verstaubten<br />
„Museums von früher“ bedienen, sondern sich dynamisch entwickeln,<br />
ohne dabei die zu vermittelnden Inhalte über Bord zu werfen. Wenn ich<br />
mir zum Beispiel das Projekt von Christian Philipp Müller anschaue, der<br />
bewusst auf Textilfertigung mit Loden − also auf eine sehr starke lokale<br />
Tradition − eingeht und dabei gleichzeitig eine Strategie der Avantgarde<br />
im Umgehen damit verwendet, finde ich das einen sehr wichtigen<br />
Ansatz, um etwas klassisch Landeskundliches aufzubrechen. In diesem<br />
Zusammenhang wird es interessant sein, inwieweit das Museum und<br />
auch sein Publikum in der Folge mit solchen Projekten umgehen, und<br />
wie sich das Narrativ des Museums in dieser Region und in den nächsten<br />
Jahren weiterentwickelt.<br />
A.H. Payne nach L. Mayer<br />
Der Grimming, um 1840 (Detail)
10 — 11<br />
Trautenfels, 1681, aus<br />
dem Steirischen Schlösserbuch<br />
von G.M. Vischer<br />
(Kupferstich)<br />
Detail aus dem<br />
Freskenraum, Schloss<br />
Trautenfels<br />
1<br />
Gilles Deleuze: Logik des<br />
Sinns. Frankfurt a. M.:<br />
Suhrkamp 1993, S. 100.<br />
Die Performance des einheimischen Lebens<br />
oder: Die Herstellung der Welt in der<br />
Landschaft der Selbstbedingtheit<br />
Adam Budak<br />
Was gibt es Bürokratisches in diesen phantastischen Maschinen, die die<br />
Völker und Gedichte sind? Es reicht, daß wir uns ein wenig zerstreuen,<br />
damit wir uns auf der Oberfläche wissen, daß wir unsere Haut wie eine<br />
Trommel spannen, damit die „große Politik“ beginnt. Ein leeres Feld, weder<br />
für den Menschen, noch für Gott; Singularitäten; die weder allgemein noch<br />
individuell, weder persönliche noch universelle sind, all dies durchquert<br />
von Zirkulationen, Echos, Ereignissen, die mehr Sinn und mehr Freiheit verschaffen,<br />
mehr Wirksamkeiten, als der Mensch je erträumt und Gott sich je<br />
vorgestellt hatte. Das leere Feld zirkulieren zu lassen und die prä-individuellen<br />
und unpersönlichen Singularitäten zum Sprechen zu bringen, kurz,<br />
den Sinn zu produzieren: Darin besteht heute die Aufgabe. 1<br />
Im Herzen des Eigensinns<br />
Anmutig, doch asketisch und streng dient die im Jahr 1261 wohl im wahren<br />
Geiste des „Eigensinns“ erbaute vormalige Burg Neuhaus an der Kreuzung<br />
zwischen der Salzstraße und der Straße durch das Ennstal und vor einem<br />
herrlichen Alpenpanorama am Fuße des Grimmings − 1664 von den Grafen<br />
Trautmannsdorff unter dem Namen Schloss Trautenfels in Form eines<br />
Barockschlosses wiederaufgebaut − wohl als Beispiel für ein ganz besonderes<br />
Bauwerk: Einst Bewacher der Brücken über die Enns und der steirischen<br />
Grenze, dient dieses großartige rechteckige Gebäude mit überdachten<br />
Innenhöfen und einem mächtigen Turm, mit erlesenen Innenräumen,<br />
Fresken mit Darstellungen u. a. von Menschen bei der Arbeit, Gemälden mit<br />
mythologischen Anspielungen in der Galerie und in vielen Räumlichkeiten<br />
der Beletage, heute dem Universalmuseum Joanneum, Österreichs ältestem<br />
und zweitgrößtem museologischem Schatz, als Landschaftsmuseum<br />
und fungiert als Hommage an die einheimische Bevölkerung, die regionale<br />
Geschichte und Erinnerung. Fern jeder schlössertypischen Extravaganz,<br />
bedeckt und gar nicht so reizvoll, im Herzen bescheiden und anonym, stellt<br />
es ein kaltes Denkmal für (architektonischen) Anticharme dar, das zu Recht<br />
Stiegentür in Schloss<br />
Trautenfels, Manfred<br />
Wolff-Plottegg<br />
Buchstaben-Ornament<br />
zum Gedenken an Franz<br />
Hillebrand, um 1804<br />
2<br />
Manfred Wolff-Plottegg:<br />
Hybrid Architektur & Hyper<br />
Funktionen. Wien:<br />
Passagen Verlag 2006;<br />
ders.: Architektur-Algorithmen.<br />
Wien: Passagen<br />
Verlag 1996.<br />
an unserer Unwissenheit und seiner Unsichtbarkeit leidet und nachdrücklich<br />
nach Aufmerksamkeit heischt.<br />
Offensichtlich befinden wir uns hier genau im Herzen jenes Eigensinns,<br />
im zerkratzten Spiegel der Mentalität und des Alltags dieser Region und<br />
ihrer Bewohner, in einer (ursprünglichen) physischen wie psychischen Verteidigungslinie.<br />
Das Schloss fungiert als kritischer Apparat, als Matrix<br />
eklektischen Denkens, als Metapher und Allegorie, Ausdruck einer mühevollen<br />
Bautradition, die aufgepeppt wurde durch eine hübsche Fin-de-millenium-artige<br />
Revitalisierung (1990-92) durch den steirischen Architekten<br />
Manfred Wolff-Plottegg, Verfasser von Hybrid Architektur und Hyper Funktionen<br />
und leidenschaftlicher Verfechter von „Architekturalgorithmen“ 2 ,<br />
deren Prinzipien das Aussehen (und oft auch die Bedeutung) von bekannten<br />
architektonischen Elementen verändern. Plotteggs teils futuristische,<br />
teils märchenhafte Intervention mit gleichsam nostalgischen Untertönen<br />
ist ein verblüffendes und höchst verspieltes Beispiel für moderne Handwerkskunst<br />
im historischen Kostüm. Ein Tor ist eine Treppe, Pflastersteine<br />
sind Lampenschirme und Elemente des Burggrabens bilden Mauern in dieser<br />
algorithmischen Architektur, die das Schloss als Rätsel aus realen wie<br />
fiktiven Geschichten betrachtet. Ein solcher räumlicher Plot scheint gut zu<br />
dem ornamentalen Relief zu passen, das in eine Wand beim Schlosseingang<br />
gemeißelt ist – datiert mit 1790 und im Gedenken an Franz Hillebrand,<br />
einen einheimischen Handwerker aus der nahen Stadt Rottenmann. Das<br />
geheimnisvolle Tableau ist ein einzigartiges, beinah borgesianisches Rätsel<br />
und Diagrammgedicht aus Buchstaben, die, wenn man sie vom Zentrum<br />
aus in Richtung der Ränder liest, den Namen der bedeutendsten Familie<br />
der Region ergeben, die sich der Eisenverarbeitung widmete, welche neben<br />
dem Eisenabbau und der Verarbeitung anderer Bodenschätze der Gebirgsregion<br />
wie Kupfer, Silber und Salz die wirtschaftliche Entwicklung der Region<br />
wie auch ihr kulturelles Erscheinungsbild in bedeutendem Maße prägte.<br />
Er ist aber auch ein kosmologisches Porträt des Homo faber von Trautenfels,<br />
einem der wichtigsten „Lokalmatadore“ der Region; genauso wie die<br />
Trautenfels’sche Metapher des Eigensinnigen eine Vielzahl der Lesarten<br />
des Einen zu erlauben scheint, die in ihrer labyrinthischen Struktur eine<br />
oder aber viele Möglichkeiten eröffnen, etwa auch das Wortspiel mit Denkmal<br />
(Monument) und „Denk mal!“ (im Sinne von Denkanstoß), und auf diese<br />
Weise symbolisch den Rahmen für ein Kunstprojekt bilden, das sowohl Tribut<br />
an einen Mikrokosmos als auch Dokument einer lokalen Gemeinschaft<br />
sein will.<br />
Annäherung an den Homo faber<br />
Inszeniert in den Räumlichkeiten des Schlosses Trautenfels ist die Ausstellung<br />
Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns eine Baustelle des<br />
Selbstseins und der Subjektivität. „Vita activa”, einer der grundlegenden
12 — 13<br />
Adam Budak<br />
3<br />
Hannah Arendt: Vita activa<br />
oder Vom tätigen Leben, 8.<br />
Aufl., München: Piper 2010.<br />
4<br />
Ebda, S. 14.<br />
5<br />
Margaret Canovan: Einleitung.<br />
In: Hannah Arendt:<br />
Human Condition. 2. Aufl.,<br />
mit einer Einleitung von<br />
Margaret Canovan. Chicago:<br />
The University of Chicago<br />
Press 1998, S. XVI.<br />
6<br />
Vgl. Hannah Arendt: Vita<br />
activa, S. 23.<br />
7<br />
Ebda., S. 16.<br />
8<br />
Ebda., S. 18.<br />
Begriffe aus Hannah Arendts bahnbrechendem Werk Vita activa oder Vom<br />
tätigen Leben (1960) 3 , steckt das Wirkungsfeld für sechs Kunstprojekte ab,<br />
in denen die Eigenheiten der historischen wie der zeitgenössischen Gegebenheiten<br />
der Region Liezen, die − wie im Slogan („In der Mitte am Rand“)<br />
des ausrichtenden Festivals, der regionale10, betont wird − im geografischen<br />
Zentrum Österreichs liegt doch gleichzeitig an der (steirisch-regionalen)<br />
Peripherie, im Transitdenken, am Knotenpunkt dreier wichtiger nationaler<br />
Fernstraßen.<br />
„Was wir tun, wenn wir tätig sind“ 4 ist Arendts elementarer Vorschlag<br />
zu einer Neubetrachtung der Condition humaine in ihrem Buch, das, wie<br />
Margaret Canovan anmerkt, während der Studentenbewegung der 1960er-<br />
Jahre begeistert als Lehrbuch der partizipatorischen Demokratie 5 aufgenommen<br />
wurde und das nach wie vor eine Quelle der Inspiration und der<br />
Kontroverse darstellt. In der Tat bilden „das Schaffen“ – die Aktivität, die<br />
sie „Herstellen“ nennt – und „das Soziale” den Rahmen für ihre Analyse<br />
einer menschlichen Welt, die von Dauer sein kann. Vita activa tritt als<br />
Arendts Version des aristotelischen bios politicos auf, das ein dem Bereich<br />
des im eigentlichen Sinne Politischen gewidmetes Leben meinte 6 . „Mit<br />
dem Begriff Vita activa“, – schreibt Hannah Arendt – „sollen im folgenden<br />
drei menschliche Grundtätigkeiten zusammengefasst werden: Arbeiten,<br />
Herstellen und Handeln. Sie sind Grundtätigkeiten, weil jede von ihnen<br />
einer der Grundbedingungen entspricht, unter denen dem Geschlecht der<br />
Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist.“ 7 Die Tätigkeit der Arbeit<br />
entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers und die<br />
Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Arbeitens steht, ist das Leben<br />
selbst. Die Grundbedingung, die dem Handeln entspricht, ist das Faktum<br />
der Pluralität, nämlich die Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern viele<br />
Menschen auf der Erde leben. Und im Herstellen letztendlich „manifestiert<br />
sich das Widernatürliche eines von der Natur abhängigen Wesens, das sich<br />
der immerwährenden Wiederkehr des Gattungslebens nicht fügen kann und<br />
für seine individuelle Vergänglichkeit keinen Ausgleich findet in der potentiellen<br />
Unvergänglichkeit des Geschlechts. Das Herstellen produziert eine<br />
künstliche Welt von Dingen (…) In dieser Dingwelt ist menschliches Leben<br />
zu Hause, (…) und die Welt bietet Menschen eine Heimat in dem Maße,<br />
indem sie menschliches Leben überdauert, ihm widersteht und als objektivgegenständlich<br />
gegenübertritt. Die Grundbedingung, unter der die Tätigkeit<br />
des Herstellens steht, ist Weltlichkeit“. Arendt weiter: „(…) das Herstellen<br />
errichtet eine künstliche Welt, die von der Sterblichkeit der sie Bewohnenden<br />
in gewissem Maße unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so<br />
etwas wie Bestand und Dauer entgegenhält.“ 8 Im Bereich der Arbeit tritt<br />
der Mensch als Homo faber auf, als der schaffende Mensch, manchmal auch<br />
Weltbildner, Werkzeugmacher oder Schöpfer aller Dinge genannt. Arendt<br />
übernahm diesen Begriff von Henri Bergson, der in seinem Buch Schöpferische<br />
Entwicklung (1921; im frz. Original 1907 erschienen) auf den Homo<br />
9<br />
Henri Bergson: The Creative<br />
Evolution. Übers. v. Arthur<br />
Mitchell. New York, Dover:<br />
1998, S. 139.<br />
10<br />
Hannah Arendt: Vita activa,<br />
S. 451.<br />
11<br />
Danette diMarco: Paradise<br />
Lost, Paradise Regained.<br />
Homo faber and the Makings<br />
of a New Beginning<br />
in „Oryx and Crake“. Zit.<br />
nach: http://findarticles.<br />
com/p/articles/mi_qa3708/<br />
is_200504/ai_n13641438/<br />
(letzter Zugriff: 12.5.2010).<br />
12<br />
Sophie Loidolt: Conditio<br />
humana. So lebt der<br />
Mensch. Unveröffentlichtes<br />
Manuskript, in Auftrag<br />
gegeben vom Universalmuseum<br />
Joanneum. Wien/<br />
Graz: 2010, S. 2.<br />
13<br />
Richard Sennett: The<br />
Craftsman. New Haven: Yale<br />
University Press 2008.<br />
faber verwies, indem er Intelligenz in ihrem ursprünglichen Sinne definierte,<br />
als „die Fähigkeit zur Herstellung von künstlichen Gegenständen, besonders<br />
von Werkzeugen zur Herstellung von Werkzeugen und zur unendlichen<br />
Variation der Herstellung“ 9 . Arendt entwickelt diese Definition, indem sie<br />
behauptet: „Das lateinische Word faber, das vermutlich mit facere im Sinne<br />
des hervorbringenden Machens zusammenhängt, bezeichnet den Künstler<br />
oder Handwerker, der hartes Material bearbeitet – Holz, Stein oder Metall” 10<br />
Nach Arendt hängt die Herrschaft des Homo faber von einer Konstante ab:<br />
Er betrachtet sich selbst als das Maß aller Dinge. Obwohl er zur Vollendung<br />
seines Werkes zweifellos auf natürliche Ressourcen angewiesen ist,<br />
entgeht ihm diese Tatsache, und folglich markiert er die Ressourcen in seinem<br />
von ihm hergestellten Werk als unsichtbar. Arendt behauptet, indem<br />
sie eine populäre marxistische Behauptung wiederholt, dass der Prozess<br />
im Produkt verloren geht, dass mit der Herstellung und der letztendlichen<br />
Vergegenständlichung des Produkts der Homo faber selbst die verschiedenen<br />
für menschliche Kreativität und Geschicklichkeit bei ihrer Veränderung<br />
des innersten Wesens der Natur unabdingbaren Komponenten aus den<br />
Augen verliert. Für Arendt ist die wirkliche Tragödie des Homo faber seine<br />
Selbstbefangenheit in seiner eigenen Aktivität. Er hat die vergegenständlichte<br />
Produktion eingeführt und sich vom Animal laborans das Verlangen<br />
nach Überfluss angeeignet – und somit das Ziel der Ernährung und Grundversorgung<br />
der Gemeinschaft durch natürliche Ressourcen ersetzt durch<br />
jenes der persönlichen (oft finanziellen) Erfüllung durch die Nutzung der<br />
natürlichen Ressourcen zur Schaffung eines Mehrwerts. 11 Der Homo faber<br />
baut sich selbst eine Welt. Er erschafft Werke. Als „artifex“ wie als Schöpfer<br />
ist er Meister seines Werkes/Objekts – bis hin zur Möglichkeit, es wieder<br />
zu zerstören. Die Welten, die er erzeugt, sind, wie Sophie Loidolt anmerkt,<br />
„Welten des Eigensinns. Doch dieser Eigensinn ist immer ein weltlicher<br />
Wille. Er ist ein Streben nach einem Sein, das für seine individuelle Vergänglichkeit<br />
keinen Ausgleich findet in der potenziellen Unvergänglichkeit<br />
des Geschlechts. Weil dieses Sein eine Identität und eine Erzählung in sich<br />
birgt, die in den Werken, die es stets neu herstellt, von Trinkgefäßen bis<br />
hin zu Landschaftsgestaltung, immer manifest ist. Auch wenn das Herstellen<br />
von den natürlichen Ressourcen abhängig ist und auf sie vertraut, ist<br />
das dann selbst nicht mehr Natur, weil es den ewigen Kreislauf von Genese<br />
und Verfall durchbricht und auf einer neuen linearen Zeitebene endet. Die<br />
Tätigkeit des Herstellens hat seine eigene zeitliche Abfolge – einen Anfang<br />
und ein Ende. Doch als eine Tätigkeit ist es natürlich ein Prozess, aber keiner,<br />
der sich einfach erschöpft und erneuert. Ein Werk entsteht daraus, das<br />
in die Welt entlassen werden kann und selbst „‚die Welt’ ist, die bewusst<br />
geformt wurde“. 12 Richard Sennett betont die Rolle des Homo faber in<br />
Arendts conditione humana teatrum und hebt dabei neue Eigenschaften<br />
im Gegensatz zum Animal laborans hervor. 13 Während das Animal laborans<br />
das Herstellen als Selbstzweck betrachtet, ist der Homo faber damit<br />
beschäftigt, „gemeinsam ein Leben zu schaffen.“ Laut Sennett ist „der
14 — 15<br />
Adam Budak<br />
14<br />
Ebda., S. 7.<br />
15<br />
Julia Kristeva: Hannah<br />
Arendt. New York: Columbia<br />
University Press 2001,<br />
S. 223.<br />
16<br />
G. W. F. Hegel: Phenomenology<br />
of Mind. Mineola:<br />
Dover Publications: 2003.<br />
17<br />
H. S. Harris: Hegel’s Ladder.<br />
Bd. 1. Indianapolis (u.a.):<br />
Hackett 1997, S. 385.<br />
18<br />
Alexander Kluge, Oskar<br />
Negt: Geschichte und<br />
Eigensinn. Frankfurt a. M.:<br />
Suhrkamp 1993.<br />
Homo faber der Richter über materielle Arbeit und Praxis, kein Kollege des<br />
Animal laborans sondern sein Vorgesetzter. Deshalb leben wir Menschen<br />
(nach Arendts Ansicht) in zwei Dimensionen. In einer stellen wir Dinge her;<br />
in diesem Zustand handeln wir amoralisch, ganz in Anspruch genommen<br />
von der jeweiligen Aufgabe. Doch bergen wir auch eine andere, höhere<br />
Lebensart in uns, in der wir in der Produktion innehalten und gemeinsam<br />
zu diskutieren und zu bewerten beginnen. Wogegen das Animal laborans<br />
auf die Frage ‚Wie?’ fixiert ist, fragt der Homo faber ‚Warum?’“ 14<br />
Mehrdeutigkeiten: Eigensinn<br />
Aufgabe dieser Ausstellung ist die Untersuchung der möglichen Beziehung<br />
zwischen dem Homo faber und der Welt des Eigensinns. Wie schon eingangs<br />
erwähnt, sind seine Selbstbefangenheit und seine Selbstwahrnehmung<br />
als das Maß aller Dinge möglicherweise ein Beweis für das eigensinnige<br />
Wesen des Homo faber. Der Eigensinn als „logischer Eigensinn”<br />
(Egoismus) wurde von Hannah Arendt als Privatsinn und im Gegensatz<br />
zum Gemeinsinn verwendet. 15 Der Begriff Eigensinn selbst hat eine lange<br />
Rezeptionsgeschichte. Durch seine Verbindung zu einem Begriff moderner<br />
Individualität, der unbedingt auch Selbsttäuschung und ironische Inszenierung<br />
beinhaltet, artikuliert er die hegelianische Haltung einer „Gewissheit<br />
seiner selbst“. In Die Phänomenologie des Geistes (1807) definiert<br />
Hegel Eigensinn als Selbstbewusstsein, das sogar in Knechtschaft bestehen<br />
bleibt. 16 Der Eigensinn bezeichnet ein starrsinniges Festhalten an<br />
einer einzigen flüchtigen Art und Weise, wie die Dinge sind. Hegel betont<br />
sowohl die Ambiguität des Eigensinns (in aktiver Souveränität genauso<br />
wie im Leid und in der Abhängigkeit, als auch die „Freiheit des Eigensinns“,<br />
die das „leere Ich“ charakterisiert. 17 Der Eigensinn, so wie auf ihn<br />
in der Phänomenologie des Geistes ausdrücklich verwiesen wird, wird als<br />
die primitive Entschlossenheit des unreifen menschlichen Tieres wahrgenommen,<br />
„seinen Willen durchzusetzen“. Oskar Negt und Alexander Kluge<br />
untersuchen in Geschichte und Eigensinn (1993) 18 die gesellschaftskritischen<br />
Implikationen von Hegels Konzept. Ihre Verwendung des Begriffes<br />
Eigensinn untersucht ein Wortspiel mit ihm: „eigen-Sinn“, „jemandes eigner<br />
Sinn“ – d. h. „Sturheit“, „Halsstarrigkeit“ oder „das Eigentum betreffender<br />
Sinn“. Kluge folgert, diese Form der Eigenwahrnehmung, die für menschliche<br />
Wesen unerlässlich ist, wenn Sie die Autoren ihres eigenen Lebens sein<br />
wollen, kann nur durch ein Miteinander entstehen. Eigensinn bezeichnet<br />
ein Ringen nach Anerkennung und Selbstgewissheit. Für Andreas W. Daum<br />
bezeichnet der Eigensinn als analytisches Konzept „eine ganz bestimmte<br />
Logik, die von Einzelpersonen und Gruppen in deren sozialer Interaktion<br />
verfolgt wird. Es ist nicht bloß eine Sturheit oder Weigerung, sich an die<br />
Regeln zu halten; der Begriff bezeichnet nicht unbedingt den Widerstand<br />
des Volkes gegen die Autorität. Er bezeichnet vielmehr die Sehnsucht,<br />
unabhängig von den Forderungen oder Ansprüchen der anderen zu handeln<br />
19<br />
Andreas W. Daum: Kennedy<br />
in Berlin. Paderborn (u.a.):<br />
Schöningh 2003, S. 129.<br />
20<br />
Alf Lüdtke (Hrsg.): The<br />
History of Everyday Life.<br />
Reconstructing Historical<br />
Experiences and Ways of<br />
Life. Princeton: Princeton<br />
University Press 1995.<br />
21<br />
Kathleen Canning: Feminist<br />
History after the Linguistic<br />
Turn: Historicizing<br />
Discourse and Experience.<br />
Signs 19/1994.<br />
22<br />
Charles Bright: The Powers<br />
that Punish: Prison and<br />
Politics in the Era of the<br />
„Big House“. Ann Arbor:<br />
University of Michigan<br />
Press 1996.<br />
23<br />
Ebda, S. 231.<br />
und Handlungsmacht einzufordern, wenn auch nur vorübergehend oder in<br />
einem begrenzten Rahmen.“ 19 Der Arbeitshisto-riker Alf Lüdtke versteht<br />
unter Eigensinn die wieder in Besitz genommenen Räume der Selbsttätigkeit.<br />
Hier wird – gewissermaßen – der Ungehorsam des Eigensinns oder<br />
von jemandes eignem Sinn semantisch mit „sich aneignen” verknüpft. 20<br />
Kathleen Cannings Untersuchung des Eigensinns greift auf Lüdkes Arbeit<br />
zurück, doch ebenso auf Joan W. Scott, und er definiert Erfahrung als „den<br />
Ereignissen in dem Augenblick in dem sie passieren Sinn geben (…) sowie<br />
als ein ‚eigensinniges Distanzieren‘, das eine ‚Neurahmung‘, eine ‚Neuorganisation‘<br />
ermöglicht, oder eine ‚kreative Neuaneignung der Bedingungen<br />
des täglichen Lebens‘“. 21 Die Betonung auf „Zustimmung, Neurahmung und<br />
Neuaneignung“ in dieser Definition „impliziert, dass Subjekte über eine Art<br />
Handlungsmacht verfügen“, und zwar dahingehend, wie sie die Welt auf<br />
Basis der ihnen in ihrem soziohistorischen Kontext zur Verfügung stehenden<br />
Diskurse interpretieren. Lüdkes Eigensinn als Selbsttätigkeit impliziert<br />
eine Reihe von Mehrdeutigkeiten und eine Ambivalenz der Übereinstimmung,<br />
die in Lüdkes Augen grundlegend war für das Flickwerk der Aneignung<br />
und Reaktion, Annahme und Distanz, das die „Räume der Arbeiter“<br />
als die ihren definierte: bei sich selbst sein oder bei seinen Freunden, doch<br />
in jedem Fall „‚Distanz gewinnend‘ von den Anweisungen oder Normen<br />
von oben und von ‚außen‘“. Eigensinn ist die Praxis der Zusammenarbeit,<br />
während man dagegenhält, klarzukommen ohne überzulaufen, das Spiel<br />
mitzuspielen ohne daran zu glauben – auf der Suche nach einem Raum,<br />
in dem man wirklich sein kann, aber weder im Widerstand noch in Komplizenschaft.<br />
22 Eigensinn erweist sich als Element, das dem Arbeiter bleibt.<br />
Man sagt, er sei „die Freiheit, die in der Knechtschaft bleibt“, aber auch<br />
ein Geschick, das nur über Macht über irgendetwas verfügt“. Heute ist er<br />
die Freiheit, die sich an einer Eigentümlichkeit festmacht. Im vorgesetzlichen<br />
Kontext der Lehensherrschaft und Leibeigenschaft war der Eigensinn<br />
bereits eine wichtige Fähigkeit; doch nun in der kultivierten Welt des Stoizismus<br />
ist er das rechtsgültig anerkannte freie Bewusstsein. 23<br />
Die Suche nach einem modernen Hephaistos<br />
Das Leben und das Herstellen, sowie die Leidenschaft, die dahintersteht,<br />
stehen im Mittelpunkt der Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des<br />
Eigensinns. Wie durch die Linse eines Vergrößerungsglases wird hier die<br />
Condition humaine porträtiert und sie findet ihren Ausdruck in der Performance<br />
eines emanzipierten und autonomen Ichs. Der Eigensinn erscheint<br />
als geistiger und körperlicher Mechanismus, der die Identität eines gesellschaftlichen<br />
und kulturellen Mikrokosmos formt und bedingt: die Konstruktion<br />
einer „eigensinnigen“ Weltanschauung als Raum zwischen den Augen,<br />
eine Landschaft der Selbstbedingtheit … Wir befinden uns im vagen Territorium<br />
eines Zwischenbereichs, in dem das Kleine und Intime, das Persönliche<br />
und Exklusive, das unvermeidliche Globale und Kosmopolitische der<br />
heutigen Gesellschaft herausfordern. Der Eigensinn ist ein problematisches
16 — 17<br />
Adam Budak<br />
24<br />
Richard Sennett: The<br />
Craftsman, S. 213.<br />
Terrain, in dem Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeitsgefühl mit der<br />
Sturheit und der egozentrischen Welt der Eigentümlichkeit ringen, wo das<br />
Verlangen nach Gemeinschaft auf die Manifestation ganz individueller<br />
Glaubensgrundsätze und Wahrheiten trifft. Wie lässt sich die Matrix eines<br />
solchen Glaubens darstellen? Wie lässt sich eine solche Haltung umreißen?<br />
Was sind die historischen Perspektiven und die zeitgenössischen Bedingungen<br />
einer solchen Örtlichkeit? Wie wird lokales Wissen produziert?<br />
Diese Ausstellung ist aber auch eine Fallstudie von lokaler Widerständigkeit,<br />
von Stolz, Emanzipation und Selbstermächtigung. Wir sind die schaffenden<br />
Menschen, Schmiede der Wirklichkeiten, Produzenten des Alltags,<br />
Kinder der Tradition, Schöpfer noch kommender Zukunften und Bildhauer<br />
von Orten. Als Studie performativer Zugehörigkeit geht diese Ausstellung<br />
der Frage nach, ob der Homo faber in der Welt des Eigensinns überhaupt<br />
möglich ist; ihre Anatomie einer (lokalen) Vita activa ist gleichzeitig eine<br />
Anatomie des Eigensinns, der Schauplätze seiner Aktivität, seiner auf<br />
lokale Sehnsüchte und Ambitionen zugeschnittenen Utopien im kleinen<br />
Maßstab. Wie lassen sich Dinge, Köpfe und Denkweisen formen? Die Ausstellung<br />
stellt sich der Herausforderung, in die Organisation des Privatlebens<br />
des „Lokalmatadors“ und seinem Sinn für die Gemeinschaft, deren<br />
teil er ist, hereinzuzoomen. Wie kann man an der Welt des Eigensinns teilnehmen?<br />
Was lässt sich über traurige Versuche des gezwungenen Engagements<br />
für die sogenannten – fremden – allgemeinen Belange hinaus tun?<br />
Eigensinn ist ein Flickwerk aus heroischen Taten und konservativen Ansichten,<br />
ein Land der Enge, des Stolzes und der Selbstbehauptung, wo lokaler<br />
Gemeinschaftsgeist, das Streben nach Autonomie und Emanzipation und<br />
die Vorstellungskraft des schöpferischen Geistes, der nach Senett 24 von<br />
Widerständigkeit, Ambiguität und Intuition geprägt ist, mit Sturheit und<br />
einem Willen zur Distanz und zum Ausdruck seiner eigenen Andersheit im<br />
Wettstreit liegen.<br />
Im Rahmen der künstlerischen Freiheit des Eigensinn-Syndroms reist der<br />
Prototyp des Homo faber, Odysseus mit verbundenen Augen durch dieses<br />
Land des Sturheit, in der Hoffnung, die ihm Pandoras Büchse gegeben<br />
hat, der Hoffnung, die Welt neu zu erbauen und Kultur und Zivilisation zu<br />
erneuern, im Mitgefühl mit der tragischen Figur Hephaistos, dem lahmen<br />
Gott der Handwerker, „berühmt für Erfindungen“, Erbauer aller Gebäude auf<br />
dem Olymp, Friedensbringer und Zivilisationsschaffer.<br />
Diese Ausstellung ist eine von sechs partizipatorischen und gemeinschaftsbasierten<br />
Kunstprojekten, eine fast wie in einem Kriminalstück<br />
von Pirandello orchestrierte Fallstudie, Erzählung der Region und Bestimmung<br />
ihrer einheimischen Protagonisten. Sie ist Probe, Untersuchung und<br />
Mise-en-scène von Geschichte, Tradition und Kontemporanität, ein Tableau<br />
vivant einer widerständigen Identität. Die an Sechs Personen suchen einen<br />
Maria Papadimitriou<br />
Untitled (T.A.M.A.), 2000<br />
Dreaming the New<br />
House, 2004<br />
Autor (1921) erinnernden eingeladenen Künstler machen sich auf die Suche<br />
nach einem modernen Hephaistos, indem sie der Eigentümlichkeit einer<br />
Region nachspüren, die schon immer als besonders eigensinnig galt. Die<br />
Projekte sind in der Tat Beispiele für kritischen Regionalismus – und sind<br />
ebenso dynamische Belege für einheimisches Leben, das sich seiner selbst<br />
bewusst ist. Die Psychogeografie dieser Ausstellung navigiert zwischen den<br />
verschiedensten Aspekten des Lebens der Region: Landschaftsarchitektur<br />
und die Organisation des Privatraumes (Franz Kapfer), das sprühende<br />
Leben ganz gewöhnlicher Bewohner dieser Region als soziale Skulptur<br />
(Pawel Althamer und seine Studierenden), die Bildung einer eigensinnigen<br />
Mentalität anhand der Fallstudie zu baulicher Neugestaltung in der<br />
Region (Kateřina Šedá), das Phänomen des Genius loci mit einem Verweis<br />
auf Natur und Brauchtum der Region (Maria Papadimitriou), Schlossarchitektur<br />
als Phantasmagorie (L/B) und die Produktion von realem und symbolischem<br />
Wert, wie sie sich in der Tradition eines einheimischen Gewerbes<br />
findet (Christian Philipp Müller).<br />
Maria Papadimitriou<br />
„Alpine Altar“ oder: Rituale des Alltags<br />
Maria Papadimitrious Feldforschungen folgen einer Methode, die von der<br />
Intensität von bestehenden oder neu begründeten menschlichen Beziehungen<br />
und Verbindungen befeuert wird. In ihrer Erforschung der zerbrechlichen<br />
Bereiche einer „emotionalen Topografie” legt die griechische<br />
Künstlerin ihr Augenmerk auf die Randexistenzen und Unterprivilegierten<br />
innerhalb einer gegebenen Gesellschaftsstruktur. Die Politik des sozialen<br />
Raumes, die suburbane Landschaft und der Bereich des häuslichen Lebens<br />
stehen im Mittelpunkt ihrer interdisziplinären und gemeinschaftsbasierten<br />
Projekte und bilden in erster Linie den thematischen Rahmen für ihr<br />
kollektives Langzeitprojekt T.A.M.A. – Temporary Autonomous Museum for<br />
All – eine flexible Quasi-Struktur, die in Menidi, einem heruntergekommenen<br />
Viertel im Westen von Athen, spontan ins Leben gerufen wurde und<br />
von Wanderpopulationen wie den Roma und den Vlach-Rumänen aus Veria<br />
praktisch als Zweitwohnsitz genutzt wird. Als mobile postindustrielle Stadt<br />
ist T.A.M.A., (das im Griechischen so viel wie feierliches Versprechen, eine<br />
Geste der Gabe, der Dankbarkeit oder des Versprechens bedeutet), ein weiterer<br />
künstlerischer Versuch der Aufstellung eines Wertesystems bei der<br />
Auseinandersetzung mit Themen von bestimmter gesellschaftlicher und<br />
politischer Dringlichkeit wie Einwanderung, Armut und Menschenrechte im<br />
Allgemeinen. Beinahe unter Anwendung von Camouflage-Strategien tritt<br />
Maria Papadimitriou in Gemeinschaften und Gesellschaftschichten ein,<br />
nimmt allmählich deren Alltagsgewohnheiten an, dringt ganz tief in deren<br />
Lebensbedingungen ein und diagnostiziert auf der Basis ihrer Erfahrung<br />
den Status quo dessen, was tunlichst ausgelassen wird oder was allen<br />
Strategien oder Ökonomien der offiziellen gesellschaftlichen Zugehörigkeit
18 — 19<br />
Adam Budak<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar, 2010<br />
(Fotomontage)<br />
25<br />
Maria Papadimitriou:<br />
T.A.M.A., 25. Biennale de<br />
Sao Paulo, Futura 2002,<br />
S. 13.<br />
und Legitimität entgeht. Ihre Kunst ist die Kunst, sich in den Anderen zu<br />
verwandeln, seine Identität anzunehmen, in eine Kommunion einzutreten.<br />
T.A.M.A. ist der Versuch der Schaffung eines „besseren“, „tragfähigen“ sozialen<br />
Raums als Möglichkeit zu gemeinsamem Handeln und einem offenen<br />
Beitrag aller. In ihren Worten „brachten mich die nomadische Lebensweise<br />
und die Eigenheiten dieser Gemeinde auf die Idee, zwischen Bewohnern,<br />
der Künstlerin, den Kunst- und Kulturschaffenden und der breiten Öffentlichkeit<br />
ein System der Kommunikation und des Austauschs zu schaffen.<br />
Innerhalb sehr kurzer Zeit realisierte ich, dass alle meine Freunde und Partner<br />
an dieser Geschichte mitwirken wollten, die ich ein temporäres autonomes<br />
Museum für alle nenne.“ 25 Das lebende Museum der Künstlerin ist<br />
eine Maschine der gesellschaftlichen Möglichkeiten, die innerhalb und<br />
außerhalb des institutionellen Rahmens individuelle wie kollektive Gesten<br />
erzeugt und vollständig auf die Teilnahme der Menschen angewiesen ist.<br />
Als Konstruktion einer gemeinsamen Stimme in der Öffentlichkeit ist ihre<br />
Arbeit eine Hommage an das Lokale, das Minoritäre, das Andere.<br />
Das Phänomen des Genius loci (des Geistes eines Ortes) war schon der<br />
Protagonist zahlreicher bisheriger Installationen von Maria Papadimitriou,<br />
die allesamt von der Energie eines ganz besonderen Ortes befeuert waren,<br />
seiner realen wie symbolischen Rolle bei der Formung des Lebens der<br />
Menschen dort, ihrer Biografien, ihrer Wahrheiten und ihrer Glaubens- und<br />
Wertesysteme. Ihre Werke packten in der Tat die Ontologie eines Genius<br />
loci an, indem das Dazwischen, das Ephemere, das Intime und das Spirituelle<br />
in einer harmonischen Mischung aus Oral History und materieller<br />
Kultur erforscht wurde. Eigens geschaffen für die Ausstellung Der schaffende<br />
Mensch. Welten des Eigensinns feiert Maria Papadimitrious Projekt<br />
Alpine Altar die lokale Natur und Bevölkerung. Geschichte, Tradition, Bräuche<br />
und andere Formen des kulturellen Ausdrucks (Volksmärchen, Sagen<br />
und Lieder) tragen zu einer komplexen Ausarbeitung der Landschaft, des<br />
Lebens in der Region und regionalen Glaubens. In einem faszinierenden<br />
Vergleich zwischen dem nahe Trautenfels aufragenden, die Umgebung<br />
dominierenden und oft auch als Mons Styriae altissimus beschriebenen<br />
Grimming (etymologisch „Berg des Donners“) und dem Olymp, dem „Heim<br />
der Götter“ – insbesondere des Donnergotts Zeus) verweist die griechische<br />
Künstlerin auf ihr Heimatland. Papadimitrious Projekt ist eine Tour de<br />
force der Schauplätze, ihrer Geschichte, ihrer symbolischen Bedeutungen<br />
und aktuellen Wahrnehmungen. Die Künstlerin konstruiert (ihr eigenes)<br />
Museum der kollektiven Sehnsüchte: Alpine Altar, ein ganz besonderer<br />
Akt der interkulturellen Übersetzung, Zusammenführung des klassischen<br />
griechischen Altars mit dem lokalen Kontext des Ennstals. Gebaut aus<br />
(Grimming-)Fels ist Papadimitrious Altar ein Schrein der Gelübde, die von<br />
den Menschen gesammelt werden und sich auf die Tradition des Schaf-<br />
Festes beziehen, das jedes Jahr in Öblarn gefeiert wird. Der Altar fungiert<br />
als Ausdruck des Glaubens der Menschen, als Projektion ihrer Träume<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar, 2010<br />
(Recherchematerial)<br />
und Fantasien, als Lautsprecher ihrer intimsten gewagten Gedanken und<br />
Zukunftshoffnungen. Er ist Erlösungsort und Hort der Hoffnung, Spiegel<br />
menschlicher Sehnsüchte, Treffpunkt des Unausgesprochenen und Verborgenen<br />
– ein zeitgenössischer Beichtstuhl der Gemeinde und ein utopischer<br />
Ort der Katharsis und Kommunion. Der eklektische und heroische Altar der<br />
Künstlerin ist äußerster – kollektiver – Ausdruck des Genius loci. In ihrem<br />
Brückenschlag zwischen heidnischen und christlichen, fetischistischen und<br />
religiösen, natürlichen und übernatürlichen Kräften fordert Maria Papadimitriou<br />
die eigensinnige Mentalität der Bevölkerung des Ennstals heraus.<br />
Ihr Altar ist ein Denkmal für viele Mythologien und feiert von Göttern sowie<br />
von Menschen geschaffene Reliquien und Talismane. Von Menschenhand<br />
geschaffene und auf der geheiligten Fläche eines alten Altars dargebotene<br />
Miniatur-Spielzeugschafe leisten ihren Beitrag zu Papadimitrious<br />
selbstgefertigtem Ritual: Sie sind Gelübde, Opfersymbole und aufrichtiger<br />
Ausdruck eines tiefempfundenen Glaubens, eines Bedürfnisses, das<br />
Leben symbolisch als Geschenk Gottes/der Götter und der Natur zu feiern<br />
sowie vor unbekannten Kräften zu beschützen. Das literarische Werk<br />
von Paula Grogger (1892-1984), einer hochgefeierten Schriftstellerin aus<br />
dieser Region, dient Maria Papadimitriou als weiterer Verweis auf Struktur<br />
und Geschichte der Region. Paula Groggers umfassendes Werk, und hier vor<br />
allem der Roman Das Grimmingtor (1926), ist in seiner Zusammenstellung<br />
von - in einer einzigartigen Mischung aus Hochdeutsch, lokalen Dialekten<br />
und dem seltsamen Idiom einer Chronik des 17. Jahrhunderts erzählten -<br />
Mythen und Legenden ein Tableau vivant ihrer Heimat. Als charismatische<br />
Schriftstellerin wurde Paula Grogger als eine der „populärsten Erzählerinnen<br />
von sentimentalen Volkserzählungen betrachtet, die viel zu deutschnationalem<br />
Gedankengut beitrug.“ Während ihr Werk ohne Zweifel eine<br />
wenn auch nicht unumstrittene Hymne an die Werte der Region ist, zielt<br />
Maria Papadimitriou darauf ab, dem Translokalen (oder zumindest dessen<br />
Möglichkeit) Achtung zu bezeugen, sich von dessen Eigensinn zu befreien<br />
und Raum für ein breiteres vielstimmiges Verständnis von Kultur und Tradition<br />
zu schaffen.<br />
L/B<br />
„Beautiful Steps“ oder: Im Turm des befestigten Ichs<br />
Irgendwo zwischen Installationskunst, Plastik und erweiterter Malerei, und<br />
an der Schwelle zwischen Architektur, bildender Kunst und Design angesiedelt,<br />
lässt das höchst verführerische und spielerische Werk des Schweizer<br />
Kollektivs L/B (Sabina Lang, Daniel Baumann) die Grenzen der Wahrnehmung<br />
verschwimmen und entzieht sich jeder eindeutigen Zuordnung.<br />
Es handelt sich um ein wahrhaft traumartiges Schaffen voller Nostalgie,<br />
es verweist ganz offensichtlich auf das Unterbewusste des Betrachters,<br />
während es gleichzeitig tief ins Alltägliche, Profane und Banale eintaucht.<br />
Die architektonischen und quasi designten Interventionen von L/B sind
20 — 21<br />
Adam Budak<br />
L/B<br />
Beautiful Corner #1,<br />
1999<br />
migros museum für<br />
gegenwartskunst, Zürich<br />
Beautiful Lounge #1,<br />
2003<br />
Joburg Bar in Long<br />
Street, Cape Town<br />
26<br />
Christoph Doswald: Simply<br />
Beautiful, in diesem Band.<br />
bisweilen sanftere und dann wieder gewaltsamere Versuche des Zusammenlebens,<br />
mal in Freundschaft, mal in Feindschaft, parasitär und willkommen<br />
geheißen, doch fast immer angenehm, sympathisch und idyllisch:<br />
schön, „einfach schön“. 26 Quasi nomadisch lassen sie an Mobilität denken,<br />
sind eher Tagträume mit einem futuristischen Flair, Anti-Utopien vielleicht,<br />
doch performative Schauplätze potenzieller Erzählungen. L/B sind Meister<br />
des visuellen Raumes, meisterhafte Errichter von paradiesischen Welten.<br />
Ihre verzauberten (planen) Landschaften und die ephemeren Architekturen<br />
ihrer aufgeblasenen Röhren sind Einladungen zu einer halluzinogenen<br />
Reise durch die verwunschenen Länder der Fantasie mit einer Explosion aus<br />
leuchtenden Farben, psychedelischen Mustern und komplexen Geometrien.<br />
Ihre Lounges, Bars und Diskussionsplattformen sind verblüffende Beispiele<br />
für sinnliche haptische Räume von überraschender Vieldimensionalität.<br />
Industrial Design, Mode, Lifestyle, Tourismus sowie die ästhetischen<br />
Ansprüche einer nomadischen Freizeitgesellschaft leisten ihren Beitrag<br />
zur ganz besonderen Poetik des Raumes von L/B, einer Union von Neo-Pop<br />
Art, Op Art und möglicherweise Post-Minimal und Post-Land Art. Darüber<br />
hinaus wird die Funktion des architektonischen Elements hinterfragt und<br />
letztendlich annulliert; als Zeugen der Herstellung sind wir in dieser Tour<br />
de Force der Perfektion und erhabenen Schönheit mit der Simulation von<br />
handwerklicher Tätigkeit konfrontiert. Obwohl sie die plane Oberfläche in<br />
starkem Maße fetischisieren, erweisen sich die Tableaus von L/B als ein<br />
Ringen zwischen Ebene und räumlicher Tiefe, ein Wettkampf zwischen Perspektive<br />
und zweiter Ebene. Doch sind sie eher der Schauplatz der ersten<br />
Ebene, eines Bildes im klaren Rahmen einer subvertierten Wirklichkeit,<br />
einer lebenden Installation, einer bewohnbaren Umgebung mit partizipatorischem<br />
Charakter.<br />
Die im Rahmen der Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des<br />
Eigensinns präsentierten Projekte von L/B stellen weitere Schritte im<br />
ihrem Prozess der Meisterung (kritischer) Schönheit dar: Beautiful Steps<br />
#3 und Beautiful Steps #5. Die (räumlichen) Prinzipien des Eigensinns als<br />
natürliche Eigenschaft einer konservativen Weltsicht sind wie es scheint<br />
ein gerader, schmaler und strikt horizontaler Pfad, ästhetische Strenge der<br />
Architektur und eine schmerzhafte Logik der Dinge. Installiert im prächtigen<br />
und glanzvollen Marmorsaal des Schlosses Trautenfels provoziert<br />
die riesige, überlebensgroße Skulptur Beautiful Steps mit ihrer vielleicht<br />
zu offensichtlichen metaphorischen Aufladung. Plötzlich und offenbar<br />
ohne unser Zutun finden wir uns im Reich der Allegorie wieder. Über dem<br />
Boden schwebend schlängelt sich eine geschwungene weiße Stiege durch<br />
dieses großzügige und monumentale Interieur, umgarnt es wie ein Band,<br />
das man um ein kostbares Geschenk gewickelt hat, und erreicht den Himmel<br />
– die von Carpoforo Tencalla im 17. Jahrhundert mit beeindruckenden<br />
Fresken - meisterlichen Variationen auf mythologische Heldenmotive<br />
- geschmückte Decke des Marmorsaals. Solcherart in die Höhe gehoben<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #3,<br />
2009<br />
Beautiful Steps #5,<br />
2010 (Rendering)<br />
27<br />
Julia Kristeva: Hannah<br />
Arendt, S. 156.<br />
ist ihre luftige Gegenwart erhaben und magisch. Eine moderne asketische<br />
Struktur korrespondiert mit dem Barock und reicher Aristokratie. Doch<br />
diese auf den ersten Blick höchst unpassende Mischung erweist sich sehr<br />
bald als durchaus kompatibel und sinnvoll. Die Beautiful Steps #3 necken<br />
mit ihrer formalen Reinheit und der Illusion ihrer Benützbarkeit, fordern<br />
die Wahrnehmungsfähigkeiten des Betrachters heraus und versetzen ihn<br />
in eine recht surreale räumliche Umgebung. L/B steht für Phantasmagorien<br />
des Alltäglichen, Schwebezustände der Wahrnehmung und Überarbeitungen<br />
jeder konventionellen Semantik des Raumes. Wir befinden uns<br />
an der Schwelle zum Absurden; wir erleben die Sensation, das, was sich<br />
Logik und Menschenverstand entzogen hat; hier befinden wir uns an der<br />
Schwelle zwischen Realität und Fiktion, an der Pforte zur Fantasie. Mit<br />
Beautiful Steps #5 setzen L/B ihre Untersuchung von Grenzbereichen fort.<br />
In diesem Fall fungiert auch die Architektur des Schlosses als ein Hauptdarsteller<br />
in der unheimlichen Vision der Künstler: Zwei schmale Stiegen<br />
führen auf rätselhafte Art und Weise auf die diagonalen Schlossfenster<br />
zu, überqueren die Fenstersimse und schleichen sich ins Freie davon, setzen<br />
ihre Bahn fort und umschließen letztendlich den Turm des Schlosses<br />
mit einer bescheidenen ringförmigen Plattform. Eine solche ortsspezifische<br />
Intervention gehört dem Genre der psychologischen Architektur an.<br />
Teils wie ein Fluchtplan aussehend, teils wie Raumakrobatik à la Alice im<br />
Wunderland fungiert sie als Medium einer Vorstellungskraft ohne Grenzen.<br />
Ihre elegante neutrale Struktur belebt die eher eintönige Fassade,<br />
indem sie eine mögliche zweite Haut enthüllt, in einem für den Historiker<br />
interessanten Sinne Spannung erzeugt und einen Verfremdungseffekt, der<br />
eine kritische Haltung evoziert. Beautiful Steps #5 lässt sich vielleicht als<br />
gebrochene endlosschleifenartige Gedankenlinie wahrnehmen, oder als<br />
unmögliche Brücke ohne Zugang als Metapher für Eigensinn in einem als<br />
Symbol für das bewehrte Ich zu sehenden Schloss. L/B durchdringen das<br />
Verhältnis zwischen dem Drinnen und dem Draußen, dem Öffentlichen und<br />
dem Privaten, dem Realen und dem Imaginären. Was entkommt dem Lauf<br />
der Geschichte? Wie können wir die Zeit bewahren, die im Flug vergeht?<br />
Was ist persönliche und kollektive Erinnerung? Das Projekt von L/B verweist<br />
auf die Bedeutung der Oberfläche – der Oberfläche, die zählt, der<br />
Oberfläche der Bedeutung, einer Plattform des Sinns. Wir sind Erzeuger<br />
der Ansichten der Welt, der Vielzahl der Ansichten. Die Brücke als Umarmung<br />
agiert als ein Ausdruck von Arendts Glauben an „gemeinsame<br />
Interessen“ oder, wie Cicero gesagt hätte „gemeinsamen ‚Konsens‘“: esse<br />
kann zu inter-esse, oder Interesse, werden. Inter-esse ist ein „Zwischen-<br />
Menschen” und Grundlage und Ziel zugleich, sowie nicht nur Antithese<br />
aller totalitären Systeme, sondern aller Formen von solipsistischer Isolation<br />
und transzendentalem Utilitarismus“. 27 Doch, so wie das auch für<br />
Wolff-Plotteggs algorithmische Architektur gilt, sind die Stiegen von L/B<br />
nur Instrumente der Sinnlichkeit; sie sind nur ein Verlangen, ein Phantom<br />
eines notwendigen Architekturgegenstandes – eines fehlenden…
22 — 23<br />
Adam Budak<br />
Pawel Althamer<br />
Bródno, 2000, 2000<br />
Common Task, 2009<br />
28<br />
Sarah Cosulich Canarutto:<br />
Phenomenology of the<br />
Invisible. In: New! Experience<br />
Clear and Perfect<br />
Vision. Discover a New<br />
Reality. Non-addictive/Nondeforming.<br />
Pawel Althamer,<br />
19/10/02 – 03/12/02,<br />
Comotato Trieste Contemporanea<br />
2002, S. 13.<br />
29<br />
Pawel Althamer im Gespräch<br />
mit Maurizio Cattelan.<br />
In: Sarah Cosulich<br />
Canarutto: Phenomenology<br />
of the Invisible, S. 51.<br />
Pawel Althamer und seine Klasse für Objektbildhauerei der Akademie<br />
der Bildenden Künste, Wien<br />
„Things You Can Walk Into“ oder: Zwischen Herstellen und Handeln<br />
Die Bedingungen des Andersseins und Zustände der Fremdheit bilden den<br />
Kern von Pawel Althamers Realitätswahrnehmung und seiner Auffassung<br />
von der Kunst als therapeutische Aktivität. „Jeden Tag, wohin auch immer<br />
ich gehe, fühle ich mich wie ein Außerirdischer, der gerade auf der Erde<br />
gelandet ist. Sogar die Dinge, die ich wieder und wieder sehe, ziehen meine<br />
Aufmerksamkeit auf sich, weil sie mir jedes Mal neu erscheinen. Und wenn<br />
ich mein eigenes Schlafzimmer betrete, habe ich den Eindruck, dass ich es<br />
jedes Mal durch eine andere Türe betrete.“ 28 Seine Kunst ist insgesamt,<br />
ganz egal in welchem Medium, eine Art Kostümierung und nimmt die Form<br />
einer Übung des erweiterten Selbstporträts an und den reinen Ausdruck<br />
der Identität eines Außenseiters, der durch seine Verkörperung des archetypischen<br />
Schamanen einen privilegierten Zugang zur Realität innehat. Bei<br />
seiner Ausübung zeitgenössischer gesellschaftlicher und privater Alltagsrituale<br />
fetischisiert Althamer sich selbst und seine Rolle als Kommunikator<br />
mit dem „Außerhalb“ des normalen (Geistes-)Zustands und der herkömmlichen<br />
(soziopolitischen) Ordnung. Sein Werk – der Bau einer sozialen Skulptur<br />
– strahlt die gleichsam außerirdische Magie ritualistischer Überschreitung<br />
aus. „Ich bin ein Mitgefangener – das ist meine Rolle in der<br />
Gesellschaft“ 29 , bekennt der Künstler anlässlich einer seiner Interventionen.<br />
Außerhalb des Mythos, im Zwischenraum eines Rituals, werden die<br />
Wirklichkeit und die Welt im Allgemeinen als Spielfilm wahrgenommen und<br />
es ist die Rolle des Künstlers, die Bühne einzurichten und sanft einzugreifen,<br />
also Regieanweisungen zu geben und die Ereignisse und deren (lokale)<br />
Protagonisten aufzuzeichnen – doch ohne auch nur eine einzige Filmrolle<br />
zu verwenden. Dies ist die konzeptuelle Konstruktion der Mehrzahl der Projekte<br />
von Pawel Althamer, gemeinschaftsbasierten Projekten im öffentlichen<br />
Raum mit Protagonisten wie Obdachlosen, Häftlingen, Kindern, Passanten<br />
oder aber den Nachbarn des Künstlers wie im Falle der<br />
monumentalen Performance/Aktion/sozialen Skulptur Bródno, 2000, die<br />
zu einer eindrucksvollen Manifestation kommunalen Geistes wurde.<br />
Ursprünglich geplant zur Feier des neuen Jahrtausends war Bródno, 2000<br />
eine spektakuläre Lichtinstallation, die auf der Fassade eines Häuserblocks<br />
im Warschauer Bezirk Bródno, also dem Wohnviertel des Künstlers, „performt“<br />
wurde. Als Ergebnis der gelungenen, äußerst präzisen Zusammenarbeit<br />
der vielen, vielen Bewohner des Blocks ergaben die beleuchteten Fenster<br />
über die Länge des Blocks die Zahl 2000 in riesigen Ziffern. Als<br />
perfektes Beispiel für die Kreuzung des Unmöglichen mit vermeintlich utopischer<br />
Kollektivität war Althamers Projekt ein Fest des Engagements und<br />
ein Spektakel der Zugehörigkeit, das mithalf, viele Bedeutungen und<br />
Bedürfnisse weit über den reinen Kunstkontext hinaus zum Ausdruck zu<br />
bringen, indem soziale Anonymität aufgehoben und für gewöhnlich<br />
Pawel Althamer und seine<br />
Klasse für Objektbildhauerei<br />
der Akademie der<br />
Bildenden Künste, Wien<br />
Things You Can Walk Into,<br />
2010 (Detail)<br />
30<br />
Sarah Cosulich Canarutto:<br />
Phenomenology of the<br />
Invisible, S. 13-23.<br />
31<br />
Susanne Cotter: Common<br />
Task, Broschüre, Modern<br />
Art Oxford, England, December<br />
2009.<br />
einander entfremdete Gesellschaftsgruppen aktiviert wurden. Der Künstler<br />
verfolgt durch Assimilation und Eintauchen in die vorgegebenen Strukturen<br />
die Taktik der sozialen Camouflage als künstlerische Strategie im Umgang<br />
mit der Wirklichkeit und deren vorwiegend ökonomischer, politischer und<br />
sozialer Konstruktion. „Phänomenologie des Unsichtbaren“ – mit diesen<br />
Worten beschreibt Sarah Cosulich Canarutto Althamers quasi naiven und<br />
bisweilen recht ephemeren Gesten, die jedoch auf überraschend starken<br />
Widerhall stoßen und beinah kathartische Wirkungen zeitigen. 30 Die Grenzen<br />
des Körpers überschreitend und sich frei in Raum und Zeit bewegend,<br />
vermischt der Künstler auf beinah alchemistische Art und Weise Spirituelles<br />
mit Irrationalem, Reales mit Fiktivem und Materielles mit Immateriellem.<br />
Wir betreten eine metaphysische Erfahrungszone; wir sind im Begriff,<br />
an einem geistigen Flug in Parallelwelten von seltsamer Vertrautheit teilzunehmen.<br />
Immer befeuert durch Spontanität und einen Sinn für das<br />
Unvorhersehbare, verweist Althamers künstlerische Praxis auf Oskar Hansens<br />
„offene Form“, die dem Prozess den Vorzug gibt gegenüber dem singulären<br />
Objekt, einen Prozess, in dem der Betrachter durch aktive Teilnahme<br />
zum Ko-Autor des Kunstwerks wird. Wie Susanne Cotter anlässlich<br />
von Althamers jüngstem Projekt Common Task (2009) bemerkt hat, „wird<br />
das Leben um uns herum als Ort des erhöhten Bewusstseins und der Entdeckungen<br />
offenbart. In jeder Begegnung liegt Potenzial und die Möglichkeiten<br />
sind optimistisch gesprochen unendlich.“ 31 Pawel Althamers Beitrag<br />
zur Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns ist eine<br />
weitere Übung in der Kartierung eines solchen Felds der unendlichen Möglichkeiten.<br />
Realisiert in Zusammenarbeit mit Studierenden der Akademie<br />
der bildenden Künste Wien (den Studierenden des erst unlängst an die<br />
Akademie berufenen Professor Althamer) ist sein Projekt mit „offenem Konzept“<br />
und dem Titel Things You Can Walk Into (Dinge, in die man hineinlaufen<br />
kann) eine wahrlich auf echter Erfahrung beruhende partizipatorische<br />
Aktion/Performance/soziale Skulptur, ausgeführt in Form einer ziemlich<br />
altmodischen Aktivität en plein air (d.h. einer Tätigkeit unter freien Himmel),<br />
womit im Frankreich des 19. Jahrhunderts der Akt des Malens im<br />
Freien beschrieben wurde und heutzutage eine Form des kollaborativen<br />
Schaffens außerhalb jeden institutionellen Kontexts, ausgeführt in einem<br />
Eintauchen in das Leben einer Community. Das Campieren von Althamer<br />
und seinen Studierenden auf Schloss Trautenfels verwandelt diesen Ort in<br />
einen Schauplatz eines gemeinschaftlichen Rituals und das radikale und<br />
dauerhafte Eintauchen in die Örtlichkeit der Region ermöglicht die Kommunion<br />
mit der einheimischen Bevölkerung und die Konstruktion einer sozialen<br />
Skulptur aus dem pulsierenden Stoff einer lokalen Community.<br />
Althamer orchestriert soziale Situationen, manchmal offene, bisweilen<br />
intime, in denen die Grenzen zwischen öffentlich und privat verschwimmen,<br />
indem er sich selbst spielt und der reale Akt seiner eigenen Hochzeit in der<br />
hiesigen romanischen Johanneskappelle eines der grundlegenden Elemente<br />
der Dramaturgie des Projekts darstellt. Wir sind bereits Zeugen
24 — 25<br />
Adam Budak<br />
Christian Philipp Müller<br />
Green Border, 1993<br />
Performance anlässlich<br />
eines weiteren Films im Kopf unter der Regie von Pawel Althamer, oder wir<br />
berühren das authentische Gewebe des ganz gewöhnlichen Lebens, oder<br />
aber wir erleben beides gleichzeitig, da wir offenbar bereits IN DIE DINGE<br />
HINEINGELAUFEN SIND… In seiner Transzendierung der Grenzen des Vertrauten<br />
und Hinterfragung des Status des Aliens ist das Projekt Things You<br />
Can Walk Into eine weitere Kritik an der Mentalität des Eigensinnigen. Der<br />
Ruf nach Zusammengehörigkeit und ein Sinn für Zugehörigkeit und<br />
Gemeinschaft, der so typisch für Althamers Künstlerethos ist, ist der Weltsicht<br />
des Homo faber ähnlich und erlaubt die Wahrnehmung des Künstlers<br />
als reine Verkörperung der Vita activa: „Die Vita activa, menschliches<br />
Leben, sofern es sich auf Tätigsein eingelassen hat, bewegt sich in einer<br />
Menschen- und Dingwelt, aus der es sich niemals entfernt und die es nirgends<br />
transzendiert. (…) Es gibt kein menschliches Leben, auch nicht das<br />
Leben des Einsiedlers in der Wüste, das nicht, sofern es überhaupt etwas<br />
tut, in einer Welt lebt, die direkt oder indirekt von der Anwesenheit anderer<br />
Menschen zeugt. Alle menschlichen Tätigkeiten sind bedingt durch die Tatsache,<br />
dass Menschen zusammenleben, aber nur das Handeln ist nicht einmal<br />
vorstellbar außerhalb der Menschengesellschaft.” 32 Genau dort sollte<br />
man Althamers Praxis ansiedeln – im Zwischenbereich zwischen Herstellen<br />
und Handeln: „Dieser besondere Bezug, der das Handeln an das menschliche<br />
Zusammen bindet, scheint es vollkommen zu rechtfertigen, dass schon<br />
sehr früh (bei Seneca) die aristotelische Bestimmung des Menschen als<br />
eines zoon politikon, eines politischen Lebewesens, im Lateinischen durch<br />
das animal socialis wiedergegeben wird, bis schließlich Thomas [von Aquin]<br />
ausdrücklich sagt: ‚homo est naturaliter politicus, id est, socialis (Der<br />
Mensch ist von Natur politisch, das heißt gesellschaftlich)’”. 33 Das ist<br />
genau die Gesamtdimension Pawel Althamers künstlerischer Praxis: Politik<br />
und Gesellschaft.<br />
der Venedig Biennale Christian Philipp Müller<br />
32<br />
Hannah Arendt: Vita activa,<br />
S. 33.<br />
33<br />
Ebda., S. 34.<br />
34<br />
James Meyer, Christian<br />
Philipp Müller: Ein Gespräch.<br />
In: Philipp Kaiser<br />
(Hrsg.): Christian Philipp<br />
Müller. Basel: Kunstmuseum<br />
Basel, Museum für<br />
Gegenwartskunst 2007,<br />
S. 41.<br />
Christian Philipp Müller<br />
„Burning Love“ oder: Das performative Porträt eines Lokalmatadors<br />
Christian Philipp Müllers kritische Kunstpraxis beschäftigt sich mit der<br />
Kartierung der institutionellen und geopolitischen Parameter des Vernakulären.<br />
Sein Werk ist die Mise-en-scène verschiedenster Wissensdisziplinen,<br />
geschaffen von einem Künstler, der in die verschiedensten Rollen<br />
schlüpft – Archivar, Forscher, Kommunikator und Performer. Dabei bleiben<br />
die Themen nationale Identität und Konstruktion von Grenzen im Zentrum<br />
von Müllers Untersuchungen der Ökonomien des jeweiligen Ortes und der<br />
Politik der Zugehörigkeit. Für die Installation Grüne Grenze, die er 1993 für<br />
den österreichischen Pavillon im Rahmen der Biennale von Venedig realisiert<br />
hat, überquerte der Künstler im Wanderer-Outfit acht Mal illegal Staatsgrenzen.<br />
„In meiner Anleitung zur Grenzüberquerung machte ich Vorschläge<br />
für das beste Outfit, um mit der Landschaft zu verschmelzen. Heutzutage<br />
ist der Tourist die unauffälligste Gestalt“ 34 , bekennt der Künstler bei der<br />
Space Rendez-Vouz,<br />
2008<br />
Manifesta 7, Rovereto<br />
Strickmuster „Brennende<br />
Liebe“<br />
35<br />
Ebda., S. 56.<br />
36<br />
James Meyer: The Functional<br />
Site. In: Platzwechsel.<br />
Ursula Biemann, Tom Burr,<br />
Mark Dion, Christian Philipp<br />
Müller, Kunsthalle Zürich<br />
1995, S. 25-29.<br />
Beschreibung seines bahnbrechenden Projekts, das mittlerweile zu einem<br />
Symbol für den künstlerischen Diskurs zur Politik nach 1989 und Themen<br />
der nationalen Repräsentation geworden ist. Das gesamte Schaffen von<br />
Christian Philipp Müller scheint ein Statement gegen den Eigensinn zu<br />
sein. In einem Gespräch mit James Meyer räumt er ein: „Ich hasse starre<br />
Identitäten. Ich glaube an multiple Identitäten (…) Wir werden alle auf Klischees<br />
reduziert. Wir werden typisiert, weil unsere Gesellschaft mit multiplen<br />
Identitäten nichts anfangen kann. Wenn ich über diesen Bach springe,<br />
dann sehen Sie mich genau im Dazwischen, an der Grenze: Das ist es vor<br />
allem, worum es in meiner Arbeit geht. Sie ist eine Hybride. Sie haben ein<br />
Bild vor sich und eine Bildunterschrift, und sie versuchen dann im Kopf eine<br />
Verbindung zwischen dem, was Sie sehen und dem was Sie lesen herzustellen.<br />
Was ich dabei erreichen möchte, ist die richtige Abstimmung. Ich<br />
versuche das geeignete Medium, den Maßstab, den Raum und die Einbeziehung<br />
meines eigenen Körpers zu finden, um meine Botschaft rüberzubringen.<br />
Zum Beispiel zeigte ich in Venedig nicht das Werk von Christian Philipp<br />
Müller. Ich präsentiere mich nicht selbst als das Produkt. Ich präsentiere<br />
Umstände. Ich orientiere mich in der Arbeit an Themen, vorgegebenen und<br />
selbst gewählten.“ 35 Seine für die Manifesta 7 (2008) konzipierte Feldarbeit/Installation/Performance<br />
Space Rendez-Vous ist ein komplexes ortsspezifisches<br />
Gebäude aus Querverweisen, in dem der Futurist Fortunato<br />
Depero auf Weltraumeroberungsträume aus der Zeit des Kalten Krieges<br />
trifft, die globale Industrie und folkloristische Allegorien. Müllers Carro<br />
Largo-Parade, die bevölkert war mit in Trachten für Deperos festa dell’uva<br />
im Jahr 1936 gekleideten Menschen war ein ehrgeiziger Versuch, unter Verwendung<br />
des kritischen Vokabulars einer globalisierten Welt die Dogmen<br />
des Regionalismus neu zu schreiben. Christian Philipp Müllers Kunstpraxis<br />
(zusammen mit dem Werk von u.a. Fred Wilson, Mark Dion, Andrea Fraser)<br />
wurde von James Meyer als Erforschung des so genannten „funktionalen<br />
Ortes“ beschrieben, einem erweiterten Ortsbegriff, der im Gegensatz zu<br />
einem (physikalischen) festen Ort als „ein Prozess, ein sich zwischen Orten<br />
vollziehender Vorgang, eine Kartierung institutioneller und diskursiver Verzweigungen<br />
und der sich dazwischen bewegenden Körper (vor allem dem<br />
des Künstlers) verstanden wird. Es ist ein Ort der Informationen, Schauplatz<br />
des Ineinandergreifens von Texten, Fotografien und Videoaufzeichnungen,<br />
physikalischen Orten und Dingen: ein allegorischer Ort (…).“ 36 Nach<br />
dieser Definition ist das Werk eine Bewegung, eine Bedeutungskette; eine<br />
Funktion erscheint in der Passage zwischen Orten und Blickwinkeln. Meyer<br />
unterstreicht die Bedeutung des Zusammentreffens zwischen dem Produzenten<br />
und dem Ort, an dem die grundlegenden Identitäten des Künstlers<br />
und einer Gemeinde zusammenfallen oder ernsthaft herausgefordert<br />
werden. Eine solche Praxis weist Züge einer „diskursiven Performativität“<br />
auf, einer bestimmten Form der sozialen Maskerade, die tiefergehende<br />
Forschung, kritisches Engagement und Identifikation mit dem Thema bzw.<br />
dem untersuchtem Subjekt erleichtert.
26 — 27<br />
Adam Budak<br />
Christian Philipp Müller<br />
Burning Love<br />
(Lodenfüßler), 2010<br />
Müllers Burning Love (Lodenfüßler), das er für die Ausstellung Der schaffende<br />
Mensch. Welten des Eigensinns vorbereitet hat, ist eine vielschichtige,<br />
beinah monografische Erforschung der regionalen Identität durch die<br />
ganz besondere Fallstudie einer für das Ennstal typischen Tradition – der<br />
Herstellung von Loden, einem dicken Wollstoff, der von der Textilindustrie<br />
der Region zur Herstellung von einheimischer Mode verwendet wird.<br />
Der sinnliche Projekttitel ergab sich aus der Aneignung des Namens eines<br />
Musters – „Brennende Liebe“ – das von lokalen Sockenherstellern (Lodenfüßler)<br />
entwickelt wurde und dem der Künstler im Rahmen des Besuchs<br />
eines in Schloss Trautenfels stattfindenden Handarbeitstreffen erstmals<br />
begegnet ist. Müllers Burning Love (Lodenfüßler), das Einblicke in Herstellung<br />
und Gebrauch einer Tracht liefert, die für nationale Identität und<br />
ein Gefühl von Zugehörigkeit steht, spürt nicht nur den Mechanismen<br />
des Handwerksethos und der Konstruktion vom Nationalstolz und Emanzipation<br />
nach, sondern definiert auch Tradition als Synergie von Leben<br />
und Gemeinschaftsgeist und artikuliert ein Bedürfnis nach (historischer<br />
und ideologischer) Kontinuität und kultureller Vielfalt, wie es in einem im<br />
Katalog von Loden Steiner 2009/2010 gefundenen Slogan zum Ausdruck<br />
gebracht wird: „Zukunft braucht Herkunft, denn je globaler die Welt, desto<br />
wichtiger die Wurzeln”. Müllers Projekt umfasst eine ganz besondere Performance:<br />
eine Prozession über 42 Kilometer mit 25 Einheimischen, die eine<br />
Art kollektive Tracht aus einem 50 Meter langen Lodenstoff von Steiner als<br />
spektakuläre mobile Skulptur durch das Ennstal hinauf zum Landschaftsmuseum<br />
Schloss Trautenfels tragen. In seiner Reise zwischen den Kontexten,<br />
die immer zu engen Grenzen nur eines kulturellen Ausdrucks hinter<br />
sich lassend, bringt der Künstler hier eine Mise-en-scène auf die Bühne, die<br />
gleichermaßen bodenständig wie weltgewandt ist, da sie, unter anderem,<br />
an die Aktionen von James Lee Byars anklingt, der 1968 das größte Kleid<br />
der Welt hergestellt hat, mit dem 500 Menschen um die Häuserblocks von<br />
New York zogen, oder an die Arbeiten von Christo, Helio Oiticica oder Robert<br />
Morris. Müllers unheimliche Verschmelzung von Modeschau und Ritual ist<br />
ein einzigartiges und einmaliges performatives Porträt eines Lokalmatadors<br />
– die Feier einer Leidenschaft, die man oft „brennende Liebe“ nennt“…<br />
Kateřina Šedá<br />
„Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels“ oder:<br />
Die Möglichkeit von Katharsis<br />
Kateřina Šedás künstlerische Praxis ließe sich vielleicht als Chronik der<br />
kollektiven Erinnerung und Storyboard des sozialen wie individuellen<br />
Imaginären beschreiben. Präziser formuliert sind es die Überschneidungen<br />
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich, die den Inhalt<br />
wie den Umfang des beeindruckenden Werkkorpus der tschechischen Künstlerin<br />
ausmachen. Ihre Grafiken, Videos und Installationen sind Musterbeispiele<br />
für einen neokonzeptuellen Ansatz, bei dem der dokumentarische<br />
Kateřina Šedá<br />
It Doesn‘t Matter,<br />
2005<br />
Over and Over,<br />
2008, Berlin Biennale<br />
Modus der persönlichen Erfahrung der Realität gefiltert durch die Linse<br />
künstlerischer Manipulation entspricht. Šedá manipuliert Wahrnehmung<br />
wie Imagination von kommunalen Strukturen, aber auch ihrer eigenen Familie,<br />
und erzielt dabei unerwartete, beinah magische Ergebnisse, irgendwo<br />
an der Schwelle zum Unbewussten. Weder interventionistisch noch aktivistisch<br />
birgt ihre Kunst mit ihrer Einfachheit und vorgeblichen Naivität eine<br />
therapeutische Kraft in sich, fähig zu beinah revolutionären Veränderungen.<br />
Die Künstlerin kombiniert in ihrer Untersuchung der Bedingungen von<br />
„Normalität“ und der Aufstellung ihres eigenen subjektiven moralischen<br />
Werteindex Vertrautes mit Verdrängtem, die große Erzählung mit der<br />
kleinen und gewöhnlichen. Auch das Gefühl für Wichtigkeit wird aus dem<br />
Gleichgewicht gebracht: Kateřina Šedás Interesse gilt Neubewertungen von<br />
Verhaltensmustern und Urteilssystemen. Für gewöhnlich ist die Alltagsroutine<br />
Ausgangspunkt ihrer gleichsam soziologisch motivierten und oft<br />
psychologisch intensiven Untersuchungen des Alltäglichen. It Doesn’t Matter<br />
(2005), eine Grafikenserie und ein Video, ist ein repräsentatives Beispiel<br />
für Kateřina Šedás Strategie: Hier erlegte die Künstlerin ihrer inzwischen<br />
verstorbenen Großmutter die Aufgabe auf, aus dem Gedächtnis so viele<br />
Produkte zu zeichnen, die sie in mehr als 30 Jahren im Haushaltswarenladen<br />
der Familie in ihrer Heimatstadt Brno verkauft hatte, und rettete die<br />
alte Frau somit aus der tiefen Depression, in die sie in ihren letzten Lebensjahren<br />
gefallen war. It Doesn’t Matter als auferlegte Nachstellung der Vergangenheit<br />
ist ein Tableau des Gedächtnisses und des Akts des Erinnerns,<br />
ein Leben in seiner aufrichtigsten und elementarsten Form. Berührend und<br />
höchst intim, sorgt dieses Werk für eine Neubelebung der Kunst als soziale<br />
Praxis und verringert ihre Losgelöstheit von der Banalität des Alltags. Šedá<br />
betrachtet die Kunst als Instrument der Kommunikation und des Handelns<br />
bzw. Agierens - oder vielmehr Reagierens - in Not- oder Konfliktsituationen.<br />
Ihr prozess- und gemeinschaftsbasiertes Projekt Over and Over (2008) ist<br />
ein Mikroporträt der heutigen Gesellschaft und die eingehendere Untersuchung<br />
der Künstlerin der Veränderungen der Mentalität der Menschen unter<br />
dem Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die sich<br />
in Kateřina Šedás Heimatland, Tschechien, vollzogen haben. Ein architektonisches<br />
Element, das normalerweise kommunale Verbindungen trennt<br />
oder eindämmt, ist hier der Protagonist: der Zaun einer privaten Umgebung<br />
und das dazugehörige Gartentor. Šedás 40 Nachbarn aus einem Vorort von<br />
Brno wurden darum gebeten, die Zäune zwischen ihren Eigenheimen zu<br />
überqueren und wurden darauf nach Berlin eingeladen (da Over and Over<br />
ein Auftragswerk der Berliner Biennale war), um auch dort ihre Zäune aufzubauen<br />
und erneut ein offenbar kathartisches Ritual des Zusammenseins<br />
und der Trennung zur Aufführung zu bringen. Im Kern partizipatorisch, ist<br />
dieses Projekt eine recht ironische Fallstudie einer ganz gewöhnlichen Aufgabe<br />
und eine Untersuchung dahingehend, was denn eigentlich die Menschen<br />
wirklich verbindet. Projekte aus jüngster Zeit wie What Can I Do?<br />
und It Can’t Be Helped, die in kleinen Gemeinschaften in der Stadt bzw.
28 — 29<br />
Adam Budak<br />
Kateřina Šedá<br />
Es gibt kein Licht am<br />
Ende des Tunnels,<br />
2010<br />
auf dem Land durchgeführt wurden, wären noch weitere zwei Beispiele für<br />
Šedás Kritik an Gentrifizierung, Landbesitz und globalen Ökonomien, die<br />
die Ursache für Stadtsanierungen bilden und die Entscheidungen von multinationalen<br />
Konzernen beeinflussen. In beiden Fällen wird durch lächerliche<br />
Baumaßnahmen entweder die Landschaft vor Ort zerstört oder die<br />
Bewegungsfreiheit und der Komfort der Anwohner ernstlich getrübt. Das<br />
dunkle Metalltor eines neuen Eigentümers versperrt den Weg und nimmt<br />
dem Bereich jedes Sonnenlicht; eine neu errichtete Industriezone mit einer<br />
riesigen Autofabrik nimmt auch ihre Umgebung in Beschlag, indem sie sie<br />
etwa mit einer aggressiven Flut künstlichen Lichts blendet. Das Gefühl von<br />
Resignation und Hoffnungslosigkeit angesichts der Macht der politischen<br />
Autorität überwiegt in Kateřina Šedás emotional aufgeladenen Untersuchungen<br />
des Scheiterns und der Absurdität. Die Unmöglichkeit von Kommunikation<br />
(einschließlich des Scheiterns des Zusammengehörigkeitsgefühls),<br />
Ignoranz, Menschenrechtsverletzungen, Nichtachtung der Privatsphäre –<br />
das sind die wichtigsten Themen von Kateřina Šedás Projekten, die quasi<br />
als Lautsprecher fungieren, für vorwiegend marginale Gemeinschaften/<br />
Gemeinden, die von Global Playern unter Druck gesetzt wurden.<br />
Die Künstlerin beschreibt die Entstehungsgeschichte ihres neuen für die<br />
Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns in Auftrag<br />
gegebenen Projekts als in der Tat neue Erfahrung, die sich wirklich von<br />
ihren bisherigen Projekten, die vorwiegend mit Tschechien zu tun hatten,<br />
unterscheidet: Als sie die einheimische Bevölkerung des Ennstals darauf<br />
ansprach, erfuhr sie, dass in dieser (geografisch und politisch) offenbar<br />
idyllischen Landschaft keinerlei Wunsch oder Bedürfnis nach Veränderung<br />
besteht. Darüber hinaus wird das alles beherrschende Naturschauspiel, der<br />
Grimming, nicht als Barriere betrachtet, von der Landschaft und Menschen<br />
voneinander getrennt werden, sondern vielmehr als zentrale Schnittstelle,<br />
die alles auf den Punkt bringt: Von der Künstlerin aufgefordert, sich vorzustellen,<br />
was sich hinter dem Berg befindet und das, was sich genau hinter<br />
dem Berg befindet, zu zeichnen, lieferten die Einheimischen der Künstlerin<br />
ein perfektes Bild von hoher Präzision. Der Berg schien durchsichtig zu<br />
sein; der Sichtbarkeits- oder Wahrnehmungstest der Künstlerin scheiterte<br />
… oder war letztendlich ganz unerwartet erfolgreich! Jedenfalls brachten<br />
weitere Nachforschungen Kateřina Šedá auf den wahren Kern der entdeckten<br />
lokalen Kontroverse: der geplante Bau des größten Kreisverkehrs<br />
Österreichs, und zwar mitten in einem Ortszentrum, mit dem zwar der Transitverkehr<br />
erleichtert und das Problem mit dem Durchzugsverkehr gelöst<br />
sein, aber die bestehende Raumorganisation zerstört würde, das Dorf<br />
praktisch durchschnitten und somit das Leben der Bewohner schwieriger<br />
würde. Diese Entscheidung wurde nun schon seit beinahe drei Jahrzehnten<br />
heiß debattiert und konnte bislang von Interessensgruppen, Bürgerinitiativen<br />
wie LIEB, NETT und der Kampagne „Stop Transitschneise Ennstal“<br />
erfolgreich verhindert werden. Mit ihrem Projekt Es gibt kein Licht am<br />
Ende des Tunnels erweitert Kateřina Šedá ihr Interesse an Metaphern des<br />
Franz Kapfer<br />
Zentaur, 2004/05<br />
37<br />
Katerina Seda: Es gibt kein<br />
Licht am Ende des Tunnels,<br />
Projektbeschreibung.<br />
38<br />
Roger M. Buergel in: Franz<br />
Kapfer/Emil Varga, Katalog.<br />
Fotogalerie Wien, 2003.<br />
Lichts und der Blendung, der Sichtbarkeit und der Transparenz, als Instrumente<br />
einer aktiven Kritik an Modernisierung und Industrialisierung. „Der<br />
geplante Kreisverkehr, genauso wie die Autofabrik mit ihrem Licht, blendet<br />
die Anwohner und die Menschen können sich durch die Dunkelheit gar nicht<br />
sehen“, meint die Künstlerin und stellt sich die Aufgabe „eine Möglichkeit<br />
zu finden, wie die größtmögliche Personenanzahl durch das blendende<br />
Licht (den Kreisverkehr) verbunden werden und auf diese Art und Weise ihr<br />
Blick nur in eine Richtung gelenkt werden kann.“ 37 Šedá organisiert eine<br />
ganz besondere performative Zeichensession von kollektiver Urheberschaft,<br />
indem sie die Einheimischen dazu auffordert, den Kreisverkehr mit<br />
verbundenen Augen mit Buntstiften zu zeichnen. Diesem Konzept folgend,<br />
zusammengefügt und geschichtet, bieten die überlappenden Zeichnungen<br />
eine „einheitliche“ Sicht auf einen höchst problematischen Gegenstand –<br />
einen metaphorischen, beinah halluzinatorischen Knoten aus den verschiedensten<br />
Vorstellungen und Erwartungen. Hier in diesem kritischen Akt der<br />
Gruppentherapie betritt das Individuum die kommunale Ebene und erreicht<br />
auf auf diese Art und Weise möglicherweise die Neuverhandlung oder<br />
Erweiterung der Grenzen des Eigensinns.<br />
Franz Kapfer<br />
“Sieh-Dich-Für” oder: “My Home Is My Castle”, einmal umgekehrt<br />
Die Untersuchung von Klischeedarstellungen bildet die Grundlage für viele<br />
Projekte des in der Steiermark geborenen Künstlers Franz Kapfer. In seinen<br />
bildhauerischen Interventionen und auf Video, inszenierter Fotografie<br />
und Performance beruhenden Arbeiten werden in einem Akt der Herstellung<br />
der ganz persönlichen Privatmythologie des Künstlers – einem subjektiven<br />
Theater der männlichen Identität, da, in den Worten Roger M. Buergels,<br />
Kapfer „mit der dynamisierten Pose, der Maskerade oder der Dramatisierung<br />
seiner eigenen Erscheinung arbeitet“ 38 – antike und christliche Ikonografien<br />
einer Neubetrachtung unterzogen. Seine Kunstpraxis beruht auf einer Performativität,<br />
die auf die Tradition der Performancekunst und der Body Art<br />
der 1970er-Jahre verweist. Es finden sich auch Anklänge an die Poetik des<br />
mittelalterlichen Theaters und sie erinnert auch an die Figuren der Commedia<br />
dell‘ arte mit ihrer für das Bachtinsche Karnevaleske typischen Körperlichkeit,<br />
Groteskheit und ihrem so genannten „Realismus auf einer niedrigeren<br />
Ebene“. (Männliche) Körperpolitik und Sexualität stehen im Zentrum<br />
seiner kritischen Untersuchungen von Identitätsbildung (Gender-Diskurs),<br />
Gesellschaftsstrukturen (Faschismus, Familie) und Religion (Katholizismus),<br />
die er in Form einer Reihe von performativen Travestie-Tableaus zur<br />
Aufführung bringt. Indem er in Rollen aus der Mythologie oder der Weltgeschichte<br />
schlüpft, Rituale nachstellt und deren Symbolsprache hinterfragt,<br />
untersucht Kapfer die Darstellungsmuster, von denen unsere Vorstellung<br />
und Wahrnehmung der Welt geprägt ist. Mal als mythologischer Pan verkleidet,<br />
der seine Freundin verführen möchte, mal als Zentaur, der seiner
30 — 31<br />
Adam Budak<br />
Franz Kapfer<br />
Rom 2003, 2004<br />
Wunderwürdiges Kriegsund<br />
Siegs-Lager, 2008<br />
Tochter näher kommen möchte, aber immer wieder an ikonische Figuren aus<br />
der Welt der Mythen, Sagen und Legenden erinnernd, probt der Künstler<br />
auf offenbar selbstironische Art und Weise seine Vater- und Liebhaberrolle.<br />
Fruchtbarkeit, Sexualität, Liebe, Familie, Vaterschaft – dies sind die großen<br />
Themen aus Kapfers Repertoire, in dem Scheitern, Impotenz und Illusion<br />
quasi als Chor hinter der Bühne den Plot kommentieren. (Nicht nur) das<br />
mythologische Kostüm hilft dem Künstler, die falsche Seite der Wirklichkeit<br />
zu entlarven: indem er seiner Tochter im Video Zentaur (2004/5) „Höre, höre<br />
Tochter, alles ist Lüge“ ins Ohr flüstert; indem er die Binsenweisheit „Die<br />
Welt ist eine Bühne“ postuliert, während sein eigener Körper mit bildhauerischen<br />
Mittel neu gestaltet wird und in mimische Interaktion mit den Steinbildern<br />
des Brunnens auf dem Salzburger Kapitelplatz (1991) tritt, oder mit<br />
dem Denkmal von Kaiserin Elisabeth (1991) und dem St. Sebastian Friedhof<br />
(1991) in seiner Performance Festspiele; oder, indem er mit den Plastiken in<br />
Rom 2003 (2004) aus seinen skulpturalen Objekten ein trügerisches Idyll<br />
schafft, das - obwohl es auf Fruchtbarkeitssymbole der österreichischen Alpenwelt<br />
verweisen und italienische Glaskunst simulieren soll - zum Großteil<br />
aus weggeworfenen Plastikflaschen besteht, die er in Rom als Müll eingesammelt<br />
hat.<br />
Kapfers Theater ist ein Brecht’sches Theater. Gesellschaftskritik, Geschichte<br />
und Politik ergänzen das Themenspektrum, das auf der Bühne dieses<br />
Künstlers zur Aufführung gelangt. Seine Installation und Architekturintervention<br />
Wunderwürdiges Kriegs- und Siegs-Lager des Prinzen Eugen<br />
(2008/09), die er für das Obere Belvedere realisierte, vergrößert durch unterhalb<br />
aufgestellte große Spiegel einige der weniger gut sichtbaren Fragmente<br />
des Deckenfreskos im Marmorsaal, insbesondere jene, auf denen die<br />
von vier türkischen Sklaven erlebte Unterdrückung und deren Wehklagen<br />
dargestellt sind und welche neben den Allegorien der Tugenden des Prinzen<br />
die Zeit überdauert haben. Inmitten des herrlichen Interieurs errichtet,<br />
umreißt die scheinbar abstrakte minimale Struktur sowohl das Siegeslager<br />
des Prinzen als auch ein Türkenzelt. Kapfers Installation Trophäen (2010)<br />
ist eine Sammlung von skulpturalen Silhouetten von klischeehaften türkischen<br />
Motiven, wie sie in der österreichischen Architektur zu finden sind.<br />
Den Künstler interessieren die Überführungen von Ideen und die verborgenen<br />
Motive des Kulturapparates, wie sie etwa beim Status des Bildes in der<br />
heutigen Gesellschaft sowie bei der Konstruktion einer Symbolsprache der<br />
Repräsentation zum Ausdruck kommen.<br />
In der für die Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns<br />
realisierten Installation Sieh-Dich-Für untersucht Franz Kapfer die Eigenheiten<br />
der einheimischen Architektur des Ennstals. Auf Architektur wie<br />
Geschichte von Schloss Trautenfels verweisend, sowie auf einen seiner Besitzer,<br />
General Trauttmansdorff („Am liebsten experimentierte er, General<br />
Siegmund J. von Trauttmansdorff, ausgiebig in seinem militärischen ‚Labo-<br />
Franz Kapfer<br />
Trophäen , 2007<br />
Sieh-Dich-Für, 2010<br />
39<br />
Franz Kapfer: Sieh-Dich-Für,<br />
Projektbeschreibung.<br />
ratorium’, das er sich auf der Bastei hatte einrichten lassen. Durch seine<br />
spontanen Schießübungen und Probesprengungen erschreckte er die Bevölkerung,<br />
die zunächst mit einem anrückenden Feind rechnete, immer wieder”),<br />
und auch auf die so genannte Alpenfestung und deren historischen<br />
und ideologischen Hintergrund (am Toplitzsee experimentierte ab 1943<br />
das „Torpedolaboratorium” der Seemarine, gegen Ende des Krieges wurde<br />
das Ausseerland angesichts der unmittelbar bevorstehenden militärischen<br />
Niederlage als „Alpenfestung des Dritten Reiches“ propagiert 39 , führt der<br />
Künstler eine vergleichende Studie zu privaten wie öffentlichen Mustern der<br />
Raumorganisation durch und zeichnet Beziehungen nach zwischen auf der<br />
einen Seite militärischem Design (V2-Raketen, Minen, Bomben usw.) und<br />
Verteidigungsarchitektur (Burgbasteien und Befestigungen) und, auf der<br />
anderen, der Art und Weise wie die einheimische Bevölkerung ihre intimste<br />
und privateste Wohnumgebung gestaltet, inklusive Gartengestaltung<br />
und Landschaftsarchitektur der Umgebung. Die Wohnhäuser der Menschen<br />
mit ihren massiven hohen Zäunen, die aus dichter Vegetation herausragen,<br />
verwandeln sich hier in kleine Festungen und Tempel der Privatsphäre des<br />
in höchstem Maße beschützten Lebens; die gesamte häusliche Umgebung<br />
erinnert an eine Art „Gated Community“, eine gefängnisartige, eher aggressive<br />
und brutalistische, wenn auch sterile und elegante und von der<br />
sie umgebenden Welt abgekapselte Kleinbürgerwohnsiedlung. Kapfers<br />
theatralische Installation ist fürwahr eine Recherche der Bildung (einheimischer)<br />
Mentalität und Wahrnehmung, sowie des Wesens einer unterbewussten<br />
Referenz, von der die einheimische Wohnarchitektur beeinflusst<br />
ist. Seine Skulpturen von mauerartigen Zäunen und raketenartigen Thujen<br />
sind überzeugende Metaphern des Eigensinns – Monumente der Isolation,<br />
der Engstirnigkeit und des antikommunalen Geistes. Aufgestellt im Freien,<br />
auf einer der Terrassen des Schlosses, steht die monumentale Textskulptur<br />
Sieh-Dich-Für, die auf den eigentlichen Namen der Bastei verweist, für Franz<br />
Kapfers subjektive Definition von Eigensinn, und suggeriert die Unmöglichkeit<br />
von Kommunikation, Unzugänglichkeit und ein verzweifeltes Bedürfnis<br />
nach Unabhängigkeit und Emanzipation. Kapfer setzt sich hier ironisch mit<br />
„My home is my castle“ auseinander, einem an und für sich freundlichen,<br />
guten alten englischen Sprichwort, das hier aber doch pejorativ besetzt ist,<br />
als Sehnsucht nach Abtrennung und Entfremdung, nach Herstellung unsichtbarer<br />
abgeschlossener Welten, die weder Zugang noch Einblick bieten.<br />
Darüber hinaus liefert er noch einen kritischen Kommentar auf das noch<br />
immer präsente Erbe des Faschismus und dessen autoritären Denkmustern.<br />
Eindrucksvoll und triumphierend überblickt Kapfers Skulptur Sieh-Dich-Für<br />
die Landschaft und sieht der Bevölkerung ins Auge – als provokanter Ruf<br />
nach einem notwendigen Wandel.
34 — 35<br />
Simply Beautiful<br />
Über das Moment des Schönen<br />
im Werk von Lang/Baumann<br />
Christoph Doswald<br />
Im ästhetischen Diskurs der Jetztzeit herrscht ein merkwürdiges Misstrauen<br />
gegenüber dem Schönen, das sich im Wesentlichen auf die Paradigmen<br />
der Moderne zurückführen lässt. Verkürzt gesagt geht es um<br />
Fragen der Wirklichkeit, der Authentizität, der Wahrhaftigkeit und der<br />
Glaubwürdigkeit. Schönheit steht immer im Verdacht, diese normativen,<br />
aufklärungsmodernistischen Kriterien nicht zu erfüllen. Die schöne<br />
Oberfläche stellt zwar einen durchaus geschätzten gesellschaftlichen<br />
Wert dar, doch steht sie immer im Verdacht, die möglicherweise dahinter<br />
liegende wirkliche Wirklichkeit zu manipulieren, sie zu verfälschen und<br />
zu camouflieren. Bei der Beurteilung von Kunstwerken ist dieser Widerspruch<br />
noch ausgeprägter anzutreffen.<br />
1<br />
Lang/Baumann:<br />
Beautiful Book. Zürich:<br />
JRP | Ringier 2008.<br />
L/B<br />
Street Painting #1, 2003<br />
Môtier, Schweiz Marmorsaal um 1940<br />
Das aus der Schweiz stammende Künstlerpaar Sabina Lang (*1972) und<br />
Daniel Baumann (*1967), das unter dem Kürzel L/B firmiert, beschäftigt<br />
sich in seinem Werk häufig mit diesem Paradoxon des Schönen. Es gibt<br />
Beautiful Walls, Beautiful Windows, Beautiful Corners, Beautiful Entrances,<br />
den Beautiful Floor, die Beautiful Steps, das Beautiful Mezzanine,<br />
den Beautiful Carpet und die Beautiful Lounge – und schließlich auch ein<br />
Beautiful Book 1 , das diese seit 1991 andauernde Beschäftigung mit dem<br />
Schönen dokumentiert. Man könnte mittlerweile fast ein ganzes Gebäude<br />
mit den Versatzstücken dieser künstlerischen Tätigkeit errichten.<br />
In Marmorsaal von Schloss Trautenfels in der Nähe von Graz sollen nun<br />
weitere Kapitel dieses L/B-Schönheitsdiskurses geschrieben werden:<br />
Beautiful Steps #3, eine Skulptur in Form einer 12 Meter langen, leicht<br />
gekrümmten weißen Treppe, die horizontal über den Köpfen der Betrachter<br />
im Barocksaal schwebt. Und wie fast immer, wenn L/B das Thema<br />
Schönheit anpacken, geschieht dies mit einem architektonischen Echoraum<br />
- so auch bei den schönen Stufen, die sich im Milieu des feudalen<br />
Herrensitzes breit machen, ihre behauptete minimalistische Schönheit<br />
mit der herrschaftlichen Kulisse in Dialog bringen: ein Wort- und Formenwechsel<br />
zwischen barocken und modernistischen Ordnungssystemen.<br />
Allzu gerne möchte man sie beschreiten, diese formreinen Treppenstufen,<br />
die in den farbüberladenen, elysischen Himmel zu führen versprechen;<br />
man möchte den Boden der Realität verlassen: schwebend, träumend,<br />
lustwandelnd, sich der Verführungskraft hingebend, auf Augenhöhe mit<br />
Göttern und Engeln.
36 — 37<br />
L/B<br />
Stiegentür in Schloss<br />
Trautenfels, Manfred<br />
Wolff-Plottegg<br />
Dass bei solchen Verlockungen durch das Schöne immer irgendwo der<br />
Absturz lauert, ist ein kulturgeschichtlicher Topos, der sich in unser tiefstes<br />
Unterbewusstsein eingebrannt hat. Besonders deutlich wird das bei<br />
jener Skulptur, die L/B als Beautiful Steps #5 an die Außenwand eines<br />
rund laufenden Eckturms von Schloss Trautenfels applizieren. Im Obergeschoss<br />
des Turms erschließen zwei Treppen, die durch bestehende Außenfenster<br />
geführt werden, einen um die Außenfassade laufenden Steg.<br />
Die Treppenaufgänge sind begehbar, sodass für Besucher des Schlosses<br />
der Eindruck entstehen muss, auch der Steg könne benutzt werden. Ein<br />
Irrtum: Der umlaufende Steg hat kein Geländer und ist in Leichtbauweise<br />
gefertigt, sodass die Konstruktion höchstens eine symbolische Tragfähigkeit<br />
aufweist. Simply beautiful. Schön, aber nicht benutzbar.<br />
Eingangsbereich Schloss Trautenfels<br />
mit architektornischen Elementen<br />
von Manfred Wolff-Plottegg<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #5, 2010<br />
(Rendering Innenansicht)
38 — 39<br />
L/B<br />
Doppelwendeltreppe in der Grazer Burg, um 1500
40 — 41<br />
L/B<br />
2<br />
Vgl. hierzu das Projekt<br />
Höhenrausch, das im<br />
Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms<br />
über den Dächern von<br />
Linz 2009 realisiert<br />
wurde.<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #3, 2010<br />
(Fotomontage, Marmorsaal)<br />
Beautiful Steps #3, 2009<br />
Le Confort Moderne, Poitiers<br />
Mit Gegenwartskunst vertraute Betrachter mögen sich dieser Frage der<br />
Benutzbarkeit differenziert nähern. Denn es gab ja bereits komplette<br />
Ausstellungen, die sich mit der Rekontextualisierung von Museen oder<br />
Ausstellungsräumen beschäftigt haben, oder die mit einer Perspektiven-<br />
Verschiebung nach oben dem White Cube aus luftiger Höhe einen neuen<br />
Blickwinkel zu verleihen versuchten. 2 Beautiful Steps #5 ist jedoch keine<br />
begehbare Skulptur, die nach Benutzbarkeit verlangt, sondern eine<br />
Intervention, die auf subtile und vielfältige Weise mit unserer Vorstellungskraft<br />
spielt: Theaterkulisse, Architekturdiskurs, Design-Tourismus,<br />
Freizeitgesellschaft, Jugendkultur, Zukunftsgläubigkeit, Retrovision -<br />
um diese Ambivalenz der Wahrnehmungen, um diese Ausdifferenzierung<br />
im post-postmodernen Bewusstsein geht es bei den vordergründig so<br />
spektakulären archiskulpturalen Interventionen, die L/B unter dem Deckmantel<br />
des Schönen in unsere Welt bringen.
42 — 43<br />
L/B<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #2, 2009<br />
11. Schweizerische Plastikausstellung,<br />
Stadt Biel-<br />
Bienne<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #4, 2009<br />
Le Confort Moderne, Poitiers
44 — 45<br />
L/B<br />
L/B<br />
Comfort #3, 2005<br />
KBB, Barcelona<br />
L/B<br />
Comfort #6, 2008<br />
Madrid
46 — 47<br />
L/B<br />
Diving Platform, 2005; Marks Blond Project, Bern<br />
L/B<br />
Spielfeld #2, 2004; Zollkanal Speicherstadt, Hamburg
50 — 51<br />
Ein Glashügel und beleuchtete Kreuzungen<br />
Tomáš Pospiszyl<br />
I<br />
Einige von Kateřina Šedás Projekten verströmen ein besonders rustikales<br />
Flair: Sie behandeln nicht die aktuellsten globalen Themen, sondern<br />
beziehen sich auf Individuen und Gemeinschaften, die wahrscheinlich<br />
normal scheinen, alltäglich und marginal. Sie interagieren mit Orten, die<br />
die dramatischste Periode ihrer Existenz schon hinter sich haben: das<br />
kleine staubige Dorf Ponětovice, die nicht besonders beeindruckende<br />
Gegend von Líšeň oder das vergessene ostdeutsche Loch Uhyst, aus dem<br />
jeder, der etwas aus seinem Leben machen wollte, längst weggezogen<br />
ist. Wenn es etwas gibt, das diese Orte verbindet, ist es ihre besondere<br />
posttraumatische Situation. Es sind Orte, die jeweils in einer bestimmten<br />
Situation aufgebaut wurden, die sich in der Zwischenzeit substanziell<br />
verändert hat. Die politischen Regime haben sich dabei ebenso geändert<br />
wie die Art des Lebensunterhalts und des beidseitigen Kommunizierens;<br />
Zivilisationszyklen wurden ausgewechselt. Als Generatoren des europäischen<br />
Wohlstandes sind Dorf und Landwirtschaft seit Langem ersetzt<br />
worden. Nicht sosehr durch die Industrie, sondern durch eine abstrakte<br />
Dienstleistungsökonomie und die unklaren Regeln der Weltwirtschaft.<br />
Das sozialistische Wohnungsprojekt, das Dorf und die Kleinstadt müssen<br />
sich mit einer Zeit arrangieren, die sich von jener, in der sie geformt wurden,<br />
vollkommen unterscheidet.<br />
Die Situation, dass Menschen noch immer mit einem Fuß in der Vergangenheit<br />
leben, mag für das postkommunistische Europa typisch erscheinen.<br />
In dieser Hinsicht ist der österreichische Ort Trautenfels keine<br />
Ausnahme. In Osteuropa sind die neuen sozialen Konstellationen nach<br />
Jahrzehnten der Stagnation nur umso sichtbarer. Sogar in einem österreichischen<br />
Tal wird das Leben seit Langem von der Tourismusindustrie,<br />
und nicht von der Landwirtschaft diktiert.<br />
II<br />
Die Kunst ist ein Werkzeug, das die Veränderungen der Welt einfangen<br />
kann. Es macht – manchmal unabsichtlich oder als Nebenprodukt – die<br />
Beziehung zwischen Mensch und Natur und seiner Umgebung sichtbar.<br />
Die Kunstgeschichte hat aufgezeigt, auf welche Art Künstler wie z.B.<br />
Jean-François Millet, Gustave Courbet oder die Impressionisten des 19.<br />
Jahrhunderts den Wandel in der menschlichen Naturwahrnehmung bildlich<br />
darstellten. Durch die moderne Art zu leben spielte die Landschaft<br />
nicht nur für die Existenzgrundlage eine Rolle, sondern wurde auch zu<br />
einem Ort der Kontemplation, zu einem Hilfsmittel der menschlichen<br />
Subjektivität. Die zuvor genannten Künstler leisteten nicht mehr oder<br />
weniger, als in der Landschaft zum ersten Mal das zu sehen, was ihre<br />
Vorgänger immer noch nicht sehen konnten. Die Beziehung zur Natur<br />
ist nicht länger das dominierende Element der menschlichen Existenz.<br />
Wesentlich mehr Macht über sie hat etwas, das wir soziale Natur nennen<br />
können. Dennoch widerspiegeln die von Menschen besiedelten Landschaften<br />
ihre Zivilisation akkurat. Vorstadtbauten, Industrieanlagen oder<br />
sogar ein Blick auf Hochspannungsleitungen symbolisieren perfekt die<br />
Beziehungen und Werte einer Gesellschaft, die diese verwendet. Diese<br />
Gesellschaft ist von zentralisierten Energieressourcen und von Mobilität<br />
abhängig. Die Landschaft wird von einer Geometrie der Straßen durchdrungen,<br />
die – im Gegensatz zu jenen der Vorzeit – von völlig neuen Gesetzen<br />
regiert werden. Autobahnen, Überführungen oder Kreisverkehre<br />
haben klar definierte Transportfunktionen. Wir können sie aber als Metaphern<br />
der Funktionsweise der Gesellschaft wahrnehmen – als irrationale<br />
Symbole bisher unbekannter moderner Religionen.
52 — 53<br />
Kateřina Šedá<br />
III<br />
Kateřina Šedá gibt zu, dass sie die Organisatoren von Ausstellungen<br />
wohl manchmal zur Verzweiflung treibt. Man kann schwer abschätzen,<br />
wie lange sie an dem neuen Projekt gearbeitet hat. Sie weiß nicht, wann<br />
genau es ihr gelang, einen Weg zu finden, um auf diese neue Herausforderung<br />
zu reagieren. Dazu kommt, dass Trautenfels ein idyllischer Ort<br />
ist. Die Einwohner selbst tun sich schwer, etwas zu benennen, das sie<br />
gerne geändert hätten. Als ob das Ausmaß dessen, was in ihrem Leben<br />
veränderbar ist, bereits vom großen Grimming ausgefüllt wird, der für<br />
jeden Tag und jede Jahreszeit ein eigenes, besonders wandelbares Licht<br />
aufweist.<br />
Zuerst ließ Šedá die Einheimischen das zeichnen, was hinter dem Hügel<br />
liegt, auf dem Schloss Trautenfels steht. Aufgrund der Erfahrungen in<br />
ihrem Heimatland erwartete sie, dass der Hügel als ein Hindernis wahrgenommen<br />
würde und die Einheimischen nur eine dunkle Ahnung von der<br />
Welt hinter ihm haben. Es zeigte sich aber, dass der Hügel ein natürlicher<br />
Teil des Lebens der Einwohner von Trautenfels ist. Er repräsentiert<br />
keine physische Barriere, sondern einen Punkt, der Menschen aus den<br />
umliegenden Gegenden verbindet. Es ist, als könnten sie ganz bis zum<br />
Tal hinüber sehen. So als wäre der Hügel aus Glas. Aber was kann man<br />
als Malerin mit einer Landschaft anfangen, die transparent wie Glas ist?<br />
In ihr kann man nichts sehen.<br />
Der Kreisverkehr, der im Zuge der Vorbereitungen für die Ski-Weltmeisterschaft<br />
in Schladming geplant ist, hat die Atmosphäre im Dorf radikal<br />
verändert. Mit einer Breite von 60 Metern wird er die größte Konstruktion<br />
dieser Art in Österreich sein – und wird die Stadt förmlich in mehrere Segmente<br />
zerteilen. Der geplante Kreisverkehr machte plötzlich das ganze<br />
Dorf, seine Gemeinschaft und Lebensweise sichtbar.<br />
IV<br />
Kateřina Šedá strebt nicht nach seichtem politischem Aktivismus, der<br />
danach bewertet werden kann, wie sehr durch ihn die Welt korrigiert<br />
wurde. Das ist das Ziel der Politik, die Šedá von der Kunst zu unterscheiden<br />
weiß. Ihr Ziel ist scheinbar simpler und doch in seiner Schwierigkeit<br />
nahezu undurchführbar: Die Entstehung von Leben zu sehen und dann an<br />
andere weiterzureichen. Diese Herangehensweise lässt an das mittelalterliche<br />
Konzept der Illumination denken, dem Zustand der Erleuchtung,<br />
der Fähigkeit, plötzlich die Wahrheit zu erkennen. Die Offenbarung der<br />
Welt ist an ihr Verständnis geknüpft. Die Einzigartigkeit der Kunst, im<br />
Gegensatz zur Landläufigkeit der Politik, liegt in einer ähnlich kreativen<br />
Epistemologie, in der Fähigkeit, Phänomene wahrzunehmen, die vorher<br />
nicht sichtbar waren. Das ist die erste Voraussetzung, um die Welt bewerten<br />
und gegebenenfalls korrigieren zu können.<br />
Der Kreisverkehr, der ohne große Warnung mitten in Trautenfels auftauchte,<br />
hat etwas gemeinsam mit der Schicksalshaftigkeit von Seuchen<br />
oder Springfluten. Die moderne Zivilisation produziert hier so etwas wie<br />
einen Berg aus Beton und Asphalt, einen Punkt, nach dem die Einwohner<br />
von Trautenfels die Hand ausstrecken müssen. Ihre Zeichnungen des geplanten<br />
Kreisverkehrs lassen an die Berichte von Menschen erinnern, die<br />
versuchen, ihre Begegnungen mit außerirdischen Unbekannten weiterzugeben,<br />
mit einer höheren Ordnung, deren Kraft der Monumentalität jener<br />
der umliegenden Alpen ähnelt. Die Sammlung dieser Bilder ist nicht der<br />
Versuch einer Art von Kunst-Petition zum Stopp eines unsensiblen Bauprojekts,<br />
sondern ein vergeblicher Versuch, das Problem schon vorher so<br />
zu zeichnen, dass es gerade durch seine Darstellung gelöst wird.
1, Sonja Pichler 5, Gertrude Schwaiger<br />
12, Stefanie Harreiter 15, Reinhold Schirl<br />
21, Monika Kogler 22, Florian Kogler<br />
44, Christiane Tasch 55, Alois Brettschuh<br />
6, Sabine Geier 9, Selina Winterer<br />
17, Markus Maurer 18, Carmen Fladl-Schachner<br />
32, Johanna Leyendecker 33, Silvia Fercher<br />
58, Annika Hofer 63, Anna-Lena Kanzler
65, Julian Schmied 73, Karl Bindlechner<br />
89, Helene Kreutzer 93, Alois Perl<br />
110, David Wieser<br />
133, Silvia Kolb 139, Maria Kreisel<br />
82, Gerhard-Thomas Posch<br />
95, Manuela Zeiringer 100, Johann Karl<br />
123, Dominik Gastel 130, Gerald Habeler<br />
141, Thomas Klingler
148, Lena Gasteiner 152, Markus Mößlberger<br />
164, Helmut Krasa 172, Marigona Rexhaj<br />
181, Julia Ritt<br />
188, Stefanie Haigl 198, Patrick Schranz<br />
155, Melanie Resch 157, Roswitha Kals<br />
174, Patricia Kleewein 177, Daniela Auritsch<br />
185, Nada Huber 186, Michaela Ulz-Schirl<br />
200, Alexandra Danglmaier 203, Peter J. Gragabber
Bild aus der Überlappung der Zeichnungen Nummer 9, 44, 46, 49, 51, 54, 55, 62, 65, 73, 74, 76, 135
66 — 67<br />
Für immer Parken<br />
Jennifer Allen<br />
Was haben alle Reisenden gemeinsam? Sie müssen einen Schlafplatz<br />
finden, sei es für eine Nacht, eine Woche oder ein Monat. Der zeitgenössische<br />
Reisende sieht sich mit einem weiteren Dilemma konfrontiert, das<br />
durch das Finden eines Hotelzimmers nicht gelöst ist. Reisen ist heutzutage<br />
nicht nur häufiger, sondern auch standardisierter geworden. Dieser<br />
Standardisierungsprozess, der mit der Einführung der Zeitzonen im letzten<br />
Jahrhundert seinen Anfang nahm, wurde durch den internationalen<br />
Flughafen, der jede Flugerfahrung der anderen gleichen lässt, intensiviert.<br />
Anders als frühere Reisende, die unterwegs immer auf Abenteuer<br />
eingestellt waren, erwarten wir, dass die Abenteuer erst beginnen, wenn<br />
wir unsere Destination sicher erreicht haben. Am Besten sollte während<br />
einer Reise gar nichts passieren, das über die Bewegung hinausgeht. Die<br />
Taxis sollten pünktlich sein, der Flug ruhig, und das Gepäck sollte so wieder<br />
auftauchen, wie wir selbst es bei der Ankunft tun: von der Ortsveränderung<br />
unberührt. Doch wenn die Zeit zunimmt, die wir unterwegs und in<br />
der Luft verbringen, führt unser Wunsch nach ereignislosem Reisen dazu,<br />
Erfahrung und Erinnerung auszulöschen. Die Architektur und das Design<br />
von Massenmobilität – Wartehallen, Gepäckrollbänder, Taxistände, Parkplätze,<br />
Hotelzimmer – widerstehen den Spuren jener Menschen, die sie<br />
benutzt haben. Wir verbringen mehr Zeit im Übergangsstadium – das<br />
bewohnend, was Marc Augé „Nicht-Orte“ nannte – und produzieren mehr<br />
und mehr – sowohl kollektive als auch individuelle – „Nicht-Geschichte“.<br />
Was viele Reisende heute teilen, ist fortwährende Bewegung ohne Erinnerung.<br />
Für immer Parken<br />
Maria Papadimitriou befasst sich mit diesem Dilemma auf zwei Arten.<br />
Erstens zielen Papadimitrious Arbeiten auf den Reisenden ab, indem<br />
sie die Architektur und das Design der Massenmobilität reproduzieren.<br />
Maria Papadimitriou<br />
Hotel Grande, 2005<br />
Altstadt von Larissa, Griechenland<br />
Das Hotel, das Auto, der Bahnhof – allzeit benutzbar – können in ihrem<br />
interaktiven Oeuvre eine Rolle spielen. Zweitens fügt Papadimitriou<br />
jedem Schauplatz tragbare Formen des Gedächtnisses hinzu. Diese<br />
Formen des Gedächtnisses sind kein Touristenplunder, sondern eher<br />
„Memoria-Kram“, den jeder so leicht mit sich führen kann wie ein Lied.<br />
Songs, Träume, Geschichten und Bräuche werden als mnemotechnische<br />
Praktiken in ihre Interventionen integriert: Hilfsmittel, die es Reisenden<br />
ermöglichen, sich der Vergangenheit zu besinnen und die Gegenwart<br />
zu erinnern. Im Jahr 2003 lud Papadimitriou am Bahnhof von Modena,<br />
von dem aus Züge zum Arbeitervorort Sassuolo fahren, den Chor Coro<br />
popolare di San Lazzaro ein, im Wartesaal kommunistische Revolutionslieder<br />
und erotische Stücke zu singen – Musik, die sowohl vergangene<br />
als auch gegenwärtige Anstrengungen und Freuden der pendelnden<br />
Arbeiter harmonisierte. In einem Athener Migrantenviertel verwandelte<br />
Luv Car (Transbonanza Platform for Public Events) – ein mit Tanzboden<br />
und einer Soundanlage ausgerüsteter Pick-up – im Jahr 2003 internationale<br />
Passanten in tanzende Passagiere und ließ Popsongs aus aller<br />
Welt ertönen. Letztes Jahr errichtete die Künstlerin ein provisorisches<br />
Kino an einer Tankstelle am aus Larissa hinausführenden Highway und<br />
zeigte Alexis Damianos’ Filmklassiker über griechische Emigration, Until<br />
the Ship Sails (1966); ein Stop an der Tankstelle konnte hier plötzlich<br />
mit anderen kollektiven historischen Reisen verbunden werden. In einem<br />
tropischen Garten der Villa Olimpica in Puerto Rico schuf Papadimitriou<br />
2004 Hypothesis 2, The Soul Message Formula (Illumina tus sueños,<br />
Amphiareion 04), ein Heilungszentrum, das vom griechischen Halbgott<br />
Amphiaraos, der auch Orakel und Heiler war, inspiriert wurde. Menschen,
68 — 69<br />
Maria Papadimitriou<br />
Maria Papadimitriou<br />
Temporary Office, 2004<br />
Fondazione Adriano<br />
Olivetti, Rom<br />
T.A.M.A., 2005<br />
die auf den provisorischen Betten unter freiem Himmel schliefen, konnten<br />
ihre Träume erhellen und gleichzeitig mythologische Praktiken des<br />
alten Griechenlands wiederbeleben. In diesen Interventionen erschafft<br />
Papadimitriou nicht nur einen Übergangsort für Menschen in Bewegung,<br />
sie bietet ihnen auch die Gelegenheit, ihre Erfahrung des Ortes einer Erinnerung<br />
aus der Vergangenheit einzuschreiben. Der „Nicht-Ort“ – egal<br />
ob Bahnhof oder Tankstelle – markiert eine außergewöhnliche Begegnung<br />
mit der Geschichte.<br />
Homer als Architekt<br />
Papadimitrious Antwort auf das Dilemma eines Lebens in ständiger<br />
Bewegung – Strukturen für die Mobilität und die Erinnerung zu kreieren<br />
– beinhaltet das Schaffen eines neuen Gleichgewichts zwischen<br />
Architektur und Eigentum. Um sicherzugehen, dass ihre Arbeiten von<br />
allen benutzt werden können, bevorzugt Papadimitriou Schauplätze, die<br />
dem Besessenwerden von nur einer Person widerstehen – Orte, die so<br />
kollektiv bleiben wie Sinnsprüche, Legenden und Volkslieder. Tatsächlich<br />
behandelt die Künstlerin Gebäude so, als wären sie Oral History: kollektiv<br />
besessen, immer verfügbar, durch Zirkulation überdauernd. Diese<br />
Vorliebe, Architektur wie Mythologie funktionieren zu lassen, hat einen<br />
direkten Einfluss auf Papadimitrious architektonische Designs. Während<br />
Reisende ihre idealen Benutzer darstellen, heißen ihre Arbeiten nicht nur<br />
Touristen und Geschäftsleute willkommen, sondern auch Pendler, Passanten,<br />
Wanderarbeiter und sowohl legale als auch illegale Migranten.<br />
Ihr bisher ambitioniertestes Projekt T.A.M.A., das sie 1998 startete und<br />
das noch immer läuft, verwandelt ein Zigeunerlager am westlichen Rand<br />
Athens in ein Temporäres autonomes Museum für alle (Temporary Autonomous<br />
Museum for All), in dem rumänische Nomaden mit Nomaden<br />
aus der Kunstwelt zusammenarbeiten können. Um universale Zugänglichkeit<br />
zu garantieren, bevorzugt die Künstlerin die öffentliche Sphäre<br />
– nicht genutzte Parzellen im Verbund mit Parks, Straßen, Museen – ihre<br />
Strukturen hingegen sind meist temporär, mobil und parasitisch, um der<br />
Verwandlung in nicht exklusives privates Eigentum von Anfang an zu<br />
widerstehen. Hotel Grande (2005) – ein Hotel, das in einem verlassenen<br />
Geschäft installiert wurde und rund um die Uhr für Reisende, die in Larissa<br />
Halt machten, offen stand – ist ein gutes Beispiel. Ihre Baumaterialien<br />
– billig, gefunden, second-hand – sind Ready-mades, die nicht in<br />
Gefahr kommen, abtransportiert zu werden, egal ob von Dieben, Vandalen<br />
oder der Müllabfuhr. Mit dieser Materialwahl erforscht Papadimitriou<br />
die seltsame Kategorie des Mülls: Dinge, die in einer Spannungslage existieren,<br />
da sie nicht mehr wirklich benutzt werden, aber auch noch nicht<br />
weggeworfen wurden. 2004 sammelte Papadimitriou den Müll, der im<br />
Keller der Fondazione Adriano Olivetti in Rom herumstand – altes Bürozubehör,<br />
darunter Olivettis eigene altmodische, aber voll funktionsfähige<br />
Maria Papadimitriou<br />
Luv car (Transbonanza Platform for Public Events), 2003, Menidi, Athen
70 — 71<br />
Maria Papadimitriou<br />
Computermodelle, Schreibmaschinen, Faxgeräte – und schuf ein temporäres<br />
Büro im Ausstellungsraum der Fondazione. Papadimitriou belebte<br />
die erloschene Geschichte von Olivetti und machte diese Vergangenheit<br />
gleichzeitig zu einem öffentlichen Sekretariat, in dem Touristen auf ihrem<br />
Weg von der oder zur nahen Piazza Navona sich ausruhen, reorganisieren<br />
oder vielleicht eine Postkarte auf einer originalen Schreibmaschine<br />
schreiben konnten. Hier wird die Vergangenheit weder zu einem Objekt<br />
noch zu einem Spektakel; die Reisenden nehmen die Erfahrung mit, wie<br />
es denn ist, die Gegenwart mit den Mitteln der Vergangenheit zu schreiben.<br />
Ihnen gehört der architektonische Ort, nicht durch Verdienst oder<br />
Titel, sondern durch die Praxis der Benutzung der Geschichte des Orts.<br />
Bei What do we Really Remember? (2003) bestand der Müll aus einem<br />
aufgegebenen Brunnen im Hof eines ehemaligen Dominikaner-Klosters,<br />
das jetzt das Rathaus von Sternatia, Magna Graecia, ist. Menschen, die<br />
den Hof betraten, lösten Bewegungssensoren aus, die eine Aufnahme<br />
traditioneller griechischer Lieder – gesungen von einem örtlichen Jugendchor<br />
– einschaltete, die im ausgetrockneten Brunnen versteckt war.<br />
Wenn die Besucher dann in den Brunnen blickten, lösten sie weitere Sensoren<br />
aus, die die Musik leiser werden ließ. Der leere Brunnen füllte sich<br />
mit lokaler musikalischer Geschichte, die von den Körpern der Besucher<br />
ein- und ausgeschalten wurde. In Papadimitrious Arbeiten – wo Müll auf<br />
Mythos trifft – verschlechtert die öffentliche Benützung die Geschichte<br />
nicht, noch tilgt sie sie, vielmehr bringt sie Erneuerung und Dauerhaftigkeit.<br />
Zirkulierende Geschichten<br />
Für die Ausstellung Less (2006) im Padiglione d’Arte Contemporanea<br />
in Mailand schuf Papadimitriou ihre eigene Version eines mongolischen<br />
Ger-Zelts, um Mobilität und Gedächtnis als eine Strategie für alternatives<br />
Leben neu zu überdenken. Das runde Zelt mit einem Loch im Dach<br />
und einer Tür ist das tragbare Heim der mongolischen Hirten; dieselbe<br />
Struktur – bekannt als Jurte – wird von nomadischen Hirten in ganz Zentralasien<br />
verwendet. Seine Stärken liegen in seinen gebogenen Scherengitterwänden,<br />
die auf Hängen stehen und starken Winden widerstehen<br />
können. Seine Bedeutung wird in der Flagge Kirgistans demonstriert,<br />
die den Dachring des Zelts zeigt; die Geschichte einer Familie kann an<br />
den Rauchmalen, die sich rund um den Ring über die Jahre angesammelt<br />
haben, gemessen werden. Der Ger und die Jurte – leicht zu transportieren<br />
und schnell zu bauen – sind nicht nur ein Lebensstil, sondern für die Nomaden<br />
in Zentralasien auch eine Art gelebter Geschichte. Inspiriert von<br />
der Tradition dieser Zelte, erlebte Papadimitriou ein Ger nahe bei sich zu<br />
Hause in Athen während einer Reiki-Behandlung. Diese natürliche Heilmethode,<br />
bei der Energie mit den Händen des Heilers durch den Körper<br />
des Patienten gechannelt wird, ist uralt und wurde im späten 19. Jahr-<br />
Maria Papadimitriou<br />
Hotel Grande, 2005<br />
Maria Papadimitriou<br />
My Yurt, 2006, PAC, Mailand
Grimmingtor Grimming/Olymp<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpin Altar, 2010<br />
(Recherchematerial)<br />
Paula Grogger<br />
Das Grimmingtor, 1926<br />
hundert vom japanischen Minister Dr. Mikao Usui wiederentdeckt. Wie<br />
auch die nomadische Kultur, lebt Reiki durch orale Tradition; seine Geschichte<br />
wurde mündlich überliefert, und alle, die es praktizieren, müssen<br />
von Meistern ausgebildet werden, die ihrerseits von alten Meistern<br />
ausgebildet wurden. Papadimitrious eigene Heilungserfahrung ist Teil<br />
einer menschlichen Kette, die bis zu Dr. Usui zurückreicht. Wenn auch<br />
der Ger keine Rolle in dieser Geschichte spielt, wurde er doch Teil der<br />
Gegenwart des Reikis, da viele Heiler die runde Form des Zelts, das keine<br />
Ecken und keine Stützpfosten im Zentrum aufweist, schätzen. Um diese<br />
nomadischen Geschichten zu kombinieren – der Ger als Heim von Hirten<br />
und Reiki als Weg, die Körperenergie zu bewegen – hat Papadimitriou<br />
ihren Ger mit Polstern und Teppichen ausgestattet, sodass Reisende sich<br />
niederlegen, relaxen und Energie tanken können. Und um deren mündliche<br />
Erinnerungen zu erfrischen, hat die Künstlerin den Ger um Erzählungen<br />
sowie um Aufnahmen von traditionellen Geschichten auf Italienisch,<br />
Englisch und Türkisch ergänzt. Dort zu liegen und zuzuhören ist eine<br />
Einladung, mit Geschichte als eine Erfahrung zu leben, etwas, das weder<br />
angefasst, noch besessen werden kann, aber durch Zirkulation gedeiht.<br />
Alpiner Altar<br />
In der Steiermark stellt der Grimming mit seiner eigensinnigen Immobilität<br />
eine neue Herausforderung für sich bewegende Erinnerungen dar.<br />
Für die Ausstellung Der schaffende Mensch brachte Papadimitriou ihre<br />
Heimat Griechenland und ihr Gastland Österreich zusammen und baute<br />
aus Steinen vom Grimming einen traditionellen griechischen Altar. Weit<br />
von einer einfachen Mischung entfernt – ein antiker griechischer Brauch,<br />
der mit zeitgenössischer österreichischer Landschaft verschmolzen wird<br />
– legt Papadimitrious Geste eine tiefere Verbundenheit zwischen den<br />
beiden Ländern frei. Der Olymp – Heimstätte der zwölf olympischen Götter<br />
der Antike – ist der höchste Gipfel in Griechenland und der Grimming<br />
einer der höchsten in der Steiermark. Doch das sind nicht die einzigen<br />
Ähnlichkeiten zwischen Olymp und Grimming nicht. Jacob Grimm zeigt in<br />
seiner Studie Deutsche Mythologie (1835), dass der Name Grimming auf<br />
das slawische Wort germnik und das altslawische gr‘mnik zurückgeführt<br />
werden kann, was in modernem Deutsch soviel heißt wie „Donnerberg“.<br />
Natürlich war der Herrscher des Olymps kein Geringerer als Zeus, der<br />
Gott des Donners und des Wetters, des Gesetzes, der Ordnung und des<br />
Schicksals. Kurz gesagt: Der Grimming ist der Berg Zeus’.<br />
Wie Sir James Frazer in The Golden Bough (1890-1915) bemerkt, wurde<br />
Zeus am Olymp und anderswo unter dem Beinamen „Donnerkeil“ verehrt,<br />
während einige Statuen den Gott einen Blitzstrahl haltend zeigen. Quer<br />
durch die europäischen Mythologien – vom griechischen Zeus zum römischen<br />
Jupiter, vom nordischen Gott Thor zum litauischen Perkunas, vom
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar, 2010<br />
(Recherchematerial)<br />
keltischen Drynemetum zum germanischen Donar bzw. Thunar – wurde<br />
der Gott des Donners immer mit der Eiche assoziiert. Tatsächlich war die<br />
heilige Eiche, die der heilige Bonifaz im 8. Jahrhundert in Fritzlar fällte,<br />
um Heiden zum Christentum zu bekehren, auf Latein als robur Jovis<br />
(Jupiters Eiche) und im Altgermanischen als Donares eih (Donars Eiche)<br />
bekannt gewesen. Während allerdings der heidnische Kult sein Ende<br />
fand, als der Donnergott den heiligen Bonifaz für das Fällen des heiligen<br />
Baumes nicht mit einem Blitz erschlug, lebt die Tradition der Verehrung<br />
des Gottes im Namen des Wochentages Donnerstag weiter. Der Name<br />
Grimming widerhallt schon durch das Fortschreiten der Zeit. Über diese<br />
philologischen und mythologischen Verbindungen zwischen Olymp und<br />
Grimming hinaus, belebt Papadimitrious Altar ritualistische Praktiken in<br />
Griechenland und Österreich wieder. Wie sich Sir Frazer erinnert, verehrten<br />
die alten Griechen Zeus nicht nur in Orakel-Eichen, sondern auch an<br />
Orten, an denen der Blitz eingeschlagen hatte, da man von Zeus wusste,<br />
dass er blitzartig von den Himmeln auf die Erde herabstieg. Diese Orte<br />
– von Hohepriestern abgeschlossen und geweiht – wurden mit Altären<br />
für Opfer ausgestattet, die dann womöglich Zeus’ Zornesausbrüche samt<br />
Donner und Blitz besänftigt und gleichzeitig die befruchtende Kraft des<br />
Regens angelockt haben. Der Grimming als einer der höchsten Gipfel der<br />
Steiermark wäre wiederum ein Ort, der bei einem Gewitter am leichtesten<br />
vom Blitz getroffen würde, genau wie sein Korrelat, der Olymp. Sir Frazer<br />
bemerkt, wie alte germanische Mythen dem Donnergott ähnliche Fruchbarkeitskräfte<br />
zuschrieben, aber es findet sich keine Erwähnung von<br />
Altären oder Opfern. Und doch taucht der Grimming in österreichischen<br />
Legenden als heiliger Berg auf, in dem ein Goldschatz und kostbare Juwelen<br />
versteckt sind: Symbole für Wohlstand. Solche Legenden könnten<br />
die narrativen Überreste von Oper- und Fruchtbarkeitsritualen aus vorchristlicher<br />
Zeit sein: als Praktiken tot, aber in Geschichten lebendig.
76 — 77<br />
Maria Papadimitriou<br />
Maria Papadimitrious Aufruf an die Bevölkerung<br />
anlässlich des Ennstaler Schafbauerntags in Öblarn, 19./20. März 2010<br />
Rituale sind mit Bewegung verbunden. Die alten Griechen konnten zu<br />
Altären reisen und Zeus ein Opfer darbringen, zum Beispiel ein Schaf<br />
töten, in der Hoffnung auf weniger heftige Stürme und mehr sanfte<br />
Regenschauer. Die Steirer haben die alte Verehrung ihres Donnergottes<br />
und seines Berges womöglich in ihre Wanderungen überführt. Gesundheitsfördernde<br />
Wanderungen sind vielleicht die lebende Erinnerung an<br />
alte Pilgerreisen zum Berg: zuerst des Opfers und dann der Schatzsuche<br />
wegen. Wie Papadimitriou beobachtet hat, gibt es viele Einheimische<br />
rund um den Grimming, die Miniatur-Puppenschafe vor ihren Häusern<br />
zur Schau stellen – vielleicht Mementos von lebendigen Opfertieren, die<br />
einst geschlachtet wurden, um den Gott des Donners gnädig zu stimmen.<br />
In vielen Legenden, die sich um den Grimming ranken, heißt es von vielen,<br />
die nie mehr von ihren Wanderungen zurückkehrten, sie hätten den<br />
magischen Eingang gefunden, wären aber nun im Berg gefangen, weil sie<br />
mehr Gold und Juwelen mitnehmen wollten, als sie tragen konnten. Bitte<br />
einen Gott nie um zu viele Gefallen. Im Lichte dieser Erinnerungen erscheint<br />
der Grimming als riesiger Altar zu Ehren des Donnergottes – ein<br />
Altar, der nicht nur von wandernden Pilgern besucht wird, sondern auch<br />
immer wieder einige von ihnen als menschliche Opfergaben verschluckt,<br />
die wiederum eine Spur an Legenden zurücklassen. Papadimitrious Altar,<br />
wie griechisch er auch immer sein mag, scheint die Steirer an das zu erinnern,<br />
was sie schon immer getan haben.<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar, 2010, (Recherchematerial)
79 — 9
82 — 83<br />
1<br />
Georges Didi-Huberman:<br />
Ninfa moderna. Berlin,<br />
Zürich: Diaphanes 2006,<br />
S. 15f.<br />
2<br />
Ebda., S. 23.<br />
3<br />
Ebda., S. 27, sowie<br />
Gilles Deleuze: Die Falte.<br />
Leibniz und der Barock.<br />
Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp 1995, S. 199.<br />
Der Stoff, aus dem die Kunst ist<br />
Christian Philipp Müllers Eigensinn<br />
André Rottmann<br />
In seinem Essay zum anachronistischen Nachleben des faltenwerfenden<br />
Gewands, das in der Antike einst die Nymphe trug, bevor es in den Allegorien<br />
der Liebe in der Renaissance als bloßes Tuch, aus dem die menschliche<br />
Form sich verflüchtigt hat, vom Körper der schönen Venus an den<br />
Rand des Bildes abfiel, aber „figurale Autonomie“ gewann, um Jahrhunderte<br />
später als Lumpen in den Straßen von Paris in den fotografischen<br />
Blick des Neuen Sehens zu geraten und schließlich Ende der 1960er-<br />
Jahre in den verschlungenen Filz-Skulpturen von Robert Morris wiederzukehren,<br />
hat der französische Kunsthistoriker und Philosoph Georges<br />
Didi-Huberman den Versuch unternommen, die Aktualität der „paradoxen,<br />
[...] unzerstörbaren Dinge“ zu denken, „die von sehr weit herkommen und<br />
unfähig sind, endgültig zu vergehen.“ 1<br />
Mit vergleichbarem Sinn für unerwartbare Konstellationen von auf den<br />
ersten Blick disparaten Kontexten und wiederkehrenden Motiven sowie<br />
einer in akribischen Recherchen gewonnenen Aufmerksamkeit für das<br />
widersprüchliche „Eigenleben“ 2 und die historischen Wechselfälle – und<br />
Faltenwürfe, zugleich verhüllend und umhüllend, stets an der Grenze zum<br />
Anthropomorphismus 3 – eines textilen Materials, das lange schon am<br />
Körper getragen wird, über Fragen der Funktionalität hinaus aber auch<br />
den metaphorischen und metonymischen Stoff des kulturellen Gedächtnisses<br />
und traditionsbehafteten aktuellen Alltags- und vergangenen Arbeitslebens<br />
einer Region bildet, hat Christian Philipp Müller sein Projekt<br />
Burning Love (Lodenfüßler) (2010) in der Umgebung und den Räumen des<br />
Schlosses Trautenfels in der Steiermark realisiert.<br />
Es ist der hier produzierte, verarbeitete, vermarktete, getragene und<br />
lokale Identität ebenso stiftende wie repräsentierende Stoff Loden, den<br />
Müller ins Zentrum seines jüngsten Werks stellt, das aus einem Ausstellungsdisplay<br />
(in Form eines an der Wand installierten Bildtableaus), einer<br />
Performance und einer raumgreifenden Skulptur besteht, die den Betrachter<br />
durch zwei Säle im Obergeschoss des Schlosses führt, das als Teil des<br />
4<br />
Siehe hierzu den grundlegenden,<br />
mit Blick auf<br />
die Arbeiten von Müller<br />
argumentierenden Text<br />
von James Meyer: Der<br />
funktionale Ort. In:<br />
Platzwechsel. Ursula<br />
Biemann, Tom Burr,<br />
Mark Dion, Christian<br />
Philipp Müller. Ausstellungskatalog<br />
Kunsthalle<br />
Zürich, Zürich1995, S.<br />
24-39, sowie in historischer<br />
Perspektive Miwon<br />
Kwon: One Place After<br />
Another. Site-Specific<br />
Art and Locational Identity.<br />
Cambridge/Mass.,<br />
London: MIT-Press<br />
2002.<br />
5<br />
Didi-Huberman, a.a.O.,<br />
S. 55.<br />
6<br />
Vgl. Miwon Kwon:<br />
Fluktuierende Werte. In:<br />
Philipp Kaiser (Hrsg.):<br />
Christian Philipp Müller.<br />
Ausstellungskatalog<br />
Museum für Gegenwartskunst<br />
Basel. Ostfildern:<br />
Hatje Cantz 2007,<br />
S. 15-27, S. 27.<br />
Universalmuseums Joanneum auch eine Schausammlung zur Natur- und<br />
Kulturgeschichte des benachbarten Ennstals und Ausseerlands beherbergt.<br />
Der in Berlin und New York lebende, immer aber in situ arbeitende<br />
Künstler etabliert indes keine Hierarchie zwischen der Geschichte der<br />
postminimalistischen Skulptur und der „Land Art“ sowie einem im Rekurs<br />
auf soziologische und historiografische Formen der Recherche erweiterten<br />
Verständnis von Ortsspezifik 4 verpflichteten künstlerischen Methode und<br />
jenen handwerklichen Artefakten und ethnografisch sowie zunehmend<br />
kommerziell konnotierten Bildern, die sich der am Ausstellungsort ansässigen<br />
Lodenfabrikation und den mit ihr verbundenen Kodierungen der in<br />
diesem Landstrich typischen, alpenländischen Trachtenmode verdanken<br />
– finden sich doch, wie auch Didi-Huberman in seinen Ausführungen zur<br />
„Mode und ihren Hüllen“ betont, die „Überbleibsel, die Formen des Nachlebens<br />
[...] überall: Sie schleichen sich in jeden Winkel der Geschichte<br />
ein – in den der Kunst zum Beispiel.“ 5 Dementsprechend ist Burning Love<br />
(Lodenfüßler) auch nicht der erste Fall, in dem in Christian Philipp Müllers<br />
Œuvre der letzten 25 Jahre der Zusammenhang zwischen Identität und<br />
Tradition im Gewand einheimischer Trachten in einem kontextreflexiven<br />
Projekt zum Thema wird, das die in der (nach)modernen Kunst angeblich<br />
inkompatiblen Register des Sozialen und Ästhetischen – oder vermeintlich<br />
unüberbrückbaren Antinomien zwischen Gehalt und Form – dialektisch<br />
aufeinander bezieht. Umso mehr aber gilt es, über diese Kohärenz<br />
innerhalb einer kritisch-reflexiven künstlerischen Praxis hinaus, für diese<br />
konkrete Arbeit zu klären, welche Aspekte und Formen des Nachlebens<br />
eines Materials und seiner Bedeutungsschichten Müller an diesem<br />
Schauplatz ins Werk setzt. Anlässlich seiner Retrospektive im Basler Museum<br />
für Gegenwartskunst hat der Künstler 2007 zu Protokoll gegeben,<br />
ortsspezifisch zu arbeiten bedeute für ihn, sich präzise außerhalb eines<br />
Kontextes zu positionieren. 6 Burning Love (Lodenfüßler) bildet keine<br />
Ausnahme von diesem zunächst paradox wirkenden, für Müllers Methode<br />
ebenso grundlegendem wie produktivem Prinzip, das sich insbesondere<br />
in diesem Projekt der programmatischen Verknüpfung von lokalem wie<br />
künstlerischem Eigensinn mit der Eigenlogik ästhetischer Produktion und<br />
Erfahrung verdankt.<br />
Wie seit mehr als 500 Jahren üblich, wird vor der Lodenwalke Steiner in<br />
Rössing bei Ramsau am Dachstein der nasse Loden (vom althochdeutschen<br />
lodo, grober Wollstoff) in circa 1,50 x 50 Meter messenden, bunt<br />
gefärbten oder wie am Ausgang von Müllers Burning Love (Lodenfüßler)<br />
im naturbelassenen Zustand wollweißen Bahnen an einem überdachten<br />
Holzgestell an der Bergluft getrocknet, bevor er zu „Wetterflecken“,<br />
„Schladmingern“, „Walkjankern“ oder anderen traditionsreichen Modellen<br />
der regionalen Trachtenmode weiterverarbeitet wird. Wie ein abstraktes<br />
Band scheint das Bild dieser monochromen Fläche sich durch die alpine<br />
Landschaft der Steiermark zu ziehen; verstärkt durch den Ausschnitt
84 — 85<br />
Christian Philipp Müller<br />
Christian Philipp Müller<br />
Burning Love<br />
(Lodenfüßler), 2010<br />
7<br />
Didi-Huberman, a.a.O.,<br />
S. 25<br />
einer Fotografie vom mit Loden behängten Trockenstand der Walke, die<br />
Müller in seine kulturhistorisch anmutende, aus eigenen Aufnahmen, Archivalien<br />
und im Umkreis des Schlosses vorgefundenen Ölbildern bestehenden<br />
„Ausstellung in der Ausstellung“ integriert hat, stellt sich für das<br />
kunsthistorisch geschulte Auge unwillkürlich eine formale Verbindung zu<br />
den skulpturalen Interventionen der „Land Art“ in angeblich unberührten,<br />
von den Zentren der Gegenwartskunst weit entfernten Naturszenerien<br />
her – etwa dem im Wind flatternden Stoff des nördlich von San Francisco<br />
errichteten Running Fence (1972-1976) von Christo und Jeanne-Claude.<br />
Zugleich ist damit von Müller aber nicht nur eine assoziative Engführung<br />
zwischen der regionalen Textilfabrikation und der kanonischen Kunst<br />
des Postminimalismus vorgenommen, sondern gleichermaßen wird auf<br />
die entscheidende Veränderung in der Wahrnehmung und Bestimmung<br />
dieser pittoresken Landschaft in der Nachkriegszeit angespielt, wie sie<br />
auch das unvergängliche Nachleben des Lodens als Material, stoffliche<br />
Form und kultureller Bedeutungsträger betrifft, dem er in diesem Werk<br />
gleichsam Schritt für Schritt folgt: vom Schauplatz handwerklicher und<br />
landwirtschaftlicher Arbeit zur Kulisse der Freizeit- und Tourismusindustrie.<br />
Entsprechend stellt Müllers Sammlung von Bildern und Dokumenten<br />
aus der lokalen Geschichte dieses traditionsbehafteten Stoffs, aus dem<br />
sein ortsspezifisches Projekt für die Ausstellung Der schaffende Mensch.<br />
Welten des Eigensinns in der Hauptsache gemacht ist, vor Augen, welche<br />
widersprüchlichen Kodierungen dieser im Laufe der Zeit durchlaufen hat.<br />
Heute gilt Loden- bzw. Trachtenmode, sobald sie ihren angestammten<br />
Platz im sozialen Gefüge einer regional verankerten Gemeinschaft und<br />
ihren Gebräuchen verlässt und in Städten wie Graz, München, Münster<br />
oder gar Hamburg in Fußgängerzonen auf den Plan tritt, als Ausweis<br />
wertkonservativer Gesinnung, ökonomischer Prosperität und bürgerlichen<br />
Selbstverständnisses. Hinter diesem vermeintlich einfach zu deutenden<br />
Gewand aus Schafwolle verbirgt sich indes, wie Müller zu betonen scheint,<br />
eine paradoxe Geschichte „dynamischer Umkehrungen“ 7 : Es war Erzherzog<br />
Johann, Namensgeber des steirischen Universalmuseums, zu dem das vorübergehend<br />
auch als Jugendherberge genutzte Schloss Trautenfels heute<br />
gehört, der die aus Loden gefertigte Tracht als Ausdruck lokaler Verbundenheit<br />
und Patriotismus im frühen 19. Jahrhundert buchstäblich hoffähig<br />
machte und eine Transformation des durch dieses Material signalisierten<br />
sozialen Status und Habitus einleitete. War Lodenbekleidung einst jenen<br />
vorbehalten, die sich bei der Arbeit in den Bergen effektiv gegen Wind und<br />
Wetter zu schützen hatten, so fuhren ab den 1860er-Jahren wohlhabende<br />
jüdische Familien aus Wien und später Intellektuelle wie Sigmund Freud<br />
und Stefan Zweig nach Bad Aussee in die Sommerfrische und trugen im<br />
Urlaub vor Ort selbstverständlich Tracht, deren Charakter als „Volksgut“<br />
schließlich Konrad Mautner in einer Sammlung zu bewahren suchte, auf<br />
der das dortige Kammerhofmuseum noch heute aufbaut. Neben Einheimischen<br />
sind es damals wie heute Touristen, die sich zwischen Überzeugung<br />
Christian Philipp Müller<br />
The Family of Austrians,<br />
1993 (Einladungskarte<br />
der Galerie Metropol,<br />
Wien)<br />
Having Fun in Slovakia,<br />
Ringier VOYAGE, 2000<br />
8<br />
Im traditionellen Prozess<br />
des Walkens wird ein<br />
Wolltuch in handwarmem<br />
Wasser (30-40°C)<br />
unter Zugabe von Kernseife<br />
durch Druck und<br />
Reibung verfilzt, sodass<br />
ein Stoff mit einer höheren<br />
Dichte und einem um<br />
etwa 40 % reduzierten<br />
Volumen entsteht.<br />
und Travestie schwankend vor Ort in Loden hüllen, aber auch der zum<br />
konservativen Politiker avancierte Schauspieler Arnold Schwarzenegger<br />
und der verstorbene rechtspopulistische Politikerdarsteller und Landeshauptmann<br />
Kärntens Jörg Haider wurden bereits öffentlichkeitswirksam<br />
in Loden abgelichtet; entgegen dem Ruf mangelnder Raffinesse und einer<br />
gewissen Robustheit, die diesem Stoff gemeinhin vorauseilt, zählt der andere<br />
Zweig der in der Region um Schloss Trautenfels Loden fabrizierenden<br />
Familie Steiner exklusive Modehäuser wie Yves Saint Laurent und Dolce<br />
& Gabbana zu seinen Kunden und setzt ganz im Sinne des Werbeslogans<br />
„Keine Zukunft ohne Herkunft“ auf eine gewinnträchtige Kombination<br />
von Heimatverbundenheit und stilbewusster Weltoffenheit. So spannt<br />
Müllers Tableau einen weiten Bogen von der gegenwärtigen, in ihrer Widersprüchlichkeit<br />
kaum auflösbaren Polysemie eines Stoffs zu seinen rein<br />
funktionalen Anfängen als gegen die Witterung schützender Wetterfleck,<br />
wie er heute in abgewandelter Form und grüner Färbung als ärmelloser<br />
Überwurf noch Jäger kleidet, aber, wie einige Aufnahmen zeigen, auch<br />
den Künstler auf Ortsterminen in der Region ziert.<br />
Dieses archaische Modell aus dem Sortiment steirischer Trachtenmode<br />
macht Christian Philipp Müller in Burning Love (Lodenfüßler) zur Grundlage<br />
seiner ortspezifischen Auseinandersetzung mit der historischem<br />
Wandel unterworfenen Repräsentation regionaler Identität und bezieht<br />
es auf die „figurale Autonomie“ der Faltenwürfe textiler Materialien in der<br />
postminimalistischen Kunst und ihre anthropomorphen wie performativen<br />
Implikationen: Müller verwandelt eine komplette, mehr als 50 Meter<br />
lange Bahn wollweißen Lodens aus der Steiner’schen Walke in Rössing in<br />
einen überdimensionierten Wetterfleck, der nicht weniger als 20 Personen<br />
Platz und Schutz bietet. Zu diesem Zwecke hat der Künstler eine entsprechende<br />
Anzahl von kreisrunden Aussparungen in den lose gewebten Stoff<br />
geschnitten, bevor dieser gewalkt wurde; durch das Walken 8 erhalten die<br />
Kopföffnungen dieses kollektiven Kleidungsstücks individuelle organische<br />
Konturen und weiche Kanten. Noch vor Eröffnung der Ausstellung<br />
schickt Müller seinen Loden zu Himmelfahrt am 13. Mai auf den ungefähr<br />
25 Kilometer langen Weg vom Ort seiner Produktion zu den Ausstellungsräumen<br />
im Schloss Trautenfels. Diese zwischen Performance, Parade und<br />
Prozession angesiedelte Wanderung durch die obersteirische Landschaft<br />
schafft einerseits das bewegte Bild einer monochromen abstrakten<br />
Fläche, die gänzlich unerwartet an Dynamik, wenn nicht Eigenleben,<br />
gewonnen hat und darin die anthropomorphe Dimension, die dem Stoff<br />
und dessen die Figur des menschlichen Körpers evozierenden Faltenwurf<br />
immer schon inhärent ist, realisiert, noch bevor der Loden durch Schnitte,<br />
Nähte, Einfärbung und Applikationen seiner Bestimmung zum alpenländischen<br />
Gewand zugeführt werden konnte. In diesem Sinne macht Müller,<br />
indem er diese noch nicht weiter verarbeitete Bahn Loden auf den Weg<br />
bringt, die in ihrer basalen Stofflichkeit noch fern aller Assoziationen mit
86 — 87<br />
Christian Philipp Müller<br />
9<br />
Ebda., S. 137.<br />
10<br />
Zu denken ist ebenso<br />
an Arbeiten von Franz<br />
Erhard Walther aus den<br />
Sechzigerjahren und die<br />
Parangolés von Hélio<br />
Oiticica; zu letzterem<br />
siehe Sabeth Bucchmann:<br />
Denken gegen das<br />
Denken. Produktion,<br />
Technologie, Subjektivität<br />
bei Sol LeWitt, Yvonne<br />
Rainer und Hélio Oiticica.<br />
Berlin: b_books 2007, S.<br />
228ff.<br />
11<br />
Siehe dazu George Baker,<br />
Christian Philipp Müller:<br />
A Balancing Act. In:<br />
October 82, Herbst 1997,<br />
S. 95-118, S. 110f, 115. In<br />
diesem Text reflektieren<br />
Baker und Müller anlässlich<br />
des gleichnamigen<br />
Projekts des Künstlers für<br />
die Documenta X in Kassel<br />
1997 die Geschichte<br />
der öffentlichen Skulptur<br />
auf dem Friedrichplatz in<br />
Kassel in der Spannung<br />
zwischen Formalismus<br />
(Walter de Maria, Vertical<br />
Earth Kilometer, 1977)<br />
und Engagement (Joseph<br />
Beuys, 7000 Eichen,<br />
1982). Burning Love (Lodenfüßler)<br />
kann in dieser<br />
Hinsicht als Fortführung<br />
dieser Auseinandersetzung<br />
mit den historischen<br />
Voraussetzungen ortsspezifischen<br />
Arbeitens<br />
gelten.<br />
12<br />
Vgl. Didi Huberman,<br />
a.a.O., S. 42.<br />
13<br />
Siehe dazu Christian<br />
Philipp Müller, a.a.O., S.<br />
72-79.<br />
Trachtenmode scheint und so offen für alternative Besetzungen ist, jenen<br />
„morphologische[n] und bedeutsame[n] Reichtum“ buchstäblich, „auf<br />
welchen ein einfaches Tuch“ in der ästhetischen Erfahrung „unsere Augen<br />
lenken kann“ 9 .<br />
Andererseits stiftet Müller anders als die Arbeiten der „Land Art“, die hier<br />
unter anderem 10 kunsthistorisch Pate standen, und jenseits der nominalistischen<br />
Behauptung, Alltagsmaterial in Kunst verwandeln zu können,<br />
unter diesem einfachen Deckmantel eine soziale Gemeinschaft im öffentlichen<br />
Raum, die durch die Stoffbahn aus Loden gleichermaßen konstituiert<br />
und zusammengehalten wird. So überbrückt er wie schon in früheren<br />
seiner Arbeiten zumindest auf Zeit die Kluft, die sich in der Geschichte<br />
und Theorie der (nach)modernen Kunst zwischen den Bereichen des Ästhetischen<br />
und Sozialen vermeintlich unüberwindlich aufgetan hat. 11 Das<br />
Rechteck aus Stoff, das als abstrakte Bodenplastik oder farbenfroher<br />
Bildersatz beispielsweise auch in Ausstellungen von Cosima von Bonin<br />
oder Falke Pisano anzutreffen ist, wird in Gebrauch genommen, am Körper<br />
getragen und durch Berg und Tal gesandt. Freiwillig vereint unter einem<br />
kollektiven Wetterfleck, der keiner mehr oder noch keiner ist, aber auch<br />
durch die Fäden des Stoffes auf der gemeinsam zu bewältigenden Strecke<br />
zwischen dem Handwerksbetrieb und dem Museum im Schloss sind die<br />
Teilnehmer der Performance temporär aneinander gebunden bzw. aufeinander<br />
angewiesen. So findet Müller ein bewegtes, dialektisches Bild für<br />
den Umstand, dass der schaffende Mensch dieser Region in seiner Identität<br />
– anders als es Tourismusmanager und Kulturfunktionäre nahezulegen<br />
suchen – nicht in einheimischen Trachten zu repräsentieren und fixieren<br />
ist. Der Faltenwurf des Lodens lässt diesen charakteristischen Stoff, in<br />
dem sich lokaler Eigensinn manifestieren soll, zwischen formlosem Haufen<br />
und drapierter, solider, dauerhafter Form 12 changieren.<br />
Müllers Burning Love (Lodenfüßler) wirft einen retrospektiven Blick auch<br />
auf eine Reihe thematisch verwandter Arbeiten des Künstlers zu Fragen<br />
von regionaler oder nationaler Identität und deren Repräsentation: Auf<br />
der Rückseite des Katalogs und dem Plakat zum Österreichischen Pavillon<br />
der Biennale von Venedig 1993, auf der Müller seine heute schon klassische<br />
Arbeit Grüne Grenze 13 präsentierte und als Schweizer neben der<br />
Amerikanerin Andrea Fraser und dem Österreicher Gerwald Rockenschaub<br />
auf Einladung des damaligen Kommissärs Peter Weibel – in den Augen<br />
einiger unstandesgemäß – die Alpenrepublik repräsentierte, sind alle drei<br />
Künstler in einem urigen Wirtshaus (österreichisch: „Beisl“) versammelt<br />
und in Trachtenmode gekleidet zu sehen, 14 wie um den auch damals<br />
längst schon obsoleten Anspruch der Großausstellung auf einen nationalstaatlichen<br />
Wettstreit in der globalisierten Gegenwartskunst vollends<br />
ad absurdum zu führen. Selbst- und Fremdverständnis traten in diesem<br />
Bild rigoros auseinander und der Mythos einer österreichischen Identität,<br />
die eine geschlossene Gesellschaft von angestammten Privilegien<br />
14<br />
Solche Porträtaufnahmen<br />
waren darüber<br />
hinaus Teil der Arbeit<br />
almost adjusted to the<br />
new background,1993,<br />
die in Colin de Lands<br />
New Yorker Galerie<br />
American Fine Arts,<br />
Co. im Rahmen der von<br />
James Meyer kuratierten<br />
Ausstellung Whatever<br />
Happened to Institutional<br />
Critique? zu sehen<br />
war.<br />
15<br />
Siehe dazu auch Alexander<br />
Alberro: Unraveling<br />
the Seamless Totality:<br />
Christian Philipp Müller<br />
and the Reevaluation of<br />
Established Equations.<br />
In: Grey Room 06, Winter<br />
2002, S. 5-25, S. 20.<br />
16<br />
Siehe dazu ausführlicher<br />
André Rottmann:<br />
Faksimile: Kalkül und<br />
Anschauung in Serie.<br />
Überlegungen zu den<br />
Ringier Jahresberichten<br />
1997 – 2008. In: Wladimir<br />
Velminski (Hrsg.):<br />
Bildwelten des Wissens.<br />
Kunsthistorisches Jahrbuch<br />
für Bildkritik, hrsg.<br />
von Horst Bredekamp,<br />
Matthias Bruhn, Gabriele<br />
Werner, Bd. 7.2. Berlin<br />
2009 [im Druck].<br />
17<br />
Siehe dazu Christian<br />
Philipp Müller, a.a.O., S.<br />
136-139, sowie Christian<br />
Meyer: Christian Philipp<br />
Müller und die Familie<br />
der Österreicher. In:<br />
Camera Austria, Heft 49,<br />
1994, S. 15-23.<br />
18<br />
Vgl. Didi-Huberman,<br />
a.a.O., S. 27.<br />
19<br />
Siehe zu der Bedeutung<br />
dieses Konzepts für<br />
die Arbeit Müllers Ein<br />
Gespräch zwischen<br />
James Meyer und Christian<br />
Philipp Müller. In:<br />
Christian Philipp Müller,<br />
a.a.O., S. 44-57, S. 57.<br />
signalisieren soll, wird als Teil plakativen Marketings lesbar. 15 Auch die<br />
Rückseite des Jahresberichtes, den Müller 1999 für Ringier realisierte und<br />
für den er alle ausländischen Niederlassungen des Schweizer Medienkonzerns<br />
bereiste, 16 ziert eine Christian Philipp Müller having fun in Slovakia<br />
betitelte Fotografie, die auf humorvolle Weise die Gleichzeitigkeit der<br />
realiter effektiven Globalisierung mit archaischen Selbstbildern ins Bild<br />
setzt: Der Künstler ist mit Baseball-Mütze und Jeans-Jacke bekleidet<br />
auf einer Bank neben drei farbenfrohe Trachten tragenden Frauen im<br />
Liptauer Heimatmuseum zu sehen. Die ambivalente kulturelle Kodierung<br />
von Trachtenkleidung war ebenfalls Gegenstand von Müllers Ausstellung<br />
im Herbst 1993 in der Wiener Galerie Metropol The Family of Austrians,<br />
in der er auf die Darstellung des österreichischen Landlebens in Edward<br />
Steichens berühmter ethnografischer Erfassung der Welt im fotografischen<br />
Atlas einer Family of Man rekurrierte. Auf der Einladungskarte war<br />
Müller in einem Bild aus dem Kontext von „Grüne Grenze“ als Wanderer zu<br />
sehen, der sich wie noch heute für seine Arbeit im Schloss Trautenfels der<br />
Frage österreichischer Selbstdarstellung gleichsam von außen nähert. In<br />
Vitrinen waren Bregenzerwälder Trachten ausgestellt, flankiert von Verkaufsbroschüren<br />
und didaktischen Filmen aus den Beständen des Wiener<br />
Instituts für Kostümkunde, die auf volkstümliche Authentizität als Ware<br />
zielten und in dieser folkloristischen Überformung nationaler Identität<br />
eine Entsprechung in Steichens als Bildpaneele in der Galerie verteilten,<br />
in der US-amerikanischen Perspektive der Nachkriegszeit geradezu exotische<br />
Rückständigkeit suggerierenden Darstellungen des Landlebens in<br />
Österreich anno 1955 fanden. 17 Demgegenüber betont Müllers neue Arbeit<br />
auch ihrem Titel nach die Konnotationen regionaler Trachten, die sich<br />
Kalkül und Kontrolle zu entziehen vermögen. Für die Männer der Region<br />
gehört es sich, zur landestypischen Lederhose kniehohe Socken, sogenannte<br />
Lodenfüßler, mit aufwendigem Strickmustern zu tragen: Eines,<br />
das unbedingt symmetrisch auf dem Schienbein platziert werden muss,<br />
heißt „Brennende Liebe“. Auch in diesem traditionellen, für manchen<br />
heute befremdlich konservativen Wollstoff und seiner Verarbeitung zur<br />
Tracht bleibt menschliches Begehren mithin als untilgbarer Rest in jeder<br />
Form gegenwärtig. 18<br />
In seiner Performance im Außenraum mobilisiert Müller die anthropomorphe<br />
und Gemeinschaft stiftende, ein multiples statt rigides Verständnis<br />
von Identität 19 erlaubende Dimension seiner Bahn wollweißen Lodens. Als<br />
eine Referenz für Burning Love (Lodenfüßler) dient ihm ein Happening,<br />
das James Lee Byars 1969 in der von Anny de Decker in Antwerpen betriebenen<br />
Galerie „Wide White Space“ veranstaltete. Unter dem Titel Pink Silk<br />
Airplane brachte Byars ein 30 x 30 Meter messendes Stück Stoff in den<br />
Ausstellungsraum mit 100 kreisrunden Öffnungen für 100 Personen, die<br />
auf dem Boden gemeinsam eine imaginäre Flugreise antreten konnten:<br />
„So sassen nach einer Weile alle auf dem Boden, eingehüllt in eine rosa
88 — 89<br />
Christian Philipp Müller<br />
20<br />
Johannes Gachnang<br />
(Hrsg.): James Lee Byars.<br />
Ausstellungskatalog<br />
Kunsthalle Bern. Bern<br />
1978, s.p.<br />
21<br />
Siehe unter anderem<br />
mit Bezug auf die<br />
kritischen Arbeiten<br />
Müllers dazu George<br />
Baker: Beziehungen und<br />
Gegenbeziehungen: Ein<br />
offener Brief an Nicolas<br />
Bourriaud. In: Yilmaz<br />
Dziewior (Hrsg.): Zusammenhänge<br />
herstellen.<br />
Ausstellungskatalog<br />
Kunstverein in Hamburg.<br />
Köln: DuMont 2003, S.<br />
126-133.<br />
22<br />
James Lee Byars, a.a.O,<br />
s.p.<br />
23<br />
Siehe zur Ausstellung A<br />
Sense of Friendliness,<br />
Mellowness, and Permanence,<br />
die Ende 1992<br />
in der Galerie American<br />
Fine Arts, Co. in New<br />
York stattfand: Baker,<br />
a.a.O., S. 127f., sowie<br />
Christian Philipp Müller,<br />
a.a.O., S. 132-135.<br />
24<br />
James Lee Byars, a.a.O.,<br />
s.p.<br />
25<br />
Didi-Huberman, a.a.O,<br />
S. 27.<br />
Seidenwolke und schwebten in einer Atmosphäre festlicher Verwunderung.<br />
Wer das Ganze lächerlich fand und sich nicht in eine derart verrückte<br />
Situation begeben wollte, sah zu, dass er fortkam. Wer jedoch mitspielte<br />
tauchte etwas verlegen in den rosa Traum und schaute verwundert nach<br />
den schmunzelnden oder versonnenen Gesichtern um sich herum, in<br />
denen er dann Freunde [...] erkannte.“ 20 Aber auch 1969 war Byars genau<br />
wie vier Jahrzehnte später Müller nicht daran gelegen, die Freude eines<br />
gemeinschaftlichen Erlebens zu ermöglichen, wie sie in der „relationalen<br />
Ästhetik“ der Neunzigerjahre fröhliche Urständ‘ feiern sollte; 21 vielmehr<br />
sind die damals wie heute durch ein Stück Stoff hergestellten Zusammenhänge<br />
mitunter von Momenten der ungewollten Zugehörigkeit geprägt.<br />
So wiederholte Byars Pink Silk Airplane einen Monat später anlässlich<br />
eines Besuchs bei Joseph Beuys an der Kunstakademie Düsseldorf, an<br />
der in den Achtzigerjahren auch Müller studieren sollte, zerschnitt aber,<br />
wie de Decker sich erinnert, „nachdem etwas hundert Leute [...] Platz genommen<br />
hatten, [...] den Stoff mit einer Schere und das Flugzeug zerfiel<br />
in luftige rosa Engel, wobei immer zwei oder drei miteinander verbunden<br />
waren, je nachdem wie sie Byars ausgeschnitten hatte.“ 22 Der Seidenstoff<br />
ist mithin genau wie Müllers Loden kein Garant für ein Gefühl von Freundlichkeit,<br />
Heiterkeit und Beständigkeit, um den Titel eines Projekts des<br />
Schweizer Künstlers aus dem Jahr 1992 zu zitieren. 23 Was als „formloses<br />
zusammengeknülltes Bündel“ 24 begann, ist bei Byars kein Nachleben als<br />
faltenwerfender Stoff vergönnt, aus dem die „menschliche Form [...] sich<br />
tatsächlich verflüchtigt [hat]“, aber als „Suspense“ 25 gegenwärtig bleibt.<br />
Müller schneidet die Bahn, die zwanzig Personen vorübergehend als<br />
Bekleidung auf einer realen Tagesreise per pedes gedient hat, hingegen<br />
nicht in Stücke, sondern überführt sie in eine Skulptur, die sich nach dem<br />
Auftakt seines Tableaus zur Geschichte und Gegenwart des Lodens durch<br />
zwei Säle des Schlosses Trautenfels zieht, um am Ende dieses Parcours<br />
auf einen Film zu treffen, das den langen, kollektiv zurückgelegten Weg<br />
dieser Stoffmasse von der Walke ins Museum festhält. In der Formlosigkeit<br />
einer der Ästhetik des Postminimalismus folgenden Plastik tritt<br />
der Loden den Betrachtern nun haptisch entgegen; wo ihm einst die<br />
Köpfe und Rümpfe von zwanzig Personen Halt und Form gaben, sorgen<br />
nun einfache Böcke – ungefähr so breit wie ein paar Schultern und wie<br />
die Bodendielen des Schlosses aus Lärchenholz gefertigt – dafür, dass<br />
er über dem Boden der Ausstellungsräume schwebt. Die Präsenz der<br />
menschlichen Figur bleibt bestehen: Müllers Minimalismus begnügt sich<br />
nicht, wie oft von dieser Formation in der nachmodernen Kunst behauptet<br />
wird, mit der Tautologie angeblich elementarer Formen und neutraler<br />
Materialien, die nur das zu sehen geben, was man tatsächlich sieht. Das<br />
dialektische Bild dieser Arbeit schlägt im Wissen um den nachhaltigen<br />
Anthropomorphismus der skulpturalen Form und eingedenk der von Müller<br />
ausgestellten Geschichte der dynamischen Umkehrungen des Stoffes,<br />
aus dem sie gemacht ist, vielmehr eine Brücke zwischen dem „Seh- und<br />
James Lee Byars<br />
Pink Silk Airplane, 1969<br />
Wide White Space,<br />
Antwerpen<br />
Christian Philipp Müller<br />
Rückseite des Kataloges<br />
der Venedig Biennale,<br />
österreichischer Pavillon,<br />
1993<br />
v.l.n.r.: Andrea Fraser,<br />
Gerwald Rockenschaub,<br />
Christian Philipp Müller<br />
26<br />
Georges Didi-Huberman:<br />
Was wir sehen blickt uns<br />
an. Zur Metapsychologie<br />
des Bildes. München:<br />
Fink 1999, S. 159.<br />
27<br />
Didi-Huberman, a.a.O.,<br />
S. 137.<br />
28<br />
Vgl. Juliane Rebentisch:<br />
Ästhetik der Installation.<br />
Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp 2003, S. 264.<br />
In diesem Sinne betont<br />
Rebentisch zurecht,<br />
dass die „Stärke ortsspezifischer<br />
Kunst noch<br />
nie in der Prätention<br />
[lag], den Produktionsbedingungen<br />
tatsächlich<br />
entkommen zu können,<br />
sondern darin, das<br />
Bewusstsein für diese<br />
und die mit ihnen verbundenen<br />
Konfliktlinien<br />
zu schärfen. Ebda., S.<br />
266.<br />
29<br />
Ebda., S. 263.<br />
30<br />
Ebda., S. 278.<br />
Tastsinn“ und den „semiotischen Sinne[n] oder Bedeutungen mit ihren<br />
Mehrdeutigkeiten.“ 26 So wie die allgemeine Kraft des Nachlebens sich in<br />
den späten Sechzigerjahren Didi-Huberman zufolge in den „Fällen“ aus<br />
Filz von Robert Morris äußerte, erscheint sie auch in dieser Skulptur Müllers<br />
als „ewige Gegenwart der Metamorphosen“ 27 , in diesem Falle jener<br />
des Lodens als Textil und Bedeutungsträger, aus dem spezifischen Kontext<br />
stammend, in dem wie so oft in den kritisch-reflexiven Werken des<br />
Schweizer Künstlers die Her- und Ausstellung von zeitgenössischer Kunst<br />
programmatisch in eins fallen.<br />
Wie Burning Love (Lodenfüßler) in der Konstellation eines idiosynkratisch<br />
anmutenden Bildtableaus mit der performativen Aktivierung eines überdimensionierten<br />
Wetterflecks in der Landschaft und einer das regional<br />
codierte Textil mit der Geschichte der Kunst nach dem Minimalismus<br />
verknüpfenden raumgreifenden Skulptur deutlich macht, wäre es indes<br />
ein Missverständnis, die Arbeitsmethode Müllers dahingehend zu deuten,<br />
dass ihr kritisches Potential daraus resultiere, sich mit einem Kontext gemein<br />
zu machen. Wie auch das eingangs angeführte, paradox wirkende<br />
Statement Müllers zu seinem Verständnis einer ortsspezifischen Praxis<br />
betont, geht es, wie die Philosophin und Kunstkritikerin Juliane Rebentisch<br />
herausgestellt hat, in solchen Werken immer darum, den „doppelten<br />
Ort der Kunst“, d.h. die etablierten Konventionen der Ausstellung und<br />
Produktion im Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Funktion insgesamt<br />
zu reflektieren. 28 Dies hat zur Folge, dass eine Arbeit wie Müllers<br />
Projekt in der Steiermark „dem jeweilig lebensweltlich bestimmten Raum<br />
gewissermaßen einen virtuellen Raum [überschiebt], der durch das Spiel<br />
der Bedeutungen bestimmt ist, das durch das Werk in bezug auf seinen<br />
sichtbaren ebenso wie in Bezug auf seine unsichtbaren Kontexte in Gang<br />
gesetzt wird. 29 Soziale Relevanz entsteht deshalb auch im Falle von im<br />
Hinblick auf einen konkreten Ort entwickelten Werken wie Burning Love<br />
(Lodenfüßler) nicht dann, wenn Ästhetik nivelliert wird, sondern im Gegenteil<br />
dann, wenn die „Spannung zwischen Darstellung und Dargestelltem<br />
alle Gehalte reflexiv so unter Strom setzt, daß deren vermeintliche<br />
Selbstevidenz von der prozessualen Logik der ästhetisch erfahrenden<br />
Werke noch dort aufgezehrt wird, wo sie ihren Produzenten als Wesentliche<br />
erscheinen.“ 30 Die Beziehung zwischen einem Material und seiner<br />
Bedeutung steht in solchen Werken niemals still, sondern ist, wie Müller<br />
in seiner bewusst eingeschränkten Perspektive auf die wechselhafte<br />
Geschichte und widersprüchliche Aktualität des Lodens vor Augen führt,<br />
strukturell bedeutungsoffen, der Intention des Künstlers entzogen und<br />
an keinen Ort unauflöslich gebunden. Das Nachleben eines Stoffes und<br />
seiner ortsspezifischen Gehalte in dieser selbstreflexiven Eigenlogik der<br />
ästhetischen Erfahrung zu brechen, ohne das Soziale gegen eine Kunst<br />
auszuspielen, die sich ihrer konstitutiven Ortslosigkeit vollends bewusst<br />
ist, darin liegt Christian Philipp Müllers Eigensinn.
122 — 123<br />
1<br />
Wiederabdruck aus: Pierre<br />
Bourdieu: Ein Zeichen der<br />
Zeit. In: Pierre Bourdieu<br />
(u.a.): Der Einzige und sein<br />
Eigenheim. Erweiterte<br />
Neuausgabe der Schriften<br />
zu Politik & Kultur 3, hrsg.<br />
von Margareta Steinrücke.<br />
Hamburg: VSA 2002.<br />
Übersetzung des Textauszugs:<br />
Jürgen Bolder.<br />
2<br />
Der sich selbst Quälende,<br />
Titel eines Gedichtes<br />
von Baudelaire aus der<br />
Sammlung Die Blumen<br />
des Bösen, ursprünglich<br />
Titel einer Komödie des<br />
römischen Dichters Terentius<br />
Afer (195-159 v. Chr.);<br />
Anm. d. Hrsg.<br />
3<br />
Verträge, aus denen eine<br />
Partei allein allen Nutzen<br />
zieht; Anm. d. Hrsg.<br />
4<br />
Die v.a. von Linken vorgenommene<br />
Idealisierung<br />
des Volkes bzw. der<br />
Volksklassen als kollektiv<br />
orientiert und klassenbewusst;<br />
Anm. d. Hrsg.<br />
Ein Zeichen der Zeit 1<br />
Pierre Bourdieu<br />
Das, was im Verlauf dieser Arbeit immer wieder zur Sprache kommen wird,<br />
bildet eine der Hauptquellen des kleinbürgerlichen Elends oder genauer,<br />
all der kleinen Nöte, all dessen, was die Freiheit, die Hoffnungen und die<br />
Wünsche beeinträchtigt und dazu führt, dass das Dasein von Sorgen und<br />
Enttäuschungen, von Einschränkungen und Fehlschlägen und nahezu<br />
unvermeidlich von Melancholie und Ressentiment erfüllt ist. Freilich ruft<br />
dieses Elend, anders als die großen Härten der proletarischen oder subproletarischen<br />
Lebenssituation, nicht spontan Sympathie, Mitleid oder<br />
Empörung hervor. Und das wohl deshalb nicht, weil die Bestrebungen,<br />
die die Unzufriedenheit, die Desillusionierung und das Leiden des Kleinbürgers<br />
nach sich ziehen, stets auch etwas der Komplizenschaft desjenigen,<br />
der diese Bedrückungen erfährt, geschuldet zu sein scheinen,<br />
seinen irregeleiteten, entpressten, entfremdeten Wünschen, durch die<br />
er, diese moderne Inkarnation des Heautontimoroumenos, 2 untergründig<br />
an seinem eigenen Unglück mitwirkt. Dadurch, dass er sich häufig auf für<br />
ihn zu groß angelegte, weil eher auf seine Ansprüche als auf seine Möglichkeiten<br />
zugeschnittene Projekte einlässt, bringt er sich selbst in eine<br />
von übermächtigen Zwängen beherrschte Lage. In dieser bleibt ihm als<br />
Ausweg nur, sich um den Preis einer enormen Anspannung den Folgen<br />
seiner Entscheidung zu stellen und sich zugleich darum zu bemühen, sich<br />
mit dem, womit die Realität seine Erwartungen sanktioniert hat, zufriedenzugeben,<br />
wie man so sagt, indem er alle Anstrengungen macht, die<br />
Fehlkäufe, die erfolglosen Unternehmungen, die leoninischen 3 Verträge<br />
in seinen eigenen wie in den Augen seiner Angehörigen zu rechtfertigen.<br />
Dieses gleichermaßen kleinliche wie triumphierende „Volk“ hat nichts,<br />
woran die populistische Illusion 4 Gefallen fände. Zu nah und zu fern zugleich,<br />
zieht es die Missbilligung und die Sarkasmen der Intellektuellen<br />
auf sich. Sie beklagen seine „Verbürgerlichung“ und machen ihm seine<br />
irregeleiteten Bestrebungen wie seine Unfähigkeit zum Vorwurf, diesen<br />
eine andere als eine ebenso irregeleitete und lächerliche Befriedigung zu
124 — 125<br />
Franz Kapfer<br />
verschaffen; kurz, all das, worauf die gängige Denunzierung des Traums<br />
vom eigenen Heim sich bezieht. Und weil es sich dazu verleiten ließ, über<br />
seine Verhältnisse, auf Kredit zu leben, stößt es doch, über kurz oder<br />
lang, namentlich in Form der Sanktionen der Bank, von der es sich wahre<br />
Wunder erhofft hatte, fast ebenso schmerzlich auf die Härten der ökonomischen<br />
Notwendigkeit wie zu anderen Zeiten die Industriearbeiter.<br />
Dieser Umstand erklärt wohl, warum dieses „Volk“, das zum Teil auch<br />
Produkt einer auf seine Bindung an die bestehende Ordnung durch die<br />
Bande des Eigentums angelegten Politik des sozialen Liberalismus ist,<br />
in seinem Wahlverhalten gleichwohl den Parteien die Treue gehalten hat,<br />
die sich auf den Sozialismus berufen. Scheinbar der besondere Nutznießer<br />
des allgemeinen „Verbürgerlichungs“-Prozesses, ist es durch den<br />
Kredit an ein Haus gefesselt, das oft unverkäuflich geworden ist. Wenn<br />
es nicht gar außerstande ist, die vor allem mit dem Lebensstil zusammenhängenden<br />
Belastungen und Verpflichtungen auf sich zu nehmen,<br />
welche die oftmals ihm selbst nicht transparente Ausgangsentscheidung<br />
stillschweigend implizierte. „Nicht alles am Vertrag ist vertragsmäßig“,<br />
hat Durkheim gesagt. Nirgends trifft diese Formel so zu wie bei dem<br />
Kauf eines Hauses, in dem unausgesprochen ein ganzer Lebensplan und<br />
Lebensstil einbegriffen sind. Das ist es, was so viele Aussagen auf so<br />
bewegende Weise zum Ausdruck bringen.
132 — 133<br />
Codename Zement<br />
Martin Prinzhorn<br />
In seinem neuen Projekt Sieh-Dich-Für verbindet Franz Kapfer zwei vordergründig<br />
entgegengesetzte Stränge: Auf der einen Seite stehen Konzepte<br />
wie Befestigung, Autarkie, Abschottung nach Außen etc., auf der<br />
anderen Seite geht es um die V2, jene deutsche Wunderwaffe, die für<br />
die Aggression der Politik der Nazis steht, für Eroberung, Unterdrückung<br />
und Terror. Rückzug trifft hier gewissermaßen auf Eroberung. Historisch<br />
gesehen hat dieses Zusammentreffen von konzeptuellen Gegensätzen<br />
vor mehr als sechzig Jahren in der Umgegend des Veranstaltungsortes<br />
tatsächlich stattgefunden, als die den Krieg verlierenden Nazis – also<br />
Deutschland und das mit diesem fusionierte Österreich – unter dem<br />
Codenamen Zement das Konzept der „Alpenfestung“ als eine Art letzten<br />
Ausweg entwickelten, um das Terrorregime doch noch über den Krieg<br />
hinaus zu retten. Die Idee dabei war sozusagen, sich hinter beziehungsweise<br />
in die Berge zurückzuziehen und hoffnungsvoll abzuwarten, bis<br />
sich Westmächte und Sowjetunion über kurz oder lang bekriegen würden<br />
und man als Dritter diesen Konflikt mehr oder weniger unbeschadet<br />
durchstehen könnte. Vor allem die Kriegsindustrie sollte unterirdisch<br />
im Schutz der Alpen weiterbestehen, um militärische Macht hinüberzuretten.<br />
Die Produktion der Wunderwaffe V2 wurde von Peenemünde<br />
ins oberösterreichische Ebensee verlagert, ihr Treibstoff sollte statt<br />
Bier in den Kellern der Brauerei Zipf hergestellt werden. Inwieweit das<br />
Verstecken oder Versenken von Schätzen dem Sagenhaften zugeordnet<br />
werden muss, ist bis heute Gegenstand von Spekulationen. Aber da die<br />
ganze Aktion so viele unwirkliche oder fantastische Elemente enthält,<br />
eignete sie sich in den Jahrzehnten nach 1945 und in rechten Kreisen<br />
wohl bis heute vorzüglich als eine Art mythischer Nachlass des Dritten<br />
Reiches, der gerne anstelle von Zerstörung, Kriegsopfern und Millionen<br />
Ermordeter thematisiert wurde. Diese Phantasien, die dann auch reichlich<br />
Stoff für Agentengeschichten abgaben, lenken von der Katastrophe<br />
in ihrer Gesamtheit ab und führen von einer politischen Reflexion des
134 — 135<br />
Franz Kapfer<br />
Faschismus weg, hin zur Räuberpistole und zur Vorstellung, man sei<br />
irgendwie doch noch überlegen gewesen, obwohl es dann letztendlich<br />
nicht geklappt hat. Es sind also auch Phantasien, wie sie für Kleinbürger<br />
typisch sind, die so den tristen Gegebenheiten ihres alltäglichen Lebens<br />
entkommen wollen.<br />
Dies führt schon in die zentrale Thematik von Franz Kapfers Kunst. In<br />
seiner künstlerischen Praxis geht es immer um eine Analyse politischer<br />
Kultur, in der die Verhältnisse von den kleinen und sehr konkreten Strukturen<br />
her aufgerollt werden und deren Abbildbarkeit auf die großen<br />
Themen wie Autorität und Unterdrückung in politischen und religiösen<br />
Systemen überprüft wird. Es sind die Symptome im Mikrobereich, die den<br />
Künstler interessieren, von denen aus er zu einer Gesamtheit gelangen<br />
will. In früheren Arbeiten war es vor allem der Austrofaschismus und das<br />
mit diesem im Zusammenhang stehende verwaschene Verhältnis zwischen<br />
Kirche und Staat, das den Kapfer interessiert hat. Aber hier hat er<br />
eben keine Analyse von oben her versucht, sondern den alltagskulturellen<br />
Zeichen nachgespürt, mit denen Politik und Kultur hier repräsentiert<br />
wird, bzw. wie ihrer gedacht wird. Hier gelingt es dem Künstler, durch das<br />
Aufspüren formaler Details oder weitgehend unbekannter inhaltlicher<br />
Querverbindungen Netzwerke freizulegen, die politischen Ideen in ihrer<br />
Gesamtheit – und das heißt vor allem auf allen unterschiedlichen Ebenen<br />
– erfassbar zu machen. Ganz in diesem Sinne erinnern auf einer formalen<br />
Ebene Kapfers künstlerische Produktionen an Bühnenbilder: Im Raum<br />
der Kunst werden sozusagen die einzelnen Requisiten in einer großen<br />
Installation zusammengetragen, und so verweist dieser Raum wiederum<br />
auf Bühne und Inszenierung, genau jene beiden Begriffe, die Kapfer in<br />
seiner Analyse der politischen Verhältnisse als konstituierende Elemente<br />
begreift. Absolute Lächerlichkeit und bitterer Ernst können an keinem<br />
besseren Ort aufeinandertreffen als auf der Bühne.<br />
Ausgangspunkt für die hier gezeigte Arbeit ist wie gesagt die Alpenfestung<br />
mit all ihren historischen und ideologischen Hintergründen. Von<br />
diesem Punkt aus unternimmt Kapfer seine Recherche zum Thema Faschismus.<br />
Er bewegt sich allerdings nicht wie ein Historiker nur in der<br />
Zeit zurück, sondern versucht, Anknüpfungspunkte in der Kultur der<br />
Gegenwart zu finden und so wiederum eine Mikroebene in das Gesamtbild<br />
einzufügen. Dabei geht es ihm wohl auch darum, den Charakter zu<br />
erforschen, der ein autoritäres System überhaupt erst ermöglicht. Diesen<br />
Charakter haben schon früher Denker wie Fromm oder Adorno im Zusammenhang<br />
mit dem Kleinbürger und seinen Phantasien gesehen. Kapfer<br />
kommt hier zu einem ähnlichen Ergebnis, aber nicht aufgrund sozialpsychologischer<br />
Recherche, sondern aufgrund der ihm eigenen Methode einer<br />
formal-inhaltlichen Assoziation. Der Alpenfestung werden jene kleinen<br />
Festungen gegenübergestellt, die beim Bau von Eigenheimen entstehen:
136 — 137<br />
Franz Kapfer<br />
Um das Einfamilienhaus wird eine Gartenanlage befestigt, umzäunt von<br />
Betonwällen oder Pflanzenhecken, sozusagen die natürliche Befestigung<br />
durch die Berge nochmals duplizierend. Daraus nimmt sich Kapfer ein<br />
Detail, das schon zu einer Art Wahrzeichen für kleinbürgerliche Gartengestaltung<br />
geworden ist: Die Thuje, der „Lebensbaum“. In seiner Kunst<br />
wird sie in zweifacher Weise übersetzt. Einmal in ihrer einzelnen Form,<br />
in der sie auf die Form der V2-Rakete verweist, die wie ein riesenhafter<br />
Phallus für Eroberung und Aggression steht, und einmal in der Formation<br />
einer Hecke, die für Schutz und Rückzug steht. Damit wird das Bild der<br />
Alpenfestung auf jenen autoritären Charakter übertragen, der in seiner<br />
Spießigkeit zwischen Abschottung und Schutzbedürfnis einerseits und<br />
Allmachtsfantasien und Eroberung andererseits hin und her schwankt.<br />
Sehr souverän verbindet Franz Kapfer hier sowohl Geschichte und Gegenwart<br />
des Ausstellungsortes als auch die ideologische Formation in<br />
einer großen Perspektive mit ihren individuellen Voraussetzungen.
140 — 141<br />
Peripher idyllisch<br />
Schnappschüsse einer<br />
eigensinnigen Landschaft<br />
Günther Marchner<br />
Ausdrücke wie „handwerkliche Fertigkeiten“ oder „handwerkliche<br />
Orientierung“… verweisen auf ein dauerhaftes menschliches<br />
Grundbestreben: den Wunsch, eine Arbeit um ihrer selbst willen gut<br />
zu machen. Und sie beschränken sich keineswegs auf den Bereich<br />
qualifizierter manueller Tätigkeiten. Fertigkeiten und Orientierungen<br />
dieser Art finden sich auch bei Programmierern, Ärzten und Künstlern.<br />
Richard Sennett: Handwerk, Berlin 2008, S. 19<br />
Vor rund zehn Jahren noch konnte es geschehen, dass sich während<br />
eines Gespräches im Eisenbahnzug ein Bauer beklagte, seine Kinder<br />
seien zu intelligent. Was soll aus uns werden, fragte er, sie wollen<br />
studieren, und wenn sie studiert haben, greifen sie kein Werkzeug<br />
mehr an. Heute wissen auch die Bauern bereits, dass Intelligenz<br />
nützlich sein kann. Nicht nur für die Herrschaften in den fernen<br />
Städten, sondern an Orte und Stelle. Im Dorf.<br />
Herbert Zand: Einsame Freiheit oder Landleben und Zivilisation. In:<br />
Kerne des paradiesischen Apfels. Aufzeichnungen, Wien 1971, S. 42<br />
Die Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.<br />
Eröffnungsworte zum Öblarner Schafbauerntag am 19. März 2010<br />
1<br />
Richard Sennett:<br />
Handwerk. Berlin 2008,<br />
bzw. Richard Sennett:<br />
Der flexible Mensch. Die<br />
Kultur des neuen Kapitalismus.<br />
Berlin 1998.<br />
Skipioniere am Hochmühleck 1909<br />
(Quelle: Familie Loitzl, Foto: Sepp Kain)<br />
In der europäischen Kulturgeschichte wird der „schaffende Mensch“<br />
(Homo faber) als Hersteller von Dingen und Leistungen für die Gemeinschaft<br />
idealisiert. Ihm wird der Mensch als Last tragendes und<br />
von Routine geplagtes Arbeitstier (Animal laborans) gegenübergestellt.<br />
Diese Unterscheidung unterstellt eine Hierarchie zwischen<br />
Gestaltern und Entscheidungsträgern einerseits und den quasi untergebenen<br />
„Ausführenden“ andererseits. Sie erinnert an die Trennung<br />
zwischen Kopf und Hand, zwischen geistiger und manueller Tätigkeit<br />
– und irgendwie auch zwischen Städten als Orte von Macht und<br />
Geist und ländlichen Regionen als Zonen der untergebenen Zuarbeit.<br />
Inmitten der Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitswelt und<br />
des Rationalisierungs- und Wettbewerbsdrucks auf die Realwirtschaft<br />
spricht Richard Sennett, ein bekannter Interpret des flexiblen Menschen,<br />
von „handwerklicher Orientierung“ als menschliches Grundbedürfnis,<br />
gute Arbeit um ihrer selbst Willen zu leisten. 1 Unsere Welt sei von handwerklich<br />
gut gemachten Dingen und Leistungen abhängig. Sennett meint<br />
damit nicht nur das vertraute Bild des klassischen Handwerkers in seiner<br />
Werkstatt, sondern viele Professionelle wie zum Beispiel Künstler,<br />
Wissenschafterinnen, Ärzte, Komponisten, Designerinnen, Köche oder<br />
Hebammen, die hochmotiviert und qualitätsorientiert Dinge herstellen<br />
oder Leistungen erbringen, für die sie Kopf und Hand (= Fertigkeit durch<br />
Übung) brauchen. Und er widerspricht der Unterscheidung zwischen Homo<br />
faber und Animal laborans. Denn bei allen arbeitenden Menschen – seien<br />
es Bäuerinnen, Handwerker, Köche, Facharbeiterinnen oder Frisöre – sind<br />
für eine gute Arbeit Motivation, Fertigkeit, Verantwortung und Qualitätsorientierung<br />
wesentlich, müssen Kopf und Hand „im Dialog“ stehen.
142 — 143<br />
Günther Marchner<br />
Sägewerk Loitzl in den 1920er-Jahren<br />
(Quelle: Familie Loitzl, Fotograph unbekannt)<br />
In wohl keinem Bereich wird das Wunschbild einer motivierenden, sinnerfüllenden<br />
und naturnahen Tätigkeit so „hinein idealisiert“ wie in die bäuerliche<br />
Landwirtschaft oder in das Handwerk in ländlichen Regionen. Auch<br />
wenn die vielen kleinen Landwirtschafts-, Handwerks- und Gewerbebetriebe<br />
auch in den Gegenden des Bezirks Liezen einem enormen Druck,<br />
oft bei abnehmenden Erträgen, entwerteter Arbeit und der lähmenden<br />
Erfahrung der Konkurrenz durch Massenprodukte und Großstrukturen<br />
ausgesetzt sind, verbunden mit Perspektivlosigkeit für Betriebsnachfolger/innen.<br />
Auch wenn in dieser agrarisch anmutenden, von Montan-<br />
Traditionen durchzogenen Region die meisten Menschen nicht in diesen<br />
Bereichen tätig sind. In einer Region, die nur in wenigen Fällen „Austragungsort“<br />
einer großen Dienstleistungsindustrie – Seilbahngesellschaften,<br />
touristische Leitbetriebe, Eventmacher – sowie einer Immobilien-<br />
und Finanzwirtschaft mit entsprechenden Erträgen ist. In einer Region, in<br />
der die klassische Trennung zwischen manueller und geistiger Tätigkeit<br />
spürbar wird: durch die Abwanderung von Menschen mit „höheren“ technischen<br />
und anderen Qualifikationen in die Ballungsgebiete. Oder durch<br />
die Minderwertschätzung von vorrangig manuell tätigen Lehrberufen<br />
und damit auch jenen Menschen, die in der Regel in der Region bleiben.<br />
Ob Pionier und Erneuerer, Gestalter und Zerstörer seiner Umwelt und<br />
Landschaft, bedauertes Arbeitstier oder romantisiertes Wesen in der<br />
alpinen Idylle: Der „schaffende Mensch“ kommt in den Gegenden des Bezirks<br />
Liezen – wie in einer Bildergalerie – in vielerlei Gestalten daher. Und<br />
das oft in eigensinniger Form.<br />
2<br />
Siehe dazu: Richard<br />
Lamer: Das Ausseer Land:<br />
Geschichte und Kultur<br />
einer Landschaft. Graz:<br />
Styria 1998, S. 63-66.<br />
3<br />
Siehe dazu: Siegfried<br />
Ellmauer: Ohne Holz kein<br />
Salz. Maximilian Edler von<br />
Wunderbaldinger. Wegbereiter<br />
der neuzeitlichen<br />
Forsteinrichtung. In:<br />
Thomas Hellmuth u.a.<br />
(Hg.): Visionäre bewegen<br />
die Welt. Ein Lesebuch<br />
durch das Salzkammergut.<br />
Salzburg: Pustet<br />
2005, S. 150-161.<br />
4<br />
Vgl. dazu: Gerhard Longin:<br />
Landwirtschaft aus dem<br />
Lehrbuch. Paul Adler und<br />
sein Leben für den bäuerlichen<br />
Fortschritt. In:<br />
Thomas Hellmuth u.a.<br />
(Hg.): Visionäre bewegen<br />
die Welt. Ein Lesebuch<br />
durch das Salzkammergut.<br />
Salzburg: Pustet 2005,<br />
S. 143-149; Hermann<br />
Baltl: Paul Adler – Ein<br />
Leben für den bäuerlichen<br />
Fortschritt. Graz: Leykam<br />
1984.<br />
5<br />
Siehe dazu: Landgenossenschaft<br />
Ennstal (Hg.):<br />
Ein Wal im Wandel der<br />
Zeit, Stainach 1983.<br />
Pioniere, Visionäre, Innovatoren<br />
Ein Vorurteil lautet, dass Neuerungen immer von den wirtschaftlichen und<br />
politischen Machtzentren ihrer jeweiligen Zeit ausgingen und dass der ländliche<br />
Raum in der Regel diese zu erleiden, zu erdulden oder nachzuahmen<br />
hatte. Aber die Geschichte von Regionen ist nicht allein eine Geschichte<br />
des passiven Erlebens äußerer Veränderungen, seien es Krisen, rasante<br />
Umwälzungen oder – positiv gewendet – die Umverteilung von Wohlstand<br />
und Wachstum. Die „schaffenden Menschen“ waren an Veränderungen in<br />
ihrer Region immer auch aktiv beteiligt. Und sie nutzten veränderte Rahmenbedingungen<br />
und Gelegenheiten für die Einführung von Neuerungen.<br />
So ist auch diese Region nie nur „Objekt“ der von außen angestoßenen<br />
Veränderungen gewesen, wie zum Beispiel der erzherzoglichen Organisation<br />
des Bergwerkswesens und damit verbundener Nebengewerbe über<br />
mehrere Jahrhunderte. Oder der Angliederung an die überregionale Industriegesellschaft<br />
durch den Eisenbahnbau Ende des 19. Jahrhunderts.<br />
Der Integration in überregionale Tourismus- oder landwirtschaftliche<br />
Absatzmärkte im 20. Jahrhundert. Oder der Etablierung staatlicher Industrien<br />
im Dritten Reich und in der Zweiten Republik auf der Grundlage<br />
vorhandener montaner Traditionen. Neuerungen waren zumeist mit<br />
Pionieren und innovativen Persönlichkeiten aus der Region verbunden.<br />
Sei es zum Beispiel Christoph von Praunfalk, der in der frühen Neuzeit<br />
die Grundlage für die Modernisierung der Ausseer Salinen und für eine<br />
ökonomische Nutzung der Waldbestände legte. 2 Oder ein Pionier der<br />
modernen Forstwirtschaft, wie der im Salzkammergut tätige Max von<br />
Wunderbaldinger. 3 Dazu zählen auch der Hinterberger Bauer Paul Adler,<br />
der sich als Freund der steirischen Leitfigur Erzherzog Johann für eine<br />
Verbesserung und Modernisierung der Landwirtschaft seiner Region einsetzte.<br />
4 Der Gröbminger Bauer Franz Haiger, der die Initiative zur Gründung<br />
der Käsereigenossenschaft Gröbming im Jahr 1900 ergriff und somit<br />
den Grundstein für die spätere Landgenossenschaft Ennstal und für die<br />
Schaffung gemeinschaftlicher Verarbeitungs- und Absatzmöglichkeiten<br />
legte. 5 Der ehemalige Ausseer Salzfuhrmann Johann Loitzl, der sein Kontaktnetz<br />
und sein kaufmännisches Talent nutzte, um als Hinterberger<br />
Sägewerksbesitzer auf das neue Eisenbahnnetz für den Holzexport zu<br />
setzen. Oder jene Skipioniere, die noch in der Zeit der k.k. Monarchie die<br />
Möglichkeiten ihrer Landschaft wie auf der Tauplitzalm, im Hinterbergertal<br />
oder anderen Gegenden der Region mit den Bedürfnissen städtischer<br />
Skiverrückter aus Wien, Graz und München verknüpften. Oder Bergsteigerpioniere<br />
wie die Steinerbrüder in der Ramsau, die mit ihrer Route durch<br />
die Dachsteinsüdwand Aufsehen erregten. Oder ein Schneider wie Robert<br />
Kanzler, der im Dialog mit dem Skisportler Leo Gasperl in den 1930er-<br />
Jahren die „Keilhose“ entwickelte, Jahrzehnte bevor der sicherlich dafür<br />
passende Ausdruck „Creative Industries“ überhaupt in Verwendung
144 — 145<br />
Günther Marchner<br />
6<br />
Vgl. dazu: Rudolf<br />
Raimund Gross: Bad<br />
Mitterndorf, Liezen 1972;<br />
Dokumentationsarchiv<br />
„Kultur in der Natur“<br />
zur Gemeinde Bad<br />
Mitterndorf (noch<br />
unveröffentlicht); Günter<br />
Cerwinka und Walter<br />
Stippberger (Hg.): Schladming.<br />
Geschichte und<br />
Gegenwart, Schladming<br />
1996; Herbert Thaller:<br />
Ramsau am Dachstein.<br />
„Land und Leut`“. Eine<br />
zeitgeschichtliche<br />
Photodokumentation,<br />
Schladming, o.J.; Günther<br />
Cerwinka: Bauern. Bibel.<br />
Berge. Ramsau am Dachstein,<br />
Ramsau 1999.<br />
7<br />
Vgl. dazu: Ernst Hanisch:<br />
Der lange Schatten des<br />
Staates. Österreichische<br />
Gesellschaftsgeschichte<br />
im 20. Jahrhundert. Wien<br />
1994.<br />
8<br />
Herbert Zand: Einsame<br />
Freiheit oder Landleben<br />
und Zivilisation. In:<br />
Kerne des paradiesischen<br />
Apfels. Aufzeichnungen.,<br />
Wien: Europaverlag, 1971,<br />
S. 42. Der aus Knoppen<br />
(Gemeinde Pichl-Kainisch)<br />
stammende Herbert<br />
Zand erhielt Anfang der<br />
1950er-Jahre den Österreichischen<br />
Staatspreis<br />
für Literatur.<br />
kam. Oder unternehmerische Persönlichkeiten wie der Bad Mitterndorfer<br />
Langzeitbürgermeister Siegfried Saf, der in den 1960er-Jahren die Rahmenbedingungen<br />
des deutschen Wirtschaftswunders für den Aufbau des<br />
Massentourismus ebenso nutzte wie die Schladminger und Ramsauer,<br />
deren Sprung zur Massentourismus in Seilbahnprojekten auf den Dachstein,<br />
in Sportstadien und spektakulären Wintersport-Events mündete. 6<br />
Stets war es die Schaffenskraft von regionalen Pionieren, Visionären und<br />
Innovatoren in dieser ländlich-patriarchalen Welt, die allgemeine Bedingungen<br />
und darin liegende Chancen erkannten und für Neuerungen nutzten,<br />
neue Existenz- und Erwerbsmöglichkeiten schufen, zur Bewältigung<br />
von Krisen beitrugen – gelegentlich aber auch zur Schaffung nachfolgender<br />
Krisen. Es war ihre Schaffenskraft, die mit der Einführung von Neuem<br />
in einer traditionsreichen Gegend damit immer auch „Gewachsenes“ wie<br />
„Gewohntes“ zerstörte.<br />
Animal laborans als Homo ludens<br />
Bis in das 20. Jahrhundert war der „schaffende Mensch“ in den<br />
vergleichsweise armen Alpentälern der k.k. Monarchie Teil einer<br />
bäuerlich-dörflichen Welt, geprägt von harter Arbeit und einem bescheidenen<br />
Leben, autarker Selbstversorgungswirtschaft, geringen<br />
Marktbeziehungen, eingeschränkten Konsummöglichkeiten, strenger<br />
sozialer Kontrolle und einem Aufeinanderangewiesensein in dörflichen<br />
Gemeinschaften 7 – in den Gegenden des Bezirks Liezen ergänzt durch<br />
Zuverdienstmöglichkeiten im Bergbau, in der Holzwirtschaft, im Fuhrwerk<br />
oder Handwerk, erst später gelegentlich durch den Tourismus.<br />
Der aus der Region stammende Schriftsteller Herbert Zand betonte in<br />
den 1960er-Jahren in seinem Essay Einsame Freiheit oder Landleben<br />
und Zivilisation die illusionslose und unromantische Seite des Arbeitens<br />
und Lebens auf den Höfen und in den Dörfern seiner Heimat – gegen eine<br />
falsche Idealisierung des Landlebens. 8 Für ihn war es eine Welt, wo die<br />
Menschen durch ihre Arbeit „der Natur“ ständig näher waren, als es städtische<br />
Naturliebhaber je sein konnten, eingebunden in einen gnadenlosen<br />
Jahreskreislauf und eine karge Basis, die kaum Freiheiten für anderes zuließ.<br />
Aber Zand nahm auch wahr, wie diese Welt auch ein gewisses Maß<br />
an Eigenständigkeit und Freiheiten von Menschen ermöglichte, vorausgesetzt<br />
sie waren in der Lage, mit diesen Bedingungen zurechtzukommen.<br />
Diese bäuerliche, mit Bergbau, Forstwirtschaft und Fuhrwesen vermischte<br />
Welt, wie sie diese Region prägte, war aber nicht nur eine Zone<br />
hart arbeitender Menschen außerhalb der Städte, die keinen Geist und<br />
Sinne für mehr hatten. Sondern sie war auch eine Welt voller Fertigkeiten,<br />
voller Stolz und voller Kreativität. Der in Spital am Phyrn aufgewachsene<br />
Siegfried Saf bei der<br />
Errichtung der Tauplitzalmstrasse<br />
Anfang der<br />
1960er Jahre<br />
(Quelle: Frau Saf,<br />
Fotograf: Sepp Kain)<br />
9<br />
Roland Girtler: Sommergetreide.<br />
Vom Untergang<br />
der bäuerlichen Kultur.<br />
Wien: Böhlau 1996.<br />
10<br />
Vgl. dazu: Nora Schönfellinger<br />
(Hg.): „Conrad<br />
Mautner, großes Talent“.<br />
Ein Wiener Volkskundler<br />
aus dem Ausseerland.<br />
Grundlsee: Kulturelle<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Grundlsee 1999.<br />
11<br />
Vgl. dazu: Vom Leben auf<br />
der Alm. Ausstellungskatalog.<br />
Kleine Schriften<br />
des Landschaftsmuseum<br />
Schloß Trautenfels am<br />
steiermärkischen Landesmuseum<br />
Joanneum, Heft<br />
12. Trautenfels 2004.<br />
österreichische Soziologe Roland Girtler beschreibt diese Welt, die er als<br />
Jugendlicher nach dem Zweiten Weltkrieg noch erlebt hatte und welche<br />
in den 1950er- und 1960er-Jahren zu Ende ging: 9 Eine bäuerliche Kultur,<br />
die seit dem Mittelalter nach dem Prinzip der Selbstversorgung lebte<br />
und wo Menschen nebenher Einnahmequellen erschlossen, wie im Bereich<br />
des ländlichen Handwerks, im Bergbauwesen, als Holzknechte und<br />
Holzführer – oder ab dem späten 19. Jahrhundert im Ausseerland durch<br />
die Aufnahme und Versorgung von „Herrschaften“ aus den Städten über<br />
die Sommermonate. Diese Welt war voller Fertigkeiten und Erfahrungswissen:<br />
Nicht nur von Ennstaler Bauern, sondern auch von Handwerkern,<br />
wie jene entlang der Salzstrasse wie an einer Perlenschnur aufgefädelten<br />
Schmiede, Wagner oder Sattler. Oder die Schneider und Schuster,<br />
die „auf Stör“ von Hof zu Hof zogen, Kleider und Schuh richteten und<br />
herstellten. Oder die stolzen und gewiss privilegierten Salinenbergleute<br />
und Salzfuhrleute. Oder jene Holzknechte und Holzführer, die in der<br />
Lage waren, harte und gefährliche Handarbeit im Wald zu verrichten.<br />
Dabei war nicht nur der arbeitende Mensch am Werk, sondern vielfach<br />
auch der Homo ludens. Nicht zufällig „entdeckte“ das städtische Bürgertum<br />
bei seiner Flucht in die idyllische Sommerfrische, dass die Menschen<br />
auf dem Lande nicht nur eine „arbeitende Masse“, sondern auch<br />
kreative und originelle Kulturschöpfer waren. Die Begeisterung für diese<br />
Menschen, im Besonderen für ihre Volksmusik, drückte sich gerade im<br />
Ausseerland aus, wie zum Beispiel bei Konrad Mautner, der sich als<br />
Abkömmling einer Industriellenfamilie in einen begeisterten Gössler<br />
verwandelte. 10 Vielleicht klingt in der überdurchschnittlich hohe „Musikantendichte“<br />
der Region, die in keiner öffentlichen Statistik als bemerkenswerte<br />
Erscheinung vorkommt, diese Seite des Homo ludens noch nach.<br />
Zu dieser besonderen Welt gehörten auch Almen und Berge, jener<br />
„erste Stock“ der Region, den auch Herbert Zand in seiner biografischen<br />
Erinnerung als Achse der Freiheit und des mythischen Zaubers<br />
erlebte. Nicht zufällig wurde das „Almleben“, trotz harter und verantwortungsvoller<br />
Arbeit, jedoch verbunden mit geringerer sozialer<br />
Kontrolle und mit mehr Freiheit, zum besonderen „Labor“ volkskultureller<br />
Ausdrucksformen und Gegenstand späterer Idealisierung. 11<br />
Die Zeit der Modernisierung und des großen Wandels ländlicher Regionen<br />
vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg machte jedoch auch sichtbar, wie<br />
gerne Menschen aus dieser kargen bäuerlich geprägten Welt flüchteten,<br />
hinein in eine Welt der – in dieser Region oft staatlichen – Arbeitsplätze<br />
in Industrie und Dienstleistung, die mehr Rechte, weniger Schinderei und<br />
mehr Wohlstand bedeutete. Vielleicht war die rasante Modernisierung in<br />
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ablehnung alles Ländlichen,<br />
Regionalen und Alten und die Zuwendung zur modernen materiellen Kultur<br />
seit den 1960er-Jahren auch ein Ausdruck dieser Flucht.
146 — 147<br />
Günther Marchner<br />
12<br />
Thomas Hellmuth u.a.:<br />
Visionäre bewegen die<br />
Welt, Ein Lesebuch durch<br />
das Salzkammergut.<br />
Salzburg: Pustet 2005.<br />
13<br />
Daten laut „Rauminformationssystemsystem<br />
Steiermark. Regionalprofil<br />
Liezen“ (ein Projekt der<br />
Initiative Regionext des<br />
Landes Steiermark): Im<br />
Jahr 2005 waren 7% der<br />
Erwerbstätigen in der<br />
Land- und Forstwirtschaft,<br />
30% in Industrie<br />
und Gewerbe, 63% im<br />
Bereich der Dienstleistungen<br />
beschäftigt.<br />
Die romantische Idealisierung ländlich-alpinen Schaffens<br />
Alpine Landschaften dienten seit der Industrialisierung und seit ihrer<br />
romantischen „Entdeckung“ als vielfältige Projektionsflächen: sowohl für<br />
bürgerliche Fluchtbewegungen als auch für wärmestiftende Heimatbilder<br />
im Gegensatz zur Unwirtlichkeit und Unbehaglichkeit der industriellen<br />
Moderne. Die Landschaften des Bezirks Liezen – vor allem das Ausseerland<br />
– zeugen davon mit reichhaltigem Material. 12 Die arbeitenden<br />
Menschen in ländlichen Regionen – vor allem Bauern, Handwerker, Jäger,<br />
Holzknechte oder Sennerinnen – schienen für Adel und Bürgertum einem<br />
„Leben mit der Natur“ näher zu stehen. Sie idealisierten das harmonisch<br />
erscheinende und bescheidene Leben eines stolzen und eigensinnigen<br />
„Menschenschlages“. So entstanden Mythen des einfachen Volkes in<br />
einer heilen ländlichen Welt, nachhaltig wie wirkungsvoll besungen etwa<br />
von Erzherzog Johann<br />
Im Hinblick auf Idealisierung bis hin zum politischen Missbrauch stand<br />
im Besonderen immer das Bild des „stolzen unabhängigen Bauern“ im<br />
Mittelpunkt: zum Beispiel als Repräsentant des „einfachen und fleißigen<br />
Volkes“, als Vertreter einer ständischen Gesellschaftsordnung,<br />
oder – wie in der NS-Zeit – als tragendes Element einer Blut-und Boden-<br />
Mythologie. Heute ist es das Bild des Bauern als spezialisierter selbständiger<br />
Unternehmer. Dieses Bild kollidiert aber auch in dieser Region<br />
mit einer Realität, in welcher die Mehrheit der immer weniger werdenden<br />
Landwirtschaftsbetriebe zu abhängigen Gliedern einer Agrarmaschine<br />
geworden ist, eingespannt in vor- und nachgelagerte Bereiche einer Bereitstellungs-<br />
und Verarbeitungsindustrie und eines dschungelartigen<br />
Vertretungs- und Förderwesens.<br />
Ländlich-alpine Regionen werden auch in aktuellen Vorurteilen und<br />
Wunschbildern vieler Menschen noch immer als vorrangig „agrarische“<br />
Welt verstanden, ergänzt mit Tourismus und Naturschutz. Andere Bereiche<br />
wie Dienstleistung und neue Industrien, Forschung, Wissenschaft<br />
oder „Kreativwirtschaft“ sind in diesen Vorstellungen des ländlichen<br />
Raumes gar nicht vorgesehen – auch wenn die meisten Menschen im<br />
Bezirk Liezen nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sind und obwohl es<br />
in dieser Region immer auch schon andere Branchen und Berufe gegeben<br />
hat. 13<br />
Der schaffende Mensch als Gestalter und Zerstörer seiner Umwelt<br />
Der „schaffende Mensch“ als Gestalter – und auch als Zerstörer – seiner<br />
Landschaft und Umwelt, manifestierte sich in der Region vielfältig: zum<br />
Beispiel in der Bewirtschaftung der Wälder für die Ausseer Salinen, die<br />
die Landschaften seit dem Mittelalter mitformte. In der Regulierung der<br />
14<br />
Der Begriff wurde verwendet<br />
in: Stefan Karner: Geschichte<br />
der Steiermark<br />
im 20. Jahrhundert. Graz:<br />
Styria 2000.<br />
Enns und die Nutzbarmachung des Talbodens für Verkehr und Landwirtschaft<br />
im 19. Jahrhundert. In der rasanten Veränderung der Kulturlandschaft<br />
durch Meliorationen, Mechanisierung, Flurbereinigung, Produktivitätssteigerung<br />
und Spezialisierung auf Grünlandbewirtschaftung.<br />
Oder im Wandel von der ennstalerischen Heuhütten- in eine Heuballen-<br />
Landschaft, unterbrochen vom Zeitalter der Betonsilos der 1970er- und<br />
1980er-Jahre.<br />
Oder durch den Wandel der Verkehrswege in der Region, wie zum Beispiel<br />
mit dem markanten Beginn des Eisenbahnzeitalters in den 1870er-<br />
Jahren (was erst durch die Regulierung der Enns möglich geworden war).<br />
Historisch waren die Verkehrswege oft quer zum Talboden verlaufen, zum<br />
Beispiel vom Pass Stein ins Sölktal oder durch das Donnersbachtal über<br />
das Gladjoch Richtung Süden. Die uns heute bekannten Hauptstrecken<br />
durch die Talböden waren nicht immer die wichtigsten, da technisch genauso<br />
rasch (oder langsam) zu bewältigen, wie die Saumpfade über die<br />
Alpen. Der Bau des Eisenbahnnetzes veränderte durch die Einbindung<br />
der Region in ein überregionales Industriesystem die Bedingungen des<br />
Wirtschaftens in der Region ebenso radikal wie der spätere motorisierte<br />
Straßenverkehr. In den 1970er-Jahren wurde das Ennstal zur gefürchteten,<br />
da gewundenen, langsam zu befahrenden, vom Verkehr überrollten<br />
„Gastarbeiterroute“. Eine Entwicklung, die schließlich zur Planung der<br />
„Ennsnahen Trasse“ führte, die nicht nur als Verkehrsweg, sondern auch<br />
als Konfliktlinie von Befürwortern und Gegnern das Tal in zwei Hälften<br />
schneidet.<br />
Oder sei es der Tourismus, der in den Gesichtern mancher Gemeinden<br />
seine Spuren hinterließ, sogar bis hin zum „totalen Tourismus“ 14 , der<br />
als teilweise realisierte Vision in den 1970er-Jahren z.B. die Gemeinde<br />
Bad Mitterndorf prägte, bis der Bauboom aufgrund des zunehmend unbehaglichen<br />
Gefühls quer durch alle Gemeinderatsfraktionen in einem<br />
Baustopp mündete. Genauso wie in der Dachstein-Tauernregion, wo die<br />
Tourismusinfrastruktur den umliegenden Bergen einen nachhaltigen<br />
Stempel aufdrückt.<br />
Regionalität als Aufstand gegen Entwertung<br />
„Regionalität“, jenes Schlagwort, das im Schatten der Globalisierung zur<br />
Konjunktur gelangte, lebt nicht nur vom der Erfahrung des Verschwindens<br />
nahräumlicher Qualitäten, sondern vor allem vom „Aufstand“ gegen<br />
einen schleichenden Entwertungsprozess lokal gebundener Erwerbstätigkeit<br />
und Wertschöpfung. Dieser Wandel, der traditionelle wirtschaftliche<br />
Kleinstrukturen unter Druck setzt, hat seine Auswirkungen auch in<br />
einem Bezirk wie Liezen, wo Wertschöpfung, Kaufkraft und Humanressourcen<br />
in einem stetigen Prozess an Ballungsräume verloren gehen oder
148 — 149<br />
Günther Marchner<br />
15<br />
Siehe dazu: www.meisterstrasse.at<br />
16<br />
Vgl. dazu: Landschaft des<br />
Wissens (Hrsg.): Strategien<br />
des Handwerks.<br />
Sieben Portraits außergewöhnlicher<br />
Projekte in<br />
Europa. Stuttgart 2006.<br />
sich an wenigen verkehrsgünstigen Punkten und attraktiven Standorten<br />
in der Region konzentrieren.<br />
Bereits vor drei Jahrzehnten ist dagegen die Idee der „eigenständigen Regionalentwicklung“<br />
geboren worden – die auch in der Programmatik des<br />
europäischen Förderprogramms „Leader“ ihren Ausdruck findet. Statt auf<br />
Betriebsansiedlungen, Wachstumseffekte und den Segen von außen und<br />
von oben alleine zu hoffen, werden mit dieser Idee die vorhandenen Potenziale<br />
und Stärken der Menschen einer Region und das gemeinschaftliche<br />
innovative Handeln und Erneuern in den Mittelpunkt gestellt. Diese<br />
Idee erzählt im Grunde von nichts anderem als von „schaffenden“ und<br />
„eigensinnigen“ Menschen als Motoren für die Entwicklung in Regionen.<br />
Gerade in der Konzentration auf wertschöpfende Potenziale und identitätsschaffende<br />
Qualitätsprodukte einer Region wird die Wiederaufwertung<br />
von vorhandenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um<br />
gute Arbeit zu machen und Qualität zu schaffen, zum Leitmotiv. Erzählt<br />
nicht gerade die Vermarktungsplattform der „Meisterstraße“, die die Renaissance<br />
österreichischer Handwerkskultur propagiert, und der inzwischen<br />
viele Betriebe im Salzkammergut und im Ennstal angehören, nicht<br />
vom Stolz auf die eigene Qualität, auf die Besonderheit originärer wie<br />
kreativer Leistungen und von ihrem Beitrag zu Wertschöpfung und Lebensqualität<br />
in der Region? 15 Sind nicht die Ennstaler Lodenwalkereien<br />
Beispiele für „neue Strategien des Handwerks“ 16 und für Betriebe, die es<br />
schaffen, traditionelle Verfahren und gewachsenes Wissen mit Spezialisierung<br />
und Nischen-Marketing zu kombinieren und sich in einer Wirtschaft<br />
zu behaupten, in welcher eine europäische Textilindustrie kaum<br />
noch eine Rolle spielt?<br />
Sind die Landschaften des Bezirks nicht voll brach liegendem und unsichtbar<br />
gewordenem Erfahrungswissen in Land- und Forstwirtschaft, in<br />
der Holzverarbeitung, in montanistischen Techniken oder im Tourismus,<br />
die in neuen Kombinationen und Modellen auch in der „Wissensgesellschaft“<br />
genutzt werden können?<br />
Vielleicht tritt der „schaffende Mensch“ in dieser Region zukünftig<br />
vermehrt als jugendlicher Neugründer, als kreative Bäuerin, als initiative<br />
Dienstleisterin oder als engagierter Migrant ebenso hervor wie als<br />
neuartige Kooperation zwischen Gewerbetrieben oder als kleingenossenschaftliche<br />
Initiative in der Landwirtschaft – wie es zum Beispiel die<br />
„Hinterberger Landpartie“ als Plattform von rund 15 Bauern tut.<br />
Auf der Suche nach dem regionalen Eigensinn<br />
Eigensinn wird den Landschaften des Bezirks Liezen zugeschrieben –- positiv<br />
wie negativ. Aber was ist damit gemeint? Ist es ein bäuerlicher Katholizismus<br />
oder eine sozialdemokratische Holzknechtkultur, die so manche<br />
gegen den Nationalsozialismus immunisierte oder der Eigensinn mancher<br />
Menschen aus dem Salzkammergut, der sie in den spanischen Bürgerkrieg,<br />
zur Desertion von Kriegseinsatz und zum Versteck ins Tote Gebirge geführt<br />
hat. Ist es der Eigensinn mancher Ortschaften, wo das geheimprotestantische<br />
Verstecken und Zusammenhalten gegenüber der katholisch-habsburgischen<br />
Obrigkeit noch heute seine kulturellen Spuren hinterlässt, obwohl<br />
in den meisten Fällen jegliche Überlieferung an reformatorisches Aufbegehren<br />
gelöscht worden ist? Oder ist es der Eigensinn des „Ausseers“, der in<br />
seinen Jahreskalender gleich mehrere heilige Faschings- und Bierzelttage<br />
einbaut, um gesellschaftliche Normen und Pflichten außer Kraft zu setzen<br />
und welcher im Wechselspiel zwischen Einheimischen und bewundernden<br />
„Zuagroasten“ zum überregionalen Markenartikel geworden ist? Oder der<br />
Eigensinn von Menschen, die – wie einst die Figur des murtalerischen Hödlmosers<br />
– gar nicht wissen, dass sie sich in einer peripheren Lage befinden<br />
und die eigene Welt immer als Mittelpunkt „rationalisieren“, um gar keine<br />
defizitären Gefühle aufkommen zu lassen, und eben Graz und andere „abgelegene“<br />
Gegenden zur unwichtigen Peripherie erklären? Oder jener Eigensinn,<br />
der scheinbar selbstbewusst, aber bildungsfeindlich daherkommt und<br />
der entsteht, wenn man sich ausgeschlossen fühlt, nicht mehr mitkommt<br />
und auf „eckig sein“ pocht, im Widerstand gegen eine Modernisierung, von<br />
der man sich ausgeschlossen fühlt. Oder ist es der Eigensinn von Personen,<br />
die sich in einer Region ohne bürgerlich-städtische Kultur erlauben,<br />
in der Öffentlichkeit „abweichende“ und kritische Meinungen zu äußern?<br />
Oder vielleicht der Eigensinn, der in der unnachahmlichen Querfeldinterpretation<br />
von Volksmusik und Jazz bei der Wörschacher „Lemmerer Musi“<br />
zum Ausdruck kommt?<br />
In einer Arbeitswelt, die den Menschen Anpassung und Funktionieren abverlangt,<br />
wird Querdenken und Kreativität zunehmend als Quelle für Innovation<br />
gesehen, sodass in der heutigen Wettbewerbsgesellschaft überall<br />
nach eigensinnigen Menschen mit neuen Ideen gesucht wird. Heute hängen<br />
auch die Möglichkeiten von ländlichen Regionen immer weniger von<br />
Grund und Boden, sondern vor allem von Wissenspotenzialen ihrer Menschen<br />
sowie von Motivation und Eigensinn ab. Und obwohl die „Statistik<br />
Austria“ und wahrscheinlich alle Raum- und Regionalexperten aufgrund<br />
vorhandener Daten und der topografisch-strukturellen Lage den Bezirk<br />
Liezen zur strukturschwachen und peripheren Region erklären, wird in<br />
Schladming oder vor allem auch im Ausseerland niemand daran zweifeln,<br />
sich trotzdem im Mittelpunkt der Welt zu befinden.
150 — 151<br />
Der Autor, seine realen und<br />
fiktiven Protagonisten<br />
Wegnotizen auf einem literarischen<br />
Weitwanderweg<br />
Text: Peter Gruber<br />
Bilder: Kurt Hörbst<br />
� � Im Sommer lebe ich im Dachsteingebirge. Auf einer Alm. In einer<br />
Textwerkstätte. In einer Denkhütte. Mit Blick auf den Dichterfelsen, von<br />
dessen höchstem Punkt einst mein literarischer Weg seinen Ausgang<br />
nahm. Ein Weg, der längst zum Weitwanderweg wurde. Ein Weg, der<br />
mich zunächst in die Notgasse führte, eine bizarre Felsenschlucht<br />
inmitten des Kemetgebirges, danach durch wildreiche Hochwälder in die<br />
düstere Tälchenfurche mit dem Schattenkreuz lenkte, von dort aus auf<br />
die Hirzberghöhen und weiter auf das Wind und Wetter ausgesetzte<br />
Karstplateau zum Tod Am Stein, und schließlich im gwändigen öden<br />
Gebürg in den Sommerschnee. Ein Weitwanderweg, der gewissermaßen<br />
mit meinen literarischen Werken Hand in Hand geht und einen chronologischen<br />
Bogen von fast 500 Jahren übers Dachsteingebirge spannt, vom<br />
Spätmittelalter bis in die Gegenwart. Ein Weg, dessen Tritte in den<br />
Tälern, Stufen auf den Höhen, Fußstapfen im Schnee und Schritte im<br />
Nebel ich gerne erneut abschreite, jedenfalls gedanklich, auf der Suche<br />
nach besonderen Wegnotizen und nach Begegnungen mit jenen Menschen,<br />
die meinen Weitwanderweg kreuzten, und die seither wie Wegmarken<br />
in meinen Erinnerungen leben, ob realer oder fiktiver Natur. � �<br />
Etappe I: Die Blütezeit des Almlebens, die Anfänge der Reformation, der<br />
Bauernaufstand im Jahr 1525. Etappe II: Die Hoch-Zeit der verbotenen<br />
Jagd, die Wilderei, das Aufeinanderprallen von Wildschützen und Jägern,<br />
vor dem Hintergrund der Zwischenkriegszeit und der Wirren der Ersten<br />
Republik. Etappe III: Die Erschließung des Gebirges als internationale<br />
Fremdenverkehrsattraktion, das unvergessliche Unglück der Heilbronner<br />
Schüler und Lehrer. Etappe IV: Die gegenwärtige Situation der Dachstein-Almen,<br />
die kaum noch erhebliche wirtschaftliche Bedeutung<br />
haben, heutzutage auch als Rückzugsorte für Identität suchende Menschen<br />
dienen – so etwa für mich, den Hüterautor, wie mich der Alm-<br />
Kunst-Kurator zu benennen pflegt. � � Der 23. Oktober 1994 ist ein<br />
Bilderbuchtag. Auf den Almhöhen strahlen die Lärchen, bronzefarbene<br />
Nadeln tänzeln durch die Lüfte, entkleiden die knorrigen Uraltriesen,<br />
lassen dünnes Gezweige mehr und mehr nackt zurück, besäen die frosterstarrten<br />
Mulden und länger und länger werdenden spätherbstlichen<br />
Schatten. Auf einem meiner liebsten Aussichtshöcker im Gebirge lasse<br />
ich die Gedanken lustwandeln. Ich stelle mir vor, wie es gewesen sein<br />
mag, vor Jahrhunderten, als die Steige und Almen mindestens so sehr<br />
belebt waren wie die Dörfer und Märkte in den umliegenden Tälern. Ich<br />
stelle mir das rege Leben und Treiben recht fantasievoll vor. In den Almdörfern<br />
mit dutzenden von niedrigen Hütten, mit hunderten von Almtieren,<br />
mit unzähligen Menschen, Frauen und Männern, Kindern und Alten.<br />
Ich ahne, wie die Almschreie und Juchzer der Almleute und die Glocken<br />
und Schellen des Almviehs die Höhen zum Erklingen gebracht haben.<br />
Die Vorstellung, eine große Geschichte über die Almen im Dachsteingebirge<br />
zu schreiben, beseelt mich. Meine Idee vom Leben auf der Hirzbergalm<br />
nimmt ihren Anfang, ebenso die vom Sterben in der Notgasse. � �<br />
Ein umtriebiger Felsritzbildhüter gewährt mir Zugang und Einblick in<br />
ein reichhaltiges Archiv. Ich orte die Anfänge der Reformationszeit als<br />
die veränderungsstärkste Epoche aller Zeiten im und rund um das Dachsteingebirge,<br />
die Jahre von 1523 bis 1525. Mit dem vereinten Aufstand<br />
der Bergknappen und Bauern gegenüber Grundherrschaften. Mit einem<br />
Rebellenheer von 10.000 Mann, das sich gegen die Söldner des Landesfürsten<br />
stellt, im Ennstal und im Paltental, einen blutigen, unerbittlichen,<br />
zunächst durchaus erfolgreichen Kampf führt. Aber das Kriegsglück<br />
ist für die Aufständischen nur von kurzer Dauer. Die Notgasse<br />
gerät in den Mittelpunkt der Geschichte, als unheimlicher Ort, an dem<br />
dämonische Kräfte walten. Der gleichnamige Romantitel soll zugleich<br />
eine Metapher sein für Leid, Schuld und deren Überwindung. � �<br />
Aneignen eines sonderbaren Glossars: Aderlassen (den Kranken Blut<br />
entziehen, schröpfen), Bader (handwerksmäßig geschulte Helfer bei<br />
Krankheiten), Bergmiete (Zinsabgabe für Almbenützung), Drude (alptraumhafte<br />
Peinigerin aus der Teufel-Sippschaft), Fußbrand (offene Feuerstätte),<br />
Gewäg Haar (Maßeinheit für Flachs), Gorz (Maßeinheit, 12<br />
Gorz = 1 Mut), Harnisch (Brustpanzer für Soldaten), Hellebarde (Waffe,<br />
Spieß mit Axt), Kaskee (konisches Holzgefäß mit durchlöchertem<br />
Boden), Mut (Maßeinheit, ca. 270 Liter), Pfleger (Verwalter für eine<br />
Grundherrschaft), Schwardach (Flachdach mit Legschindeln und Steinbeschwerung),<br />
Sudpfanne (zum Aussieden von Salz), Terz (Türkensteuer,<br />
wurde vom Landesfürsten speziell zur Abwehr der Türken eingehoben).<br />
� � Die Felsritzbilder in der Notgasse, an überhängenden Felsen zu<br />
finden, sind zwar in ihren symbolischen Bedeutungen erklärbar, hinsichtlich<br />
ihrer Herkunft jedoch bleiben die meisten bis heute ein Rätsel,<br />
öffnen deshalb Tür und Tor für alle möglichen Interpretationen. Dass die<br />
Bilder den Lebenswelten von Almleuten, Jägern, Salzträgern, Holzarbeitern<br />
entspringen, gilt als am Wahrscheinlichsten. Wie eine seltene Blüte
152 — 153<br />
Peter Gruber<br />
der Erkenntnis erscheint es mir, dass die in die Verwitterungsrinde des<br />
Kalkgesteins geritzten Initialen und Jahreszahlen, vorwiegend das<br />
17./18. Jahrhundert betreffend, als Sterbedaten von geheimprotestantischen<br />
Bauern gedeutet werden, wie dies einem ORF-Radio-Wandersendung-Skript<br />
von 1982 zu entnehmen ist, wobei sich die Redakteure auf<br />
eine Gröbminger Quelle berufen. � � Manche Bergführer, die heutzutage<br />
Gäste durch die enge, verschlungene Notgasse führen, zeigen sich<br />
mehr vom realen Gegenwärtigen angetan als vom mystischen Vergangenen,<br />
wie etwa von einer Kleinflugzeugabsturzstelle, die an den tragischen<br />
Tod von vier Insassen erinnert, nach denen in den 1980er-Jahren<br />
wochenlang gesucht wurde. � � Notgasse ist der historische Roman<br />
der Heimat Peter Grubers, die er herzlich liebt und die ihn in ihren Armen<br />
hält, stellt der Geschichteprofessor fest, anlässlich der Roman-Erstpräsentation<br />
beim Grafenwirt in Aich. � � Der Autor dürfte für diesen<br />
Roman einen guten Lektor gehabt haben, äußerst sich die betagte<br />
Volksmusiklehrerin, selbst auch poetisch tätig, im höchsten Maße anerkennend<br />
nach etwa der ersten Hälfte der Lektüre, erfreut über die gute<br />
Recherche im Milieu der Bauern und was die Besiedelungshistorie des<br />
Ennstales betrifft. Der Autor müsse jedoch plötzlich von allen guten<br />
Geistern verlassen worden sein, meint sie vernichtend, ebenso im<br />
höchsten Maße, nach der zweiten Hälfte der Lektüre, und sie ortet diesen<br />
Teil als schrecklichen Unsinn. � � Wissenshüter, wie es insbesondere<br />
Wissenschaftler, Forscher, Historiker, Chronisten, Archivare, aber<br />
vor allem auch Hobby-Volkskundler sind, mögen es gar nicht gerne,<br />
wenn ihnen ein vermeintlich Gescheiterer in die Quere kommt. Dies ist<br />
eine Erkenntnis, die ich im Zuge meiner Recherchen mache, die mich<br />
zwar befremdet, den einen und anderen Zugang zu Wissenswertem deshalb<br />
auch erschwert, mich aber von meinem weiteren Tun nicht abbringen<br />
lässt. � � Im Frühjahr 1999 erfahre ich, dass vier Jäger aus dem<br />
Gröbminger Winkl das Höflechner-Kreuz wiederaufgestellt haben, das<br />
schwere Eisenkreuz, nachdem es nach fast sieben Jahrzehnten durch die<br />
winterliche Schneelast vom großen Kalksteinklotz gedrückt worden war,<br />
der seit 1931 an den erschossenen Jäger in der Tälchenfurche erinnert,<br />
an einem äußerst schwer aufzufindenden Ort im Kemetgebirge, zwischen<br />
dem kleinen Z’sammtreibboden und der Zeissenstallalm. In einer<br />
Nacht-und-Nebel-Aktion haben die Jäger den Schaden behoben, unter<br />
Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es sich für diesen Berufsstand<br />
geziemt. Doch was vermag schon geheim zu bleiben, wenn anschließend<br />
Jäger und Nichtjäger im Dorfwirtshaus einander begegnen. � � Wenn<br />
man das erste Mal diese Tälchenfurche betritt, bei schlechtem Wetter,<br />
bei Nebel, Nieseln oder bei Nordwind, man plötzlich zwischen den zig<br />
quer liegenden Bäumen und inmitten der vielen glitschigen, stummen<br />
Tothölzer das schwarze Eisenkreuz mit seinen nach oben und seitlich<br />
ragenden scharfen Zargen erblickt, überkommt einen leicht ein Gefühl<br />
des Unbehagens, und man beginnt sogleich, sich vorzustellen, was sich<br />
hier an jenem Julimontagmorgen tatsächlich zugetragen haben könnte.<br />
� � Als ich meinen Vater – zugleich einer meiner wichtigsten<br />
Gesprächspartner, was Recherchen hinsichtlich der Dachsteinweitwanderweggeschichten<br />
anbelangt – darüber in Kenntnis setze, dass ich<br />
mich literarisch dem offensichtlich nie wirklich geklärten Fall Höflechner,<br />
insbesondere dem damit in Verbindung stehenden und damals<br />
wider Erwarten vom Gericht, noch dazu in einem aufsehenerregenden<br />
Prozess mit Lokalaugenschein am Tatort im Hochgebirge, in allen Anklagepunkten<br />
freigesprochenen Wilderer August Dormann widmen möchte,<br />
fragt er mich spontan: Traust du dich das? Ist das nicht zu gewagt?<br />
Schließlich geht selbst heute noch ein heftiger Ruck durch die Jägerkreise,<br />
wenn das Wort auf den Freispruch dieses verruchten Wilderers<br />
fällt. � � Die Steiner-Gretl, leidenschaftliche und legendäre Sängerin<br />
und Jodlerin, bevorzugt in Perlloden gekleidet, begleitet mich zu einem<br />
erfahrenen Jäger am Fuße der Dachstein-Südwände, zu einem älteren<br />
Mann, dem ein großer Wissensschatz nachgesagt wird. Ja, ich weiß von<br />
diesem Fall Höflechner, von der Geschichte mit dem Stock und den Haaren,<br />
vom unverzeihlichen Freispruch, vom Justizirrtum, vom Justizskandal,<br />
von der Aufgebrachtheit in der Jägerschaft. Ich vermute, dass Dormann<br />
falsche Aussagen gemacht hat, vielleicht doch Mithelfer hatte.<br />
Jedenfalls galt er als frech und selbstsicher. Hat die ganze Justiz in die<br />
Irre geführt. Das Gerücht, dass Ramsauer Wildschützen für seinen Verteidiger<br />
Geld gesammelt hätten, für einen Juden noch dazu, ist wahrlich<br />
nicht glaubhaft. Es war bestimmt kein Unfall, keine Notwehr, sondern<br />
kaltblütiger Mord. � � Der erfahrene Jäger bestätigt mir, dass es tatsächlich<br />
so was wie Schussfieber gibt. Vor allem bei jüngeren Schützen.<br />
Das ist die Aufregung, das Warten, bis ein Wild in richtiger Position für<br />
einen Breitschuss ist, um es ganz sicher zu treffen. Da werden die<br />
Hände zittrig, die Nerven flattern, die Ungeduld wächst. Im höheren<br />
Alter ist das nicht mehr so, kann man schon auch einmal auf einen<br />
Schuss verzichten. � � Dieser erfahrene Jäger erzählt mir auch davon,<br />
dass sie als Schüler den Heimwehr-Angehörigen nachriefen: Hahnenschwanz,<br />
Hahnenschwanz, bist ein armer Tropf. Was der Hahn am Hintern<br />
trägt, trägst du auf dem Kopf. Unerklärlich aber ist ihm, dass alle<br />
Angehörigen der Heimwehr Spielhahnfedern als Hüteschmuck trugen. So<br />
viele Spielhähne kann es doch gar nicht gegeben haben, erklärt mir der<br />
Mann, es müssten ja alle zum Abschuss freigegeben worden sein. Er<br />
vermutet vielmehr einen Import von einem verwandten Hahn in Skandinavien,<br />
den es in viel größerer Zahl gab. � � Bei einem etwas älteren<br />
Herren, ebenfalls einem Zeitzeugen der 30er-Jahre, den ich, so wie allgemein<br />
ältere Informanten mit Hilfe einer Vertrauensperson kontaktiere,<br />
erwarte ich mir mehr Details zum Fall Höflechner, erhalte stattdessen<br />
jedoch eine ausführliche Milieu-Studie, was die frühe nationalsozialistische<br />
Tätigkeit im oberen Ennstal betrifft. Ich lausche mit einer Mischung<br />
aus großem Interesse und Ernüchterung zugleich. Der ältere Herr
154 — 155<br />
Peter Gruber<br />
erzählt mir von einem Aufmarsch der Nazis mit Transparent und Gesang,<br />
cirka 20 junge Männer, alle mit weißen Hemden und weißen Stutzen<br />
bekleidet, anlässlich einer NS-Versammlung in den Jahren 1932/33 in<br />
Gröbming, die vom örtlichen Gendarmen wegen Aufmarschverbotes verhindert<br />
wurde, weshalb man später im Gasthofgarten weitergesungen<br />
hatte. Der ältere Herr weiß auch davon, dass Nazis damals zu Ehren der<br />
im Weltkrieg Gefallenen zu Allerheiligen das Kriegerdenkmal in Gröbming<br />
mit Kranz und Schleife versehen hatten. Das hat einen großen<br />
Konflikt mit dem damaligen Gröbminger Pfarrer zur Folge gehabt. Dieser<br />
ältere Herr erzählt mir auch, dass auf einem Felsen über dem Sattental<br />
ein Hakenkreuz prangte, weithin sichtbar. � � Ich ahne, dass die literarische<br />
Bearbeitung des Falles Höflechner vom zeitgeschichtlichen Hintergrund<br />
nicht loszusagen sein dürfte, vielmehr werde ich einen Nachhilfeunterricht<br />
nehmen müssen, denn mein erworbenes Schulwissen über<br />
die Zwischenkriegszeit wird kaum ausreichen, um möglichst real diese<br />
Zeit beschreiben zu können. � � Der älteste aller Zeitzeugen, ein über<br />
Neunzigjähriger, zugleich einer, der sogar noch persönlich beim Prozess<br />
vor Ort dabei war, damals bereits als Jungjäger, im Turnsaal der Volksschule<br />
Gröbming, den man kurzerhand zum Prozessraum umgewandelt<br />
hatte, und wo um zwei Uhr in der Früh der von allen Seiten vehement<br />
verteufelte Freispruch getroffen worden war. Dieser Neunzigjährige will<br />
mir in der Tat weismachen, dass die Ramsauer mit dem Angeklagten<br />
Dormann unter einer Decke steckten, weil sie selbst die ärgsten Wilderer<br />
im Kemetgebirge waren, und viel Geld für den Verteidiger aufgebracht<br />
haben. Der Mann zeigt mir einen Eintrag in seinem Tagebuch, in dem von<br />
20.000 Schilling die Rede ist. Hitlerverehrung und Judenhass in einem<br />
schlagen mir in diesem Recherchegespräch entgegen. Die Zeit sei extrem<br />
schlecht gewesen, versucht mir der Zeitzeuge verständlich zu<br />
machen. Die Bauern gingen Not abbeten, der Bauer trug dabei eine<br />
Pfanne mit Glut und Weihrauch bei sich und sprach: Koa Staberl steht,<br />
koa Bröckl Brot, und ein Bub ging hinten nach und sagte: Verdammte<br />
Not! Verfluchte Not! � � Mehrere Monate lang widme ich mich in der<br />
Folge ausschließlich dem nachträglichen Geschichteunterricht, begebe<br />
mich in Archive, sichte einschlägige Literatur, vergleiche meine Erkenntnisse<br />
und die Aufzeichnungen meiner Gespräche mit den Zeitzeugen mit<br />
historisch kompetenten Experten. Allmählich gedeiht mein Wildererroman.<br />
� � Ein Ramsauer, dessen Vater verdächtigt wurde, in den Fall<br />
Höflechner verstrickt gewesen zu sein, gewährt mir Einblick in die private<br />
Sammlung von seltenen Fotos und Postkarten. Mir fällt die gestochen<br />
schöne Handschrift von Dormann auf. In diesem Gespräch erfahre<br />
ich von einem obersten Gebot, dass sich Wildschützen immer wieder<br />
und wieder in Erinnerung riefen und regelrecht antrainierten: Sofort die<br />
Waffe wegwerfen, wenn du auf einen Jäger stoßt! Nur ja nicht in Versuchung<br />
kommen, die Waffe auf einen Jäger zu richten! � � Die Tochter<br />
eines Wildschützen zeigt sich stolz, weil sie schon im jungen
156 — 157<br />
Peter Gruber<br />
Mädchenalter vom Vater in den Wald mitgenommen wurde. Sie hat<br />
bereits als Kind einen Rehbock erlegen dürfen. Einmal haben sie beide,<br />
Vater und Tochter, frisches Gamsblut getrunken. Ihr Vater meinte, dass<br />
dies sehr gesund sei. Sie erinnert sich noch gut an die volle Doppelhandkehle<br />
mit dem Blut. Wildererleidenschaft ist nicht erklärbar, sagt<br />
sie. Das ist ein Gefühl. Nichts für den Verstand. Auch nicht die Tötungslust.<br />
Es ist das Verbotene, das Warten, die Chance, die Überlegenheit.<br />
� � Am Rande eines Vortrages des bekannten Wildererprofessors, vor<br />
voll gefülltem Saal in Gaishorn, versuche ich, den lokalen Wildschützen<br />
Dormann ins Gerede zu bringen, stelle jedoch bald fest, dass dies gar<br />
kein erwünschtes Gesprächsthema ist, trotz der längst vergangenen<br />
Geschehnisse. Mit ernsten Mienen hören die Gäste dem unterhaltsam<br />
vortragenden Professor zu und mit regungslosem Gesichtsausdruck folgen<br />
sie dem Gesangsquintett bei der Wildererhymne: An eines Sonntags<br />
Morgen. Trotz Einladung des Vortragenden findet kein einziger der<br />
Zuhörer auch nur einen Ton zum Mitsingen. � � Die Gerüchte, was<br />
unmittelbar nach dem Freispruch aus dem Wildschützen Dormann<br />
geworden ist, sind so vielfältig, wie es sich wohl oder übel für eine Figur<br />
dieser Art gehört. Man sagt, er habe sich umgebracht. Er sei in die Enns<br />
gegangen. Er habe sich erhängt. Er sei neuerlich der Leidenschaft des<br />
Wilderns nachgegangen. Er habe sich später jenseits der deutsch-österreichischen<br />
Grenze herumgetrieben. Er sei wieder auf frischer Tat<br />
ertappt und hinter Schloss und Riegel gebracht worden. Er habe geheiratet,<br />
und nachdem er seiner Gemahlin gestanden hat, dass er drei Menschenleben<br />
auf dem Gewissen habe, wurde ihm verwehrt, weiterhin im<br />
Haus zu schlafen, er habe fortan mit einer Hütte Vorlieb nehmen müssen.<br />
Wahrheiten? Gerüchte? Lügen? Legenden? Der Anfang eines<br />
Mythos? � � Im Dachsteingebirge, auf einer Alm, in einer Textwerkstätte,<br />
in einer Denkhütte, vertiefe ich mich in das Schattenkreuz-<br />
Manuskript. Einige Minuten zuvor war ich noch draußen unterwegs,<br />
habe beobachten können, wie der Bergnebel von den Hirzberghöhen tiefer<br />
und tiefer wölbte, grüne Gamsäsungen verhüllte, gleichfarben mit<br />
dem grauen Kalkkarst verschwamm, näher und näher rückte, kühle und<br />
feuchte Luft mitbringend. Bergnebel ist der Freund des Wilderers. Bergnebel<br />
ist auch mein Freund, der mich stets läutert, mir alles Wesentliche<br />
vom Unwesentlichen zu trennen vermag, und mich dazu inspiriert,<br />
unmittelbar Papier zu entrollen und Bleistifte zu spitzen, mich hinzusetzen<br />
und sofort festzuhalten, was mir gedanklich in den Sinn kommt, so<br />
wie an diesem Tag, mit der alles entscheidenden Erzählszene im Skript,<br />
der Wildererpirsch in der Tälchenfurche am Julimontagmorgen. Mittendrin<br />
in meinem Unterfangen kreuzt der Königreichalmhüter auf. Heute<br />
Nacht wird der Jäger dran glauben müssen, sage ich zum Almnachbarn.<br />
Lass ihn noch eine Nacht leben, fleht mich der Almnachbar an, nicht<br />
minder lapidar. � � Schreib doch einmal eine Geschichte mit einem<br />
guten Ausgang, wünscht sich sehnlich eine treue Leserin meiner Bücher.<br />
Wenn Schattenkreuz auch so eine grausame Geschichte ist wie Notgasse,<br />
werde ich das Buch nicht lesen, lässt mir eine andere Leserin<br />
ausrichten. � � Bei der gut besuchten Sonderausstellung Auf der Alm<br />
im Schloss Trautenfels in den Jahren 2004 und 2005 wird mir, dank<br />
eines Impulses vonseiten des AlmKunst-Kurators, die Möglichkeit zum<br />
Mitwirken beschert. Kunst 19 lässt die Besucher eine Textwerkstatt-Alm<br />
schauen, mit Werkzeug und Schwersteinen auf Materialbündeln, wo mit<br />
Roafmesser und Bleistiftspitzer gleichermaßen umgegangen wird, wo<br />
die Abfälle zum eigentlichen Werkplatz gehören wie die Scharten in die<br />
Tischlerei, oder es ist alles ganz anders, penibel geordnet und aufgeräumt.<br />
Anlässlich der Ausstellungseröffnung begegne ich dem vulgo<br />
Kalcher aus Ramsau am Dachstein, der mir schildert, wie er auf imaginäre<br />
Weise meiner Notgasse-Erzählung gefolgt ist, auf Schritt und Tritt,<br />
jeden im Buch beschriebenen Ort, ob realen oder fiktiven Ursprungs,<br />
gedanklich nachgegangen ist und jeden dieser Orte in seinen Vorstellungen<br />
auch gefunden hat. Ich bin tief bewegt von dieser Begegnung mit<br />
dem alten vulgo Kalcher, und ich denke mir, dass es sich für solch einen<br />
Leser allein lohnt, eine Geschichte zu erzählen. � � Einige Wochen<br />
nach der Veröffentlichung des Romans Schattenkreuz entdecke ich, bei<br />
einem Fitnesslauf entlang der Enns, nahe der Brücke in Aich, unmittelbar<br />
neben Altpapiercontainern einen Haufen mit alten Zeitungen und<br />
Zeitschriften. Im Zuge meiner Recherchen in Archiven und Sammlungen<br />
habe ich mir den Blick der Neugierde für altes, vergilbtes Papier angewöhnt,<br />
und ich kann nicht umhin, vor diesem Haufen jäh zu stoppen und<br />
darin zu stöbern. Nach nur wenigen Augenblicken halte ich eine Ausgabe<br />
der Neuen Illustrierten Wochenschau aus dem Jahr 1954 in Händen,<br />
eine damals im ländlichen Raum beliebte Wochenzeitung, und mir<br />
sticht sogleich die Titelseite ins Auge, mit einer Reportage vom Heilbronner<br />
Dachsteinunglück und, zu meiner völligen Verblüffung, einem<br />
Titelfoto, dass drei der im Schnee erfrorenen Opfer unmittelbar nach der<br />
Bergung in Großaufnahme zeigt. � � Magst dich schon äußern, welches<br />
Thema du als nächstes bearbeiten wirst, fragt mich der Grafenbergalmhüter<br />
in einem Café in Wien. Ja, weißt, da gibt es noch eine<br />
Geschichte, ein Dachstein-Ereignis, stottere ich wohl ein wenig unsicher,<br />
in Anbetracht des frühen Stadiums meiner Überlegungen, und ich meine,<br />
dass es vielleicht an der Zeit wäre, mir ernsthaft Gedanken zu machen.<br />
Noch gar nicht auf den Punkt meiner Äußerungen gekommen, nimmt mir<br />
der Grafenbergalmhüter das Wort vorweg: Du meinst die Dreizehn, die<br />
Kinder, die Lehrer, die an einem Karfreitag gestorben sind. � � Von der<br />
Tälchenfurche mit dem Schattenkreuz ist es ein weiter, mühsamer Weg<br />
bis zum Tod Am Stein. Die Geländeunwirtlichkeit lässt es kaum zu,<br />
geradlinig zu gehen, immer wieder muss breiten Latschenfeldern, Geröllhalden,<br />
Karen, Dolinen, Schlünden und Abgründen ausgewichen werden.<br />
Manchmal führt es einen um die rundlichen Kuppen der Hirzbergausläufer,<br />
manchmal durch die aussichtsarmen Muldensenken. Man erzählt,
158 — 159<br />
Peter Gruber<br />
dass an jenen dreizehn Orten im Kalkkarst, wo die einzelnen Opfer später<br />
gefunden wurden, jeweils ein rotes Kreuzlein auf den blanken Fels<br />
gemalt worden ist, zur Erinnerung an die weit voneinander verstreuten<br />
Dreizehn. Nur wenige Ortskundige wissen noch um die Orte dieser<br />
Kreuzlein. Ich widme mich ausgiebig der Recherche im Umfeld des Heilbronner<br />
Kreuzes – das übrigens an jener Stelle errichtet worden ist, wo<br />
seinerzeit ein Notbiwak der Vermissten entdeckt wurde – vermeide aber<br />
die Suche nach diesen kleinen Kreuzlein, aus Respekt und aus Gründen<br />
der Pietät. � � Wieder ist es mein Vater, zu dem ich mich als Erstes<br />
begebe, was meine genaueren Nachforschungen anbelangt, vor allem<br />
auch deshalb, weil ich mich entsinne, dass er schon zu meiner Kindheit<br />
über dieses Unglück erzählt hatte. Mein Vater gilt seit jeher als ausgezeichneter<br />
Kenner des Kemetgebirges. Am Freitag, dem 23. April 1954,<br />
ist er zusammen mit seinem Bruder und dem Pitzer-Friedl (ein Unikum<br />
unter den damaligen Almhütern) aufgebrochen, um sich vom Stoderzinken<br />
aus in Richtung Plankenalm auf die Suche nach den Vermissten zu<br />
begeben. In der Hoffnung, vielleicht in einer der eingeschneiten Almhütten<br />
Spuren zu entdecken. Die drei wollten nicht untätig bleiben. Es war<br />
eine innere Stimme, die sie zum Aufbruch rief. Auch sie wollten bei der<br />
groß angelegten Suchaktion ihren Anteil leisten. Ausgerüstet waren sie<br />
mit einfachen Skiern, damals noch ohne Metallkanten, sie verfügten<br />
nicht einmal über Steigfelle. In die Rucksäcke stopften sie Jause, sie<br />
rechneten mit Nächtigungen in einer der Almhütten. Es hat damals<br />
ungeheure Schneemengen und im April noch meterhohe Schneeverwehungen<br />
gegeben, erinnert sich mein Vater. Im Tumerach, kurz vor der<br />
Plankenalm, stießen die drei Männer auf Bergretter, die von Gröbming<br />
aus an der Suchaktion teilnahmen, und sie schlossen sich diesen unmittelbar<br />
an. � � Du bist dazu bestimmt, diese Geschichte zu schreiben,<br />
der Tragik der Dreizehn auf den Grund zu gehen, kommentiert die Steiner-Gretl<br />
meine Absicht, als ich sie und den Gebauer-Heli am Fastenberg<br />
auf der Tauernseite zum Gespräch treffe, hinsichtlich ihrer Erinnerungen<br />
an die Geschehnisse von Ostern 1954. Begleitet von einem<br />
seltsamen Ausdruck in ihren Augen beschwört sie, dabei regelrecht<br />
allem und jedem überlegen erscheinend: Die Buben werden dir begegnen,<br />
nachts, in den Träumen, dort oben, wenn du Wind und Wetter ausgesetzt<br />
sein wirst, auf deiner Alm! Vom Fastenberg aus erscheint es<br />
einem, als könne man das ganze Dachsteingebirge mit einem einzigen<br />
Blick erfassen, doch der Schein trügt, denn nichts ist von hier aus von<br />
der breiten, weiten Hochfläche zu erkennen, die sich hinter den Wänden<br />
und Graten ausdehnt. Spät, mit Einbruch der Dämmerung, als die letzten<br />
Sonnenstrahlen am Kalkgestein des Dachsteins rötlich aufflammen,<br />
jodeln mir die Gretl und der Heli zum Abschied den Dåchstoana nach, so<br />
klar und kräftig und perfekt, wie ich ihn niemals zuvor (auch niemals<br />
wieder danach) von den beiden vernommen habe. � � Es war die<br />
größte alpine Suchaktion in der Geschichte Österreichs.
160 — 161<br />
Peter Gruber<br />
Unzählige Männer waren in den Tagen nach Ostern 1954 unterwegs, um<br />
im Dachsteingebirge nach den dreizehn Vermissten zu suchen, Bergrettungsmänner<br />
und Alpingendarmen. Bis zu 500 waren im Einsatz,<br />
bemühten sich vergeblich, vermochten am Ende nur dreizehn Tote zu<br />
bergen. 500 Bergretter, das sind auch 500 Bergrettergeschichten. � �<br />
Von mehreren Seiten wird mir – durchwegs von einem ewig unverzeihlichen,<br />
vorwurfsvollen Unterton begleitet, zu meinem Erstaunen selbst<br />
noch 50 Jahre nach der Tragödie – ein Zitat des Klassenlehrers Hans<br />
Sailer (Anführer der Dreizehn, der letztlich selbst auch unter den Opfern<br />
war) zugetragen: Meine Jungen müssen sich richtig warm laufen! � �<br />
Im Mai 2006, in der süddeutschen Stadt Heilbronn, am Tag vor der Erstpräsentation<br />
meines Romans Tod Am Stein gegenüber der Heilbronner<br />
Öffentlichkeit, im besonders launischen Maienwetter, begebe ich mich<br />
auf den städtischen Friedhof, wo in einem Ehrengrab elf von den dreizehn<br />
Verunglückten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Dort hocke<br />
ich mich auf eine Bank, lasse meine Blicke und Gedanken über die Grabsteine<br />
schweifen, auf denen in großen Lettern die Vor- und Nachnamen<br />
und Geburtsdaten geschrieben stehen. Irgendwo, in sehr weiter Ferne, in<br />
direkter Luftlinie über die Gräber hinweg, gegen Südosten zu, denke ich<br />
mir das Gebirge, das Dachsteinmassiv, das den jungen Heilbronnern zum<br />
Verhängnis geworden war. Während ich so manchen Wegnotizen nachsinne,<br />
die diese Etappe meines literarischen Weitwanderweges mit einer<br />
ganz besonderen Tiefe geprägt haben, beginnt sich der Himmel über mir<br />
wie rasend zu verfinstern, kommt plötzlich Wind auf, setzen fast zeitgleich<br />
Blitz und Donner und ein kräftiger Wolkenbruch ein, legt ein<br />
ziemlich heftiges Frühjahrsgewitter los. Als würde die Natur mehr als<br />
bloß ein Wörtchen mitreden wollen, auch an diesem Tag. � � Seit den<br />
Ereignissen von 1954 bin ich nie wieder in die Nähe des Dachsteins<br />
gekommen, verrät mir der ehemalige Sportlehrer der Damm-Realschule,<br />
und versichert mir aus voller Überzeugung, dass er auch in Zukunft nie<br />
und nimmer diesem Gebirge begegnen will. � � Ich dagegen setze meinen<br />
literarischen Weitwanderweg fort, bleibe dem Schnee im Hochgebirge<br />
auf gewisser Weise treu, wenn auch auf gänzlich andere Art,<br />
wende mich vom Tod Am Stein in den 50er-Jahren wieder ab und der<br />
Gegenwart zu und begebe mich in den Sommerschnee. � � Als ich<br />
erstmals den Fotografen mit den Hochalmen im Kemetgebirge vertraut<br />
mache, wir zusammen über die Almhöhen schreiten, ohne viele Worte,<br />
eher schweigsam, beide in Gedanken und Beobachtungen versunken,<br />
beim Überschreiten des Almsattels zur Neubergalm, mit den Blicken auf<br />
die abgewitterten Dächer der Almhütten, Viehunterstände, Sautrempel<br />
und Wasserbunker, äußert sich der Fotograf beeindruckt: Schön, dieses<br />
gleichfarbene Grau der abgewitterten Schindeldächer, der Kalksteine,<br />
der toten Baumstrünke! � � Das Dachsteingebirge ist seit jeher eine<br />
Art Panoptikum für Narren, stellt die Mittelschulprofessorin fest. Als<br />
Dachstein-Narren könne man sie alle auch bezeichnen,<br />
die Wissenschaftler und Forscher, die Wanderer und Bergsteiger, die<br />
Wilderer und Jäger, die Schafbauern und Almhüter, die Grenzgänger und<br />
Aussteiger, die Maler und Schriftsteller. � � Sind Sie ein Einzelgänger,<br />
fragt mich die Lebenswege-Moderatorin. Einen Augenblick halte ich<br />
inne, als müsse ich erst überlegen, obgleich das auf diese Frage hin gar<br />
nicht notwendig ist, aber ich halte wohl deshalb kurz inne, weil mir<br />
bewusst wird, dass ich die Antwort in einer Rundfunksendung und somit<br />
vielen Zuhörern gebe. Ja, antworte ich schließlich aus Überzeugung.<br />
Und in Selbsteinschätzung, denn die Quelle meines literarischen Wanderns<br />
nährt sich vom Einzelgängerischen. � � Ich möchte auch zukünftig<br />
im Sommer im Dachsteingebirge leben. Auf einer Alm. In einer Textwerkstätte.<br />
In einer Denkhütte. Mit Blick auf den Dichterfelsen, wie der<br />
Schröfl-Rudl, ein treuer Weggefährte in den frühesten Jahren meiner<br />
Erkundungen auf und um die Almen im Dachsteingebirge – lange vor den<br />
ersten Schritten auf dem literarischen Weitwanderweg – einen der<br />
unzähligen, auf erstem Blick hin eher unbedeutend erscheinenden Almhöcker<br />
benannt hatte, in der Ahnung, dass der Almhöcker einer meiner<br />
Lieblingsdenkplätze ist.
162 — 163<br />
Wenn Helene kommt<br />
Text: Christof Huemer<br />
Bilder: Stefan Emsenhuber<br />
1) Ich bin ein geschmeidiger Vogel. Ich tanze und kreise. Ich schwebe und<br />
gleite. Ich liebe es. Ich spiele im Aufwind, drehe Kreise um den runden<br />
Turm, lasse mich wieder fallen. Ein paar Mal kräftig mit den Flügeln<br />
schlagen, wenn die Abendsonne die Luft bewegt unten an der großen<br />
Mauer, und wieder gleite ich. Ich gleite, um zu fühlen, wie die klare Luft<br />
mein Gefieder streift. Ich gleite um zu spüren, wie schnell ich bin. Zu<br />
fühlen wie sich meine Krallen entspannen, mein Rumpf ganz glatt wird<br />
und wildes Knarren aus meinem Schnabel dringt.<br />
Wenn ich fliege, kann ich Dinge, die sonst nur Zauberer können und<br />
Hexen. Ich drehe mich mühelos, ich drifte entlang des Frieds, ich wirble<br />
um den Reif, der den Turm umarmt, und segle weiter. Ich segle, halte dann<br />
beinahe an und schaue in die Fenster. Ich sehe und erkenne und fliege<br />
weiter. Ich schmiege mich an die Strömung, spreize meine Schwingen,<br />
folge dem Balkon und lasse mich über den Weiher treiben. Ich bin ein<br />
Wachtelkönig und mein Name ist...<br />
2) Kleine, braun gefiederte Vögel, Hunderte davon, zogen ihre Kreise<br />
rund um den Flaggenturm des Schlosses, als Theresa Hegelmann, ein<br />
Waisenkind von fast 14 Jahren, das die Erzieherinnen in ihrem Münchner<br />
Internat gerne als vorlaut oder frühreif beschrieben, wenn sie Theresa<br />
dieser Eigenschaften nicht sogar bezichtigten, vor dem Bahnhof im Dorf<br />
der Haselnussmenschen stand und vergeblich versuchte, von dem sie<br />
abholenden Fahrer Hilfe zu bekommen. Wie Theresa schnell erkannt hatte,<br />
war er nicht jener Notar, Dr. Philipp Burger, dessen Brief sie im Filibuster-<br />
Heim der Karmeliterinnen St. Rhinus über den notwendigen Antritt einer<br />
Erbschaft informiert hatte, sondern eine im Schloss angestellte Hilfskraft.<br />
Ohne auszusteigen und, wie Theresa sich einbildete, widerwillig hob der<br />
bärtige Mann im Lodenjanker die Hand zu einem müden Gruß, den man<br />
auch als Geste deuten konnte, die so viel besagen sollte wie: Ich will<br />
mit dir und deinem Schicksal nichts zu tun haben. Theresa öffnete die<br />
Beifahrertür, kletterte in den vor sich hin brummenden Wagen und da der<br />
Chauffeur weiterhin keine Anstalten machte, ihr behilflich zu sein, stellte<br />
sie ihren Koffer einfach zwischen ihre Füße.<br />
Bald begann die Fahrt sie zu irritieren. So nahe hatte das Schloss vom<br />
Bahnhof aus noch gewirkt. Doch der durch Schlaglöcher versehrte Weg<br />
durch das Dorf der Haselnussmenschen, das nun so gar nicht wie eine<br />
Ortschaft aussah, eher wie eine Ansammlung von zu unterschiedlichen<br />
Zeiten vergessenen Häusern, nahm kein Ende. Viele Gebäude im Dorf<br />
waren verlassen oder verfallen, oder vielleicht schien es nur so, und<br />
die Züge hielten zwar am Bahnhof, doch stieg nie jemand zu oder aus.<br />
Theresa war die Einzige am Bahnsteig gewesen, die Einzige in der Halle,<br />
und der Mann, der sie ins Schloss brachte, blieb der einzige Mensch, den<br />
sie sah.<br />
„Ist es zu dieser Zeit immer so kalt?“, machte sie Konversation, griff sich<br />
an dem Mantelkragen, wie eine Dame im Film es getan hätte, und der<br />
Chauffeur aus dem Dorf der Haselnussmenschen starrte vor sich hin.<br />
Auch ihre Erkundigungen nach der Einwohnerzahl und dem Grund für<br />
seine langsame Fahrweise ließ er unquittiert. Er wollte oder durfte nicht<br />
sprechen. Theresa presste ihre Unterschenkel an ihren Koffer und eine<br />
Hand, die rechte, an ihre linke Brust, dorthin, wo sie das Tagebuch ihrer<br />
Mutter vermutete. Schweigend zuckelten sie durch die letzten Häuser<br />
des Dorfs der Haselnussmenschen und ihr Chauffeur begann, holprige,<br />
zischende Silben zu murmeln.<br />
Sie nahmen die unbefestigte Straße, die das Schloss mit dem Dorf der<br />
Haselnussmenschen verband. Der Chauffeur murmelte lauter. Noch<br />
immer kam das Schloss nicht in Sicht. Hinter dieser Biegung muss es<br />
liegen, dachte Theresa bei jeder Kurve aufs Neue. Hinter jener dort vorne.<br />
Der endlose Weg und das feindselige Murmeln – sie wollte am liebsten<br />
schreien, so genervt war sie. Und dann sah sie das Schloss. Sie sah den<br />
See, in dessen Mitte ein verlassenes Ruderboot trieb. Sie passierten ein<br />
Haus, das einer Fischerhütte glich und hinter dessen Fenstern sich viele<br />
neugierige und, wie sie fand, irre Kindergesichter drängten. Sie sah die<br />
felsige Anhöhe mit dem kastenförmigen Gebäude, das wie eine Klinik oder<br />
Heilanstalt wirkte, aber so gar nicht wie ein Schloss. Sie sah die Vögel,<br />
Hunderte aufgeregte Vögel, die im abendlichen Aufwind der Nordwand<br />
tollten und dabei ein schnarrendes Geschrei ausstießen, das Theresa bis<br />
unter die Haut ging. Und dann sah sie den Ring um den runden Flaggenturm<br />
des Schlosses, einen weißen, nach unten gesunkenen und auf rätselhafte<br />
Art leuchtenden Heiligenschein, von dem Theresa schwören könnte, dass<br />
er bis vor wenige Minuten noch nicht und weder als sie das Schloss vom<br />
Bahnhof noch von der Strecke aus betrachten konnte, da war.<br />
Ohne eine Antwort zu erwarten und mehr, um sich ihrer Wahrnehmung<br />
zu versichern, fragte sie: „Was ist das für ein Ring?“ Ihr Chauffeur lachte<br />
laut auf, klammerte sich wie ein Affe an das Lenkrad des Geländewagens,<br />
den er, jetzt noch langsamer, die schmale Straße um den Teich herum
kutschierte und rief, es sei das Reich, das wiederkehre, das Reich, das<br />
gottseidank immer und immer wieder- und wiederkehre, Nacht für<br />
Nacht, und auch wenn man es rundum verboten habe, auch wenn man<br />
sie gedemütigt und erniedrigt habe, sie, die Haselnussmenschen, seien<br />
glücklich zu preisen, das Reich, es kehre wieder.<br />
Der Weg führte nun bergauf, der Irre schaltete in einen niedrigeren Gang,<br />
glücklich zu preisen, schnarrte er und Speichel, sehr weißer Speichel<br />
sammelte sich in seinem Bart.<br />
Vor dem Schlossportal angekommen, wurde ihr die Wagentür von einem<br />
Mann in dreiteiligem Anzug geöffnet, der sich als Notar Dr. Philipp Burger<br />
vorstellte. Er erkundigte sich nach ihrer Reise, die, lang wie sie war,<br />
hoffentlich frei von Überraschungen und Beschwernissen vonstatten<br />
gegangen sei. Er half ihr vom Trittbrett und führte sie sofort ein paar<br />
Schritte weg von Schloss und Wagen. Dann eröffnete er Theresa, die<br />
er abwechselnd mit „Mein Kind“ und „Liebes Fräulein“ ansprach, dass<br />
dringende Termine ihn leider zur sofortigen Abreise zwängen, ja, es bliebe<br />
nicht einmal mehr die Zeit, gemeinsam Abend zu essen, bedauerlich sei<br />
das und dennoch nicht zu ändern, nach seiner Rückkehr aber... Während<br />
all dieser Worte, denen Theresa vor allem entnahm, dass es noch dauern<br />
würde, bis sie erfuhr, um welche Art Erbschaft es sich handle und was für<br />
ein Mensch ihre Mutter gewesen war, spürte sie rege Betriebsamkeit hinter<br />
ihrem Rücken. Während seiner Abwesenheit werde sich die langjährige<br />
Haushälterin und Herrin über das wenige Personal, fuhr der Notar fort und<br />
legte eine Hand auf Theresas Rücken, gut um sie kümmern. Auch würde<br />
seine Absenz nicht lange währen, wahrscheinlich kaum einen Monat.<br />
Der Notar schob sie zum Schloss, die drei Stufen hinauf, und durch das<br />
offene Portal. Theresa stand unversehens in einer steinernen Halle,<br />
ein Mädchen von 14 Jahren, in Baumwollkleid und Mantel, der Kragen<br />
hochgeschlagen, und wurde von einer Gruppe dunkel gekleideter<br />
Personen gemustert, neugierig und ohne sichtbare Wertschätzung. Wie<br />
jedes Kind, das ohne Eltern aufgewachsen war, fühlte sich Theresa in<br />
solch einer Situation unwohl und blickte ungeschickt in die Versammlung.<br />
Ganz hinten stand ihr irrer Chauffeur, rieb sich den Bart, presste seine<br />
Hände dann übertrieben kräftig an seine Hosennaht, und als wäre somit<br />
alles fertig, trat da die Gestalt vor ihm aus der Menge. Sie war in tiefstes<br />
Schwarz gekleidet, hager und groß, zwischen 50 und 70 Jahren alt, mit<br />
hervorstechenden Backenknochen, pergamentener Haut und erinnerte<br />
Theresa vage an einen Pinguin.<br />
„Das, mein Kind,“ erklärte der Notar, „ist Frau Thannver“. Theresa<br />
schauderte bei diesem Namen. Unsicher beugte sie ihre Knie, deutete<br />
einen Kicks an, und die Vorgestellte kam auf sie zu, streckte ihre<br />
Arme nach Theresa aus, voller Liebe und doch mit staubig gemessener<br />
Haltung, blieb genau einen Schritt vor ihr stehen und betrachtete sie<br />
gütig. Sie flüsterte etwas, das wie „Helene“, klang, ganz zärtlich, „meine
166 — 167<br />
Christof Huemer<br />
Helene“, und machte sich daran, Theresas schüchtern vorgestreckte<br />
Hand zu ergreifen. „Frau Thannver,“ vollendete der Notar das Ritual<br />
in sachlichem Ton, „dies ist Fräulein Theresa.“ Die Hand, die Theresas<br />
dann ergriff, war schwer, eiskalt und fühlte sich wie tot an. Und Frau<br />
Thannvers Gesicht, eben noch voller Zuneigung, verwandelte sich in<br />
Stein, in ein in Marmor gehauenes Mahnmahl zu allen von ihr selbst, dem<br />
Dorf der Haselnussmenschen oder gleich des ganzen Gaus erlittenen<br />
Schmähungen. Sie ließ ihre eiskalte Hand in der von Theresa und bohrte<br />
ihren Blick in ihre Stirn. Dann fügte sie sich wieder in die Gruppe ein,<br />
Margit werde sie auf ihr Zimmer führen, hörte Theresa Frau Thannver<br />
sagen. Ein leicht schielendes Mädchen in Theresas Alter löste sich aus<br />
dem Aufgebot, Theresas Koffer schon in der Hand. Sie ging ein paar<br />
Schritte und huschte, als sie sah, dass Theresa ihr folgte, die Stiegen<br />
hinauf. Theresa fühlte hundert Blicke in ihrem Hinterkopf. „Sie ist eine<br />
Hegelmann“, hörte sie den Notar noch sagen, „die Vorletzte.“ Und<br />
Thannver sagte, ausatmend: „Wir wollen es hoffen.“<br />
3) Das Zimmer, das man Theresa zuwies, war geräumig und trotz der<br />
Dämmerung hell. Margit schickte sich an, ihren Koffer auszupacken, was<br />
Theresa sie ersuchte, nicht zu tun, und selbst als die Vorhänge zugezogen,<br />
der Koffer im rechten Winkeln am Bett abgelegt und auch sonst nichts<br />
mehr zu tun war, kostete es Theresa einige Mühe, Margit aus dem Zimmer<br />
zu komplimentieren. „Was ist nur mit diesen Haselnussmenschen los?“,<br />
dachte sie unkompliziert, legte sich samt Mantel und Schuhen auf das<br />
Bett, rollte auf den Bauch und öffnete ihren Koffer.<br />
Als sie wieder erwachte, war es dunkel, ein Tablett mit einem Teller<br />
Suppe ruhte neben dem Bett auf einem Tisch, der zuvor noch nicht da<br />
gestanden hatte und ihr Koffer, eine Tatsache, die Theresa aber erst viel<br />
später auffiel, war verschwunden.<br />
Nachdem Theresa ein paar Löffel kalte Suppe gegessen hatte, zog sie<br />
das Tagebuch ihrer Mutter aus der Innentasche ihres Mantels. Dieses<br />
Buch, ein Heft von circa 120 Seiten, war die Gesamtheit dessen, was<br />
Theresa von ihrer Mutter kannte, die bei ihrer Geburt sehr jung ums Leben<br />
gekommen war, oder so hatten es ihr die Schwestern im Internat erzählt.<br />
Theresa sei Österreicherin, so wie ihre Mutter Gertrude eine gewesen sei,<br />
und auch das monatliche Geld an das Internat würde von Österreich aus<br />
überwiesen, ihr Vater sei wohl im Krieg gefallen, im Alter von vier Jahren<br />
sei sie zu den Karmeliterinnen gekommen, was früh sei, sehr früh, mehr<br />
wisse man oder wolle man auch beim besten Willen nicht wissen, noch<br />
habe es irgendeinen Sinn, in der Vergangenheit zu rühren, nun weine<br />
doch nicht, wer wird denn gleich sentimental werden. Vor zwei Wochen<br />
kam dann der Brief des Notars, ihrem Vormund, wie er sich auch nannte,<br />
mit der dringenden Bitte, ins Dorf der Haselnussmenschen zu reisen. Wie<br />
im Testament ihres Vaters vorgesehen, solle sie eine Erbschaft antreten,<br />
für Details bliebe vor Ort noch Zeit, eine Zugkarte fände sie anbei.<br />
Dem freundlich, aber vollkommen unpersönlich gehaltenen Brief<br />
lag jenes Tagebuch von Theresas Mutter bei, das den Zeitraum von<br />
März bis September 1941 umspannte, also in etwa zwei Monate vor<br />
Theresas Geburt abbrach. Schon nach ein paar Zeilen hatte Theresa<br />
erkannt, worum es sich handelte, das Heft wieder zärtlich geschlossen.<br />
Und seitdem jeden Tag darin und nie mehr als drei Seiten, es musste<br />
lange halten, gelesen. Wie ihre Mutter, womöglich bereits schwanger,<br />
im März 1941 ins Dorf der Haselnussmenschen kam, wo der Künstler<br />
Conrad Halder (ein bedeutender? Theresa hatte noch nie von ihm<br />
gehört) Gertrudes Zukünftiger und, so konnte man mutmaßen, Theresas<br />
Vater, von seinem engen Freund, Reichspostminister Ohnesorge zum<br />
Verwalter im Schloss bestellt worden war, eine Funktion, die dieser alles<br />
andere als wahrnahm. Wie eine Haushälterin namens Thannver ihrer<br />
Mutter jede Minute ihres dort verbrachten Lebens durch Gemütskälte<br />
erschwerte; wie die für Juni anberaumte Hochzeit wieder und wieder<br />
verschoben wurde, wie die Menschen des Haselnussdorfs sich über sie<br />
und ihren Zustand das Maul zerrissen, ein Umstand, den ihre Mutter<br />
tollkühnerweise konterte, indem sie im Gewand einer Schlossherrin ins<br />
Dorf ging; wo ihre Versicherungen, Conrad Halder werde sie heiraten,<br />
allerdings niemand ernst nahm, erst recht nicht, als sich ihre Besuche<br />
wöchentlich wiederholten und die Haselnussmenschen Gelegenheit<br />
hatten, Gertrudes Courage und Aufgeklärtheit zu begegnen (auch<br />
bei den anzüglichsten Bemerkungen ihren Körper oder ihr Gesicht<br />
betreffend wahrte sie Beherrschung und Contenance, worin die Mehrheit<br />
der darüber klatschenden Haselnussmenschen den Hinweis auf einen<br />
kühnen, freisinnigen Charakter sahen, was nur den Schluss zuließ:<br />
Hierher, und vor allem zu Halder, passte sie nicht), kurz, weder das Jahr<br />
1941 noch das Dorf der Haselnussmenschen eigneten sich besonders<br />
für fehlende Kleingeistigkeit. Wie ihre Mutter versuchte, angesichts<br />
ihrer fortschreitenden Schwangerschaft und des nahenden Herbstes<br />
Renovierungsarbeiten durchzusetzen; wie sie dabei scheiterte. Und,<br />
immer wieder, so als wäre es ein Refrain, wie ihre Mutter nach Einsetzen<br />
der Dunkelheit durch die Gänge des Schlosses wandelte, im Nachthemd,<br />
barfuss, vom Schlafzimmer in den Salon in den Marmorsaal, durch den<br />
Saal in das Speisezimmer und immer weiter. Und Theresa richtete sich<br />
auf.<br />
Konnte dieses Bett, auf dem sie lag, das Bett ihrer Mutter sein? Sie stand<br />
auf und betrachtet es kurz, ein einfaches Bett, alt, aber in gutem Zustand.<br />
Jetzt erst bemerkte Theresa, dass am Fußende des Bettes ein Nachthemd<br />
für sie lag. Nahe der Halsnaht waren die Initialen HH eingestickt. Wie<br />
lange konnte sie geschlafen haben?<br />
Und dann tat Theresa etwas, wozu eigentlich nur ihre Mutter mutig genug<br />
war. Theresa schlüpfte aus Schuhen, Mantel, Kleid und Unterwäsche,<br />
zog das Nachthemd über. Dann machte sie sich daran, das Schloss zu<br />
erkunden.
168 — 169<br />
Christof Huemer<br />
Barfuss, eine Kerze in der Hand, alles wie bei ihrer Mutter, schlich sie<br />
hinaus in den Salon, durch den das Hausmädchen sie geführt hatte<br />
und dessen Deckengemälde sie aufgrund geschlossener Fensterbalken<br />
abermals ignorierte, wandte sich dann aber nicht sofort nach rechts<br />
in Richtung des Stiegenhauses, sondern ging, als sie die zweite Tür zu<br />
ihrer Rechten ausmachte, ein paar Schritte weiter. Sie drückte lautlos die<br />
Klinke, nie hatte ihre Mutter Geräusche erwähnt, bis auf das Schnarren<br />
der Vögel, natürlich, das sie zu rufen schien, ein Werben, gegen das sich<br />
wehren musste, so schrieb sie, und Theresa trat ein in die vom Mondlicht<br />
annehmend beleuchtete Halle. Sie bemerkt sofort den Marmorboden,<br />
der die Sicheln ihrer Fußsolen abbildete, anders als die Parkett- und<br />
Schiffsböden in den restlichen Räumen. Sie setzte weiter Fuß vor Fuß,<br />
Schritt für Schritt. „Ich setze Schritt für Schritt, Fuß vor Fuß und summe<br />
ein Lied für mein Mädchen“, hatte Gertrude an einer Stelle geschrieben;<br />
obwohl sie nicht wissen konnte, dass ich ein Mädchen würde, dachte<br />
Theresa und ließ ihren Blick dem vom Mond hingeworfenen Umriss eines<br />
Fensters vom Fensterrahmen die Wand hinauf bis zur Decke folgen, wo<br />
der helle Umriss bei einer gemalten Szene anhielt: Eine dicke Frau, die in<br />
der rechten Hand ein Seepferdchen schwang, kniff einen noch dickeren<br />
Engel mit der linken Hand in die Schulter. Ihr gegenüber ein irgendwie<br />
von einem Einhorn aufgespießter Engel, der ihr einen Spiegel hinhielt;<br />
über ihm ein Band mit der Aufschrift „PRUDENTIA TE SERVABIT“, ein<br />
Spruch, den die Klosterschülerin Theresa unschwer als Teil der Sentenz<br />
„Consilium custodiet te, prudentia servabit te“ erkannte. De facto hatte<br />
sie ihn schon drei Mal hundert Mal in ein Heft geschrieben, samt der<br />
Übersetzung: Guter Rat wird dich bewahren, Verstand dich behüten. Doch<br />
was sollte das Fehlen des ersten Teils hier bedeuten? Und warum zwickte<br />
die dicke Frau den armen Engel?<br />
Theresa jedenfalls wärmte sich zuerst ihre rechte, dann ihre linke Fußsohle<br />
am jeweils anderen Oberschenkel und nahm dann die offen stehende Tür<br />
zu ihrer Rechten, die sie, wie Theresa erkannte, direkt ins Stiegenhaus<br />
führte. Es mochte genetisch vererbte Sorglosigkeit sein, Waghalsigkeit,<br />
Forschergeist – Theresa war der mysteriöse Ring eingefallen, der sich wie<br />
eine Halskrause um den Flaggenturm gezogen hatte. Zu ihm, zumindest<br />
zu einem Fenster im zweiten Stockwerk, von dem aus man ihn begutachten<br />
konnte, wollte sie nun vordringen.<br />
Theresa bewegte sich bereits auf die Stufen zu, als ihr Blick ein zweites<br />
Mal von einem Kunstwerk gefesselt wurde. Der Stein oder Marmor, das<br />
konnte sie nicht sagen, schien ihr, als sie ihn berührte, sonderbar kalt<br />
und sein Standort schien mit Stolz gewählt und entbehrte nicht einer<br />
gewissen Logik, denn das Stiegenhaus gab gewissermaßen den Herztrakt<br />
des Schlosses. Sie legt kurz ihre Wange an die kühle Tafel, als würde<br />
sie an der Wand lauschen, dann trat sie zwei Schritte zurück und besah<br />
das Ornament genauer. Wie auf einem Schachbrett, einem in die Länge<br />
gezogenen Schachbrett, um exakt zu sein, waren dort Buchstaben
170 — 171<br />
Christof Huemer<br />
angeordnet. Suchte man das Zentrum des Kunstwerks, was Theresa<br />
automatisch tat, fand man ein tänzelndes F, den einzigen Buchstaben,<br />
der nur einmal vorkam. Ausgehend von diesem Mittel-F strahlten all die<br />
restlichen Buchstaben in alle Richtungen, ergaben unzählige mögliche<br />
Wege und Straßen und Schneisen. Doch egal, welchen Pfad von der Mitte<br />
zu einer der Ecken man nahm, egal welchen Ausweg man suchte – die<br />
Buchstaben waren so angeordnet, dass sie immer den Namen „Franz<br />
Hillebrand“ ergaben, nie etwas anderes. Einen kurzen, bitteren Moment<br />
lang dachte Theresa, sie müsse das Orakel etwas fragen, aber ihr fiel keine<br />
Frage ein, warum hat meine Mutter darüber nie geschrieben, wunderte sie<br />
sich und ihr Gesicht verzog sich zu einer Grimasse, der es gelang, den<br />
restlichen Körper zu beruhigen. Dann setzte sie einen Fuß auf die erste<br />
Stufe und erstarrte, als sie plötzlich die Stimme von Frau Thannver direkt<br />
hinter sich vernahm.<br />
„Wohin, darf ich fragen, gedenken Sie zu gehen?“<br />
Theresa blies wie auf Befehl ihre Kerze aus.<br />
„Auf dem Weg zum Schloss ist mir ein, wie soll ich sagen, Steg, rund um<br />
den Flaggenturm aufgefallen“, sagte sie.<br />
„Ein Steg?“<br />
„Vielleicht mehr ein Ring, wie eine Beilagscheibe...“<br />
„Fräulein Theresa,“ aus ihrem Mund klang es wie der Name einer zur<br />
Recht Verurteilten, „ich gebe Ihnen einen guten Ratschlag: Sie werden<br />
keinen Fuß in den zweiten Stock dieses Hauses setzen.“<br />
„Aber wieso denn nicht?“<br />
„Der zweite Stock ist für Helene reserviert.“ Dann fügte die im blassen<br />
Mondlicht noch fahler und toter wirkende Thannver hinzu, dass es spät<br />
sei, das Fräulein jetzt wohl besser zu Bett gehe, man habe ihr eine Tasse<br />
Tee ans Bett gestellt, und als Theresa sich darauf hin nicht bewegte,<br />
vernahm sie ein gefauchtes „Verschwinde in Dein Zimmer!“<br />
Theresa brach in Tränen aus, lief zurück in ihr Zimmer, knallte die schwere<br />
Tür zu, warf sich sehr theatralisch dagegen, und es war, als hörte sie<br />
direkt davor jemanden zischen: „Bleib weg von meinem zweiten Stock!“<br />
5) Den nächsten Tag brachte Theresa damit zu, das Schloss mit Ausnahme<br />
des zweiten Stocks zu erkunden und ihr Erleben mit dem in Einklang zu<br />
bringen, was sie bisher aus dem Tagebuch ihrer Mutter kannte. Bei sich<br />
im Zimmer und gleich nachdem sie morgens die Augen geöffnet hatte,<br />
fing sie an. Sie öffnete, auch auf der Suche nach ihrem eigenen Koffer,<br />
sämtliche Schränke, drei an der Zahl, und fand sie voller weißer Wäsche.<br />
Es handelte sich jedoch nicht um Bettwäsche, wie sie die Stapel zunächst<br />
vermuten ließen. Im Kasten neben der Tür zum Stiegenaufgang fand sich<br />
im Mittelfach Babykleidung für, so schien es Theresa, Kinder von null bis<br />
24 Monaten, und sie hatte mit dieser Einschätzung recht. Allen Lätzchen,<br />
Strampelanzügen, Hemdchen etc., alle weiß, war in Hals- oder Bundnähe<br />
das Monogramm HH eingestickt. Im Fach darunter: Kinderhemden,<br />
-nachthemden, -leibchen, -röcke, -jäckchen, alle weiß, allen in Hals- oder<br />
Bundnähe das Monogramm HH eingestickt. Im Fach darüber: Blusen,<br />
Jacken, Röcke, Leibchen für Kinder im Schulalter, wie Theresa wieder<br />
richtig schätzte, alle weiß, allen in Hals- oder Bundnähe das Monogramm<br />
HH eingestickt. In den beiden anderen Schränken, und auch hier fehlte<br />
weder das Monogramm noch das Weiß, der Rest einer Garderobe eines<br />
ganzen noch einzukleidenden Frauenlebens, vom ersten Schrei bis zum<br />
– wer konnte schon sagen, wie es zu Ende ging, sagte sich Theresa mit<br />
der für Heranwachsende typischen Morbidezza – dem letzten. Bis zum<br />
letzten Schrei, letzten Ächzen oder Hauchen von HH, in deren Nachthemd<br />
sie steckte. Ha ha. Zweimal der achte Buchstabe. H wie Hillebrand, wie<br />
Hegelmann, wie Heil. Theresa beschloss jemand nach HH zu fragen,<br />
Margit, wenn sie sie sah, Thannver, wenn es sein musste, den Notar, wenn<br />
es nicht anders ging. Dann schlüpfte Theresa in Kleid und Wäsche des<br />
Vortages, vergaß erneut, sich um den Verbleib ihres Koffers zu sorgen<br />
und wiederholte, auch aufgrund des Tageslichts weniger zaghaft, ihren<br />
nächtlichen Rundgang, das Tagebuch in der Hand.<br />
Schritt für Schritt. Das Durchgangszimmer, von dem Theresa diesmal<br />
wahrnahm, dass es anders als ihres, eine üppig verzierte Zimmerdecke<br />
aufwies. Fuß vor Fuß. Geradeaus ins nächste Zimmer, ein leeres<br />
Schlafzimmer mit kleiner, einer Voliere nachempfundenen Badenische.<br />
Auf einem Schemel warteten dort (für Theresa?) zwei penibelst gefaltete<br />
Badetücher. Schritt für Schritt. Zurück und nach links in den Marmorsaal,<br />
guter Rat und Verstand, Fuß vor Fuß in den nächsten, unbekannten<br />
Raum, das Speisezimmer. Auf einem runden, unter dem verschlissenen<br />
Tischtuch massiven Tisch – einer der schweren Stühle war bereits für sie<br />
zurückgeschoben – ein Teller mit zwei länglichen Brotschnitten, beide<br />
mit Butter bestrichen. Kein Besteck. In einer Tasse schwarzer Tee oder<br />
sehr erbärmlicher Kaffee. Schritt für Schritt und noch immer barfuss hielt<br />
sie sich links, die Tür zum Eckzimmer, eine Bibliothek, stand offen. Bücher<br />
bis an die Decke, schwere Fauteuils, auch hier wohnte niemand, ruhte<br />
niemand, las niemand, auch hier kein Mensch, nicht einmal ein Vogel vor<br />
dem Fenster. Enttäuscht, erleichtert und einsam, vor allem einsam, lief<br />
Theresa zurück in ihr Zimmer, schlüpfte in ihre Schuhe. Lief zurück ins<br />
Speisezimmer und frühstückte.<br />
Schwäche und Übelkeit, die kurz nach dieser Mahlzeit einsetzten,<br />
fesselten Theresa den restlichen Tag ans Bett. Thannver kam und sah<br />
nach ihr, legte ihre Eishand auf Theresas Stirn, ließ einen heißen, in Tücher<br />
geschlagenen Ziegelstein bringen und Theresa fragte nicht nach Frau H<br />
und fragte auch nicht nach Medizin, sondern dämmerte in Sphären, in<br />
denen die Welten der Klosterschule und des Schlosses sich ineinander<br />
schoben, und kam erst wieder so richtig zu sich, als es dämmerte. Theresa<br />
stellte sich ans Fenster, betrachtete aufmerksam das Dach der Bäume,<br />
die einen kleinen Wald bildeten, der „ein dunkler Bauch war, durch den
172 — 173<br />
Christof Huemer<br />
lautlose Tiere huschten“, dachte sie, ihre Mutter zitierend, und hörte ein<br />
Schnarren und Kreischen und Klagen, das in der Luft flog wie ein langes<br />
weißes Band und langsam näher kam. Hinter mir, auf der anderen Seite,<br />
geht die Sonne unter, sagte sich Theresa. Ich muss Thannver finden und<br />
mit ihr sprechen. Dann sah sie die Vögel.<br />
Doch wie auch schon Gertrude Hegelmann in ihrem Tagebuch notiert hatte,<br />
konnte man<br />
„Thannver nicht finden; wenn, dann fand Thannver einen. Ich habe<br />
versucht, mit den anderen Angestellten über dieses Phänomen zu<br />
sprechen und viele haben mir bestätigt, man könnte fast sagen, es<br />
ist eine Tatsache, dass man Thannver sich nie durch das Schloss<br />
bewegen sieht. Bekommt man sie zu Gesicht, dann steht sie, so<br />
als stünde sie schon ewig und noch länger hier, die Hände vor<br />
der Scham verschränkt, ihr Rock reicht bis zum Boden und man<br />
sieht ihre Füße nicht. Wie sie dies schafft, wie sie zwischen den<br />
Stockwerken wechselt, wie sie in die einzelnen Räume gelangt,<br />
ohne je auf dem Weg dorthin gesehen zu werden, ist mir, und allen,<br />
mit denen ich sprach, ein Rätsel, dessen dunkelster Teil jener ist,<br />
dass Thannver die Angewohnheit hat, stets völlig überraschend<br />
hinter einem aufzutauchen. Da steht sie dann plötzlich, erschreckt<br />
einen zu Tode mit irgendeiner Form des Tadels und wieder fragt<br />
man sich, wie sie einem so lautlos so nahe kommen konnte.“<br />
In der Tat. Als Theresa in das Zimmer mit der Badenische kam, stand dort<br />
Thannver und obwohl das Zimmer hell beleuchtet war und nichts an dieser<br />
Begegnung, die sie ja herbeiführen wollte, überraschend war, fuhr Theresa<br />
zusammen. „Ihr Bad ist bereitet“, sagte Thannver knapp. Hatte sie auf<br />
Theresa gewartet? Hatte sie gewusst, dass sie kam?<br />
6) Folgendes Bild: Theresa in der Wanne, in warmem Wasser halb liegend,<br />
halb schwebend, eine Hand auf ihrem kindlichen Bauch, ein Unterarm über<br />
ihren weiblichen Brüsten. Neben der Nische, den Blick abgewandt, auf<br />
einem Sessel sitzend, Thannver. Der Raum allein erleuchtet durch eine<br />
kleine Tischlampe, von draußen die Laute der Vögel. Keine Nachricht von<br />
Notar Burger, das Abendessen stehe, erkaltet natürlich, immer noch im<br />
Speisezimmer, Theresa fragte nicht nach der Bedeutung des Monogramms,<br />
und Thannver sprach von Theresas Mutter. „Auch ihre Mutter litt vom<br />
ersten Tag an an Übelkeit“, sagte sie und wer könnte beurteilen, ob sie<br />
es abschätzig sagte oder bloß kalt. „Eine Frau von ruheloser Energie“, sei<br />
Gertrude Hegelmann gewesen, Conrad Halder eine Seele, ein Künstler, ein<br />
Poet. Das Fehlen jeglichen Blickkontaktes verleitete Thannver zu sprechen,<br />
könnte man annehmen; schwierige Jahre hätten sie hinter sich, doch werde<br />
es bald besser; wenn Helene kommt, alles werde besser, alles sei bereit für<br />
Helene.<br />
„Ihr Vater?“, fragte Theresa, die sich auch nicht nach Helene zu fragen<br />
traute. Meldete sich im Herbst 1941, einer Eingebung folgend, zu den<br />
Fahnen. Wurde zunächst zum 312. Infanterieregiment geschickt, diente<br />
dann später unter General von Bohle, einem von Wilhelms (gemeint ist<br />
der Theresa aus dem Tagebuch ihrer Mutter hinlänglich bekannte Wilhelm<br />
Ohnesorge, damaliger Reichspostminister und enge Freund des Führers,<br />
der so wie Thannver selbst aus Gräfenheinichen stammte, wie Thannver<br />
selbst 1920 der Partei beitrat und dem zu begegnen Thannver am<br />
Machnower See das Vergnügen und dann natürlich des öfteren in diesem<br />
Hause im Dorf der Haselnussmenschen hatte; von dem Theresa später<br />
im Tagebuch ihrer Mutter noch lernen sollte, dass die Parteinummer 42<br />
die seine war, die 69 jene von Thannver) wirklich engen Freunden, wo<br />
sie doch beide so für Philatelie schwärmten ... Halders Spur, der seinen<br />
Teil beigetragen hatte, Ehre wem Ehre gebührt, der sich der Vorsehung<br />
unterworfen habe, verlor sich im Winter 1942, Dezember, Rumänien,<br />
Schicksalsjahr, von Bohle, Leichtsinn, und irgendwo dazwischen,<br />
eingestreut oder Sinnestäuschung, der Name Helene. Thannver sprach,<br />
und Theresa hörte. Thannver deutete an, Theresa, das Tagebuch im<br />
Hinterkopf, nicht wissend, dass Thannver es natürlich kannte, glich ab.<br />
Die nächsten Tage verliefen exakt gleich. Theresa stand auf, frühstückte,<br />
Übelkeit und Schwäche fesselten sie ans Bett, einmal kam ein Arzt,<br />
verschrieb ein Mittel, Tropfen, die Thannver Theresa gab oder vorenthielt,<br />
am Abend endlich Besserung. Ein Bad, ein Gespräch, das keines ist im<br />
Halbdunkeln.<br />
Der Tag darauf. Verlief gleich.<br />
Der Tag darauf. Verlief gleich.<br />
Theresa, in ihrer Wanne, rund um sie die Geschöpfe des Paradiesgartens,<br />
von draußen das Locken der Vögel. Thannver auf ihrem Stuhl. Immer früher<br />
wird es finster. Zeit für die Fütterung. Nie mehr fiel der Name Helene. Und<br />
doch entkam Theresa nicht der Diktatur dieses Namens. Vielen kleine<br />
dunkle Andeutungen der Haushälterin – oder vielleicht war es nur der<br />
Tonfall, oder so etwas wie die Pausen zwischen den Wörtern – zwangen<br />
Theresa förmlich zur Mutmaßung, Thannver selbst bilde womöglich den<br />
Punkt, an dem all die Geheimnisse und auch die Antworten kurzweg<br />
zueinander finden mochten, und dieser Punkt trage diesen Namen. Oder:<br />
Vielleicht war Theresa, die Klosterschülerin, das Kind, auch allzu leicht zu<br />
beeindrucken. Vielleicht war sie müde aufgrund der Krankheit und dachte<br />
schwermütiger und ängstlicher, als es sonst der Fall war. Eventuell<br />
verrieten die Worte der Haushälterin und auch jene des Fahrers aus dem<br />
Dorf der Haselnussmenschen gar nichts über den Gemütszustand, den<br />
Charakter des Haselnussdorfs und seiner zitternden Empfänglichkeit für<br />
das Ewige und Reine.<br />
Folgendes Bild: Theresa, in einem Schuppen, der der Lagerung der<br />
Gartengeräte dient, und ein Erntehelfer – die Kartoffelstauden werden
174 — 175<br />
Christof Huemer<br />
ausgerissen, ihre Erde abgeschüttelt, die Früchte in Weidenkörbe<br />
geworfen – ein Erntehelfer aus dem nächstbesten bayrischen Dorf, den<br />
Theresa seit zwei Jahren als Ministranten kannte, ihn genau so lange<br />
stumm anstarrte, von ihm angestarrt wurde, schiebt seine Hand unter<br />
ihrem Rock hoch, seine gewaschene, von Erde vollkommen freie Hand.<br />
Nach 10 Minuten ist alles vorbei. Niemand hat etwas bemerkt.<br />
7) Schwäche und Übelkeit. Übelkeit und Schwäche. Nach gut einer<br />
Woche, Theresa musste sich eingestehen, dass sie jegliches Zeitgefühl<br />
verloren hatte, waren ihr beide so sehr vertraut, dass sie untertags, es<br />
war ein Sonntagvormittag und sie wähnte Thannver in der Kirche, den<br />
Versuch zu lesen unternahm. Sie holte das Tagebuch aus dem Schrank<br />
mit der Babywäsche, vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe ihres<br />
Zimmers war und begann zu lesen, und es war an diesem Tag, dass ihre<br />
Mutter in einem Eintrag zum ersten Mal den Ring erwähnte.<br />
„Wir nahmen das Abendmahl dann ohne Gezänke [dieser Stelle<br />
war ein Streit vorangegangen] im Speisezimmer, Conrad las wie<br />
für gewöhnlich seine Zeitung. Und nach dem Essen hatte wie<br />
immer Frau Thannver ihren Auftritt und unser gerade wieder<br />
aufgenommenes Gespräch geriet ins Stocken. Frau Thannver stellte<br />
sich an den Tisch, viel näher zu Conrad als zu mir – aber: besser so<br />
– und ließ dort ihre üblichen Fragen nach dieser Front oder jenem<br />
Buch ab; sie versuchte dabei wie eine preußische Intellektuelle zu<br />
klingen (was sehr lustig ist, schade, dass Conrad keinen Humor<br />
hat), während Conrad ein Messer mit Horngriff und kurzer Klinge<br />
aus der Tischschublade holte und einen Apfel schälte, einfach des<br />
Schälens wegen. Und, ich weiß nicht warum ich es tat und warum<br />
genau dort und dann, ich fragte Conrad: „Conrad, was hat es mit<br />
dem Ring um den Turm auf sich?“ Ich war wahrscheinlich bloß<br />
neugierig. Aber Frau Thannver und Conrad wechseln hektisch<br />
Blicke, ängstliche Blicke. „Ring...?“ fragt Conrad noch, da fällt ihm<br />
Thannver dazwischen und mich an: „Das ist allein Angelegenheit<br />
Helenes. Herr Halder, bitte sorgen sie dafür, dass die zukünftige<br />
Frau Halder sich von Helenes Räumlichkeiten fernhält.“<br />
Ach, dieser entsetzliche Krieg. Er macht die Menschen so<br />
sonderbar. Ich wollte Conrad nach Helene fragen, aber die einzige<br />
Zeit, zu der ich ihn sehe, ist das Abendessen, und da kommt<br />
immer sofort Frau Thannver und stört. Meine zwei Vermutungen<br />
bezüglich Helene: Thannver hat eine geheime Liebhaberin, die<br />
oben im Turm wohnt, nicht ernst gemeint, natürlich. Oder Helene<br />
ist der Name von irgendeinem Geheimprojekt, das Ohnesorge hier<br />
betreibt (für das er womöglich auch Conrad benötigt, wofür denn<br />
auch sonst) und der Ring gehört dazu. Das Wetter ist nach wie vor<br />
grässlich. Am liebsten würde ich heizen lassen.“<br />
Und Theresa las auch den Eintrag des nächsten Tages, geschrieben<br />
gleich in der Früh, man spürte, dass Gertrudes Eindruck noch frisch war.<br />
Ihre Mutter war in der Nacht aufgewacht, verstört und angsterfüllt. Sie<br />
hatte geträumt, schlecht geträumt, in schwarzweiß. Wie sie auf einem<br />
Schachbrett stand, das das Schloss war und Personen, die sie aus dem Dorf<br />
der Haselnussmenschen kannte oder ihr nahe standen, ihre Großmutter<br />
etwa, warteten neben ihr vor sich hin, jede für sich auf einem eigenen<br />
Feld. Dann wurde Gertrude von irgendwelchen Mächten verschoben und<br />
sie spürte, dass es ein schlechter Zug gewesen war, und sie wollte etwas<br />
sagen, es gelang ihr aber nicht; sie wollte schreien, doch sie konnte nicht;<br />
sie wollte sich wehren, aber nichts half, eine hochmütige Figur rückte<br />
neben sie und Gertrude hörte Stimmen rufen, die Königin werde fallen,<br />
die Königin werde fallen. Gertrude versuchte den Bann zu lüften, sich<br />
zu bewegen, zu schreien, leben zu können. Ein Zug wurde gemacht, eine<br />
schwarze, kalte Frauenfigur kam auf sie zu, kam immer näher, stieß aber<br />
schließlich nicht sie um, sondern Conrad Halder, den König, der, ohne<br />
dass sie ihn wahr genommen hatte, direkt neben ihr stand all diese Zeit,<br />
und Gertrude wachte auf, panisch, richtete sich auf, sie blickte atemlos<br />
neben sich. Da lag ihr zukünftiger Gemahl. Conrad Halder schlief tief und<br />
fest. Gertrude lachte erleichtert auf, fuhr mit einer Hand durch sein Haar,<br />
strich es aus der Stirn. Dann konnte sie einfach nicht anders. Sie weckte<br />
ihn, rüttelte ihn wach. „Was?“, fragte Halder. „Was ist los?“<br />
„Conrad, ich liebe Dich!“, sagte Gertrude und umarmte ihn, indem sie sich<br />
einfach auf ihn legte, auf ihn warf, ihn mit sich zudeckte. „Nichts ist los.<br />
Ich liebe Dich nur so sehr.“<br />
Halders Kopf drehte sich leicht zu ihrem hin. Sie sah es ihm sofort an.<br />
Sein unbewegtes Gesicht, an dem sich außer einem Halsmuskel nichts<br />
rührte oder zuckte, als Halder sich zu ihr drehte, nicht einmal besonders<br />
verschlafen oder durcheinander, wirkte zwar wie stets elegant und<br />
distanziert. Auch sagte Halder gar nichts, nicht einmal „Was ist bloß los<br />
mit dir?“ oder was er sonst zu sagen pflegte, wenn Gertrudes Benehmen<br />
ihm Anlass zu Ärger bot oder er sich wegen ihr schämte. Er blickte sie bloß<br />
an mit einem Blick, und dieser Blick sagte es. Als sei diese Umarmung das<br />
Ekelhafteste, Unglaublichste und Abartigste, das ihm je widerfahren sei<br />
und deshalb auch ohne Beispiel, wie man damit umgehen könnte, sagte<br />
dieser Blick: Du bist widerwärtig, dreckig und noch mehr und, und das<br />
traf Gertrude am allermeisten, dieser Blick konnte auch nicht verhehlen,<br />
wie peinlich Halder das Vorgefallene war. Jedoch nicht peinlich auf<br />
herkömmliche Faux-pas-Art, weil sich so etwas nicht schickte; auch nicht<br />
peinlich um ihretwillen. Nein, peinlich um seinetwillen und einer höheren<br />
Instanz wegen, als müsste Halder vor Scham vergehen, dass zwischen<br />
dem, wofür er stand, und ihr überhaupt je, wenn auch nur einmal, eine<br />
Verbindung bestanden hatte.<br />
Gertrude wurde also klar, dass er nie mehr mit ihr schlafen oder sie<br />
berühren würde. Nicht klar wurde ihr selbstverständlich, dass sie ihn
176 — 177<br />
Christof Huemer<br />
nie mehr sehen sollte. Halder, der aufstand, bevor sie wach war und<br />
den sie den ganzen Tag – augrund seiner Arbeit? – nie sah, nahm seine<br />
Abendessen, wie Thannver sie informierte, ab dieser Nacht im Dorf. Um<br />
sie nicht zu wecken, bezog er ein zweites Schlafzimmer, und als Gertrude<br />
endlich, zwei Wochen nach dieser Nacht, den Mut aufbrachte, seine<br />
Anwesenheit ein für allemal einzufordern, war er bereits an der Ostfront.<br />
Theresa, deren Bauch sich wölbte, nahm ab diesem Sonntag ihre<br />
nächtlichen Erkundigungen wieder auf. Jedoch traute sie sich nicht<br />
in den zweiten Stock, und da alle Türen zum Nordteil des ersten<br />
Geschosses versperrt waren – sie fand sowohl die Tür vom Speisezimmer<br />
in den nächsten Raum als auch die zweite Tür in ihrem Zimmer versperrt,<br />
beschränkten sich ihre nächtlichen Wandlungen auf die fünf ihr schon<br />
bekannten Zimmer. Bis sie eines Nachts, es war eine helle, winterliche<br />
Vollmondnacht und die Böden und Möbel ächzten beim leisesten Hauch,<br />
die Klinke an der Tür im Speisezimmer drückte und die massive Holztür<br />
ein Stück nachgab. Nach kurzem Zögern – bezüglich des ersten Stocks<br />
gab es von Thannver kein Verbot – schob Theresa die Türe einen Spalt auf,<br />
schlüpfte in den Raum und sah sofort die bizarren Möbel. Sessel, Fauteuils,<br />
Tische, Beistelltische, alle in penibelster Kleinarbeit aus den Geweihen<br />
toter Hirsche gefertigt, die Sitzgarnitur gewordene Spießrutenfantasie<br />
eines vor Jagdlüsternheit kranken Gehirns. Theresa wusste nicht, was<br />
sie angesichts dieser Obszönitäten fühlen sollte, wollte lachen, spürte<br />
gleichzeitig eine ganz andere Übelkeit in sich aufsteigen und erinnerte<br />
sich an eine Stelle im Tagebuch ihrer Mutter. Die Stelle fand sich relativ<br />
am Beginn der Aufzeichnungen, und da sie nichts mit ihrer Mutter zu tun<br />
hatte, sondern mit einer Frau, die Theresa nicht kannte, hatte sie diese<br />
offenbar mit weniger großem Interesse gelesen. So aber lief Theresa<br />
zurück, holte das Tagebuch aus dem Wäscheschrank und warf sich damit<br />
aufs Bett. Sie fand den Eintrag auf der fünften Seite.<br />
„... und setze meinen Fuß durch die Tür und in ein Zimmer, das mir<br />
das Grauen über den Rücken jagte. Gleichzeitig musste ich um ein<br />
Haar lachen, denn alle Möbel in diesem Raum waren aus Tierhorn,<br />
also Geweihen gefertigt: Eine komplette Zimmereinrichtung<br />
voller Enden und Zacken und Spieße. Ich wollte mich kurz auf<br />
der Armlehne eines Stuhls niederlassen, um die Szenerie auf<br />
mich wirken zu lassen, tat es dann aber nicht aus Angst, mein<br />
Nachthemd zu beschädigen. Und da erinnerte ich mich einer<br />
Geschichte, die man sich auf der Hakeburg erzählt hatte. Dass<br />
nämlich Hitler und seine Gefährtin Eva Braun in diesem Schloss<br />
bei Wilhelm Ohnesorge, Conrads Vorgesetztem, zu Gast war und<br />
dass nach der Abendgesellschaft, während derer man sicher<br />
angeregt über die Herrlichkeit der deutschen Landschaft und den<br />
kernigen Menschenschlag der Haselnussmenschen geschwätzt
178 — 179<br />
Christof Huemer<br />
hatte, alle ins Bett gegangen waren. Nur Eva Braun wollte noch<br />
länger am Feuer sitzen. Hitler, Ohnesorge, dessen Frau Gustie<br />
und noch andere gingen also auf ihre Schlafzimmer, Eva blieb<br />
noch. Und während unser Führer Carlyles Biografie Friedrichs<br />
des Großen studierte, setzte sich Eva Braun so folgenschwer und<br />
unglücklich und gleichzeitig fest und ruckartig in einen der Sessel<br />
(oder vielleicht war es ein Unfall und sie war von der Armlehne<br />
abgerutscht; auch mag sie gestolpert sein, man war sich darin<br />
damals nicht einig) dass ein Geweihspieß eine ihrer Schamlippen<br />
perforierte und tief in ihr Fleisch eindrang. Über die folgenden<br />
Einzelheiten wusste man natürlich noch weniger. Hitlers Leibarzt<br />
reiste bereits am nächsten Tag in das Dorf der Haselnussmenschen<br />
und nähte und korrigierte so gut es ging, was der in der Nacht<br />
gerufene örtliche Mediziner sich kaum anzurühren gewagt hatte.<br />
Geschlechtsverkehr zwischen Hitler und Eva Braun soll ab dieser<br />
Nacht jedenfalls nicht mehr stattgefunden haben; stattgefunden<br />
haben können, wie es häufiger hieß, wobei sich die Berichte, die<br />
es zu diesem Unfall gab, jeweils sowohl auf einen Vertrauten<br />
des Leibarztes als auch darauf stützten, dass Hitlers Politik<br />
in den darauf folgenden Wochen, etwa in der Judenfrage, eine<br />
entscheidende Wende nahm. [Das könnte in der Tat stimmen.<br />
Historiker gehen momentan davon aus, dass die endgültigen<br />
Entscheidungen, die zum Holocaust führten, im Herbst 1941<br />
gefallen sein müsse, was zeitlich gut hinkäme.] Eine Version all<br />
dieser Berichte, die natürlich dadurch interessanter wurden, dass<br />
sie zu erzählen lebensgefährlich war, erscheint mir, da ich die<br />
Möbel selbst gesehen habe, nun jedoch am Glaubwürdigsten, ich<br />
weiß nicht warum. Es ist jene, die niemand bis dato für besonders<br />
plausibel hielt. Dass Eva Braun es absichtlich getan hatte. Dass<br />
sie den Spieß, den Zacken, das Ende absichtlich durch ihre<br />
Schamlippe getrieben hatte, warum auch immer.<br />
Ich setzte meinen Versuch, zu diesem seltsamen Ring zu<br />
gelangen, der immer nur in den Stunden der Dämmerung,<br />
gemeinsam mit dem Lullen der Vögel zu existieren scheint, an<br />
diesem Abend nicht fort.“<br />
8) Nach Wochen, vielleicht Monaten im Schloss, zumindest war aus Herbst<br />
Winter geworden, hatte sich Theresas Zustand soweit gebessert, dass sie<br />
zwar tagsüber das Bett verlassen konnte. Sobald sie aber ein paar Schritte<br />
lief, die Stiegen zu schnell nahm oder aus anderen Gründen außer Atem<br />
geriet, bemächtigte sich ihrer eine bis dato ungekannte Erschöpfung, und<br />
ihr Bauch war so geschwollen, dass die von ihr mitgebrachte und kürzlich<br />
wieder aufgetauchte Kleidung nicht mehr passte. Da Thannver sich nicht<br />
daran störte, bediente sich Theresa also jener Blusen, Jacken etc., die sie<br />
im Schrank in ihrem Zimmer fand.<br />
Vom Notar hatte Theresa einen Brief erhalten, den Thannver ihr ungeöffnet<br />
übergab. Sein Inhalt lief vollumfänglich auf eine Entschuldigung heraus,<br />
die Gründe für die lange Absenz jedoch blieben vage, Geldgeschäfte.<br />
Beigelegt war eine Postkarte aus Buenos Aires. Theresa besah kurz<br />
die Briefmarke. Sie war ebenfalls in Buenos Aires abgestempelt, sie<br />
wollte sich nicht vorstellen, wie lange eine Schiffspassage, sagen wir<br />
von Marseille nach Argentinien, oder von Buenos Aires nach Rotterdam<br />
dauerte. Theresa bemerkte Thannver, die plötzlich oder immer noch hinter<br />
ihr stand und lief weinend und leicht watschelnd auf ihr Zimmer.<br />
In einer der nächsten Nächte ereignete sich Seltsames. Theresa fand,<br />
wieso auch nicht, alle Türen im ersten Geschoss offen. Sie konnte also,<br />
wie ihre Mutter es getan hatte, Schritt für Schritt, Fuß vor Fuß aus<br />
ihrem Zimmer in den Durchgangsraum, von dort in den Marmorsaal<br />
(„Verstand wird dich behüten“), von dort in das Speisezimmer, weiter in<br />
den bizarren Raum der Eva Braun wandeln. Und weiter in eine Folge von<br />
nordseitig gelegenen, feucht-muffigen Räumen, von denen der erste an<br />
den Flaggenturm anschloss. Wie in allen anderen Räumen der Nordseite,<br />
verhinderten auch in diesem, von den Schreien der Vögel erfüllten Raum<br />
geschlossene, oder wie es Theresa schien: vernagelte Fensterläden<br />
einen klärenden Blick nach draußen. Auf die Vögel und den Grund ihres<br />
Lärms. Auf den See, der zugefroren und trüb, unterhalb des Schlosses<br />
im Dauerschatten lag. Auf die Fassade des Flaggenturms, um die sich<br />
einen Stock höher ein Ring, ein Reif, ein Steg ziehen musste. (Nicht, dass<br />
Theresa noch nie versucht hatte, bei Anbruch der Nacht aus dem Schloss<br />
zu gelangen. Sobald es ihr Zustand zuließ, galt diesem Ziel beinahe all<br />
ihre Energie; die Mission ihrer Mutter, das Auffinden des Stegs, war zu<br />
ihrer Mission geworden. Allein das Schlossportal, der einzige Weg nach<br />
draußen, blieb mehrfach verschlossen, Theresa war also eine Gefangene.<br />
Nur, dass sie dies nicht so empfand, denn auch im Münchner Internat<br />
war es ihr noch nie anders ergangen.). Theresa ging weiter, öffnete Tür<br />
um Tür der Zimmer des Nordtraktes, vier Räume, in jedem derselbe<br />
kalte Schiffsboden, dieselbe Dunkelheit, die Fenster in jedem einzelnen<br />
verschlossen, vernagelt. Ich muss versuchen, eine Zange aufzutreiben,<br />
dachte Theresa, wusste gleichzeitig, dass ihr eine Zange nicht helfen<br />
würde, dass sie schon eher so etwas wie ein Brecheisen benötigte und<br />
ärgerte sich, dass sie zwar Latein beherrschte, nicht aber die Namen für<br />
die einfachsten Werkzeuge kannte. Sie öffnete enttäuscht und zugleich<br />
erleichtert, einen ersten Rundgang absolviert zu haben, ohne jemanden<br />
zu treffen, die diesmal nicht verschlossene zweite Tür zu ihrem Zimmer.<br />
Und bemerkte sogleich eine kleine Gestalt, die sich an ihrem Versteck<br />
zu schaffen machte. Ohne das leiseste Zögern rannte Theresa los, warf<br />
sich gegen den winzigen Dieb, der wuchtig gegen die Regalbretter des<br />
Wäschekastens prallte und dann zu Boden ging, wimmernd und klein.<br />
Die Kerze, die Theresa immer noch in der Hand hielt, war bei ihrer Attacke
180 — 181<br />
Christof Huemer<br />
ausgegangen. Theresa entzündete sie erneut und erblickte ein aus der<br />
Nase blutendes Mädchen mit zwei seitlich abstehenden Zöpfen, keine<br />
acht Jahre alt.<br />
„Wer hat dich geschickt? Was willst Du mit meinem Buch?“, herrschte<br />
Theresa den blutenden Zwerg vor ihr an, der zunächst gar nichts sagen<br />
wollte, sich aber nach mehreren immer drohender dargebrachten Fragen<br />
schließlich erklärte. Sie habe nichts stehlen wollen, bei ihrer kranken<br />
Großmutter nicht. Der Grund, warum sie halb im Schrank verschwunden<br />
wäre, sei ein einfacher. Sie hätte Schritte gehört, gedacht, es handle sich<br />
um Thannver und das nächstbeste Versteck aufgesucht.<br />
Was sie in ihrem Zimmer zu suchen hätte, fragte Theresa.<br />
Ihr Vater, sie wohne unten in der Fischerhütte, eines der irren Gesichter,<br />
sagte sich Theresa, ihr Vater habe sie geschickt, Theresa zu warnen.<br />
Ihr Vater?<br />
Der Fischer, Chauffeur, Handwerker, Hausbesorger in einer Person.<br />
Und wovor warnen?<br />
„Ich weiß, wie Deine Mutter gestorben ist.“<br />
Und Theresa ließ das blasse kleine Kind mit den zwei Zöpfen erzählen.<br />
Gertrude, ihre Mutter, sei abends aus der Badewanne gestiegen,<br />
hochschwanger und angelockt durch einen Laut, so wie ein Hund auf<br />
eine Pfeife, nein, wie eine Schlange auf eine Flöte reagiert. Sie hätte<br />
sich in ihr Handtuch gehüllt und sei der Melodie gefolgt, barfuss und<br />
alle Vorsicht in den Wind schlagend, sei in den zweiten Stock gelangt,<br />
in den zweiten Stock und in jenes sagenhaft weiße Eckzimmer, das an<br />
den Flaggenturm anschließt. Sie habe gesungen, als sie das Zimmer<br />
betreten habe, „Was hat sie gesungen?“, schnappt Theresa dazwischen.<br />
Gesungen, lässt sich das Mädchen nicht irritieren, sie sei die fünf, sechs<br />
Stufen hinaufgestiegen, wie eine Braut. Das Fenster stand offen. Sie sei<br />
hinausgeschritten. Auf den Steg, den Ring, Schritt für Schritt, als hätte<br />
sie es geübt, und eigentlich hätte sie immer nur weiter gehen müssen,<br />
immer weiter um das Rund des Turms herum, beim zweiten Fenster hinein<br />
in das Weiß, die Stufen hinunter. Das kleine Mädchen begann zu husten,<br />
ein bellendes, krankes Husten, und Theresa schüttelte es: „Erzähl!“<br />
Man habe sie nie gefunden. Sie sei am höchsten Punkt ... einfach<br />
verschwunden, hieße es. Nicht hinunter gestürzt, gefallen, gesprungen,<br />
zig Meter weit, nicht davon getragen. Verschwunden. Und auf der obersten<br />
Stufe, im Zimmer, fand man ein Neugeborenes.<br />
„Mich?“, fragte Theresa.<br />
„Mein Vater sagt, ja.“<br />
„Und was hat es mit dem Steg auf sich?“<br />
„Ich weiß nicht?“<br />
„Was hat es mit dem Steg auf sich?“<br />
„Ich weiß es nicht!“<br />
Theresa packte das blasse Mädchen, riss es hoch, warf es zu Boden und<br />
trat mit ihren Füßen gegen den kleinen Körper so fest es ging, gegen<br />
den Kopf, die Rippen und dorthin, woher die enervierenden Geräusche<br />
kamen, sie trat und trat, bis sie selbst erschöpft war, bis er ihr besser<br />
ging, weil einmal sie die Stärkere war, die Unbarmherzige, weil sie einmal<br />
nicht das Gefühl hatte, sich in Luft aufzulösen, ein Gefühl des kaum mehr<br />
Existierens, das sie hatte, seitdem sie hier war; bis sie Thannver hinter<br />
sich sagen hörte: „Hör sofort auf!“<br />
Ein sehr großer, sehr blonder Mann mittleren Alters, den Theresa vorher<br />
noch nie gesehen hatte, trug den übel zugerichteten Körper des Mädchens<br />
aus ihrem Zimmer, gleich nachdem Theresa von ihm abgelassen hatte,<br />
und sogleich erschien auch Margit mit Eimer und Tüchern und beseitigte<br />
die Blutflecken. Thannver blieb vor dem offenen Kasten stehen, bis alles<br />
verrichtet war, und keine Falte in ihrem Gesicht bewegte sich, ein Hinweis,<br />
dass ihr Zorn über diesen Vorfall schnell verrauchen würde.<br />
Der Arzt, der Theresa nach dem Frühstück des nächsten Tages aufsuchte,<br />
diagnostizierte einen Nervenzusammenbruch, verordnete Ruhe,<br />
körperliche und geistige, und gab ihr eine Spritze. Theresa erwachte am<br />
nächsten Morgen.<br />
9) Folgendes Bild: Theresa sitzt im Speisezimmer beim Frühstück und<br />
dreht sich um, weil Thannver den Raum betritt, mit einer Torte. 14 Kerzen.<br />
Hinter ihr der sehr große, sehr blonde Mann, der vor ein paar Tagen das<br />
halbtote Mädchen aus ihrem Zimmer getragen hatte. Beide singen sie<br />
„Zum Geburtstags viel Glück, zum Geburtstag viel Glück“, und anstatt der<br />
Zeile, in der es „liebe Theresa“ heißen müsste, singen sie ebenfalls „zum<br />
Geburtstag.“ Theresa rechnet nach. Ihrer raschen Kalkulation zufolge, die<br />
zur Hälfte auf ihrem Gefühl, zur Hälfte auf der Zahl der Vollmonde basiert,<br />
liegt ihr Geburtstag in etwa acht, neun Wochen zurück. Thannver stellt<br />
den Kuchen auf den Tisch und eine merkwürdige Situation entsteht, da<br />
sich im Raum kein Messer befindet, um ihn anzuschneiden. Auch nicht<br />
das kleine Messer mit dem Horngriff, mit dem Ihr Vater seinen Apfel<br />
schält. Theresa hat das längst überprüft.<br />
Ab diesem Tag sollte Theresa den sehr großen, sehr blonden Mann täglich<br />
sehen. Er kam, sobald sie ihr Frühstück beendet hatte, geleitete sie die<br />
paar Meter in die Bibliothek, nahm ein Buch aus einem der Regale und<br />
ging es mit ihr durch. Theresa las über Norwegen; über die Tugenden<br />
Keuschheit, Bußfertigkeit und Entsagung; sie hörte von Pflanzenarten des<br />
Toten Gebirges, von Brehms Tierleben; sie lernte die Kunst Michelangelos<br />
über jene Brunelleschis zu stellen. Sie grub sich durch das Tal der Könige.<br />
Sie verehrte den Medici Giovanni die Bicci, zumindest tat sie so. Sie las<br />
eine vereinfachte Form von Moby Dick auf Englisch, kurz: Unterricht, der<br />
die in ihren weißen Kleidern noch blasser wirkende Theresa so erschöpfte,<br />
aber genau das mag seine Aufgabe gewesen sein, dass sie das Angebots<br />
einer Mittagsruhe gerne annahm. Sie zog sich dann in ihr Zimmer zurück,<br />
sah lange aus den Fenstern auf die verschneite Landschaft und widmete
sich ernsthaft und immer noch heimlich ihrem strengen Regime von<br />
höchstens drei Tagebuchseiten pro Tag.<br />
Ihre Mutter, hochschwanger, widmete sich wiederum allein dem Rätsel<br />
um den Ring. Sonntag für Sonntag begab sich die Hochschwangere<br />
und an sich bedingt gläubige Gertrude auf den beschwerlichen Weg zur<br />
Johanneskapelle, um nach der Messe unter dem Vorwand der Stärkung und<br />
Ruhe eines der Gasthäuser aufzusuchen und Erkundigungen einzuholen.<br />
Theresa, die sich nicht erinnern konnte, das Schlossgelände je verlassen<br />
zu haben, versuchte sich vorzustellen, wie ihre Mutter die matschige<br />
Strasse hinunter zum See schlitterte, der bleifarben und wie ein<br />
monströser Pechtropfen im Schatten lag. Wie sie dann weiterstapfte,<br />
den unerträglichen Weg entlang, der nirgendwohin führte, ins Dorf der<br />
Haselnussmenschen, und der Theresa, wie zurzeit fast alles, das nicht<br />
Schloss war, auch nicht von dieser Welt zu sein schien. Sie malte sich aus,<br />
wie ihre Mutter eine ganze Messe lang ausharrte, um dann im Gasthof des<br />
Herrn Zettler Erkundigungen über den Ring einzuholen. Ihre Mutter, die<br />
trotz ihres Zustandes immer noch von einschüchternder Schönheit war,<br />
zumindest wollte Theresa sich so erklären, warum Thannver, die ihren<br />
Vater so verehrte, sie partout nicht leiden wollte, suchte dort dann die<br />
Nähe alter Zausel, knorriger Bauern oder Soldaten auf Heimaturlaub, die<br />
in ihrem Tagebuch zu schildern Gertrude eine Riesenfreude bereitete. Die<br />
übrigen Gespräche verstummten kurz, sobald diese Kontaktaufnahme<br />
erfolgreich war, und kreisten sodann allein darum, wie und in welcher<br />
Stellung jeder einzelne Gertrude gerne vögeln würde. Und Gertrude fragte<br />
ihre Opfer nach dem Ring, der sich, immer nur zur Zeit der Dämmerung,<br />
um den Flaggenturm des Schlosses zu schlingen schien.<br />
Zumeist gaben sich die Herren verschwörerisch. Ob sie schon einmal<br />
etwas von Feng Shui gehört habe, fragte sie etwa ein Volksschuldirektor<br />
im Ruhestand und schüttelte für sie den Kopf gleich mit. Wong Schweh,<br />
wie er es aussprach, sei die Lehre der Harmonisierung des Menschen mit<br />
seiner Umgebung, eine alte asiatische Kunst, die speziell hier im Dorf<br />
der Haselnussmenschen, denn die Haselnussmenschen seien Asiaten,<br />
Asiaten, die nicht aussähen wie Hühner und dir auch nicht die ganze Hand<br />
abkauten, wenn du ihnen einen kleinen Finger reichtest. Darin glichen sie<br />
den Bayern, aber, in Gottes Namen, man hüte sich vor den Bayern, den<br />
Salzburgern, mit denen spreche man am Besten gar nicht, es sei denn sie<br />
seien auf der Durchreise, dann seien sie wie junge Hunde. „Spielen Sie<br />
ruhig mit ihnen.“<br />
„Die Asiaten?“, fragte Gertrude.<br />
Haben eine leichte, vollkommen ausgewogene Küche, was zum Teil den<br />
Fels- und Kiessteinen ihrer Küsten geschuldet sei, da könnte Schweden<br />
nicht mit. Auch England nicht, Engländer seien dreckige Schweden mit<br />
Deckel drauf. „Und die Wong Schwe?“, fragte Gertrude. Oh ja, es heiße<br />
übrigens „Schweh, das W, als würden Sie ein Schwein küssen, Schweh!“,
184 — 185<br />
Christof Huemer<br />
dabei gehe es um eine Harmonisierung der Lebensräume mit dem Äther.<br />
Wong Schweh hieße ja „den Himmel und die Erde beobachten“. Man wolle<br />
sich also die Geister der Luft und des Wassers geneigt gemacht. So gebe<br />
es etwa in Asien viele Geister, die man sich, um das Böse, das man sich<br />
nicht so wie das Böse aus Polen vorstellen dürfe, die Polen und auch die<br />
Juden seien wesentlich penibler in ihrer Bösartigkeit, die Juden geradezu<br />
rechthaberisch, um das asiatische Böse ungestört dorthin fließen zu<br />
lassen, wo es aufgesogen werde, im großen gelben Meer etwa. In den<br />
Schluchten der mittleren Gebirge, das seien noch Schluchten, die diesen<br />
Namen verdienten. Das Böse könnte also, sagen wir, aus dem Berg, sagen<br />
wir, durch das Dorf, ohne Aufenthalt ins Meer, ins Tal, in die Schlucht<br />
fließen. Und die baulichen Maßnahmen im Dorf, die dies unterstützten, im<br />
Übrigen seien die Holländer nicht nur Sodomiten, sondern auch passable<br />
Architekten, besser als viele Deutsche, diese Maßnahmen folgten der<br />
Lehre der Beobachtung von Himmel und Erde, Luft und Wasser.<br />
Und der Ring um das Schloss?<br />
Der Gürtel um den Schlossturm, im Übrigen würde er gerne einmal beide<br />
ihrer geschwollenen Titten kneten, sei genau das. Im Schloss sitze<br />
das Böse, nur dass es nicht sitze, es lauere dort, nein, es brüte dort,<br />
im Portugiesischen (als Volk schwuchtliger als die Spanier, aber bessere<br />
Seemänner) gäbe es ein Wort dafür, eine Mischung aus „wachsen“, „lauern“,<br />
„zu Kräften kommen“ und dabei „etwas planen“; und wie eine dunkle<br />
Sonne, die von Zeit zur Zeit Eruptionen zeige, Protuberanzen, müsse<br />
dieses Böse im seinem momentanen Stadium hie und da ausbrechen. Und<br />
der Ring, er gehe davon aus, das Fräulein werde sich für diese Information<br />
erkenntlich zeigen, man sollte dies als alleinstehende Frau ja schon allein<br />
des Nährwerts des Spermas wegen, er sorge dafür, dass dieses Böse, all<br />
die dunkle Energie, die aus dem Schloss schieße zur Abendstunde, nicht<br />
das Dorf der Haselnussmenschen heimsuche; dass es nicht am Grimming<br />
vorbei und in Richtung Tauplitz flöge. Dass es nicht den Weg nach Westen<br />
gen Schladming finde. Und so weiter. Das Böse würde aus dem Schloss<br />
hinaus geschleudert, das meiste davon im Ring gefangen und zurück ins<br />
Schloss geleitet werden. Der Überschuss schaffe es nicht weiter als bis<br />
zum See und zur Fischerhütte, arme Brut, die sich dort zusammenrotte.<br />
Nie schrieb ihre Mutter, ob sie sich schlussendlich erkenntlich zeigte.<br />
10) Wieder glichen sich Theresas Tage. Nach dem Frühstück das<br />
Studium, nach dem Mittagessen die Müdigkeit, das Trampeln im ihren<br />
Bauch, die Lektüre des Tagebuchs, das Abendmahl, ein treuer, seltsamer<br />
Muttesanbeterinnen-Rundgang durch den ersten Stock. Schlaf.<br />
Ein anderer Sonntag hatte Gertrude in die Stube des Gasthauses<br />
Beichtbuchner geführt, und während die anderen Männer rauchten und<br />
sich darüber unterhielten, in welcher Stellung sie die schöne Schwangere<br />
gerne vögeln würden, erhielt Gertrude einmal nicht jene mal mehr, mal<br />
weniger einfallreich ausstaffierte Geschichte vom Bösen im Schloss. Ein<br />
junger, auf einem Auge erblindeter Invalider, dem sich die Haut in Fetzen<br />
vom Gesicht schälte und den Gertrude als jungfräulich, ungeschickt und<br />
zerstreut beschrieb, als „menschliche Taschenlampe“, lud sie auf einen<br />
warmen Wein ein. Und wusste, dass „der Krieg ohne die Atombombe<br />
bald verloren sei“, worauf ein Geraune durch die Gaststube ging, sich<br />
zwei andere Heimkehrer erboten, ihm das Maul zu stopfen, vom Wirt<br />
aber barsch aufgefordert wurden, an ihrem eigenen Zopf zu ziehen,<br />
was auch immer das bedeuten sollte. Die Taschenlampe fuhr fort: Karl<br />
Wilhelm Ohnesorge, der Schlossbesitzer, wie Gertrude ja sicher wisse<br />
(was Gertrude bewies, dass er sie und ihre Geschichte nicht kannte),<br />
und dazu ein persönlicher Freund des Führers, sei auch dessen erste<br />
Ansprechperson in Sachen Atom. Ohnesorge sei er bis zu seinem Unfall<br />
unterstellt gewesen, als dessen Mann im Institut von Manfred Baron von<br />
Ardenne in Berlin-Lichterfelde (deswegen der Dialekt, dachte Gertrude),<br />
wo er an der Entwicklung eines elektromagnetischen Massetrenners<br />
gearbeitet habe, mehr dürfe er wirklich nicht sagen. Beim Flaggenturm<br />
des Schlosses handle es sich demnach, er dürfe das wahrscheinlich nicht<br />
sagen, andererseits wisse er es ja nicht, er „wisse“ es nur, ob sie verstehe,<br />
um die äußere Scheibe eines Zyklotrons, welches wohl bald um eine<br />
Anlage zur Isotopentrennung erweitert würde.<br />
Conrad Halder?<br />
Ja, er habe diesen Namen gehört.<br />
Und die Vögel, die um den Ring kreisten?<br />
Vögel?<br />
Die Gaststube prustete.<br />
Warum der Ring nur bei Dämmerung erscheine und dann wieder<br />
verschwinde?<br />
Eine optische Täuschung. Worauf Gertrude beschloss, ihm nicht länger<br />
zuzuhören.<br />
Die Ausbeute anderer Sonntage:<br />
• Die Heilige Lanze sei im Schloss versteckt (und, aber das<br />
dürfe man niemandem sagen: Eva Braun habe sich daran die<br />
Schamlippen geritzt). Gesprächspartner: ein Messdiener.<br />
• Ganz ohne Zweifel verfeinere man im Turm und für den Endsieg<br />
den so sehnlichst im Einsatz erwarteten Nurflügler, weshalb<br />
der Ring zur Dämmerung auch in Richtung Neuschwabenland<br />
zeige. Gesprächspartner: ein für den Pfarrer aus dem Dorf der<br />
Haselnussmenschen einspringender Kaplan.<br />
• Die Vril-Gesellschaftz werden ihn umbringen, wenn er es<br />
verrate, aber, nun gut: Gemeinsam mit Wissenschaftern des<br />
Sternensystems Aldebaran (über 60 Lichtjahre entfernt),<br />
denen der Grimming als Einflugsschneise und das Schloss als<br />
Lande- und Arbeitsplatz diene, werde im Schloss aus simplen<br />
organischen Verbindungen Gold gewonnen. Nebenbei, Frau
186 — 187<br />
Christof Huemer<br />
Thannver sei natürlich niemand anderes als Maria Oršič. (Als<br />
wer? Mein Gott, Kind. Selig die Unwissenden.) Gesprächspartner:<br />
ein junger Rekrut, Überlebender eines Kopfschusses.<br />
• Es handle sich um einen Balkon, nein, Verzeihung, es sei natürlich<br />
die zynischerweise als Jungfernsturz bekannt gewordene<br />
Anhöhe, derer sich junge, in Not geratene Frauen bedienten, um<br />
die Ehre ihrer Familien nicht zu schädigen. Hü und Hüpf. Haha.<br />
Gesprächspartner: ein Arschloch, dem Gertrude ins Gesicht<br />
schlug.<br />
11) Für Theresa, in deren Leben Sexualität, bis auf einen einzigen Vollzug,<br />
keine Rolle gespielt hatte, öffnete sich mit den Schilderungen dieser<br />
sonntäglichen Nachforschungen und den auf sie folgenden, impliziten<br />
Übergriffen ein Panoptikum sexuellen Wissens. Der einzige Mensch,<br />
mit dem sie darüber sprechen konnte (abgesehen von ihrem großen,<br />
blonden Lehrer, der ihr immer leicht das Gefühl vermittelte, ihm grause<br />
vor ihr) blieb Thannver. Nicht nur, weil sie neben Margit die einzige<br />
weibliche Person im Schloss war. Auch weil sich zwischen Thannver<br />
und Theresa, durch die stets einseitig verlaufenden Unterhaltungen<br />
während des abendlichen Bades und trotz oder wegen aller Asymmetrie<br />
der Beziehung, trotz aller Feindseligkeit, die von beiden kaum verhohlen<br />
wurde, so etwas wie Vertrautheit entwickelt hatte.<br />
Und so beschloss Theresa, ihr Bauch eine Kugel und die Wanne der<br />
einzige Ort, an dem sich zu bewegen ihr noch schmerzlos möglich war,<br />
Thannver, die wie jeden Abend seit Monaten auf einem Stuhl im dunklen<br />
Zimmer saß, den Rücken Theresa zugewandt, einfach zu fragen.<br />
„Wie ist das,“ fragte sie, „wenn man es in sich fühlt, wenn man endlich<br />
möchte, dass es passiert, dass diese große Nähe, der Wunsch danach,<br />
endlich beisammen sein zu können, wenn man...“<br />
„Wenn man“, nahm Thannver ihren Gedanken auf, die Stimme weicher<br />
als sonst, „in der Erwartung lebt, dass es passiert. Wenn man horcht,<br />
immerzu, ob man es nicht hört, das Nahen eines Wunders, das sich eines<br />
Nachts dem Zimmer nähert, wo sie alle warten, und es dann endlich so<br />
weit ist, das Warten ein Ende hat und sie endlich kommt, wenn sie endlich<br />
kommt ...“ Thannver verstummte. Auch Theresa sagte nichts mehr, und<br />
in der eintretenden Stille, die vom Schnarren der Vögel nicht gemindert<br />
wurde, war ihr, als hörte sie Thannver schluchzen. Leise, schüchtern und<br />
erleichtert schluchzen.<br />
In der darauf folgenden Nacht badete Theresa zum ersten Mal allein.<br />
Margit legte die Handtücher zurecht, Thannver sei ins Dorf gegangen,<br />
sagte sie, ob Theresa wünsche, dass sie bei ihr bleibe und sie starrte<br />
Theresa, die aus ihren Kleidern stieg, dabei seltsam wissend an. Nein,<br />
sie brauche nichts, es sei schon gut, antwortete Theresa und stieg erst<br />
ins Wasser, als Margit die Zimmertür geschlossen hatte. „Gute Nacht“,<br />
sagte sie dann leise. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Sie blies die<br />
Kerze aus, ließ ihren Rumpf mit dem Ausatmen ins Wasser sinken, mit<br />
dem Einatmen aufsteigen und lauschte den Vögeln, der Symphonie ihres<br />
Knarrens, sie sah sie förmlich vor sich. Wie sie mühelos schwebten,<br />
sich fallen ließen, kurz nur mit den Flügeln schlugen, Höhe gewannen<br />
und wieder frei waren. Sie schloss die Augen, konzentrierte sich ganz<br />
auf dieses tierische Raunen, und eine neue Note mischte sich unter<br />
die Schreie. Theresa war, als würde sie ihren Namen hören, als wäre<br />
es dringlich. Komm zu uns, schienen die Stimmen zu weinen, komm,<br />
säuselten die ihr so vertrauten Geschöpfe. Theresa wusste nicht, ob<br />
sie es hörte oder roch wie einen betörenden Duft. Komm, spürte sie sie<br />
rufen. Theresa drehte schnell ihre Haare im Nacken zu einem Zopf, wrang<br />
ihn aus und stieg aus der Wanne. Ein Badetuch verknotete sie oberhalb<br />
der Brüste, das zweite schlang sie um den Kopf wie einen gelüfteten<br />
Schleier. Dann folgte sie dem Rufen, folgte ihm und nichts tat ihr mehr<br />
weh. Leicht setzte sie Fuß vor Fuß auf dem Parkettboden, „Was ist los,<br />
bitte?“ fragt sie hallend in den Raum rund um sich, mehr um denjenigen,<br />
zu dem sie ging, wer auch immer das war, wissen zu lassen, dass sie<br />
kam. „Bitte?“<br />
Wie auf einem Band glitt sie vorwärts. Sie kam in den Marmorsaal, der ihr<br />
heller schien als je zuvor. In seiner Mitte schwebte, wartete eine weiße<br />
Treppe, wie aus Zähnen gefertigt, sie wand sich in einer großzügigen<br />
Pirouette nach oben durch den Raum. All das ist Theresa vertraut. Das<br />
ist der Traum meiner Mutter, sagt sie sich. Das Ende des Schachspiels.<br />
Die Obhut der Vernunft. Und: Wie kann es sein, dass diese Treppe, diese<br />
gleichzeitig so himmlische und entartete Treppe, nicht schon immer<br />
hier war? „Hier, wo sie hingehört.“ Theresa, die nicht mehr zu sagen<br />
vermochte, ob sie noch selber ging und ob die Stufen vom Himmel herab<br />
oder in ihn hinauf führten, sprach es laut aus. Sie begann zu singen.<br />
Der Raum drehte sich um sie, verlosch unter ihr, auf dem Singsang der<br />
Vögel kehrte sie ein in das zweite Geschoss des Schlosses. Ich komme,<br />
sang Theresa, der klar war, dass man sie nicht hörte. Zwei vollkommen<br />
unerhebliche Räume noch. Ich komme.<br />
Die Tür stand offen. Theresa verstummte. Noch nie hatte Theresa so ein<br />
Weiß gesehen. Ein vollkommen strahlender Raum, weiß wie die Hölle. An<br />
der Stirnseite ein offenes Fenster, fünf, sechs Stufen führten hinauf zum<br />
Ring um den Turm. Der Singsang der Vögel war ein Brausen. Der sanfte<br />
Nachtwind nahm sie bei der Hand. „Ich trage dich“, hörte Theresa ihn<br />
sagen. Gleich ist es vorbei. Eine Stufe noch, und Theresa, beide Hände<br />
auf ihrem Bauch, geht hinaus. Schritt für Schritt. Fuß vor Fuß. Dann kam<br />
der Schmerz und irgendwann hörte er auf.
188 — 189<br />
Christof Huemer<br />
13) Ich bin ein kluger Vogel. Ich kann Brot fressen, ich kann Aas fressen.<br />
Ich esse mit Genuss. Wenn ich nicht esse oder schlafe, fliege ich. Ich<br />
fliege und drehe mich, und segle und tolle. Ich fliege am Schloss vorbei.<br />
Ich wirble um den Reif, der den Turm umarmt. Ich fange den Wind, lasse<br />
mich nach oben tragen, spreize meine Schwingen und schaue in die<br />
leuchtenden Fenster. Diese Frau, die wie eine Krähe aussieht, läuft ins<br />
Zimmer, die Prozession hinter ihr hält Abstand. Ich sehe ihre Tränen. Ich<br />
stoße einen Schrei aus, fliege eine schnelle Schleife, komme wieder zu<br />
stehen vor diesem offenen Fenster, und das nackte Menschenjunge, das<br />
halb am Fenster lag, halb am Reif, liegt nun im Arm der Frau. Sie wischt<br />
sich eine Träne von der Wange, dreht sich dann um und präsentiert das<br />
Menschenjunge der fiebernden, strahlenden Gesandtschaft aus dem Dorf.<br />
Heil Helene, rufen sie. Heil Helene. Der Säugling wird herumgereicht. Sie<br />
heben ihn hoch, Heil, jeder hält ihn und vergießt seine Freudentränen auf<br />
ihm. Dann nehmen sie ihn, hüllen ihn in Loden und tragen ihn zum Altar.<br />
Ich fliege weiter. Ich gleite und sause. Ich bin ein Wachtelkönig und meine<br />
Name ist ...
190 — 191<br />
1<br />
Wiederabdruck aus: Hannah<br />
Arendt: Vita activa oder<br />
Vom tätigen Leben. (c) 1967<br />
Piper Verlag GmbH, München.<br />
2<br />
Das lateinische Wort faber,<br />
das vermutlich mit facere<br />
im Sinne des hervorbringenden<br />
Menschen zusammenhängt,<br />
bezeichnet den<br />
Künstler oder Handwerker,<br />
der hartes Material bearbeitet<br />
– Holz, Stein oder<br />
Metall. Ihm entspricht das<br />
griechische Wort τέχτων,<br />
für das faber auch als<br />
Übersetzung dient. Der<br />
Plural fabri ist häufig in<br />
fabri tignarii für Bauhandwerker<br />
und Zimmerleute.<br />
Es war mir unmöglich<br />
festzustellen, wann der<br />
Begriff des Homo faber<br />
zuerst auftaucht oder wer<br />
ihn geprägt hat. Sicher ist<br />
nur, daß er ganz modernen<br />
Ursprungs ist: Jean Leclercq<br />
(in Vers la Société basée<br />
sur le Travail, in Revue du<br />
Travail, Vol. LI, No. 3, März<br />
1950) meint, daß Bergson<br />
sein Urheber ist.<br />
Das Herstellen 1<br />
Hannah Arendt<br />
Die Dauerhaftigkeit der Welt<br />
Das Werk unserer Hände, und nicht die Arbeit unseres Körpers, Homo<br />
faber, der vorgegebenes Material bearbeitet zum Zwecke der Herstellung,<br />
und nicht das Animal laborans, das sich körperlich mit dem Material<br />
seiner Arbeit „vermischt“ und ihr Resultat sich einverleibt, verfertigt<br />
die schier endlose Vielfalt von Dingen, deren Gesamtsumme sich zu der<br />
von Menschen erbauten Welt zusammenfügt. 2 Die meisten dieser Dinge,<br />
aber nicht alle, sind Gebrauchsgegenstände, und als solche besitzen sie<br />
die Haltbarkeit, die Locke als Vorbedingung des Eigentums erkannte, die<br />
Adam Smith als Vorbedingung der „Werte“ benötigte, die auf dem Markt<br />
erscheinen und ausgetauscht werden, und in der Marx den Beweis für<br />
die der menschlichen Natur eigene Produktivität erblickte. Diese Gegenstände<br />
werden gebraucht und nicht verbraucht, das Brauchen braucht<br />
sie nicht auf; ihre Haltbarkeit verleiht der Welt als dem Gebilde von<br />
Menschenhand die Dauerhaftigkeit und Beständigkeit, ohne die sich<br />
das sterblich-unbeständige Wesen der Menschen auf der Erde nicht einzurichten<br />
wüßte; sie sind die eigentlich menschliche Heimat des Menschen.<br />
Aber auch die Haltbarkeit der von Menschen geschaffenen Dingwelt<br />
ist nicht absolut. Der Gebrauch, den wir von den Dingen machen, nutzt<br />
sie ab, wiewohl er sie nicht verzehrt; der Lebensprozeß, der die Existenz<br />
des Menschen treibt und sie dringt, dringt auch in die Welt; und<br />
selbst wenn wir die Dinge nicht benutzten, würden sie doch schließlich<br />
verfallen, nämlich zurückkehren in den umgreifenden Kreislauf<br />
der Natur, dem sie entrissen und gegen den sie in ein eigenständiges<br />
Dasein gestellt wurden. Ausgestoßen aus der Welt der Menschen<br />
und sich selbst überlassen, wird auch der Stuhl wieder zu Holz werden,<br />
und das Holz wird verwittern und zu dem Boden zurückkehren,<br />
aus dem der Baum wuchs, bevor man ihn fällte, um ihn als Material<br />
3<br />
Das Wort „Gegenstand“ ist<br />
eine wörtliche Übersetzung<br />
von „Objekt“, das, von<br />
obicere „entgegenstellen“,<br />
ursprünglich das Entgegengestellte<br />
bezeichnete.<br />
für Herzustellendes zu benutzen. Dies scheint das Ende zu sein, das<br />
schließlich alle einzelnen Dinge der Welt erwartet, gleichsam als Zeichen<br />
dafür, daß sie Produkte sterblicher Menschen sind; aber für die<br />
Welt im Ganzen, in der alle einzelnen Dinge ständig ersetzt werden im<br />
Wechsel der Generationen, die in sie geboren werden, in ihr verweilen<br />
und aus ihr wieder verschwinden, gibt es ein solches Ende nicht.<br />
Außerdem nutzt das Gebrauchen die einzelnen Gegenstände zwar ab,<br />
aber dies Abgenutztwerden gehört nicht im gleichen Sinne zu ihrem<br />
Wesen, wie das Verzehrtwerden zum Wesen der Konsumgüter gehört.<br />
Was sich im Gebrauchtwerden abnutzt, ist Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit.<br />
Diese Haltbarkeit nun verleiht den Dingen der Welt eine relative<br />
Unabhängigkeit von der Existenz der Menschen, die sie herstellten<br />
und in Gebrauch nehmen, die „objektive“ Gegenständlichkeit, die sie<br />
dazu befähigt, den unersättlichen Bedürfnissen und Notdürften ihrer<br />
Erzeuger „entgegenzustehen“ und sie wenigstens für eine Zeit zu<br />
überstehen. 3 So gesehen, haben die Weltdinge die Aufgabe, menschliches<br />
Leben zu stabilisieren, und ihre „Objektivität“ liegt darin, daß<br />
sie der reißenden Veränderung des natürlichen Lebens − daß, wie<br />
Heraklit sagt, niemals derselbe Mensch in denselben Fluß steigen<br />
kann − eine menschliche Selbigkeit darbieten, eine Identität, die sich<br />
daraus herleitet, daß der gleiche Stuhl und der gleiche Tisch den jeden<br />
Tag veränderten Menschen mit gleichbleibender Vertrautheit entgegenstehen.<br />
Mit anderen Worten, das, was der Subjektivität des Menschen<br />
entgegensteht, und woran sie sich mißt, ist die Objektivität, die<br />
Gegenständlichkeit der von ihm selbst hergestellten Welt, und nicht<br />
die erhabene Gleichgültigkeit einer von Menschenhand unberührten<br />
Natur, deren überwältigende Elementargewalt ihn im Gegenteil, vermöge<br />
des biologischen Lebensprozesses und seines Kreislaufs, in<br />
die umgreifend kreisende Bewegung zwingt und einfügt, in der alles<br />
Natürliche schwingt. Nur weil wir aus dem, was die Natur uns gibt,<br />
die objektive Gegenständlichkeit einer eigenen Welt errichtet, weil<br />
wir in den Umkreis der Natur eine nur uns eigene Umgebung gebaut<br />
haben, die uns vor der Natur schützt, sind wir imstande, nun auch die<br />
Natur als einen „Gegenstand“ objektiv zu betrachten und zu handhaben.<br />
Ohne eine solche Welt zwischen Mensch und Natur gäbe es ewige<br />
Bewegtheit, aber weder Gegenständlichkeit noch Objektivität.<br />
Wiewohl Gebrauchen und Verbrauchen so wenig dasselbe sind wie<br />
Herstellen und Arbeiten, kommen sie sich doch oft so nahe, gehen so<br />
fast unmerklich ineinander über, daß die öffentliche und gelehrte Meinung,<br />
die diese Sachen miteinander identifiziert, gerechtfertigt zu sein<br />
scheint. Alles Brauchen enthält in der Tat ein Element des Verbrauchens,<br />
insofern der Abnutzungsprozeß durch Kontakt des gebrauchten
192 — 193<br />
Hannah Arendt<br />
Gegenstandes mit einem lebend-verzehrenden Organismus zustande<br />
kommt, so daß die Identifizierung von Gebrauchen und Verbrauchen<br />
um so einleuchtender sein wird, je mehr der betreffende Gegenstand<br />
in den körperlichen Bereich des Benutzers rückt. Denkt man z. B. bei<br />
der Erörterung von Gebrauchsgegenständen an das, was wir für unsere<br />
Kleidung benötigen, so wird man zu der Überzeugung kommen, daß<br />
Gebrauchen sich von Verbrauchen nur durch eine Verlangsamung des<br />
Tempos unterscheidet. Hiergegen spricht, wie wir bereits erwähnten,<br />
daß Abgenutztwerden eine zwar unvermeidliche, aber sekundäre Folge<br />
des Gebrauchtwerdens ist, während das Verzehrtwerden eines Konsumgutes<br />
dasjenige ist, um dessentwillen es überhaupt erzeugt wurde. Die<br />
billigste Fabrikware unterscheidet sich von der erlesensten Delikatesse<br />
noch dadurch, daß sie nicht verdirbt, wenn sie nicht benutzt wird, daß<br />
sie eine bescheidene Eigenständigkeit hat, die sie befähigt, die wechselnden<br />
Launen ihres Besitzers für einen recht beträchtlichen Zeitraum<br />
zu überdauern. Wenn man ein Paar Schuhe nicht gerade mutwillig zerstört,<br />
werden sie, getragen oder ungetragen, für eine gewisse Zeit in<br />
der Welt verweilen.<br />
Aber es gibt ein berühmteres und auch viel plausibleres Beispiel, das<br />
man zugunsten der Gleichsetzung von Herstellen und Arbeiten anführen<br />
kann. Die notwendigste und elementarste Arbeit des Menschen besteht<br />
in der Bestellung des Bodens, und der Ackerbau stellt in der Tat eine<br />
Tätigkeit dar, in welcher sich das Arbeiten in seinem Vollzug in ein Herstellen<br />
verwandelt. Denn obwohl alle landwirtschaftlichen Arbeiten dem<br />
biologischen Lebensprozeß des Menschen notwendiger und dem Kreislauf<br />
der Natur inniger eingefügt sind als irgendeine andere Tätigkeit, hinterlassen<br />
sie doch ein Resultat, das die Tätigkeit selbst überdauert und<br />
zu einem greifbaren, bleibenden Teil der Welt wird: wo jahrein und jahraus,<br />
in endloser Wiederholung gepflügt, gesät und geerntet wird, fügt<br />
sich die Wildnis der Natur schließlich in ein von Menschen bestelltes<br />
Land. Das ist natürlich der Grund, warum zu allen Zeiten die Würde der<br />
Arbeit an der Landarbeit exemplifiziert worden ist, während die Haushaltsarbeiten<br />
stets ins Feld geführt wurden, wenn man die knechtische<br />
Natur der Arbeit kennzeichnen wollte. Zweifellos steht die Landarbeit,<br />
die die Produktion der Lebensmittel besorgt, dem Herstellen näher als<br />
die Hausarbeit, die für ihren Konsum erforderlich ist; zweifellos auch<br />
geht die uralte Hochschätzung des Landbaus darauf zurück, daß die<br />
Bodenbestellung eben nicht nur Lebensmittel erzeugt, sondern bestelltes<br />
Land, in welchem die Erde, zum Acker verwandelt, nun den Grund<br />
hergibt für die Erstellung der Welt. Dennoch springt selbst in diesem<br />
Fall der Unterschied zwischen Arbeiten und Herstellen als menschlichen<br />
Tätigkeiten in die Augen: auch Ackerland ist niemals wirklich ein<br />
Gebrauchsgegenstand, der seine Eigenständigkeit besitzt und für seine<br />
Beständigkeit nur einer gewissen Pflege bedarf; der bestellte Boden<br />
4<br />
Die Vorstellung, daß der<br />
Mensch in seinem Schaffen<br />
an Material gebunden ist,<br />
während Gott aus dem<br />
Nichts hervorbringt, ist<br />
mittelalterlich, während die<br />
Auffassung vom Menschen<br />
als unumschränkten Herrn<br />
der Erde und der irdischen<br />
Natur charakteristisch für<br />
die Neuzeit ist. Beide<br />
Auffassungen stehen in<br />
gewissem Widerspruch zu<br />
dem Geist der Bibel. Denn<br />
für das Alte Testament ist<br />
der Mensch der Herr aller<br />
lebenden Kreaturen, die zu<br />
seiner Hilfe geschaffen<br />
wurden; er bleibt ein Diener<br />
der Erde, und die Güter der<br />
Erde sind nicht Material für<br />
eine unabhängige, prometheischeSchöpfungskraft.<br />
So ist es bezeichnend,<br />
daß Luther auch in dieser<br />
Hinsicht die Versuche der<br />
Scholastik, die Lehren der<br />
Bibel mit Hilfe griechischer<br />
Philosophie zu interpretieren,<br />
zurückweist und<br />
seinerseits versucht, alle<br />
eigentlich produktiven<br />
Elemente im menschlichen<br />
Tun zu eliminieren. Alles,<br />
was der Mensch tut mit<br />
Bezug auf die Natur, ist,<br />
daß er die Schätze „findet“,<br />
die Gott in sie gelegt hat; er<br />
bleibt Diener der Erde wie<br />
im Alten Testament: „Sage<br />
an, wer legt das Silber und<br />
Gold in die Berge, daß man<br />
es findet? Wer legt in die<br />
Äcker solch großes Gut als<br />
herauswächst…? Tut das<br />
Menschen Arbeit? Ja wohl,<br />
Arbeit findet es wohl; aber<br />
Gott muß es dahin legen,<br />
soll es die Arbeit finden…So<br />
finden wir denn, daß alle<br />
unsere Arbeit nicht ist denn<br />
Gotte Güter finden und<br />
aufheben, nicht aber möge<br />
machen und erhalten“<br />
(Werke, Ausg. Walch, Bd. V,<br />
S. 1873).<br />
muß, wenn er Ackerland bleiben soll, immer wieder von neuem bearbeitet<br />
werden; er besitzt kein von menschlicher Mühe unabhängiges Dasein,<br />
er wird niemals zu einem Gegenstand. Selbst da, wo in jahrhundertelanger<br />
Mühe der bestellte Boden zur Landschaft geworden ist, hat er nicht<br />
die Gegenständlichkeit erreicht, die den hergestellten Dingen eigen ist,<br />
die ein für allemal in ihrer weltlichen Existenz gesichert sind; um Teil der<br />
Welt zu bleiben und nicht in die Wildnis der Natur zurückzufallen, muß<br />
er immer wieder von neuem erzeugt werden.<br />
Die Verdinglichung<br />
Die Werktätigkeit von Homo faber, der die Welt herstellt, vollzieht sich<br />
als Verdinglichung. Selbst den zerbrechlichsten Dingen verleiht er eine<br />
gewisse Konsistenz, die er dem Material entnimmt, aus dem er sie verfertigt.<br />
Dies Material wiederum ist ebenfalls bereits etwas Verfertigtes;<br />
es ist nicht einfach da und gegeben wie die Früchte von Baum und<br />
Strauch, die wir pflücken oder hängen lassen mögen, ohne damit in den<br />
Haushalt der Natur einzugreifen. Material muß erst einmal gewonnen<br />
werden, seiner natürlichen Umgebung entrissen, und mit der Gewinnung<br />
von Material greift der Mensch in den Haushalt der Natur ein,<br />
indem er entweder ein Lebendiges zerstört – einen Baum fällt, um Holz<br />
zu gewinnen – oder einen der langsameren Naturprozesse unterbricht,<br />
wenn er das Eisen, den Stein, den Marmor aus dem Schoß der Erde<br />
bricht. Alles Herstellen ist gewalttätig, und Homo faber, der Schöpfer<br />
der Welt, kann sein Geschäft nur verrichten, indem er Natur zerstört. Die<br />
Bibel hat Adam, den dem Acker verpflichteten, arbeitenden Menschen,<br />
zum Herrn über alle lebende Kreatur gesetzt, aber das Animal laborans,<br />
das die Kraft des eigenen Körpers durch die Kraft der ihm unterstellten<br />
und von ihm gezähmten Tiere vervielfachen kann, um dem Leben seine<br />
Nahrung zuzuführen, wird nie Herr der Erde und der Natur selbst. Nur<br />
weil er auch Homo faber ist, kann es dem Menschen gelingen, Herr und<br />
Meister der gesamten Erde zu werden. Und da menschliche Produktivität<br />
sich immer an einer göttlichen Schöpferkraft gemessen hat, die<br />
ex nihilo, aus dem Nichts schafft, während der Mensch eine Substanz<br />
braucht, die er gestaltet, hat sich das Bild der Rebellion des Prometheus<br />
der Vorstellung von Homo faber so innig vermählt, wie das Bild einer<br />
Gott ergebenen Frömmigkeit im Sinne der Bibel exemplarisch geworden<br />
ist für ein Leben, das gesegnet ist, wenn es Mühe und Arbeit gewesen.<br />
In jedem Herstellen liegt etwas Prometheisches, weil es eine Welt<br />
errichtet, die auf der gewalttätigen Vergewaltigung eines Teils der von<br />
Gott geschaffenen Natur sich gründet. 4 Kraft und Stärke des Menschen<br />
äußern sich am elementarsten in den Erfahrungen der Gewalttätigkeit,<br />
und sie stehen daher im äußersten Gegensatz zu der qualvoll-erschöpfenden<br />
Anstrengung, welche die Grunderfahrung des Arbeitens ist. Aus<br />
ihnen stammen Selbstgewißheit und Selbstgefühl, und sie können sogar
194 — 195<br />
Hannah Arendt<br />
5<br />
In Hendrik de Mans berühmtem<br />
Buch Der Kampf um<br />
die Arbeitsfreude (1927)<br />
wird z.B. ausschließlich die<br />
für alle Werktätigkeit<br />
charakteristische Befriedigung<br />
über die Fertigstellung<br />
eines Gegenstandes,<br />
die natürlich erst einsetzt,<br />
wenn das Werk vollendet<br />
ist, beschrieben.<br />
6<br />
Die Formulierung steht in<br />
Yves Simon: Trois Leçons<br />
sur le Travail (Paris, o. J.),<br />
aber sie ist typisch für die<br />
Idealisierungen der Arbeit<br />
bei liberalen katholischen<br />
Autoren. „Le travailleur<br />
travaille pour son œvre<br />
plutôt que pour lui-même:<br />
loi de générosité métaphysique,<br />
qui définit l’activité<br />
laborieuse“, meint z.B. der<br />
Dominikaner M. D. Chenu in<br />
Pour une Théologie du<br />
Travail in Esprit 1952 u.<br />
1955. Ganz ähnlich auch<br />
Jean Lacroix: La Nation du<br />
Travail, in der Zeitschrift La<br />
Vie Intellectuelle, Juni<br />
1952.<br />
Quelle lebenslänglicher Zufriedenheit werden, aber sie sind grundsätzlich<br />
verschieden von dem Segen, der auf einem Leben ruht, das in Mühe<br />
und Arbeit dahingegangen ist, und sie vermögen niemals die Intensität<br />
des Lustgefühls zu erreichen, das das Arbeiten zuweilen begleitet, vor<br />
allem dann, wenn die Anstrengung rhythmisch verläuft und der Körper<br />
die gleiche Lust empfindet, die jeder rhythmisch geordneten Bewegung<br />
eigen ist. Sofern die modernen Beschreibungen der „Arbeitsfreude“ mehr<br />
meinen als die Arbeitslust eines gesunden Körpers, sofern sie ferner<br />
nicht einfach auf einer Verwechslung des Stolzes auf eine Leistung mit<br />
der höchst fragwürdigen „Freude“ beruhen, die angeblich den Vorgang<br />
des Vollbringens selbst begleiten soll, 5 haben sie ihre echte Erfahrungsgrundlage<br />
in dem beinahe physischen Gefühl einer Genugtuung, die sich<br />
meldet, wenn immer der Mensch das ihm eigene Kraftpotential in seiner<br />
ganzen Gewalttätigkeit an der überwältigenden Macht der Elementargewalten<br />
mißt, denen er in dem Grad standzuhalten vermag, als es ihm<br />
gleichsam gelingt, sie zu überlisten, nämlich durch die Erfindung von<br />
Werkzeugen die eigene Kraft ungeheuer über ihr natürliches Maß hinaus<br />
zu vervielfältigen. Die dinghafte Substantialität, die den Gegenständen<br />
der Welt innewohnt und sie befähigt, Widerstand zu leisten, ist nicht das<br />
Resultat des Segens und der Mühe, der Lust und der Qual, mit denen wir<br />
im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen, sondern das Produkt<br />
dieser Stärke; und solche Produkte fallen dem Menschen nicht in den<br />
Schoß wie die Früchte der Erde, sie sind nicht freie Gabe der Natur, welche<br />
die Immerwährende ihren Kreaturen reicht; das zu ihrer Erstellung<br />
benötigte Material muß dem Schoß der Erde entrissen werden, Substanz<br />
und Substantialität sind bereits Dinge von Menschenhand.<br />
Die eigentliche Herstellung nun vollzieht sich stets unter Leitung eines<br />
Modells, dem gemäß das herzustellende Ding angefertigt wird. Ein solches<br />
Modell mag dem inneren Blick des Herstellenden nur vorschweben,<br />
oder es kann als Entwurf bereits versuchsweise vergegenständlicht<br />
sein. In jedem Fall befindet sich das Vorbild, das die Herstellung<br />
leitet, außerhalb des Herstellenden selbst; es geht dem Werkprozeß<br />
voraus und bedingt ihn auf eine ganz ähnliche Weise, wie die drängenden<br />
Antriebe des Lebensprozesses im Arbeiter der eigentlichen<br />
Arbeit vorangehen und sie bedingen. (Diese Beschreibung widerspricht<br />
natürlich den Lehren der modernen Psychologie, die meint, daß Vorstellungen<br />
sich ebenso greifbar im Kopfe lokalisieren ließen wie das<br />
Hungergefühl im Magen. Diese Subjektivierung der modernen Wissenschaft<br />
spiegelt nur die radikalere Subjektivierung der modernen<br />
Gesellschaft wider und läßt sich damit rechtfertigen, daß das moderne<br />
Herstellen in der Tat in der Weise des Arbeitens vonstatten geht, so<br />
daß der Werktätige, selbst wenn er es wirklich wollte, ganz außerstande<br />
ist, „mehr um der Sache als um seiner selbst willen“ zu arbeiten,<br />
6 da er von dieser „Sache“, nämlich davon, wie der Gegenstand, an<br />
7<br />
Georges Friedman<br />
(Problèmes humains du<br />
Machinisme industriel,<br />
1946, S. 211) berichtet<br />
ausführlich, wie häufig die<br />
Fabrikarbeiter noch nicht<br />
einmal den Namen oder den<br />
Zweck des von ihrer<br />
Maschine produzierten Teils<br />
kennen.<br />
dessen Herstellung er beteiligt ist, schließlich aussehen wird, zumeist<br />
nicht die leiseste Ahnung hat. 7 Aber diese rechtfertigenden Umstände,<br />
wiewohl sie historisch von großer Bedeutung sind, kommen in einer<br />
Beschreibung der grundsätzlichen Gliederung der Vita activa kaum in<br />
Betracht.) Ausschlaggebend ist hier, daß alle körperlichen Empfindungen,<br />
Lust und Unlust, das Verlangen und seine Stillung – die so „privater“<br />
Natur sind, daß sie noch nicht einmal angemessen mitgeteilt werden<br />
können, von einem dinglichen Erscheinen in der Außenwelt ganz<br />
zu schweigen – durch eine Kluft von der geistigen Vorstellungswelt<br />
geschieden sind, die sich so leicht und selbstverständlich der Verdinglichung<br />
fügt, daß wir weder ein Bett herstellen können, ohne uns vorher<br />
irgendwie ein Bett vorzustellen, d. h. ohne die „Idee“ eines Bettes<br />
vor Augen zu haben, noch uns ein Bett vorstellen können, ohne uns an<br />
ein bestimmtes Bett aus unserer sinnlichen Anschauungserinnerung<br />
zu halten.<br />
Für die Stellung, welche die Herstellung in der Hierarchie der Vita<br />
activa eingenommen hat, ist von großer Bedeutung, daß die Vorstellung<br />
oder das Modell, das den Herstellungsprozeß leitet, ihm nicht<br />
nur vorausgeht, sondern auch nach Fertigstellung des Gegenstandes<br />
nicht wieder verschwindet und sich so in einer Gegenwärtigkeit hält,<br />
welche die weitere Herstellung identischer Gegenstände ermöglicht.<br />
Aber diese der Herstellung inhärente, potentielle Vervielfältigung desselben<br />
unterscheidet sich prinzipiell von der Wiederholung, die das<br />
Kennzeichen der Arbeit war. Denn Wiederholung ist nur die Art und<br />
Weise, in welcher die Arbeit dem Kreislauf des biologischen Lebens<br />
nachkommt und ihm untertan bleibt; die Bedürfnisse und Begehren<br />
des menschlichen Körpers kommen und gehen in rhythmischer Folge,<br />
sie erscheinen und verschwinden, aber verweilen nicht. Vervielfältigung<br />
dagegen vervielfacht das, was bereits eine relativ stabile, relativ<br />
gesicherte Existenz in der Welt besitzt. Diese Eigenschaft des<br />
Beständigseins, die dem Modell und Vorbild zukommt – daß es vor<br />
dem Beginn der Herstellung schon war und noch als identisches da<br />
ist, wenn die Herstellung an ihr Ende gekommen ist, daß es also die<br />
Entstehung aller in seinem Bilde hergestellten Dinge überdauert und<br />
immer weiter unveränderlich und unerschöpflich zur Herstellung neuer<br />
Dinge dienen kann –, spielt eine sehr große Rolle in Platos Lehre von<br />
den immerwährenden Ideen. Sofern nämlich die Ideenlehre wirklich<br />
von dem Wort Idee – also von ίδέα und είδος, von Gestalt und Aussehen<br />
–, das Plato als erster in einem philosophischen Sinne verwandte,<br />
ausgeht, beruht sie offensichtlich auf Erfahrungen des Herstellens,<br />
der ποίησις, und wiewohl Plato die Ideen selbstverständlich dazu<br />
benutzt, um ganz andere, nämlich eigentlich philosophische Erfahrungen<br />
des „Sehens“ mitzuteilen, greift er doch immer, wenn er die<br />
Plausibilität seiner Lehren illustrieren will, auf Beispiele zurück, die
196 — 197<br />
Hannah Arendt<br />
8<br />
Daß Plato das Wort ίδέα als<br />
erster in philosophischer<br />
Bedeutung verwandte,<br />
wissen wir von Aristoteles<br />
(1. Buch der Metaphysik,<br />
987b8). Gerard F. Else: The<br />
Terminology of Ideas (in<br />
den Harvard Studies in<br />
Classical Philology, Bd.<br />
XLVII, 1936), unterrichtet<br />
ausgezeichnet über die<br />
vorphilosophische Bedeutung<br />
des Wortes. Else<br />
betont mit Recht, daß wir<br />
aus den Dialogen nicht<br />
erfahren, was die Ideenlehre<br />
in ihrer endgültigen Form<br />
lehrte. Wir wissen auch<br />
nichts Definitives über ihren<br />
Ursprung, aber hier mag der<br />
sicherste Hinweis noch in<br />
der Bedeutung des Wortes<br />
selbst liegen, das Plato so<br />
überraschend in die philosophische<br />
Begriffssprache<br />
eingeführt hat, obwohl es<br />
in der attischen Alltagssprache<br />
ungebräuchlich<br />
war. Die Worte είδος und<br />
ίδέα beziehen sich zweifellos<br />
auf sichtbare Formen<br />
und Gestalten, und zwar im<br />
speziellen von lebendigen<br />
Wesen; dies macht es<br />
eigentlich unwahrscheinlich,<br />
daß die Ideenlehre<br />
geometrisch-mathematischen<br />
Ursprungs ist. Cornford<br />
nimmt an, daß die<br />
Lehre einerseits Sokratischen<br />
Ursprungs ist, da ja<br />
Sokrates solchen Fragen<br />
wie dem Gerechten überhaupt,<br />
dem Guten an sich<br />
nachging und versuchte,<br />
Begriffe zu definieren, die<br />
aus der Welt des Handwerkers und des Herstellens stammen. 8 So wird<br />
schließlich einleuchtend, daß eine einzige, immerwährende Idee über<br />
der Vielheit vergänglicher Dinge thront, weil diese Beziehung zwischen<br />
dem ewig Einen und dem veränderlich Vielen in offenbarer Analogie zu<br />
der Beziehung gesehen ist, die zwischen der Beständigkeit und Einzigkeit<br />
des Modells und den vielen entstehenden und vergehenden Dingen<br />
obwaltet, die in seinem Bilde hergestellt werden können.<br />
Was nun den Herstellungsprozeß selbst anlangt, so ist er wesentlich<br />
von der Zweck-Mittel-Kategorie bestimmt. Das hergestellte Ding ist ein<br />
Endprodukt, weil der Herstellungsprozeß in ihm an ein Ende kommt („der<br />
Prozeß erlischt im Produkt“, wie Marx sagt), und es ist ein Zweck, zu<br />
dem der Herstellungsprozeß selbst nur das Mittel war. Zwar produziert<br />
die Arbeit zweifellos auch für den „Zweck“ des Konsums, aber da dieser<br />
Zweck, als Endprodukt gesehen, der weltlichen Beständigkeit eines<br />
Gegenstandes ermangelt, ist das Ende des Arbeitsprozesses nicht durch<br />
das Endprodukt determiniert, sondern durch die Erschöpfung der Arbeitskraft;<br />
die Arbeitsprodukte andererseits werden sofort wieder zu Mitteln,<br />
ihr Zweckcharakter ist eine ganz vorübergehende Eigenschaft, die sofort<br />
verschwindet, wenn die erzeugten Güter ihrer Bestimmung zugeführt<br />
werden, um als Lebensmittel für die Regeneration der Arbeitskraft verwendet<br />
zu werden. Über das Ende des Herstellungsprozesses kann dagegen<br />
gar kein Zweifel bestehen; er ist zu Ende, wenn ein ganz und gar<br />
neues Ding, das beständig und eigenständig genug ist, von nun an ohne<br />
alle Hilfe des Menschen in der Welt zu bleiben, dem Gebilde von Menschenhand<br />
hinzugefügt worden ist. Was dies Ding in seinem Fertigsein<br />
betrifft, so braucht der Prozeß, dem es sein Entstehen schuldet, nicht<br />
wiederholt zu werden. Daß der Handwerker ihn dann doch wiederholt<br />
und ein Ding nach dem anderen herstellt, hat lediglich damit zu tun, daß<br />
auch er sich seinen Lebensunterhalt verdienen muß, was nichts anderes<br />
heißt, als daß in gewissem Sinne Herstellen und Arbeiten zusammenfallen;<br />
oder es mag daher rühren, daß eine Nachfrage nach solchen Dingen<br />
besteht, die der Verfertiger aus Erwerbsgründen zu befriedigen wünscht,<br />
was nichts anderes besagt, als daß er, wie Plato gemeint haben würde,<br />
neben seiner Handwerkskunst noch die zusätzliche Kunst des Gelderwerbs<br />
gelernt hat und zu betreiben wünscht. Worauf es hier ankommt,<br />
ist, daß der Herstellungsprozeß in beiden Fällen aus Gründen wiederholt<br />
wird, die außerhalb seiner selbst liegen und mit ihm nichts zu tun haben;<br />
während eine endlose, sich im Kreise drehende Wiederholung allen<br />
Arbeitsprozessen inhärent ist: man muß essen, um zu arbeiten, und muß<br />
arbeiten, um zu essen.<br />
Es ist das eigentliche Merkmal des Herstellens, daß es einen definitiven<br />
Anfang und ein definitives, voraussagbares Ende hat; und hierdurch<br />
allein schon unterscheidet es sich von allen anderen menschlichen Tätigkeiten.<br />
Das Arbeiten, gefangen in den Kreislauf des Körpers, hat weder<br />
Anfang noch Ende. Und das Handeln hat zwar einen klar erkennbaren<br />
wir ständig gebrauchen und<br />
die uns in sinnlicher Erfahrung<br />
nicht gegeben sind;<br />
und daß sie andererseits<br />
unter pythagoreischem<br />
Einfluß entstanden ist, weil<br />
die Antwort der Ideenlehre<br />
auf die Sokratischen Fragen,<br />
nämlich die ewige und<br />
von allem Vergänglichen<br />
abgetrennte Existenz einer<br />
Idee des Gerechten oder<br />
des Guten, implizierte, daß<br />
es eine bewußte und der<br />
Erkenntnis fähige Seele<br />
gibt, die so abgesondert<br />
von Körper und Sinnen<br />
existiert wie die Idee von<br />
irdischen Dingen. Es ist<br />
also, als hätte Plato auf die<br />
sokratischen Fragen mit der<br />
pythagoreischen Seelenlehre<br />
geantwortet. Dies klingt<br />
wahrscheinlich (für Cornford,<br />
siehe vor allem seinen<br />
Plato und Parmenides).<br />
Aber meine Darstellung<br />
läßt alle diese Fragen in der<br />
Schwebe; sie bezieht sich<br />
einfach auf das 10. Buch<br />
des Staates, wo Plato<br />
selbst den Begriff der Idee<br />
mit dem alltäglichen Beispiel<br />
eines Handwerkers<br />
erklärt, der Betten und<br />
Stühle herstellt „entsprechend<br />
seiner Idee“, also<br />
einer im vorhinein gefaßten<br />
Vorstellung, wobei Plato<br />
noch ausdrücklich hinzufügt:<br />
dies meinen wir in<br />
diesen und ähnlichen<br />
Fällen. Für Plato hatte<br />
natürlich das Wort „Idee“<br />
eine ganz andere, konkret<br />
sprechende und bedeutende<br />
Qualität als für uns; und<br />
was er mit dem Wort selbst<br />
andeuten wollte, war<br />
einfach, daß ja auch der<br />
„Handwerker, der ein Bett<br />
oder einen Tisch herstellt,<br />
hierfür nicht auf ein anderes<br />
Bett oder einen anderen<br />
Tisch blickt, sonder auf die<br />
‚Idee‘ des Bettes“ (vgl. Kurt<br />
von Fritz: The Constitution<br />
of Athens, 1950, S. 34/5).<br />
Selbstverständlich rührt<br />
keine dieser Erklärungen an<br />
den Kern der Sache, d.h.<br />
weder an die spezifisch<br />
philosophische Erfahrung,<br />
die dem Ideenbegriff zugrunde<br />
liegt, noch an die<br />
entscheidende und gearde<br />
nur den Ideen zukommende<br />
Eigenschaft der Leuchtkraft,<br />
daß sie gleich der<br />
Sonne alles Erscheinende<br />
erhellen und zum Leuchten<br />
bringen.<br />
Anfang, ist aber dann, wenn es erst einmal begonnen ist, wie wir sehen<br />
werden, ebenfalls, wenn auch auf andere Weise, endlos; auf keinen Fall<br />
hat es ein Ende, das man voraussagen, und einen Zweck, den man in<br />
Gewißheit verfolgen könnte. Diese große Verläßlichkeit, die dem Herstellen<br />
eignet, spiegelt sich in der Tatsache wider, daß es, im Unterschied<br />
zum Handeln, nicht unwiderruflich ist. Was von Menschenhand geschaffen<br />
wurde, kann von Menschenhand auch wieder zerstört werden, und<br />
kein Gebrauchsgegenstand wird so dringlich im Lebensprozeß benötigt,<br />
daß sein Verfertiger sich seine Vernichtung nicht leisten und sie überleben<br />
könnte. Homo faber ist in der Tat ein Herr und Meister, nicht nur, weil<br />
er Herr der Natur ist oder verstanden hat, sie sich untertan zu machen,<br />
sondern auch, weil er Herr seiner selbst, seines eigenen Tuns und Lassens<br />
ist – was man weder von dem Animal laborans, das der Notwendigkeit<br />
des eigenen Lebens unterworfen bleibt, noch von dem handelnden<br />
Menschen sagen kann, der sich immer in Abhängigkeit von seinen Mitmenschen<br />
befindet. Unabhängig von Allem und Allen, allein mit dem ihm<br />
vorschwebenden Bild des herzustellenden Dinges, steht es Homo faber<br />
frei, es wirklich hervorzubringen; und wiederum allein, konfrontiert mit<br />
dem Resultat seiner Tätigkeit, kann er entscheiden, ob das Werk seiner<br />
Hände der Vorstellung seines Geistes entspricht, und ist frei, wenn es<br />
ihm nicht gefällt, es zu zerstören.<br />
Die Rolle des Instrumentalen in der Arbeit<br />
Für Homo faber, der sich vollkommen auf seine Hände verläßt, diese<br />
ursprünglichsten aller Werkzeuge und Geräte, läßt sich der Mensch in der<br />
Tat, in den Worten Benjamin Franklins, als ein „toolmaking animal“, ein<br />
Werkzeug-fabrizierendes Lebewesen definieren. Die gleichen Geräte, die<br />
dem Animal laborans nur zur Erleichterung seiner Last und zur Mechanisierung<br />
der Arbeit dienen, hat Homo faber entworfen und erfunden für<br />
die Errichtung einer Dingwelt, und ihre Tauglichkeit und Präzision hat<br />
sich weit mehr nach den objektiv-gegenständlichen Zwecken gerichtet,<br />
für die er sie verwenden wollte und die seinem inneren Auge als Modelle<br />
jeweils vorschwebten, als daß sie unter dem Druck der Lebensnotdurft<br />
oder der subjektiven Bedürfnisse entstanden wären. Werkzeuge, Geräte<br />
und Instrumente sind so durch und durch weltliche Gegenstände, daß wir<br />
ganze geschichtliche Epochen und ihre Zivilisationen nach ihnen benennen<br />
und mit ihrer Hilfe klassifizieren. Nirgends aber kommt gerade ihr<br />
weltlicher Charakter so ausgesprochen zum Vorschein als in Arbeitsprozessen,<br />
wo sie in der Tat die einzigen Dinge sind, die sowohl den Arbeitsprozeß<br />
wie den Konsumprozeß überdauern. Dem Animal laborans, gerade<br />
weil es dem Lebensprozeß unterworfen und um seine Erhaltung dauernd<br />
besorgt sein muß, repräsentieren die Werkzeuge und Geräte, deren<br />
es sich bedient, daher die Welt in ihrer Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit<br />
überhaupt und müssen in seiner „Weltanschauung“ eine erheblich
198 — 199<br />
Hannah Arendt<br />
9<br />
Seit Karl Büchers berühmter<br />
Sammlung von Arbeitsliedern<br />
ist eine umfangreiche<br />
wissenschaftliche Literatur<br />
der Verbindung von „Arbeit<br />
und Rhythmus“ weiter<br />
nachgegangen. In einer der<br />
besten dieser Untersuchungen<br />
wird von Joseph<br />
Schopp (Das deutsche<br />
Arbeiterlied, 1935) ausdrücklich<br />
darauf hingewiesen,<br />
daß es zwar Arbeitslieder,<br />
aber keine eigentlichen<br />
Werklieder gibt. Die<br />
Lieder der Handwerker<br />
werden nach der Arbeit<br />
beim geselligen Beisammensein<br />
gesungen. Dies<br />
hat natürlich damit zu tun,<br />
daß es bei der Werktätigkeit<br />
keinen „natürlichen“<br />
Rhythmus gibt. Abgesehen<br />
von den zahlreichen Klagen<br />
über den künstlichen<br />
Rhythmus, den die<br />
Maschinen dem Menschen<br />
auferlegen, wird gelegentlich<br />
auch bemerkt, daß<br />
dieser künstliche Rhythmus<br />
dem natürlichen Rhythmus<br />
des Arbeitens auffallend<br />
ähnelt. Es ist daher auch<br />
bezeichnend, daß die<br />
Arbeiter selbst sich verhältnismäßig<br />
selten über den<br />
Rhythmus der Maschinen<br />
beklagen und im Gegenteil<br />
offenbar die gleiche „Arbeitslust“<br />
empfinden, ob<br />
nun die Maschinenarbeit<br />
oder reine Körperarbeit den<br />
Rhythmus des Arbeitsvorganges<br />
bestimmen (hierfür<br />
s. Georges Friedmann: Où<br />
va le Travail humain?,<br />
1953, S. 233 und Hedrik de<br />
Man, op. cit., S. 213). Dies<br />
wird vor allem auch durch<br />
die Erhebungen bestätigt,<br />
die am Anfang des Jahrhunderts<br />
in den Fabriken von<br />
Ford gemacht wurden.<br />
Bücher, der meinte, rhythmische<br />
Arbeit sei bereits<br />
„vergeistigte Arbeit“, wies<br />
ebenfalls darauf hin, daß<br />
„nur solche einförmigen<br />
Arbeiten, die sich nicht<br />
rhythmisch gestalten<br />
lassen“, als aufreibend<br />
empfunden werden (op. cit.,<br />
S. 443). All dies beweist,<br />
daß die Arbeit an der<br />
Maschine, wenn auch ihr<br />
Tempo größer und ihre<br />
Verrichtungen einförmiger<br />
bedeutendere Rolle spielen, als bloßen Mitteln sonst zugestanden wird.<br />
Für das Arbeiten verlieren Werkzeuge und Maschinen ihren instrumentalen<br />
Charakter, und das Animal laborans bewegt sich unter ihnen so,<br />
wie Homo faber sich in der Welt der fertigen Dinge, in der Welt seiner<br />
Zwecke, bewegt.<br />
Die häufigen Klagen, die wir über die Verkehrung der Mittel in Zwecke<br />
und umgekehrt der Zwecke in Mittel in der modernen Gesellschaft<br />
hören: daß die Mittel sich als stärker als die Zwecke erweisen und daß<br />
der Mensch der Knecht der Maschinen wird, die er selbst erfunden hat,<br />
daß er sich ihren Erfordernissen anpaßt, anstatt sie als bloße Mittel für<br />
menschliche Zwecke und Bedürfnisse zu nutzen – haben ihre Wurzel in<br />
der tatsächlichen Situation des Arbeitens. Denn für das Arbeiten, das ja<br />
primär in einer Präparierung von Gütern für den Konsum besteht, ergibt<br />
die für die Herstellung so außerordentlich wesentliche Unterscheidung<br />
zwischen Zweck und Mitteln einfach keinen Sinn, weil in ihm Zweck und<br />
Mittel gar nicht getrennt genug auftreten, um überhaupt scharf auseinandergehalten<br />
und geschieden werden zu können. Daher verlieren die<br />
von Homo faber erfundenen Instrumente und Werkzeuge, mit denen er<br />
dem Animal laborans bei seiner Arbeit zu Hilfe gekommen ist, sofort ihren<br />
instrumentalen Charakter, wenn sie erst einmal wirklich in den Arbeitsprozeß<br />
eingegangen sind. So ist es auch müßig, an das Leben und den<br />
Lebensprozeß, von dem die Arbeit einen integrierenden Teil bildet und<br />
den sie als solchen niemals übersteigt, Fragen zu stellen, die die Zweck-<br />
Mittel-Kategorie voraussetzen, also z. B. zu fragen, ob der Mensch lebt<br />
und seine Bedürfnisse stillt, um die Kraft zur Arbeit zu haben, oder ob<br />
umgekehrt er nur arbeitet, um dann auch seine Bedürfnisse stillen zu<br />
können.<br />
Will man sich klarmachen, was es eigentlich für menschliches Verhalten<br />
besagt, in einer Situation zu sein, in der es unmöglich ist, klar zwischen<br />
Mitteln und Zwecken zu unterscheiden, so muß man sich die Situation<br />
eines arbeitenden Körpers vergegenwärtigen, für den an die Stelle der<br />
freien Disposition und des freien Gebrauchs von Werkzeugen für ein<br />
bestimmtes Endprodukt die rhythmische Vereinigung des Körpers mit<br />
seinem Gerät getreten ist, wobei die vereinigende Kraft von Körper und<br />
Gerät die arbeitende Bewegung selbst ist. Die Leistung des Arbeiters,<br />
aber nicht die des Herstellers, verlangt zur Erzielung bester Resultate<br />
eine rhythmisch geordnete Bewegung, bzw. bei dem Zusammenarbeiten<br />
mehrerer Arbeiter die rhythmische Koordinierung aller individuellen<br />
Bewegungen in der Gruppe. 9 In dieser Bewegtheit verlieren die Werkzeuge<br />
ihren instrumentalen Charakter, und es verwischt sich in ihr sowohl<br />
der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Werkzeug, also seinem<br />
Mittel, wie der zwischen dem Menschen und dem, was er produziert,<br />
also seinem Zweck. Was den Arbeitsprozeß – und alle in der Weise des<br />
Arbeitens vollzogenen Herstellungsprozesse – beherrscht, ist weder der<br />
im vorhinein entworfene Zweck noch ein begehrtes Produkt, sondern die<br />
sind, dem nichtmaschinellen,<br />
spontanen Arbeiten<br />
sehr viel näher kommt als<br />
dem Herstellen; den Ausschlag<br />
gibt das Rhythmische<br />
als solches. So weist auch<br />
Hendrik de Man darauf hin,<br />
daß „diese von Bücher<br />
gepriesene Welt weniger<br />
die des…handwerksmäßig<br />
schöpferischen Gewerbes<br />
[ist] als die der einfachen,<br />
schieren…Arbeitsfron“ (op.<br />
cit., S. 244). Gerade diese<br />
Arbeitsfron aber erregt<br />
Lust, und zwar unabhängig<br />
von dem, was sie leistet;<br />
während die Werktätigkeit<br />
selbst überhaupt keine<br />
„Lust“ erregt, sie kann sich<br />
nur des hergestellten<br />
Gegenstandes erfreuen und<br />
stolz auf die Leistung sein.<br />
Wie fragwürdig aber alle<br />
diese Theorien von einer<br />
„Arbeitsfreude“ überhaupt<br />
sind, wird offenbar, sobald<br />
man die Arbeiter selbst<br />
fragt, warum sie z.B.<br />
eintönige Arbeit vorziehen.<br />
Ihr Grund ist, daß sie<br />
mechanisch ist und keine<br />
Aufmerksamkeit beansprucht,<br />
so daß sie ihnen<br />
erlaubt, an anderes zu<br />
denken – „geistig wegzutreten“,<br />
wie man in Berlin<br />
sagt (vgl. Thielicke u.<br />
Pentzlin: Mensch und<br />
Arbeit im technischen<br />
Zeitalter: Zum Problem der<br />
Rationalisierung, 1954, S.<br />
35ff.). Nach den Erhebungen<br />
des Max-Planck-Instituts<br />
für Arbeitspsychologie<br />
ziehen 90% aller Arbeiter<br />
mechanische, einförmige<br />
Arbeiten allen anderen vor.<br />
Daß diese Vorliebe für das<br />
mechanische Arbeiten<br />
keineswegs ein Zeichen von<br />
Dummheit oder Abgestumpftheit<br />
zu sein braucht,<br />
geht daraus hervor, daß es<br />
durchaus im Einklang mit<br />
sehr frühen christlichen<br />
Erfahrungen des körperlichen<br />
Arbeitens steht; daß<br />
es weniger Aufmerksamkeit<br />
beanspruche als alle anderen<br />
Tätigkeiten, galt als<br />
einer seiner wesentlichen<br />
Vorzüge, weil es einen<br />
Spielraum für „Kontemplation“<br />
läßt (siehe Etienne<br />
Delaruelle: Le Travail dans<br />
les Règles monastiques<br />
occidentales du 4e aus 9e<br />
siècle, im Journal des<br />
Psychologie Normale et<br />
Pathologique, Vol. XLI, No.<br />
1, 1948).<br />
Bewegung des Prozesses selbst und der Rhythmus, in den er den Arbeitenden<br />
hineinzwingt. In diesen Rhythmus werden die Arbeitsgeräte mithineingezogen,<br />
so daß Körper und Werkzeug in der gleichen, immer wiederholten<br />
Bewegung schwingen, bis schließlich die Maschinen, die sich<br />
wegen ihrer Bewegtheit am besten von allen Geräten für die Verrichtungen<br />
des Animal laborans eignen, dem Körper die Initiative für die Bewegung<br />
abnehmen und nicht mehr er dem Werkzeug den Takt angibt, sondern<br />
nach dem Takt der Maschine gewissermaßen tanzt. Nichts kommt<br />
der Mechanisierung leichter und selbstverständlicher entgegen als der<br />
Rhythmus des Arbeitsprozesses, und zwar weil er seinerseits bedingt ist<br />
von dem gleichfalls automatischen, in der Form der Wiederholung verlaufenden<br />
Rhythmus des Lebensprozesses und seines Stoffwechsels mit<br />
der Natur. Gerade weil das Animal laborans Werkzeuge und Instrumente<br />
nicht zum Zweck der Errichtung einer Welt benutzt, sondern um sich die<br />
Arbeit zu erleichtern, lebt es buchstäblich in einer Welt von Maschinen,<br />
seit die industrielle Revolution und die Befreiung der Arbeit nahezu alle<br />
Werkzeuge durch Maschinen ersetzte, und das heißt, die menschliche<br />
Arbeitskraft mit Hilfe der Naturgewalten ungeheuer vervielfachte.<br />
Den entscheidenden Unterschied zwischen Werkzeugen und Maschinen<br />
kann man sich vielleicht am besten vergegenwärtigen, wenn man an die<br />
nicht enden wollenden Diskussionen darüber denkt, ob nun der Mensch<br />
sich der Maschine anpassen solle oder ob umgekehrt es humaner sei,<br />
die Maschine der „Natur“ des Menschen anzupassen. Den Hauptgrund,<br />
warum eine solche Diskussion unfruchtbar bleiben muß, haben wir im<br />
ersten Kapitel erwähnt: da der Mensch ein bedingtes Wesen in dem Sinne<br />
ist, daß jegliches, ob er es vorfindet oder selbst macht, für ihn sofort<br />
eine Bedingung seiner Existenz wird, hat er sich natürlich der Umgebung<br />
der Maschinen in dem Augenblick auch angepaßt, sich von ihnen bedingen<br />
lassen, in dem er sie erfand. Die Maschinen sind heute für unsere<br />
Existenz eine nicht weniger unabdingbare Bedingung als Werkzeuge und<br />
Geräte für alle früheren Epochen. Das Interesse an dieser Diskussion liegt<br />
daher nicht so sehr in der Vexierfrage, um die sie sich dreht, wie darin,<br />
daß sie diese Fragen überhaupt anschneiden konnte. Denn kein Mensch<br />
hat sich je den Kopf darüber zerbrochen, ob der Mensch sich auch gehörig<br />
den Werkzeugen anpasse, die er benutzt, oder ob man umgekehrt das<br />
Werkzeug seiner Natur angleichen müsse, um es humaner zu gestalten.<br />
Das hätte sich genauso lächerlich angehört wie der Vorschlag, den Menschen<br />
und seine Hände in die gehörige Beziehung zueinander zu setzen.<br />
Der Fall der Maschinen liegt in der Tat ganz anders. Ungleich dem Werkzeug,<br />
das in jedem einzelnen Augenblick des Herstellungsprozesses der<br />
Hand untertan bleibt und ihr als Mittel dient, fordert die Maschine von<br />
dem Arbeiter, daß er sie bediene und den natürlichen Körperrhythmus<br />
der mechanischen Bewegung angleiche. Das heißt natürlich keineswegs,<br />
wie man oft annimmt, daß der Mensch als solcher mechanisiert werde<br />
oder sich zum Diener der Maschinen erniedrigen müsse; aber es heißt
200 — 201<br />
Hannah Arendt<br />
10<br />
Abgesehen von allen<br />
Erfahrungen, war die wesentlichste<br />
Vorbedingung<br />
der industriellen Revolution<br />
einfach die Verknappung<br />
des Holzes und die Entdeckung<br />
der Kohle als<br />
Brennstoff. In diesem<br />
Zusammenhang ist die<br />
Vermutung von R. H. Barrow<br />
bemerkenswert, daß<br />
die Lösung des „bekannten<br />
Rätsels der Wirtschaftsgeschichte<br />
des Altertums,<br />
dessen industrielle Entwicklung<br />
über einen gewissen<br />
Punkt nicht<br />
hinauskam“, nicht darin<br />
besteht, daß man keine<br />
Maschinen zu erfinden<br />
wußte, sondern daß es für<br />
solche Maschinen keinen<br />
Brennstoff, eben keine<br />
Kohle gegeben hätte<br />
(Slavery in the Roman<br />
Empire, 1928, S. 123).<br />
11<br />
„The greatest pitfall to<br />
avoid is the assumption<br />
that the design aim ist<br />
reproduction oft he hand<br />
movements oft he operator<br />
or laborer“, meint John<br />
Diebold: Automation: The<br />
Advent oft he Automatic<br />
Factory, 1952, S. 67.<br />
12<br />
Ebda., S. 69.<br />
13<br />
So Georges Friedmann in<br />
Problèmes humains du<br />
Machinisme industriel, S.<br />
168. Und zu diesem Schluß<br />
muß man allerdings kommen,<br />
wenn man Diebolds<br />
Buch mit einiger Aufmerksamkeit<br />
liest. Denn wenn<br />
das Fließband das Resultat<br />
einer Vorstellung ist, in der<br />
„die Fabrikation als ein<br />
kontinuierlicher Prozeß<br />
erscheint“, so ist die Automation<br />
ihrerseits die weitere<br />
Mechanisierung dieses<br />
Prozesses, bei der nun auch<br />
die am Fließband stehenden<br />
Arbeiter durch einen<br />
kontinuierlichen, von<br />
Maschinen getriebenen<br />
Prozeß ersetzt werden. Die<br />
Arbeiter am fließenden<br />
Band hatten die von der<br />
Maschine geleistete Arbeit<br />
wohl, daß, solange die Arbeit an der Maschine andauert, der mechanische<br />
Prozeß an die Stelle des Körperrhythmus getreten ist und daß der<br />
Mensch sich an diesen Rhythmus der Maschinen gewissermaßen schon<br />
gewöhnt haben mußte, als er ein solches Ding wie eine Maschine auch<br />
nur im Geist konzipierte. Noch das raffinierteste Werkzeug bleibt ein Diener<br />
seines Herrn, unfähig die Hand zu leiten oder sie zu ersetzen. Aber<br />
selbst die primitivste Maschine leitet die Arbeit des Körpers, bis sie sie<br />
schließlich ganz und gar ersetzt.<br />
Der Historiker weiß nur zu gut, daß der Sinn geschichtlicher Abläufe<br />
meist erst zum Vorschein kommt, wenn sie ihren Abschluß erreicht<br />
haben, niemals aber zu erkennen ist, bevor die Entwicklung auf ihren<br />
Höhepunkt gekommen ist. So ist es auch in diesem Fall, als zeigte sich<br />
die wirkliche Bedeutung der Technik, d. h. der Ersetzung von Werkzeugen<br />
und Geräten durch die Maschinen, erst in dem, was wir vorläufig als<br />
das unmittelbar bevorstehende Endstadium dieser Entwicklung antizipieren,<br />
nämlich in der Automation. Blicken wir von diesem antizipierten<br />
Endstadium auf die Entwicklung der neuzeitlichen Technik zurück, so<br />
entfaltet sie sich ungefähr in folgenden Stadien: Im ersten Stadium, das,<br />
von der Dampfmaschine beherrscht, unmittelbar in die industrielle Revolution<br />
führte, ahmte man mit Hilfe der Maschine Naturprozesse nach<br />
oder bediente sich zu diesem Zweck auch direkt der Naturkräfte; beides<br />
unterschied sich grundsätzlich kaum von den Wasser- und Windmühlen,<br />
in denen der Mensch seit unvordenklichen Zeiten bestimmte Naturkräfte<br />
eingefangen und in seinen Gebrauch gestellt hatte. Neu war nicht die<br />
Dampfmaschine, sondern vielmehr die Entdeckung und Ausbeutung der<br />
Kohlenlager der Erde, durch die man endlich den Brennstoff gewann, um<br />
das Prinzip der Dampfmaschine anzuwenden. 10 Die Maschinenwerkzeuge<br />
dieses Anfangsstadiums zeigen auf ihre Weise die gleiche Nachahmung<br />
des natürlich Gegebenen; auch sie imitieren und steigern die Kraft der<br />
menschlichen Hand. Dies gerade gilt heute als mangelndes Verständnis<br />
für das Wesen der Maschine, als eine Art Kurzschluß, den man auf jeden<br />
Fall vermeiden muß. Unter keinen Umständen darf das Entwerfen von<br />
Maschinen von dem Ziel geleitet sein, die Hand des Arbeiters zu ersetzen<br />
oder die Handbewegungen dessen nachzuahmen, der die Maschine<br />
bedient. 11<br />
Im nächsten Stadium tritt die Elektrizität und Elektrifizierung der Welt<br />
in den Vordergrund, und in diesem Stadium befinden wir uns auch heute<br />
noch, jedenfalls im Rahmen des Alltagslebens, das ja noch nicht von der<br />
Automation oder der Nutzung der Atomenergie bestimmt ist. In diesem<br />
Stadium kommt man mit den Vorstellungen einer technisch bedingten,<br />
gigantischen Steigerung der handwerklichen Möglichkeiten, also der<br />
Technisierung von Herstellungsprozessen, nicht mehr aus; auf diese<br />
bereits wirklich technisch bestimmte Welt sind die Kategorien von Homo<br />
faber, für den ein Werkzeug eben ein Mittel zur Erreichung eines vorgefaßten<br />
Zweckes ist, nicht mehr anwendbar. Denn hier handelt es sich<br />
zu ergänzen und zu kontrollieren,<br />
und die Automation<br />
besagt nichts anderes,<br />
als daß diese gleichsam<br />
noch von menschlicher<br />
„Gehirnkraft“ geleiteten<br />
Arbeiten der Kontrolle und<br />
Leitung nun ihrerseits<br />
genauso von Maschinen<br />
übernommen werden wie in<br />
den frühen Stadien der<br />
Industrialisierung die<br />
Leistungen der „Arbeitskräfte“<br />
(op. cit., S. 140).<br />
Was von den Maschinen<br />
geleistet wird, ist in den<br />
beiden Fällen Arbeit und<br />
nicht eigentlich Werk. Das<br />
Selbstbewußtsein des<br />
Werktätigen und der<br />
Handwerkerstolz, deren<br />
„menschliche und psychologische<br />
Werte“ (S. 146) fast<br />
alle Werke auf diesem<br />
Gebiet verzweifelt zu retten<br />
versuchen – was manchmal<br />
nicht ohne eine gewisse<br />
unfreiwillige Komik abgeht,<br />
wie wenn Diebold und<br />
andere im Ernst meinen,<br />
daß Reparaturarbeiten, die<br />
vielleicht niemals voll<br />
automatisiert werden<br />
können, das gleiche Selbstbewußtsein<br />
werden vermitteln<br />
können wie einst die<br />
Befriedigung, einen neuen<br />
Gegenstand hervorgebracht<br />
zu haben –, gehören schon<br />
darum nicht hierher, weil<br />
sie längst aus den Fabriken<br />
verschwunden waren, bevor<br />
auch nur irgend jemand das<br />
Wort Automation gehört<br />
hatte. Fabrikarbeiter sind<br />
immer Arbeiter, und nicht<br />
Werktätige, gewesen, und<br />
obwohl sie als Personen ein<br />
völlig intaktes Selbstbewußtsein<br />
entwickeln<br />
mögen, so kann dieses sich<br />
schwerlich gerade auf ihre<br />
Arbeit gründen. Man kann<br />
nur hoffen, daß sie sich von<br />
den gesellschaftlichen<br />
Surrogaten, die ihnen die<br />
Arbeitstheoretiker anbieten,<br />
nicht irremachen<br />
lassen und sich nicht<br />
einreden werden, daß<br />
Berufsinteresse und<br />
Handwerksstolz durch<br />
„human relations“ ersetzt<br />
werden können oder durch<br />
gegenseitige Hochachtung<br />
(S. 164). Die Automation<br />
sollte jedenfalls den Vorzug<br />
haben, die Absurdität des<br />
neumodischen „Humanismus<br />
der Arbeit“ handgreiflich<br />
zu demonstrieren; für<br />
den allerdings, der über-<br />
nicht mehr darum, der Natur, so wie sie ist, das zu entnehmen oder zu<br />
entreißen, was wir in der Form von Material brauchen und gebrauchen,<br />
wobei wir in die Natur nur eingriffen, indem wir ein Natürliches vernichteten,<br />
einen natürlichen Prozeß „künstlich“ unterbrachen oder auch ihn<br />
künstlich nachahmten. In all diesen Fällen haben wir für unsere eigenen<br />
weltlichen Zwecke Natürliches verändert oder auch die Natur künstlich<br />
denaturiert, so zwar, daß die von Menschen errichtete Welt und die<br />
Natur durchaus deutlich voneinander geschieden und unterschieden<br />
blieben. Wir haben begonnen, gewissermaßen Naturprozesse selbst<br />
zu „machen“, d.h. wir haben natürliche Vorgänge losgelassen, die niemals<br />
zustande gekommen wären ohne uns, und anstatt die menschliche<br />
Welt, wie alle historischen Epochen vor der unsrigen, vorsichtig gegen<br />
die Elementargewalten der Natur abzuschirmen, sie so weit wie möglich<br />
aus unserer Welt zu entfernen, haben wir im Gegenteil gerade diese<br />
Kräfte in ihrer Elementargewalt mitten in unsere Welt geleitet. Daß hier<br />
mehr im Spiele ist und mehr auf dem Spiele steht als die Entwicklung<br />
rein technischen Könnens, sieht man schon daran, daß sich die geänderte<br />
Relation von Welt und Natur am augenfälligsten in dem modernen<br />
Städtebau nachweisen ließe, für den ja weder das Hochhaus noch das<br />
Stadtbild von New York auf der Halbinsel Manhattan charakteristisch<br />
ist, sondern die neuerdings angestrebte und in Amerika im Ansatz auch<br />
bereits verwirklichte Auflösung des städtischen Elements in menschlichen<br />
Siedlungen, also eine Nicht-Stadt von der Art Los Angeles‘, bei der<br />
der „Ausgleich zwischen Stadt und Land“ nun in der Tat so weit gediehen<br />
ist, daß weder von Stadt noch von Land, wie wir es gemeinhin verstehen,<br />
auch nur das geringste übriggeblieben ist. In der Literatur über diese<br />
zweite technische Revolution wird hierauf nicht hingewiesen, wohl aber<br />
auf ein verwandtes Auflösungsphänomen im Herstellungsprozeß selbst;<br />
die Fabrikation, die sich bisher „aus einer Reihe voneinander getrennter<br />
Handgriffe“ ergab, ist zu „einem kontinuierlichen Prozeß“ geworden,<br />
dem fließenden Band, an dem produziert und montiert wird. 12<br />
Die letzte Phase in dieser Entwicklung ist die Automation, die nun tatsächlich<br />
„die gesamte Geschichte der Maschinisierung erhellt“ 13 . Sie wird<br />
den Gipfelpunkt dieser Entwicklung bilden, selbst wenn ein Atomzeitalter<br />
mit auf nuklearer Energie beruhender Technik sie rasch noch einmal<br />
ablösen sollte, weil nur die Automation, für die man keine Atomenergie,<br />
sondern nur Elektrizität benötigt, noch dem Gesetz folgt, nach dem wir<br />
seit der industriellen Revolution angetreten sind. Die verschiedenen<br />
Arten von Atombomben, welche gewissermaßen die ersten Geräte der<br />
Atomtechnik darstellen und bereits ein Vernichtungspotential besitzen,<br />
das ausreicht, das gesamte organische Leben auf der Erde zu zerstören,<br />
geben ein erstes Anzeichen davon, in was für einem Ausmaße eine<br />
Umstellung der Technik auf Atomenergie die uns bekannte Welt verändern<br />
würde. Denn in einer solchen von der Atomtechnik bestimmten Welt<br />
würde es sich nicht mehr um die Entfesselung von Elementargewalten
202 — 203<br />
Hannah Arendt<br />
haupt noch fähig ist, sich<br />
unter diesem abgegriffensten<br />
aller Worte etwas<br />
vorzustellen, dürfte ein<br />
„Humanismus der Arbeit“<br />
ohnehin nichts anderes<br />
bedeutet haben als eine<br />
contradictio in adiecto.<br />
Jedenfalls findet sich in der<br />
neueren Literatur zunehmend<br />
eine entschiedene<br />
Kritik an der Gestaltung der<br />
„human relations“, die in<br />
den Fabriken so sehr en<br />
vogue war. Siehe z.B. die<br />
ausgezeichneten Ausführungen<br />
von Daniel Bell in<br />
Work and ist Discontents,<br />
1956, 5. Kapitel und den<br />
Artikel von R. F. Genelli,<br />
Facteur humain ou Facteur<br />
social du Travail, in Revue<br />
Française du Travail, Vol.<br />
VII, Nos. 1-3, 1952, der sich<br />
auch sehr entschieden<br />
gegen die „schrecklichen<br />
Illusionen“ der „Arbeitsfreude“<br />
wendet.<br />
14<br />
In einigen interessanten<br />
Bemerkungen zur Atombombe<br />
in seiner Antiquiertheit<br />
des Menschen weist<br />
Günther Anders allerdings<br />
mit Recht darauf hin, daß<br />
man im Falle der Atomexplosion<br />
kaum noch von<br />
Experiment und Laboratorium<br />
sprechen könne, weil<br />
„die Effekte so ungeheuer<br />
sind, daß im Moment des<br />
Experiments das ‚Laboratorium‘<br />
ko-extensiv mit dem<br />
Globus wird“ (S. 260). Für<br />
Laboratoriumsversuche ist<br />
charakteristisch, daß der<br />
Raum, in dem sie stattfinden,<br />
gegen die Umgebung<br />
isoliert und von der Welt<br />
abgegrenzt ist.<br />
der Natur und auch nicht mehr um das Loslassen natürlicher Prozesse<br />
handeln, die im Haushalt der Natur nie vorgesehen waren, sondern<br />
darum, Energien und Kräfte auf der Erde und im täglichen menschlichen<br />
Leben zu handhaben, die sonst nur außerhalb des Irdischen, im Universum,<br />
vorkommen; in gewissem Sinne geschieht ähnliches bereits heute,<br />
aber doch nur in dem abgegrenzten und abgeschirmten Rahmen der<br />
Versuchslaboratorien der Atomphysik. 14 Wenn die gegenwärtige Technik<br />
darauf beruht, daß Naturkräfte in die von Menschen erstellte Welt<br />
geleitet werden, so könnte die Technik eines kommenden Atomzeitalters<br />
darin bestehen, die Universumskräfte des Weltalls, in dem wir rotierend<br />
schweben und von dem wir umgeben sind, in die irdische Natur zu leiten.<br />
Ob eine solche zukünftige Technik den Haushalt der Natur im gleichen,<br />
oder vielleicht noch größeren, Maße verändern wird, wie die gegenwärtige<br />
Technik die Weltlichkeit der Menschenwelt verändert hat, kann<br />
heute noch niemand wissen.<br />
Die Naturkräfte, welche die moderne Technik in die Welt selbst geleitet<br />
hat, haben vorerst einmal die spezifische Zweckhaftigkeit dieser Welt<br />
vernichtet, d. h. den heute veralteten Tatbestand, daß Werkzeuge und<br />
Geräte zum Zwecke der Herstellung von Gegenständen entworfen werden.<br />
Wir verstehen unter Naturprozessen Vorgänge, die ohne menschliche<br />
Hilfe entstehen, und wir verstehen unter Naturdingen all das, was<br />
nicht „gemacht“ ist, sondern aus sich heraus wächst und eine Gestalt<br />
annimmt. (Dem entspricht auch die ursprüngliche Bedeutung des Wortes<br />
„Natur“, ob wir es nun aus dem lateinischen nasci, geborenwerden,<br />
herleiten oder es weiter in seine griechische Wurzel verfolgen und von<br />
der „Physis“ sprechen, wörtlich dem Gewachsenen.) Im Unterschied<br />
zu dem, was die menschliche Hand mit oder ohne Zuhilfenahme eines<br />
Werkzeugs her- und aufstellt, was nur Schritt um Schritt bewerkstelligt<br />
werden kann, und wobei schließlich das Dasein des Produkts so weit von<br />
dem Vorgang seiner Herstellung geschieden ist, daß es überhaupt erst<br />
zu existieren anfängt, wenn dieser Vorgang zum Abschluß gekommen<br />
ist, ist die Existenz der Naturdinge von dem Wachstumsprozeß, in dem<br />
sie entstehen, nicht nur nicht zu trennen, sie ist mit ihm sogar auf eine<br />
geheimnisvolle Weise identisch: Das Samenkorn enthält nicht nur, sondern<br />
ist in gewissem Sinne bereits der Baum, und der Baum hört auf zu<br />
„sein“, er stirbt, sobald der Wachstumsprozeß, durch den er entstand,<br />
zum Stillstand kommt. Betrachten wir diese Prozesse aus dem Blickwinkel<br />
menschlicher Zweckhaftigkeit, wo ein vorgefaßter Zweck mit absoluter<br />
Präzision Anfang und Ende eines Vorganges von außen limitiert, so<br />
müssen sie als automatische Prozesse erscheinen. Automatisch nennen<br />
wir alle Bewegungsarten, die, sind sie erst einmal angelaufen, von selbst<br />
weiterlaufen, also nicht angewiesen sind auf willentliche und zweckbestimmte<br />
Eingriffe. In der Automation wird nun tatsächlich „automatisch“<br />
produziert, und darum gibt es strenggenommen in dem automatischen<br />
Fabrikationsprozeß keinen Unterschied mehr zwischen dem<br />
15<br />
So Diebold, op.cit., S.<br />
59-60.<br />
16<br />
Ebda, S. 67.<br />
Produktionsvorgang und dem Fabrikat. Daher sind auch Vorstellungen,<br />
wie die, daß der fabrizierte Gegenstand ein Primat vor dem Prozeß habe,<br />
durch den er entsteht, daß der Prozeß nur das Mittel für einen Zweck sei,<br />
sinnlos und veraltet. 15 Die „mechanistischen“ Kategorie- und Begriffssysteme<br />
von Homo faber versagen hier genau so, wie sie seit eh und je vor<br />
den Vorgängen einer organischen Natur und des natürlichen Universums<br />
versagt haben. Warum denn auch die Vertreter der Automation allgemein<br />
die mechanistische Naturbetrachtung ausdrücklich verwerfen und<br />
sich gegen den praktischen Utilitarismus des achtzehnten Jahrhunderts<br />
kehren, der so außerordentlich charakteristisch für die einseitig zielbewußte<br />
Werk-Mentalität von Homo faber war.<br />
Die Erörterungen des Problems der Technik, bzw. der Veränderungen<br />
des Lebens und der Welt durch die Einführung der Maschine, bewegen<br />
sich zumeist in einem merkwürdig unangemessenen Horizont, weil sie<br />
ausschließlich an der Frage ihres Nutzens für den Menschen orientiert<br />
bleiben. Sie unterstellen, daß alle Werkzeuge und Geräte dazu bestimmt<br />
seien, das menschliche Leben zu erleichtern und menschliche Arbeit von<br />
Mühe und Plage zu befreien. Ihre Zweckdienlichkeit wird ausschließlich<br />
anthropozentrisch verstanden. Aber der unmittelbar gegebene Zweck,<br />
für den ein Werkzeug oder ein Instrument als Mittel entworfen wird, ist<br />
nicht der Mensch, sondern ein Gegenstand, und der „humane Wert“ dieses<br />
Instrumentariums beschränkt sich auf den Gebrauch, den das Animal<br />
laborans, das von sich aus keine Werkzeuge fabriziert, dann von<br />
ihnen macht. Homo faber, mit anderen Worten, hat seine Werkzeuge und<br />
Geräte erfunden, um mit ihnen eine Welt zu errichten, aber nicht, oder<br />
doch nicht primär, um dem menschlichen Lebensprozeß zu Hilfe zu kommen.<br />
Daher ist die Frage, ob wir nun die Herren oder die Sklaven unserer<br />
Maschinen sind, falsch gestellt; die hier angemessene Fragestellung ist,<br />
ob die Maschine noch im Dienst der Welt und ihrer Dinghaftigkeit steht<br />
oder ob sie nicht vielleicht im Gegenteil angefangen hat, ihrerseits die<br />
Welt zu beherrschen, nämlich die von ihr produzierten Gegenstände in<br />
den eigenen automatischen Prozeß wieder zurückzuziehen und damit<br />
gerade ihre Dinglichkeit zu zerstören.<br />
Eines steht schon heute fest: der kontinuierlich automatische Fabrikationsprozeß<br />
hat nicht nur mit der „ungerechtfertigten Annahme“ aufgeräumt,<br />
daß „menschliche Hände, die von einem menschlichen Kopf<br />
gelenkt werden, die höchste Leistungsfähigkeit erzielten“, 16 sondern<br />
mit der ungleich wichtigeren „Annahme“, daß die Weltdinge, von denen<br />
wir umgeben sind, von Menschen entworfen werden und bestimmten<br />
menschlichen Maßstäben der Schönheit und Nützlichkeit genügen müssen.<br />
An die Stelle des Nutzens ist die Funktion getreten, und das Aussehen<br />
der fabrizierten Gegenstände wird vorwiegend von dem Gang der<br />
Maschine selbst bestimmt. Die „Grundfunktionen“, die das Maschinenfabrikat<br />
immer noch erfüllen muß, sind natürlich Funktionen im Lebensprozeß<br />
des Einzelnen und der Gesellschaft, da keine andere „Funktion“
204 — 205<br />
Hannah Arendt<br />
17<br />
Ebda, S. 38-45.<br />
18<br />
Ebda, S. 110 u. 157.<br />
grundsätzlich „notwendig“ ist, so daß das Fabrikat selbst nicht nur<br />
Variationen desselben, sondern auch „die Umstellung auf ein absolut<br />
neues Produkt“ –, bzw. die Frage, welche Gegenstände denn überhaupt<br />
produziert werden sollen, ausschließlich von den Möglichkeiten der<br />
Maschinen abhängig wird. 17<br />
Gegenstände so zu entwerfen, daß sie maschinell hergestellt werden<br />
können, anstatt Maschinen zu erfinden, die sich für die Fabrikation<br />
bestimmter Gegenstände eignen, würde nun allerdings die genaue Verkehrung<br />
des alten Zweck-Mittel-Verhältnisses bedeuten, wenn diese<br />
Kategorie überhaupt noch anwendbar wäre. Aber selbst ein so allgemeiner<br />
und vor kurzem noch allgemein anerkannter Zweck der Maschinen,<br />
wie die Entlastung menschlicher Arbeitskraft und die Steigerung der<br />
gesellschaftlichen Produktivität, gilt heute als überholt und zweitrangig,<br />
weil auch er noch den „verblüffenden Steigerungsmöglichkeiten des<br />
Leistungspotentials“ unangemessen ist, ja ihnen Grenzen setzen würde,<br />
nämlich die natürliche Begrenztheit der menschlichen Konsumfähigkeit.<br />
18 Wie die Dinge heute liegen, ist es ebenso sinnlos geworden, diese<br />
Maschinenwelt auf ihre Zweckdienlichkeit zu befragen, wie es stets<br />
sinnlos gewesen ist, die Natur daraufhin abzufragen, ob sie den Samen<br />
hervorbringe, um einen Baum zu erzeugen, oder umgekehrt den Baum<br />
hervorgebracht habe, damit er Frucht und Samen trage. Und weil Maschinenprozesse,<br />
je automatischer sie werden, desto mehr sich Naturprozessen<br />
angleichen, ja weil ihr kontinuierlicher Automatismus überhaupt nur<br />
dadurch ermöglicht wurde, daß wir die kreisenden, anfangs- und endlosen,<br />
zweckfreien Prozesse der Natur in eine von menschlichen Zwecken<br />
bestimmte Welt geleitet haben, ist es durchaus vorstellbar, daß ein voll<br />
automatisiertes Maschinenzeitalter, obzwar es vermutlich die Weltlichkeit<br />
der Welt als einem Gebilde von Menschenhand vernichten wird, sich<br />
als ein ebenso zuverlässiger und grenzenlos produktiver Versorger des<br />
Menschengeschlechts herausstellen wird, wie die Natur es war, bevor<br />
der Mensch sich ihr „entfremdete“ und eine Welt in ihr errichtete, die ihn<br />
behauste und damit eine Schranke bildete zwischen ihm und der Natur.<br />
In einer Arbeitsgesellschaft ersetzt die „Welt“ der Maschinen die wirkliche<br />
Welt, wenn auch diese Pseudowelt die größte Aufgabe der Welt nie<br />
erfüllen kann, nämlich sterblichen Menschen eine Behausung zu bieten,<br />
die beständiger und dauerhafter ist als sie selbst. In den ersten Stadien<br />
ihrer Entwicklung hatte die Welt der Apparaturen, in welche die Neuzeit<br />
den arbeitenden Teil der Menschheit hineingeworfen hat, noch einen<br />
eminent weltlichen Charakter, insofern das arbeitende Leben sich nun<br />
plötzlich in einer Umgebung abspielte, die wesentlich von dem eigenständigen,<br />
jede Tätigkeit überdauernden Dasein der Werkzeuge und<br />
Geräte bestimmt war; diesen weltlichen Charakter aber hat die moderne<br />
Fabrik, die durch den kontinuierlichen, tag- und nachtwährenden Lauf<br />
der Maschinen bestimmt ist, bereits verloren. Die Naturprozesse, von<br />
denen der Gang der Maschinen gespeist wird, machen ihn mehr und mehr<br />
19<br />
Werner Heisenberg: Das<br />
Naturbild der heutigen<br />
Physik, 1955, S. 14/5.<br />
zu einer Abart des Lebensprozesses selbst, und die Apparate, die wir<br />
einst frei handhabten, fangen in der Tat an, so zu unserm biologischen<br />
Leben zu gehören, daß es ist, als gehöre die menschliche Spezies eben<br />
nicht mehr zur Gattung der Säugetiere, sondern beginne sich in eine Art<br />
Schaltier zu verwandeln – es kann so aussehen, als ob die Apparate, von<br />
denen wir überall umgeben sind, „ebenso unvermeidlich zum Menschen<br />
gehören wie das Schneckenhaus zur Schnecke oder das Netz zur Spinne“.<br />
Von diesem die zur Automation drängende Entwicklung der modernen<br />
Technik antizipierenden Gesichtspunkt aus „erscheint dann die Technik<br />
fast nicht als das Produkt bewußter, menschlicher Bemühung um die<br />
Ausbreitung der materiellen Macht, sondern eher als ein biologischer<br />
Vorgang im Großen, bei dem die im menschlichen Organismus angelegten<br />
Strukturen in immer weiterem Maße auf die Umwelt des Menschen<br />
übertragen werden; ein biologischer Vorgang also, der eben als solcher<br />
der Kontrolle durch den Menschen entzogen ist.“ 19<br />
Die Rolle des Instrumentalen für das Herstellen<br />
Die Werkzeuge und Geräte, die Homo faber für sein Herstellen und Fabrizieren<br />
benötigt und entwirft, stecken das Feld ab, in welchem Zweckdienlichkeit<br />
und das rechte Verhältnis zwischen Mitteln und Zwecken<br />
ursprünglich erfahren werden. Hier stimmt wirklich, daß der Zweck die<br />
Mittel rechtfertigt; er tut sogar noch erheblich mehr für sie, er produziert<br />
sie nämlich überhaupt erst und organisiert sie. Der Zweck rechtfertigt<br />
die Gewalt, die der Natur angetan wird, wenn man Material aus ihr<br />
gewinnen will, wie das Holz das Fällen des Baumes rechtfertigt, wie der<br />
Tisch schließlich die nochmalige Zerstörung des Materials, das Zersägen<br />
des Holzes, rechtfertigt. Um des bezweckten Gegenstandes willen aber<br />
werden auch Werkzeuge nur entworfen, Geräte hergestellt, und der gleiche<br />
Endzweck organisiert noch den Herstellungsprozeß selbst, entscheidet<br />
darüber, welche Fachleute in ihm zusammenarbeiten sollen, wie viele<br />
Leute man zu den ungelernten Arbeiten braucht usw. Auch während des<br />
Herstellungsprozesses wird alles danach beurteilt und entschieden, ob<br />
es dem Endzweck angemessen und für ihn von Nutzen ist.<br />
Der gleiche Maßstab der Zweckdienlichkeit wird an das Produkt dieses<br />
Vorgangs, den hergestellten Gegenstand, angelegt. Zwar ist das Fertigfabrikat<br />
ein Zweck mit Bezug auf die Mittel, durch die es hergestellt<br />
wurde, und so der Endzweck des Herstellens selbst; dennoch wird es,<br />
wenn es fertig ist, kein „Zweck an sich“, jedenfalls nicht, solange es ein<br />
Gebrauchsgegenstand bleibt. Der Stuhl, der für die Tätigkeit des Tischlers<br />
ein Endzweck war – nämlich der Zweck, der, wenn er erreicht ist,<br />
seiner Tätigkeit ein Ende setzt –, ist in der Welt, in die er eintritt, wenn<br />
er die Tischlerwerkstatt verläßt, wieder eine Art Mittel; er muß benutzt<br />
werden und kann seinen Nutzen nur dadurch beweisen, daß er einem<br />
neuen Zweck dient, sei es dem, das Leben bequemer zu machen, oder,
206 — 207<br />
Hannah Arendt<br />
20<br />
Wille zur Macht, Aphorismus<br />
666.<br />
als Tauschmittel in der Warenzirkulation zu fungieren. Alles, was ist, an<br />
seinem Nutzen zu messen und in seiner Zweckdienlichkeit zu beurteilen,<br />
liegt im Wesen des Herstellens, aber die Schwierigkeit, mit den Urteilsmaßstäben<br />
dieser Tätigkeit in der Welt auszukommen, liegt darin, daß<br />
die Zweck-Mittel-Kategorie, auf der sie beruhen, unbegrenzt anwendbar<br />
ist und eine Kette ohne Ende erzeugt, in welcher sich jeder erreichte<br />
Zweck immer sofort wieder in ein Mittel in einem anderen Zusammenhang<br />
auflöst. Jede wirklich durch und durch, konsequent utilitaristisch<br />
organisierte Welt befindet sich, wie Nietzsche gelegentlich bemerkte, in<br />
einem „Zweckprogressus in infinitum“. 20<br />
Theoretisch kann man diese Aporie des konsequenten Utilitarismus, der<br />
die eigentliche Weltanschauung von Homo faber ist, als eine ihm inhärente<br />
Unfähigkeit diagnostizieren, den Unterschied zwischen dem Nutzen<br />
und dem Sinn einer Sache zu verstehen, den wir sprachlich ausdrücken,<br />
wenn wir dazwischen unterscheiden, ob wir etwas im Modus des „Umzu“<br />
oder des „Um-willen“ tun. So ist das Ideal des Nutzens selbst, das<br />
dem Tun in einer Handwerksgesellschaft vorschwebt – wie das Ideal der<br />
Bequemlichkeit in einer Arbeitsgesellschaft oder das Ideal des Erwerbs in<br />
einer kommerziellen Gesellschaftsordnung –, nicht mehr vom Nutzen her<br />
zu entscheiden; es ist nicht die Antwort auf eine Zweckfrage, sondern<br />
auf die Frage nach dem Sinn des Tuns. Um des Ideals der Nützlichkeit<br />
willen, das ihn in seinem Tun leitet, tut Homo faber alles, was er betreibt,<br />
in der Form des Um-zu, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Das<br />
Ideal des Nutzens selbst kann nicht mehr damit erklärt werden, daß es<br />
„nützlich“ sei; über seinen eigenen Nutzen und Zweck befragt, muß es<br />
die Auskunft verweigern. Denn es gibt keine Antwort innerhalb dieser<br />
Kategorien auf die Frage, die Lessing einmal den utilitaristischen Philosophien<br />
seiner Zeit stellte: „Und was ist der Nutzen des Nutzens?“ Die<br />
Aporie des Utilitarismus besteht darin, daß er in dem Zweckprogressus<br />
ad infinitum hoffnungslos gefangen ist, ohne je das Prinzip finden zu<br />
können, das die Zweck-Mittel-Kategorie rechtfertigen könnte, bzw. den<br />
Nutzen selbst. Innerhalb des Utilitarismus ist das Um-zu der eigentliche<br />
Inhalt des Um-willen geworden – was nur eine andere Art ist zu sagen,<br />
daß, wo der Nutzen sich als Sinn etabliert, Sinnlosigkeit erzeugt wird.<br />
Innerhalb der Zweck-Mittel-Kategorie und ihres Erfahrungsfeldes, in<br />
dem die gesamte Welt von Gebrauchsgegenständen und der Nützlichkeit<br />
überhaupt lokalisiert ist, gibt es keine Möglichkeit, den Zweckprogressus<br />
zu durchbrechen und zu verhindern, daß alle Zwecke schließlich<br />
wieder zu Mitteln für weitere Zwecke werden, es sei denn, man<br />
deklariere eines dieser Dinge zu einem „Zweck an sich“. In der Welt von<br />
Homo faber, wo alles seinen Nutzen beweisen muß und daher als ein<br />
Mittel gebraucht wird, um etwas anderes, als es selbst ist, zu erreichen,<br />
kann Sinn nur als ein Zweck verstanden werden, und zwar als ein Endzweck,<br />
bzw. ein „Zweck an sich“, also etwas, was entweder tautologisch<br />
allen Zwecken zukommt, nämlich wenn man sie vom Standpunkt<br />
des Herstellers ansieht, oder ein Widerspruch in sich selbst ist. Denn<br />
ein Zweck, der erreicht ist, hört ja damit auf, ein Zweck zu sein; er hat<br />
seine Fähigkeit verloren, die Auswahl bestimmter Mittel zu indizieren,<br />
sie zu rechtfertigen, sie zu organisieren und zu produzieren. Der hergestellte<br />
Gegenstand war ein Zweck nur, solange er noch nicht fertig war;<br />
als Fertigfabrikat ist er ein Gegenstand unter anderen Gegenständen,<br />
ein Objekt mehr in dem gewaltigen Arsenal des Vorliegenden, aus dem<br />
Homo faber sich frei seine Mittel wählt, um seine Zwecke zu erreichen.<br />
Ein Sinn muß dagegen beständig sein, und er darf von seinem Charakter<br />
nichts verlieren, wenn er sich erfüllt, oder besser, wenn er dem Menschen<br />
in seinem Tun aufgeht oder sich ihm versagt und ihm entgeht.<br />
Homo faber, d. h. der Mensch, sofern er ein herstellendes Wesen ist und<br />
keine anderen Kategorien kennt als die Zweck-Mittel-Kategorie, die sich<br />
unmittelbar aus seiner Werktätigkeit ergibt, ist genau so unfähig, Sinn<br />
zu verstehen, wie das Animal laborans, d. h. der Mensch, sofern er ein<br />
arbeitendes Lebewesen und nichts anderes ist, unfähig ist, Zweckhaftigkeit<br />
zu verstehen. Und so wie die Werkzeuge und Geräte, die Homo faber<br />
nur benutzt, um eine Welt zu errichten, für das Animal laborans stellvertretend<br />
für die Welt und Weltlichkeit überhaupt werden, so wird die<br />
Sinnhaftigkeit dieser Welt, die den Verstand von Homo faber übersteigt,<br />
für ihn das Paradox eines „Zwecks an sich“ oder eines Endzwecks.<br />
Was das utilitaristische Denken selbst anlangt, so gibt es für dieses keinen<br />
anderen Ausweg aus dem Dilemma der Sinnlosigkeit, als der objektiven<br />
Welt der Gebrauchsgegenstände den Rücken zu wenden und sich<br />
auf die Subjektivität des Brauchens selbst zurückzuziehen. Nur in einer<br />
absolut anthropozentrisch geordneten Welt, in der der Mensch selbst als<br />
Gebrauchender der Endzweck ist, der den endlosen Zweckprogressus zum<br />
Halten bringt kann der Nutzen als solcher zu einer Bedeutung kommen,<br />
die dem Sinn nahekommt. Aber wenn dies geschieht, setzt die Tragödie<br />
ein; sobald nämlich Homo faber eine seiner eigenen Tätigkeit immanente<br />
Sinnerfüllung gefunden hat, beginnt er auch bereits, die Dingwelt, den<br />
Zweck seines Sinnens und das Erzeugnis seiner Hände, zu degradieren;<br />
wenn der Mensch, insofern er Hergestelltes braucht und nutzt, das „Maß<br />
aller Dinge“ ist, dann ist nicht nur die Natur, die Homo faber ohnehin als<br />
bloßes Material für Herzustellendes betrachtet und behandelt, sondern<br />
sind die „wertvollen“ Dinge selbst zu Mitteln geworden und haben ihren<br />
eigenen immanenten „Wert“ verloren.<br />
In der Kantischen Formulierung, daß kein Mensch je Mittel zum Zweck<br />
sein darf, daß jeder Mensch vielmehr einen Endzweck, einen Zweck an sich<br />
darstelle, hat der anthropozentrische Utilitarismus von Homo faber seinen<br />
größten und großartigsten Ausdruck gefunden. Zwar finden wir bereits vor<br />
Kant eine gewisse Einsicht davon, zu welch furchtbaren Konsequenzen ein<br />
ungehindertes und kritikloses Denken im Begriff der Zweck-Mittel-Kategorie<br />
auf dem Gebiet des Politischen führen muß (so z. B. bei Locke, der<br />
immer wieder darauf hinweist, daß niemandem erlaubt werden dürfe, eines
208 — 209<br />
Hannah Arendt<br />
21<br />
Kritik der Urteilskraft, § 2.<br />
22<br />
Ebda., §§ 83 u. 84.<br />
23<br />
Dritter Band des Kapitals,<br />
Marx-Engels-Gesamtausgabe,<br />
S. 698.<br />
anderen Menschen Körper zu besitzen oder seine Körperkraft auszunutzen);<br />
aber erst in der Kantischen Philosophie haben diese frühen Einsichten<br />
einen begrifflich adäquaten Ausdruck gefunden und eine Tiefe erreicht,<br />
mit der sich das Niveau „mittelmäßiger Verständer“ nicht vergleichen läßt,<br />
das Nietzsche zu Unrecht den „braven Engelländern“ zuschreibt, weil es in<br />
Wahrheit überall da vorherrscht, wo Homo faber die Maßstäbe bestimmt.<br />
Der Unterschied zwischen Kant und seinen Vorläufern ist offenbar; Kant<br />
wollte ja keineswegs die Grundsätze des Utilitarismus formulieren und<br />
zum Begriff erheben, sondern im Gegenteil die Zweck-Mittel-Kategorie<br />
auf den ihr gehörigen Platz verweisen, um zu verhindern, daß sie im Feld<br />
politischen Handelns zur Anwendung komme. Dennoch können seine Formulierungen<br />
in der „Kritik der praktischen Vernunft“ ihren Ursprung aus<br />
utilitaristischem Denken genau so wenig verleugnen, wie die berühmte<br />
und ebenfalls paradoxe Formel, mit der er in der „Kritik der Urteilskraft“<br />
den Umgang mit den einzigen Dingen, die nicht Gebrauchsgegenstände<br />
sind, nämlich mit Kunstwerken, festlegt, an denen wir „ein Wohlgefallen<br />
ohne alles Interesse“ nehmen. 21 Denn der gleiche Gedanke, der den Menschen<br />
als einen Zweck an sich etabliert, macht ihn auch zum „betitelten<br />
Herrn der Natur“, der seinem Dasein, „soviel er vermag, die ganze Natur<br />
unterwerfen kann“, 22 nämlich jederzeit die Natur wie die Welt zu Mitteln<br />
seines Daseins machen und sie der ihnen zukommenden Eigenständigkeit<br />
für seine Zwecke berauben darf. Auch Kant konnte die Aporie des utilitaristischen<br />
Denkens nicht lösen und die Blindheit, mit der Homo faber<br />
dem Sinnproblem gegenübersteht, nicht heilen, ohne einen paradoxen<br />
Endzweck anzusetzen. Die Aporie hat ihren Grund darin, daß zwar nur das<br />
Herstellen und sein Zweck-Mittel-Denken fähig ist, eine Welt zu errichten,<br />
daß aber diese selbe Welt sofort so „wertlos“ wird wie das zu ihrer Errichtung<br />
verwendete Material, ein bloßes Mittel für nie abreißende Zwecke,<br />
sobald man versucht, die gleichen Maßstäbe in der fertigen Welt zur Geltung<br />
zu bringen, die unerläßlich alles Tun leiten, das Weltliches erst einmal<br />
entstehen läßt.<br />
Sofern der Mensch Homo faber ist, kennt er nichts als seine vorgefaßten<br />
Zwecke, zu deren Realisierung er alle Dinge zu Mitteln degradiert, so daß<br />
schließlich unter seiner Herrschaft nicht nur die hergestellten Dinge, sondern<br />
„die Erde überhaupt, wie alle Naturkraft, keinen Wert [haben], weil<br />
sie keine in [ihnen] vergegenständlichte Arbeit darstellen“. 23 Weil die Griechen<br />
das wußten, haben sie in ihrer klassischen Zeit das gesamte Gebiet<br />
der Herstellung, des Handwerks und der bildenden Künste, wo keine Tätigkeit<br />
um ihrer selbst willen vor sich geht und jeder Handgriff schon ein Mittel<br />
für einen Zweck darstellt, unter das Verdikt des Banausischen gestellt<br />
und der Verachtung preisgegeben. Die Konsequenz dieser Gesinnung, die<br />
offenbar nichts so fürchtete wie das Vulgäre und das Zielstrebige, muß<br />
uns immer wieder in Erstaunen setzen, wenn wir bedenken, wie groß die<br />
bildenden Künstler und Architekten waren, die unter dies Verdikt fielen.<br />
Worum es sich hier handelt, ist natürlich nicht die Zweckdienlichkeit als<br />
24<br />
Siehe Theatet 152 und<br />
Cratylus 385E. – Der Satz<br />
des Protagoras lautet fast<br />
übereinstimmend: πάντων<br />
χρημάτων μέτρον άνδρωπον<br />
είναι, των μεν όντων ως<br />
έστι, των δε μη όντων ως<br />
ουχ εοτιν. Das Wort<br />
χρήματα, von χράομαι,<br />
bezeichnet aber nicht so<br />
sehr „alle Dinge“ als „alles<br />
Brauchbare“ unter den<br />
Dingen; es bezieht sich auf<br />
den Menschen und seine<br />
Bedürfnisse. Hätte Protagoras<br />
sagen wollen: Aller<br />
Dinge Maß ist der Mensch,<br />
so hätte er dies auf<br />
griechisch eher durch ein<br />
άνζρωπος μτερον πάντων<br />
ausgedrückt, so wie auch<br />
Heraklit einfach sagt:<br />
πόλεμος πατήρ πάντών,<br />
„Streit (oder was immer<br />
πόλεμο hier heißt), ist der<br />
Vater aller Dinge“. Diels-<br />
Kranz: Vorsokratiker,<br />
Fragm. B1.<br />
solche, der Gebrauch von Mitteln für einen bestimmten Zweck, sondern<br />
vielmehr die Verallgemeinerung der für die Herstellung gültigen Erfahrungen,<br />
in welcher Nutzen und Nützlichkeit die eigentlichen Maßstäbe für<br />
das Leben und die Welt der Menschen werden. Auch diese Verallgemeinerung<br />
liegt noch im Wesen der herstellenden Tätigkeit, weil die Zweck-<br />
Mittel-Erfahrungen, die dem Herstellen inhärent sind, nicht einfach verschwinden,<br />
wenn der Zweck erreicht und der Gegenstand hergestellt ist,<br />
sondern diesen fertigen Gegenstand weiterhin begleiten, wenn er sein<br />
neues Dasein als ein Gebrauchsding antritt. Nicht der Herstellungsprozeß<br />
als solcher verursacht die Degradierung aller Welt- und Naturdinge<br />
zu bloßen Mitteln, die unaufhaltsame Entwertung alles Vorhandenen,<br />
das Anwachsen der Sinnlosigkeit, in dessen Prozeß alle Zwecke verschlungen<br />
werden, um wieder als Mittel zu dienen, und der auch den<br />
Menschen verschlingen würde, wenn man ihn nicht zu einem Endzweck<br />
deklariert hätte, der nun desto freier alles, was er selbst nicht ist, für<br />
seine Zwecke als Mittel verwenden und degradieren darf; denn vom<br />
Standpunkt des Herstellungsprozesses selbst ist das Endprodukt genau<br />
so ein Selbstzweck, ein unabhängig autonom Seiendes, wie der Mensch<br />
der Endzweck in Kants politischer Philosophie ist. Nur weil das Herstellen<br />
vorwiegend Gebrauchsgegenstände herstellt, kann das Endprodukt<br />
wieder zu einem Mittel, nämlich einem Gebrauchsmittel, werden, und nur<br />
insofern der Lebensprozeß sich der Gegenstände bemächtigt und sie für<br />
seine Zwecke benutzt, kann die produktive und limitierte Zweckhaftigkeit<br />
des Herstellers umschlagen in die unbegrenzte Zweckdienlichkeit,<br />
die sich aller Dinge, die nur überhaupt sind, als Mittel bemächtigt.<br />
Daß den Griechen diese Entwertung der Welt und der Natur mit dem<br />
ihr inhärenten Anthropozentrismus – der „absurden“ Meinung, daß der<br />
Mensch das höchste Seiende sei, dessen Dasein alles sonst Seiende<br />
untertan sein müsse (Aristoteles) – unheimlich war, liegt ebenso klar<br />
zutage, wie daß sie die einfache Vulgarität einer konsequent utilitaristischen<br />
Gesinnung verachteten. Wie sehr sie sich der Folgen einer<br />
Gesinnung bewußt waren, die in Homo faber die höchste Möglichkeit<br />
des Menschen ansetzt, läßt sich vielleicht am besten an Platos<br />
berühmtem Streit mit Protagoras exemplifizieren, der die anscheinend<br />
selbstverständliche Feststellung gemacht hatte, daß „der Mensch das<br />
Maß aller Gebrauchsdinge (χρήματα) ist, derer, die sind, und derer, die<br />
nicht sind“. 24 Denn Protagoras hat offenbar niemals gesagt, daß der<br />
Mensch das Maß aller Dinge schlechthin sei, wie die Überlieferung und<br />
die Standardübersetzungen es ihm unterschieben. Aber − und dies,<br />
scheint mir, ist der entscheidende Punkt − Plato hat, obwohl Protagoras<br />
nur von Gebrauchsdingen spricht, die sich ja selbstverständlich in<br />
ihrem Vorhanden- oder Nicht-Vorhandensein nach den sie brauchenden<br />
Menschen richten, sofort gesehen, daß dies auf Grund der Eigentümlichkeiten<br />
menschlicher Bedürfnisse dazu führen muß, daß nun der Mensch
210 — 211<br />
Hannah Arendt<br />
25<br />
In den Gesetzen, 716D,<br />
zitiert Plato noch einmal<br />
den Satz des Protagoras,<br />
nur daß hier an die Stelle<br />
des Wortes άνζρωπος der<br />
Gott ό ζεός tritt.<br />
in der Tat das Maß aller Dinge wird. Denn wenn man vom Menschen<br />
als dem Maß der Gebrauchsdinge spricht, so meint man ja den Menschen,<br />
der braucht, benutzt und als Mittel verwendet, und nicht den<br />
Menschen, insofern er spricht und handelt und denkt; macht man ihn<br />
zum Maß der Gebrauchsdinge, so wird er sich schwerlich davon abhalten<br />
lassen, alle Dinge für seinen Gebrauch zu reklamieren, das heißt,<br />
alles als ein Mittel für einen möglichen Zweck zu betrachten, in jedem<br />
Baum schon das Holz zu sehen, und sich so zum Maßstab nicht nur der<br />
Dinge zu machen, deren Sein oder Nichtsein in der Tat von ihm abhängen,<br />
sondern von allem Vorhandenen überhaupt.<br />
In der Platonischen Deutung klingt das, was Protagoras zu sagen hat,<br />
wie eine erste Vorwegnahme Kantischer Philosophie, denn wenn man<br />
den Menschen als das Maß aller Dinge ansetzt, so hat man ihn als dasjenige<br />
bestimmt, was selbst außerhalb des Zweckprogressus ad inifinitum,<br />
außerhalb der Kette verbleibt, in der notwendigerweise jeder Zweck<br />
wieder zu einem Mittel wird, eben als den Endzweck, der, selbst niemals<br />
Mittel, sich alles Bestehende für seine Zwecke untertan macht. Aber im<br />
Unterschied zu anderen Maßstäben, deren Wesen sich darin erschöpft,<br />
außerhalb des Meßbaren und zu Messenden als ein Selbiges zu verbleiben,<br />
ist der Mensch, der hier als Maßstab gilt, ein lebendiges und lebendig<br />
unbegrenzbares Wesen, dessen Produktionsmöglichkeiten so wenig<br />
ein für allemal festgelegt sind wie seine Wünsche und Geschicklichkeiten.<br />
Erlaubt man dem Menschen in seinem Brauchen und Gebrauchen<br />
der fertigen Welt sich der gleichen Maßstäbe zu bedienen, die unerläßlich<br />
waren für ihre Entstehung, sieht man, mit anderen Worten, in Homo<br />
faber nicht nur den Hersteller, sondern auch den Bewohner und Herrn<br />
der Welt, so wird er in der Tat alles in seinen Gebrauch nehmen und<br />
es entweder als ein Mittel für neue Zwecke oder als ein Mittel für sich<br />
selbst betrachten und verwerten. Dann wird es nichts mehr geben, was<br />
nicht ein Gebrauchsgegenstand, ein der Klasse der χρήματα angehöriges<br />
Ding ist, und − um Platos Beispiel zu folgen − der Wind wird nicht mehr<br />
als eine eigenständige Naturkraft die menschliche Welt durchwehen,<br />
sondern nur noch im Rahmen menschlicher Bedürfnisse als etwas, das<br />
erfrischt oder wärmt oder kältet, erfahren werden − was für Plato nichts<br />
anderes bedeutet, als daß der Mensch seine Fähigkeit, das Dasein des<br />
Windes als ein natürlich Vorhandenes zu erfahren, eingebüßt hat. An<br />
diese Konsequenzen rührt Platos Polemik gegen Protagoras, und es ist,<br />
um sie abzuwehren, daß er in den „Gesetzen“ schließlich die paradox<br />
klingende Gegenformulierung wagt: Nicht der Mensch − der vermöge<br />
seiner Wünsche und Geschicklichkeit alles brauchen und gebrauchen<br />
kann und daher dabei enden muß, alles Vorhandene nur als Mittel zu<br />
nutzen − sondern „ein Gott ist das Maß [selbst] aller Gebrauchsdinge“. 25<br />
Die Beständigkeit der Welt und das Kunstwerk<br />
Zu den Dingen, die der Welt, dem Gebilde von Menschenhand, die Stabilität<br />
verleihen, die sie geeignet macht, den unstabilsten Wesen, die<br />
wir kennen, sterblichen Menschen, eine irdische Behausung zu bieten,<br />
gehören auch eine Anzahl von Gegenständen, die überhaupt keinen Nutzen<br />
aufweisen und dazu noch so einmalig sind, daß sie prinzipiell unvertauschbar<br />
sind, also überhaupt keinen „Wert“ besitzen, den man in Geld<br />
ausdrücken oder sonst auf einen Generalnenner bringen könnte. Wenn<br />
sie auf dem Markt erscheinen, erzielen sie zwar auch Preise, aber diese<br />
Preise stehen überhaupt in keinerlei Verhältnis mehr zu ihrem „Wert“,<br />
sie sind ganz und gar willkürlich. Auch ist die angemessene Art des<br />
Umgangs mit den Dingen, die wir Kunstwerke nennen, sicher nicht das<br />
Brauchen und Gebrauchen; vor diesem müssen sie vielmehr sorgfältig<br />
bewahrt und daher aus dem Gesamtzusammenhang der gewöhnlichen<br />
Gebrauchsgegenstände entfernt werden, um den ihnen gemäßen Platz<br />
in der Welt einnehmen zu können. So müssen sie auch den täglichen<br />
Bedürfnissen und Notdürften des Lebens entrückt werden, mit denen sie<br />
weniger in Berührung kommen als irgendein anderes Ding. Ob nun diese<br />
Nutzlosigkeit von Kunstdingen immer bestanden hat oder ob in früher<br />
Zeit die Kunst den sogenannten religiösen Bedürfnissen des Menschen<br />
in der gleichen Weise gedient hat und auf sie in der gleichen Weise zugeschnitten<br />
war wie Gebrauchsgegenstände auf das alltägliche Brauchen,<br />
spielt hierfür keine Rolle. Denn selbst wenn es stimmen sollte, daß der<br />
geschichtliche Ursprung der Kunst ausschließlich religiöser oder mythischer<br />
Natur wäre, so bliebe doch immer noch die Tatsache bestehen, daß<br />
die Kunst die Ablösung von Zauber, Religion und Mythos auf das glorreichste<br />
überstanden hat.<br />
Kunstwerke sind die beständigsten und darum die weltlichsten aller<br />
Dinge. Der zersetzende Einfluß, den Naturprozesse auf alles Gegenständliche<br />
ausüben, bleibt nahezu ohne Wirkung auf sie, weil sie nicht<br />
dem Gebrauch lebendiger Wesen ausgesetzt sind, der sie in ihrer Eigentümlichkeit<br />
nur zerstören könnte, und nicht, wie im Falle von Gebrauchsgegenständen,<br />
eine ihnen inhärente Möglichkeit verwirklichen würden.<br />
In dem Sinne, in dem der Zweck eines Stuhles nur verwirklicht ist, wenn<br />
jemand auf ihm sitzt, gibt es überhaupt keinen Zweck, den ein Kunstwerk<br />
erfüllt. Daher unterscheidet sich seine Dauerhaftigkeit nicht nur<br />
quantitativ, sondern qualitativ von der Stabilität, deren alle Dinge für<br />
ihre Existenz bedürfen; seine Beständigkeit ist so ungemeiner Art, daß<br />
es unter Umständen durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch den<br />
sich ändernden Bestand der Welt zu begleiten vermag. „Über dem Wandel<br />
und Gang/ Höher und freier / Währt noch dein Lobgesang/ Gott mit<br />
der Leier“ (Rilke). Und in diesem Währen des Beständigen tritt die Weltlichkeit<br />
der Welt, die als solche niemals absolut sein kann, weil sie von<br />
Sterblichen bewohnt und benutzt wird, selbst in Erscheinung, ja in ein
212 — 213<br />
Hannah Arendt<br />
Leuchten, in dessen Glanz auch der Wandel und Gang aufleuchtet. Was<br />
hier aufleuchtet, ist die sonst in der Dingwelt, trotz ihrer relativen Dauerhaftigkeit,<br />
nie rein und klar erscheinende Beständigkeit der Welt, das<br />
Währen selbst, in dem sterbliche Menschen eine nicht-sterbliche Heimat<br />
finden. Es ist, als würde in dem Währen des Kunstwerks das weltlich<br />
Dauerhafte transparent, und als offenbare sich hinter ihm ein Wink<br />
möglichen Unsterblichseins − nicht etwa der Unsterblichkeit der Seele<br />
oder des Lebens, sondern dessen, was sterbliche Hände gemacht haben;<br />
und das Ergreifende dieses Tatbestands ist, daß er nicht eine sehnende<br />
Regung des Gemüts ist, sondern im Gegenteil greifbar und den Sinnen<br />
gegenwärtig vorliegt, leuchtend, um gesehen zu werden, tönend, um<br />
gehört zu werden, in die Welt noch hineinsprechend aus den Zeilen des<br />
gelesenen Buches.<br />
Wenn Gebrauchsgegenstände ihre Existenz der menschlichen Geschicklichkeit<br />
verdanken, Gegenständliches zu brauchen und zu nutzen, wenn<br />
Waren ihre Existenz der menschlichen „Neigung zum Tauschen und Einhandeln“<br />
(Smith) schulden, dann entstehen Kunstwerke aus der menschlichen<br />
Fähigkeit, zu denken und zu sinnen. Alles dies sind wirkliche<br />
Fähigkeiten des Menschen, und nicht bloß Attribute eines der Gattung<br />
Mensch angehörenden Lebewesens, wie Gefühle, Bedürfnisse und Triebe,<br />
auf die sie sich allerdings beziehen können und die oft ihren eigentlichen<br />
Inhalt bilden. Die dem menschlichen Lebewesen eigentümlichen<br />
Attribute haben so wenig zu tun mit der Welt, die sich der Mensch als<br />
seine Heimat auf der Erde errichtet, wie die entsprechenden Attribute<br />
anderer Lebewesen, und wollte man die weltliche Umgebung des Menschen<br />
auf sie zurückführen, so wäre diese Umgebung, wie die tierische,<br />
nicht eigentlich weltlich, d. h. sie wäre, wie das Netz der Spinne oder die<br />
Seide des Seidenwurms, nicht Kreation, sondern Emanation. Sofern das<br />
Denken sich auf Gefühle bezieht, verwandelt es bereits die verschlossene<br />
Stummheit schieren Fühlens, nicht anders als Tauschen die nackte<br />
Gier der Begehrlichkeit verwandelt und das Brauchen die getriebene<br />
Notdurft des Bedürfens transformiert − bis sie sich schließlich alle der<br />
Welt eignen, weil sie bereit sind, vorbereitet gleichsam, sich auf Gegenstände<br />
zu richten und im dinglichen Bestand der Welt ihre Erfüllung und<br />
Begrenzung zu erfahren. In jedem dieser Fälle transzendiert eine ihrem<br />
Wesen nach weltoffene und weltbezogene Fähigkeit die leidenschaftliche<br />
Intensität eines bloßen Gefühls oder Triebs oder Dranges und befreit<br />
sie dadurch aus dem Gefängnis des bloßen Bewußtseins, d. h. eines nur<br />
sich selbst fühlenden Selbsts, in die Weite der Welt.<br />
Alles Verdinglichen ist Verwandlung und Transformation, aber die vergegenständlichende<br />
Verdinglichung, die das Kunstwerk dem ihm zugrunde<br />
liegenden Inhalt zufügt, ist eine Transfiguration, eine Metamorphose so<br />
radikaler Art, daß es ist, als könne in ihm der natürliche Lauf der Dinge<br />
umgekehrt werden − als gäbe es Gebilde, die aus so „unbeschreiblicher<br />
Verwandlung stammen“, daß die Flammen des Herzens, in sie gerettet,<br />
26<br />
Der Text benutzt ein Gedicht<br />
von Rilke, das unter<br />
dem Titel „Magie“ diese<br />
Transfiguration der Kunst<br />
beschreibt. Es lautet: „Aus<br />
unbeschreiblicher Verwandlung<br />
stammen/solche<br />
Gebilde − : Fühl! und<br />
glaub!/ Wir leidens oft: zu<br />
Asche werden Flammen,/<br />
doch, in der Kunst: zu<br />
Flamme wird der Staub.<br />
Hier ist Magie. In das [sic!]<br />
Bereich des Zaubers/<br />
scheint das gemeine Wort<br />
hinaufgestuft…/ und ist<br />
doch wirklich wie der Ruf<br />
des Taubers,/ der nach der<br />
unsichtbaren Taube ruft.<br />
(Aus Taschen-Büchern und<br />
Merk-Blättern, 1950).<br />
nicht mehr zu Asche werden, ja daß noch der Staub der Vergänglichkeit<br />
in ein immerwährendes Feuer entflammt. 26 Das, was das leuchtende<br />
Feuer in das Kunstwerk bannt, ist das sinnende Denken, aber obwohl<br />
Kunstwerke Gedankendinge sind, sind sie doch wesentlich Dinge wie<br />
andere Dinge auch. Das sinnende Denken ist an sich nicht herstellend,<br />
und ein Gedankengang produziert so wenig greifbare Dinge − Bücher,<br />
Bilder, Statuen, Kompositionen −, wie das alltägliche Brauchen und<br />
Gebrauchen von sich aus Häuser oder Möbel herstellt und produziert.<br />
Die Verdinglichung, die statthat, wenn ein Gedanke niedergeschrieben,<br />
ein Bild gemalt, eine Melodie komponiert, eine Gestalt in Marmor<br />
geschlagen wird, steht natürlich mit dem Denken, das ihm vorausging,<br />
in ständiger Beziehung; aber das, was den Gedanken realisiert und das<br />
Gedankending herstellt, ist die gleiche Werktätigkeit, welche vermöge<br />
des Urwerkzeugs, das die menschliche Hand ist, auch alles andere dauerhaft<br />
Dingliche der Welt schafft und herstellt.<br />
Wir erwähnten bereits in einem anderen Zusammenhang (Kap. III, 12) den<br />
hohen Preis, den das Denken und Sinnen, wie das Sprechen und Handeln,<br />
dafür zahlen, daß sie durch das herstellende Vergegenständlichen<br />
als greifbar wirkliche Dinge in die Dingwelt eingehen; der Preis ist das<br />
Leben selbst, da immer nur ein „toter Buchstabe“ überdauern kann, was<br />
einen flüchtigen Augenblick lang lebendigster Geist war. Zwar kann auch<br />
der tote Buchstabe immer wieder zum Leben erweckt werden, nämlich<br />
sobald er wieder mit einem Lebendigen in Berührung kommt, das vermöge<br />
des eigenen Lebens den lebendigen Geist spürt, welchen der tote<br />
Buchstabe gleichsam verewigt hat; aber auch diese Auferstehung von<br />
den Toten teilt das Los aller lebendigen Dinge, aufs neue dem Tod zu<br />
verfallen. Es gibt keine Kunsterzeugnisse, die nicht in diesem Sinne unlebendig<br />
wären, und ihre Leblosigkeit zeigt den Abstand an, der zwischen<br />
der Quelle des Denkens und Sinnens im Herzen oder Hirn des Menschen<br />
besteht und der Welt, in die das Gedachte und Ersonnene schließlich<br />
entlassen wird. Aber diese Leblosigkeit ist nicht allen Künsten in gleichem<br />
Maße zu eigen; sie ist dort am schwächsten, wo die herstellende<br />
Verdinglichung am wenigsten an Material im eigentlichen Sinne gebunden<br />
ist, also in der Musik und der Dichtung, deren „Material“ Worte und<br />
Töne sind, mit denen umzugehen ein Minimum an Materialkenntnis und<br />
Werkerfahrung erfordert. Darum spielt in der Dichtung die Gestalt des<br />
Jünglings eine so große Rolle, und darum gibt es gerade in der Musik,<br />
aber weder in den bildenden Künsten noch in der Architektur, das Phänomen<br />
des Wunderkinds.<br />
Die gewissermaßen menschlichste und unweltlichste der Künste ist die<br />
Dichtkunst, deren Material die Sprache selbst ist und deren Produkt<br />
dem Denken, das es inspirierte, am nächsten bleibt. Die Dauerhaftigkeit<br />
des Gedichts entsteht gleichsam durch Verdichtung; es ist, als wäre<br />
ein in äußerster Dichte und Aufmerksamkeit gesprochenes Sprechen in<br />
sich bereits „dichterisch“. Das andenkende Erinnern − Mnemosyne, die
214 — 215<br />
Hannah Arendt<br />
27<br />
Wenn der Sprachgebrauch<br />
davon spricht, daß man ein<br />
Gedicht „macht“ – auch im<br />
Französischen sagt man<br />
vom Dichten fair des vers<br />
und im Englischen to make<br />
a poem –, so bezieht sich<br />
dies auf die im Dichten<br />
bereits stattfindende<br />
Verdinglichung. Aber auch<br />
das deutsche Dichten<br />
stammt aus dem lateinischen<br />
dictare und heißt<br />
„das ausgesonnene geistig<br />
Geschaffene niederschreiben<br />
oder zum Niederschreiben<br />
vorsagen“ (Grimms<br />
Wörterbuch). Kluge-Götz,<br />
Etymologisches Wörterbuch<br />
(1951), leitet das Wort<br />
dichten neuerdings von<br />
tichen, einem alten Wort für<br />
schaffen ab, was besagen<br />
würde, daß es mit dem<br />
lateinischen fingere vielleicht<br />
zusammenhängt.<br />
Auch in diesem Fall ist die<br />
eigentliche dichterische<br />
Tätigkeit, die das Gedicht<br />
herstellt, bevor es niedergeschrieben<br />
wird, als<br />
eine Art von Verdinglichung<br />
vorgestellt. Und in ganz<br />
dem gleichen Sinne pries<br />
bereits Demokrit den<br />
Dichter aller Dichter, Homer,<br />
daß er „einen wohlgeordneten<br />
Bau mannigfaltiger<br />
Verse gezimmert habe“<br />
(Diels-Kranz, B 21).<br />
Demokrit griff hier<br />
sprachlich nur die gängige<br />
griechische Bezeichnung<br />
für die Dichter auf, die<br />
„Zimmerer von Gesängen“,<br />
τέχτωνες υμνων.<br />
Mutter aller anderen Musen und Künste − vermag sprachlich so zu konzentrieren,<br />
daß das Gedachte sich in etwas verwandelt, was sich unmittelbar<br />
dem Gedächtnis einprägt; und auch Rhythmus und Reim, die<br />
technischen Mittel der Dichtkunst, stammen noch aus dieser äußersten<br />
Konzentration. Die ursprüngliche Nähe des Gedächtnisses zu dem lebendig<br />
andenkenden Erinnern ermöglicht es dem Gedicht, auch ohne die<br />
Niederschrift in der Welt zu überdauern, und wiewohl die Qualität eines<br />
Gedichts von einer Reihe ganz anders gearteter Maßstäbe bestimmt<br />
ist, wird doch gerade seine „Einprägsamkeit“ weitgehend darüber entscheiden,<br />
ob es sich endgültig im Gedächtnis der Menschheit festsetzen,<br />
ihm sich einprägen kann. So bleiben Gedichte, unter den Gedankendingen<br />
der Kunst, dem Denken als solchem am engsten verhaftet;<br />
sie sind gleichsam die wenigst dinglichen unter den Weltdingen. Aber<br />
wenn auch „Dichterworte/ Um des Paradieses Pforte/ Immer leise klopfend<br />
schweben/ Sich erbittend ewges Leben“, und wenn es auch wahr<br />
ist, daß „in des Ursprungs Tiefe“ sich ein Gedicht einzig bewährt, indem<br />
es als „gesprochen Wort“ aus dem Gedächtnis des Dichters oder derer,<br />
die ihm zuhören, dringt, als wäre es gerade erst entstanden, so kommt<br />
doch immer die Zeit, da auch dies undinglichste aller Dinge „gemacht“<br />
werden muß, niedergeschrieben und verwandelt in ein greifbares Ding<br />
unter Dingen, weil lebendige Erinnerung und die Fähigkeit des Gedächtnisses,<br />
aus denen alles Verlangen nach Unvergänglichkeit stammt, der<br />
Greifbarkeit des Dinglichen bedarf, um sich an ihm festzuhalten und<br />
nicht seinerseits dem Vergessen und der Vergänglichkeit zu verfallen. 27<br />
Denken und Erkennen sind nicht dasselbe. Denken, das für das Kunstschaffen<br />
die außerhalb seiner selbst liegende Quelle bildet, manifestiert<br />
sich direkt in aller großen Philosophie, während Erkennen, das Wissen<br />
vermittelt und Gewußtes ansammelt und ordnet, sich in den Wissenschaften<br />
niederschlägt. Das Erkennen verfolgt stets ein bestimmtes Ziel,<br />
das ihm sowohl praktische Erwägungen wie „müßige Neugier“ gesetzt<br />
haben mögen; ist dies Ziel erreicht, so ist der Erkenntnisprozeß an sein<br />
Ende gelangt. Denken hingegen hat weder ein Ziel noch einen Zweck<br />
außerhalb seiner selbst, und es zeitigt strenggenommen noch nicht einmal<br />
Resultate. Daß das Denken wirklich zu nichts nütze ist, haben ihm<br />
nicht nur die utilitaristischen Gesinnungen von Homo faber, sondern auch<br />
die Männer der Tat und der Wissenschaften oft genug bestätigt; es ist in<br />
der Tat so nutzlos wie das von ihm inspirierte Kunstwerk. Und nicht einmal<br />
auf diese nutzlosesten aller Dinge kann das Denken als auf von ihm<br />
erzeugte Resultate Anspruch erheben, denn man kann im Ernst von den<br />
Kunstwerken sowenig wie von den großen philosophischen Systemen<br />
behaupten, sie seien durch nichts als durch reines Denken entstanden;<br />
gerade den reinen Denkprozeß, den eigentlichen Gedankengang, muß<br />
der Künstler, aber auch der schreibende Philosoph, unterbrechen, wenn<br />
er das Gedachte so verwandeln will, daß es sich einer schriftlich-verdinglichenden<br />
Darstellung eignet. Denken als eine Tätigkeit ist endlos wie<br />
das Leben, das es begleitet, und die Frage, ob es einen Sinn hat zu denken,<br />
ist genau so unbeantwortbar wie die Frage, ob das Leben einen Sinn<br />
habe. Gedankengänge durchdringen das Gesamte menschlicher Existenz,<br />
jedes, auch das primitivste menschliche Leben, ist von ihnen gleichsam<br />
durchpflügt, und dies Denken hat weder Anfang noch Ende, es sei denn<br />
den Anfang, der mit der Geburt, und das Ende, das mit dem Tode gegeben<br />
ist. Zu denken ist daher keineswegs das spezifische Vorrecht von<br />
Homo faber, obwohl das Sinnen seine höchste weltliche Produktivität<br />
inspiriert; aber in diesem höchsten Schaffen, dessen er fähig ist, das sich<br />
von Brauchen und Gebrauchen so weit emanzipiert hat, daß es nutzlose<br />
Dinge herstellt, ist es auch, als wachse er gleichsam über sich selbst und<br />
alle nur auf den Menschen bezogenen Bedürfnisse hinaus, als könne er<br />
ohne den Stachel materieller oder intellektueller Antriebe auskommen,<br />
als bedürfe er, um der Welt zu dienen, weder des natürlichen Verlangens<br />
nach den Gütern der Welt noch des spezifisch menschlichen Durstes,<br />
über die Welt Bescheid zu wissen. Das Erkennen hingegen spielt in allen,<br />
und nicht nur in den geistigen oder künstlerischen, Herstellungsprozessen,<br />
eine ausgezeichnete Rolle. Es hat mit dem Herstellen gemein, daß<br />
es ein Prozeß ist mit Anfang und Ende, dessen Nutzen kontrollierbar ist<br />
und der, wenn er nicht zu dem gewünschten Resultat führt, eben seinen<br />
Zweck verfehlt hat, wie das Tischlern seinen Zweck verfehlt hat, wenn es<br />
einen zweibeinigen Tisch hervorbringt. Die Rolle, die das Erkennen in den<br />
Wissenschaften spielt, unterscheidet sich grundsätzlich nicht von seiner<br />
Funktion im Herstellen; und die wissenschaftlichen Resultate, die durch<br />
Erkennen gewonnen werden, können wie alle anderen Dingprodukte der<br />
menschlichen Welt hinzugefügt und in ihr untergebracht werden.<br />
Was die spezifisch intellektuellen Tätigkeiten anlangt, so muß die<br />
logische Verstandestätigkeit noch einmal vom Denken wie vom Erkennen<br />
geschieden werden, sofern sie nämlich weder, wie das Denken, der<br />
lebendigen Erfahrung noch, wie das Erkennen, eines vorgegebenen<br />
Gegenstandes bedarf, um sich zu entfalten. Sowohl das Deduzieren aus<br />
Axiomen wie das Subsumieren von Einzelnem unter allgemeinere Regeln<br />
wie schließlich die verschiedenen Techniken, durch die der Verstand<br />
Ketten in sich stimmiger Schlußfolgerungen gleichsam aus sich herausspinnen<br />
kann, sind Tätigkeiten, in denen das menschliche Gehirn eine<br />
Art „Kraft“ entfaltet, die der Arbeitskraft, die sich aus dem Stoffwechsel<br />
des Menschen mit der Natur ergibt, sehr ähnlich ist. Im Gegensatz zum<br />
Denken wie Erkennen ist die Intelligenz, die sich im Logischen bewährt,<br />
ein eigentlich physisches Kraft-Phänomen und daher mit Intelligenz-<br />
Tests genauso meßbar, wie Körperkraft mit Hilfe anderer Apparaturen<br />
meßbar ist. Die Gesetze, denen logische Prozesse unterworfen sind,<br />
sind natürliche Gesetze, die letztlich von nichts anderem abhängen als<br />
von der Struktur des menschlichen Gehirns, in dem sie verankert sind.<br />
Alles eigentlich Logische übt auf menschliches Denken einen Zwang aus,<br />
dem es sich nicht entziehen kann − jedenfalls nicht, solange ein Gehirn
216 — 217<br />
Hannah Arendt<br />
normal funktioniert. Aber dieser Zwang, mit dem der Verstand das Denken<br />
beherrscht, unterscheidet sich in nichts von dem Zwang, mit dem<br />
der Körper das menschliche Leben seiner Notdurft untertan macht. Wäre<br />
der Mensch wirklich ein Animal rationale, das sich von anderen Tieren nur<br />
durch eine überlegene Intelligenz unterscheidet, dann wären die neuen<br />
elektronischen Maschinen, die diese Intelligenz ins Ungeheure steigern,<br />
in der Tat jene Homunculi, für die ihre Erfinder sie manchmal zu halten<br />
versucht sind. In Wirklichkeit tun auch diese Maschinen nichts anderes,<br />
als was Maschinen immer tun: sie ersetzen, verstärken und verbessern<br />
die physische Kraftleistung des Menschen, seine Arbeitskraft, die Kraft<br />
seiner Muskeln oder die Kraft seines Gehirns. Und das Prinzip, nach dem<br />
sie funktionieren, ist das altbewährte Prinzip der Arbeitsteilung, das<br />
Aufbrechen komplizierterer Operationen in ihre einfachsten Bestandteile,<br />
also z. B. die Rückführung der Multiplikation auf die ihr inhärenten Operationen<br />
des Addierens. Das, was die Arbeitsteilung eigentlich attraktiv<br />
macht, nämlich daß die Arbeitsleistung durch Beschleunigung produktiver<br />
wird, ist auch hier der ausschlaggebende Faktor; nur daß in diesen<br />
Intelligenz-Maschinen die Geschwindigkeit, das Tempo, in welchem logische<br />
oder rechnerische Prozesse verlaufen, so ungeheuer gesteigert ist,<br />
daß auf die alten, gleichsam menschlichen Tricks der Beschleunigung,<br />
wie z. B. auf Multiplikation, die ja ihrerseits nur dazu diente, Additionsprozesse<br />
zu beschleunigen, verzichtet werden kann.<br />
Das einzige, was die Computer, diese ins Gigantische gewachsenen<br />
Rechenmaschinen, wirklich beweisen, ist, daß das siebzehnte Jahrhundert<br />
unrecht hatte, wenn es mit Hobbes meinte, daß der Verstand,<br />
nämlich die Fähigkeit des Schlußfolgerns − das „reckoning with consequences“<br />
−, die höchste und menschlichste aller menschlichen Fähigkeiten<br />
ist, und daß das neunzehnte Jahrhundert mit seiner Arbeits- und<br />
Lebensphilosophie − mit Marx, Bergson und Nietzsche − im Recht war,<br />
wenn es den Verstand für eine bloße Funktion des Lebensprozesses<br />
hielt und also das Leben selbst für etwas „Höheres“ als den Verstand.<br />
Der bis heute vielfach anhaltende, eigentliche Irrtum dieser neuzeitlichen<br />
Entwicklung war natürlich zu glauben, daß Denken und Erkennen<br />
ihren eigentlichen Ursprung in diesen animalischen Funktionen eines<br />
mit Intelligenz ausgestatteten Lebewesens haben. Offenbar ist, daß<br />
diese im Gehirn verankerten Intelligenzprozesse ebenso weltlos, d. h.<br />
ebenso außerstande sind, eine Welt zu errichten, wie die anderen physischen<br />
Prozesse, durch die das Leben den Menschen zwingt, die zwangsläufigen<br />
Prozesse der Arbeit und des Verzehrs.<br />
Der auffallendste innere Widerspruch der klassischen politischen Ökonomie,<br />
auf den oft aufmerksam gemacht worden ist, besteht darin, daß<br />
die gleichen Theoretiker, die so stolz auf ihre konsequent utilitaristische<br />
Weltanschauung waren, im Grunde eine ausgesprochene Verachtung für<br />
das bloß Nützliche hegten, die sich vor allem darin manifestierte, daß sie<br />
auf die Produktion der reinen Konsumgüter, also des Nützlichsten, was es<br />
gibt, immer als auf etwas Zweitrangiges herabsahen. Nicht Nützlichkeit,<br />
sondern Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit waren die Maßstäbe, die sie in<br />
Wirklichkeit anlegten, um Produktivität zu bestimmen. Und dies heißt<br />
nichts anderes, als daß sie sich noch im Sinne von Homo faber an der<br />
Welt und ihrer Dinglichkeit orientierten, und nicht im Sinne des Animal<br />
laborans alle Tätigkeiten auf das Leben und das ihm Notwendige bezogen.<br />
Zwar ist die Haltbarkeit alltäglicher Gebrauchsgegenstände relativ<br />
und nur ein schwacher Abglanz jener Beständigkeit, welche die weltlichsten<br />
aller Dinge, die Kunstwerke, durch die Jahrhunderte hindurch<br />
währen läßt; aber auch diese relative Haltbarkeit ist noch eine Abart des<br />
währenden Überdauerns (das Plato für etwas Göttliches hielt, weil es<br />
sich der Unvergänglichkeit nähert), das jedem Ding qua Ding zukommt.<br />
Jedenfalls ist es diese Eigenschaft, die seine Gestalt, seine Erscheinungsform<br />
in der Welt bestimmt und damit die Voraussetzung dafür ist,<br />
daß es uns schön erscheinen kann oder häßlich. Dabei spielt natürlich die<br />
eigentliche Gestalt für alltägliche Gebrauchsgegenstände eine ungleich<br />
geringere Rolle als für die dem Gebrauch entrückten Kunstdinge, und<br />
der Versuch des modernen Kunstgewerbes, Gebrauchsgegenstände so<br />
herzustellen, als wären sie Kunstdinge, hat genug Geschmacklosigkeiten<br />
auf dem Gewissen. Aber der Wahrheitskern, der diesen Bemühungen<br />
innewohnt, liegt in dem unbestreitbaren Tatbestand, daß jegliches, das<br />
überhaupt lange genug währt, um als Form und Gestalt wahrgenommen<br />
zu werden, gar nicht anders kann, als sich einer Beurteilung auszusetzen,<br />
die nicht nur seine Funktion, sondern auch seine Erscheinung angeht;<br />
und solange wir uns nicht die Augen ausreißen, bzw. uns vorsätzlich<br />
der Maßstäbe berauben, die für Sichtbares gelten, können wir gar nicht<br />
anders, als alles Dingliche auch danach zu beurteilen, ob es schön ist<br />
oder häßlich oder irgend etwas dazwischen.<br />
Weil alles Seiende auch erscheint, und nicht erscheinen kann ohne eine<br />
ihm eigene Gestalt, gibt es in Wahrheit kein Ding, das nicht das bloße<br />
Gebrauchtwerden bereits übersteigt und eine Art von Existenz hat, die<br />
jenseits seiner Funktion liegt. Dies gilt nur nicht von den Konsumgütern,<br />
die aber in die eigentliche Dingwelt niemals eintreten, weil sie zum Verzehr<br />
bestimmt und für den Konsum präpariert sind. (Hier wird infolgedessen<br />
jedes Bemühen, sie „schön“ zu machen, unweigerlich zum Kitsch<br />
führen, wobei der Kitsch darin besteht, daß „Schönheit“ appetitanregend<br />
wirken soll, was dem Wesen des Schönen widerspricht, das gerade das<br />
Zugreifen abwehrt und, wo es voll in Erscheinung tritt, jeglichen Umgang<br />
mit dem betreffenden Gegenstand verwehrt.) Das jenseits des Funktionellen<br />
liegende Sosein eines Dinges ist seine Schönheit oder seine Häßlichkeit,<br />
und dies Sosein, im Unterschied zu der Funktion, ist an Erscheinen<br />
überhaupt gebunden und damit an Sichtbarkeit in einer öffentlichen<br />
Welt. Sofern ein Gegenstand überhaupt in die Welt der Dinge eingeht,<br />
transzendiert er bereits die Sphäre des nur Zweckdienlichen, durchbricht,
218 — 219<br />
Hannah Arendt<br />
gleichsam auf eigene Faust, den ihm vom menschlichen Gebrauchtwerden<br />
diktierten Zweckprogressus ad infinitum. In dieser Dingwelt kann der<br />
Maßstab seiner Trefflichkeit nicht mehr seine bloße Nützlichkeit sein, als<br />
erfülle ein häßlicher Tisch seinen Zweck genausogut wie ein „schöner“;<br />
hier entscheidet sein Aussehen über seine Vortrefflichkeit. Und dies Aussehen<br />
ist, platonisch gesprochen, nichts anderes als die mögliche Entsprechung<br />
oder Annäherung an das ειδος oder die ιδέα, an das vorgestellte<br />
Bild, das dem inneren Auge des Herstellers vorschwebte, als er<br />
den Gegenstand fabrizierte, und das als solches schon war, bevor der<br />
Herstellungsprozeß begann, andauert, wenn er zum Abschluß gekommen<br />
ist, und selbst das Verschwinden durch Verbrauchen oder Zerstörung<br />
des in seinem Ebenbilde hergestellten Gegenstandes überdauert.<br />
So entzieht sich alles Gestaltete und Geformte in seinem Sosein, auch<br />
wenn es dem Gebrauch dient, in gewisser Weise den nur »subjektiven«<br />
Bedürfnissen derer, für deren Zwecke es doch hervorgebracht ist, und<br />
geht ein in eine von „objektiven“ Maßstäben bestimmte Welt von Gegenständlichem,<br />
in der es nicht nur dem Gebrauch dient, sondern auch das<br />
Aussehen, die spezifische Qualität, der dinglichen Umwelt bestimmt, in<br />
der menschliches Leben sich bewegt.<br />
Die Umwelt des Menschen ist die Dingwelt, die Homo faber ihm errichtet,<br />
und ihre Aufgabe, sterblichen Wesen eine Heimat zu bieten, kann sie<br />
nur in dem Maße erfüllen, als ihre Beständigkeit der ewig-wechselnden<br />
Bewegtheit menschlicher Existenz standhält und sie jeweils überdauert,<br />
d. h. insofern sie nicht nur die reine Funktionalität der für den Konsum<br />
produzierten Güter, sondern auch die bloße Nützlichkeit von Gebrauchsgegenständen<br />
transzendiert. Wie der Stoffwechsel mit der Natur, also der<br />
biologische Lebensprozeß, den der Mensch mit allem Lebendigen gemein<br />
hat, sich in der Tätigkeit der Arbeit realisiert, so realisiert sich das spezifisch<br />
menschliche Leben, die Zeitspanne, die ihm zwischen Geburt und<br />
Tod zugemessen ist, in den Tätigkeiten des Handelns und Sprechens, die<br />
immerhin mit dem Leben so viel gemeinsam haben, daß auch sie in sich<br />
selbst flüchtig sind und vergänglich. Denn es mag einer noch so „beredt<br />
in Worten sein und rüstig in Taten“, weder Worte noch Taten hinterlassen<br />
irgendeine Spur in der Welt, nichts zeugt von ihnen, wenn der kurze<br />
Augenblick verflogen ist, während dessen sie wie eine Brise oder ein Wind<br />
oder ein Sturm durch die Welt strichen und die Herzen von Menschen<br />
erschütterten. Ohne die Geräte, die Homo faber entwirft, um die Arbeit<br />
zu erleichtern und die Arbeitszeit zu verkürzen, könnte auch menschliches<br />
Leben nichts sein als Mühe und Arbeit; ohne die Beständigkeit der<br />
Welt, die die den Sterblichen zugemessene Frist auf der Erde überdauert,<br />
wären die Geschlechter der Menschen wie Gras und alle Herrlichkeit der<br />
Erde wie des Grases Blüte; und ohne die gleichen herstellenden Künste<br />
von Homo faber, aber jetzt auf ihrem höchsten Niveau, in der vollen Glorie<br />
ihrer reinsten Entfaltung, ohne die Dichter und Geschichtsschreiber,<br />
ohne die Kunst des Bildens und die des Erzählens, könnte das Einzige,<br />
was redende und handelnde Menschen als Produkt hervorzubringen<br />
vermögen, nämlich die Geschichte, in der sie handelnd und sprechend<br />
auftraten, bis sie sich so weit gefügt hat, daß einer sie als Geschichte<br />
berichten kann, niemals sich so dem Gedächtnis der Menschheit einprägen,<br />
daß sie Teil der Welt wird, in der Menschen leben. Insofern aber Sprechen<br />
und Handeln die höchsten und menschlichsten Tätigkeiten der Vita<br />
activa sind, ist die Welt eine wirkliche Heimat für sterbliche Menschen<br />
nur in dem Maße, als sie diesen in sich flüchtigsten und vergeblichsten<br />
Tätigkeiten eine bleibende Stätte sichert, als sie sich dafür eignet, Tätigkeiten<br />
zu beherbergen, die nicht nur völlig nutzlos für den Lebensprozeß<br />
als solchen sind, sondern auch prinzipiell anderer Natur als die mannigfaltigen<br />
herstellenden Künste, durch die die Welt selbst und alle Dinge in<br />
ihr hervorgebracht sind. In dieser Hinsicht handelt es sich schwerlich um<br />
eine Wahl zwischen Plato und Protagoras oder darum zu entscheiden,<br />
ob nun der Mensch oder ein Gott das Maß aller Dinge sei; denn so viel<br />
ist sicher, das Maß für die Welt ist nicht die zwingende Lebensnotwendigkeit,<br />
die sich in der Arbeit kundgibt, und es kann nicht in dem Reich<br />
von Mitteln und Zwecken gefunden werden, das maßgebend ist für die<br />
Herstellung der Weltdinge und maßgeblich noch für den Gebrauch, den<br />
wir von ihnen machen.
222 — 223<br />
1<br />
Wiederabdruck aus: Richard<br />
Sennett: Handwerk. Berlin:<br />
BvT 2009. © Berlin Verlag,<br />
S. 201-239.<br />
2<br />
So sagt es jedenfalls<br />
Raymond Tallis: The Hand:<br />
A Philosophical Inquiry in<br />
Human Being. Edinburgh<br />
2003, S. 4.<br />
3<br />
Charles Bell: The Hand,<br />
Its Mechanisms and Vital<br />
Endowments, as Evincing<br />
Design. London 1833; dt.:<br />
Die menschliche Hand und<br />
ihre Eigenschaften, Stuttgart<br />
1836. Es handelt sich<br />
um den vierten Band einer<br />
Schriftenreihe mit dem Titel<br />
The Bridgewater Treatises<br />
on the power, wisdom<br />
and goodness of God as<br />
manifested in the creation;<br />
dt: Die Natur, ihre Wunder<br />
und Geheimnisse oder Die<br />
Bridgewater-Bücher.<br />
Die Hand 1<br />
Richard Sennett<br />
Technik hat einen schlechten Ruf. Sie kann seelenlos erscheinen. Menschen,<br />
die in ihren Händen ein hohes Maß an Übung erreichen, sehen<br />
das allerdings nicht so. Für sie ist Technik eng verbunden mit Ausdruck.<br />
In diesem Kapitel will ich einen ersten Schritt in der Erforschung dieser<br />
Verbindung unternehmen.<br />
Vor zwei Jahrhunderten bemerkte Kant einmal, die Hand sei das Fenster<br />
zum Geist. 2 Die moderne Wissenschaft hat diese Beobachtung vertieft.<br />
Von allen menschlichen Gliedern verfügt die Hand über das größte Repertoire<br />
unterschiedlicher und willentlich steuerbarer Bewegungen. Die<br />
Wissenschaft versucht zu klären, in welcher Weise diese Bewegungen<br />
in Verbindung mit dem Greifen und dem Tastsinn unser Denken beeinflussen.<br />
Der Verbindung zwischen Hand und Kopf werde ich am Beispiel<br />
dreier „Handwerker“ nachgehen, die ihre Hand in beträchtlichem Maße<br />
üben müssen: Musiker, Köche und Glasbläser. Eine Handfertigkeit dieser<br />
Art ist zwar etwas Besonderes, hat aber auch Implikationen für das normalere<br />
Erleben.<br />
Die intelligente Hand<br />
Wie die Hand menschlich wurde<br />
Greifen und Tasten<br />
Das Bild der „intelligenten Hand“ erschien in den Wissenschaften bereits<br />
1833, als Charles Bell eine Generation vor Darwin sein Buch The Hand<br />
(Die menschliche Hand) veröffentlichte. 3 Der fromme Christ Bell glaubte,<br />
die Hand sei vom Schöpfer als vollkommenes, seinen Zwecken bestens<br />
angepasstes Glied geschaffen worden, wie es für all seine Werke galt.<br />
Bell schrieb der Hand eine privilegierte Stellung in der Schöpfung zu<br />
und führte diverse Experimente durch, die beweisen sollten, dass unser<br />
Gehirn von der Hand vertrauenswürdigere Informationen erhält als von<br />
den Augen, die uns oft nur falsche oder irreführende Bilder lieferten.<br />
4<br />
Charles Darwin: The<br />
Descent of Man (1879),<br />
London 2004; dt.: Die Abstammung<br />
des Menschen.<br />
Stuttgart 1966, S. 60–63.<br />
5<br />
Frederick Wood Jones: The<br />
Principles of Anatomy as<br />
Seen in the Hand. Baltimore<br />
1942, S. 298–299.<br />
6<br />
Tallis: The Hand, S. 24.<br />
7<br />
Siehe John Napier: Hands,<br />
überarb. von Russell<br />
H. Tuttle: Princeton, N.<br />
J. 1993, S. 55 ff. Eine<br />
ausgezeichnete populärwissenschaftliche<br />
Zusammenfassung dieser<br />
veränderten Sichtweise<br />
findet sich bei Frank R.<br />
Wilson: The Hand: How<br />
Its Use Shapes the Brain,<br />
Language, and Human Culture.<br />
New York 1998; dt.:<br />
Die Hand – Geniestreich der<br />
Evolution: Stuttgart 2000,<br />
S. 129–160.<br />
Darwin entthronte Bells Überzeugung, wonach die Hand nach Form und<br />
Funktion zeitlos sei. In der Evolution, so nahm Darwin an, vergrößerte<br />
sich das Gehirn der Affen, als die Arme nicht mehr nur dazu dienten, den<br />
Körper in der Bewegung zu stabilisieren. 4 Mit wachsender Hirnkapazität<br />
lernten unsere menschlichen Vorfahren, mit den Händen Dinge zu halten,<br />
über die in den Händen gehaltenen Dinge nachzudenken und diese<br />
Dinge schließlich auch zu formen. Der Menschenaffe konnte Werkzeuge<br />
machen. Der Mensch macht Kultur.<br />
Bis vor kurzem glaubten Evolutionswissenschaftler, dass der Gebrauch<br />
der Hand und nicht deren Struktur sich mit der wachsenden Größe des<br />
Gehirns veränderte. So schrieb Frederick WoodJones vor einem halben<br />
Jahrhundert: „Nicht die Hand ist vollkommen, sondern der gesamte<br />
Nervenapparat, der die Bewegungen der Hand auslöst, koordiniert und<br />
kontrolliert.“ Und dies habe die Evolution des Homo sapiens ermöglicht. 5<br />
Heute wissen wir, dass auch die physische Struktur der Hand sich in der<br />
jüngeren Geschichte des Menschen entwickelt hat. Der moderne Philosoph<br />
und Arzt Raymond Tallis erklärt die Veränderung zum Teil durch die<br />
beim Menschen im Vergleich zum Schimpansen größere Bewegungsfreiheitim<br />
Gelenk zwischen Trapezbein und Metakarpalknochen. „Wie beim<br />
Schimpansen besteht das Gelenk aus ineinandergreifenden konkaven<br />
und konvexen Flächen, die einen Sattel bilden. Der Unterschied zwischen<br />
uns und den Schimpansen liegt darin, dass die Teile dieses Gelenks beim<br />
Schimpansen enger ineinandergreifen und so die Bewegung behindern,<br />
insbesondere die Opposition des Daumens zu den übrigen Fingern.“ 6 Die<br />
Forschung von John Napier und anderen hat gezeigt, dass die physische<br />
Gegenstellung des Daumens und der übrigen Finger in der Evolutionvon<br />
Homo sapiens immer ausgeprägter wurde und mit sehr feinen Veränderungen<br />
jener Knochen einherging, die den Zeigefingerstützen und stärken.<br />
7<br />
Diese strukturellen Veränderungen ermöglichten unserer Art die einzigartige<br />
körperliche Erfahrung des Greifens. Das Greifen ist eine willentliche<br />
Handlung, Ergebnis einer Entscheidung und keine unwillkürliche Bewegung<br />
wie der Lidschlag. Die Ethnologin Mary Marzke unterscheidet drei<br />
Grundformen des Greifens. Beider ersten fassen wir kleine Gegenstände,<br />
indem wir sie zwischen die Spitze des Daumens und die Innenseite des<br />
Zeigefingers nehmen. Bei der zweiten wiegen wir einen Gegenstand auf<br />
der Handfläche und bewegen ihn mit stoßenden und massierenden Bewegungen<br />
des Daumens und der übrigen Finger. (Zwar beherrschen auch<br />
fortgeschrittene Primaten diese beiden Griffe, aber sie können sie nicht<br />
so gut ausführen wie wir.) Die dritte Grundform ist der Korbgriff, etwa<br />
wenn man einen Ball oder andere größere Gegenstände mit dem Daumen<br />
und sämtlichen anderen Fingern in der hohlen Hand festhält, und diese<br />
Form ist beim Menschen sogar noch höher entwickelt. Der Korbgriff erlaubt<br />
es uns, einen Gegenstand fest in der Hand zu halten, während wir<br />
ihn mit der anderen Hand bearbeiten.
224 — 225<br />
Richard Sennett<br />
8<br />
Mary Marzke: Evolutionary<br />
Development of the<br />
Human Thumb, Hand<br />
Clinics 8, Nr. 1 (Februar<br />
1992), S. 1–8. Siehe auch<br />
Marzke: Precision Grips,<br />
Hand Morphology, and<br />
Tools, American Journal of<br />
Physical Anthropology 102<br />
(1997), S. 91–110.<br />
9<br />
Siehe K. Müller und<br />
V.Homberg, Development<br />
of Speed of Repetitive<br />
Movements in Children…,<br />
Neuroscience Letters 144<br />
(1992), S. 57–60.<br />
Beherrscht ein Tier wie wir erst einmal diese drei Grundformen des<br />
Greifens, übernimmt alles weitere die kulturelle Evolution. Für Marzke<br />
erschien Homo faber erstmals auf der Erde, als jemand die Fähigkeit erwarb,<br />
Dinge mit sicherem Griff zu halten, um sie zu bearbeiten. „Die meisten<br />
Besonderheiten der modernen menschlichen Hand, darunter auch<br />
der Daumen, lassen sich mit den Belastungen verbinden …, zu denen es<br />
durch den Einsatz dieser Griffformen beim Umgang mit Steinwerkzeugen<br />
gekommen sein dürfte.“ 8 Daraus ergibt sich dann das Nachdenken über<br />
die Dinge,die man solcherart im Griff hat. Man sagt von Problemen, dass<br />
man sie „im Griff hat“, und ganz allgemein von geistigen Zusammenhängen,<br />
dass man sie begreift. In beidem spiegelt sich der evolutionäre<br />
Dialog zwischen Hand und Gehirn.<br />
Es gibt indessen ein Problem mit dem Greifen, das besondere Bedeutung<br />
für Menschen besitzt, die ein hohes Maß an technischer Handfertigkeit<br />
entwickeln, die Frage nämlich, wie man loslässt. Wer etwa lernen will, ein<br />
Musikinstrument schnell und sauber zu spielen, muss lernen, wie er die<br />
Finger auch schnell wieder von der Klaviertaste, der Saite oder der Ventilklappe<br />
löst. In ähnlicher Weise müssen wir uns zumindest zeitweise von<br />
einem Problem lösen, um es aus der Distanz zu betrachten und uns dann<br />
erneut an seine Lösung zu machen. Neuropsychologen glauben heute,<br />
dass die physischen und kognitiven Fähigkeiten des Loslassensauch der<br />
Fähigkeit des Menschen zugrunde liegen, sich von Ängsten und Zwangshandlungen<br />
zu lösen. Das Loslassen besitzt auch zahlreiche ethische<br />
Implikationen, etwa wenn wir andere aus unserer Kontrolle – unserem<br />
Griff – entlassen.<br />
Zu den Mythen um hohe technische Fertigkeiten gehört die Vorstellung,<br />
wer technische Meisterschaft erwerbe, müsse einen besonderen Körper<br />
besitzen. Soweit es die Hand betrifft, ist diese Vorstellung nicht ganz<br />
richtig. Die Fähigkeit etwa, die Finger sehr schnell zu bewegen, liegt bei<br />
allen Menschen im Pyramidaltrakt des Gehirns begründet. Jede Hand<br />
lässt sich so trainieren, dass Daumen und Zeigefinger im rechten Winkel<br />
voneinander abgestreckt werden können. Und während kleine Hände für<br />
Cellisten eine wichtige Voraussetzung darstellen, sind sie für Pianisten<br />
ein Handicap, das sie allerdings durch entsprechende Techniken ausgleichen<br />
können. 9 Auch für andere körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten<br />
wie die des Chirurgen ist es nicht erforderlich, dass die Hand von Anfang<br />
an eine besondere Beschaffenheit besäße. Schon Darwin bemerkte vor<br />
langer Zeit, dass physische Begabung einen Ausgangspunkt für das Verhalten<br />
von Organismen darstellt und nicht das Ziel. Das gilt sicher auch<br />
für die technischen Fertigkeiten der Hand. Griffe entwickeln sich beim<br />
Einzelnen in derselben Weise, wie sie sich innerhalb unserer Art entwickelt<br />
haben.<br />
* * *<br />
10<br />
Siehe Charles Sherrington:<br />
The Integrative<br />
Action of the Nervous<br />
System. New York 1906.<br />
Der Tastsinn wirft andere Fragen hinsichtlich der intelligenten Hand auf.<br />
In der Geschichte der Medizin wie auch der Philosophie gibt es eine lange<br />
Debatte über die Frage, ob der Tastsinn dem Gehirn eine andere Art von<br />
Sinneseindrücken liefert als das Auge. Es scheint, dass der Tastsinn aufdringliche,<br />
„ungebundene“ Daten, das Auge dagegen Bilder liefert, die in<br />
einen Rahmen eingebunden sind. Wenn man einen heißen Ofen berührt,<br />
erfährt der gesamte Körper plötzlich einen Schock. Einen schmerzhaften<br />
Anblick kann man dagegen lindern, indem man die Augen schließt. Vor<br />
einem Jahrhundert gab der Biologe Charles Sherrington dieser Diskussion<br />
eine neue Richtung. Er erforschte das „aktive Tasten“, wie er es nannte,<br />
bei dem die Fingerspitzen bewusst über eine Oberfläche geführt werden.<br />
Er sah im Tastsinn einen ebenso aktiven wie reaktiven Sinn. 10<br />
Ein Jahrhundert nach Sherrington haben dessen Forschungen eine weitere<br />
Wende erfahren. Die Finger können einen Gegenstand auch ohne<br />
bewusste Absicht aktiv abtasten, etwa wenn sie nach einem bestimmten<br />
Punkt suchen, der das Gehirn anregt nachzudenken. Man spricht hier von<br />
„lokalisiertem“ Tasten. Einem Beispiel dafür sind wir bereits begegnet,<br />
denn genau so prüfte der mittelalterliche Goldschmied Metalle. Er rollte<br />
und drückte die metallene „Erde“ so lange zwischen den Fingerspitzen,<br />
bis er auf eine Stelle stieß, die ihm unrein erschien. Aus dieser lokalisierten<br />
Sinneswahrnehmung schloss der Goldschmied dann zurück auf die<br />
Natur des betreffenden Stoffes.<br />
Einen Spezialfall lokalisierten Tastens stellen die Schwielen an den Händen<br />
von Menschen dar, die von Berufs wegen manuelle Tätigkeiten verrichten.<br />
Im Prinzip sollten die verhornten Hautschichten den Tastsinn beeinträchtigen.<br />
In der Praxis stellt sich jedoch der umgekehrte Effekt ein.<br />
Da die Schwiele die Nervenenden in der Haut schützt, kann das Tasten<br />
zielstrebiger erfolgen. Obwohl wir die Physiologie dieses Vorgangs noch<br />
nicht ganz verstehen, gilt doch offenbar: Die Schwiele sensibilisiert die<br />
Hand für kleinste räumliche Bereiche und stimuliert das Empfindungsvermögen<br />
der Fingerspitzen. Man könnte sagen, die Schwiele leiste für<br />
die Hand etwas Ähnliches wie das Zoomobjektiv für die Kamera.<br />
Im Blick auf die tierischen Fähigkeiten der Hand glaubte Charles Bell,<br />
die verschiedenen Glieder oder Organe besäßen jeweils eigene Nervenbahnen<br />
zum Gehirn, so dass die Sinne sich voneinander trennen ließen.<br />
Die moderne Neurowissenschaft hat gezeigt, dass diese Vorstellung<br />
falsch ist. Ein neuronales Netz, das Auge, Gehirn und Hand verbindet,<br />
sorgt vielmehr für eine Integration des Tastens, Greifens und Sehens.<br />
So greift das Gehirn beim Betrachten der zweidimensionalen Fotografie<br />
eines Balls auf gespeicherte Informationen zurück, die aus der Erfahrung<br />
stammen, einen Ball in der Hand zu halten. Die Krümmung der Finger<br />
und das von der Hand empfundene Gewicht des Balls helfen dem Gehirn,<br />
in drei Dimensionen zu denken und das flache Objekt aufdem Papier als<br />
Kugel zu sehen.
226 — 227<br />
Richard Sennett<br />
11<br />
Wilson, Die Hand, S. 115.<br />
12<br />
A. P. Martinich: Hobbes:<br />
A Biography. Cambridge<br />
1999.<br />
Prehension<br />
Etwas erfassen<br />
Wenn wir sagen, dass wir „etwas erfassen“, so setzt dies physisch voraus,<br />
dass wir danach greifen. Wenn wir etwa nach einem Glas greifen,<br />
antizipiert die Hand, schon bevor sie die Oberfläche des Glases berührt,<br />
dass es sich um einen runden Gegenstand handelt, den sie in vertrauter<br />
Weise fassen kann. Der Körper ist zum Greifen bereit, bevor er weiß,<br />
ob das, wonach er greift, eiskalt oder kochend heiß ist. Der Fachbegriff<br />
für solche Bewegungen, in denender Körper im Vorgriff auf Sinnesdaten<br />
agiert und sie antizipiert, lautet „Prehension“.<br />
Geistig „erfassen“ wir etwas, wenn wir zum Beispiel eine Gleichung wie<br />
a/d= b+ c nicht nur ausführen, sondern auch verstehen. Geistiges Verstehen<br />
wie auch physisches Handeln erhalten durch Prehension eine besondere<br />
Prägung. Wir warten mit dem Denken nicht, bis alle Informationen<br />
beisammen sind, sondern antizipieren die Bedeutung. Prehension signalisiert<br />
Aufmerksamkeit, Engagement und Risikobereitschaft im Blick<br />
nach vorn. Sie ist das genaue Gegenteil eines vorsichtigen Buchhalters,<br />
der keinen einzigen Finger rührt, bis er nicht alle erforderlichen Zahlen<br />
beisammenhat.<br />
Neugeborene beginnen mit der Prehension schon in der zweiten Lebenswoche,<br />
wenn sie etwa nach Spielsachen greifen, die man ihnen vors Gesicht<br />
hält. Wegen des Zusammenspiels zwischen Auge und Hand nimmt<br />
die Prehension zu, wenn das Kind den Kopf heben kann, da es dann besser<br />
sieht, wonach es greift. In den ersten fünf Lebensmonaten entwickelt<br />
die Hand des Kindes die neuromuskuläre Fähigkeit, sich unabhängig in<br />
Richtung des gesehenen Gegenstands zu bewegen, und in den folgenden<br />
fünf Monaten die Fähigkeit, verschiedene Greifpositionen einzunehmen.<br />
Beide Fähigkeiten hängen mit der Entwicklung des Pyramidaltrakts zusammen,<br />
einer Verbindung zwischen dem primären motorischen Kortex<br />
und dem Rückenmark. Gegen Ende des ersten Lebensjahres, so schreibt<br />
Frank Wilson, „ist die Hand zur lebenslangen Erkundung bereit“. 11<br />
Die sprachlichen Ergebnisse der Prehension illustriert ein Experiment,<br />
das der Philosoph Thomas Hobbes mit den Kindern der Familie Cavendish<br />
durchführte. Hobbes schickte seine Schützlinge, deren Hauslehrer<br />
er war, in ein abgedunkeltes Zimmer, in dem er diverse Gegenstände deponiert<br />
hatte, mit denen die Kinder nicht vertraut waren. Nachdem sie<br />
die Gegenstände betastet hatten,rief er sie aus dem Zimmer und ließ sie<br />
beschreiben, was siemit ihren Händen „gesehen“ hatten. Er stellte fest,<br />
dass die Kinder präzisere Ausdrücke benutzten als bei der Beschreibung<br />
von Dingen, die sie bei Licht gesehen hatten. Hobbes erklärte dies unter<br />
anderem durch den Umstand, dass sie im Dunkeln „nach Bedeutung<br />
griffen“ – dieser Reiz half ihnen dann im Hellen, als die unmittelbaren<br />
Empfindungen bereits „zerfallen“ waren, treffende Worte zu finden. 12<br />
Ein Vorgreifen im Sinne der Prehension schafft Tatsachen, zum Beispiel<br />
13<br />
Beryl Markham: West<br />
with the Night. London<br />
1984; dt.: Westwärts<br />
mit der Nacht. München<br />
1987.<br />
14<br />
Siehe Tallis: The Hand,<br />
Elftes Kapitel, insb. S.<br />
329–331.<br />
15<br />
Siehe Shin’ichi Suzuki:<br />
Nurtured by Love: A<br />
New Approach to Talent<br />
Education. Miami, Fl.,<br />
1968; dt.: Erziehung<br />
ist Liebe: eine neue<br />
Erziehungsmethode.<<br />
Kassel 1994.<br />
wenn die Handzeichen des Dirigenten dem Ton um einen Augenblick<br />
vorausgehen. Gäbe er das Handzeichen für einen Taktschlag genau zum<br />
richtigen Zeitpunkt, führte er das Orchester gar nicht, denn der Ton wäre<br />
längst gespielt. Die Schläger beim Kricket erhalten gleichfalls den Rat,<br />
dem Schlag voraus zu sein. In Beryl Markhams bemerkenswerten Memoiren<br />
West with the Night (Westwärts mit der Nacht) findet sich noch<br />
ein weiteres Beispiel. Zu einer Zeit, als die Piloten bei ihren Flügen kaum<br />
auf Instrumente zurückgreifen konnten, stellte Markham sich bei ihren<br />
Flügen durch die afrikanische Nacht vor, sie hätten das geplante Flugmanöver<br />
wie einen Steigflug oder eine Kurve bereits hinter sich. 13 All diese<br />
technischen Meisterleistungen basieren auf dem, was jeder tut, wenn er<br />
nach einem Glas greift.<br />
Die bislang vollständigste Darstellung der Prehension hat Raymond Tallis<br />
gegeben. Er gliedert das Phänomen in vier Dimensionen: Antizipation, wie<br />
sie geschieht, wenn die nach einem Glas greifende Hand sich vorweg entsprechend<br />
formt; Berührung, wenn das Gehirn Sinnesdaten im Bereich des<br />
Tastsinns erhält; sprachliches Erkennen, wenn man den ergriffenen Gegenstand<br />
benennt; und schließlich Nachdenken über das, was man getan<br />
hat. 14 Tallis behauptet nicht, dass all dies bewusst geschehen müsste.<br />
Die Orientierung kann auf den Gegenstand fokussiert bleiben. Die Hand<br />
weiß genau das, was sie tut. Den vier von Tallis genannten Dimensionen<br />
möchte ich noch eine weitere hinzufügen: die Bedeutungen, die sich durch<br />
große technische Handfertigkeit entwickeln lassen.<br />
Tugenden der Hand<br />
An der Fingerspitze<br />
Wahrhaftigkeit<br />
Wenn ein Kind ein Streichinstrument zu spielen lernt, weiß es zunächst<br />
nicht, wohin es die Finger auf dem Griffbrett setzen soll, um einen bestimmten<br />
Ton präzise zu erzeugen. Die nach dem japanischen Musikpädagogen<br />
Suzuki Shin’ichi benannte Suzuki-Methode löst dieses Problem durch dünne<br />
farbige Plastikstreifen, die auf das Griffbrett geklebt werden. Die junge<br />
Geigenschülerin legt den Finger auf diesen farbigen Streifen, um einen bestimmten<br />
Ton zu erzielen. Die Methode legt das Schwergewicht von Anfang<br />
an auf die Schönheit des Tons oder, wie Suzuki dies nannte, die „Intonierung“,<br />
ohne sich um die komplizierten Details der Erzeugung eines schönen Tons zu<br />
kümmern. Die Bewegung der Hand wird durch das fest vorgegebene Ziel für<br />
die Fingerspitze bestimmt. 15<br />
Diese benutzerfreundliche Methode stärkt das individuelle Zutrauen. Schon<br />
nach der vierten Stunde kann das Kind ein Kinderlied wie „Twinkle, Twinkle,<br />
Little Star“ bestens spielen. Und sie stärkt das gemeinschaftliche Zutrauen,<br />
denn ein ganzes Streichorchester aus Siebenjährigen vermag das Kinderlied<br />
zu spielen, weil jeder genau weiß, was die Hand zu tun hat. Diese beglückende<br />
Zuversicht schwindet allerdings, sobald man die Streifen entfernt.
228 — 229<br />
Richard Sennett<br />
Eigentlich sollte man erwarten, dass die eingeschliffene Gewohnheitsich<br />
auch auf die Präzision erstreckt und die Finger auf dem nicht<br />
mehr markierten Griffbrett genau die Stelle träfen, an denen sich der<br />
Streifen befunden hatte. In Wirklichkeit jedoch versagt eine solcherart<br />
mechanische Gewohnheit, und das aus einem physischen Grund. Die<br />
Suzuki-Methode dehnt die kleinen Hände seitlich am Knöchelkamm,<br />
sie sensibilisiert jedoch nicht die Fingerspitze, die letztlich die Saite<br />
nach unten drückt. Da die Fingerspitze das Griffbrett nicht kennt,<br />
erklingen falsche Töne, sobald die Streifen entfernt werden. In der<br />
technischen Fingerfertigkeit ist es wie in der Liebe: Unschuldige Zuversicht<br />
führt nicht weit. Eine weitere Komplikation ergibt sich, wenn<br />
der Spielende auf das Griffbrett schaut, um zu sehen, wohin er die<br />
Fingerspitze setzen soll. Das Auge wird auf dieser glatten schwarzen<br />
Fläche keine Antwort finden. Deshalb klingt ein Kinderorchester wie<br />
ein jaulender Mob, wenn die Markierungsstreifen abgenommen werden.<br />
Das Problem liegt hier in der falschen Sicherheit. Die Schwierigkeiten<br />
des musizierenden Kindes erinnern an Victor Weisskopfs Warnung an<br />
erwachsene Wissenschaftler und Techniker, der Computer verstehe<br />
die Antwort, „aber ich glaube nicht, dass Sie die Antwort verstehen“.<br />
Eine weitere Analogie zu den farbigen Markierungen wäre das Rechtschreib-<br />
und Grammatikprogramm eines Computerschreibprogramms.<br />
Wer es benutzt, lernt nicht, weshalb eine grammatische Konstruktion<br />
der anderen vorzuziehen ist.<br />
Suzuki war sich des Problems der falschen Sicherheit durchaus bewusst.<br />
Er empfahl, die farbigen Streifen zu entfernen, sobald das Kind<br />
erlebt hat, welchen Spaß das Musizieren macht. Als musikalischer Autodidakt<br />
(sein Interesse an der Musik erwachte, als er Ende der 1940er<br />
Jahre eine Aufzeichnung des Ave Maria von Franz Schubert in einer<br />
Interpretation von Mischa Elman hörte) wusste Suzuki aus eigener Erfahrung,<br />
dass die Wahrhaftigkeit in den Fingerspitzen liegt: Der Tastsinn<br />
ist der Richter über den Ton. Auch hier findet sich eine Parallele<br />
zur Probe des Goldschmieds, der das Material mit den Fingerspitzen<br />
erforscht und so der falschen Sicherheit des ersten Blicks entgeht.<br />
Wir möchten wissen, welche Art Wahrheit solche falsche Sicherheit<br />
verhindert.<br />
In der Musik arbeiten Ohr und Fingerspitze gemeinsam an dieser<br />
Probe. Recht trocken ausgedrückt: Der Musiker berührt die Saite in unterschiedlicher<br />
Weise, er hört die verschiedenen Wirkungen und sucht<br />
dann nach einer Möglichkeit, den gewünschtenTon zu reproduzieren.<br />
In der Realität ist dies zuweilen ein schwieriger und schmerzhafter<br />
Kampf um die Frage: „Was habe ich da eigentlich gemacht? Wie kann<br />
ich es wiederholen?“ Die Fingerspitze ist hier kein bloßes Werkzeug.<br />
Bei dieser Art der Berührung sucht man den Rückweg von der Sinneswahrnehmung<br />
zum Vorgehen, von der Wirkung zur Ursache.<br />
16<br />
D.W. Winnicott: Playing<br />
and Reality. London 1971;<br />
dt.: Vom Spiel zur Kreativität.<br />
Stuttgart 1973; John<br />
Bowlby: A Secure Base:<br />
Parent-Child Attachment<br />
and Healthy Human Development,<br />
London 1988;<br />
dt.: Elternbindung und<br />
Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Heidelberg 1995.<br />
Was folgt nun daraus für jemanden, der nach diesem Grundsatz handelt?<br />
Stellen wir uns einen Jungen vor, der ohne Hilfe farbiger Markierungen<br />
darum kämpft, die richtigen Töne zu treffen. Er scheint eine Note ganz<br />
genau zu treffen, aber dann sagt ihm das Ohr, dass die nächste mit dieser<br />
Fingerstellung gespielte Note schief klingt. Für dieses Problem gibt<br />
es einen physischen Grund. Bei allen Streichinstrumenten verkürzt sich<br />
die Saite, wenn man sie hinunterdrückt, und entsprechend muss auch<br />
der Abstand zwischenden Fingern verkürzt werden. Das Feedback des<br />
Ohrs schickt das Signal, dass es einer seitlichen Anpassung am Knöchelkamm<br />
bedarf (eine berühmte Übung in den Études von Jean-Pierre<br />
Duport erkundet das Wechselspiel zwischen der Verringerung der seitlichen<br />
Spannweite und der Aufrechterhaltung der Rundung in der Hand<br />
des Cellisten, während sie über alle Saiten und die gesamte Länge des<br />
Griffbretts wandert). Durch Versuch und Irrtum mag der Neuling auch<br />
ohne Markierungen lernen, wie er den Knöchelkamm zusammenziehen<br />
kann, doch eine Lösung ist auch dann nicht in Sicht. Er hält die Hand im<br />
rechten Winkel zum Griffbrett, und vielleicht sollte er nun versuchen,<br />
die Handfläche in Richtung der Wirbel leicht zu höhlen. Das hilft. Nun<br />
trifft er den richtigen Ton, weil die Neigung einen Ausgleich für die<br />
unterschiedliche Länge des Zeige- und des Mittelfingers schafft. (Außerdem<br />
strafft ein vollkommen rechtwinkliger Ansatz den längeren Mittelfinger.)<br />
Doch diese neue Stellung verdirbt die Lösung, die er für das<br />
Problem der seitlichen Knöchelstellung gefunden hatte. Und so geht es<br />
weiter. Jedes neue Problem beim Spielen korrekter Töne zwingt ihn, die<br />
bisherigen Lösungen zu überdenken.<br />
Was könnte ein Kind motivieren, einen so anspruchsvollen Weg zu<br />
gehen? Eine Psychologenschule behauptet, Motivation basiere auf einer<br />
für jegliche menschliche Entwicklung grundlegenden Erfahrung. Das<br />
Urereignis der Trennung könne jeden jungenMenschen lehren, neugierig<br />
zu sein. Diese Forschungen waren Mitte des 20. Jahrhunderts mit den<br />
Namen D.W. Winnicott und John Bowlby verknüpft, zwei Psychologen,<br />
die sich für die frühesten menschlichen Erfahrungen der Bindung und<br />
der Trennung interessierten, angefangen bei der Loslösung des Säuglings<br />
von der Mutterbrust. 16 Nach der Volkspsychologie führt der Verlust<br />
dieser Bindung zu Angst und Trauer. Die beiden britischen Psychologen<br />
wollten zeigen, dass es sich um einen weitaus komplexeren Vorgang<br />
handelt.<br />
Winnicott behauptete, wenn das Kleinkind nicht mehr eins mit dem Körper<br />
der Mutter sei, werde es auf neuartige Weise stimuliert und wende<br />
sich nach außen. Bowlby beobachtete in Kinderkrippen Kleinkinder, um<br />
herauszufinden, welchen Einfluss Trennung auf den Umgang der Kinder<br />
mit unbelebten Objekten hat. Mit größter Sorgfalt beobachtete er alltägliche<br />
Aktivitäten, denen man bis dahin kaum Einfluss beigemessen<br />
hatte. Für unsere Fragestellung ist ein Aspekt dieser Forschung besonders<br />
interessant.
230 — 231<br />
Richard Sennett<br />
Beide Psychologen betonten die Energie, die Kleinkinder in „Übergangsobjekte“<br />
investieren – ein Fachausdruck für die menschliche Fähigkeit,<br />
sich für Menschen oder materielle Objektezu interessieren, die sich<br />
ihrerseits verändern. Als Psychotherapeuten versuchten die Vertreter<br />
dieser psychologischen Schule erwachsenen, auf ein kindliches Sicherheitstrauma<br />
fixierten Patienten zuhelfen, mit veränderlichen zwischenmenschlichen<br />
Beziehungen besser zurechtzukommen. Doch die Idee<br />
des „Übergangsobjekts“ macht auch deutlich, was wirklich Neugier auszulösen<br />
vermag: eine ungewisse oder instabile Erfahrung. Ein Kind, das<br />
mit der Unsicherheit der Erzeugung von Tönen oder dem Erwerb jeder<br />
anspruchsvollen Handfertigkeit zu kämpfen hat, bildet jedoch einen Sonderfall,<br />
denn es scheint in einen endlosen, kaum strukturierten Prozess<br />
verwickelt zu sein, für den es allenfalls vorläufige Lösungen gibt, so dass<br />
dem Musiker das Gefühl zunehmender Kontrolle und die emotionale Erfahrung<br />
von Sicherheit versagt bleiben.<br />
Aber ganz so schlimm ist es denn auch wieder nicht, denn der Musiker<br />
muss einem objektiven Maßstab genügen: Er muss den Ton treffen. Wie<br />
bei den im ersten Kapitel beschriebenen politischen Vorgaben könnte<br />
man behaupten, nur mit festgelegten objektiven Wahrheitsmaßstäben<br />
lasse sich ein hohes Maß an technischen Fertigkeiten erwerben. In der<br />
Musik brauchte man nur daraufzu verweisen, dass der Glaube an Korrektheit<br />
die technische Verbesserung vorantreibt. Aus der Neugier für<br />
Übergangsobjekte wird eine Definition dessen, was sie sein sollten. Die<br />
Qualität des Klangs ist solch ein Maßstab für Korrektheit – selbst in Suzukis<br />
Augen. Deshalb beginnt er bei der Intonierung. Der Glaube an technische<br />
Korrektheit und das Streben danach sorgen dann fürden Ausdruck.<br />
In der Musik kommt es zu diesem Übergang, wenn die Maßstäbe sich von<br />
physischen Ereignissen wie dem Spielen eines guten Tons hin zu stärker<br />
ästhetischen Maßstäben wie einer wohlgeformten Phrase entwickeln.<br />
Natürlich sagen uns spontane Entdeckungen und glückliche Zufälle, wie<br />
ein Musikstück klingen sollte. Dennoch müssen Komponist und Musiker<br />
über Kriterien verfügen, mit denen sie glückliche Zufälle erkennen und<br />
mit denen sie bestimmen können, welche davon glücklicher sind als andere.<br />
Bei der Entwicklung der Technik verwandeln wir Übergangsobjekte<br />
in Definitionen, auf deren Grundlage wir dann Entscheidungen treffen.<br />
Von Komponisten und Musikern sagt man, sie hörten mit dem „inneren<br />
Ohr“, doch diese immaterielle Metapher führt in die Irre. Berühmte Beispiele<br />
dafür sind Komponisten wie Arnold Schönberg, die selbst schockiert<br />
waren, als sie die Musik hörten, die sie auf dem Blatt komponiert<br />
hatten. Gleiches gilt für Musiker. Auch für sie ist das Studium der Partitur<br />
eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Vorbereitung auf die<br />
tatsächliche Darbietung. Der Klang ist der eigentliche Augenblick der<br />
Wahrheit.<br />
Der Klang ist deshalb auch der Augenblick, in dem der Musiker Fehler<br />
erkennt. Als Musizierender spüre ich den Fehler in den Fingerspitzen–<br />
und versuche, ihn zu korrigieren. Ich verfüge über Maßstäbe, wie etwas<br />
klingen soll, doch meine Wahrhaftigkeit liegt in der schlichten Wahrnehmung,<br />
dass ich Fehler mache. In wissenschaftlichen Diskussionen wird<br />
diese Wahrnehmung oft auf das Klischee reduziert, wonach man „aus<br />
seinen Fehlern lernt“. Die musikalische Technik zeigt, dass die Dinge<br />
nicht so einfach sind. Ich muss bereit sein, Fehler zu machen und falsche<br />
Noten zu spielen, um sie am Ende richtig spielen zu können. Die Verpflichtung<br />
auf solche Wahrhaftigkeit geht der junge Musiker ein, wenn er<br />
die Suzuki-Streifen abnimmt.<br />
Beim Spielen eines Musikinstruments besitzt die Rückkopplung zwischen<br />
Fingerspitze und Handfläche eine merkwürdige Konsequenz: Sie<br />
bietet ein festes Fundament für die Entwicklung physischer Sicherheit.<br />
Ein Üben, das auf Fehler an der Fingerspitze sogleich reagiert, steigert<br />
das Selbstvertrauen. Vermag der Musiker etwas mehr als ein Mal korrekt<br />
zu tun, hat er keine Angst mehr vor Fehlern. Und zugleich besitzt<br />
er damit einen Gegenstand, über den er nachdenken und den er durch<br />
Variation im Blick auf Gleichheit oder Unterschiede erkunden kann. Das<br />
Üben wird so zu einer Geschichte statt zu bloßer Wiederholung. Die hart<br />
erarbeiteten Bewegungen prägen sich dem Körper immer tiefer ein, und<br />
der Spieler erwirbt Schritt für Schritt immer größere Fertigkeiten. Bei der<br />
Markierung durch die Streifen wird das Üben dagegen bald langweilig,<br />
weil hier ein und dasselbe ständig wiederholt wird. Da wundertes nicht,<br />
wenn die Handfertigkeit unter diesen Bedingungen eher abnimmt.<br />
Die Angst vor Fehlern zu verringern ist in unserer Kunst von größter Bedeutung,<br />
da der Musiker auf der Bühne nicht gelähmt einhalten kann,<br />
wenn er einen Fehler macht. Bei der Darbietung von Musik ist die Zuversicht,<br />
dass man sich von einem Fehler erholen wird, kein Persönlichkeitsmerkmal,<br />
sondern eine erlernte Fähigkeit.<br />
Die Entwicklung der musikalischen Technik erweist sich demnach als<br />
Wechselspiel zwischen korrektem Spiel und der Bereitschaft, zu experimentieren<br />
und dabei Fehler zu machen. Die beiden Seiten lassen sich<br />
nicht voneinander trennen. Wenn man einem jungen Musiker nur den<br />
korrekten Weg vorgibt, erwirbt er eine falsche Sicherheit. Wenn er nach<br />
Belieben seiner Neugier und dem Fluss des Übergangsobjekts folgt, wird<br />
er niemals besser werden.<br />
* * *<br />
Dieser Dialog verweist auf einen der Prüfsteine handwerklichen Könnens,<br />
den Einsatz „gebrauchsfertiger“ Verfahren oder Werkzeuge. Dabei versucht<br />
man, alle Verfahren zu eliminieren, die nicht dem vorbestimmten<br />
Zweck dienen. Dieser Gedanke stand schon hinter Diderots Tafeln zur Papierherstellung<br />
in L’Anglée, auf denen keinerlei Abfälle oder Papierreste<br />
zu sehen sind. Programmierer sprechen heute von Systemen ohne hiccups<br />
(Schluckauf). Die Suzuki-Streifen sind eine Vorrichtung, die solche
232 — 233<br />
Richard Sennett<br />
Gebrauchsfertigkeit herstellen soll. Wir sollten in Gebrauchsfertigkeit<br />
eher eine Leistung als einen Ausgangspunkt erblicken. Um dieses Ziel zu<br />
erreichen, muss der Arbeitsprozess dem ordnungsliebenden Geist etwas<br />
Unangenehmes antun – er muss ihm zumuten, sich zeitweilig auf chaotische<br />
Zustände einzulassen: auf falsche Wege, verpatzte Anfänge und<br />
Sackgassen. Aber in Wirklichkeit ist dieses Durcheinander für den experimentierenden<br />
Handwerker in der Technik wie in der Kunst weit mehr<br />
als bloßes Chaos. Er produziert es, um seine Arbeitsverfahren besser zu<br />
verstehen.<br />
Gebrauchsfertiges Handeln bildet den Rahmen für Prehension. Prehension<br />
scheint die Hand auf ihren zielgerichteten Gebrauch vorzubereiten,<br />
doch das ist nur ein Teil der Geschichte. Beim Musizieren bereiten wir<br />
uns zwar vor, aber wir können nicht zurück, wenn unsere Hand das angestrebte<br />
Ziel nicht erreicht. Wollen wir das korrigieren, müssen wir bereit<br />
sein und sogar wünschen, noch etwas länger bei einem Fehler zu verharren,<br />
um ganz zu verstehen, was an der ursprünglichen Vorbereitung<br />
falsch war. Das vollständige Szenario für eine die Fertigkeit verbessernde<br />
Übung besteht also aus folgenden drei Elementen: vorbereiten, Fehler<br />
erkunden, zur Form finden. In dieser Geschichte wird Gebrauchsfertigkeit<br />
nicht vorausgesetzt, sondern erst geschaffen.<br />
Die beiden Daumen<br />
Aus der Koordination entsteht Kooperation<br />
Ein bleibendes Merkmal des Handwerkers findet sich in der bildlichen<br />
Darstellung der Werkstatt. Diderot idealisierte auf den Tafeln zur Papierherstellung<br />
in L’Anglée die Kooperation. Die Menschen dort arbeiten<br />
harmonisch zusammen. Hat solche Zusammenarbeit eine körperliche<br />
Grundlage? In den Sozialwissenschaften ist man dieser Frage in jüngster<br />
Zeit meist im Zusammenhang mit Diskussionen um Altruismus nachgegangen.<br />
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob altruistisches Verhalten<br />
beim Menschen genetisch verankert ist. Ich möchte in eine andere<br />
Richtung fragen: Was könnte die Erfahrung körperlicher Koordination für<br />
diesoziale Kooperation bedeuten? Konkretisieren lässt sich diese Frage,<br />
indem wir erkunden, wie die beiden Hände koordiniert werden und miteinander<br />
kooperieren.<br />
Die Finger der Hand besitzen nicht alle die gleiche Kraft und Biegsamkeit,<br />
was deren Koordination erschwert. Das gilt selbst für die beiden<br />
Daumen, deren Fähigkeiten davon abhängen, ob man Rechts- oder Linkshänder<br />
ist. Wer ein hohes Niveau der Handfertigkeit entwickelt, kann<br />
diese Ungleichheit kompensieren. Finger und Daumen verrichten dann<br />
eine Arbeit, die andere Finger von sich aus nicht zu leisten vermögen.<br />
In der Wendung „eine helfende Hand“ findet diese physische Erfahrung<br />
ihren Ausdruck. Die kompensatorische Leistung der Hände legt den Gedanken<br />
nahe, dass brüderliche Kooperation nicht davon abhängt, ob die<br />
17<br />
David Sudnow: Ways of the<br />
Hand: A Rewritten Account.<br />
2. Ausg. Cambridge, Mass.:<br />
2001.<br />
Beteiligten über dieselben Fertigkeiten verfügen. Als Beispiel werde ich<br />
auch hier die Musik heranziehen, um die Koordination und Kooperation<br />
zwischen Ungleichen zu erforschen, aber statt der Streichinstrumente<br />
will ich das Klavier betrachten.<br />
* * *<br />
Die wechselseitige Unabhängigkeit der Hände ist beim Klavierspielen ein<br />
zentrales Thema, ebenso die wechselseitige Unabhängigkeit der Finger.<br />
Einfache Klaviermusik weist die Melodie häufig dem vierten und fünften<br />
Finger der rechten, die Begleitung dem vierten und fünften Finger der<br />
linken Hand zu, das heißt den jeweils schwächsten Fingern. Diese Finger<br />
müssen stärker werden, während der Daumen, der stärkste Finger an<br />
beiden Händen, lernen muss, seine Kraft zurückzuhalten. Anfängern gibt<br />
man meist gnädig Stücke zu spielen, die der rechten Hand eine größere<br />
Rolle zuweisen als der linken. Zu Beginn hat also der Klavierspieler bei<br />
der Koordinierung der Hände mit Problemen der Ungleichheit zu kämpfen.<br />
Beim Jazzpiano ist die körperliche Herausforderung noch größer. Der moderne<br />
Klavierjazz verteilt Melodie und Harmonie nur noch selten auf die<br />
beiden Hände, wie es beim Barrelhouse-Blues der Fall war. Die Rhythmen<br />
werden heute vielfach mit der linken Hand statt wie früher mit der rechten<br />
gespielt. Als der Pianist und Philosoph David Sudnow Jazz zu spielen<br />
begann, entdeckte er, welche schwierigen Koordinationsprobleme sich<br />
dabei ergeben konnten. In seinem bemerkenswerten Buch Ways of the<br />
Hand berichtetder klassisch ausgebildete Sudnow, wie er sich in einen<br />
Jazzpianisten verwandelte. Anfangs schlug er einen Weg ein, der zwar<br />
logisch, aber dennoch falsch war. 17<br />
Wenn man auf dem Klavier Jazz spielt, muss die linke Hand häufiger zwischen<br />
einer weiten Spreizung der Finger und einer engen Fingerstellung<br />
abwechseln, um die für diese Kunst typischen Harmonien zu erzeugen.<br />
Sudnow begann ganz logisch, indem er den Wechsel zwischen weiter und<br />
enger Fingerstellung übte. Entsprechend übte er auch mit der rechten<br />
Hand die schnelle seitliche Bewegung über weite Bereiche der Tastatur,<br />
die hüpfende Bewegung, die im traditionellen Jazz als stride bezeichnet<br />
wird. Im moderneren Jazz hält man das rhythmische Pulsieren im Fluss,<br />
indem man rasch in die höheren Lagen springt.<br />
Diese technischen Probleme in ihre Bestandteile aufzulösen erwies sich<br />
als kontraproduktiv. Die Zerlegung half ihm kaum, wenn es darum ging,<br />
mit der linken Hand die enge Fingerstellung zu realisieren und gleichzeitig<br />
mit der rechten in stride-Manier zu hüpfen. Und schlimmer noch, er<br />
übertrieb die Vorbereitung durch getrenntes Üben, und das kann tödlich<br />
für das Improvisieren sein. Weil er mit beiden Händen getrennt arbeitete,<br />
bekam er Schwierigkeiten mit den Daumen. Die Daumen sind für den<br />
Jazzpianisten die wertvollsten Finger, seine Anker auf der Tastatur. Aber
234 — 235<br />
Richard Sennett<br />
18<br />
Ebda., S. 84.<br />
19<br />
Zu einer interessanten<br />
Diskussion dieses<br />
Phänomens siehe Julie<br />
Lyonn Lieberman: The<br />
Slide, Strad 116 (Juli<br />
2005), S. 69.<br />
20<br />
Siehe Michael C.<br />
Corballis: The Lopsided<br />
Ape: Evolution of the<br />
Generative Mind. New<br />
York 1991.<br />
21<br />
Yves Guiard: Asymmetric<br />
Division of Labor in<br />
Human Bimanual Action,<br />
Journal of Motor Behavior<br />
19, Nr. 4 (1987), S.<br />
488–502.<br />
nun, da sie der Verankerung von Schiffen unterschiedlicher Größe dienen<br />
sollten, die jeweils auch noch ihren eigenen Kurs steuerten, konnten die<br />
beiden Daumen nicht mehr zusammenarbeiten.<br />
Sudnow hatte ein Heureka-Erlebnis, als er entdeckte, dass „eine einzige<br />
Note vollkommen ausreichte“, um ihm Orientierung zu bieten. „Man<br />
konnte eine Note während der Dauer eines Akkords spielen und eine weitere<br />
gleich danach für die Dauer des nächsten Akkords, und so ließ sich<br />
die Melodie spielen.“ 18 Technisch heißt dies, dass alle Finger wie Daumen<br />
zu arbeiten und die beiden Daumen miteinander zu interagieren beginnen,<br />
wobei sie im Bedarfsfall die Rolle des jeweils anderen übernehmen.<br />
Nach diesem Heureka-Erlebnis veränderte Sudnow seine Übungspraxis.<br />
Er benutzte nun alle Finger als echte Partner. Wenn einer der Finger<br />
zu schwach oder zu stark war, bat er einen anderen, die Aufgabe<br />
zu übernehmen. Fotografien, die Sudnow beim Spielen zeigen, dürften<br />
konventionelle Klavierlehrer mit Entsetzen erfüllen. Er wirkt vollkommen<br />
verdreht. Doch wenn man ihn hört, spürt man die Leichtigkeit seines<br />
Spiels. Und diese Leichtigkeit erzielte er, weil er beim Üben zu einem bestimmten<br />
Zeitpunkt die Koordination zum Ziel der Übung machte.<br />
Es gibt einen biologischen Grund, weshalb die Koordination ungleicher<br />
Glieder funktioniert. Das Corpus callosum verbindet den motorischen<br />
Kortex der linken Hirnhälfte mit dem der rechten. Über diese Verbindung<br />
werden Informationen über die Steuerung der Körperbewegungen<br />
zwischen beiden Hirnhälften ausgetauscht. Das gesonderte Üben beider<br />
Hände führt zu einer Schwächung dieses Austauschs. 19<br />
Auch die Kompensation besitzt eine biologische Grundlage. Man hat<br />
Homo sapiens als den „asymmetrischen Affen“ bezeichnet. 20 Die physische<br />
Prehension ist asymmetrisch. Wir greifen eher mit einer bestimmten<br />
Hand nach Dingen – die meisten Menschenmit der rechten. Bei dem von<br />
Mary Marzke beschriebenen Korbgriff hält die schwächere Hand den<br />
Gegenstand, während die stärkere ihn bearbeitet. Der französische Psychologe<br />
Yves Guiardhat untersucht, wie man dieser Asymmetrie begegnen<br />
kann, und ist dabei zu überraschenden Ergebnissen gelangt. 21 Die<br />
Stärkung der schwächeren Hand gehört, wie zu erwarten, dazu, aber dies<br />
allein reicht nicht aus, um der schwächeren Hand größere Geschicklichkeitzu<br />
verleihen. Vielmehr muss die stärkere Hand ihre Stärke neu kalibrieren,<br />
damit die schwächere Hand größere Geschicklichkeit entwickeln<br />
kann. Dasselbe gilt für die Finger. Der Zeigefinger etwa muss lernen, wie<br />
der Ringfinger zu denken, um „aushelfen“ zu können. Ebenso die beiden<br />
Daumen. Wir hören, dass Sudnows beide Daumen zusammenarbeiten,<br />
doch physiologisch hält der stärkere Daumen seine Spannkraft zurück.<br />
Das ist noch wichtiger, wenn der Daumen dem schwachen Ringfinger beispringt.<br />
Dann muss er sich wie ein Ringfinger verhalten. Ein Arpeggio zu<br />
spielen, bei dem der starke linke Daumen dem schwächeren kleinen Finger<br />
der rechten Hand zu Hilfe kommt, ist wohl die physisch anspruchsvollste<br />
Aufgabe bei der kooperativen Koordination.<br />
22<br />
Zu dieser Geschichte<br />
siehe Michael Symons:<br />
A History of Cooks and<br />
Cooking. London 2001,<br />
S. 144.<br />
23<br />
Norbert Elias: Über den<br />
Prozeß der Zivilisation, 2<br />
Bde. Frankfurt am Main<br />
1976, Bd. 1, S. 164.<br />
Die Koordination der Hände macht deutlich, wie falsch die Vorstellung<br />
ist, wonach man technische Beherrschung erlangt, indem man von den<br />
Teilen zum Ganzen fortschreitet. Zuerst perfektioniert man jede Teilfähigkeit<br />
gesondert und setzt die Teile anschließend zusammen – als<br />
glichen technische Fertigkeiten der industriellen Fließbandproduktion.<br />
Die Koordinierung der Hände funktioniert nur schlecht, wenn man sie auf<br />
diese Weise organisiert und sie aus gesonderten individualisierten Tätigkeiten<br />
zusammenzusetzen versucht. Weit besser funktioniert sie, wenn<br />
beide Hände von Anfang an zusammenarbeiten.<br />
Das Arpeggio bietet uns auch Aufschluss über jene Brüderlichkeit, die<br />
Diderot wie nach ihm auch Saint-Simon, Fourier und Robert Owen idealisierte:<br />
die Brüderlichkeit von Menschen, die über dieselben Fähigkeiten<br />
verfügen. Deren Bindung wird erst dann wirklich auf die Probe gestellt,<br />
wenn sie erkennen, dass sie diese Fähigkeit in unterschiedlichem Maße<br />
besitzen. Die „brüderliche Hand“ steht für die Zurückhaltung der stärkeren<br />
Finger, in der Yves Guiard das entscheidende Moment bei der<br />
physischen Koordination erblickt. Findet auch dieser Umstand seine Widerspiegelung<br />
im sozialen Bereich? Der Hinweis lässt sich weiter klären,<br />
wenn wir die Rolle des minimalen Kraftaufwands bei der Entwicklung von<br />
Handfertigkeiten besser verstehen.<br />
Hand – Handgelenk – Unterarm<br />
Die Lehre des minimalen Kraftaufwands<br />
Zur Klärung des minimalen Kraftaufwands wollen wir einen Blick auf eine<br />
andere qualifizierte Handarbeit werfen, die des Kochs.<br />
Archäologen haben geschärfte, zum Schneiden bestimmte Steine gefunden,<br />
die 2,5 Millionen Jahre alt sind. Bronzemesser wurden schon vor<br />
mindestens 6000 Jahren, Messer aus Schmiedeeisen vor mindestens<br />
3500 Jahren hergestellt. 22 Eisen ließ sich besser gießen als Bronze,<br />
und die daraus hergestellten Messer ließen sich leichter schärfen. Die<br />
heutigen, aus gehärtetem Stahl hergestellten Messer erfüllen die Grundanforderung<br />
der Schärfe. Das Messer galt, wie der Soziologe Norbert<br />
Elias bemerkt, immer schon als „ein gefährliches Instrument“, als „eine<br />
Angriffswaffe“, die in Friedenszeiten in allen Kulturen mit einer „Unzahl<br />
von Verboten oder Tabus“ belegt wurde, vor allem wenn es im Haushalt<br />
Verwendungfand. 23 Wenn wir den Tisch decken, legen wir deshalb das<br />
Messer so, dass die Schneide zum Teller zeigt und nicht nach außen, wo<br />
sie eine Gefahr für unseren Tischnachbarn darstellen könnte.<br />
Wegen seiner potenziellen Gefährlichkeit wird das Messer und dessen<br />
Gebrauch seit langem schon symbolisch mit Selbstbeherrschung assoziiert.<br />
So rät C. Calviac in seinem Traktat Civilité von 1560, das Kind<br />
solle „sein Fleisch auf dem Schneidbrett in kleine Stücke schneiden“ und<br />
die Stücke dann „mit der rechten Hand …und nur mit drei Fingern“ zum<br />
Munde führen. Dieses Verhalten sollte an die Stelle der früheren Praxis
236 — 237<br />
Richard Sennett<br />
24<br />
Ebda., S. 119–121.<br />
25<br />
David Knechtges: A<br />
Literary Feast: Food in<br />
Early Chinese Literature,<br />
Journal of the American<br />
Oriental Society 106<br />
(1986), S. 49–63.<br />
treten, bei der man ein großes Stück Nahrung mit dem Messer aufspießte<br />
und zum Mundführte, so dass man ein Stück davon abbeißen konnte.<br />
Calviac kritisiert diese Essweise nicht nur, weil dabei Saft über das Kinntropfen<br />
konnte und weil man Gefahr lief, Ausflüsse der Nase mitzuessen,<br />
sondern auch, weil sie keinerlei Anzeichen von Selbstbeherrschung darstelle.<br />
24<br />
Am chinesischen Esstisch ersetzen die Stäbchen als Symbol der Friedfertigkeit<br />
schon seit Jahrtausenden das Messer. Damit kann man kleine<br />
mundgerechte Stücke Nahrung auf jene hygienische und disziplinierte<br />
Weise aufnehmen, die Calviac vor 500 Jahren empfahl. Der chinesische<br />
Koch stand vor dem Problem, wie er die Nahrung zubereiten konnte, so<br />
dass sie sich mit den friedfertigen Stäbchen statt mit dem barbarischen<br />
Messer verzehren ließ. Die Lösung liegt zum Teil in der Tatsache, dass es<br />
beim Messer als Tötungsinstrument vor allem auf die geschärfte Spitze<br />
ankommt, beim Messer als Werkzeug des Kochs dagegen auf die scharfe<br />
Schneide. Als China während der Tschou-Dynastie in das Zeitalter des<br />
Schmiedeeisens eintrat, entstanden Spezialmesser, die ausschließlich<br />
für das Kochen bestimmt waren, darunter vor allem das Hackmesser mit<br />
seiner rasiermesserscharfen Schneide und der rechteckig abgeschnittenen<br />
Spitze.<br />
Seit der Tschou-Dynastie und bis in unsere Zeit sind chinesische<br />
Küchenchefs stolz darauf, das Hackmesser als Allzweckwerkzeug einzusetzen<br />
und Fleisch in Stücke (hsiao) oder Scheiben (tsu) zu zerlegen oder<br />
zu Hackfleisch (hui) zu verarbeiten, während weniger geschickte Köche<br />
dazu verschiedene Messer verwenden. Das Tschuang-tzu, ein früher<br />
taoistischer Text, preist den Koch Ting, der mit dem Hack messer „die<br />
Lücken in den Gelenken“ zu finden und ein Tier daher so fein zu zerlegen<br />
vermochte, dass der Mensch alle essbaren Teile verzehren konnte. 25 Der<br />
mit dem Hackmesser arbeitende Koch zerlegte Fisch und Gemüse mit<br />
größter Präzision und sorgte so für die größtmögliche Verwertung der<br />
Nahrung. Er schnitt Fleisch und Gemüse in gleich große Teile, so dass<br />
man sie im selben Topf garen konnte. Das Geheimnis dieser Kunst liegt<br />
in der Berechnung des minimalen Kraftaufwands durch die Technik des<br />
Fallenlassens und der Entlastung.<br />
Die alte Hackmessertechnik basierte auf derselben Wahl, die heute ein<br />
Zimmermann treffen muss, wenn er einen Nagel in Holz einschlägt. Eine<br />
Möglichkeit besteht darin, den Daumen an die Seite des Hammerstiels<br />
zu legen und das Werkzeug auf diese Weise zu führen. Die Kraft für den<br />
Schlag kommt dann allein aus dem Handgelenk. Oder er legt den Daumen<br />
um den Stiel. Dann liefert der ganze Unterarm die Kraft. Entscheidet<br />
ein Heimwerker sich für die zweite Möglichkeit, erhöht er die rohe Kraft<br />
des Schlages, läuft aber auch Gefahr, nicht mehr so präzise zielen zu<br />
können. Der Koch im alten China wählte beim Gebrauch des Hackmessers<br />
die zweite Möglichkeit, doch um die Nahrung sehr fein zu schneiden,<br />
entwickelte er eine andere Art, Unterarm, Hand und Hackmesser einzu-<br />
setzen. Statt das Hackmesser wie einen Hammer zu benutzen, führte er<br />
die zu einer Einheit verschmolzene Verbindung aus Unterarm, Hand und<br />
Hackmesser vom Ellbogen her und ließ das Messer auf die zu zerteilende<br />
Nahrung fallen. Sobald die Schneide die Nahrung berührte, spannte er<br />
die Unterarmmuskeln an, um das Schneidgut vom Druck des Körpers zu<br />
entlasten.<br />
Der Küchenchef hat also den Daumen um den Griff des Hackmessers<br />
gelegt. Der Unterarm dient als Verlängerung des Griffs, der Ellbogen als<br />
Drehpunkt. Im Minimum liefert das Gewicht des fallenden Hackmessers<br />
die einzige Kraft und damit das Maß, das ausreicht, um weiche Nahrungsmittel<br />
zu schneiden, ohne sie zu zerquetschen – vergleichbar einem Klavierspieler,<br />
der pianissimo spielt. Rohe Nahrungsmittel können aber auch<br />
fester sein, so dass der Koch, um im Bild zu bleiben, lauter spielen, das<br />
heißt mehr Druck vom Ellbogen her ausüben muss, um ein kulinarisches<br />
forte hervorzubringen. Beim Schneiden von Nahrungsmitteln wie beim<br />
Anschlag eines Akkords liegt die Grundlinie der physischen Kontrolle, also<br />
deren Ausgangspunkt, in Berechnung und Einsatz der geringstmöglichen<br />
Kraft. Der Koch beginnt mit dem geringsten Krafteinsatz und verstärkt<br />
ihn bei Bedarf. Das hat er gelernt, weil er sich bemüht, das Schneidgut<br />
nicht zu beschädigen. Zerquetschtes Gemüse lässt sich nicht retten, doch<br />
wenn ein Stück Fleisch nicht beim ersten Schlag zerschnitten ist, kann<br />
man einenzweiten, kräftigeren Schlag ansetzen.<br />
Der Gedanke des minimalen Krafteinsatzes als Grundlinie der Selbstbeherrschung<br />
findet sich auch in dem apokryphen, aber vollkommen logischen<br />
Rat der alten chinesischen Kochkunst, wonach der Koch erst einmal<br />
lernen müsse, ein gekochtes Reiskorn mit dem Hackmesser zu zerlegen.<br />
Bevor wir den Implikationen dieser handwerklichen Regel nachgehen,<br />
müssen wir zunächst ein physisches Korrelat zur minimalen Kraftanwendung<br />
besser verstehen, und zwar die Entlastung. Wenn der Koch das<br />
Hackmesser nach dem Schlag unten hält wie der Zimmermann den Hammer,<br />
verhindert er das Zurückprallen des Werkzeugs. Dabei treten über<br />
die gesamte Länge des Unterarms Belastungen auf. Aus physiologischen<br />
Gründen, die wir noch nicht vollständig verstehen, erhöht die Fähigkeit,<br />
den Krafteinsatz innerhalb einer Millisekunde nach deren Anwendung abzubrechen,<br />
auch die Präzision der ausgeführten Geste. Sie verbessert die<br />
Zielsicherheit. Beim Klavierspielen etwa, wo das Niederdrücken und Loslassen<br />
der Taste eine einzige Bewegung darstellt, muss der Fingerdruck in<br />
dem Augenblick abbrechen, da die Fingerspitze die Taste berührt, damit<br />
die Finger leicht und geschmeidig zur nächsten Taste gleiten können. Bei<br />
Saiteninstrumenten vermag die Hand beim Übergang zu einer neuen Note<br />
nur dann einen sauberen Ton hervorzubringen, wenn sie die gedrückte<br />
Saite eine Mikrosekunde vorher loslässt. Für die musizierende Hand sind<br />
klare, leise Töne daher schwieriger hervorzubringen als laute, kräftige.<br />
Das Schlagen beim Kricket oder Baseball erfordert ein ähnliches Geschick<br />
bei der Druckentlastung.
238 — 239<br />
Richard Sennett<br />
26<br />
John Stevens: Zen Bow,<br />
Zen Arrow: The Life and<br />
Teachings of Awa Kenzo.<br />
London 2007.<br />
27<br />
Elias: Der Prozeß der Zivilisation,<br />
Bd. 1, S. 166.<br />
In der Bewegung der Einheit aus Hand, Handgelenk und Unterarm<br />
spielt die Prehension bei der Druckentlastung eine entscheidende<br />
Rolle. Sie erfordert dieselbe Antizipation wie beim Greifen nach einer<br />
Tasse, nur in umgekehrter Reihenfolge. Schon wenn der Schlag unmittelbar<br />
bevorsteht, bereitet das Ensemble aus Hand und Unterarm sich<br />
auf den nächsten Schritt vor, die Druckentlastung in der Millisekunde<br />
unmittelbar vor dem Kontakt. Zu der von Raymond Tallis beschriebenen<br />
Berücksichtigung des Objekts kommt es genau in diesem Schritt,<br />
wenn das Arm-Ensemble die Griffspannung zurücknimmt, so dass der<br />
Hammer oder das Hackmesser nicht mehr so fest gehalten wird.<br />
Der Rat, ein gekochtes Reiskorn mit dem Hackmesser zu zerlegen,<br />
steht also für zwei eng miteinander verbundene körperbezogene Regeln:<br />
Schaffe eine Grundlinie des geringsten nötigen Krafteinsatzes!<br />
Und lerne loszulassen! In technischer Hinsicht geht es hier um die Kontrolle<br />
von Bewegungen, doch der Vorgang hat eine Vielzahl menschlicher<br />
Implikationen – mit denen die antiken Autoren der chinesischen<br />
Kochkunst vertraut waren. Das Tschuangtzu rät, sich in der Küche<br />
nicht wie ein Krieger aufzuführen, und der Taoismus knüpft daran<br />
eine ganze Ethik für Homo faber: Ein aggressiver, auf das Brechen von<br />
Widerständen ausgerichteter Umgang mit natürlichen Materialien ist<br />
kontraproduktiv. Der japanische Zen-Buddhismus nutzte dieses Erbe<br />
später, um am Beispiel des Bogenschießens die Ethik des Loslassens<br />
zu erkunden. In physischer Hinsicht steht im Mittelpunkt dieses Sports<br />
dieS pannungsentlastung beim Loslassen der Bogensehne. Zen-<br />
Autoren betonen das Fehlen jeglicher physischen Aggression und die<br />
gelassene Ruhe, die diesen Augenblick kennzeichnen müssen. Dieser<br />
Gemütszustand sei notwendig, wenn der Bogenschütze dasZiel genau<br />
treffen wolle. 26<br />
Auch in westlichen Gesellschaften diente der Gebrauch des Messers als<br />
kulturelles Symbol für ein Minimum an Aggression. Norbert Elias fand<br />
heraus, dass die Europäer die Gefahren des Messers im Frühmittelalter<br />
recht pragmatisch einschätzten. Der von ihm so genannte „Prozeß der<br />
Zivilisation“ begann, als das Messer eine stärker symbolische Bedeutung<br />
erhielt, die dem kollektiven Denken sowohl das Übel spontaner<br />
Gewalt als auch die geeigneten Heilmittel dagegen vor Augen führte.<br />
„Die Gesellschaft, die in dieser Zeit mehr und mehr die reale Bedrohung<br />
der Menschen einzuschränken… beginnt, umgibt mehr und mehr auch<br />
die Symbole, die Gesten und Instrumente der Bedrohung mit einem<br />
Zaun“, schreibt Elias. „Die Einschränkungen, die Verbote um den Gebrauch<br />
des Messers, mit ihnen die Zwänge, die man dem Einzelnen<br />
auferlegt, wachsen.“ 27 Damit meint er zum Beispiel, dass man um 1400<br />
Messerstechereien bei Gastmählern als normal empfand, während<br />
man um 1600 die Stirn darüber runzelte. Oder auch, dass ein Mann um<br />
1600 nicht gleich die Hand an den Knauf seines Degens legte, wenn er<br />
nachts auf der Straße einem Fremden begegnete.<br />
28<br />
Ebda., Bd. 2, S. 398.<br />
Ein „wohlerzogener“ Mensch disziplinierte seinen Körper in den elementarsten<br />
biologischen Bedürfnissen – im Unterschied zu Flegeln, Tölpeln<br />
und Bauern, die angeblich ungeniert furzten oder sich die laufende Nase<br />
am Ärmel abwischten. Eine Folge solcher Selbstbeherrschung war die<br />
Entlastung der Menschen von aggressiver Spannung. Der Umgang des<br />
Kochs mit dem Hackmesser macht diese sonderbare Aussage verständlicher:<br />
Selbstbeherrschung geht mit Entlastung einher.<br />
Als Elias die Entstehung der höfischen Gesellschaft im 17. Jahrhundert<br />
untersuchte, stellte er erstaunt fest, dass diese Verknüpfung zum Definitionsmerkmal<br />
des gesitteten Aristokraten geworden war: entspannt im<br />
Umgang mit anderen und selbstbeherrscht. Richtig zu essen war eine der<br />
sozialen Fertigkeiten des Aristokraten. Dass die Tischmanieren zum Kennzeichen<br />
des Aristokraten wurden, war deshalb möglich, weil die Gefahr<br />
körperlicher Gewalt in der auf Höflichkeit bedachten Gesellschaft abnahm<br />
und die gefährlichen Fertigkeiten, die mit dem Messer assoziiert wurden,<br />
an Bedeutung verloren. Als sich im 18. Jahrhundert das bürgerliche Leben<br />
entwickelte, stieg der Kodex eine soziale Stufe hinab und veränderte<br />
nochmals seinen Charakter. Gelassene Zurückhaltung wurde nun zum<br />
Kennzeichen der von den Philosophen gefeierten „Natürlichkeit“. Der Tisch<br />
und die dort herrschenden Manieren taugten auch weiterhin als Mittel der<br />
gesellschaftlichen Abgrenzung. So beachtete man in der Mittelschicht die<br />
Regel, wonach man nur solche Speisen mit dem Messer schneiden soll,<br />
die sich nicht mit der stumpferen, aber feineren Kante der Gabel zerlegen<br />
lassen, und man schaute auf die niederen Stände herab, die das Messer<br />
wie einen Spieß benutzten.<br />
Elias ist ein bewundernswerter Historiker, aber ich fürchte, als Analytiker<br />
des sozialen Lebens, das er so lebendig beschreibt, irrt er. Er behandelt<br />
zivilisiertes Verhalten als ein dünnes Furnier, unter dem ein solideres und<br />
persönlicheres Erleben liege: die Scham, der wirkliche Katalysator der<br />
Selbstdisziplin. Seine Geschichten über das Rotzen, Furzen und Pinkeln<br />
in der Öffentlichkeit und die Entwicklung der Tischsitten haben ihren Ursprung<br />
sämtlich in der Scham hinsichtlich natürlicher Körperfunktionen<br />
und deren spontanem Ausdruck. Der „Prozeß der Zivilisation“ unterdrückt<br />
Spontaneität. Elias sieht in der Scham eine nach innen gerichtete Emotion.<br />
„Dem entspricht“, so schreibt er, „daß die Angst, die wir ›Scham‹<br />
nennen, für die Sicht der Anderen in hohem Maße abgedämpft ist; so stark<br />
sie sein mag, sie kommt nicht unmittelbar in lauten Gesten zum Ausdruck<br />
…; der Konflikt, der sich in ›Scham-Angst‹ äußert …, ist ein Konflikt seines<br />
eigenen Seelenhaushalts; er selbst erkennt sich als unterlegen an.“ 28<br />
Im Blick auf die Aristokraten klingt das ein wenig falsch, während es<br />
auf die Manieren der Mittelschicht schon eher zutreffen könnte. Das ist<br />
jedoch keine Erklärung, die sich auf die entspannte Leichtigkeit oder die<br />
Selbstbeherrschung anwenden ließe, nach denen der Handwerker strebt.<br />
Nicht Scham veranlasst ihn, den minimalen Krafteinsatz und die zeitgerechte<br />
Entlastung zu erlernen. Schon rein physisch kann er unmöglich
240 — 241<br />
Richard Sennett<br />
29<br />
Eine Darstellung des<br />
Konflikts zwischen Powells<br />
und Rumsfelds Strategien<br />
in dem von Amerika 2003<br />
im Irak begonnenen Krieg<br />
findet sich in Michael R.<br />
Gordon und Bernard E.<br />
Trainor: Cobra II. New York<br />
2006.<br />
davon getrieben sein. Es gibt in der Tat eine Physiologie der Scham, die<br />
sich durch die Anspannung der Muskeln in der Bauchdecke und an den<br />
Armen erkennen lässt. Scham, Angst und Muskelanspannung bilden im<br />
menschlichen Organismus eine unheilige Dreifaltigkeit. Die Physiologie<br />
der Scham stünde der Freiheit körperlicher Bewegung im Wege, die der<br />
Handwerker für seine Arbeit benötigt. Muskelanspannung ist tödlich für<br />
physische Selbstbeherrschung. Positiv ausgedrückt, wenn die Muskeln<br />
kräftiger und ihre Bewegungen feiner werden, fallen die zur Anspannung<br />
der Muskeln führenden Reflexe nicht mehr so stark aus. Die physische<br />
Aktivität wird geschmeidiger und weniger sprunghaft. Deshalb können<br />
körperlich starke Menschen den minimalen Krafteinsatz besser steuern<br />
als körperlich schwächere. Bei ihnen hat sich ein Gradient der Muskelkraft<br />
herausgebildet. Gut entwickelte Muskeln sind außerdem eher in der Lage,<br />
sich zu entspannen. Sie behalten ihre Form selbst dann, wenn sie loslassen.<br />
Auch der Handwerker des Wortes könnte diese mental gar nicht mehr<br />
erkunden und gut nutzen, wenn er voller Angst wäre.<br />
Um Elias Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sollten wir einräumen, dass<br />
Selbstbeherrschung zwei Dimensionen besitzt. Die eine ist eine soziale<br />
Oberfläche, unter der sich persönliche Not verbirgt; die andere eine Realität,<br />
die mit sich selbst physisch und mental im Reinen ist und der Entwicklung<br />
der handwerklichen Fertigkeiten dient. Diese zweite Dimension<br />
hat ihre eigenen sozialen Implikationen.<br />
Militärische und diplomatische Strategien müssen ständig über Grade<br />
roher Gewalt urteilen. Die Strategen, die 1945 die Atombombe einsetzten,<br />
gelangten zu der Einschätzung, dass nur der überwältigende Einsatz<br />
von Gewalt die Japaner zur Kapitulation bewegen konnte. In der aktuellen<br />
Militärstrategie der Vereinigten Staaten setzt die „Powell-Doktrin“ auf die<br />
Einschüchterung durch eine große Zahl von Soldaten, während die Doktrin<br />
des Shock and Awe Technologie an die Stelle der Soldaten setzt – einen<br />
massiven und überfallartigen Einsatz automatischer Raketen und lasergesteuerter<br />
Bomben. 29 Der Politikwissenschaftler und Diplomat Joseph<br />
Nye hat einen alternativen Ansatz vorgeschlagen, den er als „soft power“<br />
(weiche Macht) bezeichnet und der eher dem Vorgehen eines erfahrenen<br />
Handwerkers ähnelt. Bei der Koordination der Hände geht es um die Ungleichheit<br />
der Kraftentfaltung. Wenn Hände ungleicher Stärke zusammenarbeiten,<br />
korrigieren sie die Schwäche. Eine zurückhaltende Kraft nach<br />
Art des Handwerkers, gepaart mit Entspannung, bedeutet einen weiteren<br />
Schritt. Durch die Kombination beider Momente entwickelt der Handwerker<br />
physische Selbstbeherrschung und erzielt eine höhere Präzision in der<br />
Ausführung. Blinde, rohe Gewalt ist bei der Handarbeit kontraproduktiv.<br />
All diese Elemente – Kooperation mit dem Schwachen, zurückhaltende<br />
Kraft, Loslassen nach dem Angriff – sind im Konzept der soft power enthalten.<br />
Diese Doktrin versucht gleichfalls, kontraproduktive blinde Gewalt<br />
zu überwinden. Das handwerkliche Können ist hier Bestandteil des politischen<br />
Handwerks, der Staatskunst.<br />
30<br />
Siehe z. B. Neil Postman:<br />
Amusing Ourselves to<br />
Death: Public Discourse in<br />
the Age of Show Business.<br />
New York 1985; dt.: Wir<br />
amüsieren uns zu Tode.<br />
Frankfurt am Main 1985.<br />
31<br />
Daniel Levitin: This Is Your<br />
Brain on Music. New York<br />
2006, S. 193.<br />
Hand und Auge<br />
Der Rhythmus der Konzentration<br />
Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom beunruhigt gegenwärtig<br />
zahlreiche Lehrer und Eltern. Dabei geht es um Kinder und Jugendliche,<br />
die ihre Aufmerksamkeit nur für kurze Zeit auf einen Gegenstand zu<br />
richten vermögen. Als Ursache gelten einerseits Störungen des Hormonhaushalts,<br />
andererseits kulturelle Faktoren. Zu den kulturellen Faktoren<br />
sichtete der Soziologe Neil Postman umfangreiche Forschungen über die<br />
negativen Auswirkungen des Fernsehens auf Kinder. 30 Qualifikationsforscher<br />
definieren die Aufmerksamkeitsspanne jedoch oft in einer Weise,<br />
die kaum adäquat auf solche Befürchtungen von Erwachsenen eingehen<br />
dürfte.<br />
Wie zu Beginn des Buches schon angemerkt, wird oft behauptet, man brauche<br />
10 000 Stunden, um ein Experte zu werden. In Studien über „Komponisten,<br />
Basketballspieler, Science-Fiction-Autoren, Eiskunstläufer … und<br />
Meisterdiebe“, so schreibt der Psychologe Daniel Levitin, „wird diese Zahl<br />
immer wieder genannt“. 31 Dieser lange Zeitraum ist nach Ansicht von Forschern<br />
erforderlich, damit komplexe Fertigkeiten sich dem Körper so tief<br />
einprägen, dass sie zu ständig abrufbarem implizitem Wissen werden. Aber<br />
so gewaltig ist die Zahl eigentlich gar nicht – wenn wir von den Meisterdieben<br />
einmal absehen. 10 000 Stunden, das sind drei Stunden Übung am<br />
Tag über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg, und das entspricht dem<br />
üblichen Trainingspensum junger Sportler. Bei der siebenjährigen Lehrzeit<br />
mittelalterlicher Goldschmiedeverteilt sich die Summe auf knapp fünf<br />
Stunden täglich an der Werkbank, und das entspricht dem, was wir aus<br />
mittelalterlichen Werkstätten wissen. Unter den strapaziösen Bedingungen<br />
der ärztlichen Ausbildung in Krankenhaus und Praxis lässt sich diese<br />
Stundenzahl auf drei Jahre oder noch weniger komprimieren.<br />
Die Besorgnis der Erwachsenen hinsichtlich des Aufmerksamkeitsmangels<br />
betrifft eine sehr viel kürzere Zeitspanne. Dort stellt sich das Problem,<br />
wie man ein Kind dazu bringen kann, sich auch nur eine Stunde lang zu<br />
konzentrieren. Pädagogen versuchen oft, Kinder geistig und emotional für<br />
bestimmte Dinge zu interessieren, um ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.<br />
Die Theorie, auf der solche Versuche basieren, besagt, dass ein<br />
inhaltliches Engagement zur Konzentration führt. Die langfristige Entwicklung<br />
manueller Fertigkeiten zeigt jedoch die Kehrseite dieser Theorie. Die<br />
Fähigkeit, sich über längere Zeit zu konzentrieren, stellt die Voraussetzung<br />
dar. Erst wenn jemand dies kann, wird er sich geistig oder emotional auf<br />
etwas einlassen. Die Fähigkeit der physischen Konzentration folgt eigenen<br />
Regeln, die darauf basieren, wie jemand lernt, eine Tätigkeit zu üben, sie<br />
ständig zu wiederholen und aus dieser Wiederholung zu lernen. Konzentration<br />
besitzt also eine innere Logik, und diese Logik lässt sich, wie ich<br />
glaube, auf das stetige Arbeiten anwenden, ob es sich dabei nun um eine<br />
Stunde oder um mehrere Jahre handelt.
242 — 243<br />
Richard Sennett<br />
32<br />
Erin O’Connor: Embodied<br />
Knowledge: The Experience<br />
of Meaning and the<br />
Struggle towards Proficiency<br />
in Glassblowing, Ethnography<br />
6, Nr. 2 (2005), S.<br />
183–204.<br />
Zur Klärung dieser Logik können wir das Verhältnis zwischen Hand und Auge<br />
weiter erkunden. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Organen erlauben<br />
es, den Übungsprozess dauerhaft zu organisieren. Wir könnten keine bessere<br />
Anleitung finden als Erin O’Connors Analyse des Prozesses, in dem Hand<br />
und Auge gemeinsam lernen, sich zu konzentrieren. 32 Die philosophische<br />
Glasbläserin untersuchte die Entwicklung lang anhaltender Aufmerksamkeit<br />
an ihrem eigenen Kampf um die Formung eines bestimmten Weinglases. In<br />
einer nüchternen Fachzeitschrift berichtet sie, dass sie seit langem italienische<br />
Barolo-Weine geschätzt und daher nach einem Weinglas gesucht habe,<br />
das groß und rund genug war, die duftende „Nase“ des Weins zu fassen.<br />
Um dieses Ziel zu erreichen, musste sie ihre Konzentrationsfähigkeit in ihrer<br />
zeitlichen Dauer erweitern. Den Rahmen für diesen Lernprozess bildete der<br />
kritische Augenblick im Handwerk des Glasblasens, wenn das geschmolzene<br />
Glas als großer Tropfen am Ende des langen, schmalen Blasrohrs hängt. Das<br />
zähflüssige Glas muss ständig gedreht werden, damit es nicht in eine Richtung<br />
herunterhängt. Um eine regelmäßige Kugel zu erzeugen, müssen die<br />
Hände eine Bewegung ausführen,die dem schnellen Drehen eines Löffels in<br />
einem Glas Honig gleicht. Der ganze Körper ist an dieser Bewegung beteiligt.<br />
Damit es beim Drehen der Glasbläserpfeife nicht zu Verspannungen kommt,<br />
muss der Glasbläser den Rücken über der Hüfte und nicht im oberen Bereich<br />
beugen, ähnlich einem Ruderer, der sich vor dem Beginn des Zugs nach vorn<br />
beugt. Diese Haltung verleiht dem Handwerker auch einen sicheren Stand,<br />
wenn er das geschmolzene Glas aus dem Ofen zieht. Doch von entscheidender<br />
Bedeutung ist das Verhältnis zwischen Hand und Auge.<br />
Als O’Connor lernte, ein Barolo-Glas zu blasen, durchlief sie mehrere Stadien<br />
ähnlich jenen, die wir bei Musikern und Köchen beobachtet haben. Zunächst<br />
musste sie einige beim Blasen einfacherer Stücke erworbene Gewohnheiten<br />
rückgängig machen, damit sie erkennen konnte, weshalb sie scheiterte.<br />
So entdeckte sie, dass die Bewegungen ihr bisher deshalb so leichtgefallen<br />
waren, weil sie zu wenig geschmolzenes Glas mit der Spitze der Pfeife<br />
aufnahm. Sie musste ein besseres Bewusstsein für das Verhältnis zwischen<br />
ihrem Körper und der zähflüssigen Masse entwickeln, als bestünde zwischen<br />
Fleisch und Glas ein bruchloser Übergang. Das klingt poetisch, doch<br />
diese Poesie dürfte rasch verflogen sein, wenn ihr Mentor lautstark seine<br />
Kommentare dazwischenrief: „Mach langsam, Trampel, ganz gleichmäßig!“<br />
O’Connor ist eine zierliche, zurückhaltende Person, und so nahm sie lieber<br />
keinen Anstoß an solchen Einwürfen. Ihre Koordination verbesserte sich<br />
dadurch.<br />
Nun war sie eher in der Lage, die Triade der „intelligenten Hand“ zu nutzen<br />
– die Koordination von Hand, Auge und Gehirn. Ihr Lehrer drängte: „Lass<br />
das Glas nicht aus dem Blick! Es beginnt schon zu hängen.“ Das hatte zur<br />
Folge, dass sie den Griff um das Rohr lockerte. Wenn sie das Rohr lockerer<br />
hielt, etwa so wie der Koch das Hackmesser, gewann sie größere Kontrolle<br />
darüber. Doch sie musste immer noch lernen, ihre Konzentrationsspanne zu<br />
verlängern.<br />
33<br />
Ebda., S. 188–189.<br />
34<br />
Siehe Maurice Merleau-<br />
Ponty: Phénoménologie<br />
de la perception. Paris<br />
1945; dt.: Phänomenologie<br />
der Wahrnehmung.<br />
Berlin 1966, 2. Teil, §12.<br />
35<br />
Michael Polanyi:<br />
Personal Knowledge:<br />
Towards a Post-Critical<br />
Philosophy. Chicago<br />
1962, S. 55.<br />
Diese Verlängerung erfolgte in zwei Phasen. Zunächst verlor sie das<br />
ständige Bewusstsein für den Kontakt des Körpers mit dem heißen<br />
Glas und versenkte sich ganz in das Material als Ziel an sich. „Mein<br />
Bewusstsein für das Gewicht der Pfeife in meiner Hand nahm ab, und<br />
an dessen Stelle verstärkte sich die Empfindung für die Kante des<br />
Rings in der Mitte der Pfeife, für das Gewichtdes Glases, das sich an<br />
der Spitze der Pfeife sammelte, und schließlich für das sich formende<br />
Weinglas.“ 33 Der Philosoph Maurice Merleau-Ponty beschreibt die Erfahrung,<br />
„wie ein Ding zu sein“. 34 Der Philosoph Michael Polanyi bezeichnet<br />
dies als „fokales Bewusstsein“ und erläutert es am Beispiel<br />
des Einschlagens eines Nagels: „Wenn wir den Hammer niedergehen<br />
lassen, haben wir nicht das Gefühl, dass der Stiel unserer Handfläche<br />
einen Schlag versetzt, sondern der Hammerkopf dem Nagel … Ich habe<br />
ein Nebenbewusstsein für das Gefühl in meiner Handfläche, eingebunden<br />
in mein fokales Bewusstsein vom Einschlagen des Nagels.“ 35<br />
Anders ausgedrückt, wir sind ganz in etwas versunken und nicht mehr<br />
unserer selbst bewusst, auch nicht unseres körperlichen Selbst. Wir<br />
sind zu dem Ding geworden, an dem wir arbeiten.<br />
Diese vertiefte Konzentration musste nun zeitlich ausgedehnt werden.<br />
Das Problem, das O’Connor lösen musste, war das Ergebnis eines weiteren<br />
Scheiterns. Obwohl es ihrem durch eine gute Körperhaltung entspannten<br />
und in das Tun versenkten Selbst gelungen war, das Glas zu<br />
einer Kugel zu formen und in die gewünschte Barolo-freundliche Form<br />
zu bringen, wirkte es nach dem Abkühlen „schief und unförmig“, so<br />
dass ihr Lehrmeister statt von einem goblet (Pokal) von einem globlet<br />
(Kügelchen) sprach.<br />
Wie sie schließlich herausfand, lag das Problem in jener Phase des<br />
„Wie-ein-Ding-Seins“. Wollte sie besser werden, musste sie vorwegnehmen,<br />
wozu das Material in seiner nächsten, noch nicht existenten<br />
Entwicklungsphase werden sollte. Ihr Lehrer nannte das einfach „Dranbleiben“.<br />
In ihrer eher philosophischen Denkweise begriff sie, dass sie<br />
in einem Prozess „körperlicher Antizipation“ stand und dem Material<br />
– erst im schmelzflüssigen Zustand, dann als Kugel, dann als Kugel<br />
mit Stiel und schließlich mit Stiel und Fuß – stets einen Schritt voraus<br />
sein musste. Sie musste diese Prehension zu einem permanenten Geisteszustand<br />
machen, und sie lernte dies, erfolgreich oder scheiternd,<br />
indem sie immer wieder solch eine Kugel blies. Auch nach dem ersten,<br />
auf Zufall beruhenden Erfolg musste sie immer weiterüben, damit sie<br />
Sicherheit im Aufnehmen der Schmelze, im Blasen der Kugel und im<br />
Drehen des Rohrs entwickelte. Das ist Wiederholung um ihrer selbst<br />
willen. Wie bei den Zügen eines Schwimmers wird die bloße Wiederholung<br />
der Bewegung als solche zu einem Genuss.<br />
Wie Adam Smith in seiner Darstellung der Industriearbeit könnten wir<br />
nun meinen, Routine sei geisttötend und ein Mensch, der eine Tätigkeit<br />
ständig wiederholt, nehme psychisch Schaden. Wir könnten Routine mit
244 — 245<br />
Richard Sennett<br />
Langeweile gleichsetzen. Für Menschen, die komplizierte Handfertigkeiten<br />
entwickeln, ist sie nichts dergleichen. Etwas immer wieder zu tun ist<br />
anregend, sofern diese Tätigkeit im Blick nach vorn organisiert wird. Die<br />
Substanz der Routine mag sich verändern, wandeln oder verbessern, der<br />
emotionale Lohn aber ist die Erfahrung, es immer wieder zu tun. Diese<br />
Erfahrung ist keineswegs sonderbar. Wir alle kennen sie, und sie hat<br />
einen Namen: Rhythmus. Die Kontraktionen unseres Herzens gebenden<br />
Rhythmus vor, der Handwerker dehnt ihn auf Hand und Kopf aus.<br />
Der Rhythmus hat zwei Komponenten: Schlagen nach einem Takt und<br />
Tempo, also die Geschwindigkeit, mit der wir etwas tun. In der Musik<br />
steht der Tempowechsel innerhalb eines Stücks für Antizipation und<br />
den Blick nach vorn. Die Bezeichnungen ritardando und accelerando<br />
verpflichten den Musiker, sich auf einen Wechsel vorzubereiten. Diese<br />
großen Tempowechsel sorgen dafür, dass er in seiner Aufmerksamkeit<br />
nicht erlahmt. Dasselbe gilt für den Rhythmus im Kleinen. Wenn Sie<br />
einen Walzer streng nach dem Takt eines Metronoms spielen, wird es<br />
Ihnen immer schwerer fallen, sich darauf zu konzentrieren. Um einen<br />
regelmäßigen Takt zu schlagen, bedarf es winziger Verzögerungen und<br />
Beschleunigungen. Der regelmäßige Takt entspricht der im letzten Kapitel<br />
angesprochenen Typenform. Tempowechsel stehen dagegen für die<br />
verschiedenen Varianten, die aus solch einem Typus hervorgehen. Prehension<br />
hat ihren Fokus auf dem Tempo. Der Musiker konzentriert sich in<br />
produktiver Weise.<br />
Der Rhythmus, der O’Connors Aufmerksamkeit wachhielt, lag in ihrem<br />
Auge, das die Hand disziplinierte, sie ständig überwachte und beurteilte,<br />
ihre Bewegungen anpasste und damit das Tempo vorgab. Kompliziert<br />
wird die Sache dadurch, dass sie sich ihrer Hände nicht mehr bewusst<br />
war und dass sie nicht mehr darüber nachdachte, was die Hände taten.<br />
Ihr Bewusstsein war ganz darauf gerichtet, was sie sah. Die eingeschliffenen<br />
Handbewegungen waren Bestandteil des Vorausschauens geworden.<br />
Beim Orchester scheint der Dirigent dem Musiker nur ganz wenig voraus<br />
zu sein. Er zeigt den Ton an, und auch hier registriert der Ausführende<br />
das Signal eine Mikrosekunde, bevor er den Ton produziert.<br />
Ich fürchte, mein Darstellungsvermögen hat in der Beschreibung des<br />
Rhythmus und seiner Bedeutung für die Konzentration seine Grenzen<br />
erreicht, und ganz sicher klingt diese Erfahrung hier abstrakter, als sie in<br />
Wirklichkeit ist. Die Zeichen der Konzentration beim Üben einer Tätigkeit<br />
sind konkret genug. Wer es gelernt hat, sich ausreichend zu konzentrieren,<br />
zählt nicht, wie oft er eine Bewegung auf Befehl des Ohrs oder des<br />
Auges wiederholt. Wenn ich beim Cellospiel tief ins Üben versenkt bin,<br />
möchte ich eine Bewegung immer wieder ausführen, damit sie besser<br />
wird, aber auch damit ich sie immer wieder besser ausführen kann. Genauso<br />
ergeht es O’Connor. Sie zählt nicht, wie oft sie es tut, sie will nur<br />
die Glasbläserpfeife in Händen halten und sie drehen und hineinblasen.<br />
Doch das Tempo gibt ihr Auge vor. Wenn die beiden Elemente des Rhyth-<br />
mus sich beim Üben verbinden, kann der Übende seine Aufmerksamkeit<br />
über eine lange Zeitspanne aufrechterhalten und eine Verbesserung erreichen.<br />
Welche Bedeutung kommt hier dem Übungsstoff zu? Übt sich eine dreiteilige<br />
Invention von Johann Sebastian Bach besser als eine Etüde von<br />
Ignaz Moscheles, weil sie bessere Musik ist? Nach meiner Erfahrung<br />
lautet die Antwort nein. Der Rhythmus des Übens, der ein Gleichgewicht<br />
zwischen Wiederholen und Antizipieren herstellt, sorgt von sich aus für<br />
Engagement. Wer als Kind Latein oder Griechisch gelernt hat, dürfte eine<br />
ähnliche Erfahrunggemacht haben. Das Lernen war zu einem Großteil<br />
rein mechanisch und der Stoff sehr entlegen. Erst nach und nach half<br />
uns die Routine, die uns befähigte, Griechisch zu lernen, Interesse an<br />
einer seit langem verschwundenen Kultur zu entwickeln. Wie bei anderen<br />
Lernenden, die einen Stoff noch nicht inhaltlich erfasst haben, gilt es zunächst,<br />
sich konzentrieren zu lernen. Das Üben hat eine eigene Struktur<br />
und ein eigenes, darin angelegtes Interesse.<br />
Die praktische Bedeutung solcher fortgeschrittenen Handfertigkeit für<br />
Menschen, die mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom umzugehen<br />
haben, liegt darin, dass sie die Aufmerksamkeit auf die Organisation von<br />
Übungsstunden lenken. Mechanisches Lernen ist nicht an sich der Feind.<br />
Übungsstunden lassen sich interessant gestalten, wenn man darin für<br />
einen inneren Rhythmus sorgt, so kurz er auch sein mag. Die komplizierten<br />
Tätigkeiten des Glasbläsers oder des Cellisten lassen sich so vereinfachen,<br />
dass sie eine ähnliche zeitliche Strukturierung aufweisen. Wir<br />
erweisen Menschen, die unter mangelnder Aufmerksamkeit leiden, einen<br />
schlechten Dienst, wenn wir verlangen, dass sie eine Sache verstehen,<br />
bevor sie sich darauf einlassen.<br />
* * *<br />
Es mag der Eindruck entstehen, dass dieses Verständnis guten Übens<br />
der Verbindlichkeit zu geringe Bedeutung beimisst, doch ein verbindliches<br />
Engagement dieser Art hat zwei Seiten: die Entscheidung, dass eine<br />
Sache es wert sei, getan zu werden, oder dass eine bestimmte Person es<br />
wert sei, Zeit mit ihr zu verbringen; und die Pflicht, die wir gegenüber<br />
einer Sitte oder den Bedürfnissen eines Menschen empfinden. Der Rhythmus<br />
organisiert eine Verbindlichkeit im zweiten Sinne. Wir lernen, wie<br />
wir eine Pflicht immer wieder erfüllen. Theologen haben schon vor langer<br />
Zeit gezeigt, dass religiöse Rituale wiederholt werden müssen, wenn sie<br />
Überzeugungskraft erlangen sollen: Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr<br />
für Jahr. Die Wiederholung sorgt für Stabilität, doch in der religiösen<br />
Übung wird sie deshalb nicht schal. Der Zelebrierende antizipiert jedes<br />
Mal, dass etwas Bedeutendes geschehen wird.<br />
Ich spreche dieses weite Feld unter anderem deshalb an, weil das Üben<br />
beim Wiederholen einer musikalischen Phrase, beim Schneiden von
246 — 247<br />
Richard Sennett<br />
Fleisch oder beim Blasen eines Weinglases etwas von einem Ritual an<br />
sich hat. Wir haben unsere Hand durch das Wiederholen trainiert. Wir<br />
sind aufmerksam statt gelangweilt, weil wir die Fähigkeit der Antizipation<br />
entwickelt haben. Doch auch wer gelernt hat, einer Pflicht immer<br />
wieder nachzukommen, hat eine technische Fertigkeit erworben, das<br />
rhythmische Vermögen des Handwerkers, ganz gleich, an welchen Gott<br />
oder an welche Götter er glauben mag.<br />
* * *<br />
In diesem Kapitel bin ich ausführlich der Vorstellung einer Einheit von<br />
Kopf und Hand nachgegangen. Diese Einheit prägte die Ideale der Aufklärung<br />
im 18. Jahrhundert, und Ruskin gründete darauf im 19. Jahrhundert<br />
seine Verteidigung der Handarbeit. Dabei sind wir ihrem Weg allerdings<br />
nicht ganz gefolgt, denn wir haben Formen mentalen Verstehens<br />
skizziert, die aus der Entwicklung seltener und sehr spezieller manueller<br />
Fertigkeiten hervorgehen, wie sie erforderlich sind, um Töne genau zu<br />
treffen, ein Reiskorn mit dem Hackmesser zu zerlegen oder ein schwieriges<br />
Weinglas zu blasen. Doch auch solche virtuosen Fähigkeiten basieren<br />
auf grundlegenden Eigenschaften des menschlichen Körpers.<br />
Konzentration sorgt für die Vollendung bestimmter Linien in der Entwicklung<br />
manueller Fertigkeiten. Die Hand musste zunächst durch Berührung<br />
experimentieren, allerdings nach einem objektiven Maßstab. Sie lernte,<br />
Ungleiches zu koordinieren. Sie lernte minimalen Krafteinsatz und Entlastung.<br />
Dadurch erwirbt die Hand ein Repertoire erlernter Gesten. Diese<br />
Gesten lassen sich weiter verfeinern oder auch revidieren innerhalb des<br />
rhythmischen Prozesses, zu dem es beim Üben kommt und der das Üben<br />
unterstützt. Bei jedem dieser Schritte spielt Prehension eine wichtige-<br />
Rolle, und jeder Schritt hat zahlreiche ethische Implikationen.
250 — 251<br />
Think Global, Fabricate Local?<br />
Auf den Spuren des „schaffenden Menschen“<br />
in der Region Liezen<br />
Elke Murlasits<br />
Dreh- und Angelpunkt unseres Projektes war die Auseinandersetzung<br />
mit dem Menschen als Subjekt, als Gestalter/in und Akteur/in seines/<br />
ihres Lebens. Inspiration und Reverenz nahmen wir dafür beim Konzept<br />
der Vita activa, das Hannah Arendt in ihrem epochemachenden gleichnamigen<br />
Buch präzisiert. Drei „menschliche Grundtätigkeiten“ seien es, die<br />
die Vita activa ausmachen: das Arbeiten, Herstellen und Handeln.<br />
Wir haben uns speziell auf das Herstellen konzentriert, wobei die Grenzen<br />
der Idee des praktischen, des realen Schaffens erweitert wurden.<br />
Abseits tatsächlicher physischer Produkte rückte die das Leben an sich<br />
bestimmende Frage in den Vordergrund: Wozu etwas schaffen? Was ist<br />
der Sinn, der Nutzen, die Funktion des Herstellens? Welche zusätzliche<br />
Bedeutung wird dem Hergestellten, dem Geschaffenen zugewiesen? Was<br />
schafft sich der Mensch eigentlich? Was bedeutet das Geschaffene für<br />
andere bzw. wie nimmt es auf das Leben dieser anderen Einfluss?<br />
Sechs Künstler/innen-Formationen stellten sich diesen Fragen in einzelnen<br />
Kunstprojekten, die sie in engem Dialog gemeinsam mit und aus der<br />
Bevölkerung generierten. Dabei wurden sie von einem Team von Kulturwissenschafterinnen<br />
und -wissenschaftern begleitet, das die Gespräche<br />
mit den Menschen vor Ort intensivierte und erweiterte. Auf diese Art<br />
und Weise konnten auch vier zentrale Themenfelder in den Arbeiten der<br />
Künstler/innen festgemacht und in einem Ausstellungsteil präsentiert<br />
werden:<br />
a) Der schaffende Mensch als Gestalter/in seiner/ihrer Landschaft<br />
b) Der schaffende Mensch als Garant/in seiner/ihrer Sicherheit<br />
c) Der schaffende Mensch als Produzent/in seiner/ihrer zweiten Haut<br />
d) Der schaffende Mensch als Gestalter/in seiner/ihrer Lebensräume<br />
Der Mensch und die Landschaft<br />
Die Vorstellung der nicht von Menschenhand geformten Natur, der Landschaft<br />
als gewachsene physische Umwelt, als steingewordener Rahmen<br />
unseres Seins ist nicht erst seit der Einführung von Flussbettregulierungen<br />
und Autobahnen obsolet. Der Mensch hat mit seiner Kultur im weitesten<br />
Sinn immer schon in die Landschaft eingegriffen, sie geformt, sie<br />
nutzbar gemacht. Ob nun im Dienste der zu steigernden landwirtschaftlichen<br />
Produktion feuchte Wiesen trocken gelegt, Flüsse umgeleitet oder<br />
Wälder abgeholzt wurden. Gerade in der montanen und wenig urbanisierten<br />
Region Liezen, in der einerseits die Natur so definitionsmächtig,<br />
aber auch so schützenswert ist, ist der Kampf um die Gestaltungshoheit<br />
der Landschaft ein ganz zentraler. Wer darf wo eingreifen, was regulieren,<br />
zu welchem Zweck adaptieren? Darf Natur zur Schaffung von Privatheit<br />
ge-/miss-/braucht werden, wie es Franz Kapfer in seiner Arbeit<br />
beobachtet? Was bedeutet es, wenn sich Nutzung und Bedeutung eines<br />
Ortes innerhalb der Landschaft verändern, wenn dieser Ort z. B. zu einem<br />
Verkehrsknotenpunkt werden soll, an dem sich die Geister scheiden, so<br />
wie es Katařina Šedá für den geplanten Kreisverkehr vor dem Schloss<br />
Trautenfels erkannt hat?<br />
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat unter anderem Gundi<br />
Jungmeier Aktivistinnen und Aktivisten sowie Funktionärinnen und<br />
Funktionäre rund um die Natura 2000 und die Ennsnahe Trasse interviewt<br />
und lässt diese in ihrem Ausstellungs- und Katalogbeitrag zu Wort<br />
kommen.<br />
Der Mensch und sein Überleben<br />
Der Mensch schafft sich nicht nur die Dinge seines täglichen Lebens, er<br />
schafft sich auch ein System der Ordnung und Sinnhaftigkeit, das ihm<br />
Orientierung und Sicherheit gewährleistet. Früher waren es die Kirche<br />
oder der unantastbare Erfahrungsschatz der Älteren, der Schicksalsschlägen<br />
eine Bedeutung zuwies und damit erträglich machte. Heute<br />
dreht sich das Leben vordergründig darum, solche Ereignisse präventiv<br />
zu vermeiden. Radfahrhelme und Sicherheitsgurte bewahren Menschen<br />
vor Verletzungen, Pestizide wehren Schädlinge ab und Impfungen schützen<br />
Mensch und Vieh vor Erkrankungen. Der Mensch hat eine Reihe praktischer<br />
Sicherheitsmechanismen geschaffen – sie sollen das abwenden,<br />
wogegen eigentlich doch im Vorfeld eine Versicherung abgeschlossen<br />
wurde. Doch was verschafft uns tatsächlich Sicherheit? Und was würden<br />
wir opfern, abseits der monatlichen Versicherungsbeiträge, damit<br />
wir (uns) „sicher“ sind? Maria Papadimitriou hat Teile der Liezener Bevölkerung<br />
dahingehend befragt, welche Systeme der Sicherheit sie sich<br />
geschaffen haben. Im Mittelpunkt standen dabei vordergründig Landwirtinnen<br />
und -wirte, die in ihrem Arbeitskreislauf auf die oft unberechen-
252 — 253<br />
Elke Murlasits<br />
bare und nicht immer beherrschbare Natur angewiesen sind. Gernot Rabl<br />
hat mit diesen Interviews gearbeitet und über Glaube und Aberglaube<br />
reflektiert.<br />
Des Menschen alte und neue Kleider<br />
Etwas scheinbar so banales wie unser „Gewand“, unsere Kleidung, muss<br />
mannigfaches leisten: vor Wind und Wetter ebenso wie vor Schmutz und<br />
Kälte schützen, Schweiß abführen und Feuchtigkeit abweisen. Nicht umsonst<br />
wird die Kleidung auch als „zweite Haut“ bezeichnet.<br />
Unsere Kleidung, und da nicht nur die sogenannte „Funktionswäsche“,<br />
muss auch inhaltlich mehrere Funktionen erfüllen: Sie muss unsere<br />
Scham bedecken, uns vor übergriffigen Blicken schützen, kommunizieren,<br />
wer wir sind, oft auch woher wir kommen, was wir wollen und wozu<br />
wir da sind.<br />
Gerade traditionelle Stoffe und Kleidung wie der Loden oder die Tracht<br />
sind sehr stark dieser bewussten Sinnstiftung und Sinnkommunikation,<br />
mit diesen zusätzlichen inhaltlichen Bedeutungszuschreibungen, unterworfen.<br />
An dieser per Definition für eine Region/Berufsgruppe/Zeit/etc.<br />
typischen Kleidung kann sehr viel über das Selbstbild eben dieser Zeiten,<br />
Gruppen und Individuen abgelesen werden. Was bedeutet es aber,<br />
wenn diese Kleidung auch noch in Handarbeit produziert wird? Wenn die<br />
Arbeit, der Aufwand, die Sorgfältigkeit nicht in ein unbekanntes Land<br />
zu Minimallöhnen vergeben, abgeschoben, sondern erfahrbar, sichtbar<br />
wird? Christian Philipp Müller hat für seine künstlerische Arbeit viele<br />
Gespräche mit Produzierenden und Trägerinnen und Trägern von Tracht<br />
und Loden geführt, Günther Marchner hat ihn dabei unterstützt und<br />
dabei die Abgründe und Hochebenen politischer Vereinnahmung bis zu<br />
emanzipierter Selbstdefinition ausgeleuchtet und in seinem Beitrag über<br />
die „Karriere des Lodens“ verarbeitet. Ebenso wurden die Mitglieder des<br />
Vereins Schloss Trautenfels um ihren ganz persönlichen Standpunkt zu<br />
Tracht und Loden befragt.<br />
Der Mensch und seine Architektur_en<br />
Architektur ist nun unbestreitbar ein vom Menschen geschaffenes Werk.<br />
Doch wie wir uns diese Architektur zu eigen machen, wie wir sie benutzen<br />
(dürfen), das wird durch deren und unsere Aufgabe definiert.<br />
Für öffentliche Gebäude wie die Schauräume eines Schlosses oder ein Museum<br />
gelten klar geregelte Verhaltensmuster, die – nicht nur, aber auch –<br />
durch künstlerische Interventionen wie die vom Künstler/innen-Paar Lang<br />
& Baumann (L/B) unterwandert werden können. Architekturen können<br />
„falsch“ verwendet, subversiv miss-/gebraucht werden oder ihre Funktion<br />
– zumindest temporär – umgewandelt werden. Da muss sich der Mensch<br />
aber schon auch aktiv neue Perspektiven und Interpretationen schaffen.<br />
Einfacher hingegen ist die Nutzung des Privatraums, der ja dazu geschaffen<br />
wurde, um ganz privat, um ganz sie/er selbst zu sein. Franz<br />
Kapfer hat sich in der Recherchephase für seine Arbeit mit Mustern in der<br />
vielleicht typischen regionalen Privatarchitektur auseinandergesetzt, die<br />
sich nach außen hin – gleich einer Wehranlage – dem Fremden gegenüber<br />
klar abgrenzt.<br />
Gundi Jungmeier hingegen hat die Fragestellung umgedreht und Fremde,<br />
die sich in der Region Liezen – also aus deren Sicht „in der Fremde“ –<br />
Privatraum geschaffen haben, befragt. Auszüge der Interviews sind im<br />
Katalog zu finden, die Filmdokumentation in der Ausstellung zu sehen.<br />
Die Schüler/innen der VS Unterburg haben mit Wolfgang Otte und ihrer<br />
Lehrerin Maria Mössner das Schloss Trautenfels von einer unbekannten<br />
Seite kennengelernt. Ihre Eindrücke haben sie für uns fotografisch festgehalten<br />
und in spannenden Aufsätzen dokumentiert. Gernot Rabl hat<br />
der Architektur des Schlosses in seinem Beitrag ebenfalls ein besonderes<br />
Augenmerk geschenkt.<br />
Hier ist es endlich Zeit, sich bei all jenen zu bedanken, die uns bei den<br />
vorhin genannten Projekten unterstützt haben und erst den Inhalt dieser<br />
überaus spannenden Arbeiten geliefert haben. Danke an all die Interviewpartner/innen,<br />
die uns Einblick in ihr Leben und ihre Arbeiten gewährt<br />
haben, uns ihre Zeit geschenkt und ihre Wohnungen geöffnet haben.<br />
Danke auch an alle, die Fotos und Informationen bereitgestellt haben<br />
und besonders an die Schüler/innen der VS Unterburg, die ihrer Fantasie<br />
freien Lauf gelassen und das Schloss für uns neu entdeckt haben.
254 — 255<br />
Kurzer historischer Aufriss zur<br />
Geschichte von Schloss Trautenfels<br />
in Verbindung mit klassischen<br />
Architektur- und Raumfragen<br />
Gernot Rabl<br />
Sabina Lang und Daniel Baumann (L/B) greifen mit ihren Installationen in<br />
ein bereits existierendes Gebäude sowie einen klar definierten Raum ein<br />
und lassen die sich daraus ergebenden Wechselbeziehungen zwischen<br />
Schloss, Raum und Objekt bewusst in Schwebe. Die vertraute Sichtweise<br />
des vor allem durch die erhöhte Lage weit über dem Ennstal erkennbaren<br />
Schlosses wird durchbrochen. Die durch L/B erfolgten Eingriffe sorgen für<br />
eine geänderte Wahrnehmung und lassen klassische Architekturfragen<br />
nach Konstruktion, Raum, Positionierung, Form und Funktion aufkommen,<br />
die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der repräsentativen<br />
Architektur und der Geschichte des Schlosses stehen.<br />
Bereits im Jahre 1261 wurde an dieser Stelle zum ersten Mal eine Burg<br />
Neuhaus urkundlich erwähnt. Die Burg – an einer strategisch wichtigen<br />
Stelle errichtet – stand rasch im Spannungsfeld zwischen dem Salzburger<br />
Bischofssitz, dem Herzogtum Steiermark und den Habsburgern, galt<br />
es doch, den Kreuzungspunkt der Salzstraße mit der Strecke durch das<br />
Ennstal, den Ennsübergang und die wenige Kilometer westlich gelegene<br />
steirische Landesgrenze abzusichern.<br />
Auf kriegerische Auseinandersetzungen folgte am Ende des 13. Jahrhunderts<br />
nach dem Erzbistum Salzburg die endgültige Übernahme durch<br />
das Landesfürstentum Steiermark. Im Zuge der immer wiederkehrenden<br />
Machtkämpfe wurde die Burg allerdings völlig zerstört und erlangte nach<br />
dem Wiederaufbau nicht mehr dieselbe strategische Bedeutung.<br />
Ende des 15. Jahrhunderts trat die Familie Hoffmann, eine der reichsten<br />
und mächtigsten Adelsfamilien der Steiermark, als neuer Besitzer auf.<br />
Sie waren bedeutende und einflussreiche Förderer des protestantischen<br />
Glaubens und ließen im 16. Jahrhundert unweit der Burg eine evangelische<br />
Kirche errichten, wodurch Neuhaus während der Reformation zu<br />
einem Zentrum des neuen Glaubens wurde. Mit der Zerstörung der Kirche<br />
(1599) verlor Neuhaus allerdings in der darauffolgenden Gegenreformation<br />
wieder an Bedeutung.<br />
Nach einigen Jahrzehnten unterschiedlicher Burgpfleger fiel die Anlage<br />
1664 in den Besitz der Familie Trauttmansdorff. Unter Siegmund Friedrich<br />
von Trauttmansdorff, dem damaligen steirischen Landeshauptmann,<br />
erfolgte der Umbau der Burg zu dem heutigen barocken Schloss und<br />
erhielt den Namen Trautenfels. Trauttmansdorff verpflichtete um 1670<br />
den Tessiner Maler Carpoforo Tencalla für die Gestaltung der Fresken<br />
des Marmorsaales, der Schlosskapelle sowie für zwei weitere Räume des<br />
Schlosses; für die Stuckaturen zeichnete Alessandro Sereni verantwortlich.<br />
Bis 1815 blieb das Schloss Eigentum der Familie Trauttmansdorff.<br />
Nach zahlreichen Besitzerwechseln war das Schloss schließlich im Besitz<br />
der Familie Lamberg, den letzten adeligen Eigentümern des Schlosses.<br />
Unter Graf Josef Lamberg (Besitzer von 1878 bis 1904) wurde Schloss<br />
Trautenfels umfassend renoviert, wohnlich ausgestattet und unter anderem<br />
mit einer Zentralheizung versehen. Durch die Mitgift seiner Frau<br />
Anna und sein eigenes Vermögen war ihm die dringende Restaurierung<br />
des damals stark vernachlässigten Gebäudes möglich geworden.<br />
Seine Gattin Anna führte den Besitz nach seinem Tod bis 1941 weiter,<br />
ehe sie aus finanziellen Gründen das Schloss an die Deutsche Reichspost<br />
verkaufen musste. Aufgrund der Kriegslage war das geplante Erholungs-<br />
bzw. Postkongressheim nicht realisierbar, weshalb die Republik<br />
Österreich als anschließender Eigentümer die Liegenschaft an das<br />
steirische Jugendherbergswerk verkaufte. Dieses zog nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg ein, konnte aber ebenfalls die Erhaltung nicht über längere<br />
Zeit finanzieren, sodass das Schloss 1983 in den Besitz der öffentlichen<br />
Hand gelangte.<br />
In den 1950er-Jahren erfolgte schließlich der Aufbau des Schlosses zu<br />
einem Regionalmuseum für das steirische Ennstal und das Salzkammergut,<br />
als eine Abteilung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum,<br />
seit 2009 Universalmuseum Joanneum. Die Eröffnung fand am 9. August<br />
1959 statt, wobei bereits von Beginn an eine starke Bindung der Bevölkerung<br />
an „ihr“ Museum festzustellen war.<br />
Im Jahr 1983 erwarb die Gemeinde Pürgg-Trautenfels mit Unterstützung<br />
des Landes das Schloss, und im selben Jahr konstituierte sich auch der<br />
Verein Schloss Trautenfels, der die Sanierung der baufälligen Substanz in<br />
anfänglich kleinen Schritten vorantrieb. Als die Abteilung Schloss Trautenfels<br />
1989 die Landesausstellung für 1992 („Lust und Leid“) zugesprochen<br />
bekam, konnte die notwendige Generalsanierung beschleunigt und<br />
in nur zweieinhalb Jahren Bauzeit durchgeführt werden. Als ausführen-
256 — 257<br />
Gernot Rabl<br />
1<br />
Walter Brunner, Barbara<br />
Kaiser: Schloss Trautenfels<br />
(=Kleine Schriften der<br />
Abteilung Schloss Trautenfels<br />
am Steiermärkischen<br />
Landesmuseum Joanneum).<br />
Trautenfels 1992, zit. nach:<br />
http://www.museum-<br />
joanneum.at/de/trautenfels/das_schloss<br />
[Zugriff: 28.4.2010.]<br />
2<br />
Walter Chramosta:<br />
Grimmi(n)ge(r) Gegenkodierungen.<br />
Manfred Wolff-<br />
Plotteggs Eingriffe in Körper<br />
und Seele von Schloss<br />
Trautenfels (=Architektur<br />
& Bauforum, Nr. 152). Wien<br />
1992, 109 ff; Wolfgang<br />
Otte: Der Umbau des alten<br />
Schlosses. Überraschungen<br />
und neue Effekte. In: Da<br />
schau her, Folge 2, Trautenfels<br />
1992, 22 ff.<br />
3<br />
Marc Redepenning: Eine<br />
selbst erzeugte Überraschung:<br />
Zur Renaissance<br />
von Raum als Selbstbeschreibungsformel<br />
der Gesellschaft.<br />
In: Jörg Döring,<br />
Tristan Thielmann (Hg.):<br />
Spatial Turn. Das Raumparadigma<br />
in den Kultur- und<br />
Sozialwissenschaften.<br />
Bielefeld: transcript 2008,<br />
S. 317.<br />
den Architekten gewann man Manfred Wolff-Plottegg, welcher die alte<br />
Bausubstanz des Schlosses mit moderner Architektur verband. 1<br />
Bei einem Rundgang durch das Schloss lassen nun im Besonderen die<br />
Einbauten Wolff-Plotteggs einen Vergleich mit den künstlerischen Installationen<br />
von L/B zu. Auch der Architekt ging von einem fertigen Gebäude<br />
aus und sorgte in der Durchführung für bewusste Irritationen: So<br />
trennt beispielsweise im Zwischengeschoss eine Treppenkonstruktion, in<br />
Verwendung als Tür, den Seminar- vom Museumsbereich oder dienen im<br />
Museumsshop in die Wand führende Stufen als Präsentationsflächen. Weiters<br />
kann unter anderem an die zweite Hauptstiege, den Eingangs- und<br />
Kassabereich sowie die Überdachung der Lichthöfe erinnert werden. 2 Im<br />
Unterschied zu Manfred Wolff-Plotteggs Maßnahmen bleiben jedoch die<br />
Interventionen von L/B zeitlich begrenzt und sind vollständig reversibel,<br />
d. h. sie werden entfernt, bevor sie langfristig Teil der Geschichte des<br />
Schlosses werden.<br />
Das Künstler/innen-Paar erzwingt eine völlig neue Auseinandersetzung<br />
und stellt den ursprünglichen Architekturgedanken infrage. Sie vermeiden<br />
es dabei, den Besucherinnen und Besuchern vorzuschreiben, was sie zu<br />
sehen oder zu denken haben und machen deutlich, „dass es nicht um den<br />
Raum an sich geht, sondern um Raumkonzepte und Raumvorstellungen,<br />
wie man den Raum denken kann.“ 3 Nicht aufgezwungene Erklärungen über<br />
Benutzbarkeit, Funktion und Bedeutung schaffen ausreichend Platz für<br />
Fantasie, sodass ganz unterschiedliche Sichtweisen gepaart mit Geschichten<br />
entstehen können (vgl. unten). Die Besucher/innen werden durch die<br />
„erzwungene“ aktive Beschäftigung Teile des Kunstwerkes.<br />
Generell sei festgehalten, dass bei der klassischen Definition eines Raumes<br />
beziehungsweise eines Gebäudes auch der gesamte Kontext berücksichtigt<br />
werden muss: zum Beispiel das äußere Umfeld, die politischen Bedingungen,<br />
Funktionen aber natürlich auch ästhetische Belange. Auch ein als<br />
Museum adaptiertes Schloss wird anders zu behandeln sein als ein eigens<br />
geschaffener Museumsbau. Architektur zieht allgemein eine Grenze zwischen<br />
innen und außen und definiert den umliegenden Landschaftsraum<br />
beziehungsweise die vorgegebene Fläche. Dabei fügt sich ein Bauwerk<br />
entweder harmonisch in die Umgebung ein oder bildet einen bewussten<br />
Kontrast. Hat sich ein Gebäude hingegen etabliert und werden nachträgliche<br />
und/oder temporäre Eingriffe wie die den Innen- und Außenraum des<br />
Schlosses betreffenden Interventionen von L/B aufgenommen, ist eine<br />
gewohnte Sichtweise nicht mehr möglich. Ablehnung, Unverständnis und<br />
Irritation, aber auch Neugierde, Wissensdrang und Interesse entstehen, da<br />
die vermeintlich bekannte Lesbarkeit des Gebäudes, welche sich mitunter<br />
bereits an der Fassade ausdrückt, aufgehoben und infrage gestellt wird.<br />
Die uns umgebende Architektur, sei es im städtischen oder ländlichen<br />
4<br />
Vilém Flusser: Räume.<br />
In: Jörg Dünne, Stephan<br />
Günzel (Hg.): Raumtheorie.<br />
Grundlagentexte<br />
aus Philosophie und<br />
Kulturwissenschaften.<br />
Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp 2006, S. 279.<br />
5<br />
Ebda, S. 283 f<br />
Bereich, hat somit für jeden einzelnen Menschen eine konkrete Bedeutung.<br />
Sie ist Teil eines gewohnten Blickes, persönlicher Erfahrungen oder<br />
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Erlebtem. So ergaben viele<br />
im Zuge der Vorbereitungen zur Sonderausstellung getätigte Umfragen,<br />
dass die um das Schloss wohnenden Personen sich dem Bauwerk stark<br />
verbunden fühlen und es nicht missen wollen: Ihre Reaktionen auf L/Bs<br />
Eingriffe werden am nachhaltigsten sein.<br />
Eine wichtige Funktion von Architektur, eines Raumes oder eines Gebäudes<br />
ist die klare Trennung von öffentlichen und privaten Lebensbereichen.<br />
„Es gibt [aber] immer wieder Einbrüche aus dem Privatraum in<br />
die Republik und aus der Politik in den Privatraum, und Raumgestalter<br />
sind dazu da, den Verkehr zwischen privat und öffentlich zu regeln. Zu<br />
diesem Zweck eben entwerfen sie Mauern, Fenster und Türen, und Straßen,<br />
Plätze und Tore. Privat und öffentlich sind die beiden großen Lebensraumkategorien,<br />
und alle übrigen Räume sind dort einzuräumen.“ 4<br />
Dieser Feststellung Vilém Flussers folgt seine auch auf L/Bs Installationen<br />
umlegbare Forderung an die Raumgestaltung, Räume zu öffnen und<br />
nicht mehr auf ein starres Achsenkreuz zu reduzieren. „Da wir bisher den<br />
Raum vom Boden her, also geometrisch, erlebt und verstanden haben,<br />
war bisher das Merkmal alles Räumlichen die Definition, die Grenze. Und<br />
jetzt, da wir den Raum von innen her, also topologisch, zu erleben und zu<br />
verstehen beginnen, wird das Merkmal alles Räumlichen das Überschneiden,<br />
das Überdecken, das Ineinandergreifen werden.“ 5<br />
Durch die Schaffung von Übergängen von innen nach außen und der<br />
damit verbundenen Auflösung des Raumes verliert folglich auch „Architektur“<br />
ihre unbewegliche Körperhaftigkeit und ein Gebäude, in unserem<br />
Fall das Schloss, verliert an Massivität. Die gezielt platzierten Eingriffe<br />
von Lang und Baumann lassen bewusst geschaffene neue Blickwinkel<br />
und Sichtweisen entstehen, welche von den Betrachterinnen und Betrachtern<br />
subjektiv wahrgenommen und interpretiert werden.<br />
Dabei wird ein unbefangener Blick nötig sein, um auf das in diesem Zusammenhang<br />
noch nie Gesehene reagieren zu können. Unter anderen<br />
Vorzeichen wurde bereits vor der Eröffnung der Sonderausstellung mit<br />
einer Volksschulklasse ähnliches erprobt. Im Rahmen einer gezielten<br />
Führung konnten die Schüler/innen Räumlichkeiten des Schlosses betreten,<br />
die im Normalfall nicht öffentlich zugänglich sind. Ihre Reaktionen<br />
auf Unbekanntes lösten unterschiedliche Fantasien und Geschichten<br />
aus und sorgten für neue Blickwinkel, die während der Führung mit Einwegkameras<br />
festgehalten wurden. Die verschiedenen Eindrücke wurden<br />
nachträglich in einer Unterrichtsstunde niedergeschrieben und sind am<br />
Ende dieses Beitrags nachzulesen.<br />
So wie bei den Schülerinnen und Schülern beim Anblick von Unbekanntem
258 — 259<br />
Gernot Rabl<br />
Fantasien frei wurden, sollen diese auch durch die Eingriffe von Sabina<br />
Lang und Daniel Baumann entstehen, sodass die von ihnen geschaffenen<br />
Installationen bald ihre eigene Geschichte erzählen, gemeinsam mit oder<br />
losgelöst von jener des Schlosses.<br />
Abenteuer auf Burg Neuhaus<br />
Vor langer Zeit lebte auf Burg Neuhaus ein tapferer Ritter namens Adula.<br />
Adula war stark und gescheit. Eines Tages sah er, dass Feinde kommen<br />
und er rief: „Feinde! Feiiinde!“, und lief den Turm hinunter. Die Armee von<br />
Burg Neuhaus stand mit Ritter Adula bereit. Dann riefen sie: „Angriff!“,<br />
und sie rannten aus der Burg, und da kamen auch schon die Feinde und<br />
auf einmal krachte es. Die Schlacht begann. Adula kämpfte gegen einen<br />
anderen Ritter und verletzte den Ritter so viel, dass er nicht mehr kämpfen<br />
konnte. Die Ritter von Burg Neuhaus gewannen die Schlacht und<br />
gingen in die Burg zurück und feierten noch viel wegen der gewonnen<br />
Schlacht.<br />
Burg Neuhaus<br />
Es war früh am Morgen, und das Telefon klingelte. Mein Vater wachte auf<br />
und sagte: „Was ist passiert?“ Ich wachte auf und sagte: „Vater, bitte<br />
geht nicht schon wieder in den Kampf.“ Mein Vater legte den Hörer auf<br />
das Telefon und sagte zu mir: „Mein Schatz, ich verspreche dir, dass ich<br />
zurückkommen werde.“ Nun wachte auch meine Mutter auf und sagte:<br />
„Schatz, dein Vater muss kämpfen, sonst wird unsere Burg zerstört.“<br />
Dann sagte sie noch: „Warum bist du eigentlich in unserem Schlafgemach?“<br />
Dann sagte ich: „Mir war so kalt und ich hatte einen Albtraum,<br />
deswegen bin ich bei dir.“ Dann sagte unsere Hausmagd: „Prinzessin Lilli,<br />
hilfst du mir das Frühstück zubereiten?“ Ich sagte: „Natürlich Greta.“<br />
Nach dem Frühstück zog mein Vater in den Kampf und schrie laut: „Für<br />
Troja!“ Nach dem Mittagessen bekamen wir einen Anruf, der mein Leben<br />
veränderte. Meine Mutter sagte schluchzend: „Dein Vater ist im Kampf<br />
gefallen.“ Ich fing laut zu schreien an und schrie: „Ihr blöden Briten, ich<br />
nehme Rache!“ Dann fing ich zu weinen an und lief in mein Zimmer. Meine<br />
Mutter kam zu mir und tröstete mich. Dann sagte ich: „Oh Mutter, ich<br />
werde Rache nehmen.“ Und das tat ich auch. Sechs Jahre später war ich<br />
sechzehn, und mir passte die erste Ritterrüstung. Ich zog in den Kampf.<br />
Meine Mutter wollte mich aufhalten und sagte: „Bleib hier oder willst du<br />
auch ermordet werden?“ Aber ich sagte: „Mein Pferd und ich sind bereit,<br />
wir nehmen Rache.“ Dann zog ich los, und ich war fast am Ziel. Doch<br />
dann kamen feindliche Ritter und sagten: „Sieh mal Franz, da will ein<br />
kleines Mädchen gegen uns kämpfen.“ Ich sagte: „Ich bin kein kleines<br />
Mädchen, ihr habt mir etwas weggenommen, was mir sehr wichtig war.“<br />
Dann spuckte ich ihnen ins Gesicht. Ein Ritter sagte: „Komm Kleine, wir<br />
Katharina Jos, Schloss Trautenfels 2010<br />
bringen dich nach Hause.“ Aber ich schrie: „Hüa, Lissi!“ Mein Pferd ritt<br />
los, ich drehte mich um und schrie laut: „Ich lasse mich doch nicht von<br />
euch schmierigen Banausen herumkommandieren!“ Die Ritter lachten<br />
und ritten weiter. Ich stürmte die Burg und stach alles nieder, was mir in<br />
den Weg kam. Doch dann passierte es, ich wurde erstochen. Ich wachte<br />
auf und merkte, dass es nur ein Traum gewesen ist. Aber ich war wirklich<br />
im Mittelalter. Ich ging ganz langsam zum Schlafgemach von meinen Eltern,<br />
ich öffnete ganz langsam und leise die Türe. Mein Vater lebte noch,<br />
ich war heilfroh, dann kroch ich unter die Decke von meiner Mutter und<br />
träumte etwas ganz Schönes. So ist es passiert oder so ähnlich. Und das<br />
war die Geschichte von Burg Neuhaus. Dann merkte ich, dass ich eigentlich<br />
in der Schule bin. Mein Lehrer klatschte und sagte: „Bravo, bravo.<br />
Das war mit Abstand die beste Geschichte.“<br />
Abenteuer auf Burg Neuhaus<br />
Vor langer Zeit lebte auf Burg Neuhaus ein tapferer Ritter namens Eisenstein.<br />
Er war mein Vater. Als ich früh am Morgen aufwachte, sah ich<br />
meinen Vater, er war schon in der Ritterrüstung. Er sagte: „Morgen, mein<br />
Prinzesschen!“ Ich fragte ganz verschlafen: „Was machst du denn schon<br />
wieder?“ Er sagte: „Ach Lala, das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle es<br />
dir später. Ich habe es eilig!“ Als ich noch etwas sagen wollte, war er auch<br />
schon weg. Meine Mutter wachte auch schon auf. Und fragte mich: „Wo<br />
ist Papa?“ Ich sagte traurig: „Er ist schon wieder in den Kampf gegangen!“<br />
Meine Mutter sagte zu mir: „Sei nicht traurig, Papa macht das nur<br />
für uns.“ Nach einer Weile kam Papa wieder in die Burg zurück. Ich fragte:
260 — 261<br />
Fotos links:<br />
Sara Egger, Schloss Trautenfels<br />
2010<br />
Fotos rechts (i.U.):<br />
Julian Schmied, Annika Hofer,<br />
Alois Brettschuh, Alexandra<br />
Schirl, Ramona Eingang,<br />
Schloss Trautenfels 2010
262 — 263<br />
Gernot Rabl<br />
„Bist du verletzt?“ Er sagte ganz traurig: „Nein, aber wir haben alles verloren!“<br />
Ich sagte ganz verweint: „Auch die Burg?“ Papa sagte: „Ja, auch<br />
die Burg!“ Ich sagte: „Aber wo sollen wir jetzt wohnen?“ Er hatte mich<br />
nicht mehr gehört, weil er schon in ein anderes Zimmer verschwunden<br />
war. Mir kam eine Idee. Ich wollte für die Burg kämpfen. Ich nahm den<br />
Telefonhörer und rief bei den Kämpfern an. Wir machten einen Termin<br />
aus. Er war heute um 4 Uhr. Es war schon 3:14 Uhr. Ich richtete mich<br />
zusammen. Ich nahm mein Pferd und ritt hinunter in die Kampfstube.<br />
Ich wurde immer nervöser. Es ging los! Ich setzte mich auf mein Pferd.<br />
Ein starker Mann kam mir entgegen. Ich stieß ihn vom Pferd hinunter. Ich<br />
hatte gewonnen!! Wir würden uns die Burg behalten. Wir feierten noch<br />
lange. In der Früh merkte ich, dass alles nur ein schrecklicher Traum war.<br />
Abenteuer auf Burg Neuhaus<br />
Vor langer Zeit lebte auf Burg Neuhaus ein tapferer Ritter namens Peter<br />
Rosegger. Er war bei den Bauern beliebt. Peter Rosegger hatte drei<br />
Frauen, die ihn liebten. Peter Rosegger konnte aber nur eine Frau heiraten.<br />
Es griff eine Armee von Burg Lachtal Schloss Trautenfels an. Peter<br />
Rosegger rief: „Wachen auf den Schlossturm! Ritter vor das Burgtor und<br />
die anderen Leute in die Häuser! Die Ritter ohne Ritterrüstung an die<br />
Pechnasen über dem Burgtor.“ Peter Rosegger zog die Ritterrüstung an<br />
und schrie: „Auf zum Krieg gegen die Burg Lachtal!“ Aber die Lachtaler<br />
hatten den Geheimgang gefunden und stürzten in die Grube ab. Burg<br />
Trautenfels hatte nochmal Glück gehabt. Peters Mannen gewannen den<br />
Krieg gegen das Lachtal. Peter Rosegger heiratete eine Frau und die hieß<br />
Johanna Rosegger und sie bekamen ein Kind. Das Kind hieß Verena Rosegger.<br />
Abenteuer auf Burg Neuhaus<br />
Vor langer Zeit lebte auf Burg Neuhaus ein tapferer Ritter namens Reinhold.<br />
Er hatte eine bezaubernde Frau namens Michaela und ein Kind, das<br />
hieß Alexandra. Alexandra hatte eine Freundin namens Verena. Sie hatten<br />
schon viele Abenteuer erlebt. Aber heute hatten sie einen Geheimgang<br />
gefunden. Sie untersuchten ihn und gingen hinein. Es war sehr staubig.<br />
Trotzdem wollten sie hinein. Am Ende des Ganges war eine Tür aus Eisen.<br />
Zum Glück war die Tür nicht verschlossen. Die Tür führte ins Dorf. Sie<br />
sahen sich um. Es waren viele Leute, Kinder, Erwachsene aber auch Tiere.<br />
Da kam ein schwarzer Ritter. Alle schrien vor Angst. Der schwarze Ritter<br />
klaute die Sachen von ihnen. Schnell rannten sie hinter eine Mauer und<br />
beobachteten ihn. Es kam Ritter Reinhold und kämpfte mit ihm. Vater<br />
gewann den Kampf. Der schwarze Ritter musste fort. Ende.<br />
6<br />
Auswahl an Schüler/innen-<br />
Arbeiten der VS Unterburg,<br />
4. Klasse: Johannes<br />
Berger, Alois Brettschuh,<br />
Max Brettschuh, Verena<br />
Brettschuh, Sara Egger,<br />
Ramona Eingang, Annika<br />
Hofer, Katharina Jos, Anna-<br />
Lena Kanzler, Nico Pichler,<br />
Alexandra Schirl, Julian<br />
Schmied, Birgit Steiner;<br />
Klassenlehrerin: Dipl. Päd.<br />
VD Maria Mössner.<br />
Burg Neuhaus<br />
Vor langer Zeit lebte auf der Burg Neuhaus ein tapferer Ritter namens<br />
Baldur. Eines Tages war ein Kampf mit dem König Paul. Er war der stärkste<br />
Ritter auf der Welt. Alle Ritter hatten Angst vor Paul. Eines Tages war<br />
Nina, die Frau von Baldur, sehr enttäuscht, weil er nie da war und immer<br />
was zu erledigen hatte. Und das war kämpfen und kämpfen. „Nie hat er<br />
Zeit für mich. Immer muss er kämpfen“, sagte Nina ganz traurig. Baldur<br />
hatte so etwas wie eine Kämpfkrankheit. Es war am Morgen. Nina schrie:<br />
„Aufstehen, Baldur! Es gibt Frühstück!“ Baldur sagte mit müder Stimme:<br />
„Was gibt es denn?“ „Maisbier, Eier, Erdbeeren, Bananen, Wurst, Bier,<br />
Kaffee, Nutellabrot und Äpfel.“ Baldur erschrak: „So viel?“, “Ja, so viel,<br />
und du musst alles aufessen!“ Da versprach Baldur, dass er wieder mehr<br />
Zeit für Nina hatte. Nina sagte: „Danke, mein Schatz!“ Ende.<br />
Der Ritter Kunibert<br />
Es war einmal vor langer Zeit ein Ritter, der hieß Kunibert. Er war ein tapferer<br />
Ritter. Eines Tages gab es auf der Burg Neuhaus ein großes Reitturnier.<br />
Dieses Turnier war sehr wichtig für ihn. Denn wenn er es gewinnen<br />
konnte, bekam er eine hohe Prämie. Es waren viele Leute gekommen, um<br />
sich das Turnier anzusehen. Da waren Knappen, Kinder, Frauen, Männer<br />
und viele Ritter. Diese Veranstaltung dauerte 1 Woche lang. Zu essen<br />
gab es Spanferkel und Kalbfleisch und Wasser, Bier und Wein zu trinken.<br />
Kunibert stieß bei einem Kampf den schwarzen Ritter mit seiner Lanze<br />
vom Pferd. Somit hatte er das Turnier gewonnen, und er bekam die Prämie.<br />
Endlich konnte er sein Haus fertig bauen. Er war sehr glücklich über<br />
sein fertiges Haus.“ 6
264 — 265<br />
1<br />
Richtlinie 92/43/EWG zur<br />
Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der<br />
wildlebenden Tiere und<br />
Pflanzen, Fauna-Flora-<br />
Habitat-Richtlinie.<br />
In: http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/<br />
naturrecht/eu_richtlinien/<br />
ffh_richtlinie/ [Zugriff:<br />
15.3.2010].<br />
2<br />
Richtlinie 79/409/EWG<br />
vom 2. April 1979 über die<br />
Erhaltung der wildlebenden<br />
Vogelarten, Fauna-Flora-<br />
Habitat-Richtlinie.<br />
In: http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/<br />
naturrecht/eu_richtlinien/<br />
vogelschutz_rl/ [Zugriff:<br />
15.3.2010].<br />
3<br />
What is Natura 2000?<br />
Environment Directorate-<br />
General of the European<br />
Commission.<br />
In: http://ec.europa.eu/<br />
environment/nature/<br />
natura2000/ [Zugriff:<br />
15.3.2010].<br />
4<br />
Ernst Zanini: Natura 2000<br />
in der Steiermark. In:<br />
Bericht. 10. Österreichisches<br />
Botanikertreffen vom 30.<br />
Mai bis 1. Juni 2002 an der<br />
HBLA Raumberg. Irdning<br />
2002, S. 57.<br />
5<br />
Managementplan Kurzfassung.Europaschutzgebiete<br />
zwischen Pruggern<br />
und Selzthal, Amt der<br />
Steiermärkischen Landesregierung,<br />
Fachabteilung<br />
13C Naturschutz. Gleisdorf<br />
2009, S. 7.<br />
6<br />
Verordnung der SteiermärkischenLandesregierung<br />
vom 4. Dezember<br />
2006 über die Erklärung<br />
des Gebietes „Wörschacher<br />
Moos und ennsnahe Bereiche“<br />
(AT 2212000 zum<br />
Europaschutzgebiet Nr. 4,<br />
4.12.2004, 1. In: http://<br />
www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrSt<br />
Das schlechte Gewissen des Homo faber<br />
Standpunkte zur Ausweisung von Natura<br />
2000-Schutzgebieten im steirischen Ennstal<br />
Gundi Jungmeier<br />
Natura 2000 bezeichnet ein EU-weites Netzwerk von Naturschutzgebieten,<br />
das sich auf die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 1 (FFH-RL) und die<br />
Vogelschutz-Richtline 2 (VS-RL) der EU stützt. Ziel ist nicht die Schaffung<br />
isolierter Naturschutzgebiete, aus denen jegliche menschliche Aktivitäten<br />
ausgeschlossen sind, sondern die Handhabung dieser Flächen im<br />
Sinne einer ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit. 3<br />
Mit dem Beitritt zur EU im Jahr 1995 hat sich Österreich verpflichtet,<br />
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um die Natura<br />
2000-Richtlinen umzusetzen. Da in Österreich Natur- und Umweltschutz<br />
in die Kompetenz der Bundesländer fallen, hat der Steiermärkische Landtag<br />
im Jahr 2000 eine Novelle zum Steiermärkischen Naturschutzgesetz<br />
erlassen, um den EU-Richtlinien zu entsprechen. 4<br />
Mittlerweile sind zwischen Pruggern und Selzthal Flächen entlang der<br />
Enns Flächen von knapp 3.000 ha als Natura 2000-Schutzgebiete nach<br />
der FFH-RL bzw. VS-RL ausgewiesen. 5<br />
Auf den betroffenen Grundstücken finden sich zahlreiche Pflanzenarten<br />
und Lebensraumtypen sowie Tierarten, wie z. B. Fischotter, Gelbbauchunken,<br />
Uhu, Eisvogel, Neuntöter u. v. m., die als schützenswert gelten. 6<br />
Der Crex crex, besser als Wachtelkönig bekannt, wurde schließlich zur<br />
„Galionsfigur“ des Naturschutzes in der Region, da die Population im<br />
steirischen Ennstal als eines der wichtigsten alpinen Vorkommen erachtet<br />
wird. 7<br />
Ziel der „Europaschutzgebiete“, wie die Natura 2000-Gebiete in der<br />
Steiermark genannt werden, ist die Bewahrung bzw. Wiederherstellung<br />
eines günstigen Erhaltungszustandes für die Schutzgüter. 8 Die Grundeigentümer/innen<br />
der – in erster Linie landwirtschaftlichen – Nutzflächen<br />
werden für die durch die Umsetzung der Maßnahmen des „Freiwilligen<br />
Vertragsnaturschutzes“ 9 entstehenden Einschränkungen bei der Bewirtschaftung<br />
finanziell entschädigt.<br />
mk&Dokumentnummer=L<br />
RST_5500_028&Tabbed-<br />
MenuSelection=Landesrech<br />
tTab&WxeFunctionToken=c<br />
bb31231-ed42-47ed-b649eeb988e4156b<br />
[Zugriff:<br />
15.3.2010].<br />
7<br />
Der Wachtelkönig (Crex<br />
crex) im Ennstal zwischen<br />
Pruggern und dem Gesäuse.<br />
Bestand, Bewertung, Habitate<br />
– mit Empfehlungen<br />
zur Abgrenzung und zum<br />
Management des SPA<br />
„Steirisches Ennstal“, Amt<br />
der Steiermärkisch-en<br />
Landesregierung, Fachabteilung<br />
13C Naturschutz, Planungsbüro<br />
für Landschafts-<br />
& Tierökologie–Wolf Lederer.<br />
In: http://www.verwaltung.<br />
steiermark.at/cms/beitrag/10084508/2407657/<br />
[Zugriff: 15.3.2010].<br />
8<br />
Erläuterungen zum Entwurf<br />
einer Verordnung über die<br />
Erklärung des Gebietes<br />
„Ennstal zwischen Liezen<br />
und Niederstuttern“ zum<br />
Europaschutzgebiet Nr. 41.<br />
In: http://www.verwaltung.<br />
steiermark.at/cms/beitrag/10084508/2407657/<br />
[Zugriff: 28.4.2010].<br />
9<br />
Mit der Gebietsbetreuung<br />
bzw. mit der Umsetzung<br />
der für die einzelnen<br />
Schutz-güter ausgearbeiteten<br />
Einzelmaßnahmen<br />
beauftragte die zuständige<br />
Fachabteilung 13 C der<br />
Steiermärkischen Landesregierung<br />
die Ziviltechnikkanzlei<br />
Dr. Hugo Kofler;<br />
Managementplan Kurzfassung.Europaschutzgebiete<br />
zwischen Pruggern<br />
und Selzthal. Amt der<br />
Steiermärkischen Landesregierung,<br />
Fachabteilung<br />
13C Naturschutz. Gleisdorf<br />
2009, S. 2.<br />
10<br />
Gerald Schlager: Entschädigungen<br />
der Forstwirtschaft<br />
in Natura 2000 Gebieten.<br />
In: Ernst Zanini, Barbara<br />
Reithmayr (Hg.): Natura<br />
2000 in Österreich. Wien:<br />
NWV 2004, S. 205.<br />
11<br />
Brigitta Hauser-Schäublin:<br />
Von der Natur in der Kultur<br />
und der Kultur in der Natur.<br />
Werden Grundflächen zur Erreichung eines Schutzzweckes in<br />
ihrer Nutzung eingeschränkt, so haben die Eigentümer sowie<br />
Inhaber sonstiger privater und öffentlicher Rechte grundsätzlich<br />
Anspruch auf die Abgeltung hierdurch entstehender Nachteile<br />
(Schadloshaltung). 10<br />
Was genau ist jedoch unter „Natur“ zu verstehen und woher rührt der<br />
Wunsch bzw. die Notwendigkeit, sich in ihr einzurichten und sie trotzdem<br />
zu schützen?<br />
Der Begriff „Natur“ ist mit einer Reihe von Werten belegt und umreißt<br />
unterschiedliche Felder, die von der „fundamentalen Kraft, die die Welt<br />
bewegt“ über die „physische Umwelt im Unterschied zur menschlichen<br />
Umwelt“ bzw. die „Ländlichkeit im Unterschied zur Stadt oder das Wesen<br />
bzw. den Charakter einer Person oder Sache“ reichen, um nur einige Beispiele<br />
zu nennen. 11<br />
Der deutsche Soziologe Hans Paul Bahrdt verortet die Ursache für den<br />
ambivalenten Umgang mit der Natur im rationalen Denken und Handeln,<br />
das beginnend mit dem Zeitalter der Aufklärung stark an Bedeutung<br />
gewann. Die daraus hervorgegangene systematische Beobachtung dieser<br />
führte zu einem Bild von Natur als „beherrschbare Struktur“ bzw. zu<br />
einer Vorstellung von Natur als Objekt, aus dem sich der beobachtende<br />
Mensch selbst ausnimmt. 12<br />
René Descartes betrachtet Körper und Geist als gegensätzlich bzw. voneinander<br />
trennbar, wobei der Körper die Natur darstellt, die dem Geist<br />
untergeordnet ist. Da er den Menschen als einziges Wesen betrachtet,<br />
das über die Fähigkeit zu Denken bzw. über eine Seele verfügt, ist er<br />
allen anderen Wesen übergeordnet. 13<br />
Diese distanzierte Betrachtung führte nach Hans Paul Bahrdt in weiterer<br />
Folge zu einem ambivalenten Verhältnis der bürgerlichen Gesellschaft<br />
zu den von ihr verübten Eingriffen in ihre Außenwelt [Natur], das er als<br />
„Enttäuschungen und Schuldgefühle des homo faber“ 14 bezeichnet. Der<br />
Mensch greift zwar rational in sein Umfeld ein, allerdings handelt es<br />
sich nicht um eine absolute, sondern um eine relative Zweckrationalität,<br />
da nicht alle Konsequenzen dieser Eingriffe kalkulierbar und absehbar<br />
sind. Durch den Einsatz technischer Mittel können Veränderungen bewirkt<br />
werden, deren vorausgesehener Effekt zwar einerseits eintritt, die<br />
jedoch andererseits Folgen haben, die schwer oder gar nicht kalkulierbar<br />
sind. Daraus wiederum konnte ein Gesellschaftsbild entstehen, in dem<br />
die menschliche Existenz als „schädlich“ betrachtet wird und Bildern der<br />
„heilenden Natur“ gegenüber steht. In dieser Wahrnehmung bedarf diese<br />
heilende Natur mitunter Schutz und Pflege. In diesem Konzept kommt<br />
der Natur eine ideologische Bedeutung zu. „Natürlich“ ist einerseits z. B.<br />
der Wald, andererseits aber auch die Bäuerin oder der Bauer, wenn diese/r<br />
konservative Agrarpolitik betreibt. „‚Natürlich‘ ist alles, was so alt ist,<br />
dass es den Anschein der Ursprünglichkeit hat […].“ 15 Als natürlich und
266 — 267<br />
Gundi Jungmeier<br />
Eine kritische Reflexion<br />
dieses Begriffspaars. In:<br />
Rolf Wilhelm Brednich, Annette<br />
Schneider, Ute Werner<br />
(Hg.): Natur – Kultur. Volkskundliche<br />
Perspektiven<br />
auf Mensch und Umwelt.<br />
Münster (u. a.): Waxmann<br />
2001, S. 11.<br />
12<br />
Hans Paul Bahrdt: „Natur“<br />
und Landschaft als kulturspezifischeDeutungsmuster<br />
für Teile unserer<br />
Außenwelt. In: Gert Gröning<br />
und Ulfert Herlyn (Hg.):<br />
Landschaftswahrnehmung<br />
und Landschaftserfahrung<br />
(=Arbeiten zur sozialwissenschaftlich<br />
orientierten<br />
Freiraumplanung, Bd. 10),<br />
Münster: Lit 1996, S. 168-<br />
169.<br />
13<br />
Brigitta Hauser-Schäublin,<br />
Von der Natur in der Kultur,<br />
S. 13.<br />
14<br />
Hans Paul Bahrdt: „Natur“<br />
und Landschaft als kulturspezifischeDeutungsmuster<br />
für Teile unserer Außenwelt,<br />
S. 174.<br />
15<br />
Ebda., S. 175.<br />
16<br />
Ebda, S. 176.<br />
17<br />
Ebda., S. 174-176.<br />
18<br />
Michael Huter: Die Idee der<br />
Landschaft. In: Wolfgang<br />
Kos: Die Eroberung der<br />
Landschaft. Semmering –<br />
Rax – Schneeberg. Wien:<br />
Falter 1992, S. 49–53.<br />
damit als berechtigt werden in diesem System auch Rangunterschiede<br />
der sozialen Schichten, Heterosexualität oder Statusunterschiede zwischen<br />
Mann und Frau usw. betrachtet. Hinter dem Begriff Natur verbirgt<br />
sich demzufolge eine ganze Reihe unterschiedlicher biologischer,<br />
psychologischer und sozialwissenschaftlicher Argumente, Meinungen,<br />
Überzeugungen usw.<br />
Obwohl die Natur in vielen Bereichen des Lebens rationalen Gesichtspunkten<br />
untergeordnet wird, erhält sie einen Platz in „unverbindlichen Bereichen“<br />
16 , z. B. in der Freizeit (Bewegung im Freien, Zeit an der frischen Luft<br />
verbringen) oder auch im Bereich des Wohnens (ein Haus im Grünen). Hier<br />
entsteht ein Wirkungsbereich für das „schlechte Gewissen der bürgerlichen<br />
Gesellschaft“ angesichts der Eingriffe, die aufgrund rationaler Herangehensweise<br />
verübt wurden. 17<br />
Die Vorstellung von Natur geht zudem oft einher mit der Vorstellung von<br />
Landschaft, jedoch unterscheiden sich diese beiden Begriffe stark voneinander.<br />
Landschaft ist vielmehr die subjektive ästhetische Erfahrung der<br />
Betrachterin/des Betrachters. Das bedeutet, dass Landschaft im individuellen<br />
Bewusstsein entsteht. Die Interpretation(en) des wahrgenommenen<br />
Außenraumes (des Naturraumes bzw. der menschlich geschaffenen räumlichen<br />
Veränderungen darin, z. B. Bauwerke, bewirtschaftete Flächen usw.)<br />
prägen die individuelle Wahrnehmung von Landschaft. 18<br />
Die Vermischung des Naturbegriffes mit dem Landschaftsbegriff und<br />
Bahrdts Feststellung, dass kulturelle Gegebenheiten durch das Verstreichen<br />
von Zeit als natürlich betrachtet werden, eröffnen eine ganze Reihe<br />
weiterer Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs Natur und bedingen unterschiedliche<br />
Vorstellungen darüber, wie mit ihr umgegangen werden soll.<br />
Auch im Falle der Natura 2000-Gebiete entlang der steirischen Enns<br />
handelt es sich nicht um unberührte Natur, sondern um Flächen, die für<br />
landwirtschaftliche Nutzung urbar gemacht wurden, also um sogenannte<br />
„Sekundär-Lebensräume“ für darin vorkommende Tier- und Pflanzenarten.<br />
19<br />
Ist die heimische Natur auch längst durch vielfältige nachhaltige Eingriffe<br />
in Flora und Fauna drastisch verändert worden, so sind Ängste vor Klimaveränderungen<br />
und vor der Störung des biologischen Gleichgewichtes<br />
– das vielerorts durch menschliches Zutun reguliert und stabilisiert wird<br />
bzw. werden muss – fester Bestandteil des heutigen gesellschaftlichen<br />
Bewusstseins. Diese Entwicklung geht in erster Linie auf die sogenannte<br />
„Ökologiebewegung“ zurück.<br />
Denn wenn Naturschutz auch keine Neuerfindung des 20. Jahrhunderts<br />
ist – bereits in vorangegangenen Jahrhunderten gab es Bestrebungen in<br />
diese Richtung, so entstand in den 1960er-Jahren als politisch aktives<br />
Kollektiv die „Ökologiebewegung“ 20 , deren Ursprung eng mit der Studierendenbewegung<br />
verknüpft ist und die stark im Bedürfnis bzw. in der<br />
Notwendigkeit des Schutzes und Erhaltens der Natur als menschliche<br />
Lebensgrundlage wurzelt. 21<br />
19<br />
Kundmachung zum Entwurf<br />
einer Verordnung über die<br />
Erklärung des Gebietes<br />
„Ennstal zwischen Liezen<br />
und Niederstuttern“ zum<br />
Europaschutzgebiet Nr. 41,<br />
Amt der Steiermärkischen<br />
Landesregierung, Fachabteilung<br />
13 C Naturschutz.<br />
In: http://www.verwaltung.<br />
steiermark.at/cms/beitrag/10084508/2407657/<br />
[Zugriff: 17.3.2010].<br />
20<br />
Thomas Stuhlfauth: Die<br />
Ökologiebewegung aus dem<br />
Blickwinkel der Umweltsoziologie.<br />
Norderstedt:<br />
Grin 2000, S. 5-10.<br />
21<br />
Franz-Josef Brüggemeier,<br />
Jens Ivo Engels: Den Kinderschuhen<br />
entwachsen:<br />
Einleitende Worte zur<br />
Umweltgeschichte der<br />
zweiten Hälfte des 20.<br />
Jahrhunderts. In: Franz-<br />
Josef Brüggemeier, Jens Ivo<br />
Engels (Hg.), Natur- und<br />
Umweltschutz nach 1945.<br />
Konzepte, Konflikte, Kompetenzen.<br />
Frankfurt am<br />
Main: Campus 2005, S. 11.<br />
22<br />
Michael Jungmeier,<br />
Christina Pichler-Koban:<br />
Natura 2000 und Regionalwirtschaft.<br />
In: Ernst Zanini,<br />
Barbara Reithmayr (Hg.):<br />
Natura 2000 in Österreich,<br />
S. 245–255.<br />
23<br />
Interview, Universalmuseum<br />
Joanneum, Multimediale<br />
Sammlungen/Büro der<br />
Erinnerungen (i. d. F.: UMJ),<br />
26.3.2010.<br />
24<br />
Aufruhr gegen „Natura<br />
2000“. Bezirkspolitiker kündigen<br />
Marsch nach Brüssel<br />
an. In: Der Ennstaler.<br />
Unabhängiges Wochenblatt<br />
für das gesamte Ennstal,<br />
16.9.2004, zit. nach: www.<br />
derennstaler.at/cms/berichte/detail.php?id=2355<br />
[Zugriff: 12.3.2010].<br />
Naturschutz im Sinne der Natura 2000 stellt eine Herangehensweise<br />
dar, die vorsieht, Lebensräume bestimmter Tier- und Pflanzenarten zu<br />
erhalten und gleichzeitig neue Möglichkeiten für die betreffende regionale<br />
Wirtschaft zu eröffnen. 22<br />
Diese bereits eingangs erwähnte Zielsetzung in der Handhabung der<br />
Natura 2000-Gebiete, nämlich ökologische und ökonomische Interessen<br />
miteinander zu verknüpfen bzw. dadurch neue wirtschaftliche Ressourcen<br />
zu erschließen, erweist sich in der Praxis – nicht zuletzt aufgrund<br />
unterschiedlicher Vorstellungen von Natur und divergierenden Anforderungen<br />
an diese – als nicht ganz unproblematisch.<br />
Auch im Fall der Schutzgebiete an der Enns trafen unterschiedliche<br />
Meinungen, Bedürfnisse und Interessen der Menschen in der Region<br />
aufeinander. Eine Reihe von Auseinandersetzungen und Konflikten rund<br />
um die Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur war den Beschlüssen zur<br />
Natura 2000 zudem seit Jahrzehnten vorausgegangen.<br />
„Der Wachtelkönig war in der breiten Bevölkerung nicht im Bewusstsein.<br />
Das haben ein paar Spezialisten gewusst, eben „Die<br />
Vogelwarte“ [Verein „Die Vogelwarte“, Liezen], die sich eigentlich<br />
schon – glaube ich – seit den [19]80er-Jahren mit dem Vogel und<br />
auch mit der Verhinderung einer möglich mehrspurigen Straße<br />
– damals noch S8 – beschäftigt hat; und der Wachtelkönig ist<br />
nachher einfach zur Galionsfigur geworden. Und es sind im Laufe<br />
der Jahre natürlich bei Straßenbefürwortern so heftige Emotionen<br />
gegenüber diesem Vogel, den ganz wenige nur gesehen haben,<br />
entstanden, wo man sich denkt, das gibt es gar nicht, was kann<br />
der Vogel dafür? Und wenn man sich ein bisschen näher damit<br />
beschäftigt, weiß man ja, dass der Vogel nur die Spitze des Eisberges<br />
ist. Dass er halt der empfindlichste Teil ist, und [dass]<br />
viele andere Vogelarten und Tiere […] diese Bereiche oder diese<br />
naturräumlichen Voraussetzungen brauchen [..], und das weiß<br />
man, das ist auch nachgewiesen. Aber der Wachtelkönig ist halt<br />
die Leitfigur geworden.“ 23<br />
„Während die Bezirks-‚Grünen‘ jubeln, zeigen sich die Ortschefs<br />
und Wirtschaftstreibenden der davon betroffenen acht Gemeinden<br />
darüber entsetzt. Seitens der Wirtschaftskammer hagelt es<br />
ebenfalls Proteste. ‚Man könne doch eine wirtschaftlich ohnehin<br />
angeschlagene Region mit hoher Arbeitslosigkeit nicht so ohne<br />
weiteres‚ unter einen Glassturz stellen‘, lauten die Kommentare.“<br />
24<br />
„Ich sehe die Vorteile [darin], dass bestehende Landschaften<br />
erhalten werden können. Alles was mit der Natura 2000-Aus-
268 — 269<br />
Gundi Jungmeier<br />
25<br />
Interview, UMJ, 26.3.2010.<br />
26<br />
Interview, UMJ, 8.4.2010.<br />
27<br />
Interview, UMJ, 6.4.2010.<br />
28<br />
Interview, UMJ, 26.3.2010.<br />
29<br />
„Natura 2000“ sorgt<br />
weiter für Diskussionen.<br />
Bauernschaft im Ennstal<br />
trotz Information skeptisch.<br />
In: Der Ennstaler.<br />
Unabhängiges Wochenblatt<br />
für das gesamte Ennstal,<br />
27.9.2004, zit. nach: http://<br />
www.ennstal.com/derennstaler/ennstaler-archiv.htm<br />
[Zugriff: 15.3.2010].<br />
30<br />
Interview, UMJ, 26.3.2010.<br />
31<br />
Interview, UMJ, 6.4.2010.<br />
weisung zusammenhängt, ist für mich persönlich einfach gut.<br />
Ich möchte in dem Tal wohnen bleiben und nicht irgendwann<br />
einmal draufkommen, dass ich die Belastungen, die zum Beispiel<br />
vom Verkehr ausgehen, nicht mehr aushalte. Und darum tue ich<br />
persönlich etwas, damit das möglichst nicht passiert. Und da gehört<br />
es eben dazu, dass man sich engagiert, und dass man sich<br />
halt für die verschiedenen Sachen interessiert und hofft, dass<br />
irgendwann die hohe Politik auch einsieht, dass die Lobbygesellschaft<br />
nicht unbedingt das ist, wo man sich total engagieren<br />
soll, sondern [dass es] besser ist, naturräumliche Situationen zu<br />
erhalten, die positiv sind fürs Überleben der Menschheit. [… ] Ich<br />
war immer da, ich bin nie weg gewesen […]. Ich bin auch einer<br />
der […] schon viel auf den Bergen unterwegs ist, und es ist ein<br />
erhebendes Gefühl auf einem Gipfel zu stehen und in die Ferne zu<br />
schauen. Aber wenn man dann hinunter schaut ins Tal, dann ist<br />
einem auch bewusst, wie eng das Tal ist, und wie verdammt gut<br />
[..] man aufpassen muss, dass diese Naturschätze, die da unten<br />
vorherrschen, nicht verloren gehen. Und das ist einfach auch ein<br />
extremes Anliegen für mich. Weil ich, glaube ich halt, nicht nur<br />
für unsere Generation denken will, sondern auch für viele nachfolgende<br />
Generationen, und was unsere Generation momentan mit<br />
der Natur macht, das ist eigentlich fürchterlich. Das ist mir halt<br />
total wichtig.“ 25<br />
„Ich glaube, dass diese besonders schützenswerten Gebiete, wie<br />
es diese Natura 2000- Gebiete sind, dass die nur dadurch ausgewiesen<br />
werden konnten, weil die Landwirtschaft da in der Vergangenheit<br />
alles so gemacht hat, dass man heute noch so besonders<br />
schützenswerte Gebiete hat. Und ich glaube, das ist auch das<br />
Wichtige für die Zukunft, dass man auf die Bauern schaut, weil<br />
das sind diejenigen, die die Gebiete erhalten.“ 26<br />
„Die Sache ist aus unserer Sicht, also aus der Sicht der Wirtschaft<br />
sehr unglücklich gelaufen. Es hat einen Gebietsvorschlag gegeben,<br />
der für die Wirtschaft ein bissl problematisch gewesen ist,<br />
weil er letztendlich den gesamten Talboden mehr oder weniger<br />
in Anspruch genommen hat und wir im Talboden – nachdem wir<br />
sonst keine Ausdehnungsmöglichkeiten mehr haben – die einzige<br />
Chance gesehen haben oder noch immer sehen, dass wir uns wirtschaftlich<br />
weiterentwickeln können.“ 27<br />
„Im Endeffekt hat es [die Gebietsausweisung] unter sehr großem<br />
Zeitdruck passieren müssen. […] Und das ist wirklich im letzten<br />
möglichen Abdruck passiert […]. Das Land Steiermark ist schon<br />
verurteilt gewesen zu dieser Strafzahlung, weil es untätig war<br />
Protest gegen den Bau<br />
der Ennsnahen Trasse<br />
(ORF, 1993)<br />
[…]. Jetzt haben sie natürlich auch keine Möglichkeit mehr gehabt,<br />
mit den Grundbesitzern irgendwelche Sachen auszuverhandeln.<br />
Das war natürlich dann auch für den Dr. F. sehr mühsam.<br />
Da sind 20 Bauern dort gesessen, jeder hat geschimpft wie ein<br />
Rohrspatz über die Natura 2000-Ausweisung, und der liebe Dr. F.<br />
hat genau gewusst, er muss das jetzt machen. Er muss zu ihnen<br />
sagen: ‚Leitln, es ist so – und es kann jetzt gar nimmer anders<br />
geschehen.‘“ 28<br />
„Grundtenor aus den Reihen der Bauernschaft: Naturschutz ja,<br />
aber nicht um den Preis massiver Nachteile für den Menschen.<br />
Der Mensch, seine rechtlichen Ansprüche und wirtschaftlichen<br />
Bedürfnisse müssen im Vordergrund stehen.“ 29<br />
„Man kann in dem Sinn nicht eingreifen, dass man das unterstützt<br />
durch irgendwelche Zuchtmaßnahmen. Das Einzige, was man<br />
machen kann ist, dass man die Fläche zur Verfügung stellt, dass<br />
man seinen Lebensraum [den des Wachtelkönigs] erhält. Aber wie<br />
gesagt, Lebensraum nicht nur für den Wachtelkönig. Da gibt es<br />
das Braunkehlchen, den Kiebitz und, und, und. Also da gibt es<br />
Schmetterlinge, die nur da vorkommen und es gibt wirklich keine<br />
Sparte, von der man nicht sagen kann, die profitieren auch davon<br />
[von der Natura 2000].“ 30<br />
„Der politische Bezirk Liezen ist wahrscheinlich der bestuntersuchteste<br />
[Bezirk], den es in der ganzen Steiermark gibt. […]<br />
In etwa 70% der Gesamtfläche ist jetzt von irgendeiner Naturschutzmaßnahme<br />
betroffen. Und für uns war immer das Argument<br />
spannend: ‚Man muss die Natur schützen‘. So quasi die Wirtschaft<br />
betreibt sonst Raubbau. Das ist so mehr oder weniger ein bisserl<br />
rübergekommen. Das stimmt insofern nicht, weil wir sehr wohl<br />
wissen, dass wir von einer intakten Natur leben und unsere Schigebiete,<br />
speziell im Oberland, sind ja das beste Beispiel dafür,<br />
dass mit der Ressource Natur sehr vorsichtig agiert wird, weil das<br />
letztendlich unser Erwerbskapital ist.“ 31
270 — 271<br />
Maria Papdimitriou<br />
T.A.M.A., 2005<br />
1<br />
www.trans-formers.org/<br />
artists_1/301_papadi_d.htm<br />
[Zugriff: 28.4.2010].<br />
Glaube oder Aberglaube?<br />
Gernot Rabl<br />
Die griechische Künstlerin Maria Papadimitriou hat sich bereits in der<br />
Vergangenheit mit kollektiven Projekten beschäftigt, die neben der Fotografie<br />
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden. In diesem Zusammenhang<br />
kann vor allem auf ihre unter dem Titel Temporary Autonomous Museum<br />
For All (T.A.M.A.) initiierte Arbeit verwiesen werden. 1<br />
Auch im Rahmen ihrer Arbeit für die regionale10 war für die Künstlerin<br />
von Beginn an die Einbindung der Bevölkerung ein primäres Anliegen.<br />
Dies entsprach im Übrigen dem Wunsch der regionale10-Verantwortlichen,<br />
die darin – wie in der Schnittstelle zwischen Kunst und Alltagskultur<br />
– einen zentralen Punkt des gesamten Festivals für zeitgenössische<br />
Kunst sahen.<br />
Schon Papadimitrious später verworfene Idee mit den das gesamte Landschaftsbild<br />
des Ennstals prägenden „Heustadeln“ sah die Einbringung<br />
persönlicher Objekte der hiesigen Menschen vor. Wurden auch die „Heustadeln“<br />
später aus ihrer Arbeit verbannt und durch einen Altar ersetzt,<br />
blieb der ursprüngliche Gedanke in leicht veränderter Weise aufrecht.<br />
Wie kam nun Maria Papadimitriou zu den Positionen, die zu ihrem künstlerischen<br />
Beitrag in Schloss Trautenfels führten, wie wurde die Bevölkerung<br />
eingebunden und welche in unserem Diskurs wesentlichen Überlegungen<br />
sind darin auszumachen?<br />
Die Räume des Landschaftsmuseums im ersten Stock von Schloss Trautenfels<br />
widmen sich in klar strukturierter Weise je eines übergeordneten<br />
Themas, wobei sich Papadimitriou speziell auf den Raum „Vom wahren<br />
Glauben“ konzentrierte. Dieser behandelt nicht nur das Thema Reformation<br />
und Gegenreformation – bestimmte Bereiche des Bezirkes Liezen<br />
stellten bis zur gewaltsamen Unterdrückung 1599 Hochburgen für den<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar, 2010<br />
(Detail)<br />
2<br />
Eva Kreissl: heilsam.<br />
Volksmedizin zwischen<br />
Erfahrung und Glauben.<br />
Katalog zur gleichnamigen<br />
Sonderausstellung des<br />
Volkskundemuseums am<br />
Landesmuseum Joanneum.<br />
Graz 2006, S. 13.<br />
3<br />
Klaus Beitl: Volksglaube.<br />
Zeugnisse religiöser<br />
Volkskunst. München:<br />
Hugendubel 1983, S. 5.<br />
4<br />
Vgl. Martin Urban: Wer<br />
leichter glaubt, wird<br />
schwerer klug. Wie man das<br />
Zweifeln lernen und den<br />
Glauben bewahren kann.<br />
Frankfurt a. M.: Eichborn<br />
2007.<br />
5<br />
Vgl. den Beitrag von Jennifer<br />
Allen in diesem Band.<br />
protestantischen Glauben dar – sondern zeigt unter anderem auch zahlreiche<br />
Votivgaben und Wachsvotive, in welche die Menschen ihre Hoffnungen<br />
und Wünsche legten. Eine beispielsweise aus Wachs hergestellte<br />
Kröte soll Fruchtbarkeit herbeiführen, ein Wickelkind dem Neugeborenen<br />
Schutz bescheren sowie Füße, Hände oder Zahnreihen eine Heilung der<br />
entsprechenden Körperteile erbitten oder Dank sagen. Votivgaben sind<br />
ganz allgemein Zeichen eines Gelübdes oder Gnadenerweises einer/<br />
eines angerufenen Heiligen – bei den Exponaten im Landschaftsmuseum<br />
vertrauten die Gläubigen häufig auf die Muttergottes. Während die genannten<br />
Objekte in einem klaren Bezug zum Glauben und Gebet stehen –<br />
Tausende von Votivgaben in Kirchen bezeugen übrigens, „dass Vertrauen<br />
und Kommunikation mit dem Höheren erfolgreich zur Heilung beigetragen<br />
haben“ 2 –, geht Maria Papadimitriou einen Schritt weiter, indem sie<br />
die Symbole und Objekte unserer Ängste zu ergründen sucht.<br />
In unserer Zeit stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit wir gegenwärtig<br />
eigentlich noch „Bilder“ für unseren Glauben und/oder Aberglauben<br />
brauchen. „Es gab Zeiten, in denen religiöse Symbole, Bilder und religiöses<br />
Brauchtum eine Selbstverständlichkeit waren; Zeiten auch, die in<br />
einer Vielfalt von Zeichen, Bildern und Brauchtum geradezu geschwelgt<br />
haben, so daß man manchmal den Eindruck hat, die Fülle der äußeren<br />
Symbole verstelle fast den Blick auf die gemeinte religiöse Wirklichkeit,<br />
die sie doch zugänglich machen sollte. Wir sind nüchtern geworden.<br />
Viele Symbole und Bilder ebenso wie altvertraute Bräuche haben ihre<br />
Ausdruckskraft eingebüßt und sagen uns nur mehr sehr wenig. Wir orientieren<br />
uns nach dem, was wir zählen, wägen und messen können ….“ 3<br />
Ungeachtet dessen lässt sich der Mensch in seinem Wunsch nach Sicherheit<br />
immer wieder überlisten, denn neurologisch gesehen ist der Homo<br />
sapiens nach wie vor mit einem Gehirn ausgestattet, welches sich seit<br />
der Steinzeit nicht verändert hat und vor allem auf das Überleben hin<br />
ausgerichtet ist. So werden unvollständige Informationen, also Dinge,<br />
die wir nicht beeinflussen oder uns erklären können, ergänzt, indem<br />
das Unbekannte in bekannte Bilder oder Objekte eingeordnet wird. Aus<br />
diesem Grund bestimmt weniger das Wissen, als vielmehr der Wunsch<br />
nach Schutz und Überschaubarkeit der eigenen Welt das menschliche<br />
Handeln. Eine immer komplexer werdende Wirklichkeit erfordert neue<br />
Zugänge. 4<br />
Maria Papadimitriou 5 schuf für die Sonderausstellung einen Altar nach<br />
dem Vorbild altgriechischer Opferaltäre und forderte die Bewohner/innen<br />
des Bezirkes Liezen auf, persönliche Schutzobjekte (symbolhaft verdichten<br />
sich diese bei Papadimitriou zu kleinen „Wünsch-Dir-Was-Glücksschafen“),<br />
welche über die erwähnten Votivgaben, Amulette oder Talismane<br />
hinausgehen, am Altar darzubringen, um die wie immer gearteten Ängste
272 — 273<br />
Gernot Rabl<br />
6<br />
Der Ennstaler, Nr. 10, 105.<br />
Jg., 12. März 2010, S. 24.<br />
abzulegen. Vor allem die Gruppierung der unterschiedlichsten Objekte in<br />
und außerhalb der Einfamilienhäuser und den damit verbundenen Funktionen<br />
(zum Beispiel Unwetter abhaltende „Sonnwendbüscherln“), weckten<br />
bereits im Vorfeld Papadimitrious Interesse und trugen wesentlich zu<br />
ihrer späteren Arbeit bei. Durch die nun neue und aus dem Zusammenhang<br />
gerissene Form der Präsentation rückt folglich auch ein scheinbar<br />
materiell wertloses Objekt, jedoch mit klarem persönlichem Bezug, in<br />
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Weiter gefasst kann auch an die<br />
mit Opfergaben verbundenen Rituale erinnert werden – Opfergaben als<br />
Darbringung an eine übergeordnete, übernatürliche Kraft.<br />
Aus dieser Motivation heraus ergab sich die Überlegung, die Bevölkerung<br />
„ihre“ Bräuche, Symbole oder Schutzobjekte selbst definieren zu lassen<br />
und zu ergründen, was sie bereit wären für die eigene Sicherheit zu „opfern“.<br />
Diesen und ähnlichen Fragen versuchte am zweitägigen 20. Schafbauerntag<br />
(vom 19. bis 20. März 2010) ein Team von Kulturwissenschaftlerinnen<br />
und -wissenschaftlern nachzugehen. Papadimitriou wählte,<br />
nachdem bei einem ihrer ersten Aufenthalte im Ennstal der Kontakt zu<br />
den Verantwortlichen hergestellt und ein Interesse geweckt worden war,<br />
bewusst diese Veranstaltung aus. Aufgrund der zu erwartenden breiten<br />
Streuung der Besucher/innen schienen auch begleitende Recherchen<br />
Sinn zu machen. Mit der Bitte um eine aktive Beteiligung der Besucher/<br />
innen erfolgte unter dem Titel „regionale10 und Schafbauerntag“ über<br />
die Presse folgender Aufruf: An beiden Tagen besteht die Möglichkeit,<br />
„sich in Interviewform den gezielten Fragen der regionale 10 Mitarbeiter<br />
zu stellen und somit selbst Teil der Sonderausstellung Der schaffende<br />
Mensch. Welten des Eigensinns im Schloss Trautenfels zu werden …. Auf<br />
rege Beteiligung und Schilderungen der unterschiedlichsten Art – von<br />
lustig über spannend bis berührend – freut sich das regionale10-Team.“ 6<br />
Ausgerüstet mit einfachen Aufnahmegeräten wurden sowohl Besucher/<br />
innen wie Teilnehmer/innen mit Fragen unter anderem zu den oben genannten<br />
Themen spontan interviewt.<br />
Erwartungsgemäß spielte in der Einschätzung über schutzbietende<br />
Objekte auch der Aberglaube eine zentrale Rolle (hierbei wurden häufig<br />
Silvesterglücksbringer genannt). Kennzeichnet der Begriff des „Aberglaubens“<br />
auch nichtchristliche Religionen, gilt er auch als Abweichung von der<br />
Vernunft über etwas nicht zu bestätigendes oder belegbares, ist auf der<br />
anderen Seite die Grenze zum „anerkannten“ Volksglauben sehr schmal.<br />
So kann dabei an die zahlreichen Bauernregeln erinnert werden, die auf<br />
langjährigen, oft über Generationen weitergegebenen Erfahrungen beruhen.<br />
Die dadurch ableitbaren Wettervorhersagen spielen, wenn man<br />
etwa der Profession einer Landwirtin bzw. eines Landwirtes nachgeht<br />
und in vielen Belangen von der Natur abhängig ist, eine wichtige Rolle.<br />
7<br />
Helmut Groschwitz: Anmerkungen<br />
zum Verhältnis<br />
populärer Esoterik und<br />
popularer Religiosität als<br />
Ausstellungsthema. In:<br />
Anja Schöne (Hg.): Dinge<br />
– Räume – Zeiten. Religion<br />
und Frömmigkeit als Ausstellungsthema.<br />
Münster:<br />
Waxmann 2009, S. 41.<br />
8<br />
Christoph Daxelmüller:<br />
Vorwort. In: Hanns<br />
Bächtold-Stäubli (Hg.):<br />
Handwörterbuch des deutschen<br />
Aberglaubens, Bd. 1.<br />
Berlin u.a.: De Gruyter 1987,<br />
S. XXIII ff.<br />
9<br />
Hannah Arendt: Vita activa<br />
oder Vom tätigen Leben.<br />
München: Piper 2010, S. 33.<br />
Vom Aberglauben selbst ist jedoch ein Großteil der Menschen – ob im<br />
ländlichen oder städtischen Raum – betroffen, wenn beispielsweise mit<br />
gewissen Gegenständen, der Verknüpfung bestimmter Handlungen oder<br />
mit täglichen kleinen Riten ein wie immer gearteter Erfolg verbunden<br />
wird. Einfache Symbole werden zu Glücksbringern und halten imaginäres<br />
Unheil von uns fern. In der psychologischen Funktion verschaffen sowohl<br />
Glaube als auch Aberglaube den Menschen Sicherheit. Berufsgruppen<br />
mit zeitweilig riskanten Tätigkeiten, wie zum Beispiel Seeleute, Bergknappen<br />
oder auch Bäuerinnen und Bauern, waren und sind aus diesem<br />
Grund abergläubischen Riten wesentlich stärker zugetan.<br />
Jene Rituale und Gegenstände, die nun im Diskurs von „Aberglaube“ oder<br />
„Volksglaube“ betrachtet werden, befinden sich aber in einem Grenzbereich<br />
populärer Religiosität. So weiß man von zahlreichen Objekten,<br />
„deren Materialien über den religiösen Gebrauchswert hinausgehen,<br />
denen übernatürliche Wirkungen zugeschrieben wurden und die dem<br />
christlich legitimierten Wunderglauben zuzuordnen sind.“ 7<br />
Die Grenzen sind somit fließend, und scheinbar festgeschriebene Formen<br />
führen durch individuelle Abweichungen und Auslegungen, die nicht einer<br />
gesellschaftlichen und/oder wissenschaftlichen Idee folgen (zum Beispiel<br />
Naturdeutung), zu eigenen, magischen Kausalitäten. Es kommt zu Ab-<br />
und Ausgrenzung von kirchlichen und naturwissenschaftlichen Dogmen.<br />
Eine allgemeingültige Definition von Aberglaube und dem damit verbundenen<br />
oben erwähnten Sicherheitsbedürfnis ist somit unmöglich, da eine<br />
subjektive Auslegung, heute wie damals und unabhängig vom ländlichen<br />
oder urbanen Bereich, dominiert. Letztlich sind eine dem Aberglauben<br />
zweifelsfrei innewohnende magische Komponente und die Überzeugung,<br />
dass sich, neben physikalisch erklärbaren Gesetzmäßigkeiten, eine darin<br />
verborgene okkulte Wirklichkeit befindet, die Garanten dafür, dass diese<br />
Form der Schutzsuche auch in Zukunft seine Faszination beibehält. 8<br />
Untrennbar verbunden mit den wie immer gearteten Handlungen ist<br />
dabei die Tatsache, dass jeder Mensch durch die eigene Umgebung,<br />
Landschaft, Erziehung oder Erfahrung geprägt wird. Aus diesem Grund<br />
bewegt sich auch die „Vita activa, menschliches Leben, sofern es sich auf<br />
Tätigsein eingelassen hat, … in einer Menschen- und Dingwelt, aus der<br />
es sich niemals entfernt und die es nirgends transzendiert. Jede menschliche<br />
Tätigkeit spielt in einer Umgebung von Dingen und Menschen; in ihr<br />
ist sie lokalisiert und ohne sie verlöre sie jeden Sinn. Diese umgebende<br />
Welt wiederum, in die ein jeder hineingeboren ist, verdankt wesentlich<br />
dem Menschen ihre Existenz, seinem Herstellen von Dingen, seiner pflegenden<br />
Fürsorge des Bodens und der Landschaft, seinem handelnden<br />
Organisieren der politischen Bezüge in menschlichen Gemeinschaften.“ 9<br />
Folglich befinden sich auch Glaube und Aberglaube – gebunden eben
274 — 275<br />
Gernot Rabl<br />
10<br />
Helmut Groschwitz: Anmerkungen<br />
zum Verhältnis<br />
populärer Esoterik und<br />
popularer Religiosität als<br />
Ausstellungsthema. In:<br />
Anja Schöne (Hg.): Dinge<br />
– Räume – Zeiten. Religion<br />
und Frömmigkeit als Ausstellungsthema.<br />
Münster:<br />
Waxmann 2009, S. 46.<br />
an feste Orte und Rituale – in einem stetigen Wandel. Aufgrund der soziokulturellen<br />
Entwicklungen und den immer komplexer werdenden Anforderungen<br />
suchen Menschen somit nicht nur in der Religion (Glaube),<br />
sondern auch – und dies mitunter durchaus ergänzend – Zuflucht in der<br />
Esoterik („Aberglaube“ im weitesten Sinn). Allen damit verbundenen<br />
Objekten, wie eben Amuletten, Pendeln, Traumfängern, Talismanen usw.<br />
ist eines gemeinsam: Aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen<br />
erschließen sie sich den Betrachter/innen nicht ohne entsprechende Kontextualisierung.<br />
10 Aus diesem Grund versuchte ein (auch nicht immunes)<br />
Team von Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern während<br />
des Schafbauerntages, Hintergründe und Beweggründe zu erfragen. Offene<br />
Schilderungen über Ängste und Sehnsüchte machten letztlich vieles<br />
begreifbarer und verdeutlichen, wie viel „Tiefe“ in scheinbar bedeutungslosen<br />
Dingen steckt. Maria Papadimitriou holte diese „Tiefe“ ins Museum<br />
und sorgt mit ihrem Altar und den scheinbar naiv beigegebenen kleinen<br />
Schafen für eine gänzlich neue Raumwirkung.<br />
Wie bereits in dieser kurzen Abhandlung deutlich wird, handelt es sich bei<br />
diesem letztlich auch heiklen Thema um ein sehr komplexes Feld. Die Abhandlungen<br />
und Meinungen dazu sind vielfältig und individuell. Dennoch<br />
lässt sich resümierend und vereinfacht feststellen, dass die Grenzen zwischen<br />
Glaube und Aberglaube häufig ineinander übergehen – dient doch<br />
jede Form der Ausübung (vgl. Interviews im Anschluss) nur dem zutiefst<br />
menschlichen Wunsch nach Schutz und Sicherheit.<br />
„Die Trud’ ist angeblich – laut der Überlieferung – eine alte Frau,<br />
die mit den Kindern herumzieht, die keine Namen erhalten haben,<br />
die gestorben sind, während der Geburt, vor der Geburt, wie auch<br />
immer. Und da sagt man, das ist immer in der Walpurgisnacht, da<br />
geht sie immer mit den Kindern herum und da stellt man entweder<br />
Zuckerl hinaus oder man richtet ein paar Apferl hinaus. Und man<br />
sagt einfach Namen so hinaus, in die Luft. Irgendwelche Namen<br />
die einem gerade einfallen, damit die Kinder Namen erhalten. Und<br />
sobald ein Kind einen Namen hat, kann es weitergehen. Das ist ein<br />
ganz alter Brauch, der stammt noch aus – sie vermuten – aus der<br />
Zeit der Kelten. […] Für mich ist das eigentlich ein Glücksbringer,<br />
weil […] es heißt ja du sollst jeden mit [seinem] Namen ansprechen,<br />
und damit gibst du ihm eine Persönlichkeit, eine Wichtigkeit,<br />
und mir kommt vor, dadurch kommt Segen auf den Betrieb<br />
zurück.“<br />
„Ich glaube Angst ist ein schlechter Ratgeber. Man soll also vor<br />
solchen Ereignissen [Wetterschäden] keine Angst haben. Das<br />
gehört einfach zur Landwirtschaft dazu.“<br />
11<br />
Interviews, Universalmuseum<br />
Joanneum, Multimediale<br />
Sammlungen/Büro der<br />
Erinnerungen, 20.3.2010.<br />
„Ich glaube das Wichtigste ist der Glaube an die Zukunft. Und<br />
wenn man einen Weg in Zukunft begehen will, dann ist das keine<br />
Einbahnstraße, sondern man muss Rückschläge zur Kenntnis<br />
nehmen. Und wie gesagt, so ein Rückschlag ist zum Beispiel auch<br />
der Hagel oder sonst irgendeine Sache. Aber das sind Dinge, die<br />
man eben im Leben mitmachen muss. […] Klar, ist ein christlicher<br />
Glaube hier von Vorteil und macht einem auch wieder Mut. Ich<br />
muss aber sagen, an sonstige Glücksbringer, irgendwelche Spielzeuge<br />
oder sowas, glaube ich nicht.“<br />
„Früher wenn man ein Haus gebaut hat, [hat man] unter dem<br />
Haus beim Eingang vorne ein lebendes Tier begraben. Das war ein<br />
uralter Brauch, um das Böse abzuhalten. Das ist uralt, das macht<br />
heute niemand mehr.“<br />
„Ich glaube, wenn man daran glaubt [an schützende Bräuche],<br />
dann wird es etwas bringen. Ich glaube nicht daran, mir bringt<br />
es nichts, und ich nehme auch in Kauf, was auf mich zukommt –<br />
[damit ist es für mich] erledigt.“<br />
„Wir weihen auch unsere Autos immer, damit wir keinen Unfall<br />
haben – das ganze Jahr. Und die Haube tut man auch einweihen,<br />
dass man nicht krank wird.“<br />
„Das ist das Räuchern […] das ist so eine Rauchpfanne mit Weihrauch,<br />
Kranewitter [Wacholder], Gras, Palmzweigerl von der Palmprozession,<br />
die kommen in einen Topf hinein – mit einer Glut und<br />
dann gehen wir alles durch – Haus, Garage, Stall, alles. In jeden<br />
Raum wo gearbeitet wird gehen wir hinein und dahinter geht einer<br />
[Weihwasser] versprengen. Und für mich ist das eigentlich – ich<br />
gehe da mit seit ich ein kleiner Bub war, und ich möchte das auch<br />
weiterhin so machen.“ 11
276 — 277<br />
1<br />
Eine eindrückliche Darstellung<br />
zur Technikgeschichte<br />
der Lodenwalken liefert<br />
Johann Schwertner: Der Lodenwalker<br />
in der Ramsau.<br />
Ein Beitrag zur Volkskunde<br />
des steirischen Handwerks.<br />
Phil. Diss., Graz 1988;<br />
Johann Schwertner: „…von<br />
einem guoten stampfhart.<br />
Loden im Wandel der<br />
Zeit (=Schriftenreihe des<br />
Kärntner Freilichtmuseums<br />
in Maria Saal). Klagenfurt<br />
1996.<br />
2<br />
Siehe dazu die aus der<br />
Region (Ennstal, Steirisches<br />
Salzkammergut) stammenden<br />
Mitgliedsbetriebe<br />
der Meisterstrasse (www.<br />
meisterstrasse.at).<br />
Wetterfest in die Globalisierung<br />
Notizen zur unverwüstlichen<br />
Karriere des Lodens<br />
Günther Marchner<br />
Das Ding aus einer anderen Zeit<br />
Die „zweite Haut“ der schaffenden Menschen wurde in den Gegenden des<br />
Bezirks Liezen – wie in anderen alpinen Räumen – aus Tierhäuten, Wolle<br />
und Flachs zu Loden, Leder und Leinen und schließlich zur Kleidung lokal<br />
verarbeitet. Dieses „G’wand“ für Alltag und Arbeit ist im Prozess von<br />
Industrialisierung und Globalisierung unserer Arbeits-, Wirtschafts- und<br />
Lebensverhältnisse als „Mainstream-Kleidung“ beinahe bedeutungslos<br />
geworden. Aber vielleicht nur vorläufig.<br />
Zum Teil bis in die 1950er- und 1960er-Jahre hat sich die historische<br />
Funktion von Loden-, Leder- oder Leinenbekleidung und damit verbundener<br />
Gewerbe erhalten: Loden als Wollprodukt schützte vor den Elementen<br />
der „verschärften“ alpinen Natur und war Material für die Arbeitskleidung<br />
von Bauern oder Holzknechten. Bauern tauschten die Wolle ihrer Schafe<br />
gegen gewalkte Wolle (Loden) ein. Historisch wurde Lodenwalken in den<br />
meisten Fällen als Nebengewerbe und Dienstleistung für den Bedarf des<br />
lokalen Umfeldes betrieben. 1 Störschneider zogen von Hof zu Hof und<br />
erzeugten bzw. richteten bis in die Zeit der Textilhandelsgeschäfte das<br />
„Jahresg’wand“ für die bäuerliche Bevölkerung.<br />
Nun sind Schneider beinahe ausgestorben, außer sie schaffen es, in<br />
einem Exklusivbereich mit hochpreisigen Qualitätsprodukten für einen<br />
spezifischen Markt zu operieren. 2 Ebenso sind die meisten Lodenwalken<br />
im alpinen Raum verschwunden, wie insgesamt der größte Teil des europäischen<br />
Textilgewerbes. Textilwirtschaft ist – als erste Branche – Teil<br />
einer globalisierten Industrie geworden.<br />
Die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung „regionaler“ Textilprodukte<br />
und „traditioneller“ Kleidung wie im Besonderen des Lodenge-<br />
3<br />
In den folgenden Ausführungen<br />
beziehe ich mich<br />
auf folgender Literatur:<br />
Franz Lipp (Hg.): Trachten<br />
in Österreich. Wien 1984;<br />
Franz Lipp: Das Ausseer<br />
G’wand (Neuauflage).<br />
Bad Ausseee 1997; Ulrike<br />
Kammerhofer-Aggermann:<br />
Dirndl, Lederhose und<br />
Sommerfrischenidylle.<br />
In: Robert Kriechbaumer<br />
(Hg.): Der Geschmack der<br />
Vergänglichkeit. Jüdische<br />
Sommerfrische in Salzburg<br />
(=Schriftenreihe des Forschungsinstitutes<br />
für Politisch-Historische<br />
Studien<br />
der Dr.-Wilfried-Haslauer-<br />
Bibliothek, Salzburg 14).<br />
Wien (u.a.): Böhlau 2002;<br />
Salzburger Landesinstitut<br />
für Volkskunde (Hg.): Trachten<br />
nicht für jedermann?<br />
Heimatideologie und Festspieltourismus<br />
dargestellt<br />
am Kleidungsverhalten in<br />
Salzburg zwischen 1922<br />
und 1938. (=Salzburger Beiträge<br />
zur Volkskunde, Bd.<br />
6). Salzburg 1993; Bernhard<br />
Tschofen: „Urtracht“ als<br />
Touristenkostüm. Ein<br />
moderner Alpenmythos<br />
zwischen Volkskunde und<br />
Alpinismus. In: Tradition<br />
Nr. 57/Frühling & Sommer<br />
2001, S. 78-81. ders.:<br />
Trachtengrün. Berufsgewand<br />
– Gesinnungsmode<br />
– Alltagskleid. In: Tradition<br />
Nr. 63/Frühling & Sommer<br />
2004, S. 8-12.; ders.:<br />
Lebensgefühl Tracht. Wege<br />
aus der Verkrampfung. In:<br />
Nora Schönfellinger, Lutz<br />
Maurer (Red.): Tracht –<br />
Landschaft – Musik. Forum<br />
Aussee 2001, Abschlussbericht.<br />
Bad Aussee 2001,<br />
S. 10-20. Zusätzliche Informationen<br />
verdanke ich den<br />
Gesprächen mit Vertretern<br />
der Ennstaler Lodenwalken,<br />
mit zwei Schneidermeistern<br />
aus der Region sowie einem<br />
Ausseer Lederhosenmacher.<br />
wandes erfuhr einen enormen Funktions- und Bedeutungswandel: Aus<br />
dem historischen „G’wand“ der Leute entstand die „Tracht“ und die<br />
„Trachtenmode“. Der frühere Einsatz von Loden als wetterfestes Material<br />
(feuchtigkeits- und schmutzabweisend, wärmend, strapazfähig) für<br />
alpines Leben und Arbeiten wurde zunehmend von seiner Rolle als Basismaterial<br />
für Trachtenbekleidung abgelöst. Aber auf den in den letzten<br />
Jahrzehnten abnehmenden Markt für „Wetterflecke“ und Lodenmäntel<br />
folgt auf leisen Sohlen die Renaissance des Lodens als Naturprodukt für<br />
qualitätsvolle Sport- und Modebekleidung sowie dessen subtiler Einsatz<br />
in der internationalen Mode und als edler Bezugsstoff.<br />
Vom G’wand zur vieldeutigen Tracht<br />
Aus dem historischen „G’wand“ der schaffenden Menschen entwickelte<br />
sich die Tracht bzw. die Trachtenmode. 3 Denn dieses „G’wand“<br />
war immer auch „Kommunikationsfläche“, verbunden mit Bedeutungen<br />
und Zuschreibungen: Sei es aufgrund von „Kleiderordnungen“, die den<br />
Menschen per Kleidung den richtigen „Stand“ zuwiesen. Oder sei es als<br />
„Mode“, die zum Beispiel Bürgern, Hammerherren oder großen Bauern<br />
zur Präsentation von Reichtum und von sozialem Status diente oder besondere<br />
Individualität ausdrücken sollte.<br />
Im Zeitalter von Aufklärung und Romantik (18. auf 19. Jahrhundert) entdeckten<br />
Adel und Bürgertum die Natur und das „einfache Volk“. Mit dieser<br />
sehnsüchtigen Hinwendung zu einer heil erscheinenden ländlichen<br />
Welt machten sie jenes alte, regional und sozial begrenzte bäuerliche<br />
Gewand, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Relikt einer ständischen<br />
Gesellschaft galt und nur in stadtfernen, alpinen Regionen überdauerte,<br />
salonfähig – wie im Besonderen im Salzkammergut und in der Obersteiermark.<br />
Die Entwicklung von Trachten, deren heute bekannte Formen großteils im<br />
ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert entstanden, ist auch Ausdruck<br />
der Zunahme an bürgerlicher Freiheit und Individualität. In Verbindung<br />
mit ihrer Natur- und Heimatsehnsucht begannen städtisch-bürgerliche<br />
Schichten und Adelige, sich im Gewand des einfachen Volkes zu kleiden<br />
– im Gegensatz zu den abwandernden „proletarischen Massen“ aus<br />
ländlichen Regionen – und machten es als Tracht in stilisierten Formen<br />
und Verfeinerungen populär. Dies hatte aber auch Auswirkungen auf das<br />
Selbstverständnis und die kollektive Identität von ländlichen Bevölkerungsgruppen<br />
und letztlich auf ihre Kleidungsideale, da dem verblassenden<br />
alten Gewand wieder ein Wert gegeben wurde.<br />
Ein wichtiges Beispiel für die Entwicklung und Verbreitung von Tracht im<br />
19. Jahrhundert bildet der populäre graugrüne Lodenrock (der spätere
Farbproben Loden Steiner 1988 In der Lodenwalke Ramsau, 2010
280 — 281<br />
Günther Marchner<br />
Steireranzug), forciert im Besonderen von Erzherzog Johann. Dieser<br />
graugrüne Rock wird zum besonderen, vielschichtigen Symbol – mit der<br />
Farbe Grün für Natur- und Heimatverbundenheit, aber auch als Absage<br />
an feudale Werte und als Bekenntnis zum neuen Staatsbürgertum (so<br />
propagierte Erzherzog Johann eine graugrüne Landwehruniform), gleichzeitig<br />
auch „rationaleren“ Vorstellungen von Kleidung entsprechend:<br />
Abgesehen vom dezent eingesetzten Grün ist er einfärbig grau, einfach,<br />
klar, schnörkellos.<br />
Über städtische Schichten, Adel und Bürgertum ist somit aus dem alten<br />
„G’wand“ die „Tracht“ geworden. Und immer weniger dient sie dem Alltagsgebrauch,<br />
sondern vermehrt als Kleidung für festliche Anlässe und<br />
für Zwecke der Präsentation.<br />
Tracht zu tragen entwickelte sich seit dem 19. Jahrhundert insgesamt zu<br />
einer komplexen und vielschichtigen Angelegenheit: Als gewohnheitsmäßiges<br />
und „selbstverständliches“ Tragen von Loden in bäuerlich-ländlichen<br />
Milieus im Alltag. Als Bekenntnis zur „Tradition“ einer Gruppe oder<br />
einer Region, der man sich mit Stolz zugehörig fühlt. Als Lust auf die besondere<br />
Ästhetik von Formen und Stoffen und des Sich-Bewegens in den<br />
Sehnsuchtsräumen des städtischen Großbürgertums („Leichtigkeit des<br />
Seins in der Sommerfrische“). Darüber hinaus wird Tracht auch Ausdruck<br />
für kulturelle und politische Werthaltungen (Ablehnung der industrialisierten,<br />
urbanen und modernen Welt, Bekenntnis zu einer überlieferten<br />
ländlichen Welt, Heimat- und Naturverbundenheit). Mit dem beginnenden<br />
20. Jahrhundert avancierte Tracht auch zum Objekt völkischer und<br />
nationaler Strömungen.<br />
Einen besonderen Höhepunkt der Adaptierung der Kleidung der Einheimischen<br />
für ein neues Lebensgefühl städtisch-bürgerlicher Schichten in<br />
Verbindung mit Freizeit und Jagd bildet die im auslaufenden Zeitalter<br />
von Romantik und Historismus aufkeimende Sommerfrische. So ist zum<br />
Beispiel das „Dirndl“ eine Erfindung bürgerlicher Sommerfrischlerinnen,<br />
die in das „Stallg’wand“ der Almerinnen schlüpften. Über Erzherzog Johann<br />
hinaus setzten auch die Habsburger das Trachtentragen fort, wie<br />
zum Beispiel Kaiser Franz Josef, der in Lederhosen auf die Ischler Jagd<br />
ging und damit starke Signale („Natursehnsucht“, „Volksnähe“, „Heimatverbundenheit“)<br />
setzte.<br />
Gegen die Auswüchse der „X-Beliebigkeit“ von Trachtenmode seit dem<br />
Ende des 19. Jahrhunderts bemühte sich die im Kontext von Heimatbewegungen<br />
und Liebe zur Volkskultur entstandene Volkskunde um die<br />
Aufarbeitung der Trachtenentwicklung sowie auch um Maßstäbe für „korrekte“<br />
Tracht. So entstanden mehrere Trachtensammlungen. Ein besonderes<br />
Beispiel für eine umfangreiche und nachhaltig wirksame Sammlung<br />
4<br />
Konrad Mautner: Steirisches<br />
Trachtenbuch.<br />
Weitergeführt und<br />
herausgegeben von<br />
Viktor Geramb. 2 Bde.<br />
Graz 1932 und 1935 (eigentlich<br />
abgeschlossen<br />
1939); vgl. dazu: Nora<br />
Schönfellinger (Hg.):<br />
„Conrad Mautner, großes<br />
Talent“. Ein Wiener<br />
Volkskundler aus dem<br />
Ausseerland. Grundlsee<br />
1999.<br />
5<br />
So der Titel eines Klassikers<br />
von Stefan Zweig.<br />
stellt das Steirische Trachtenbuch von Konrad Mautner, des regelmäßig<br />
in Gössl verweilenden Sprosses einer Industriellenfamilie, dar. 4<br />
In der Ersten Republik war Tracht nicht nur Freizeitbekleidung für die<br />
Sommerfrische und die neuen Salzburger Festspiele, sondern auch Symbol<br />
eines Bekenntnisses zu Österreich als Staat, „den keiner wollte“ und<br />
als nostalgische Hinwendung zur versunkenen „Welt von gestern“, der<br />
k.k. Monarchie. 5 Dirndl und Lederhose avancierten zur schicken Sommermode<br />
– wie zum Beispiel im Falle von vielen Künstlern und Prominenten in<br />
der Festspielstadt Salzburg (auch ein eigener Salzburger Trachten-Look<br />
wird kreiert). Der Ständestaat progagierte in seinem Identitätsbemühen<br />
im neuen, kleineren Österreich die Einführung von Landestrachten.<br />
Völkisch-nationale Gruppierungen instrumentalisierten Tracht für Agitation<br />
und Ausgrenzung und machten sie zur „heiligen, ererbten Vätertracht“<br />
als Symbol für völkischen Heimatschutz. Die antisemitische<br />
Programmatik dieser Strömungen sprach den jüdischen Mitbürgerinnen<br />
und Mitbürgern, darunter auch vielen begeisterten Sommerfrischlern,<br />
das Recht ab, Tracht zu tragen – eine Entwicklung, die im Trachtenverbot<br />
für Juden im nationalsozialistischen Staat mündete.<br />
Nach 1945 wurde das Tragen von Tracht in vielen Kreisen desavouiert. Einerseits<br />
ist dies jenem „Graben“ zu verdanken, den die völkisch-nationale<br />
und nationalsozialistische Vereinnahmung von Trachten hinterlassen<br />
hatte. Andererseits hat diese Ablehnung von Tracht auch mit der (linken)<br />
Populärkultur seit den 1960er-Jahren zu tun. Tracht zu tragen unterliegt<br />
seither – auch aufgrund politischer Vereinnahmungen – Vorurteilen und<br />
damit verbundenen Zuweisungen (Tracht = rückständig, bürgerlich, traditionell,<br />
konservativ, rechts usw.).<br />
Zurück zum Loden: Ab den 1960er-Jahren wurde Loden (oder auch Leinen)<br />
durch neue Stoffe ersetzt. Insbesondere der traditionelle Einsatz<br />
des Lodens als funktionales Material für Arbeits- und Sportbekleidung<br />
verschwand zugunsten der Verwendung von Kunstfaser. Noch bis in die<br />
1950er-Jahre war Loden aufgrund seiner besonderen Qualitäten (feuchtigkeits-<br />
und schmutzabweisend, wärmend, strapazfähig) von Bergsteigern<br />
genutzt worden.<br />
Abgesehen von alpinen Regionen – wo Trachten verbreitet bei festlichen<br />
Anlässen getragen werden – verschwand die Tracht in den letzten Jahrzehnten<br />
aus dem Alltag, besteht jedoch in spezifischem Rahmen weiter,<br />
zum Beispiel im Rahmen von Trachten- und Heimatpflegeaktivitäten.<br />
Im Besonderen wurden örtliche Musikkapellen zu Repräsentanten von<br />
Tracht, die sich zusehends von militärischen Formationen zu kollektiv<br />
marschierenden Trachtenkörpern verwandeln. In Verbindung mit Touris-
282 — 283<br />
Günther Marchner<br />
6<br />
Aus einem Gespräch mit<br />
einem Lodenproduzenten.<br />
7<br />
Ich beziehe mich dabei auf<br />
Aussagen und Informationen<br />
aus den Gesprächen<br />
mit Vertretern der Ennstaler<br />
Lodenwalken, mit zwei<br />
Schneidermeistern aus der<br />
Region sowie einem Ausseer<br />
Lederhosenmacher.<br />
8<br />
Dieser Ursprungsstandort<br />
in Rössing in der Ramsau<br />
ist eine der ältesten Lodenwalken<br />
im Alpenraum (über<br />
500 Jahre).<br />
musregionen und populärer Volkskultur wird Trachtenmode für manche<br />
Bevölkerungsschichten in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol sowie im<br />
süddeutschen Raum zum Ausdruck eines Lebensgefühls.<br />
Heute gehört vor allem das Ausseerland – wie andere Teile des Salzkammergutes<br />
– zu jenen besonderen „Trachteninseln“, die sich im<br />
Wechselspiel des eigensinnigen Stolzes der Bewohner/innen mit dem<br />
städtisch-bürgerlichen „Sommerfrische-Import“ erhalten haben. Wo sich<br />
andernorts Trachtenvereine bemühen, „bedrohte“ Tracht zu bewahren<br />
und zu repräsentieren, zählt sie hier zur alltäglichen Selbstverständlichkeit<br />
– quer durch alle Bevölkerungsschichten. Als typisch „ausseerisch“<br />
und „steirisch“ gilt das typische Ausrüstungsset: wie zum Beispiel die<br />
Lederhose (eng und lang bis oberhalb des Knies), der Gamslrock, grüne<br />
Stutzen mit der eingemusterten „brennaden Liab“ oder anderen Motiven,<br />
der Ausseer, bzw. der Steirerhut oder das Seidenbindl. Oder eben der<br />
graugrüne Steieranzug. Oder das Dirndl.<br />
Eine besondere Variante des graugrünen Rocks ist der „Schladminger“:<br />
als „schwerwiegender“ Überrock in der Regel aus besonderem Loden<br />
(Perlloden) hergestellt, der zwar weit über die Region hinaus bekannt ist,<br />
doch überwiegend im oberen Ennstal von Einheimischen wie zunehmend<br />
von langjährigen Gästen und zugezogenen „Zweiheimischen“ getragen<br />
wird. Im Zusammenhang mit einem „Trachtenboom“ in den 1990er-Jahren,<br />
der 10 Jahre später ebenso rasch wieder zusammengebrochen ist, 6<br />
wurde der „Schladminger“ zum besonderen Kult- und Werbeobjekt des<br />
boomenden Wintersportortes Schladming. Er avancierte vom Bauern-<br />
und Holzknechtgwand zum „Bürgermeisterjanker“, der Exilschladmingern<br />
zu ehrenhaften Anlässen oder Verwandten zum „50er“ geschenkt<br />
wird, oder auch Prominenten wie Arnold Schwarzenegger verpasst wird,<br />
durch welchen der Schladminger zum besonders „massiven“ Werbeträger<br />
wurde.<br />
Erfolgreiche Nischen- und Qualitätsprodukte<br />
für einen überregionalen Markt<br />
Alpines Textilgewerbe ist angesichts einer globalisierten Textilindustrie<br />
zu einer Besonderheit geworden. Aber hat Lodenproduktion überhaupt<br />
eine Zukunft? Kann Trachtenhandwerk überleben? Beispiele aus dem<br />
Ennstal und dem Ausseerland zeigen sehr wohl Beispiele für erfolgreiche<br />
Nischen- und Qualitätsstrategien 7 :<br />
Im Ennstal bestehen derzeit zwei Lodenwalken, die familiengeschichtlich<br />
aus einem Standort hervorgehen. 8 Beide Betriebe (mit durchschnittlich<br />
25 bzw. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) haben es geschafft, dem<br />
Wandel von Produktionsbedingungen, Modeströmungen und Globalisie-<br />
Lederhosenstilleben,<br />
Was man nicht sieht
284 — 285<br />
Günther Marchner<br />
9<br />
Informationen aus Gesprächen<br />
mit Vertretern<br />
der beiden Betriebe im<br />
März 2010 sowie verfügbaren<br />
Unterlagen.<br />
rung zum Trotz erfolgreich zu bestehen. Im Gegensatz dazu sind viele<br />
andere kleine Lodenwalken in den letzten Jahrzehnten verschwunden.<br />
Beide Ennstaler Betriebe produzieren Loden zwar auch für Trachtenkleidung<br />
(zu ca. 50%), wie auch den berühmten „Schladminger“. Allerdings<br />
sind Trachten nicht der einzige und vor allem nicht der entscheidende<br />
Markt, der das Überleben dieser Betriebe sichert.<br />
Dafür haben diese Betriebe unterschiedliche Spezialisierungs- und<br />
Nischenstrategien entwickelt: 9<br />
→ Die Lodenwalke in Ramsau/Rössing setzt auf „Tradition“: Bis<br />
auf notwendige Modernisierungen (Maschinen für Spinnerei und<br />
Weberei) ist vieles unverändert geblieben. Loden wird naturnahe<br />
und schonend erzeugt, der Betrieb überzeugend als transparentes<br />
und ehrliches „Erlebnis“ inszeniert. Zu dieser Authentizität gehört<br />
auch, dass die Konfektionierung des Lodenstoffes für Tracht<br />
und Mode zu 100% durch steirische Schneidereien erfolgt. Eine<br />
Besonderheit, die zum Markenzeichen des Betriebes zählt: Die<br />
Produkte dieser Lodenwalke gibt es nur „vor Ort“ zu kaufen bzw.<br />
zu bestellen. Entscheidend für den Betrieb ist jedoch, dass eine<br />
Kombination aus traditionellen mit neuen modischen Produkten<br />
gelingt und damit ein erweitertes Publikum anzieht. Zunehmend<br />
wird von einer neuen Kundschaft die besondere Qualität des<br />
Lodens wahrgenommen und geschätzt, die er zum Beispiel für<br />
Sportbekleidung hat (feuchtigkeits- und schmutzabweisend, wärmend,<br />
geruchsabsorbierend). Allerdings wird von diesem Betrieb<br />
schon lange nicht mehr heimische Wolle verwendet. Diese ist aufgrund<br />
des Klimas zu hart und zu kratzig. Loden aus der Ramsau<br />
wird aus feinerer, überseeischer Wolle erzeugt. Heute bildet die<br />
Lodenwalke in Rössing einen originellen handwerksorientierten<br />
Herzeigebetrieb mit hoher Produktqualität und besonderem Erlebniswert<br />
in einer Tourismusregion.<br />
→ Loden Steiner in Mandling ist seit dem Rückgang traditioneller<br />
Lodenkleidung in den 1980er-Jahren zunehmend innovativ auf<br />
neue Märkte ausgerichtet. Im Besonderen der früher weit verbreitete<br />
Lodenmantel ist, so ein Vertreter des Unternehmens, „quasi<br />
ausgestorben und müsste unter Artenschutz gestellt werden“. Mit<br />
der Neuausrichtung des Unternehmens wurden die Lodenstoffe<br />
bunter und vielfältiger. Internationale Marken werden mit ausgewählten<br />
Stoffen beliefert, die flexibel und in kleinen Mengen<br />
erzeugt werden. Die Firma ist auf Modemessen in Paris vertreten<br />
und inzwischen dort „in den Köpfen verankert“. Zusätzlich wird mit<br />
Innendekoration (Decken, Bezugsstoffe wie zum Beispiel für Hoteleinrichtungen)<br />
eine neue und wachsende Schiene aufgebaut.<br />
Entscheidend ist: Beide Betriebe verbinden Tradition und Erfahrungswissen<br />
mit neuen Strategien (Nischen- und Qualitätsproduktion für einen<br />
überregionalen Markt) und tragen quasi als identitätsstiftende „Leit-<br />
KMUs“ zur Wertschöpfung in der Region bei.<br />
Darüber hinaus gibt es in der Region erfolgreiche Handwerksbetriebe im<br />
Bereich der Verarbeitung und Vermarktung von Trachten. Dazu zählt zum<br />
Beispiel der einzige Lederhosenmacher im Ausseerland, der Lederhosen<br />
nur auf Maß erzeugt (Kostenpunkt: zwischen 1000 bis 2000 Euro pro<br />
Stück, mit durchschnittlich einem ¾ Jahr Wartezeit), der zwischendurch<br />
für Kundinnen und Kunden auch eine Blue Jeans richtet, mit einer Werkstatt<br />
als gleichzeitigem Verkaufs-, Verhandlungs- und Anproberaum<br />
sowie einem Werbebudget von Null Euro. Und es gibt Schneidereibetriebe<br />
im Ausseerland oder in der Ramsau, die Tracht, auch in eigenständiger<br />
Weiterentwicklung und in Maßarbeit für ein ausgewähltes Publikum erzeugen<br />
– und dies mit dem Handel von Trachten- und Modebekleidung<br />
„von der Stange“ in allen Lagen und Preisklassen verbinden. Entscheidend<br />
für ihren Erfolg ist ihre Positionierung in einer Tourismusregion, aus<br />
denen sich auch ein überregionales Publikum erschließt.<br />
Wetterfest in die Globalisierung<br />
Loden wird überwiegend mit „Tracht“, „grün“ oder „grau“ und „konservativ“<br />
assoziiert. Aber das stimmt schon lange nicht mehr. Traditionelle<br />
Lodenkleidung wie der „Wetterfleck“ ist nicht ausgestorben. Aber der<br />
Wetterfleck ist zu etwas Besonderem geworden, getragen „von Individualisten“,<br />
so ein Lodenproduzent.<br />
Der Alltagseinsatz des „Schladmingers“ ist nicht nur bei Prominenten zu<br />
bewundern, sondern auch bei Skiliften der Region, wo er den Bauern, die<br />
dort im Neben- oder Zuerwerb tätig sind, jenen besonderen Schutz bietet,<br />
wie er es früher immer schon getan hat.<br />
Einer tendenziell statisch-konservierenden Trachtenpflege durch Volkskunde,<br />
Museen und Trachtenvereinen ist eine dynamische Seite gegenüberzustellen:<br />
Zum Beispiel jene cool-bunten Trachtenträger/innen, die<br />
beim „Weaner Seertag“ alljährlich das Altausseer Bierzelt heimsuchen<br />
oder jene Schneider, die mit viel Kompetenz und Behutsamkeit Trachtenkleidung<br />
in Maßarbeit durch eigene Kreationen weiterentwickeln und sich<br />
nicht gerne vorschreiben lassen möchten, wie Tracht auszusehen hat.
286 — 287<br />
1<br />
Ortsplan von Bad Mitterndorf,http://www.badmitterndorf.at/Ortsplan-<br />
Bad-Mitterndorf.577.0.html<br />
[Zugriff: 31.3.2010].<br />
2<br />
Walter Kiwit: 40 Jahre Sonnenalm<br />
in Bad Mitterndorf<br />
im steirischen Salzkammergut.<br />
Bad Mitterndorf<br />
2005, S. 4.<br />
3<br />
http://www.sonnenalm.<br />
net/3.html [Zugriff:<br />
14.4.2010].<br />
4<br />
Hermine Vidovic: Wirtschaftliche,<br />
soziale und<br />
räumliche Auswirkungen<br />
von Zweitwohnsitzen.<br />
Fallstudie Bad Mitterndorf.<br />
Dipl.-Arb., Wien 1982, S.<br />
54–55.<br />
5<br />
Ebda., S. 93–95.<br />
6<br />
Ralph Weiß: Vom gewandelten<br />
Sinn für das Private.<br />
In: Ralph Weiß, Jo Groebel:<br />
Privatheit im öffentlichen<br />
Raum. Medienhandel<br />
zwischen Individualisierung<br />
und Entgrenzung (=Schriftenreihe<br />
Medienforschung,<br />
Bd. 43). Opladen: Leske und<br />
Budrich 2002, S. 31.<br />
Schöne Ferienwohnung in ruhiger Lage<br />
Einblicke in die Gestaltung von Privaträumen<br />
auf der Sonnenalm in Bad Mitterndorf<br />
Gundi Jungmeier<br />
Gute drei Kilometer vom Ortskern von Bad Mitterndorf, nordöstlich der<br />
Salzkammergut-Bundesstraße, liegt die Sonnenalm, eine Ansiedlung<br />
von Ferienwohnbauten. 1<br />
Zwischen 1964 und 1974 wurden acht Appartementhäuser sowie eine<br />
Reihe von Bungalows und kleineren Freizeitwohnanlagen errichtet, die<br />
insgesamt 609 Wohneinheiten umfassen. 2 Diese werden von ihren Besitzerinnen<br />
und Besitzern teilweise auch anderen Erholungssuchenden<br />
zur Miete angeboten. 3<br />
Der Bau dieser Anlage ging einher mit einem in den 1960er-Jahren einsetzenden<br />
gesamtösterreichischen Trend, Freizeitwohnraum für (in erster<br />
Linie ausländische) Erholungs- und Erlebnissuchende zu schaffen,<br />
um so die regionale Wirtschaft anzukurbeln. 4<br />
Worin liegt jedoch der Reiz, sich am Urlaubsort einen Zweitwohnsitz<br />
einzurichten, anstatt den Service eines Hotels oder die Gemütlichkeit<br />
einer Frühstückspension zu genießen?<br />
Neben finanziellen Überlegungen (z. B. um sich längere Aufenthalte<br />
in einer Ferienwohnung besser leisten zu können oder den Ankauf der<br />
Wohnung auch als Wertanlage zu betrachten) ist dies auch eine Frage<br />
von Prioritäten in punkto „Wohnen am Urlaubsort“. 5 Im Gegensatz zu<br />
Beherbergungsbetrieben bieten Ferienwohnungen ein hohes Maß an<br />
privater Atmosphäre.<br />
Was aber genau ist unter „privat“ zu verstehen?<br />
Privatheit bedeutet einerseits Schutz vor Eingriffen durch öffentliche<br />
Gewalt – also staatliche Kontrolle und Überwachung – wodurch persönliche<br />
Autonomie gewährleistet wird. Andererseits schließt Privatheit<br />
auch Freiheit vor Übergriffen anderer Privatpersonen und die Sicherung<br />
materieller und sozialer Voraussetzungen für persönliche Freiheit ein.<br />
Letzteres wird wiederum von der öffentlichen Gewalt gewährleistet. 6<br />
7<br />
Hans Erich Bödeker: Die<br />
bürgerliche Literatur- und<br />
Mediengesellschaft. In:<br />
Notker Hammerstein, Ulrich<br />
Herrmann: Handbuch der<br />
deutschen Bildungsgeschichte.<br />
18. Jahrhundert.<br />
Vom späten 17. Jahrhundert<br />
bis zur Neuordnung<br />
Deutschlands um 1800, Bd.<br />
2. München: Beck 2005, S.<br />
516–517.<br />
8<br />
Helgard Mahrdt: Öffentlichkeit,<br />
Gender und Moral. Von<br />
der Aufklärung zu Ingeborg<br />
Bachmann (=Palaestra.<br />
Untersuchungen aus der<br />
deutschen und skandinavischen<br />
Philologie, Bd. 304).<br />
Göttingen: Vandenhoeck &<br />
Ruprecht 1998, S. 12.<br />
9<br />
Werner Faulstich: Die<br />
bürgerliche Mediengesellschaft<br />
(1700–1830).<br />
Göttingen: Vandenhoeck &<br />
Ruprecht 2002, S. 22.<br />
10<br />
Ebda., S. 21–22.<br />
11<br />
Ralph Weiß: Vom gewandelten<br />
Sinn für das Private,<br />
S. 34.<br />
12<br />
Siegfried Lamnek: Die Ambivalenz<br />
von Öffentlichkeit<br />
und Privatheit, von Nähe<br />
und Distanz. In: Siegfried<br />
Lamnek, Marie-Theres Tinnefeld:<br />
Privatheit, Garten<br />
und politische Kultur. Von<br />
kommunikativen Zwischenräumen.<br />
Opladen: Leske u.<br />
Budrich 2003, S. 40.<br />
13<br />
Ebda., S. 40.<br />
14<br />
Marie-Theres Tinnefeld:<br />
Privatheit: Garten und politische<br />
Kultur. Einführende<br />
Gedanken. In: Siegfried<br />
Lamnek: Marie-Theres Tinnefeld,<br />
Privatheit, Garten<br />
und politische Kultur, S. 18.<br />
Die Idee der Privatheit steht außerdem in engem Zusammenhang mit<br />
der Entwicklung der „bürgerlichen Öffentlichkeit“ im 18. Jahrhundert.<br />
Diese stellt eine Teilöffentlichkeit mit eigenen Werten und Medien<br />
dar, welche ihren Protagonistinnen und Protagonisten die Möglichkeit<br />
zur Kommunikation eröffnet. Dadurch werden Privatpersonen – die ursprünglich<br />
das Publikum bildeten – zu Akteurinnen und Akteuren. 7 Voraussetzung<br />
für diese Entwicklung ist die Trennung von Staat und bürgerlicher<br />
Gesellschaft, wobei die bürgerliche Öffentlichkeit eine eigene,<br />
vom herrschaftlich-öffentlichen und vom privaten Bereich getrennte<br />
Sphäre darstellt. 8 Im Verlauf des 18. Jahrhunderts vollzieht sich auch<br />
im wirtschaftlichen bzw. familiären Bereich ein Strukturwandel. Die privatwirtschaftliche<br />
Sphäre büßt beispielsweise an privatem Charakter<br />
ein und erhält stärkere öffentliche Relevanz. Analog zur bürgerlichen<br />
Öffentlichkeit entwickelt sich bis zur Wende zum 19. Jahrhundert die<br />
sogenannte „bürgerliche Privatheit“, die z. B. durch Veränderungen in<br />
Familienstrukturen (bürgerliche Kleinfamilie) gekennzeichnet ist. Zudem<br />
kommt es, so Werner Faulstich, zu einer „Isolation von Familie als programmatische<br />
Abgrenzung von der ökonomisch bestimmten neuen<br />
Öffentlichkeit“. 9 Vor dem Hintergrund der neu entstandenen kommerziellen<br />
Öffentlichkeit bildet die Familie somit einen Ort der Regeneration<br />
außerhalb eines leistungs- und gewinnorientierten Umfelds. 10<br />
Innerhalb des sehr komplexen Themas der Privatheit und in Zusammenhang<br />
mit der starken Abgrenzung der Familie bzw. des Familienlebens<br />
kann der Begriff „Häuslichkeit“ ausgemacht werden. Dieser kennzeichnet<br />
einen Bereich, in dem sich eingegangene soziale Beziehungen auf<br />
Übereinkunft gründen und davon bestimmt sein sollen. Hier können sich<br />
Menschen – zumindest der Idee nach – ohne Rücksichtnahme auf Konventionen,<br />
die bestimmend für ihr öffentliches Leben sind, offenbaren<br />
und werden um ihrer selbst willen anerkannt. Die häusliche Atmosphäre<br />
bietet Möglichkeiten für Selbstausdruck und Selbstverwirklichung und<br />
garantiert die Sphäre der Intimität. 11<br />
In den letzten Jahren verschwimmen wiederum die Grenzen zwischen<br />
häuslicher Privatheit und Öffentlichkeit, da persönliche Aspekte zunehmend<br />
in öffentlichen Räumen sichtbar werden. Siegfried Lamnek<br />
sieht darin die „schleichende Privatisierung der Öffentlichkeit“ 12 und<br />
führt dabei Argumente wie mobile Kommunikation auf offener Straße<br />
und neue Unterhaltungsformate, in denen Intimitäten und persönliche<br />
Schicksale im Fernsehen gezeigt bzw. beobachtet werden, ins Treffen. 13<br />
Umgekehrt kommt es auch zu einer stärkeren Durchdringung des privaten<br />
Raumes durch Aspekte des öffentlichen Lebens, die stark von<br />
neuen Kommunikationstechnologien, wie z. B. dem Internet, ermöglicht<br />
werden. „Staatliche und private Akteure suchen Zugang zu den Interaktionsprozessen<br />
in der digitalisierten Wirklichkeitsschicht und erfassen<br />
sie datenmäßig, um sie abzubilden und für verschiedene Zwecke zu<br />
nutzen.“ 14
288 — 289<br />
Gundi Jungmeier<br />
15<br />
Mathias Stock: Polytopisches<br />
Wohnen – ein<br />
phänomenologisch-prozessorientierter<br />
Zugang<br />
(=Informationen zur<br />
Raumentwicklung, Heft<br />
1/2.2009). Bonn 2009,<br />
S. 107.<br />
16<br />
Ebda., S. 111.<br />
17<br />
Rainer Maderthaner:<br />
Wohlbefinden, Lebensqualität<br />
und Umwelt. In:<br />
http://homepage.univie.<br />
ac.at/rainer.maderthaner/<br />
Wohlbefinden%20LQ%20<br />
Umwelt%20(Kryspin)%20<br />
Reprint.pdf [Zugriff:<br />
14.4.2010], S. 6–10.<br />
18<br />
Burkhard Pöttler: Der<br />
Urlaub im Wohnzimmer.<br />
Dinge als symbolische<br />
Repräsentation von<br />
Reisen – Reiseandenken<br />
und Souvenirs. In: Johannes<br />
Moser, Daniella Seidl (Hg.):<br />
Dinge auf Reisen. Materielle<br />
Kultur und Tourismus.<br />
Münster: Waxmann 2009,<br />
S. 120–121.<br />
19<br />
Rainer Maderthaner: Wohlbefinden,<br />
Lebensqualität<br />
und Umwelt, S. 6–10.<br />
20<br />
Marie-Theres Tinnefeld:<br />
Privatheit, Garten und<br />
politische Kultur, S. 18.<br />
Die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit sowie deren Durchdringbarkeit<br />
variieren also und unterliegen je nach kulturellem, politischem<br />
und zeitlichem Kontext Veränderungen.<br />
Im Hinblick auf den Ort, an dem sich Menschen häuslich einrichten,<br />
lässt sich seit einigen Jahrzehnten der Trend zu höherer Mobilität feststellen.<br />
Der Begriff „Wohnen“ impliziert Werte wie Verbundenheit oder<br />
Ortsansässigkeit, die im Gegensatz zu Mobilität stehen. Die Nutzung<br />
von Zweitwohnsitzen, Pendeln zum Arbeitsplatz über große Distanzen,<br />
Studienaufenthalte usw. sind Mobilitätserscheinungen, die sich nicht<br />
mehr mit ortsgebundenem Leben, in dem alle Erledigungen des Alltags<br />
im näheren Umfeld des Wohnraumes erfolgen, verbinden lassen. 15<br />
Touristische Mobilität wiederum ist gekennzeichnet vom Unterschied<br />
zwischen Alltagsort und Urlaubsort. Im Falle der Nutzung einer Zweitwohnung<br />
löst sich diese Differenz teilweise durch die Vertrautheit mit<br />
der Wohnung am Urlaubsort auf. 16<br />
Was die Wahl des Ortes bzw. der Immobilie einerseits und die Gestaltung<br />
des Wohnraumes sowie des Lebens in diesem Umfeld andererseits betrifft,<br />
so müssen Architektinnen bzw. Architekten und Bewohner/innen<br />
ein geeignetes Maß an Privatheit, Sicherheit, Funktionalität, Ordnung,<br />
Möglichkeiten zu Kommunikation und Regeneration, Aneignung, Partizipation<br />
und Ästhetik finden. 17<br />
Durch die sich laufend ändernden wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen<br />
ändern sich auch die Anforderungen im Bereich der<br />
Wohnraumschaffung.<br />
Eine besondere Bedeutung spielen – besonders auch im Hinblick auf<br />
die Gestaltung von Wohnräumen – Objekte, mit denen sich Menschen<br />
umgeben, denn diese bestätigen deren soziale Identität. Ebenso von<br />
Bedeutung sind persönliche Gegenstände und Andenken, über die sich<br />
ebenfalls die Identität ausdrückt. Immaterieller Besitz bzw. sogenanntes<br />
„kulturelles Kapital“ findet daher sehr oft in Form symbolischer Objekte<br />
Eingang in den alltäglichen Lebensraum und wird häufig dekorativ platziert<br />
oder an weniger prominenten Orten aufbewahrt. 18<br />
Durch die Aneignung von Räumen, das heißt durch deren Adaption<br />
als Teil des eigenen Lebensraums, z.B. durch das Schmücken von Eingangstüren,<br />
Anlegen von Vorgärten usw. wird die Verbundenheit und<br />
Identifikation mit der näheren Umgebung erhöht. Mit der ästhetischen<br />
Bewertung des eigenen Wohn- und Lebensumfeldes werden neben einer<br />
höheren Wohnzufriedenheit, bzw. einem höheren Wohnprestige, auch die<br />
Ortsverbundenheit und die Einsatzbereitschaft für gemeinschaftliche<br />
bzw. kommunale Angelegenheiten gesteigert. 19<br />
Die Vorstellung von häuslicher Privatheit schließt Balkone, zum Haus gehörende<br />
Gärten usw. mit ein. 20 Dennoch handelt es sich dabei um Räume,<br />
deren Grenzen (im Sinne häuslicher Zurückgezogenheit) durchlässig<br />
sind. Sie stellen eine Verbindung zur Außenwelt her und ermöglichen<br />
Lukas Kogler,<br />
Johannes Pötscher<br />
Einblicke in die Gestaltung<br />
von Privaträumen auf<br />
der Sonnenalm in<br />
Bad Mitterndorf<br />
(von oben nach unten):<br />
Andenken am Kachelofen,<br />
Hummelfiguren am<br />
Zierboard, Selbstgefertigte<br />
Schnitzerei, Andenken, 2010
290 — 291<br />
Gundi Jungmeier<br />
21<br />
Interviews mit Besitzerinnen<br />
und Besitzern von<br />
Immobilien der Sonnenalm,<br />
Universalmuseum<br />
Joanneum, Multimediale<br />
Sammlungen, Büro<br />
der Erinnerungen (i. d.<br />
F.: UMJ), 31.3.2010,<br />
1.4.2010, 2.4.2010.<br />
22<br />
Interview, UMJ,<br />
31.3.2010.<br />
23<br />
Interview, UMJ,<br />
1.4.2010.<br />
24<br />
Interview, UMJ,<br />
31.3.2010.<br />
25<br />
Interview, UMJ,<br />
1.4.2010.<br />
26<br />
Interview, UMJ,<br />
31.3.2010.<br />
Interaktion. Hier sind die Bewohner/innen vor die Aufgabe gestellt, ein<br />
für sie passendes Maß zwischen Transparenz und Abgeschlossenheit aus<br />
einem breiten Feld von Möglichkeiten – zwischen symbolischen Grenzen<br />
in Form von optisch wahrnehmbaren Umrandungen (z. B. Blumenrabatten)<br />
und tatsächlichen Barrieren (z. B. Zäune oder Hecken) – zu wählen.<br />
Die Gestaltung von Gärten, Balkonen usw. bestimmt zu einem Teil die<br />
Möglichkeiten bzw. die Intensität der Interaktion mit der Öffentlichkeit.<br />
Mittlerweile haben mehrere Besitzer/innen von Ferienwohnungen die<br />
Sonnenalm als permanenten Wohnsitz auserkoren und wollen ihren Lebensabend<br />
ganz oder zumindest zu einem großen Teil dort verbringen.<br />
Einige von ihnen haben für das vorliegende Projekt ihre Türen geöffnet<br />
und Einblicke in ihre Wohnräume und Gärten ermöglicht. 21<br />
„Wir sind keine Hotelmenschen in dem Sinn. Beide nicht. Sondern<br />
wir waren immer [darauf] bedacht, dass man etwas besitzt, wo<br />
man hin kann und gleich wieder zuhause ist. Mit seinen eigenen<br />
Möbeln, auch mit der Kleidung etc. Das hat eben besser gepasst,<br />
als wenn man dann mit dem Koffer jedes Mal anreisen muss. Also<br />
wir gehen nicht gerne ins Hotel.“ 22<br />
„Wir brauchen keine Vorhänge oder sonst etwas, bei uns ist es<br />
immer offen. Es kann niemand hereinschauen, es scheint den<br />
ganzen Tag die Sonne herein. Wir können uns frei bewegen, das<br />
ist super.“ 23<br />
„Das ist der hintere Garten. Der ist ostseitig, den nutzen wir sehr<br />
viel. Im Sommer schon beim Frühstück, weil da die Sonne aufgeht.<br />
Und dann kann man hier an unserem Tisch wunderschön<br />
frühstücken. Das ist wie so ein Atrium als Innenhof, da schaut<br />
kaum jemand rein.“ 24<br />
„Wir wissen oft nicht, kommt es von da oder kommt es von da<br />
oder von oben, das kann man nicht feststellen. Wenn man einen<br />
Fernseher oder Musik hört. Das kann man nicht recht feststellen,<br />
wo das herkommt. Aber es ist nicht störend, es ist ganz leise,<br />
wenn man ab und zu etwas hört.“ 25<br />
Lukas Kogler, Johannes Pötscher<br />
Sonnenalm, 2010<br />
„Wir haben es uns halt in der Zeit unseres Hierseins so angenehm<br />
wie möglich gemacht, haben uns gemütlich – so wie wir uns<br />
wohl fühlen – eingerichtet. Unter anderem haben wir dann auch<br />
so Sachen wie die Wandverkleidung und die Deckenverkleidung<br />
in Eigenarbeit montiert und in den Räumen, wo es nötig war das<br />
anzubringen, angebracht. […] Und dazu gehören halt die kleinen<br />
Dinge, die oben auf dem Board stehen, wie die Hummelfiguren.<br />
Auf der anderen Seite haben wir noch ein paar Geweihe. Wir versuchen<br />
das halt mit so viel Liebe wie möglich einzurichten. […]<br />
Da sind so urige Häferl hier mit ganz netten Sprüchen drauf, die<br />
haben wir uns mal angeschafft. Wenn es mal Glühwein gibt im<br />
Winter, dann werden die auch wieder benutzt.“ 26
Biografien<br />
PAWEL ALTHAMER<br />
Geboren 1967 in Warschau<br />
(PL), lebt in Warschau (PL)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2009<br />
Pawel Althamer und Andere,<br />
Secession, Wien (AT)<br />
Frühling, Kunsthalle Fridericianum,<br />
Kassel (DE)<br />
(mit Nowolipie Group)<br />
2007<br />
One of Many, Fondazione<br />
Nicola Trussardi, Mailand<br />
(IT)<br />
black market, neugerriemschneider,<br />
Berlin (DE)<br />
2006<br />
In the Centre Pompidou,<br />
Espace 315, Musée National<br />
d’Art Moderne, Centre<br />
Pompidou, Paris (FR)<br />
2005<br />
Paweł Althamer zachęca,<br />
Zacheta National Gallery of<br />
Art, Warschau (PL)<br />
2004<br />
Pawel and Vincent, The<br />
Vincent Van Gogh Bi-annual<br />
Award for Contemporary Art<br />
in Europe, Bonnefantenmuseum<br />
Maastricht (NL)<br />
2003<br />
The Wrong Gallery, New<br />
York (US)<br />
2002<br />
Unsichtbar, Alexanderplatz,<br />
Berlin (DE, Projekt im<br />
öffentlichen Raum)<br />
Prisoners, Kunstverein<br />
Münster, Münster (DE)<br />
2001<br />
Weronika, Amden (CH, Projekt<br />
im öffentlichen Raum)<br />
The Collective Unconsciousness,<br />
migros museum,<br />
Zürich (CH)<br />
Museum of Contemporary<br />
Art, Chicago (US)<br />
2000<br />
Bródno 2000 (Projekt im<br />
öffentlichen Raum),<br />
Warschau (PL)<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
Les Promesses du Passé,<br />
Centre Pompidou, Paris<br />
(FR)<br />
2009<br />
Shifting Identities. Art<br />
Now, Contemporary Art<br />
Center Vilnius (LT)<br />
2008<br />
Art Comes Before Gold,<br />
Museum of Modern Art<br />
Warsaw, Warschau (PL)<br />
After Nature, New<br />
Museum, New York (US)<br />
Periphere Blicke und<br />
kollektive Körper, Museion,<br />
Bozen (IT)<br />
Shifting Identities,<br />
Kunsthaus Zürich, Zürich<br />
(CH)<br />
Double Agent, ICA, London<br />
(UK)<br />
2007<br />
The World as a Stage, Tate<br />
Modern, London (UK)<br />
Volksgarten: Politik der<br />
Zugehörigkeit, Kunsthaus<br />
Graz (AT)<br />
Skulptur Projekte Münster,<br />
Münster (DE)<br />
2006<br />
The exotic journey ends,<br />
Foksal Gallery Foundation,<br />
Warschau (PL)<br />
Of mice and men, Berlin<br />
Biennale 4, Berlin (DE)<br />
Sculptures in the Park,<br />
Villa Manin, Udine (IT)<br />
2005<br />
9. Istanbul Biennale,<br />
Istanbul (TR)<br />
Kollektive Kreativität<br />
(zusammen mit Artur<br />
Zmijewski), Kunsthalle<br />
Fridericianum, Kassel (DE)<br />
1. Moskau Biennale,<br />
Moskau (RU)<br />
2004<br />
Utopia Station, Haus der<br />
Kunst, München (DE)<br />
54 th Carnegie International,<br />
Carnegie Museum<br />
of Art, Pittsburgh (US)<br />
Artists’ Favourites, ICA<br />
Institute of Contemporary<br />
Art Gallery, London (UK)<br />
Dreaming of a Better<br />
World in Six Parts, BAK,<br />
Utrecht (NL)<br />
2003<br />
Art Focus 4 (zusammen<br />
mit Artur Żmijewski), Israel<br />
Museum, Jerusalem (IL)<br />
Bring on the Clowns,<br />
Frieze Art Fair Projects,<br />
London (UK)<br />
Dreams and Conflicts-The<br />
Viewer’s Dictatorship,<br />
Biennale di Venezia,<br />
Venedig (IT)<br />
2002<br />
Warum, Martin Gropius<br />
Bau, Berlin (DE)<br />
„I promise it’s political”,<br />
Museum Ludwig, Köln (DE)<br />
The Collective Unconsciousness,<br />
migros<br />
museum, Zürich (CH)<br />
2001<br />
„Ausgeträumt...”,<br />
Secession, Wien (AT)<br />
Abbild, Landesmuseum<br />
Joanneum, Graz (AT)<br />
2000<br />
Manifesta 3, Ljubljana<br />
(SLO)<br />
1997<br />
Documenta X, Kassel (DE)<br />
FRAnz KAPFER<br />
geboren 1971 in<br />
Fürstenfeld (AT), lebt in<br />
Wien (AT)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2009<br />
In the shadow<br />
of Skanderbeg.<br />
Lichtinstallation, Oper<br />
Tirana, TICA Tirana (AL)<br />
Für Gott, Kaiser und<br />
Vaterland, Kunstpavillon,<br />
Innsbruck (AT)<br />
2008<br />
Zur Errettung des<br />
Christentums, Traklhaus,<br />
Salzburg (AT)<br />
Wunderwürdiges Kriegs-<br />
und Siegs-Lager, Oberes<br />
Belvedere, Wien (AT)<br />
2007<br />
Zur Errettung des<br />
Christentums, MMK<br />
Stiftung Wörlen, Passau<br />
(DE)<br />
2006<br />
Franz Kapfer, Salzburger<br />
Kunstverein, Salzburg (AT)<br />
Zur Errettung des<br />
Christentums, Galerie<br />
Hohenlohe, Wien (AT)<br />
2004<br />
Rom 2003, Galerie<br />
Hohenlohe & Kalb, Wien<br />
(AT)<br />
Franz Kapfer 2002-03,<br />
Studio, Neue Galerie, Graz<br />
(AT)<br />
2003<br />
Der Einzug König Etzels in<br />
Wien, MAK NITE, Wien (AT)<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
tanzimat, Augarten<br />
Contemporary, Wien (AT)<br />
Triennale Linz 1.0, OK<br />
Offenes Kulturhaus<br />
Oberösterreich, Linz (AT)<br />
2009<br />
Because it’s Like That<br />
Now, it Won’t Stay That<br />
Way, Galeria Arsenal,<br />
Bialystok (PL)<br />
Rewind / Fast Forward.<br />
Die Videosammlung, Neue<br />
Galerie Graz, Graz (AT)<br />
Einführung in die<br />
Kunstgeschichte 6,<br />
Landesgalerie Linz (AT)<br />
Schönheit des Hässlichen,<br />
Forum Frohner, Krems (AT)<br />
2008<br />
Rückblende, Neue Galerie,<br />
Graz (AT)<br />
Sexy Sexism, Galerie<br />
Václava Špály, Prag (CZ)<br />
Open Sky, regionale08,<br />
Schloss Kalsdorf,<br />
Kalsdorf (AT),<br />
Another Tomorrow,<br />
Slought Foundation,<br />
Philadelphia (US)<br />
2007<br />
Scheitern, Landesgalerie,<br />
Linz (AT)<br />
Soufflé, Kunstraum<br />
Innsbruck (AT)<br />
Objekthaftes, MdM<br />
Rupertinum, Salzburg (AT)<br />
Exitus, Künstlerhaus Wien,<br />
Wien (AT)<br />
Einführung in die<br />
Kunstgeschichte, Ursula<br />
Blickle Stiftung, Kraichtal-<br />
Unteröwisheim (AT)<br />
2005<br />
Das Neue 2, Atelier<br />
Augarten, Wien (AT)<br />
2004<br />
Lost Eight, Museum<br />
Moderner Kunst Stiftung<br />
Wörlen, Passau (DE)<br />
2002<br />
Ines Doujak / Franz<br />
Kapfer, Galerie Hohenlohe<br />
& Kalb, Wien (AT)<br />
2001<br />
The Subject and the<br />
Power, Central House of<br />
Artists, Moskau (RU)<br />
Le Tribù dell’Arte,<br />
Galeria Communale<br />
d’Arte Moderna e<br />
Contemporanea, Rom (IT)<br />
2000<br />
Gouvernementalität, Expo<br />
2000, Hannover (DE)
L/B<br />
Sabina Lang , geboren<br />
1972 in Bern (CH), Daniel<br />
Baumann, geboren 1967 in<br />
San Francisco (US),<br />
leben in Burgdorf (CH),<br />
Zusammenarbeit seit 1990<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2009<br />
Le Bel Accident. Vincent<br />
Ganivet, Lang/Baumann,<br />
Le Confort Moderne,<br />
Poitiers (FR)<br />
I’m Real, Galerie Urs Meile,<br />
Beijing (CN)<br />
2008<br />
More is More, Galerie<br />
Loevenbruck, Paris (FR)<br />
2007<br />
Pocket Stadium, Locust<br />
Projects, Miami (US)<br />
Hotel Everland, Palais de<br />
Tokyo, Paris (FR)<br />
Comfort #4, Villa du Parc,<br />
Annemasse (FR)<br />
2006<br />
Lumps and Bumps, Spiral/<br />
Wacoal Art Center,<br />
Tokio (JP)<br />
Hotel Everland, Galerie für<br />
Zeitgenössische Kunst,<br />
Leipzig (DE)<br />
2005<br />
Diving Platform, Marks<br />
Blond Project, Bern (CH)<br />
2004<br />
Perfect #2, Stage,<br />
Bern (CH)<br />
Lobby, Kunsthalle,<br />
St.Gallen (CH)<br />
2003<br />
L/B, Bell-Roberts Gallery,<br />
Cape Town (ZA)<br />
2002<br />
Duell, Galerie Urs Meile,<br />
Luzern (CH)<br />
Hotel Everland, Expo.02,<br />
Yverdon (CH)<br />
2001<br />
Window 002, Kunstraum<br />
Walcheturm, Zürich (CH)<br />
Transit, eine Navigation,<br />
Kunstverein, Freiburg (DE)<br />
Beautiful Entrance #3,<br />
Swiss Institute,<br />
New York (US)<br />
2000<br />
L/B, Josh Blackwell, Hot<br />
Coco Lab,<br />
Los Angeles (US)<br />
1999<br />
Au dernier cri, Galerie Urs<br />
Meile, Luzern (CH)<br />
Inforaum, Kunsthalle,<br />
Bern (CH)<br />
SAT 2, migros museum für<br />
gegenwartskunst,<br />
Zürich (CH)<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
Fukutake House, Art<br />
Setouchi 2010,<br />
Kagawa (JP)<br />
Portrait de l’artiste en<br />
motocycliste. Olivier<br />
Mosset, Musée des<br />
beaux-arts, La Chaux-de-<br />
Fonds (CH)<br />
2009<br />
WolaArt, Warschau (PL)<br />
Portrait de l‘artiste en<br />
motocycliste. Olivier<br />
Mosset, Magasin,<br />
Grenoble (FR)<br />
Utopics. 11.<br />
Schweizerische Plastikausstellung,<br />
Stadt,<br />
Biel-Bienne (CH)<br />
2008<br />
Nationale<br />
Kunstausstellung,<br />
Autofriedhof,<br />
Kaufdorf (CH)<br />
Balls and Brains,<br />
Helmhaus, Zürich (CH)<br />
2007<br />
Môtiers 2007, Art en plein<br />
Air, Môtiers (CH)<br />
The Memory of this<br />
Moment from the<br />
Distance of Years, Former<br />
Schindler’s Factory,<br />
Krakau (PL)<br />
2006<br />
5 Milliards d’années,<br />
Palais de Tokyo, Paris (FR)<br />
Trial Baloons, Canal<br />
Musac, León (ES)<br />
Space Boomerang, Swiss<br />
Institute, New York (US)<br />
2005<br />
Rundlederwelten, Martin-<br />
Gropius-Bau, Berlin (DE)<br />
Focus Switzerland, KBB,<br />
Barcelona (ES)<br />
Malereiräume, Helmhaus,<br />
Zürich (CH)<br />
2004<br />
Design? Kunst, Kunsthaus,<br />
Langenthal (CH)<br />
2003<br />
Floating Land, L’art sur<br />
place, Biennale de Lyon,<br />
Lyon (FR)<br />
Lee 3 Tau Ceti Central<br />
Armory Show, Villa Arson,<br />
Nizza (FR)<br />
Môtiers 2003, Art en plein<br />
Air, Môtiers (CH)<br />
2002<br />
Sweet Nothing, Kunsthaus<br />
Baselland, Basel (CH)<br />
Balsam - Exhibition der<br />
Fussballseele, Helmhaus,<br />
Zürich (CH)<br />
Cape Town Festival, SA<br />
National Gallery, Cape<br />
Town (ZA)<br />
2001<br />
Dreamgames, Stadion<br />
Dynamo Kiev, Kiew (UA)<br />
70s versus 80s, Museum<br />
Bellerive, Zürich (CH)<br />
migros museum für<br />
gegenwartskunst,<br />
Zürich (CH)<br />
CHRISTIAn PHILIPP<br />
MÜLLER<br />
Geboren 1957 in Biel (CH),<br />
lebt in Berlin (DE) und<br />
New York (US)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2008<br />
Resolutions, Galerie<br />
Christian Nagel,<br />
Berlin (DE)<br />
cookie-cutter, 47 Orchard,<br />
New York (US)<br />
2007<br />
Basics, Kunstmuseum<br />
Basel, Museum für<br />
Gegenwartskunst,<br />
Basel (CH)<br />
Passé immediate: [plug.in],<br />
Kunst und Neue Medien,<br />
Basel (CH)<br />
2006<br />
Mozart Was Here<br />
(permanent, mit Roman<br />
Ondak), Benediktinerstift<br />
Melk, Melk (AT)<br />
2005<br />
Berlin, Deutschland und<br />
die Welt, Galerie Christian<br />
Nagel, Berlin (DE)<br />
2004<br />
Im Geschmack der<br />
Zeit. Das Werk von<br />
Hans und Marlene<br />
Poelzig aus heutiger<br />
Sicht, IG-Hochhaus<br />
der Johann Wolfgang<br />
Goethe Universität,<br />
Frankfurt am Main (DE);<br />
Architekturmuseum Basel,<br />
Basel (CH)<br />
2003<br />
Im Geschmack der Zeit.<br />
Das Werk von Hans und<br />
Marlene Poelzig aus<br />
heutiger Sicht, Weydinger<br />
Strasse 20, Berlin (DE)<br />
Spice up Powdermaker<br />
Hall, Social Sciences,<br />
Queens College,<br />
New York (US)<br />
2002<br />
A Taste for Money, Galerie<br />
Christian Nagel, Köln (DE)<br />
2001<br />
Humus. Kulturelle<br />
Bodenprobe aus Hamburg,<br />
Köln und Luzern,<br />
Hochschule für Gestaltung<br />
und Kunst, Luzern (CH)<br />
2000<br />
A Sense of Place,<br />
American Fine Arts, Co.,<br />
New York (US)<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
Modernologies, Muzeum<br />
Sztuki Nowoczesnej,<br />
Warschau (PL)<br />
Under one Umbrella,<br />
Silberkuppe at Bergen<br />
Kunsthall, Bergen (NW)<br />
2009<br />
TOHUWABOHU. Spirit<br />
of the Haus, Haus der<br />
Kulturen der Welt,<br />
Berlin (DE)<br />
Modernologies, MACBA,<br />
Barcelona (ES)<br />
See this Sound, Lentos<br />
Kunstmuseum Linz,<br />
Linz (AT)<br />
Fifty Fifty. Kunst im Dialog<br />
mit den 50er-Jahren, Wien<br />
Museum, Wien (AT)<br />
C’era una volta un anello,<br />
Galleria d’arte moderna,<br />
Palazzo Margerita,<br />
Modena (IT)<br />
2008<br />
Recollecting. Raub und<br />
Restitution, MAK,<br />
Wien (AT)<br />
Manifesta 7. The European<br />
Biennal of Contemporary<br />
Art, Rovereto (IT)<br />
2007<br />
Rückblende, Neue Galerie<br />
am Landesmuseum<br />
Joanneum, Graz (AT)<br />
Helmut Draxler:<br />
Shandyismus, Kunsthaus<br />
Dresden, Dresden (DE)<br />
The Price of Everything...<br />
Perspectives on the Art<br />
Market, präsentiert vom<br />
Whitney Museum of<br />
American Art Independent<br />
Study Program, The Art<br />
Gallery, CUNY Graduate<br />
Center, New York<br />
Shandyismus. Autorschaft<br />
als Genre, Secession,<br />
Wien (AT)<br />
2006<br />
Sammlung Grässlin, St.<br />
Georgen (CH)<br />
Heard Not Seen, Orchard,<br />
New York (US)<br />
Make Your Own Life:<br />
Artists In & Out of<br />
Cologne, ICA Philadelphia;<br />
The Power Plant,<br />
Toronto (CA)<br />
2005<br />
Projekt Migration,<br />
Kölnischer Kunstverein,<br />
Köln (DE)<br />
Icestorm, Kunstverein<br />
München, München (DE)<br />
In den Wäldern, Kunsthaus<br />
Mürz, Mürzzuschlag (AT)<br />
2004<br />
Election, American Fine<br />
Arts, Co., New York (US)<br />
2003<br />
Watershed, The Hudson<br />
Valley Art Project, Bard<br />
College, Annandale-on-<br />
Hudson, New York (US)<br />
2002<br />
Ökonomien der Zeit,<br />
Museum Ludwig, Cologne<br />
(DE); Akademie der<br />
Künste, Berlin (DE);<br />
migros museum für<br />
gegenwartskunst,<br />
Zürich (CH)<br />
Minimal Maximal, National<br />
Museum of Contemporary<br />
Art, Seoul (KO)
MARIA PAPADIMITRIOU<br />
geboren 1957 in Athen<br />
(GR), lebt in Volos und<br />
Athen (GR)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
Hotel Balkan, Haifa<br />
Mediterranean Biennial,<br />
Haifa (ISR)<br />
2009<br />
The Party, öffentliches<br />
Event, Aliveri, Volos (GR)<br />
Infinito fa rumore eternita<br />
fa Silenzio, Mercato<br />
Coperto, Regio Emillia (IT)<br />
2008<br />
Corbu, Zina Athnasiadou<br />
Gallery, Thessaloniki (GR)<br />
2007<br />
Sa Ma Khol Truck – a City<br />
Tour, öffentliches Event,<br />
Teseco Foundation,<br />
Pisa (IT)<br />
Novocomum on Wheels,<br />
Direct Architecture,<br />
Politics and Space,<br />
Borgovico33, Como (IT)<br />
2006<br />
Hotel Plug-Inn, Castillo<br />
de San Gabriel, Lanzarote,<br />
1st Bienal de Arquitectura,<br />
Arte y Paisaje de Canarias,<br />
Kanaren (ES)<br />
2005<br />
Screening at the Kinitron<br />
Gas Station, National<br />
Road Larissa-Trikala,<br />
Larissa Contemporary Art<br />
Center, Thessaly (GR)<br />
Two or Three Things<br />
I Know About him,<br />
Riflemaker Gallery,<br />
London (UK)<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
Hotel Balkan, Haifa<br />
Mediterranean Biennial,<br />
Haifa (ISR)<br />
Mute Signs –<br />
Contemporary approaches<br />
to (in)tolerance,<br />
Hungarian University<br />
of Fine Arts Budapest,<br />
Budapest (HU)<br />
2009<br />
T.A.M.A. Side Effects, 10 th<br />
Lyon Biennial, Lyon (FR)<br />
We do it, Kunstraum<br />
Lakeside, Klagenfurt (AT)<br />
The First Image, Center<br />
of Contemporary Art<br />
Sete, (FR)<br />
Naughtiness, Beltsios<br />
Collection, Margari<br />
Foundation, Amfilohia (GR)<br />
Amateur Bicyclism,<br />
ReMap2, Locus, Athen (GR)<br />
The 2nd Gypsy Roma<br />
Traveller Month -<br />
Screening, Autograph ABP,<br />
London (UK)<br />
EU-Roma Dwelling, RIBA,<br />
London (UK)<br />
2008<br />
Nothing is Happening,<br />
Common View, National<br />
Theater, Athen (GR)<br />
National Museum of<br />
Contemporary Art,<br />
Thessaloniki (GR)<br />
Material Links: A Dialogue<br />
Between Greek and<br />
Chinese Artists,<br />
Museum of Contemporary<br />
Art, Shanghai (CN)<br />
Women Only, Beltsios<br />
Collection, Margaris<br />
Foundation, Amfilohia (GR)<br />
Ideal Homes, Casa del<br />
Lago, Mexico City (MX)<br />
Sũeno de casa propia,<br />
VIMCORSA, Cordoba (ES)<br />
Games Without Frontiers,<br />
Zoumboulaki Gallery,<br />
Athen (GR)<br />
2007<br />
Volksgarten Orchestra,<br />
Volksgarten: Politik der<br />
Zugehörigkeit, Kunsthaus<br />
Graz, Graz (AT)<br />
TAMAhouse, Sueňo de<br />
Casa Propia, La Casa<br />
Encendida, Madrid (ES)<br />
Luv car, 7 th Gwangju<br />
Biennale, Gwangju (CO)<br />
Topoi, Benaki Museum,<br />
Athens (GR)<br />
Who’s There, Macedonian<br />
Museum of Contemporary<br />
Art, Thessaloniki (GR)<br />
Two or three things I know<br />
about him, Photosynkyria<br />
19, International festival<br />
of Photography, Museum<br />
of Contemporary Art,<br />
Thessaloniki (GR)<br />
2006<br />
The Athens Effect,<br />
Mudima Foundation,<br />
Mailand (IT)<br />
What Remains is Future,<br />
European Cultural Capital<br />
2006, Patras (GR)<br />
Check in Europe, EPO,<br />
München (DE)<br />
Less: Alternative Living<br />
Strategies, Pavillion of<br />
Contemporary Art,<br />
Mailand (IT)<br />
The People’s Choice, Isola,<br />
Mailand (IT)<br />
2005<br />
The Rolling Billboard Art<br />
Project euroPART,<br />
Wien (AT)<br />
Myths / AntiMyths, Forum<br />
Plus, Wroclaw (PL)<br />
Gesture, Quarter, Centro<br />
Produzione Arte,<br />
Florenz (IT)<br />
Biennial on the<br />
Mediterranean Landscape,<br />
Pescara (IT)<br />
Mira como se mueven,<br />
Telefonica Foundation,<br />
Madrid (ES)<br />
KATEŘInA ŠEDÁ<br />
Geboren 1977 in Brno (CZ),<br />
lebt in Brno - Líšeň und<br />
Prag (CZ)<br />
Einzelausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
From Morning Till Night,<br />
Tate Modern, London (UK)<br />
2009<br />
Der Geist von Uhyst, Über<br />
Tage, Uhyst (DE)<br />
Česky snadno a rychle<br />
(Tschechisch schnell und<br />
mühelos), mit Rolf Simmen,<br />
Deutsches Radio (DE)<br />
2008<br />
1+1+1 =3, Culturgest,<br />
Lissabon (PO), mit Robert<br />
MacPherson und Manfred<br />
Pernice<br />
Kateřina Šedá (Colocation<br />
n. 4), La box, Bourges (FR)<br />
Kateřina Šedá, The<br />
Renaissance Society,<br />
Chicago (US)<br />
2007<br />
Sweden, mit Fritz<br />
Quasthoff, 1+1, galerie<br />
Arratia/Beer, Berlin (DE)<br />
Vnučka (The Granddaughter),<br />
Czech Center,<br />
New York (US)<br />
2006<br />
Kateřina Šedá *1977, etc.<br />
Galerie, Prag (CZ)<br />
Kateřina Šedá, Cultural<br />
House, Brno – Líšeň (CZ)<br />
Kateřina Šedá x 3,<br />
Francosoffiantino<br />
Artecontemporanea,<br />
Turin (IT)<br />
Arrivals > Czech Republic,<br />
Modern Art Oxford,<br />
Oxford (UK)<br />
Gruppenausstellungen<br />
(Auswahl):<br />
2010<br />
Video Drawing, The Israel<br />
Museum, Jerusalem (ISR)<br />
Jeden na jednoho/ ONE ON<br />
ONE, The Brno House of<br />
Arts, Brno (CZ)<br />
Les Promesses du<br />
passé, Centre Pompidou,<br />
Musée National d´Art<br />
Moderne, Paris (FR)<br />
2009<br />
Video Drawing, The Ticho<br />
House, Jerusalem (ISR)<br />
Radio D-CZ, Tranzitdisplay,<br />
Prag (CZ)<br />
Po sametu / After Velvet,<br />
City Gallery Prague,<br />
Prag (CZ)<br />
Formáty transformace<br />
/ Formats of<br />
Transformation, The Brno<br />
House Of Arts, Brno (CZ)<br />
Na okraji zájmu / On the<br />
Periphery of Concern, Emil<br />
Filla Gallery, Ústí nad<br />
Labem (CZ)<br />
Fri Porto, Den Frie Centre<br />
of Contemporary Art<br />
Copenhagen, (DK)<br />
After The Final<br />
Simplification Od Ruins,<br />
Montehermoso Cultural<br />
Center in Vitoria (ES)<br />
10th Lyon Biennial,<br />
Lyon (FR)<br />
Der Geist von Uhyst, Über<br />
Tage, Uhyst (DE)<br />
Time out of Joint: Recall<br />
a Evocation in Recent Art,<br />
Kitchen, New York (US)<br />
Monument transformace,<br />
City Gallery Prague,<br />
Prag (CZ)<br />
Younger than Jesus, New<br />
Museum, New York (US)<br />
2008<br />
The Green Room, CCA,<br />
Bard Center, New York (US)<br />
Cutting Realities. Gender<br />
Strategies in Art, Austrian<br />
Cultural Forum NYC,<br />
New York (US)<br />
La Petite Histoire,<br />
Kunstraum<br />
Niederösterreich,<br />
Wien (AT)<br />
Average, Kunsthaus<br />
Langenthal,<br />
Langenthal (CH)<br />
Manifesta 7, Bozen (IT)<br />
Social Diagrams,<br />
Künstlerhaus Stuttgart,<br />
Stuttgart (DE)<br />
Sixth Biennial of Young<br />
Artists, Zvon 2005 (Bell<br />
2005), City Gallery Prague,<br />
Prag (CZ)<br />
Where Are Lions Are, Para/<br />
Site Art Space,<br />
Hong Kong (CN)<br />
5 th Berlin Biennial,<br />
Berlin (DE)<br />
No Borders, AICA,<br />
Brüssel (BE),<br />
Close Encounters, Fine<br />
Arts Center Galleries,<br />
University of Rhode<br />
Island (US)<br />
2007<br />
Documenta 12, Aue<br />
pavillon, Kassel (DE)<br />
Dazwischen (INGENDWO),<br />
Museum Sammlung in<br />
Friedrichshof (AT)<br />
Asia Europe Meditation,<br />
National Museum of Art,<br />
Poznan (PL)<br />
Facelift: 3 Contemporary<br />
Czech and Slovak Artists,<br />
A.I. R. Gallery,<br />
New York, (US)<br />
As In Real Life, Gallery P<br />
74, Ljubljana (SLO)<br />
Auditorium, Stage,<br />
Backstage. An Exposure<br />
In 32 Acts, Frankfurter<br />
Kunstverein,<br />
Frankfurt (DE)<br />
2006<br />
Gray Zones, Dům umění,<br />
Brno and Galerie für<br />
Zeitgenössische Kunst,<br />
Leipzig (DE)<br />
Shadows of Humor, BWA<br />
Wrocław (PL)<br />
Local Stories, Modern Art<br />
Oxford (UK)
Autoren<br />
Jennifer Allen<br />
lebt als Kunstkritikerin<br />
in Berlin.<br />
Hannah Arendt<br />
Gesellschafts- und politikwissenschaftlicheTheoretikerin,<br />
geboren 1906 in<br />
Hannover, gestorben 1975<br />
in New York, studierte<br />
Philosophie, Theologie und<br />
Griechisch unter anderem<br />
bei Martin Heidegger,<br />
Edmund Husserl und Karl<br />
Jaspers, bei dem sie 1928<br />
promovierte. Nach einer<br />
kurzen Inhaftierung<br />
durch die Gestapo 1933<br />
Emigration nach Paris,<br />
Sozialarbeiterin bei jüdischen<br />
Einrichtungen,<br />
1940 Verschleppung in<br />
das Internierungslager<br />
Gurs, ab 1941 in New York,<br />
1944-46 Forschungsleiterin<br />
der Conference on<br />
Jewish Relations, 1946-49<br />
Cheflektorin im Salman<br />
Schocken Verlag, 1948-<br />
52 Direktorin der Jewish<br />
Cultural Reconstruction<br />
Organization zur Rettung<br />
jüdischen Kulturguts,<br />
1953 nach mehreren Gastvorlesungen<br />
u. a. in Princeton<br />
und Harvard Professur<br />
am Brooklyn College in<br />
New York, 1959 als erste<br />
Frau Gastprofessur an der<br />
Princeton University, 1963<br />
Professorin an der Universität<br />
von Chicago, ab<br />
1967 an der New School<br />
for Social Research in New<br />
York.<br />
Publikationen (Auswahl):<br />
Elemente und Ursprünge<br />
totaler Herrschaft,<br />
1955; Rahel Varnhagen.<br />
Lebensgeschichte einer<br />
deutschen Jüdin aus der<br />
Romantik, 1958; Vita<br />
activa oder Vom tätigen<br />
Leben, 1958; Eichmann in<br />
Jerusalem. Ein Bericht von<br />
der Banalität des Bösen,<br />
1963; Über die Revolution,<br />
1963; Macht und Gewalt,<br />
1970; Das Urteilen. Texte<br />
zu Kants politischer Philosophie,1982.<br />
Christoph Doswald<br />
Freier Kurator, Publizist<br />
und Kritiker in Zürich.<br />
Vorsitzender der Arbeitsgruppe<br />
Kunst im öffentlichen<br />
Raum, AG KiöR der<br />
Stadt Zürich und Kurator<br />
diverser Ausstellungen,<br />
u.a. Press Art (Kunstmuseum<br />
St.Gallen/Museum der<br />
Moderne, Salzburg),<br />
Hanspeter Hofmann<br />
(Kunsthaus Graz/Villa<br />
Arson, Nizza), Konkret<br />
Megamopp (Seedamm<br />
Kulturzentrum, Pfäffikon),<br />
Missing Link: Menschen-<br />
Bilder in der Fotografie<br />
(Kunstmuseum, Bern/<br />
Kunst Haus, Dresden),<br />
Nonchalance (Centre<br />
Pasquart, Biel/Akademie<br />
der Künste, Berlin).<br />
Peter Gruber<br />
1955 geboren, aufgewachsen<br />
im Ennstal, Steiermark,<br />
auf dem Bergbauernhof<br />
seiner Eltern. Lebt<br />
als Autor (Textwerkstätte)<br />
in Wien, im Ennstal und<br />
als Hirte am Dachstein.<br />
Seit 1981 literarische<br />
Veröffentlichungen: Naturfeuilletons,<br />
Lyrik, Sagen,<br />
Märchen, Wildererspiel,<br />
Bauernspiel, Adventspiel.<br />
Texte für Fotobände,<br />
Anthologien, Symposien,<br />
Literaturzeitschriften und<br />
Schreibwerkstätten.<br />
Publikationen (Auswahl):<br />
Sommerschnee (mit Fotos<br />
von Kurt Hörbst), 2008;<br />
Tod am Stein, 2006;<br />
Schattenkreuz, 2001;<br />
Notgasse, 1998.<br />
Christof Huemer<br />
1972 geboren, lebt als<br />
Literat und Journalist in<br />
Graz. Sein Erstlingsroman<br />
Zweifellos erschien 2008<br />
in der Edition Keiper.<br />
Günther Marchner<br />
Als Organisationsentwickler,Sozialwissenschafter<br />
und Historiker<br />
tätig, Mitbegründer des<br />
sozialwissenschaftlichen<br />
Netzwerks b.a.s.e. (www.<br />
base-salzburg.at) und von<br />
conSalis - Entwicklungsberatung<br />
(www.consalis.<br />
at). Er lebt und arbeitet in<br />
Salzburg und in Bad<br />
Mitterndorf.<br />
Tomáš Pospiszyl<br />
Lebt als Kritiker, Kurator<br />
und Kunsthistoriker in<br />
Prag. Er arbeitete als Kurator<br />
in der Nationalgalerie<br />
in Prag (1997-2002) und<br />
war Forschungsstipendiat<br />
im Museum of Modern<br />
Art in New York (2000).<br />
Seit 2003 unterrichtet<br />
er an der Film- und Fernsehschule<br />
der Akademie<br />
für darstellende Kunst in<br />
Prag.<br />
Publikationen (Auswahl):<br />
Primary Documents; A<br />
Sourcebook for Eastern<br />
and Central European Art<br />
since the 1950s (hrsg. mit<br />
Laura Hoptman), 2002;<br />
Octobrianaa ruský underground,<br />
2004, sowie<br />
zahlreiche Katalogbeiträge<br />
und Zeitschriftenartikel.<br />
Martin Prinzhorn<br />
Linguist an der Universität<br />
Wien, daneben Ver-<br />
öffentlichungen zu Kunst<br />
und Architektur.<br />
André Rottmann<br />
1977 geboren, ab 1998<br />
Studium der Kunstgeschichte,<br />
Neueren deutschen<br />
Literatur, Politikwissenschaft,<br />
Philosophie<br />
und Allgemeinen und<br />
Vergleichenden Literaturwissenschaft<br />
an der<br />
Humboldt-Universität zu<br />
Berlin, der Tufts University<br />
Boston und an der<br />
Freien Universität Berlin.<br />
Seit 2005 Chefredakteur<br />
der Zeitschrift Texte zur<br />
Kunst, Berlin. Seit 2007<br />
Korrespondent in Berlin<br />
für Artforum International,<br />
New York. Arbeitet<br />
an seiner Promotion zur<br />
Geschichte und Ästhetik<br />
institutionskritischer<br />
Kunst nach 1970.<br />
Richard Sennett<br />
1943 geboren in Chicago,<br />
Illinois, lehrt Soziologie<br />
und Geschichte an der<br />
New York University und<br />
an der London School of<br />
Economics and Political<br />
Science. Seine Hauptforschungsgebiete<br />
sind<br />
Städte, Arbeit und Kultursoziologie.<br />
Publikationen (Auswahl):<br />
Verfall und Ende des<br />
öffentlichen Lebens, 1977;<br />
How I write: Sociology as<br />
Literature, 2009; Der flexible<br />
Mensch. Die Kultur des<br />
Neuen, 1998.<br />
Das kulturwissenschaftliche<br />
Team unter der Leitung<br />
von Elke Murlasits<br />
(Historikerin, Graz) setzt<br />
sich aus Gundi Jungmeier<br />
(Historikerin, Graz),<br />
Günther Marchner (Historiker,<br />
Salzburg) und Gernot<br />
Rabl (Kunsthistoriker,<br />
Trautenfels) zusammen<br />
und bildet seit 2009 eine<br />
Arbeitsgruppe.
Index<br />
Werke der Ausstellung<br />
L/B<br />
Beautiful Steps #5,<br />
2010 Holz, laminiert und<br />
lackiert; Durchmesser 8 m,<br />
Stegbreite 70 cm,<br />
Höhe 110 cm<br />
Courtesy der Künstler<br />
Beautiful Steps #3, 2009<br />
Holz, Farbe;<br />
11,5 x 5 x 4,3 m<br />
Courtesy Le Confort<br />
Moderne, Poitiers<br />
→ S. 32ff<br />
Kateřina Šedá<br />
Es ist kein Licht am Ende<br />
des Tunnels, 2010<br />
203 Zeichnungen<br />
(Ölkreide) und Faksimile<br />
der Zeichnungen in<br />
verschiedenen Versionen;<br />
je 51 x 73 cm<br />
Courtesy der Künstlerin<br />
und Franco Soffiantino<br />
Gallery<br />
→ S. 48ff<br />
Maria Papadimitriou<br />
Alpine Altar, 2010<br />
Installation, verschiedene<br />
Materialen; Maße variabel<br />
Courtesy der Künstlerin<br />
→ S. 64ff<br />
Christian Philipp Müller<br />
Burning Love<br />
(Lodenfüßler), 2010<br />
Installation bestehend<br />
aus ca. 50 m Loden,<br />
20 Schrangen aus<br />
Lärchenholz, Projektion,<br />
4 Ölgemälden und 3<br />
s/w-Fotos aus diversen<br />
Sammlungen, 3 Farbfotos;<br />
Maße variabel<br />
Courtesy des Künstlers<br />
→ S. 80ff<br />
Pawel Althamer mit<br />
seiner Klasse für<br />
Objektbildhauerei der<br />
Akademie der Bildenden<br />
Künste, Wien<br />
Coach: Donat Grzechowiak<br />
Baptiste Elbaz, Luka<br />
Berchtold, Matthias<br />
Böhler, Hannah Breitfuss,<br />
Ida Divinzenz, Batiste<br />
Elbaz, Pauline Fauchour,<br />
Roland Gaberz, Johanna<br />
Guggenberger, Veronika<br />
Gahmel, Johannes<br />
Hoffmann, Konrad Kager,<br />
Matthias Kendler, Stefan<br />
Klampfer, Tonio Kröner,<br />
Bettina Mangold, Andrea<br />
Maurer, Tobias Nagiller,<br />
Nanna Nordström,<br />
Andreas Nutz, Noële<br />
Ody, Lukas Oppenauer,<br />
Michéle Pagel, Sabrina<br />
Peer, Heidi Rada, Johanna<br />
Reiner, Roland X. Roland,<br />
Eva Seiler, Dominika<br />
Soran, Stefan Stecher,<br />
Fabian Störk, Mario Strk,<br />
Klemens Waldhuber, Julian<br />
Wallrath, Benjamin Zuber<br />
Things You Can Walk Into,<br />
2010<br />
Verschiedene Materialien;<br />
Maße variabel<br />
Courtesy der Künstler<br />
→ S. 98ff<br />
Franz Kapfer<br />
Sieh-Dich-Für, 2010<br />
Holz, Lack,<br />
Halogenscheinwerfer;<br />
295 x 388 x 100 cm;<br />
332 x 115 x 130 cm;<br />
256 x 127 x 100 cm<br />
Courtesy des Künstlers<br />
Sieh-Dich-Für, 2010<br />
Holz, Beton, Lack;<br />
12 x 15 x 5,7 m<br />
Courtesy des Künstlers<br />
→ S. 120ff<br />
Copyrights<br />
© Universalmuseum<br />
Joanneum<br />
© für die abgebildeten<br />
Werke bei den<br />
Künstlerinnen und<br />
Künstlern<br />
© für die Texte bei<br />
den AutorInnen,<br />
ÜbersetzerInnen<br />
oder deren<br />
RechtsnachfolgerInnen<br />
© für die Fotografien<br />
bei den FotografInnen<br />
oder deren<br />
RechtsnachfolgerInnen<br />
Cover: © Maria<br />
Papadimitriou<br />
Archiv Schloss Trautenfels<br />
→ S. 7, 9-11, 35<br />
Courtesy Pawel Althamer<br />
und Open Art Projects<br />
→ S. 22<br />
David Kranzelbinder<br />
→ S. 84<br />
Mike Hall → S. 20<br />
François Charrière, Môtiers<br />
→ S. 44<br />
KBB → S. 44<br />
Oliver Heissner → S. 47<br />
L/B → S. 20, 21, 33, 38-<br />
42, 45<br />
Wolfgang Otte → S. 11, 36<br />
Paul Ott → S. 37<br />
Michal Hladík → S. 28, 49,<br />
51, 52, 56-58, 62/63<br />
Courtesy Fondazione<br />
Adriano Olivetti → S. 68<br />
Contemporary Art Center<br />
→ S. 67, 71<br />
Courtesy PAC, Milano →<br />
S. 71<br />
Courtesy Thessaly<br />
University → S. 69<br />
Maria Papadimitriou<br />
→ S. 17-19, 65, 68, 74-76,<br />
78/79, 270<br />
John Yancy → S. 97<br />
Gundi Jungmeier → S. 97<br />
Christian Philipp Müller<br />
→ S. 24, 25, 27, 85, 89-<br />
95, 138/139, 220/221,<br />
248/249, 278, 279, 283<br />
Franz Kapfer → S. 29-31,<br />
121, 123, 125-131, 133,<br />
135, 137<br />
Nicole Siegel → S. 271<br />
Kurt Hörbst → S. 155, 159<br />
Stefan Emsenhuber<br />
→ S. 164, 169, 177, 182,<br />
189<br />
Pawel Althamer mit<br />
seiner Klasse für<br />
Objektbildhauerei der<br />
Akademie der Bildenden<br />
Künste, Wien → S. 23,<br />
100-119<br />
Kateřina Šedá → S. 27<br />
Lukas Kogler, Johannes<br />
Pötscher → S. 289, 291<br />
Wir haben uns bemüht,<br />
sämtliche Rechtsinhaber<br />
ausfindig zu machen.<br />
Sollte es uns im Einzelfall<br />
nicht gelungen sein, so<br />
bitten wir diese, sich an<br />
das Universalmuseum<br />
Joanneum zu wenden.<br />
Quellenverzeichnis und<br />
Übersetzungen<br />
Adam Budak<br />
Die Performance des<br />
einheimischen Lebens,<br />
oder: Die Herstellung der<br />
Welt in der Landschaft der<br />
Selbstbedingtheit<br />
(übersetzt von Otmar<br />
Lichtenwörther, textkultur)<br />
Tomáš Pospiszyl<br />
Ein Grashügel und beleuchtete<br />
Kreuzungen<br />
(übersetzt von<br />
Dan Morgan und<br />
Christof Huemer)<br />
Jennifer Allen<br />
Für immer Parken<br />
(übersetzt von<br />
Christof Huemer)<br />
Pierre Bourdieu (u.a.):<br />
Der Einzige und sein<br />
Eigenheim. Erweiterte<br />
Neuausgabe der Schriften<br />
zu Politik & Kultur 3,<br />
herausgegeben von<br />
Margareta Steinrücke.<br />
Hamburg: VSA 2002.<br />
Übersetzung des Textauszugs:<br />
Jürgen Bolder<br />
Hannah Arendt: Vita<br />
activa oder Vom tätigen<br />
Leben. Ungekürzte<br />
Taschenbuchausgabe,<br />
8. Aufl., München: Piper<br />
2010.<br />
Richard Sennett:<br />
Handwerk. Aus dem<br />
Amerikanischen von<br />
Michael Bischoff. Berlin:<br />
BvT 2009.
Dieser Katalog erscheint<br />
anlässlich der Ausstellung<br />
Der schaffende Mensch<br />
Welten des Eigensinns<br />
Schloss Trautenfels<br />
Universalmuseum Joanneum<br />
03. Juni bis 31.Oktober 2010<br />
Kurator<br />
Adam Budak<br />
Herausgeber<br />
Adam Budak, Peter Pakesch<br />
Universalmuseum Joanneum<br />
Redaktion<br />
Katia Schurl<br />
Lektorat<br />
Jörg Eipper Kaiser<br />
Grafische Gestaltung<br />
Michael Posch<br />
ISBN<br />
978–3–90209–530–5<br />
© Universalmuseum Joanneum<br />
Mariahilferstraße 2-4, A-8020 Graz<br />
www.museum-joanneum.at<br />
Mit Unterstützung von<br />
Land Steiermark<br />
Wir danken<br />
Gerhard Abel<br />
Richard Aigner<br />
Jennifer Allen<br />
Anna Baldinger<br />
Helga Baldinger<br />
Rita Bender<br />
Bezirkspolizeikommando<br />
Liezen<br />
Binder & Krieglstein<br />
Andrea Binder, Piper<br />
Verlag<br />
Helmut Blaser<br />
Dieter Boyer<br />
Christian Brugger,<br />
Bundesdenkmalamt<br />
Perry Cartwright,<br />
University of Chicago<br />
Press<br />
Christine Czaika<br />
Sarah Dodgson, Polity<br />
Press<br />
Christoph Doswald<br />
Maria Düregger<br />
Stephan Egger<br />
Stefan Emsenhuber<br />
Marion Fisch, VSA-Verlag<br />
Josefine Flöß<br />
Freiwillige Feuerwehr<br />
Mitterberg<br />
Maria Froihofer<br />
Gerhard Grill<br />
Peter Gruber<br />
Otto Habermayer<br />
Handarbeitsrunde Schloss<br />
Trautenfels<br />
Kathrin Hartenberger<br />
Georg Haselnus<br />
Anton Hausleitner<br />
Michal Hladík<br />
Ondřej Hladík<br />
Günther Holler-Schuster<br />
Kurt Hörbst<br />
Nada Huber<br />
Christof Huemer<br />
Bert Jüngermann<br />
Isle Jury<br />
Jiří Kadlec<br />
Ulrike Kammerhofer-<br />
Aggermann<br />
Grete Karner<br />
Peter Kettner<br />
Julie Klusáková<br />
Lukas Kogler<br />
Margret Kohlberger<br />
Alois Kölbl<br />
Jiří Kovář<br />
David Kranzelbinder<br />
Christa und Franz Kraus<br />
Heinz Leuner<br />
Andrea Liebenberger<br />
Gernot Lux<br />
Anja Mallmann, Berlin<br />
Verlag<br />
Birgit Marcher<br />
Heimo Marcher<br />
Günther Marchner<br />
Cyril Marounek<br />
Daniela Matlschweiger<br />
Maria Mössner<br />
Alois Murnig,<br />
Bundesdenkmalamt<br />
Karin und Frieder<br />
Nischwitz<br />
Österreichisches Rotes<br />
Kreuz/LV-Steiermark/<br />
Bezirksstelle Liezen<br />
Pauline Perrignon, Yale<br />
University Press<br />
Roswitha Planitzer<br />
Rosina Plattner<br />
Karel Poneš<br />
Tomas Pospiszyl<br />
Johannes Pötscher<br />
Karl Pucher<br />
Christian Raich<br />
Johannes Rauchenberger<br />
Peter Regner<br />
Yorgos Rimenidis<br />
Eva Rossian<br />
André Rottmann<br />
Birgit Schachner<br />
Trixi Schlömmer<br />
Christian Schmid<br />
Christine Schmiedhofer<br />
Gerhard Schmiedhofer<br />
Josef Schmiedhofer<br />
Walter Schmiedhofer<br />
Mathias Schrempf<br />
Norbert Schrempf<br />
Rudolf Schwarz<br />
Hana Šedá<br />
Josef Šedý<br />
Herbert Seiberl<br />
August Singer<br />
Franco Soffiantino Gallery<br />
Herbert Steiner<br />
Johannes Steiner<br />
Jörg Steiner<br />
Karl Stocker<br />
Markus Straber<br />
Eva Taxacher<br />
Ingeborg Trink<br />
Anna Vasof<br />
Markéta Venclů<br />
Verein Schloss Trautenfels<br />
Marianne Winkler<br />
Wollkönigin Martina II<br />
Grete Zeiler<br />
Wir danken den<br />
Bewohnerinnen<br />
und Bewohnern der<br />
Gemeinden Ramsau<br />
am Dachstein, Haus im<br />
Ennstal, Aich-Assach,<br />
Pruggern, Michaelerberg,<br />
Mitterberg, Großsölk,<br />
Öblarn, Niederöblarn,<br />
Pürgg-Trautenfels und<br />
deren Bürgermeisterinnen<br />
und Bürgermeistern<br />
und insbesondere allen<br />
Menschen, die sich an den<br />
künstlerischen Projekten<br />
ehrenamtlich beteiligt<br />
haben.<br />
Besonderer Dank gilt<br />
den Künstlerinnen und<br />
Künstler der Ausstellung,<br />
die ihre Projekte mit<br />
außergewöhnlichem<br />
Engagement und Einsatz<br />
realisiert haben.<br />
Leihgeber<br />
Kammerhofmuseum<br />
Bad Aussee<br />
Gasthof Pension Veit,<br />
Gössl/Grundlsee<br />
Neue Galerie Graz,<br />
Universalmuseum<br />
Joanneum<br />
Gestaltung und Grafik<br />
Kulturwissenschaftlicher<br />
Raum<br />
Marianne Winkler<br />
Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter der<br />
Ausstellung,<br />
Universalmuseum<br />
Joanneum<br />
Peter Pakesch,<br />
Intendant<br />
Adam Budak,<br />
Kurator<br />
Katia Schurl,<br />
Projektleitung<br />
Katharina Krenn,<br />
Leitung Schloss<br />
Trautenfels<br />
Elke Murlasits,<br />
Leitung Kulturwissenschaftliches<br />
Team<br />
Gundi Jungmeier, Gernot<br />
Rabl, Günther Marchner,<br />
Kulturwissenschaftliche<br />
Mitarbeit<br />
Wolfgang Otte,<br />
Wissenschaftliche<br />
Mitarbeit, Schloss<br />
Trautenfels<br />
Michael Posch,<br />
Grafik<br />
Jörg Eipper Kaiser,<br />
Lektorat<br />
Nicole Siegel,<br />
Office Management,<br />
Schloss Trautenfels<br />
Teresa Ruff,<br />
Office Management,<br />
Kunsthaus Graz<br />
Robert Bodlos,<br />
Leitung Zentralwerkstatt,<br />
Graz<br />
Michael Huber,<br />
Haustechnik Schloss<br />
Trautenfels<br />
Werner Wihan,<br />
Werkstatt Schloss<br />
Trautenfels<br />
Erich Aellinger, Walter<br />
Ertl, Markus Ettinger,<br />
Bernd Klinger, Klaus<br />
Riegler, Michael Saupper,<br />
Stefan Savič, Peter<br />
Semlitsch, Andreas<br />
Zerawa, Zentralwerkstatt<br />
Margit Eingang, Josefine<br />
Eichtinger, Sabine Geier,<br />
Ursula Hänsel, Johanna<br />
Köberl, Ingeborg Schranz,<br />
Unterstützung Aufbau<br />
Schloss Trautenfels
Der schaffende Mensch<br />
Welten des Eigensinns<br />
Wir sind die schaffenden Menschen, Schmiede der<br />
Wirklichkeiten, Produzenten des Alltags, Schöpfer noch<br />
kommender Zukunften und Bildhauer von Orten. Als<br />
Studie performativer Zugehörigkeit geht der Katalog zur<br />
Ausstellung der Frage nach, ob der Homo Faber in der<br />
Welt des Eigensinns überhaupt möglich ist.<br />
Leben, Arbeit und die Leidenschaft, die beidem<br />
innewohnt, stehen dabei im Zentrum. Wie der Mensch<br />
lebt, wird hier durch ein Vergrößerungsglas gesehen,<br />
porträtiert und als autonomes und emanzipiertes Selbst<br />
dargestellt. Eigensinn erscheint dabei als ein mentaler<br />
und physikalischer Mechanismus, der die Identität<br />
eines sozialen und kulturellen Mikrokosmos formt<br />
und bedingt. Es ist ein vager Zwischenraum, in dem<br />
das Kleine und Intime, das Persönliche und Exklusive<br />
das unausweichlich Globale und Kosmopolitische der<br />
heutigen Gesellschaft herausfordert. Eigensinn ist das<br />
beschwerliche Territorium, auf dem Gemeinschaft und<br />
Zusammengehörigkeitsempfinden mit der Sturheit<br />
der Singularität und des selbstzentrierten Universums<br />
kämpfen.<br />
In sechs partizipativen Kunstprojekten, die von einem<br />
kulturwissenschaftlichen Beitrag begleitet werden, stellen<br />
sich internationale Künstlerinnen und Künstler mit völlig<br />
unterschiedlichen Herangehensweisen lokalen Themen.<br />
Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung:<br />
Pawel Althamer (PL) mit Studierenden der Akademie der<br />
Bildenden Künste Wien (AT), Franz Kapfer (AT), L/B (CH),<br />
Christian Philipp Müller (CH), Maria Papadimitriou (GR),<br />
Kateřina Šedá (CZ)