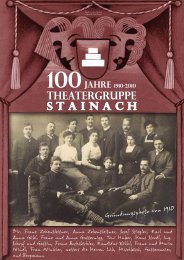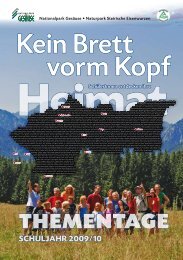Zeit1 - Regionale10
Zeit1 - Regionale10
Zeit1 - Regionale10
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
28 — 29<br />
Adam Budak<br />
Kateřina Šedá<br />
Es gibt kein Licht am<br />
Ende des Tunnels,<br />
2010<br />
auf dem Land durchgeführt wurden, wären noch weitere zwei Beispiele für<br />
Šedás Kritik an Gentrifizierung, Landbesitz und globalen Ökonomien, die<br />
die Ursache für Stadtsanierungen bilden und die Entscheidungen von multinationalen<br />
Konzernen beeinflussen. In beiden Fällen wird durch lächerliche<br />
Baumaßnahmen entweder die Landschaft vor Ort zerstört oder die<br />
Bewegungsfreiheit und der Komfort der Anwohner ernstlich getrübt. Das<br />
dunkle Metalltor eines neuen Eigentümers versperrt den Weg und nimmt<br />
dem Bereich jedes Sonnenlicht; eine neu errichtete Industriezone mit einer<br />
riesigen Autofabrik nimmt auch ihre Umgebung in Beschlag, indem sie sie<br />
etwa mit einer aggressiven Flut künstlichen Lichts blendet. Das Gefühl von<br />
Resignation und Hoffnungslosigkeit angesichts der Macht der politischen<br />
Autorität überwiegt in Kateřina Šedás emotional aufgeladenen Untersuchungen<br />
des Scheiterns und der Absurdität. Die Unmöglichkeit von Kommunikation<br />
(einschließlich des Scheiterns des Zusammengehörigkeitsgefühls),<br />
Ignoranz, Menschenrechtsverletzungen, Nichtachtung der Privatsphäre –<br />
das sind die wichtigsten Themen von Kateřina Šedás Projekten, die quasi<br />
als Lautsprecher fungieren, für vorwiegend marginale Gemeinschaften/<br />
Gemeinden, die von Global Playern unter Druck gesetzt wurden.<br />
Die Künstlerin beschreibt die Entstehungsgeschichte ihres neuen für die<br />
Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns in Auftrag<br />
gegebenen Projekts als in der Tat neue Erfahrung, die sich wirklich von<br />
ihren bisherigen Projekten, die vorwiegend mit Tschechien zu tun hatten,<br />
unterscheidet: Als sie die einheimische Bevölkerung des Ennstals darauf<br />
ansprach, erfuhr sie, dass in dieser (geografisch und politisch) offenbar<br />
idyllischen Landschaft keinerlei Wunsch oder Bedürfnis nach Veränderung<br />
besteht. Darüber hinaus wird das alles beherrschende Naturschauspiel, der<br />
Grimming, nicht als Barriere betrachtet, von der Landschaft und Menschen<br />
voneinander getrennt werden, sondern vielmehr als zentrale Schnittstelle,<br />
die alles auf den Punkt bringt: Von der Künstlerin aufgefordert, sich vorzustellen,<br />
was sich hinter dem Berg befindet und das, was sich genau hinter<br />
dem Berg befindet, zu zeichnen, lieferten die Einheimischen der Künstlerin<br />
ein perfektes Bild von hoher Präzision. Der Berg schien durchsichtig zu<br />
sein; der Sichtbarkeits- oder Wahrnehmungstest der Künstlerin scheiterte<br />
… oder war letztendlich ganz unerwartet erfolgreich! Jedenfalls brachten<br />
weitere Nachforschungen Kateřina Šedá auf den wahren Kern der entdeckten<br />
lokalen Kontroverse: der geplante Bau des größten Kreisverkehrs<br />
Österreichs, und zwar mitten in einem Ortszentrum, mit dem zwar der Transitverkehr<br />
erleichtert und das Problem mit dem Durchzugsverkehr gelöst<br />
sein, aber die bestehende Raumorganisation zerstört würde, das Dorf<br />
praktisch durchschnitten und somit das Leben der Bewohner schwieriger<br />
würde. Diese Entscheidung wurde nun schon seit beinahe drei Jahrzehnten<br />
heiß debattiert und konnte bislang von Interessensgruppen, Bürgerinitiativen<br />
wie LIEB, NETT und der Kampagne „Stop Transitschneise Ennstal“<br />
erfolgreich verhindert werden. Mit ihrem Projekt Es gibt kein Licht am<br />
Ende des Tunnels erweitert Kateřina Šedá ihr Interesse an Metaphern des<br />
Franz Kapfer<br />
Zentaur, 2004/05<br />
37<br />
Katerina Seda: Es gibt kein<br />
Licht am Ende des Tunnels,<br />
Projektbeschreibung.<br />
38<br />
Roger M. Buergel in: Franz<br />
Kapfer/Emil Varga, Katalog.<br />
Fotogalerie Wien, 2003.<br />
Lichts und der Blendung, der Sichtbarkeit und der Transparenz, als Instrumente<br />
einer aktiven Kritik an Modernisierung und Industrialisierung. „Der<br />
geplante Kreisverkehr, genauso wie die Autofabrik mit ihrem Licht, blendet<br />
die Anwohner und die Menschen können sich durch die Dunkelheit gar nicht<br />
sehen“, meint die Künstlerin und stellt sich die Aufgabe „eine Möglichkeit<br />
zu finden, wie die größtmögliche Personenanzahl durch das blendende<br />
Licht (den Kreisverkehr) verbunden werden und auf diese Art und Weise ihr<br />
Blick nur in eine Richtung gelenkt werden kann.“ 37 Šedá organisiert eine<br />
ganz besondere performative Zeichensession von kollektiver Urheberschaft,<br />
indem sie die Einheimischen dazu auffordert, den Kreisverkehr mit<br />
verbundenen Augen mit Buntstiften zu zeichnen. Diesem Konzept folgend,<br />
zusammengefügt und geschichtet, bieten die überlappenden Zeichnungen<br />
eine „einheitliche“ Sicht auf einen höchst problematischen Gegenstand –<br />
einen metaphorischen, beinah halluzinatorischen Knoten aus den verschiedensten<br />
Vorstellungen und Erwartungen. Hier in diesem kritischen Akt der<br />
Gruppentherapie betritt das Individuum die kommunale Ebene und erreicht<br />
auf auf diese Art und Weise möglicherweise die Neuverhandlung oder<br />
Erweiterung der Grenzen des Eigensinns.<br />
Franz Kapfer<br />
“Sieh-Dich-Für” oder: “My Home Is My Castle”, einmal umgekehrt<br />
Die Untersuchung von Klischeedarstellungen bildet die Grundlage für viele<br />
Projekte des in der Steiermark geborenen Künstlers Franz Kapfer. In seinen<br />
bildhauerischen Interventionen und auf Video, inszenierter Fotografie<br />
und Performance beruhenden Arbeiten werden in einem Akt der Herstellung<br />
der ganz persönlichen Privatmythologie des Künstlers – einem subjektiven<br />
Theater der männlichen Identität, da, in den Worten Roger M. Buergels,<br />
Kapfer „mit der dynamisierten Pose, der Maskerade oder der Dramatisierung<br />
seiner eigenen Erscheinung arbeitet“ 38 – antike und christliche Ikonografien<br />
einer Neubetrachtung unterzogen. Seine Kunstpraxis beruht auf einer Performativität,<br />
die auf die Tradition der Performancekunst und der Body Art<br />
der 1970er-Jahre verweist. Es finden sich auch Anklänge an die Poetik des<br />
mittelalterlichen Theaters und sie erinnert auch an die Figuren der Commedia<br />
dell‘ arte mit ihrer für das Bachtinsche Karnevaleske typischen Körperlichkeit,<br />
Groteskheit und ihrem so genannten „Realismus auf einer niedrigeren<br />
Ebene“. (Männliche) Körperpolitik und Sexualität stehen im Zentrum<br />
seiner kritischen Untersuchungen von Identitätsbildung (Gender-Diskurs),<br />
Gesellschaftsstrukturen (Faschismus, Familie) und Religion (Katholizismus),<br />
die er in Form einer Reihe von performativen Travestie-Tableaus zur<br />
Aufführung bringt. Indem er in Rollen aus der Mythologie oder der Weltgeschichte<br />
schlüpft, Rituale nachstellt und deren Symbolsprache hinterfragt,<br />
untersucht Kapfer die Darstellungsmuster, von denen unsere Vorstellung<br />
und Wahrnehmung der Welt geprägt ist. Mal als mythologischer Pan verkleidet,<br />
der seine Freundin verführen möchte, mal als Zentaur, der seiner