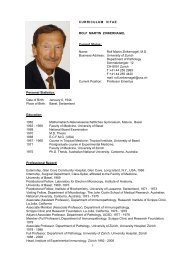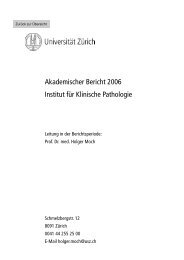Akademischer Bericht 2004 - UniversitätsSpital Zürich
Akademischer Bericht 2004 - UniversitätsSpital Zürich
Akademischer Bericht 2004 - UniversitätsSpital Zürich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gebiete (z.B. Hepatopathologie, Uropathologie, Haematopathologie) auf hohem Niveau ausgeübt werden.<br />
2. Ausbau des Angebots molekularer Tests: Molekulare Testverfahren werden zunehmend bedeutsam. Der<br />
Ausbau dieser Testverfahren ist kosten- und arbeitsintensiv und erfordert eine entsprechende Infrastruktur.<br />
In der Lymphomdiagnostik und in der onkologischen Diagnostik solider Tumoren (Sarkome, solide<br />
Tumoren) können nur noch wenige Einrichtungen dieses Angebot entwickeln. Es ist zu erwarten, dass<br />
gerade auf diesem Gebiet eine enge Zusammenarbeit mit anderen Pathologie-Instituten des staatlichen<br />
Gesundheitswesens erfolgen wird. Hier sind bereits erste Gespräche im Gang. Beispiele für solche molekularen<br />
Tests sind die Fluoreszenz in-siut-Hybridisierung bei Mammakarzinomen, die direkte Sequenzierung<br />
(Glivec-Therapie) sowie molekulare Testverfahren an zytologischen Präparaten (z.B. Urovision).<br />
3. Zunehmende Intensivierung der Krebsforschung: Die oben genannten Entwicklungen zeigen, dass durch<br />
unmittelbare Überführung von Forschungsergebnissen in die Routine-Diagnostik die Qualität der Diagnostik<br />
erhöht werden kann. Durch eine rege Kollaboration mit dem Zentrum für Funktionelle Genomik<br />
der Universität und der ETH sowie durch zahlreiche weitere Zusammenarbeiten mit Arbeitsgruppen der<br />
ETH wird versucht werden, Methoden der Proteomic und Transcriptomic neben der klassischen Molekularbiologie<br />
am Institut für Klinische Pathologie zu etablieren. Diese Methoden werden uns helfen, die von<br />
uns bearbeiteten Fragestellungen der Krankheitsforschung zu lösen.<br />
4. Trotz der vermehrten Spezialisierung der Kollegen wird einer guten Ausbildungsumgebung viel Aufmerksamkeit<br />
geschenkt. Täglich finden morgendliche Weiterbildungsveranstaltungen statt, um die Ausbildung<br />
der Fachassistenten möglichst breit zu gestalten. Gleichzeitig finden wöchentlich Forschungsseminare<br />
statt, in denen die Wissenschaftler des Instituts gemeinsam mit den diagnostisch tätigen Ärzten Forschungsergebnisse<br />
präsentieren und diskutieren. Ebenfalls wöchentlich finden Journal Clubs statt, bei<br />
denen neue Arbeiten besprochen werden. In den Semestern haben die Montagskolloquien mit Vorträgen<br />
auswärtiger Wissenschaftler grossen Anklang gefunden, nicht nur bei den Institutsangehörigen, sondern<br />
auch bei den Pathologen auswärtiger Einrichtungen.<br />
Die Forschungsschwerpunkte des Institutes beziehen sich auf klinisch relevanten Fragestellungen der klinischen<br />
Krebsforschung, der Immunpathologie und der molekularen Epidemiologie (siehe unten).<br />
2 Forschung<br />
2.1 Überblick<br />
Das Institut für Klinische Pathologie hat folgende Forschungsschwerpunkte definiert: Klinische Krebsforschung, Tumor-<br />
und Entwicklungsbiologie, Immunpathologie/Translationelle Forschung und Molekulare Epidemiologie. Für die<br />
Krebsforschung und Translationelle Forschung bedeutsam war die Etablierung eines Labors für die Entwicklung der<br />
Gewebechip-Technologie. Die Gewebechip-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Untersuchung hunderter Patientenproben.<br />
Damit können neue prädiktive und prognostische Parameter auf eine klinische Relevanz getestet werden.<br />
Durch den Aufbau des Labors für die Gewebechip-Technologie wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert.<br />
Es bestehen bereits diverse Kollaborationsprojekte, z.B. mit der Klinik für Dermatologie, der Klinik für Onkologie,<br />
sowie dem Institut für Neurobiologie.<br />
Im Forschungsschwerpunkt Tumor- und Entwicklungsbiologie sind die Arbeitsgruppen von Frau PD Dr. S. Marino<br />
sowie von Prof. Dr. D. Zimmermann federführend. Hervorzuheben ist die Publikation von Frau PD Dr. Marino in<br />
„Nature“. In dieser Arbeit konnte Bmi-1 identifiziert und grundlegende Erkenntnisse zur Entwicklung von Medulloblastomen<br />
aufgedeckt werden. Es wurde gezeigt, dass Bmi-1 eine wichtige Rolle während der Kleinhirnentwicklung<br />
spielt, indem es das Wachstum der Vorläuferzellen der äusseren Körnerschicht fördert. Man vermutet dass<br />
Medulloblastome, bösartige kindliche Hirntumore, durch eine unkontrollierte Proliferation solcher Vorläuferzellen<br />
3