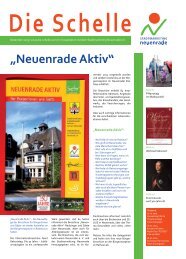April - die schelle
April - die schelle
April - die schelle
- TAGS
- april
- schelle
- die-schelle.com
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10 Die Post in Neuenrade Letzter Teil<br />
von Wolfgang Lampe<br />
Die Zollstation auf der Wilhelmshöhe<br />
wurde im September 1885<br />
verpachtet. Die Straße nach Werdohl<br />
fiel an den Schmied und Gastwirt<br />
Peter Heinrich Schmellenkamp<br />
(1802-1886, S154). Die Höllmecke-Straße<br />
(nach Altena) übernahm<br />
der Zinngießer und Gastwirt Johann<br />
Peter Gloerfeld ( 1824-1911,<br />
G050).<br />
Dieser Wegezoll, auch Accise, Tor-<br />
Sperr- oder Pflastergeld genannt,<br />
wurde vor dem Passieren der Barrieren<br />
/ Schlagbäume fällig. Die<br />
Beträge waren nicht einheitlich und<br />
es gab auch Ausnahmen, zum Beispiel<br />
für <strong>die</strong> Postwagenfahrten oder<br />
<strong>die</strong> reitenden und fahrenden Postillione,<br />
<strong>die</strong> gewöhnliche Briefpost<br />
oder Personen beförderten. Nicht<br />
befreit waren Kuriere, Estafetten<br />
(= Eilboten) und Extraposten. Dieser<br />
Wegezoll wurde auf der Wilhelmshöhe<br />
noch bis 1925 erhoben.<br />
1862 wurden am Hause Erste Straße<br />
46 (damals Apotheker Johann<br />
Strunden (S888), heute Jürgen Urbas<br />
/Provinzial-Versicherungen und<br />
das Haus Nr. 166 Gastwirtschaft<br />
Johann Heinrich Schulte (1767-<br />
1836, S429) Vorm Obertor („Vör<br />
de Poate“ = vor dem Tor, heute das<br />
Ärztezentrum) Posthaltestellen eingerichtet.<br />
Wenn <strong>die</strong> Pferde von Werdohl hoch<br />
kommend Neuenrade erreicht hatten,<br />
waren sie für <strong>die</strong> Weiterfahrt,<br />
nach Balve überfordert. In dem<br />
Haus Nr.166, durch Einheirat, jetzt<br />
des Land- und Gastwirtes Heinrich<br />
Wilhelm Dickehage (1829-1891,<br />
D061). wurde <strong>die</strong> Pferdewechselstation<br />
betrieben, um ein frisches<br />
Pferdegespann für den Wechsel<br />
bereit zustellen, sie versah ihren<br />
Dienst bis zur letzten Postwagenfahrt<br />
am 31.03.1912.<br />
Die Fahrzeit der Personenpost betrug<br />
etwa: Balve-Neuenrade 70 und<br />
Neuenrade-Werdohl 75 Minuten.<br />
Der Postillion Philips, ganz links, beim Abladen<br />
von 2 Postsäcken in der Packkammer des<br />
Postamtes Neuenrade um 1910<br />
Zu <strong>die</strong>sem Bild erzählte Anton<br />
Lampe (1877-1968, L008), der<br />
im Jahre 1888 seinen Wohnsitz in<br />
Neuenrade genommen hatte, seinem<br />
Neffen Wolfgang:<br />
Wilhelmshöhe um 1910, auf dem Bild sind <strong>die</strong> Reste des<br />
Schlagbaums zu erkennen ( siehe Pfeil )<br />
„Später musste ich täglich zur Arbeit<br />
nach Werdohl gehen, da ich<br />
<strong>die</strong> teure Postkutsche nicht benutzen<br />
konnte. Mein Weg führte mich<br />
über den alten, steilen und holperigen<br />
Hohlweg, den „Postweg“.<br />
Dem Postillion Philips begegnete<br />
ich so häufig, dass ich ihn im hohen<br />
Alter noch in Erinnerung habe.<br />
Er trug einen Helm, Stulpenstiefel,<br />
eine blaue Uniform mit roten<br />
Aufschlägen und einem Bandelier<br />
(breiter Schulterriemen). An der<br />
Kehre (Wilhelmshöhe) blies er bei<br />
der Fahrt in <strong>die</strong> Stadt <strong>die</strong> Melo<strong>die</strong><br />
des Liedes „Schier dreißig Jahre<br />
bist Du alt“.<br />
Am 01.04.1912 wurde <strong>die</strong> eingleisige<br />
Bahnstrecke Neuenrade<br />
– Menden – Fröndenberg in Betrieb<br />
genommen, <strong>die</strong> nun Personen, Güter<br />
und <strong>die</strong> Post auf <strong>die</strong>ser Strecke<br />
befördert. Zur Begleitung der Posttransporte<br />
wurde ein Eisenbahnpostschaffner<br />
und ein Paketträger<br />
eingestellt. Der im Bahnpackwagen<br />
mitfahrende Schaffner sortierte <strong>die</strong><br />
Post und stempelte sie nochmals<br />
mit dem Bahnpoststempel. An den<br />
Haltestationen wartete ein Postbeamter<br />
der <strong>die</strong> Post für den entsprechenden<br />
Bezirk übernahm.<br />
Im Jahre 1917 wurde der Postwagen<br />
für den Paket<strong>die</strong>nst und wegen<br />
der überraschenden Nachfrage nach<br />
Personenfahrten zwischen Neuenrade<br />
und Werdohl wieder in Betrieb<br />
genommen. Offensichtlich bevorzugten<br />
<strong>die</strong> aus dem Süden<br />
kommenden Bahnreisenden<br />
den Postwagen nach<br />
Neuenrade als direkte Verbindung<br />
anstelle des Umweges<br />
mit der Bahn über<br />
Hagen, Menden nach Neuenrade.<br />
Der Postwagen fuhr nun<br />
wieder zweimal wöchentlich<br />
nach Werdohl. Die<br />
Geschäftsleute mit ihren<br />
Lieferungen, insbesondere<br />
der Versandhandel, nahmen<br />
<strong>die</strong>sen Dienst gerne<br />
in Anspruch. Die Firma<br />
Heinrich Suhr, verfügte als größtes<br />
Versandhandelsgeschäft über einen<br />
eigenen Postwagen.<br />
Schweifen wir jetzt einmal von der<br />
Post ab und sehen uns andere Trans-<br />
portmöglichkeiten<br />
im Märkischen<br />
Sauerland an. Denn<br />
auch <strong>die</strong> Schmalspurbahnen,Straßenbahn<br />
und Omnibusse<br />
wurden<br />
für den Transport<br />
von der Post in Anspruch<br />
genommen.<br />
Um den zunehmenden<br />
Personen-<br />
und Güterverkehr, gleichzeitig aber<br />
auch <strong>die</strong> Entwicklung der Industrie<br />
im Märkischen Sauerland zu fördern,<br />
suchte man nach günstigen<br />
Verkehrswegen.<br />
Für Neuenrade sah das schlecht<br />
aus. Obwohl 1912 mit dem Sackbahnhof<br />
an <strong>die</strong> eingleisige Strecke<br />
nach Menden - Fröndenberg angebunden,<br />
gab es darüber hinaus<br />
keine Eisenbahnverbindung, <strong>die</strong><br />
an <strong>die</strong> so wichtige Ruhr-Sieg-Bahn<br />
heranführen konnte. Alle zahlreich<br />
diskutierten Pläne führten am Ende<br />
zu nichts, denn topographisch lag<br />
Neuenrade einfach zu hoch.<br />
Anders konnte man das für <strong>die</strong> in<br />
den Flusstälern z.B. Verse, Rahmede,<br />
Hälver und auch der Nette so<br />
zahlreich entstandenen Dörfern und<br />
kleinen und mittleren Industriebetriebe<br />
gestalten.<br />
Allerdings gab es auch hier Probleme,<br />
denn für <strong>die</strong> Staatsbahn war<br />
es unmöglich, in <strong>die</strong>sen engen und<br />
kurvenreichen Tälern mit der Normalspur<br />
zu fahren. Andererseits<br />
beteiligte sie sich aus wirtschaftlichen<br />
Gründen nicht an anderen<br />
Projekten.<br />
So wurde in Eigeninitiative <strong>die</strong><br />
KAS „Kreis Altenaer Schmalspur-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft“ gegründet.<br />
Später KAE „Kreis Altenaer Eisenbahn“<br />
genannt, <strong>die</strong> Schmalspur betrug<br />
1 Meter. 1887 wurde <strong>die</strong> erste<br />
Linie Altena - Lüdenscheid durch<br />
das Rahmedetal eröffnet. Dann<br />
folgte Werdohl -Lüdenscheid durch<br />
das Versetal und Halver - Schalksmühle<br />
durch das Hälvertal.<br />
In Dahle und Altena befasste man<br />
sich auch für das Nettetal mit dem<br />
Bau einer Schmalspurbahn, kam<br />
trotz Bemühungen jedoch nicht<br />
voran, weil <strong>die</strong> Lösung der Probleme<br />
vor sich hergeschoben wurden.<br />
1909 haben dann Dahler Bürger<br />
<strong>die</strong> „Elektromobil-Gesellschaft<br />
Nettetal“ gegründet, um wenigstens<br />
eine neuzeitliche Verkehrsverbindung<br />
für <strong>die</strong> Personenbeförderung<br />
zu schaffen. Die Frage war Elektro-<br />
oder Automobil?<br />
Nach drei Anläufen, wobei <strong>die</strong> jeweils<br />
neu gegründete Gesellschaft<br />
nach kurzer Zeit aufgaben, war es<br />
mit dem Automobilverkehr Dahle –<br />
Evingsen – Altena vorbei. Endlich,<br />
am 10.12.1921, man hatte sich seit<br />
1913 mit dem Bau einer Straßenbahn<br />
befasst, trat <strong>die</strong> elektrische<br />
Straßenbahn ihre Jungfernfahrt an.<br />
Die Bürger waren des Lobes voll<br />
und <strong>die</strong> Fabrikanten erfreuten sich<br />
auch <strong>die</strong>ser Anlage. Bekamen doch<br />
<strong>die</strong> Firmen, <strong>die</strong> es wünschten, ein<br />
Anschlussgleis. So konnten <strong>die</strong> Güterwagen<br />
der Reichsbahn (Normalspur),<br />
auf sogenannte „Rollböcke“<br />
gehoben, von einer Elektro-Lok<br />
(Schmalspur), bis in <strong>die</strong> Betriebe<br />
gefahren werden.<br />
Es hatte sich gezeigt, dass mit den<br />
Schmalspurbahnen nicht alle Verkehrsprobleme<br />
gelöst werden konnten.<br />
Vor allem bei der Personenbeförderung<br />
zeigten sich erhebliche<br />
Lücken, denn <strong>die</strong> wenigen Postkutschen<br />
konnten den steigenden<br />
Berufsverkehr nicht bewältigen.<br />
Um <strong>die</strong>ses Problem zu lösen, wurde<br />
1925 der „Kraftverkehr Mark-<br />
Sauerland GmbH“ gegründet. Initiatoren<br />
waren Landrat Dr. Thomée<br />
aus Werdohl und Dr. Jokusch aus<br />
Lüdenscheid. Gesellschafter waren<br />
der Kreis Altena, Stadt Lüdenscheid,<br />
Stadt Neuenrade, Gemeinde<br />
Werdohl, Halver, Kierspe und 1 Jahr<br />
später Herscheid und Plettenberg.<br />
Bereits am 22. März 1925 wurde <strong>die</strong><br />
erste Linie Neuenrade – Werdohl in<br />
Betrieb genommen und zwar mit<br />
einem 55 PS starken 24-sitzigen<br />
Omnibus der Firma MAN (Maschinenfabrik<br />
Augsburg Nürnberg).<br />
Die ersten Fahrer wurden Wilhelm<br />
Dickehage (1899-1985, D072) und<br />
Franz Riecke (1898-1989, R126),<br />
nachdem sie zuvor eine vierwöchentliche<br />
Ausbildung und <strong>die</strong><br />
Führerscheinprüfung in dem MAN-<br />
Werk in Nürnberg-Fürth absolviert<br />
und bestanden hatten.<br />
Sitz der Gesellschaft wurde Neuenrade,<br />
da sich <strong>die</strong> Stadt bei dem Bau<br />
der Omnibushalle mit Wohnhaus<br />
(heute das neue Feuerwehr-Gerätehaus<br />
an der Bahnhofstraße) sehr<br />
engagiert hatte. Etwas später wurde<br />
der Sitz der Gesellschaft wegen der<br />
zentraleren Lage nach Lüdenscheid<br />
verlegt.<br />
Vielerorts kam <strong>die</strong> Post jetzt den<br />
Wünschen der Bevölkerung nach<br />
und stieg von den Pferdekutschen<br />
auf <strong>die</strong> Kraftpost um. Die Post führte<br />
1929 den Landkraftpostwagen<strong>die</strong>nst<br />
ein. Diese Kraftpostwagen<br />
hatten allerdings nur 4 Fahrgastsitze<br />
und fuhren <strong>die</strong> ersten Jahre noch<br />
auf Vollgummireifen, während <strong>die</strong><br />
Omnibusse bereits Luftreifen und<br />
Platz für mindestens 25 Personen<br />
hatten.