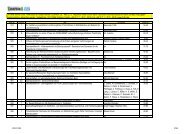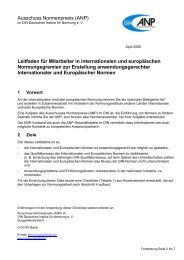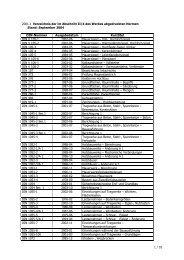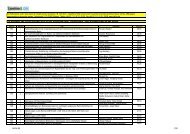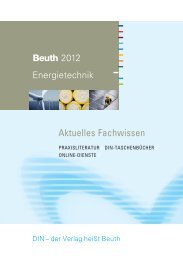VDI 2840 - Beuth Verlag
VDI 2840 - Beuth Verlag
VDI 2840 - Beuth Verlag
- TAGS
- beuth
- verlag
- www.beuth.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– 10 – <strong>VDI</strong> <strong>2840</strong> Entwurf Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 2004<br />
Nr. 2.5: Tetraedrische wasserstoffhaltige<br />
amorphe Kohlenstoffschichten<br />
ta-C:H<br />
Auch bei den wasserstoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten<br />
können sich überwiegend sp 3 -<br />
Hybridisierungen zwischen den Kohlenstoffatomen<br />
ausbilden [7]. Diese ta-C:H-Schichten werden<br />
zurzeit noch nicht industriell eingesetzt. Da sie jedoch<br />
bereits weit erforscht sind und ihre Eigenschaften<br />
bekannt sind, wurden sie in diese Richtlinie<br />
aufgenommen.<br />
Die modifizierten wasserstoffhaltigen amorphen<br />
Kohlenstoffschichten teilen sich nach den Modifizierungselementen<br />
in zwei weitere Gruppen auf:<br />
die metallhaltigen und die mit Nichtmetallen modifizierten<br />
wasserstoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten.<br />
Die zusätzlich eingebauten Elemente<br />
werden mit ihren Kürzeln ebenfalls mit<br />
Doppelpunkt an die Abkürzung a-C:H angehängt<br />
(z. B. a-C:H:Si:O).<br />
Nr. 2.6: Metallhaltige wasserstoffhaltige<br />
amorphe Kohlenstoffschichten<br />
a-C:H:Me<br />
Die metallhaltigen wasserstoffhaltigen amorphen<br />
Kohlenstoffschichten enthalten metallische Elemente,<br />
z. B. Wolfram (a-C:H:W) oder Titan<br />
(a-C:H:Ti). Die Motivation besteht, wie bei den<br />
metallhaltigen wasserstofffreien amorphen Kohlenstoffschichten,<br />
darin, die tribologischen Eigenschaften<br />
der Schicht zu beeinflussen (siehe Abschnitt<br />
4.2.1, Nr. 2.3).<br />
Nr. 2.7: Modifizierte wasserstoffhaltige<br />
amorphe Kohlenstoffschichten<br />
a-C:H:X<br />
Die mit Nichtmetallen modifizierten wasserstoffhaltigen<br />
amorphen Kohlenstoffschichten enthalten<br />
nichtmetallische Elemente, wie z. B. Silicium (Si),<br />
Sauerstoff (O), Stickstoff (N), Fluor (F) oder Bor<br />
(B), die teilweise auch Carbide bilden können<br />
(z. B. Si und B). Damit lassen sich spezielle Eigenschaften<br />
der Schicht, z. B. die Oberflächenenergie<br />
(Adhäsionsneigung, Benetzung), verändern. Weitere<br />
Eigenschaften, die mit diesen Zusatzelementen<br />
beeinflusst werden können, sind Temperaturbeständigkeit,<br />
Transluzenz, Farbe und UV-<br />
Beständigkeit.<br />
4.3 Kristalline Kohlenstoffschichten<br />
Die kristallinen Kohlenstoffschichten teilen sich<br />
auf in Diamantschichten und in Graphitschichten.<br />
Unterscheiden lassen sie sich, wie in Abschnitt 3.2<br />
erläutert, durch die Hybridisierung der Kohlenstoffbindungen.<br />
Die Kohlenstoffatome der Graphitschichten<br />
sind sp 2 -hybridisiert, die der Dia-<br />
Lizenzierte Kopie von elektronischem Datenträger<br />
mantschichten sind sp 3 -hybridisiert. Beide<br />
Schichten enthalten neben dem Kohlenstoff an den<br />
Korngrenzen auch sehr geringe Mengen Wasserstoff.<br />
4.3.1 Diamantschichten<br />
Die Diamantschichten weisen einen sehr großen<br />
Schichtdickenbereich von typisch 1 µm bis 2 mm<br />
auf und werden bei Beschichtungstemperaturen<br />
von ca. 600 bis 1000 °C abgeschieden.<br />
Die CVD-Diamantschichten sind polykristallin,<br />
das heißt, die Schicht stellt einen Vielkristall bestehend<br />
aus einzelnen, direkt aneinandergrenzenden<br />
Kristalliten dar. Abzugrenzen sind sie gegen<br />
den Schneidstoff „Polykristalliner Diamant“, den<br />
man „PKD“ abkürzt (englisch „PCD“, „polycrystalline<br />
diamond“). Hierbei handelt es sich um<br />
einen Verbundwerkstoff, der Diamant enthält. Zu<br />
seiner Herstellung werden Diamantkristallkörner<br />
mit Größen im Mikrometerbereich zusammen mit<br />
einem metallischen Binder, z. B. Cobalt, gemischt,<br />
gepresst und gesintert. PKD stellt keine Schicht<br />
dar, sondern wird als massiver Schneidstoff, meist<br />
in Plattenform verarbeitet. Nach DIN ISO 513 wird<br />
PKD mit den Kennbuchstaben DP bezeichnet.<br />
Bei den Diamantschichten unterscheidet man die<br />
Diamantdünnschichten und die Diamantdickschichten.<br />
Unter einer Diamantdünnschicht versteht<br />
man üblicherweise eine Schicht mit maximal<br />
ca. 40 µm Dicke (siehe Tabelle 2). Diamantdickschichten<br />
haben typischerweise Dicken von 0,3 bis<br />
2,0 mm, können in bestimmten Fällen jedoch auch<br />
Schichtdicken bis hinunter zu ca. 20 µm aufweisen.<br />
Im Dickenbereich zwischen ca. 20 und 40 µm<br />
gibt es also sowohl Diamantdünnschichten als auch<br />
Diamantdickschichten.<br />
Als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal wird<br />
daher die weitere Verarbeitung der Schicht herangezogen.<br />
Diamantdünnschichten dienen der direkten<br />
Beschichtung von Bauteilen, z. B. Werkzeugen.<br />
Diamantdickschichten werden dagegen in der<br />
Regel auf einem Hilfssubstrat abgeschieden und<br />
anschließend von diesem Substrat abgelöst. Diese<br />
Diamantplatten werden dann als freistehender Diamant,<br />
z. B. als Strahlungsfenster, eingesetzt oder<br />
auf Träger montiert, in der Regel durch Vakuumlöten,<br />
um daraus z. B. Werkzeuge herzustellen. Da es<br />
sich dann nicht mehr explizit um eine Schicht handelt,<br />
spricht man dann oft nicht mehr von CVD-<br />
Diamantschichten, sondern von CVD-Diamant.<br />
Technologisch gibt es keine prinzipiellen Unterschiede<br />
zwischen der Abscheidung von Diamantdünnschichten<br />
und der Abscheidung von Diamantdickschichten.<br />
Im Unterschied zu konventionellen<br />
CVD-Verfahren muss bei der CVD-Abscheidung