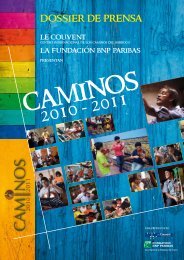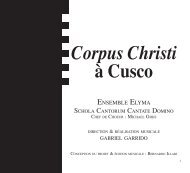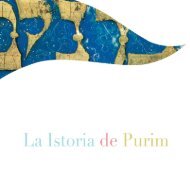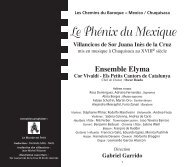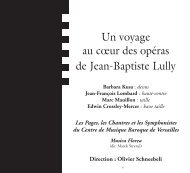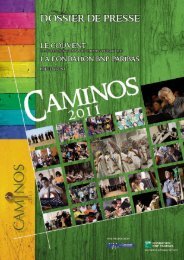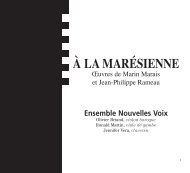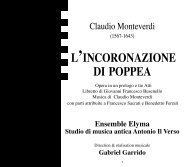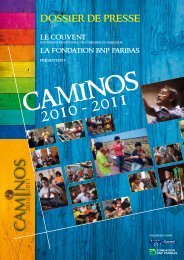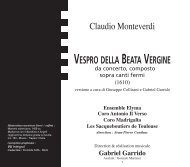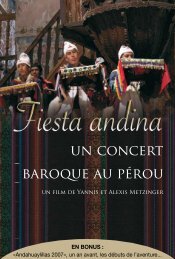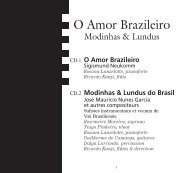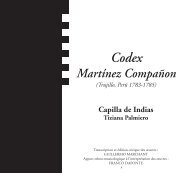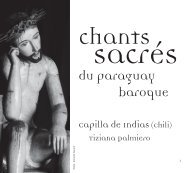Untitled - Les chemins du Baroque
Untitled - Les chemins du Baroque
Untitled - Les chemins du Baroque
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
liturgischer Musik erkennbar wären. Doch verbirgt<br />
sich hinter dieser formalen Neutralität ein Phänomen,<br />
das uns von Heinrich Schütz und seinen Zeitgenossen<br />
bis zu Haydns „Sieben letzten Worten unseres<br />
Erlösers am Kreuz“ geläufig ist: diese Formen konnten<br />
dazu bestimmt sein, den Ritus zu begleiten,<br />
ohne daß es sich ihre Schöpfer jemals in den Sinn<br />
kommen liessen, daß man sie einmal aus ihrem ursprünglichen<br />
Kontext herauslösen könnte.<br />
HEINRICH IGNAZ FRANZ VON BIBER<br />
Heinrich Ignaz Franz von Biber wurde am 12.August<br />
1644 in Böhmen geboren. Über seine ersten musikalischen<br />
Lehrer ist nichts bekannt, doch geht die<br />
Forschung allgemein davon aus, daß er in der<br />
Steiermark, wo er im Dienste des Fürsten zu<br />
Eggenberg gestanden haben muß, <strong>du</strong>rch Johann<br />
Heinrich Schmelzer, den er später in Wien wiedertraf,<br />
Violin- und Kompositionsunterricht erhielt. Die<br />
virtuose Violin-Literatur stand damals in vollster<br />
Blüte und die besten Virtuosen Österreichs und<br />
Böhmens dienten, zumindest zeitweise, in der<br />
Olmützer Kapelle des Fürstbischofs Karl Graf<br />
Liechtenstein-Kastelkorn. Auch Biber trat in diese<br />
Kapelle ein und übernahm gegen 1665 deren<br />
Leitung. Fünf Jahre später kam es zu einem Streit<br />
mit seinem Arbeitgeber, sodaß er ausschied und in<br />
die Kapelle des Salzburger Fürsterzbischofs wechselte.<br />
Dort leitete er unter anderem die Proben des<br />
Kathedralchors, dessen Direktor er 1684 wurde.<br />
Biber, der erleben <strong>du</strong>rfte, wie sein Ruhm international<br />
rapide zunahm, wurde 1690 in den Adelsstand<br />
erhoben. Neben seinen Violinsonaten schuf er ein<br />
umfangreiches Œuvre geistlicher Musik, drei Opern<br />
und 15 Schuldramen für das Salzburger Jesuiten-<br />
Gymnasium, von denen leider fast nichts erhalten<br />
ist.<br />
Bibers außerordentlich vielseitiges Schaffen sollte<br />
seine alles überragende Bedeutung für die<br />
Entwicklung des Violin-Repertoires allerdings nicht<br />
20<br />
überschatten. Charles Burney, der englische<br />
Musikschriftsteller des 18.Jahrhunderts, schrieb 1776<br />
in seiner Musikgeschichte völlig zu recht: „Von allen<br />
Geigern des letzten Jahrhunderts scheint Biber der<br />
beste gewesen zu sein. Seine Solowerke sind das<br />
Schwierigste und Kapriziöseste, was mir jemals von<br />
der Musik dieser Zeit zu Ohren gekommen ist.“<br />
DIE 15 SONATEN uND DIE PASSACAGLIA<br />
Die Rosenkranz-Sonaten lagen vermutlich 1676<br />
bereits fertig vor. Aus der Zueignung an den<br />
Fürsterzbischof - „Ich habe dieses Werk der<br />
Verherrlichung der XV Geistlichen Geheimnisse<br />
gewidmet, die Sie so sehr ehren“ – lässt sich nicht<br />
mit Bestimmtheit entnehmen, ob ihre Entstehung<br />
auf einen Auftrag seines Arbeitgebers oder auf<br />
Bibers eigene Initiative zurückgeht. Daneben weist<br />
die Dedikation aber auf die Tatsache hin, daß „die<br />
vier Saiten der Violine auf fünfzehn verschiedene<br />
Arten für die verschiedenen Sonaten, Préludes,<br />
Allemanden, Courenten, Sarabanden, Airs,<br />
Chaconnen, Variationen etc. zu stimmen sind“. Der<br />
häufige Rückgriff auf die Technik der „Skoradtur“ ist<br />
tatsächlich zweifellos das auffälligste Merkmal dieses<br />
außerordentlichen Werkes. Wörtlich übersetzt<br />
bedeutet der Begriff „Skordatur“„Verstimmung“.<br />
Damit ist eine von der üblichen Stimmung der einzelnen<br />
Saiten der Saiteninstrumente abweichende<br />
Stimmung gemeint. Vor Biber wurde diese Technik<br />
in der Mitte des 17.Jahrhunderts von Lautenisten<br />
und Gambisten angewendet, um entlegene Tonarten<br />
grifftechnisch zu ermöglichen. Später taucht sie in<br />
vielen Violinkonzerten von Vivaldi und in der 5.<br />
Cello-Suite von Johann Sebastian Bach wieder auf.<br />
Dann starb sie aus, bevor sie vereinzelt im 20.<br />
Jahrhundert wieder Verwen<strong>du</strong>ng fand: in Strawinskys<br />
„Feuervogel“, im Scherzo der 4.Sinfonie von Mahler<br />
und im letzten Satz der „Contrasts“ von Bartók.<br />
Davitt Moroney glaubt zu erkennen, daß „einige der<br />
Rosenkranz-Sonaten (zum Beispiel die erste) einem