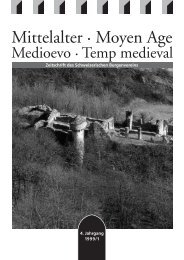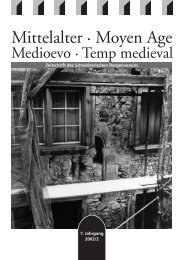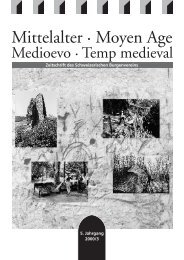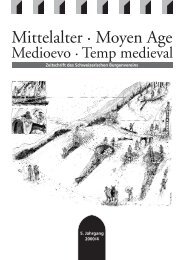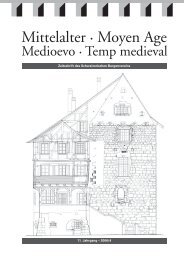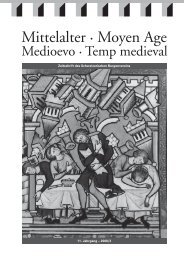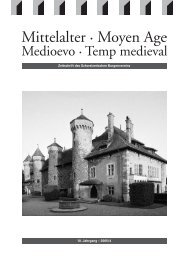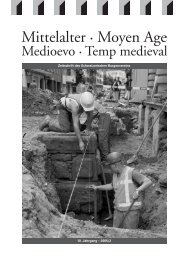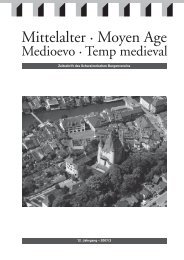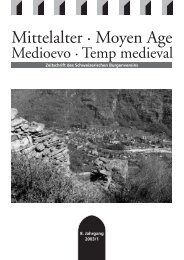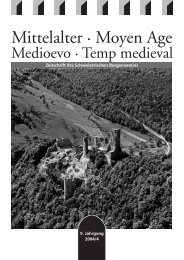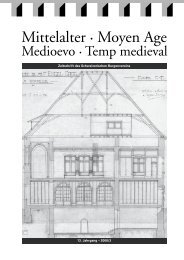Download PDF (1.2 MB) - Schweizerischer Burgenverein
Download PDF (1.2 MB) - Schweizerischer Burgenverein
Download PDF (1.2 MB) - Schweizerischer Burgenverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ein ägyptisches Schnurspannfest �<br />
Das Szenario am Tempel von Edfu schildert<br />
den Akt eines Schnurspannfestes eindrücklich.<br />
Als Akteur steht der Pharao im<br />
Mittelpunkt; von Szene zu Szene trägt er<br />
eine andere Krone.<br />
1. Szene: Im Zentrum steht Seshat, die<br />
Göttin der Schnurvermessung. Ihr Kopfschmuck<br />
ist ein Obelisk; über seinem Pyramidion<br />
steht ein fünfstrahliger Stern.<br />
Zusammen mit dem Pharao schlägt sie<br />
Messpfähle ein.<br />
2. Szene: Der barhäuptige Pharao ritzt mit<br />
der Hacke den Grundplan ein. Über sei-<br />
mehr als weiter unten die Himmelsrichtung<br />
genannt wird. Die<br />
Ausschmückung «Giebel im Himmel»<br />
umschreibt das, was zu den<br />
Gewölben und zum Schlussstein<br />
der Chrischonakirche (vgl. Abb.<br />
24) schon gesagt worden ist.<br />
Der Versuch, einen Blick hinter die<br />
Kulissen zu tun, ist für das Verständnis<br />
des mittelalterlichen Kulturschaffens<br />
unabdingbar. Dies<br />
auch auf die Gefahr hin, mit unseren<br />
Betrachtungen fehlzugehen.<br />
Als weiteres Moment kommt<br />
hinzu, dass letztlich auch hier der<br />
Architekt die Inspiration zum<br />
Planentwurf aus göttlicher Hand<br />
empfängt, im eigentlichen Sinn nur<br />
als Mittler gesehen wird und sich<br />
selber als solchen versteht (vgl.<br />
Kasten �) 26 . So sieht eine mittelalterliche<br />
Miniatur den schlafenden<br />
Mönch Gunzo in seinem Bett, wie<br />
er im Traum das Schnurgespann<br />
zum Neubau des Klosters Cluny<br />
schaut. Kein geringerer als Petrus<br />
leitet den Vermessungsakt (Abb.<br />
28) 27 . Die chaotische Faltung der<br />
abgelegten Mönchskutte steht in<br />
fröhlichem Kontrast zur Ordnung<br />
des Schnurgerüsts (vergleichbar<br />
dem Pflanzengeschlinge auf Abb.<br />
14). Die Schnüre weisen hier keine<br />
Knoten auf, dafür aber die Heili-<br />
nem Haupt steht der Horus-Falke.<br />
3. Szene: Die Kultstätte wird mit Opfergeschenken<br />
geweiht (auch als Einfärbung<br />
der Bodenmarken gedeutet).<br />
4. Szene: Der Pharao formt den ersten<br />
Lehmziegel; der Tisch kann als Modell des<br />
Tempels verstanden werden.<br />
Auf allen Szenen wird der Gottkönig von<br />
Horus begleitet und geführt. Sein göttlicher<br />
Befehlsstab berührt aber die Erde nie.<br />
Vgl. Clarke 1930, Abb. 61.<br />
Seshat, die Göttin der Schnurvermessung,<br />
ist Schutzpatronin der Maurer und gilt zugleich<br />
auch als Herrin der Schrift. Dass<br />
sich unter den Weihgeschenken zuweilen<br />
auch Hacken finden, erklärt Szene 2.<br />
genscheine der Akteure. Hinter der<br />
Szene steht Psalm 127,2: «Den Seinen<br />
gibt es der Herr im Schlaf.»<br />
Kehren wir zum Entwurf des Basler<br />
Münsters zurück (Abb. 27):<br />
Wie sehr sich der mittelalterliche<br />
Architekt bemüht, die vorgegebene<br />
«himmlische Ordnung» in seinen<br />
Entwurf einzubringen, ist allenthalben<br />
spürbar. So wird es zur verpflichtenden<br />
Aufgabe, das architektonische<br />
Konzept nicht nur<br />
nach seiner äusseren Masshaltigkeit<br />
zu sehen, sondern auch seiner Sinnhaftigkeit<br />
nachzuspüren. Dies soll<br />
in der Gegenüberstellung der beiden<br />
Grundfiguren von Chor und<br />
Kreuzgang geschehen (Abb. 29).<br />
Beide Grundrisse entwickeln sich<br />
aus einem Kreis mit demselben<br />
Durchmesser. Beim Chor fällt das<br />
Zentrum des Kreises mit dem<br />
Schwerpunkt eines gleichseitigen<br />
Dreiecks zusammen. Die Seitenlängen<br />
des Dreiecks entsprechen dem<br />
Durchmesser des Kreises, was bewirkt,<br />
dass die Spitzen des Dreiecks<br />
den Kreis durchstossen. Am deutlichsten<br />
wird dies beim Chorscheitel<br />
spürbar, wodurch das Raumgefühl<br />
entsteht, als würde dort die<br />
Kirchenachse das Chorrund aufreissen.<br />
15<br />
Die ganze Choranlage ist aber auf<br />
den Kreismittelpunkt Z hin fokussiert;<br />
in ihm treffen sich sämtliche<br />
Bezugslinien (vgl. Abb. 13). Das<br />
Dreieck steht für die Göttlichkeit<br />
der Trinität: Jeder Ecke stehen zugleich<br />
zwei andere gegenüber; es ist<br />
nicht der direkte Bezug von der einen<br />
Ecke zur anderen, sondern das<br />
Spannungsfeld mit seinem Schwerpunkt.<br />
Der Umkreis wird damit<br />
zur Mandorla, zum magischen<br />
Kreis des Immunitätsbereiches 28 .<br />
Der Lettner auf der Höhe des Vierungspfeilers<br />
trennte die ecclesia, die<br />
Gemeinde, vom sanctuarium, dem<br />
Altarbereich. Hier stand überhöht<br />
die goldene Altartafel Heinrichs II.<br />
Der heutige Besucher des Basler<br />
Münsters hat sich bewusst zu machen,<br />
dass sich das erhöhte Chorpodium<br />
einst über die ganze Vierung<br />
erstreckt hat. Die Zäsur im<br />
29: Basel – Münster. Beim Chor konzentriert sich<br />
das Raumerlebnis auf den Mittelpunkt Z.<br />
Beim Kreuzgang wird der Mittelpunkt Z wandelnd<br />
umkreist. Hier geht es um Dinge wie «Lebenswandel<br />
und Wandlung».