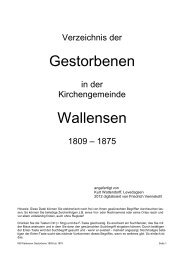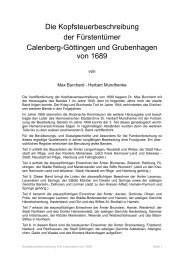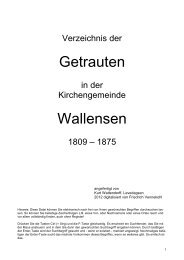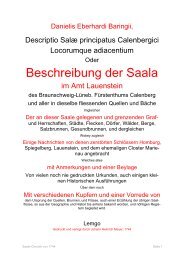750 Jahre Eime - bei Friedrich Vennekohl
750 Jahre Eime - bei Friedrich Vennekohl
750 Jahre Eime - bei Friedrich Vennekohl
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
aus. In den Jahrhunderten nach der Zeitenwende ging man allmählich erneut<br />
zur Körperbestattung über, wie viele Gräber des Sonnenberges in der Gemarkung<br />
Esbeck bezeugen. Jetzt wurden wiederum Beigaben üblich. Man<br />
findet Gefäße, Schmuck und Waffen den verehrten Toten <strong>bei</strong>gegeben.<br />
Von Ackerleuten und Hudebauern<br />
Die urzeitlichen Siedler auf der Gemarkung <strong>Eime</strong>, deren Kommen und Gehen,<br />
Schaffen und Wirken durch die Bodenurkunden vielfach belegt sind, gingen<br />
seit den Tagen der Jungsteinzeit den Weg der erzeugenden Wirtschaft. Aus<br />
Gründen der Ernährungssicherheit wurde die Natur in Hege genommen. Der<br />
Mensch unterwarf sie sich seinen Bedürfnissen und Wünschen, indem er aus<br />
Naturgeschöpfen die Kulturpflanzen und Haustiere züchtete. So bedeuteten<br />
Viehzucht und Ackerbau etwas grundlegend Neues. Kurzum, der Weg zum<br />
Bauerntum war gefunden. Durch die Bodenbewirtschaftung wurde der von<br />
den Menschen eingenommene Raum der Nahrungsfürsorge dienstbar gemacht<br />
und die Tierhaltung zur geregelten Herausgabe des Bedarfs an Milch und<br />
Fleisch gezwungen.<br />
So gaben Pflanzenzucht und Viehege von vornherein die bestmögliche Sicherheit<br />
der Lebenshaltung. In gewisser Weise brachte sie auch eine Ar<strong>bei</strong>tsentiastung<br />
mit sich, so daß der Mensch sich nunmehr anderen Aufgaben zuwenden<br />
konnte. Er war nicht mehr gezwungen, seine gesamte Zeit nur mit<br />
Jagd und dem mühsamen Sammeln von Wildfrüchten zuzubringen, wie es<br />
während der Jahrtausende der Nachciszeit notwendig war. Auch stand ihm<br />
für eine Reihe Ar<strong>bei</strong>ten die Zugkraft seiner Haustiere zur Verfügung, lim das<br />
Bild aus Lirzeittagen in allen Teilen abzurunden, sei noch hinzugefügt, daß bis<br />
um die Mitte des ersten Jahrtausends n. Chr. die Gehöfte der Bauern in der<br />
Vereinzelung lagen. So war es auch <strong>bei</strong> uns. Die Äcker schlössen sich nahe<br />
gelegen dem Gehöft an. Dann folgte immer der Wald, der vom Sonnenberg<br />
aus gesehen nach unseren Begriffen die Landschaft parkartig gestaltete. In<br />
den lichten Wäldern weidete das Vieh, und oftmals trieben die Hirten die<br />
Rinder-, Schweine- und Schafherden weithin in die ihnen zustehenden Hudegründe.<br />
Nicht nur das Gras und die würzigen Krauter auf den Waldblößen<br />
boten dem Vieh die tägliche Nahrung, sondern auch die Jungtriebe der Waldbäume<br />
aller Art wurden gern gefressen. Lind der Verbiß der Jungpflanzen<br />
sorgte dafür, daß der Forst nicht zum undurchdringlichen Dickicht wurde<br />
Unter den ausladenden Baumgruppen suchte das Vieh den wohltuenden Schatten<br />
und fand Schutz gegen die Unbilden der Witterung. - Während der<br />
Schneezeit hielt man das Vieh im Pferch, einem von undurchdringlichem Gesträuch<br />
umhegten Platz. Jetzt wurden die während des Sommers geschnittenen<br />
I.aubheustapel verfüttert. — Von der Art der Ackerwirtschaft ist schon im<br />
Kapitel der Jungsteinzeit alles Notwendige gesagt. Daß sie sich selbstverständlich<br />
<strong>bei</strong> zunehmender Zahl der Menschen weiter entwickelte, sei hier<br />
ausgesprochen.<br />
20<br />
21<br />
Vor den Toren des Mittelalters<br />
In den letzten Jahrzehnten .des 8. Jahrhunderts, in denen Karl der Große<br />
unser Sachsenland mit Krieg überzog, richtete er an den wichtigsten Brennpunkten<br />
fränkische Missions- und Verwaltungsstationen ein. Für unseren<br />
Raum sind das Hildesheim und Elze. Das erstere erhob Ludwig der Fromme<br />
im zweiten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts zum Bischofssitz des südsächsischen<br />
Raumes. Wenn auch in Elze ein Erzpriester eingesetzt und eine Taufkirche<br />
gegründet wurde, so hatte das vornehmlich darin seinen Grund, daß sich hier<br />
an der Kreuzung zweier vielbefahrener Verkehrswege der Urzeit ein für die<br />
damalige Zeit nicht unbedeutender Handelsplatz (Wieksiedlung) entwickelt<br />
Hatte, wo sogar an wichtigen Markttagen auf leichten Booten wickingische<br />
Kaufleute ihre Geschäfte machten. Zum ändern aber lag südlich, dem Markte<br />
gar nicht allzu fern, der bedeutendste Richtplatz des Leineberglandes: Der<br />
Königsstuhl zu Gudingen. Längst sind das Dorf und die Stätte alter Rechtspflege<br />
untergegangen, aber die Annalen der Geschichte künden von ihnen<br />
bis auf den heutigen Tag, und über alle Zeiten hinstrahlend zeigt das das<br />
stolze Wappen unseres blühenden Fleckens <strong>Eime</strong>.<br />
Am Königsstuhl saß der König selbst zu Gericht, wenn er durch die Lande<br />
zog. War er verhindert, vertrat ihn ein dazu aus seiner nächsten Umgebung<br />
Berufener (Herzog oder Graf). Alle Rechtsfragen im Räume zwischen Harz<br />
und Weser sowie Deister und Reinhardtswald wurden hier verhandelt, soweit<br />
sie nicht in den Gaudingen erledigt werden konnten. Bis in die Zeit um<br />
Abb. 7 Haupthof von Gudingen (9. bis 10. Jahrhundert n. Chr. Links die Halle,<br />
wie sie der Helianddichter beschreibt. In der Mitte hinten die Kemnate der<br />
Frauen, wo sie sämtliche Ar<strong>bei</strong>ten im Tagesablauf verrichteten. Zur Rechten<br />
die Schmiede. Inmitten des Hofes der Brunnen. (Wiederherstellung nach<br />
einer Grabung auf der Wüstung Gudingen, Gemarkung <strong>Eime</strong>). — In der<br />
Nähe dieses Gehöftes lag der .Königstuhl zu Gudingen".