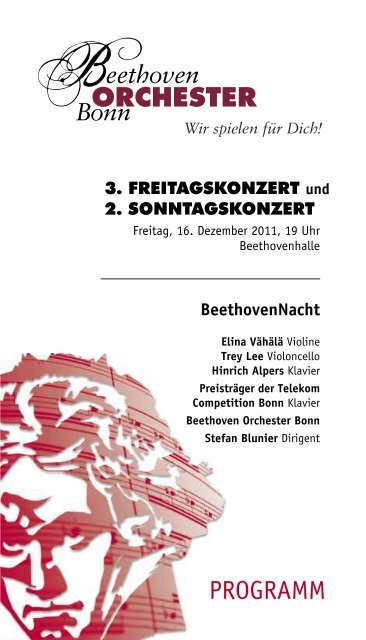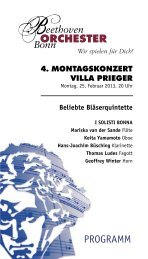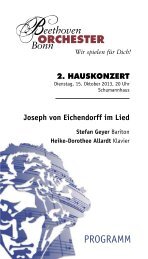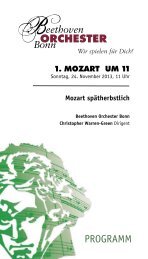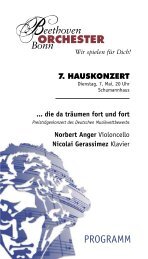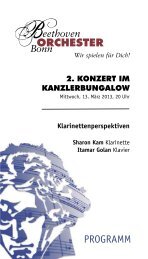3. FREITAGSKONZERT - Das Beethoven Orchester Bonn
3. FREITAGSKONZERT - Das Beethoven Orchester Bonn
3. FREITAGSKONZERT - Das Beethoven Orchester Bonn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wir spielen für Dich!<br />
<strong>3.</strong> <strong>FREITAGSKONZERT</strong> und<br />
2. SONNTAGSKONZERT<br />
Freitag, 16. Dezember 2011, 19 Uhr<br />
<strong>Beethoven</strong>halle<br />
<strong>Beethoven</strong>Nacht<br />
Elina Vähälä Violine<br />
Trey Lee Violoncello<br />
Hinrich Alpers Klavier<br />
Preisträger der Telekom<br />
Competition <strong>Bonn</strong> Klavier<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Stefan Blunier Dirigent<br />
PROGRAMM
Wir spielen für Dich!<br />
Jede Note<br />
Leidenschaft<br />
Immer wissen, was gespielt wird:<br />
Kostenlos unseren Newsletter abonnieren!<br />
www.beethoven-orchester.de<br />
Foto: Barbara Aumüller
Programm<br />
<strong>Beethoven</strong>Nacht<br />
Ludwig van <strong>Beethoven</strong> (1770-1827)<br />
Ouvertüre zu „Egmont“ f-Moll op. 84 (1809-1810)<br />
Konzert für Klavier, Violine und Violoncello C-Dur op. 56<br />
„Tripelkonzert“ (1803-1804)<br />
Allegro<br />
Largo<br />
Rondo alla Polacca<br />
Elina Vähälä Violine<br />
Trey Lee Violoncello<br />
Hinrich Alpers Klavier<br />
PAUSE<br />
Mit Auszügen aus<br />
diesem Programm<br />
gastiert das BOB<br />
zwischen dem 29.12.11<br />
und 05.01.12<br />
in CHINA<br />
Ludwig van <strong>Beethoven</strong><br />
Konzert für Klavier und <strong>Orchester</strong> Nr. 5 Es-Dur op. 73 (1809)<br />
Allegro<br />
Adagio un poco moto<br />
Rondo. Allegro<br />
Jingge Yan Klavier<br />
1. Preisträger der „4. International Telekom<br />
<strong>Beethoven</strong> Competition <strong>Bonn</strong>“
4<br />
Klaviersonate Nr. 31 As-Dur op. 110 (1821)<br />
Moderato cantabile molto espressivo<br />
Allegro molto<br />
Adagio ma non troppo - Fuga. Allegro ma non troppo<br />
Chi Ho Han Klavier<br />
2. Preisträger der „4. International Telekom<br />
<strong>Beethoven</strong> Competition <strong>Bonn</strong>“<br />
Klaviersonate Nr. 2 A-Dur op. 2 Nr. 2 (1795)<br />
Allegro vivace<br />
Largo appassionato<br />
Scherzo. Allegretto<br />
Rondo. Grazioso<br />
Rémi Geniet Klavier<br />
<strong>3.</strong> Preisträger der „4. International Telekom<br />
<strong>Beethoven</strong> Competition <strong>Bonn</strong>“<br />
PAUSE<br />
Ludwig van <strong>Beethoven</strong><br />
Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93 (1811-1812)<br />
Allegro vivace e con brio<br />
Allegretto scherzando<br />
Tempo di Menuetto<br />
Allegro vivace<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Stefan Blunier Dirigent<br />
18.25 Uhr: Einführung mit Stefan Blunier
Besetzung<br />
Ludwig van <strong>Beethoven</strong><br />
Ouvertüre zu „Egmont“ f-Moll<br />
Uraufführung: 15. Juni 1815 in Wien<br />
2 Flöten (2. auch Picc.)<br />
4 Hörner<br />
2 Oboen<br />
2 Trompeten<br />
2 Klarinetten<br />
2 Fagotte<br />
Pauke<br />
Streicher<br />
Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und <strong>Orchester</strong> C-Dur<br />
Uraufführung: Mai 1808 in Wien<br />
1 Flöte<br />
2 Oboen<br />
2 Klarinetten<br />
2 Fagotte<br />
Pauke<br />
Streicher<br />
Solo-Violine, Solo-Violoncello,<br />
Solo-Klavier<br />
2 Hörner<br />
2 Trompeten<br />
Konzert für Klavier und <strong>Orchester</strong> Nr. 5 Es-Dur<br />
Uraufführung: 28. November 1811 in Leipzig.<br />
2 Flöten 2 Hörner<br />
2 Oboen 2 Trompeten<br />
2 Klarinetten<br />
2 Fagotte<br />
Pauke<br />
Streicher<br />
Solo-Klavier<br />
Sinfonie Nr. 8 F-Dur<br />
Uraufführung: 27. Februar 1814 in Wien<br />
2 Flöten 2 Hörner<br />
2 Oboen 2 Trompeten<br />
2 Klarinetten<br />
2 Fagotte<br />
Pauke<br />
Streicher<br />
5
6<br />
<strong>Beethoven</strong>-Büste, Plastik von Hugo Hagen (1818-1871)<br />
Egmont-Ouvertüre<br />
Graf Egmont, eine historische Figur aus dem 16. Jahrhundert,<br />
war Statthalter der Niederlande – einem Land, das zu seiner<br />
Zeit von der spanischen Regentin Margarete von Parma regiert<br />
wurde. Es regte sich Widerstand im Lande – und in diesen<br />
Kontext stellte Goethe seine Figur als einen auf Individualität<br />
bedachten freiheitsliebenden, von Leichtsinn, Toleranz, aber<br />
auch Tapferkeit und persönlichen Charme geprägten Protago-<br />
nisten dar. Als Sympathieträger des unterdrückten Volkes und<br />
Freund der niederländischen Opposition in Gestalt des Herzogs<br />
von Oranien wird er nach Margaretes Flucht vom neuen Regen-<br />
ten Herzog von Alba verhaftet und zum Tode verurteilt. Egmont<br />
muss erkennen, wie die Germanistin Gisela Uellenberg<br />
schreibt, „dass tapferes Eintreten für eine Meinung da sinnlos<br />
ist, wo man es mit einem Gegner zu tun hat, der mit Andersden-
kenden nicht diskutiert, sondern sie auslöscht.“ Ein höchst aktu-<br />
elles Thema! Egmonts Liebe Klärchen, entsetzt über die Ereig-<br />
nisse, versucht noch die Bevölkerung zum Aufstand zu bewe-<br />
gen. Sie scheitert und vergiftet sich. Im Kerker, vor seiner<br />
Hinrichtung, lässt Goethe seinen Helden von ihr träumen: Die<br />
Freiheit reicht Egmont in ihrer Gestalt, einen Lorbeerkranz.<br />
Immerhin ist dem liberalen Grafen ein Sieg, der die abschlie-<br />
ßende „Symphonie“ verdient, vergönnt: der Sohn von Egmonts<br />
Gegner Alba begeistert sich<br />
für seine Ideale.<br />
Zur Bühnenmusik zu „Eg-<br />
mont“ kam es durch einen<br />
Auftrag des kaiserlichen<br />
Hoftheaterdirektor Joseph<br />
Hartl im Herbst des Jahres<br />
1809. Die Ouvertüre nimmt<br />
viele Moment der Handlung<br />
illustrativ vorweg: In der<br />
düsteren Einleitung mit dem<br />
choralartigen Streichersatz<br />
könnte man eine Darstel-<br />
lung der Niederländer erken-<br />
Graf von Egmont (1522-1568)<br />
Statthalter von Flandern u. Artois,<br />
zeitgenössischer Kupferstich<br />
nen, die unter der Macht des spanischen Unterdrückers leiden.<br />
Aus dem kämpferischen Beginn wird eine „resignative“ Passa-<br />
ge, die ins Stocken kommt, immer leiser, doch dann mit einem<br />
wahren „Kraftstoß“ ins bewegte Allegro übergeht. Als zweites<br />
Thema setzt <strong>Beethoven</strong> den jetzt kämpferischer klingenden<br />
Choralgedanken des Anfangs ein. Der Satz mündet in eine Gene-<br />
ralpause, die nach <strong>Beethoven</strong>s Anmerkungen Egmonts Tod<br />
7
8<br />
darstellt. Doch damit ist das Stück nicht zu Ende: Ausgehend<br />
von wenigen besinnlichen Holzbläsertakten entwickelt sich aus<br />
dramatischen Streichertremoli eine wirbelnde Coda mit<br />
abschließender „Siegesmusik“, wie sie Goethe in seinem Drama<br />
auch für den Schluss des Stückes vorgesehen hat.<br />
Tripelkonzert<br />
<strong>Das</strong> so genannte „Tripelkonzert“ verdankt seine Entstehung<br />
einem prominenten <strong>Beethoven</strong>-Schüler: Es entstand in den<br />
Jahren 1803 und 1804 für den Erzherzog Rudolf von Öster-<br />
Erzherzog Rudolf von Österreich<br />
reich. Seinen pianistischen<br />
Fähigkeiten ist die Klavier-<br />
stimme des Stückes ange-<br />
passt, das im Übrigen in<br />
seiner außergewöhnlichen<br />
Besetzung ein Relikt aus<br />
einer älteren Zeit darstellt.<br />
Gattungsgeschichtlich han-<br />
delt es sich dabei um eine<br />
„Sinfonia concertante“, bei der mehrere Instrumente dem<br />
<strong>Orchester</strong> gegenüberstehen und bei der sich der klassische<br />
„Wettstreit“ nicht auf den Kontrast zwischen Ensemble und<br />
Solist, sondern zwischen den einzelnen Soloparts bezieht. Die<br />
Entwicklung dieser Gattung ist aus dem alten Concerto grosso<br />
hervorgegangen und war um 1800 eigentlich so gut wie ausge-<br />
storben. <strong>Beethoven</strong> musste, um diese Anlage auf seinen<br />
ausgeformten Stil zu übertragen, mit großen Dimensionen<br />
arbeiten. Jedes der drei Instrumente sollte schließlich zu
seinem Recht kommen – und so wuchs allein der erste Satz zu<br />
einem Stück von fast 20 Minuten Länge an.<br />
Schon der orchestrale Beginn zeigt die groß dimensionierte<br />
Architektur: Sequenzartig entwickelt sich das Geschehen<br />
durch das Vorantreiben einer charakteristischen Bassfigur zum<br />
Hauptthema hin. Harmonische Spannung geht hier mit einem<br />
breit angelegten Crescendo einher. <strong>Das</strong> Cello eröffnet schließ-<br />
lich den Soloteil mit der „fragenden“ Phrase, mit der das Stück<br />
begonnen hat; Violine und Klavier vervollständigen nachei-<br />
nander das Klaviertrio, das nun dem <strong>Orchester</strong> als kammermu-<br />
sikalische Einheit gegenübertritt, obwohl sich das Klavier<br />
mitunter als Widerpart gegenüber den beiden Streichern profi-<br />
liert.<br />
Nach dem außergewöhnlichen Umfang des Kopfsatzes<br />
erscheint das Largo – übrigens in der fernen, aber terzver-<br />
wandten Tonart As-Dur – sehr kurz. Die kantablen Elemente<br />
liegen fast ausschließlich in den Streichern: Aus einem knap-<br />
pen Streichervorspiel erwächst das Cellothema. Der weitere<br />
Satzverlauf ist von variativer Entwicklung bestimmt, während<br />
das Klavier figurierend umspielt.<br />
Einige wenige, improvisatorisch anmutende Takte leiten zum<br />
abschließenden Rondo über – einem Satz, der fast reißerisch<br />
anmutet und sicherlich der eingängigste dieses Konzertes ist.<br />
<strong>Beethoven</strong> schält aus dem Beginn nach und nach den typi-<br />
schen Polonaisen-Rhythmus heraus; am Ende strafft sich der<br />
beschwingte Vorwärtsdrang zu einer Coda im 2/4-Takt – die<br />
dramaturgisch äußerst effektvolle Basis für die Solisten,<br />
wieder zum „Polacca“-Metrum zurückzukehren und das Werk<br />
triumphal zu beenden.<br />
9
10<br />
Konzert für Klavier und <strong>Orchester</strong><br />
Nr. 5 Es-Dur<br />
Als Ludwig van <strong>Beethoven</strong> im Herbst 1792 von <strong>Bonn</strong> in die<br />
damalige Musikweltmetropole Wien übersiedelt war, hatte er<br />
nicht nur den Plan, ein großer Komponist, sondern auch ein<br />
großer Pianist zu werden. Immerhin hatte schon Mozart, der<br />
<strong>Beethoven</strong> einige Jahre zuvor wahrscheinlich bei einem kürze-<br />
ren Besuch in der Donaumetropole gehört hat, angeblich die<br />
<strong>Beethoven</strong>-Porträt von<br />
Louis Letronne, 1814<br />
berühmten Worte gespro-<br />
chen „auf den gebt acht, der<br />
wird einmal von sich reden<br />
machen“, und damit auch<br />
<strong>Beethoven</strong>s Kunst des<br />
Klavierspiels gemeint. Kein<br />
Wunder, dass sich <strong>Beethoven</strong><br />
bei seinem ersten großen<br />
Auftritt in Wien am 2. April<br />
1800 mit einem ersten<br />
Klavierkonzert vorstellte und<br />
in den Jahren darauf nicht<br />
nur Sinfonie und Kammermusik, sondern auch die Konzertgat-<br />
tung in den Mittelpunkt seiner revolutionären Neuerungen<br />
stellte. Höhepunkt ist das Klavierkonzert Nr. 5, <strong>Beethoven</strong>s letz-<br />
tes Konzert überhaupt, das erstmals 1811 in Leipzig erklang.<br />
Der Komponist konnte wegen seiner vorangeschrittenen Taub-<br />
heit den Solopart nicht übernehmen.<br />
<strong>Beethoven</strong> festigte hier die großen Errungenschaften seiner<br />
Vorstellungen von der Konzertform: Wie schon im vierten<br />
Klavierkonzert lässt er den Solisten gleich am Beginn zu Wort
kommen und weist ihm einen Dialogpart im Miteinander mit<br />
dem <strong>Orchester</strong> zu, das zum Schauplatz weiträumiger themati-<br />
scher Entwicklungen wird. Der langsame Satz beginnt in der<br />
zur Grundtonart Es-Dur tonal weit entfernten Tonart H-Dur,<br />
was die Entrücktheit des dahinströmenden Gesangs unter-<br />
streicht, der schließlich nach einer nachdenklich-tastenden,<br />
fast wie eine Improvisation anmutenden Passage ins Finale<br />
führt – in einen Schlusssatz, der viele Überraschungen bereit-<br />
hält wie zum Beispiel das für <strong>Beethoven</strong>s Zeit geradezu avant-<br />
gardistische Duett von Pauke und Klavier gegen Ende.<br />
Sinfonie Nr. 8<br />
Als <strong>Beethoven</strong> im Mai 1812 seine siebente Sinfonie abgeschlos-<br />
sen hatte, notierte er gleich wieder Skizzen zu einem größeren<br />
Instrumentalwerk, das er zunächst als Klavierkonzert konzipier-<br />
te. Schließlich entschloss sich der Komponist jedoch zu einer<br />
neuen Sinfonie, seiner Achten, in die er die wichtigsten Gedan-<br />
ken des Konzertplanes einfließen ließ. Nach einem Kuraufent-<br />
halt in Böhmen traf <strong>Beethoven</strong> am 5. Oktober 1812 bei seinem<br />
Bruder in Linz ein, wo er das Werk vollendete. Zur Uraufführung<br />
kam es erst am 27. Februar 1814. <strong>Das</strong> Stück war im Programm<br />
dieses Abends zwischen der Siebten Sinfonie und dem Schlach-<br />
tengemälde „Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria“<br />
eingeklemmt, weshalb seine Wirkung völlig am Publikum<br />
vorbeiging. „<strong>Das</strong> Werk machte kein Furore“, schrieb man nach<br />
der Aufführung sehr zum Ärger <strong>Beethoven</strong>s, der seine Achte viel<br />
besser fand als die umjubelte Siebte.<br />
Die Achte beginnt als einzige der <strong>Beethoven</strong>-Sinfonien ohne<br />
Einleitung mit einem klar gegliederten, im Frage-Antwort-<br />
11
12<br />
Prinzip gestalteten Thema. Zwar verfügen auch die Sinfonien 3,<br />
5, 6 und 9 nicht über eine klassische langsame Einleitung, doch<br />
stellt <strong>Beethoven</strong> in diesen Werken einen wie auch immer gearte-<br />
ten „Vorspann“ (ein Motto, ein Anfangsunisono oder Akkord-<br />
schläge) voran. <strong>Das</strong> Kopfmotiv der Achten erscheint in der Expo-<br />
sition nur einziges Mal, doch bestreitet der Komponist mit ihm<br />
die gesamte Durchführung, die sich in einem gewaltigen Cres-<br />
cendo zu einem dreifachen Forte steigert. Durchführungsprinzi-<br />
pien, das Abspalten scheinbar unbedeutender Motivfetzen und<br />
ihre Umwandlung zu Neuem bestimmen den ganzen Satz.<br />
Um die tickende Melodie, mit der der zweite Satz beginnt,<br />
rankt sich eine berühmte Geschichte: <strong>Beethoven</strong> soll vor<br />
seiner Abreise nach Linz mit Johann Nepomuk Mälzel, dem<br />
Erfinder des Metronoms, zusammengetroffen sein und aus<br />
einer Laune heraus einen Kanon improvisiert haben, der das<br />
Geräusch des neuartigen Apparats darstellt. Der Kanon mit<br />
Die ersten sechs Takte des 2. Satzes der 8. Sinfonie
dem Text auf den Erfinder ist tatsächlich erhalten, und glaubt<br />
man der Legende, könnte man den zweiten Satz der achten<br />
Sinfonie als Persiflage auf das Gerät auffassen, und zwar vor<br />
allem an den Stellen, wo die Bläser den gleichmäßig-geistlosen<br />
Takt des Apparates „stören“.<br />
Von Humor geprägt sind auch die beiden letzten Sätze: Im<br />
„Tempo di Menuetto“ inszeniert <strong>Beethoven</strong> am Schluss einen<br />
Patzer der Musiker, und in das fröhliche Thema des Finales bricht<br />
nach einem raffinierten Decrescendo ein monströses Tutti-Cis im<br />
Fortissimo auf die Zuhörer los („als ob jemand mitten im<br />
Gespräch die Zunge herausstreckte“, umschrieb Louis Spohr die<br />
Stelle). Die Form des Finales ist bis dahin eine der gewagtesten<br />
Konstruktionen, die <strong>Beethoven</strong> geschaffen hat. Der Komponist<br />
lässt die Sonatenform gleich zweimal hintereinander ablaufen:<br />
Nach der Exposition gibt es zwei Durchführungen und zwei<br />
Reprisen, die Formteile lassen sich aber auch als Abschnitte<br />
eines monströsen, sich immer weiter emporschraubenden<br />
Rondos ansehen, das schließlich in eine gewaltige Coda<br />
mündet.<br />
Oliver Buslau<br />
13
14<br />
Elina Vähälä<br />
Elina Vähälä Violine<br />
Im Alter von drei Jahren<br />
begann Elina Vähälä am<br />
Lahti Conservatory Violine zu<br />
spielen. Ihr Konzertdebüt<br />
gab Sie im Alter von 12<br />
Jahren mit der Sinfonia<br />
Lahti. Nach ihrem Studium<br />
an der Kuhmo Violin School und der Sibelius Academy erhielt sie<br />
1999 ihr Diplom.<br />
Als Gewinnerin der Young Concert Artists International Audi-<br />
tions New York und Preisträgerin des Lipinsky-Wieniawski-<br />
Wettbewerbs Lublin, sowie des Joseph-Joachim-Wettbewerbs<br />
Hannover, wurde sie zu Konzerten und Recitals auf allen fünf<br />
Kontinenten eingeladen. Sie arbeitete mehrmals mit dem<br />
legendären English Chamber Orchestra zusammen und wurde<br />
2009 zur Professorin für Violine an der Hochschule für Musik in<br />
Detmold ernannt. Elina Vähälä spielt eine Stradivari Violine aus<br />
dem Jahr 1678, die ihr von der Finnischen Kulturstiftung zur<br />
Verfügung gestellt wird.<br />
Trey Lee<br />
Trey Lee Violoncello<br />
Der gebürtige Hongkonger<br />
Trey Lee erhält als einer der<br />
überzeugendsten jungen<br />
Künstler unserer Zeit Auf-<br />
merksamkeit für seine fein-<br />
sinnig emotionalen Inter-<br />
pretationen. Seit seinem
Gewinn bei der International Antonio Janigro Cello Competiti-<br />
on (2004) ist er ein weltweit gefragter Solist. Treys letztes<br />
Album erreichte mit Schumann, Mendelssohn und Chopin die<br />
Klassiklisten und wurde mit enthusiastischer Kritik von Publi-<br />
kum und Fachleuten überhäuft; zum Beispiel von GRAMOPHO-<br />
NE mit Worten wie: „Trey ist ein Wunder, ... seine Musikalität<br />
und sein Temperament enthält eine melancholische Freiheit,<br />
die uns in die Vergangenheit entführt.“<br />
Aufsehen erregte Trey Lee u. a. bei Auftritten im Moskauer<br />
Kreml, in der Amsterdam Royal Concertgebouw Hall, Forbidden<br />
City Concert Hall Beijing und im New York Lincoln Center. Hier<br />
spielte er u. a. mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra,<br />
dem China National Philharmonic Orchestra, dem Beijing<br />
Symphony Orchestra, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra,<br />
dem Hong Kong Chinese Orchestra und dem Macau Orchestra<br />
in Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Osmo Vänskä, Jun<br />
Markl, und Roman Brogli-Sacher.<br />
Hinrich Alpers Klavier<br />
Durch sein fesselndes Klavier-<br />
spiel hat Hinrich Alpers, mehr-<br />
facher Preisträger verschiede-<br />
ner Wettbewerbe, in den<br />
letzten Jahren eine inter-<br />
nationale Karriere eingeschla-<br />
gen, die ihn regelmäßig in<br />
Musikzentren wie New York,<br />
Toronto, Berlin, Oslo und<br />
Hinrich Alpers<br />
15
16<br />
Paris führt und Engagements mit namhaften <strong>Orchester</strong>n,<br />
Kammermusikpartnern und Musikfestivals hervorbringt. Bereits<br />
seit früher Kindheit wurde er an der Musikhochschule Hannover<br />
betreut. Ein Auslandsjahr an der Juilliard School öffnete die<br />
Türen zum amerikanischen Kontinent, wo er wichtige Erfolge<br />
feiern konnte. 2004 war er 1. Preisträger und Grieg-Preisträger<br />
des „Concours Grieg“ 2004 in Oslo. Darüber hinaus wurden ihm<br />
verschiedene Förderpreise verliehen. 2008 gab Hinrich Alpers<br />
als Gewinner des Juilliard Petscheck Piano Debut Recital Award<br />
ein viel beachtetes Debüt in der New Yorker Carnegie Hall.<br />
Hinrich Alpers lebt in Berlin, verbringt so viel Zeit wie möglich<br />
als Photograph in der Natur und begeistert sich für Kochkunst<br />
und Naturwissenschaften.<br />
Rémi Geniet<br />
Rémi Geniet<br />
Der 1992 in Montpellier gebo-<br />
rene Rémi Geniet studiert<br />
zurzeit bei Brigitte Engerer am<br />
„Conservatoire National Supé-<br />
rieur de Musique“ in Paris und<br />
bei Rena Shereshevskaya am<br />
„Ecole Normale de Musique de<br />
Paris“. Er ist unter anderem<br />
Preisträger des „Prix du Piano Interlaken Classics“ Bern (2011),<br />
des „Rencontre Internationale de Piano de Paris“ (2010), und<br />
der „Vladimir Horowitz International Competition“ in Kiew<br />
(2010). Rémi Geniet gab bereits mehrere Konzerte in Frankreich,<br />
der Schweiz, der Ukraine und in Polen.
Chi Ho Han<br />
Chi Ho Han, der 1992 in<br />
Seoul geboren wurde, erhielt<br />
ab seinem elften Lebensjahr<br />
Klavierunterricht. Seine Aus-<br />
bildung begann er in den<br />
Jahren 2004 bis 2008 bei<br />
Prof. Kyung Seun Pee. Seit<br />
2008 studiert er an der Folk-<br />
wang Hochschule Essen bei Prof. Arnulf von Arnim. 2009<br />
gewann er mit 17 Jahren als jüngster Teilnehmer den <strong>3.</strong> Preis<br />
beim 1<strong>3.</strong> <strong>Beethoven</strong> Klavierwettbewerb in Wien. Chi Ho Han war<br />
bereits bei zahlreichen Musikfestivals und Konzertauftritten in<br />
Europa zu Gast.<br />
Jingge Yan<br />
Der in Peking lebende Jing-<br />
ge Yan erhielt bereits mit<br />
vier Jahren Klavierunter-<br />
richt. Von 2007 bis 2011<br />
studierte er am Oberlin<br />
Conservatory in Ohio (USA)<br />
bei Prof. Peter Takacs und<br />
setzt seine Ausbildung<br />
derzeit am Mozarteum in Salzburg bei Prof. Pavel Gililov fort.<br />
Jingge Yan gewann bereits mehrere Wettbewerbe in seiner<br />
Heimat China, so beispielsweise die „Hope Cup International<br />
Piano Competition“ und die „Gulangyu International Piano<br />
Competition“.<br />
Chi Ho Han<br />
Jingge Yan<br />
17
18<br />
Stefan Blunier<br />
Stefan Blunier Generalmusikdirektor<br />
Der 1964 in Bern geborene Dirigent Stefan Blunier studierte in<br />
seiner Heimatstadt und an der Folkwang Hochschule Essen<br />
Klavier, Horn, Komposition und Dirigieren. Nach Stationen in<br />
Mainz, Augsburg und Mannheim, war er bis 2008 Generalmusik-<br />
direktor am Staatstheater Darmstadt. 2008 übernahm Stefan<br />
Blunier die Position des Generalmusikdirektors der <strong>Beethoven</strong>s-<br />
tadt <strong>Bonn</strong>. Er gastierte u. a. bei nahezu allen deutschen Rund-<br />
funkorchestern, dem Gewandhausorchester Leipzig, sowie vielen<br />
<strong>Orchester</strong>n in Dänemark, Belgien, Korea, der Schweiz und Frank-<br />
reich. Gastdirigate übernahm er an den Opernhäusern in<br />
München, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Berlin sowie in Mont-<br />
pellier, Oslo und Bern. 2010 feierte er sein erfolgreiches Debüt<br />
an der English National Opera in London.<br />
Seine Konzertprogrammgestaltungen haben das Publikum in<br />
den vergangenen Spielzeiten begeistert. Unter seiner charis-<br />
matischen Führung zog ein neues musikalisches Bewusstsein<br />
im <strong>Orchester</strong> und Publikum ein. Der Erfolg des Dirigenten mit<br />
Foto: Barbara Aumüller
dem <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> hat überregionales Interesse<br />
an der Musik aus <strong>Bonn</strong> geweckt. Stefan Blunier produziert CDs<br />
für SONY, CPO und MDG. Seine CD-Einspielungen mit dem<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> (Arnold Schönberg, Franz Schmidt,<br />
Eugen d’Albert, Anton Bruckner, Franz Liszt, Ottorino Respighi,<br />
Franz Schreker) offenbaren musikalische Raritäten und werden<br />
von der Fachpresse in höchsten Tönen gelobt. Für die Einspie-<br />
lung der Oper „Der Golem“ hat das <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
unter der Leitung von Stefan Blunier 2011 den ECHO Klassik-<br />
Preis erhalten.<br />
Mit Beginn der Saison 2010/2011 wurde Stefan Blunier zum „Pre-<br />
mier Chef Invité” des Orchestre National de Belgique in Brüssel<br />
ernannt.<br />
19
20<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
<strong>Das</strong>s Tradition und Moderne nicht im Widerspruch stehen, zeigt<br />
das aktuelle Saisonprogramm des <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong>.<br />
In Konzerten in <strong>Bonn</strong>, sowie im In- und Ausland transportiert<br />
der Klangkörper den Ruf der Stadt <strong>Bonn</strong> im Geiste <strong>Beethoven</strong>s<br />
in die Welt. Die Präsentation ausgefallener Programme ist ein<br />
Hauptgedanke in der künstlerischen Arbeit. Exemplarisch dafür<br />
steht die Aufnahme der „Leonore 1806“ – einer Frühfassung von<br />
<strong>Beethoven</strong>s Oper „Fidelio“. Die SACD-Produktion des Oratori-<br />
ums „Christus“ von Franz Liszt erhielt 2007 einen ECHO Klassik-<br />
Preis, und in 2011 gewann das <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> für<br />
die CD-Einspielung der Oper „Der Golem” von Eugen d´Albert<br />
ebenfalls einen ECHO Klassik-Preis.<br />
Was Richard Strauss als einer der ersten Gastdirigenten des<br />
<strong>Orchester</strong>s begann, setzten später Dirigenten wie Max Reger,<br />
Sergiu Celibidache und Dennis Russell Davies fort: Sie führten<br />
Foto: www.wichertzelck.com
das <strong>Orchester</strong> zur Spitzenklasse der deutschen <strong>Orchester</strong>,<br />
welches von der Fachpresse als herausragend bewertet wird.<br />
Seit der Saison 2008/2009 ist Stefan Blunier Generalmusikdi-<br />
rektor. Mit großer Leidenschaft berührt er das Publikum und<br />
begleitet es auf der großen musikalischen Reise. Neben der<br />
Opern- und Konzerttätigkeit (ca. 40 Konzerte und 120 Opern-<br />
aufführungen pro Saison) bildet die Kinder- und Jugendarbeit<br />
unter dem Titel „Bobbys Klassik“ einen wichtigen Schwerpunkt.<br />
Thomas Honickel, Konzertpädagoge des <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong><br />
<strong>Bonn</strong>, steht dabei als Garant für musikalische Bildung, Enter-<br />
tainment und Kreativität. 2009 und 2011 wurde das erfolgrei-<br />
che Education-Programm jeweils mit einem der begehrten ECHO<br />
Klassik-Preise ausgezeichnet.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong> wird weit über die Grenzen<br />
<strong>Bonn</strong>s als einer der bedeutendsten deutschen Klangkörper wahr-<br />
genommen.<br />
21
22<br />
VORSCHAU<br />
<strong>3.</strong> SONNTAGSKONZERT<br />
<strong>Das</strong> atmende Klarsein<br />
So 22. Januar 2012, 18 Uhr<br />
<strong>Beethoven</strong>halle <strong>Bonn</strong><br />
Richard Strauss<br />
Der Bürger als Edelmann.<br />
Suite op. 60 (IIIa) TrV 228c (1915-1920)<br />
Burleske für Klavier und <strong>Orchester</strong><br />
d-Moll TrV 145 (1885)<br />
Johannes Brahms<br />
Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (1877)<br />
Gerhard Oppitz Klavier<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Christof Prick Dirigent<br />
Gerhard Oppitz<br />
Karten: € 31 - 14
Wir spielen für Dich!<br />
Musik unter den Baum!<br />
Die schönsten Geschenke zum Fest der Feste sind die, die lange<br />
nachklingen. Mit einer unserer CDs oder mit Geschenk-Karten für<br />
ein sinfonisches Konzert ist anhaltende Freude garantiert. Fragen<br />
Sie uns, wir beraten Sie gerne! Tel. 0228 - 77 8008
26<br />
THEATER- UND KONZERTKASSE<br />
Tel. 0228 - 77 8008<br />
Windeckstraße 1, 53111 <strong>Bonn</strong><br />
Fax: 0228 - 77 5775, theaterkasse@bonn.de<br />
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr, Sa von 9.00 - 16.00 Uhr<br />
Tel. Vorbestellung: Mo - Fr 10.00 - 15.30 Uhr, Sa 9.30 - 12.00 Uhr<br />
Kasse in den Kammerspielen<br />
Am Michaelshof 9, 53177 Bad Godesberg<br />
Tel. 0228 - 77 8022<br />
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 1<strong>3.</strong>00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr,<br />
Sa 9.00 - 12.00 Uhr<br />
print@home: Karten buchen & drucken von zu Hause aus<br />
BONNTICKET: 0228 - 50 20 10, www.bonnticket.de<br />
Fax: 0228 - 910 41 914, order@derticketservice.de<br />
IMPRESSUM<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Generalmusikdirektor<br />
Stefan Blunier<br />
Wachsbleiche 1<br />
53111 <strong>Bonn</strong><br />
Tel. 0228 - 77 6611<br />
Fax 0228 - 77 6625<br />
info@beethoven-orchester.de<br />
www.beethoven-orchester.de<br />
Redaktion<br />
Markus Reifenberg<br />
Brigitte Rudolph<br />
Texte<br />
Oliver Buslau<br />
Gestaltung<br />
res extensa, Norbert Thomauske<br />
Druck<br />
Druckerei Carthaus, <strong>Bonn</strong><br />
Bildnachweise:<br />
Für die Überlassung der Fotos<br />
danken wir den Künstlern und<br />
Agenturen.<br />
HINWEISE<br />
Wir möchten Sie bitten, während des<br />
gesamten Konzertes Ihre Mobiltelefone<br />
ausgeschaltet zu lassen.<br />
Wir bitten Sie um Verständnis, dass<br />
wir Konzertbesucher, die zu spät<br />
kommen, nicht sofort einlassen<br />
können. Wir bemühen uns darum,<br />
den Zugang zum Konzert so bald<br />
wie möglich – spätestens zur Pause<br />
– zu gewähren. In diesem Fall<br />
besteht jedoch kein Anspruch auf<br />
eine Rückerstattung des Eintrittspreises.<br />
Wir machen darauf aufmerksam,<br />
dass Ton- und/oder Bildaufnahmen<br />
unserer Aufführungen durch jede<br />
Art elektronischer Geräte strikt<br />
untersagt sind. Zuwiderhandlungen<br />
sind nach dem Urheberrechtsgesetz<br />
strafbar.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
behält sich notwendige Programm-<br />
und Besetzungsänderungen vor.
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong><br />
Wachsbleiche 1<br />
53111 <strong>Bonn</strong><br />
Tel: +49 (0) 228-77 6611<br />
Fax: +49 (0) 228-77 6625<br />
info@beethoven-orchester.de<br />
www.beethoven-orchester.de<br />
Kulturpartner des<br />
<strong>Beethoven</strong> <strong>Orchester</strong> <strong>Bonn</strong>