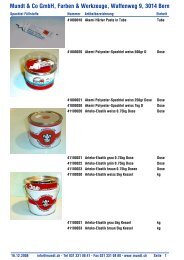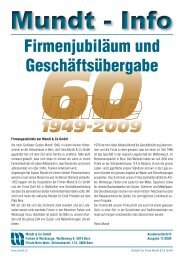Shell Lkw-Studie bis 2030
Shell Lkw-Studie bis 2030
Shell Lkw-Studie bis 2030
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
IV ANTRIEBE, KRAFTSTOFFE, TECHNIK<br />
4.5 hyBRid- uNd elektROANtRieB<br />
In der jüngeren Vergangenheit ist es zu einer immer stärkeren<br />
Elektrifizierung und Hybridisierung des Antriebsstrangs<br />
gekommen. Von Hybridtechnologie und Elektromobilität<br />
werden große technologische Impulse für die Fahrzeugentwicklung<br />
erwartet.<br />
Hybridtechnologie zeichnet sich durch zwei Motoren, einen<br />
Elektromotor und einen Verbrennungsmotor sowie zwei<br />
Energiespeicher (einen Kraftstofftank und einen Akkumulator)<br />
aus. Mit diesen Komponenten sind verschiedenste Fahrzeugkonfigurationen<br />
möglich, denn beim Hybrid müssen mehrere<br />
Varianten unterschieden werden (siehe Abbildung 26).<br />
So können die Fahrzeuge zum einen nach der Art der<br />
Kombination von Elektromotor und Verbrennungsmotor in<br />
serielle, parallele und Mischhybride und zum anderen nach<br />
der Leistungsfähigkeit des Elektromotors in Micro-, Mild-,<br />
Full- und Plug-in-Hybride eingeteilt werden. Allen Kombinationen<br />
ist jedoch gemeinsam, dass sie mit dem Ziel konstruiert<br />
sind, Kraftstoff einzusparen und eingesetzte Energie effizient<br />
zu verwenden.<br />
Mit dem gleichen Ziel wird die Entwicklung von reinen<br />
Elektrofahrzeugen vorangetrieben. Diese Fahrzeuge werden<br />
ausschließlich mit einem Elektromotor angetrieben und<br />
26<br />
hyBRidteChNik<br />
Verbrennungsmotor und Elektromotor wirken gemeinsam<br />
auf die Antriebswelle. Bei Leistungsspitzen werden Verbrennungsmotor<br />
und Elektromotor gemeinsam mit hoher Leistung<br />
betrieben. So ist es möglich, Verbrennungs- und Elektromotor<br />
jeweils kleiner und sparsamer auszulegen. Diese Technologie<br />
erfordert eine komplizierte Leistungselektronik sowie ein<br />
Getriebe und kommt bei heutigen Hybrid-<strong>Lkw</strong> bevorzugt zur<br />
Anwendung.<br />
verfügen über einen Akkumulator als Energiespeicher. Da<br />
Hybrid- und Elektrofahrzeuge Technologien wie Elektromotor<br />
und Akkumulator teilen, können sie auch von ähnlichen<br />
Vorteilen profitieren, haben andererseits aber auch Nachteile,<br />
die minimiert werden müssen. Neben dem Vorteil der<br />
geringeren Schadstoffemissionen vor allem bei einer rein<br />
elektrischen Betriebsweise – diese erlaubt je nach der Form<br />
der Hybridisierung nur eine begrenzte Entfernung zurückzulegen<br />
– sind als Nachteile insbesondere die Kosten und Alltagstauglichkeit<br />
heutiger Batteriesysteme zu nennen.<br />
Als alternative Antriebsform stehen Hybrid- und Elektroantrieb<br />
im Nutzfahrzeugbereich erst am Anfang ihrer Entwicklung.<br />
Diese Tatsache bestätigt sich auch in den Zulassungszahlen<br />
von 79 Hybrid- und 874 Elektro-Nutzfahrzeugen in allen<br />
Fahrzeugklassen zum 1. Januar 2009. 73) Im Gegensatz zum<br />
Pkw-Bereich werden im Nutzfahrzeugbereich noch keine<br />
Hybridfahrzeuge serienmäßig angeboten. Das Angebot<br />
beschränkt sich noch auf einige Vorserienfahrzeuge und<br />
Prototypen.<br />
Für verschiedene Hybridkonzepte und Fahrzeugklassen<br />
ergeben sich unterschiedliche Kraftstoffeinsparungspotenziale;<br />
diese sind in Tabelle 27 auf der nächsten Doppelseite brutto,<br />
73) Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Emissionen, Kraftstoffe,<br />
a.a.O., S. 28.<br />
FuNktiONSPRiNZiP deS PARAllel-hyBRidS FuNktiONSPRiNZiP deS ReiheN-hyBRidS MiSChFORMeN<br />
Tank<br />
Batterie<br />
Elektrische<br />
Leistungsübertragung<br />
Verbrennungsmotor<br />
Elektronisches<br />
Steuergerät<br />
Elektromotor/<br />
Generator<br />
Getriebe<br />
Mechanische<br />
Leistungsübertragung<br />
Räder<br />
Achse/<br />
Differential<br />
Räder<br />
Tank<br />
Verbrennungsmotor<br />
Generator<br />
Elektronisches<br />
Steuergerät<br />
Elektrische<br />
Leistungsübertragung<br />
Batterie<br />
Elektromotor/<br />
Generator<br />
Mechanische<br />
Leistungsübertragung<br />
Räder<br />
Achse/<br />
Differential<br />
Räder<br />
Der Verbrennungsmotor treibt ausschließlich einen Generator<br />
an, dessen elektrische Energie direkt dem Elektromotor oder<br />
dem Akkumulator zugeführt wird. Der Verbrennungsmotor<br />
ist vergleichsweise schwach ausgelegt, da Leistungsspitzen<br />
durch Energie aus dem Akku abgefedert werden. Der Elektromotor<br />
muss dagegen so stark sein, dass er alle Leistungsanforderungen<br />
des Fahrzeuges bedienen kann. Beim<br />
seriellen Hybrid, wie er in Stadtbussen zum Einsatz kommt,<br />
ist kein Getriebe notwendig.<br />
das heißt ohne Gegenrechnung von Fahrstrom, dargestellt.<br />
Danach ergeben sich für den Einsatz im städtischen Liefer- und<br />
Verteilerverkehr durchschnittliche Einsparpotenziale im<br />
Vergleich zum konventionellen Diesel von etwa 5 % für die<br />
Start-Stopp-Automatik, von 20 <strong>bis</strong> 30 % für Voll-Hybridfahrzeuge,<br />
<strong>bis</strong> hin zu 40 % für Plug-in-Hybridfahrzeuge. Prinzipiell<br />
lässt sich ableiten, dass sich die Kraftstoffeinsparungen<br />
erhöhen, wenn leistungsfähigere Akkus und Elektromotoren auf<br />
längeren Fahrabschnitten genutzt werden, ohne dass der<br />
Dieselmotor zugeschaltet werden muss, und wenn das<br />
Fahrmuster der Fahrzeuge häufige Starts und Stopps aufweist.<br />
Die Bemühungen zum Einsparen von Kraftstoff führen auch zu<br />
einem geringeren CO 2-Ausstoß von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.<br />
Bei Hybridfahrzeugen entspricht die CO 2-Ersparnis<br />
der Kraftstoffersparnis und bewegt sich demnach im Rahmen<br />
von 5 <strong>bis</strong> 20 %.<br />
Bei Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden hängt die<br />
Treibhausgasbilanz von den Emissionen, die durch die<br />
Bereitstellung des Stromes entstehen, ab.<br />
Eine Beispielrechnung anhand eines leichten Nutzfahrzeuges<br />
verdeutlicht diesen Zusammenhang: Ein elektrisch betriebenes<br />
leichtes Nutzfahrzeug hat bei heutiger Technologie einen<br />
Stromverbrauch von etwa 0,3 kWh/km. Verrechnet man dies<br />
mit dem spezifischen CO 2-Ausstoß im deutschen Strommix<br />
von etwa 596 gCO 2 / kWh (Wert für 2006), dann erhält<br />
man CO 2-Emissionen von etwa 180 gCO 2 / km.<br />
Es gibt noch weitere Hybridformen, welche die Eigenschaften von parallelen und seriellen Hybriden durch den Einsatz<br />
komplexer Leistungselektronik und weiterer Getriebe variabel miteinander kombinieren:<br />
Micro-hybrid – Start-Stopp-Automatik<br />
Micro-Hybride sind mit einem sehr kleinen Elektromotor/-generator und einem Akku geringer Kapazität ausgestattet. Bei Stillstand wird<br />
der Verbrennungsmotor abgestellt und bei Weiterfahrt mit Hilfe des Elektromotors gestartet. Geringe Mengen der Bremsenergie können<br />
im Akku gespeichert und auch zum Betrieb von Nebenaggregaten verwendet werden. Die Verbrauchseinsparungen sind gering. Das<br />
Fahrzeug kann nur bei laufendem Verbrennungsmotor fahren.<br />
Mild-hybrid<br />
Mild-Hybrid-Fahrzeuge besitzen leistungsfähigere Elektromotoren und Akkus, die es ermöglichen, die Traktion zu unterstützen. Dabei<br />
unterstützt der Elektromotor den Verbrennungsmotor speziell beim Anfahren und Beschleunigen. Ein größerer Teil der Bremsenergie wird<br />
rekuperiert und für den weiteren Antrieb nutzbar gemacht. Der Antriebsstrang ist als Parallel-Hybrid ausgelegt.<br />
Voll-hybrid<br />
Ein Voll-Hybrid verfügt über leistungsfähige Elektromotoren und Akkus, die es ermöglichen, zeitweise bzw. über längere Strecken rein<br />
elektrisch zu fahren. Starke Elektromotoren und Akkus ermöglichen die Auslegung des Antriebsstranges als parallelen, seriellen oder<br />
Misch-Hybrid. Bremsenergie wird rekuperiert.<br />
Plug-in-hybrid<br />
Eine Sonderform der Hybrid-Fahrzeuge stellt der Plug-in-Hybrid dar. Dem Aufbau nach handelt es sich um einen Voll-Hybriden,<br />
der zur Ladung der Akkumulatoren nicht allein auf den fahrzeugeigenen Verbrennungsmotor, sondern auch auf extern erzeugten Strom<br />
(„aus der Steckdose“) zurückgreift.<br />
Quelle: Ricardo 2009, a.a.O., S.137ff.<br />
Verglichen mit dem durchschnittlichen CO 2-Ausstoß leichter<br />
Nutzfahrzeuge im Jahre 2005 auf Grundlage von Verbrauchsauswertungen<br />
– real ca. 230 gCO 2/km – bedeutete dies<br />
einen Rückgang der Treibhausgasemissionen von etwa 23 %.<br />
Ein Faktor, der die Life-Cycle-CO 2-Emissionen von Hybrid- und<br />
Elektrofahrzeugen zusätzlich belastet, ist der hohe Energieaufwand<br />
zur Herstellung der Batterien. Legt man diesen Energieaufwand<br />
für die Batterieherstellung auf die Fahrzeugkilometer<br />
eines elektrisch betriebenen leichten Nutzfahrzeuges um, so<br />
schlägt dieser Posten in Abhängigkeit von Fahrleistung und<br />
Lebensdauer der Batterien deutlich zu Buche.<br />
Als Richtwert gilt für heutige Bedingungen, dass reine Elektrofahrzeuge<br />
ein CO 2-Minderungspotenzial von etwa 15 <strong>bis</strong><br />
30 % haben. 74) Erst die Verfügbarkeit von großen Mengen<br />
CO 2-frei erzeugten Stromes wird dazu führen, dass Elektro-<br />
und Plug-in-Hybridfahrzeuge größere CO 2-Einsparungen<br />
erreichen können.<br />
Der Vorteil für die Nutzer dieser Fahrzeuge besteht somit erst<br />
einmal darin, die CO 2-Emissionen langfristig zu reduzieren<br />
und innerhalb eines zum Beispiel von einer Stadt festgelegten<br />
Gebietes vollkommen ohne Schadstoffemission fahren zu<br />
können.<br />
74) Vgl. Rolf Fischknecht, Marianne Lauenberger, Elektroauto – Königsweg oder<br />
Sackgasse? Arbeitskreis Umwelt MitarbeiterInnen Daimler AG, Präsentation,<br />
Sindelfingen 29.6.2009, S. 48.<br />
44/45