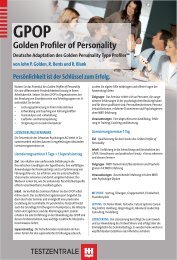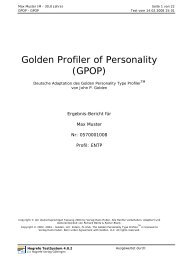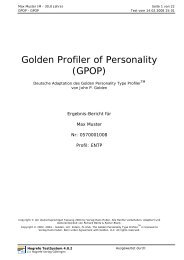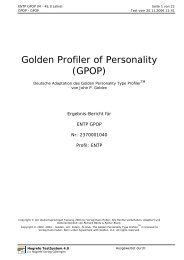Testinformationen - Testzentrale
Testinformationen - Testzentrale
Testinformationen - Testzentrale
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
208 <strong>Testinformationen</strong><br />
tische Anwendung“ gegliedert. Die standardisierte Durchführung<br />
und Auswertung ist bei alleiniger Kenntnis des<br />
letzten Kapitels (10 Seiten) möglich.<br />
4. Grundkonzept<br />
Die SELLMO sollen „die reliable und valide Erfassung von<br />
Zielen in Lern- und Leistungskontexten bei Schülerinnen<br />
und Schülern sowie Studierenden“ ermöglichen (TM,<br />
S. 7). Theoretische Grundlage sind neuere Theorien der<br />
Leistungsmotivation z. B. nach Ames (1992) oder Elliot<br />
(1999). Auf dieser Basis werden zunächst zwei Kategorien<br />
von Zielen bei der Lern- und Leistungsmotivation unterschieden:<br />
„Erstens das Ziel, eigene Fähigkeiten zu erweitern<br />
[Lernziele] und zweitens das Ziel, anderen gegenüber<br />
hohe Fähigkeit zu demonstrieren [Annäherungs-Leistungsziele]<br />
bzw. niedrige Fähigkeit zu verbergen [Vermeidungs-Leistungsziele]“<br />
(TM, S. 7). Ergänzt werden diese<br />
Ziele durch die allgemeine Tendenz, Arbeit zu vermeiden,<br />
wobei hier kein allgemeines affektives Ziel der Anstrengungsvermeidung<br />
(wie bei Rollett, 1970) angenommen<br />
wird. Im Gegensatz zu den anderen drei Zielen beruht „Arbeitsvermeidung“<br />
nicht auf einem Vergleich mit anderen<br />
oder einem Gütemaßstab. Die Autoren verweisen auf die<br />
Nähe der älteren theoretischen Konstrukte „intrinsische<br />
Motivation“ und „individuelle Bezugsnormen“ zu den<br />
Lernzielen sowie „extrinsische Motivation“ und „soziale<br />
Bezugsnormen“ zu den Leistungszielen, betonen aber die<br />
größere Klarheit und empirische Eindeutigkeit der hier gewählten<br />
Begriffe.<br />
Aus persönlichkeitspsychologischer Sicht können<br />
Lern- und Leistungsziele sowohl als situativ variierende<br />
Zustände (states) als auch als relativ stabile Eigenschaften<br />
(traits) auftreten. Sie können zudem eher unabhängig<br />
voneinander, aber auch in verschiedenen Kombinationen<br />
in einer Person vorhanden sein. Lediglich die „Tendenz<br />
zur Arbeitsvermeidung ist mit einer ausgeprägten Lernzielorientierung<br />
unvereinbar“ (TM, S. 10).<br />
Bedeutsam für spätere Konsequenzen aus den Testergebnissen<br />
ist die Analyse des Zusammenhanges von<br />
Lern- und Leistungszielen mit tatsächlich vollbrachten<br />
Leistungen. Hier zeigt die empirische Forschung, dass die<br />
Annahme von Lernzielen sowohl bei schlechten als auch<br />
bei guten Leistungen mit vorteilhaften Attributionen und<br />
damit mit einer günstigeren Prognose zukünftiger Leistungen<br />
einhergeht. Dies betrifft adaptive Kognitionen ebenso<br />
wie Emotionen und förderliche Verhaltensweisen. Als förderlich<br />
für gute Leistungen erwiesen sich zudem Annäherungs-Leistungsziele,<br />
also das Streben, eigene Fähigkeiten<br />
zu demonstrieren. Hingegen führen Vermeidungs-<br />
Leistungsziele zu schlechten Leistungen und dies um so<br />
mehr, wenn gleichzeitig ein negatives Fähigkeitskonzept<br />
vorliegt. Die Autorinnen und Autoren empfehlen bei einer<br />
solchen Motivationslage, die Person systematisch auf<br />
Lernziele hin zu orientieren, um „dem Teufelskreis aus geringer<br />
Fähigkeitseinschätzung und geringer Lernmotivation<br />
zu entkommen“ (TM, S. 11). Dauerhaft weniger erfolgreich<br />
wäre an dieser Stelle die Veränderung des Fähigkeitskonzeptes.<br />
Generell ungünstig für gute Leistungen<br />
ist eine hohe Tendenz zur Arbeitsvermeidung.<br />
5. Durchführung<br />
Alter: Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse und Studierende<br />
jeden Alters<br />
Ausschluss: unregelmäßiger Schulbesuch und mangelhafte<br />
Sprach- und Lesefähigkeiten<br />
Dauer: 8 bis 15 Minuten<br />
Formen: Einzel- und Gruppen-Test (mit jeweils speziell angepasster<br />
Instruktion im TM) möglich, keine Parallelformen,<br />
Paper-Pencil-Version.<br />
6. Auswertung und Interpretation<br />
Fragebogen mit mehr als drei fehlenden oder in Bezug auf<br />
die Benutzung der Antwortskala fehlerhaften Antworten<br />
sollten von der Auswertung ausgeschlossen werden. Die<br />
Auswertung erfolgt mittels Schablone und Auswertungsbogen.<br />
Auf der Schablone sind die vier verschiedenen<br />
Zielorientierungen jeweils mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet.<br />
Der fünf-stufigen Antwortskala von „stimmt gar<br />
nicht“ bis „stimmt genau“ sind die Ziffern 1 bis 5 zugeordnet.<br />
Für jede der vier Zielorientierungen werden zunächst<br />
die den angekreuzten Kästchen zugeordneten Zahlen auf<br />
der 3. Seite des Fragebogens aufsummiert und dann die<br />
Werte auf der 4. Seite dazugezählt. Für die Skalen Lernziele,<br />
Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung<br />
ergibt sich damit ein Rohwert zwischen 8 und 40, für die<br />
Skala Annäherungs-Leistungsziele zwischen 7 und 35. Die<br />
Rohwerte werden für jede Skala getrennt zusammen mit<br />
Name, Vorname und Klassenstufe/Semesterzahl (inkl. Studiengang<br />
und Alter bei Studierenden) auf dem Auswertungsbogen<br />
notiert. Für die SELLMO-ST ist die Auswertung<br />
damit abgeschlossen.<br />
Für die Schülerinnen und Schüler (SELLMO-S) kann<br />
zusätzlich ein so genanntes Rohwerteband (Konfidenzintervall),<br />
der Prozentrang, der T-Wert und ein T-Werteband<br />
ermittelt werden. Dies geschieht unter Rückgriff auf die<br />
Normtabellen am Ende des TM. Die Normtabellen liegen<br />
getrennt für die Klassenstufen 4 bis 6 sowie 7 bis 10 vor.<br />
Jedem Rohwert sind in den Normtabellen zeilenweise die<br />
anderen vier Werte zugeordnet. Abschließend kann ein<br />
grafisches Profil der T-Werte erstellt werden. Hierzu wird<br />
auf dem unteren Teil des Auswertungsbogens der erreichte<br />
T-Wert auf der Skala zwischen 15 und 85 angekreuzt.<br />
Dann werden die vier Kreuze durch gerade Linien verbunden.<br />
Die T-Werte zwischen 40 und 60 sind dabei hell hervorgehoben<br />
und markieren durchschnittliche Werte, während<br />
T-Werte unter 40 unterdurchschnittliche und T-Werte<br />
über 60 überdurchschnittliche Werte anzeigen. Das Profil<br />
dient vor allem als anschauliche Rückmeldung für die<br />
Probanden und Probandinnen selbst, aber auch für Eltern<br />
oder Lehrerinnen bzw. Lehrer.<br />
Je nachdem, welches Ziel der Einsatz der SELLMO-S<br />
verfolgt, kommt den verschiedenen Werten eine entsprechende<br />
Bedeutung zu. Das Rohwerteband informiert über<br />
den bei der Messung zu erwartenden Messfehler. Diese<br />
Information gestattet einen Vergleich zwischen zwei Mes-