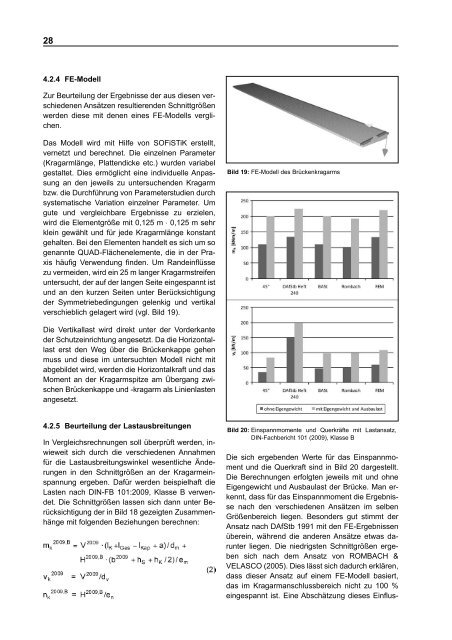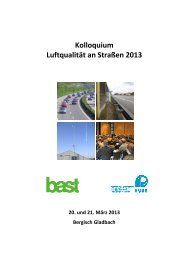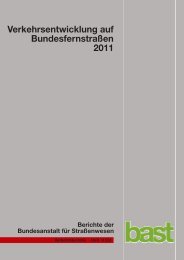Dokument 1.pdf
Dokument 1.pdf
Dokument 1.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
28<br />
4.2.4 FE-Modell<br />
Zur Beurteilung der Ergebnisse der aus diesen verschiedenen<br />
Ansätzen resultierenden Schnittgrößen<br />
werden diese mit denen eines FE-Modells verglichen.<br />
Das Modell wird mit Hilfe von SOFiSTiK erstellt,<br />
vernetzt und berechnet. Die einzelnen Parameter<br />
(Kragarmlänge, Plattendicke etc.) wurden variabel<br />
gestaltet. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung<br />
an den jeweils zu untersuchenden Kragarm<br />
bzw. die Durchführung von Parameterstudien durch<br />
systematische Variation einzelner Parameter. Um<br />
gute und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen,<br />
wird die Elementgröße mit 0,125 m ⋅ 0,125 m sehr<br />
klein gewählt und für jede Kragarmlänge konstant<br />
gehalten. Bei den Elementen handelt es sich um so<br />
genannte QUAD-Flächenelemente, die in der Praxis<br />
häufig Verwendung finden. Um Randeinflüsse<br />
zu vermeiden, wird ein 25 m langer Kragarmstreifen<br />
untersucht, der auf der langen Seite eingespannt ist<br />
und an den kurzen Seiten unter Berücksichtigung<br />
der Symmetriebedingungen gelenkig und vertikal<br />
verschieblich gelagert wird (vgl. Bild 19).<br />
Die Vertikallast wird direkt unter der Vorderkante<br />
der Schutzeinrichtung angesetzt. Da die Horizontallast<br />
erst den Weg über die Brückenkappe gehen<br />
muss und diese im untersuchten Modell nicht mit<br />
abgebildet wird, werden die Horizontalkraft und das<br />
Moment an der Kragarmspitze am Übergang zwischen<br />
Brückenkappe und -kragarm als Linienlasten<br />
angesetzt.<br />
4.2.5 Beurteilung der Lastausbreitungen<br />
In Vergleichsrechnungen soll überprüft werden, inwieweit<br />
sich durch die verschiedenen Annahmen<br />
für die Lastausbreitungswinkel wesentliche Änderungen<br />
in den Schnittgrößen an der Kragarmeinspannung<br />
ergeben. Dafür werden beispielhaft die<br />
Lasten nach DIN-FB 101:2009, Klasse B verwendet.<br />
Die Schnittgrößen lassen sich dann unter Berücksichtigung<br />
der in Bild 18 gezeigten Zusammenhänge<br />
mit folgenden Beziehungen berechnen:<br />
Bild 19: FE-Modell des Brückenkragarms<br />
Bild 20: Einspannmomente und Querkräfte mit Lastansatz,<br />
DIN-Fachbericht 101 (2009), Klasse B<br />
Die sich ergebenden Werte für das Einspannmoment<br />
und die Querkraft sind in Bild 20 dargestellt.<br />
Die Berechnungen erfolgten jeweils mit und ohne<br />
Eigengewicht und Ausbaulast der Brücke. Man erkennt,<br />
dass für das Einspannmoment die Ergebnisse<br />
nach den verschiedenen Ansätzen im selben<br />
Größenbereich liegen. Besonders gut stimmt der<br />
Ansatz nach DAfStb 1991 mit den FE-Ergebnissen<br />
überein, während die anderen Ansätze etwas darunter<br />
liegen. Die niedrigsten Schnittgrößen ergeben<br />
sich nach dem Ansatz von ROMBACH &<br />
VELASCO (2005). Dies lässt sich dadurch erklären,<br />
dass dieser Ansatz auf einem FE-Modell basiert,<br />
das im Kragarmanschlussbereich nicht zu 100 %<br />
eingespannt ist. Eine Abschätzung dieses Einflus