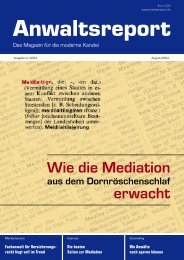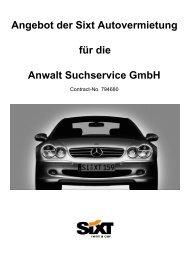Anwaltswoche - Anwalt-Suchservice
Anwaltswoche - Anwalt-Suchservice
Anwaltswoche - Anwalt-Suchservice
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kunden auf, sich die betreffende Software selbst zu kopieren<br />
oder von der Homepage der Klägerin herunterzuladen.<br />
Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass die Beklagte gegen das<br />
Urheberrecht verstoße. Sie habe in ihren Lizenzbestimmungen<br />
geregelt, dass an der überlassenen Software nur einfache, nicht<br />
weiter abtretbare Nutzungsrechte bestünden. Der Erwerber der<br />
Rechte könne diese daher nicht an Dritte weiterübertragen. Die<br />
Unterlassungsklage hatte Erfolg. Das Urteil ist allerdings noch<br />
nicht rechtskräftig.<br />
Die Gründe:<br />
Die Beklagte hat das ausschließliche Nutzungsrecht der Klägerin<br />
verletzt. Die Klägerin hat in ihren Lizenzbestimmungen geregelt,<br />
dass an der überlassenen Software nur einfache, nicht weiter<br />
abtretbare Nutzungsrechte bestehen. Wegen dieser dinglichen<br />
Einschränkungen konnte die Beklagte ihren Kunden keine zur<br />
Vervielfältigung berechtigenden Lizenzen verschaffen.<br />
Die Beklagte kann den Handel mit den „gebrauchten“ Lizenzen<br />
auch nicht auf den so genannten Erschöpfungsgrundsatz nach §§<br />
69c Nr.3, 17 Abs.2 UrhG stützen. Hiernach sind die Nutzungsgebühren<br />
für den Rechteinhaber eines urheberrechtlich geschützten<br />
Werks mit der Veräußerung der Vervielfältigungsstücke abgegolten.<br />
Vorliegend hat die Beklagte aber lediglich den Download<br />
der „gebrauchten“ Lizenzen angeboten. Sie verarbeitete demnach<br />
nicht von der Klägerin vervielfältigte Software, sondern<br />
forderte ihre Kunden zur Herstellung neuer, nicht von Klägerin<br />
autorisierter Software auf.<br />
Der Hintergrund:<br />
Das Urteil des LG wird in Fachkreisen zu Diskussionen führen.<br />
Denn der BGH hat mit Urteil vom 6.7.2000 (Az.: I ZR 244/97)<br />
entschieden, dass der Weiterverkauf von „entbundelter“ Software<br />
- Software, die laut Herstellerkennzeichnung nur zum gemeinsamen<br />
Vertrieb mit bestimmter neuer Hardware vorgesehen ist<br />
- grundsätzlich nicht zu beanstanden ist. Nach Auffassung des<br />
BGH liefert das Urheberrecht keine Handhabe zur Durchsetzung<br />
einer Vertriebseinschränkung.<br />
Zwangsvollstreckung und<br />
Insolvenz<br />
Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen<br />
sind zum 1.7.2005 wirksam erhöht worden<br />
BGH 24.1.2006, VII ZB 93/05<br />
Die Erhöhung der Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen zum<br />
1.7.2005 durch die entsprechende Bekanntmachung des Bundesjustizministeriums<br />
ist wirksam. Nach § 850c Abs.2a ZPO n.F.<br />
werden die Pfändungsfreigrenzen alle zwei Jahre entsprechend<br />
der Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags erhöht.<br />
Dabei kommt es entgegen dem Wortlaut von § 850c Abs.2a ZPO<br />
nicht auf den „jeweiligen Vorjahreszeitraum“ an, sondern auf<br />
den Zeitraum, der seit dem letzten vorgesehenen Anpassungszeitpunkt<br />
verstrichen ist.<br />
Der Sachverhalt:<br />
Der BGH hatte im Fall einer Gläubigern, die gegen ihren Schuldner<br />
einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss erwirkt hatte,<br />
darüber zu entscheiden, ob die Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen<br />
zum 1.7.2005 wirksam erhöht worden sind.<br />
Grundlage der Erhöhung war § 850c Abs.2a ZPO n.F., wonach<br />
die Pfändungsfreigrenzen jeweils zum 1.7. eines jeden zweiten<br />
Jahres, erstmalig zum 1.7.2003, entsprechend der sich im<br />
Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum ergebenden Entwicklung<br />
des Grundfreibetrags gemäß § 32a Abs.1 Nr.1 EStG<br />
angehoben werden. Die Anhebung muss vom Bundesjustizministerium<br />
bekannt gemacht werden.<br />
Der Grundfreibetrag gemäß § 32a Abs.1 Nr.1 EStG war lediglich<br />
zum 1.1.2004, nicht aber zum 1.1.2005 erhöht worden. Das Bundesjustizministerium<br />
gab im Hinblick auf die Entwicklung des<br />
Grundfreibetrags im Gesamtzeitraum vom 1.1.2003 bis zum<br />
1.1. 2005 die entsprechende Erhöhung der Pfändungsfreibeträge<br />
zum 1.7.2005 bekannt.<br />
Die Gläubigerin hielt die Erhöhung des Pfändungsfreibetrags<br />
für unwirksam, da der Grundfreibetrag im Vorjahreszeitraum,<br />
nämlich vom 1.1.2004 bis zum 1.1.2005, nicht gestiegen sei.<br />
Mit dieser Auffassung hatte sie in allen Instanzen keinen Erfolg.<br />
Die Gründe:<br />
Die Pfändungsfreigrenzen für die Pfändung von Arbeitseinkommen<br />
sind zum 1.7.2005 wirksam erhöht worden. Dem steht nicht<br />
entgegen, dass § 850c Abs.2a ZPO n.F. für die Erhöhung auf<br />
den „Vorjahreszeitraum“ abstellt und im Zeitraum vom 1.1.2004<br />
bis zum 1.1.2005 der Grundfreibetrag gemäß § 32a Abs.1 Nr.1<br />
EStG nicht gestiegen ist.<br />
Der Begriff „Vorjahreszeitraum“ ist ersichtlich nur versehentlich<br />
in den Gesetzentwurf der endgültigen Gesetzesfassung aufgenommen<br />
worden. Er geht auf den ursprünglichen Gesetzentwurf<br />
zurück, der eine jährliche Anpassung des Pfändungsfreibetrags<br />
an den jeweiligen steuerlichen Grundfreibetrag vorsah. Im Laufe<br />
des Gesetzgebungsverfahrens wurde dieser Entwurf dahingehend<br />
geändert, dass die Anpassung aus Vereinfachungsgründen<br />
nur alle zwei Jahre erfolgen soll.<br />
Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass der von<br />
der ersten Entwurfsfassung übernommene Begriff des „Vorjahreszeitraums“<br />
mit der ursprünglichen Bedeutung aufrechterhalten<br />
werden sollte. Der Gesetzgeber wollte vielmehr, dass der Zeitraum<br />
erfasst wird, der seit dem letzten vorgesehenen Anpassungszeitpunkt<br />
verstrichen ist. Dies war im Streitfall der Zeitraum vom<br />
1.1.2003 bis zum 1.1. 2005, so dass die Pfändungsfreigrenzen<br />
zu Recht entsprechend der zum 1.1.2004 wirksam gewordenen<br />
Erhöhung des Grundfreibetrags angehoben worden sind.<br />
Verwaltungs- und<br />
Verfassungsrecht<br />
Berlin muss den Zeugen Jehovas die Rechte<br />
einer Körperschaft öffentlichen Rechts<br />
verleihen<br />
BVerwG 1.2.2006, 7 B 80.05<br />
Das Land Berlin muss der Religionsgemeinschaft der Zeugen<br />
Jehovas die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts<br />
verleihen. Es bestehen keine greifbaren Anhaltspunkte dafür,<br />
07/2006 <strong><strong>Anwalt</strong>swoche</strong> 15