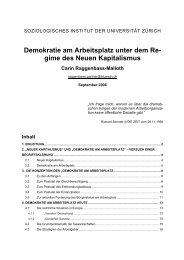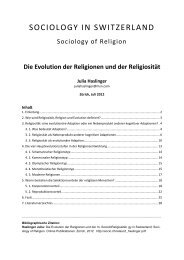GRUNDZÜGE UND ENTWICKLUNG DER SOZIALEN ARBEIT
GRUNDZÜGE UND ENTWICKLUNG DER SOZIALEN ARBEIT
GRUNDZÜGE UND ENTWICKLUNG DER SOZIALEN ARBEIT
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Joël Orizet / Christa Kappler: Grundzüge und Entwicklung der Sozialen Arbeit http.//socio.ch/arbeit/t_orikap.pdf<br />
dieser wechselseitigen Mediatisierung zu konstatieren (vgl. Jäger 2005: 515). Letzteres kann<br />
dazu führen, dass die Motivation, einen Konsens herbeizuführen, unter Umständen nicht um des<br />
Konsenses willen geschieht, sondern vielmehr wegen der Produktivität, wegen des<br />
wirtschaftlichen Erfolgs (ebd.).<br />
Die vom Autor mit Nachdruck betonte „ganzheitliche“ Identitätserwartung von<br />
Dienstleistungen ist insbesondere für das Berufsfeld der Sozialen Arbeit eine unabdingbare<br />
Motivationsgrundlage. Das Streben nach einer „Einheit des Lebenszusammenhanges“, in der<br />
Arbeit nicht als etwas Zwanghaftes und Fremdes empfunden wird, sondern als Beweisstellung<br />
von gesellschaftlicher Nützlichkeit der eigenen Person gedacht werden kann, gilt nach wie vor<br />
grundlegend für die Berufswahl (vgl. Baron / Landwehr 1990: 140f.).<br />
Unter direktem Rückgriff auf die Kolonialisierungsthese ist diesbezüglich ein Verfall von wertund<br />
normbildender Tradition, bzw. dessen Substituierung durch administrative Regeln zu<br />
vermuten (vgl. ebd.: 154f.). Autoren, die eine Affinität zum Diskurs der Postmoderne<br />
aufweisen, sprechen hingegen oftmals von „radikaler Pluralität“ (Welsch 1987: 4, in Kleve<br />
1999: 33). In Bezug auf die Soziale Arbeit wird von der ihr innewohnenden ambivalenten<br />
Struktur darauf geschlossen, dass sie seit jeher eine postmoderne Profession sei, die als „Einheit<br />
ihrer heterogenen Vielheit“ beschrieben werden kann (vgl. Kleve 1999: 31f.).<br />
9. Ausblick<br />
Die unterschiedlichen Auffassungen zur Frage nach der Professionalisierbarkeit der Sozialen<br />
Arbeit spiegeln die Unsicherheit wider, mit der das Berufsfeld in Zukunft wohl konfrontiert sein<br />
wird. Von unterschiedlichen Befürchtungen bis hin zu Heilserwartungen streckt sich die<br />
Debatte über verschiedene Interpretationen der Gesellschaft hinweg. Ein wichtiger Kritikpunkt<br />
ist die berufliche Autonomie, welche je nach dem, ob die organisationale Eingebundenheit eine<br />
Professionalisierung verunmöglicht, als charakteristisches Hindernis der Entwicklung eines<br />
professionellen Selbstverständnisses problematisiert wird. „Die berufliche Autonomie der<br />
Sozialen Arbeit als Profession und ihre Kompetenzdomäne ist in der Kooperation mit<br />
höherrangigen Professionen dann nicht gefährdet, wenn die Fachkräfte ihre spezifische<br />
Expertise in einer ganzheitlichen, umfeldbezogenen Beratungs-, Betreuungs-, Vermittlungs- und<br />
Vernetzungsarbeit sehen, anstatt mit höherrangigen Professionen in deren Arbeitsfeld (z.B. in<br />
der Therapie) zu konkurrieren.“ (Heiner 2004: 153)<br />
Selbstbeschreibungen der Sozialen Arbeit, welche mit dem Terminus der Postmoderne<br />
konnotiert sind, stellen einen Versuch dar, das Dilemma der Professionalisierung zu<br />
überwinden, indem die Dissonanzen der konkurrierenden Wertvorstellungen zum Normalfall<br />
35