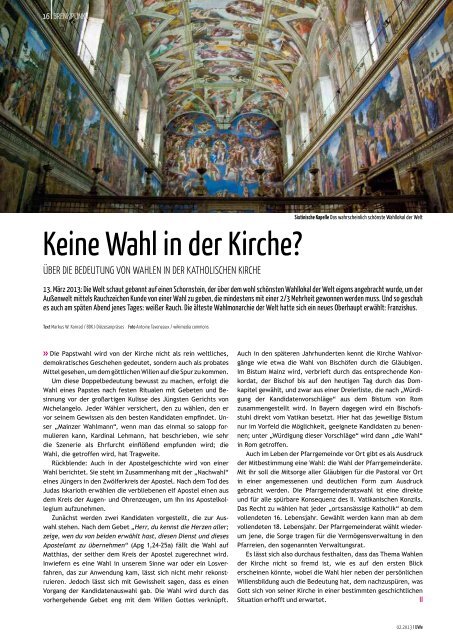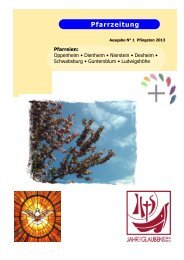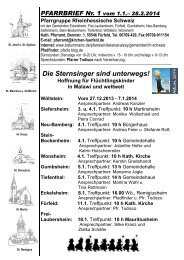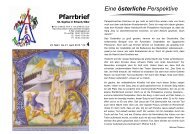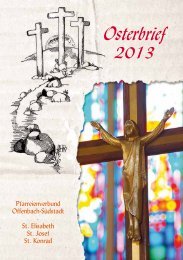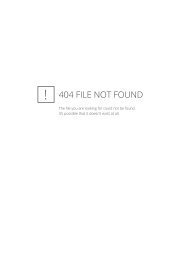BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz
BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz
BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16<br />
BRENNPUNKT<br />
Keine Wahl in der Kirche?<br />
ÜBER DIE BEDEUTUNG VON WAHLEN IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE<br />
13. März 2013: Die Welt schaut gebannt auf einen Schornstein, der über dem wohl schönsten Wahllokal der Welt eigens angebracht wurde, um der<br />
Außenwelt mittels Rauchzeichen K<strong>und</strong>e von einer Wahl zu geben, die mindestens mit einer 2/3 Mehrheit gewonnen werden muss. Und so geschah<br />
es auch am späten Abend jenes Tages: weißer Rauch. Die älteste Wahlmonarchie der Welt hatte sich ein neues Oberhaupt erwählt: Franziskus.<br />
Text Markus W. Konrad / <strong>BDKJ</strong>-Diözesanpräses Foto Antoine Taveneaux / wikimedia commons<br />
>> Die Papstwahl wird von der Kirche nicht als rein weltliches,<br />
demokratisches Geschehen gedeutet, sondern auch als probates<br />
Mittel gesehen, um dem göttlichen Willen auf die Spur zu kommen.<br />
Um diese Doppelbedeutung bewusst zu machen, erfolgt die<br />
Wahl eines Papstes nach festen Ritualen mit Gebeten <strong>und</strong> Besinnung<br />
vor der großartigen Kulisse des Jüngsten Gerichts von<br />
Michelangelo. Jeder Wähler versichert, den zu wählen, den er<br />
vor seinem Gewissen als den besten Kandidaten empfindet. Unser<br />
„<strong>Mainz</strong>er Wahlmann“, wenn man das einmal so salopp formulieren<br />
kann, Kardinal Lehmann, hat beschrieben, wie sehr<br />
die Szenerie als Ehrfurcht einflößend empf<strong>und</strong>en wird; die<br />
Wahl, die getroffen wird, hat Tragweite.<br />
Rückblende: Auch in der Apostelgeschichte wird von einer<br />
Wahl berichtet. Sie steht im Zusammenhang mit der „Nachwahl“<br />
eines Jüngers in den Zwölferkreis der Apostel. Nach dem Tod des<br />
Judas Iskarioth erwählen die verbliebenen elf Apostel einen aus<br />
dem Kreis der Augen- <strong>und</strong> Ohrenzeugen, um ihn ins Apostelkollegium<br />
aufzunehmen.<br />
Zunächst werden zwei Kandidaten vorgestellt, die zur Auswahl<br />
stehen. Nach dem Gebet „Herr, du kennst die Herzen aller;<br />
zeige, wen du von beiden erwählt hast, diesen Dienst <strong>und</strong> dieses<br />
Apostelamt zu übernehmen“ (Apg 1,24-25a) fällt die Wahl auf<br />
Matthias, der seither dem Kreis der Apostel zugerechnet wird.<br />
Inwiefern es eine Wahl in unserem Sinne war oder ein Losver-<br />
fahren, das zur Anwendung kam, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.<br />
Jedoch lässt sich mit Gewissheit sagen, dass es einen<br />
Vorgang der Kandidatenauswahl gab. Die Wahl wird durch das<br />
vorhergehende Gebet eng mit dem Willen Gottes verknüpft.<br />
Sixtinische Kapelle Das wahrscheinlich schönste Wahllokal der Welt<br />
Auch in den späteren Jahrh<strong>und</strong>erten kennt die Kirche Wahlvorgänge<br />
wie etwa die Wahl von Bischöfen durch die Gläubigen.<br />
Im <strong>Bistum</strong> <strong>Mainz</strong> wird, verbrieft durch das entsprechende Kon-<br />
kordat, der Bischof bis auf den heutigen Tag durch das Domkapitel<br />
gewählt, <strong>und</strong> zwar aus einer Dreierliste, die nach „Würdi-<br />
gung der Kandidatenvorschläge“ aus dem <strong>Bistum</strong> von Rom<br />
zusammengestellt wird. In Bayern dagegen wird ein Bischofs-<br />
stuhl direkt vom Vatikan besetzt. Hier hat das jeweilige <strong>Bistum</strong><br />
nur im Vorfeld die Möglichkeit, geeignete Kandidaten zu benen-<br />
nen; unter „Würdigung dieser Vorschläge“ wird dann „die Wahl“<br />
in Rom getroffen.<br />
Auch im Leben der Pfarrgemeinde vor Ort gibt es als Ausdruck<br />
der Mitbestimmung eine Wahl: die Wahl der Pfarrgemeinderäte.<br />
Mit ihr soll die Mitsorge aller Gläubigen für die Pastoral vor Ort<br />
in einer angemessenen <strong>und</strong> deutlichen Form zum Ausdruck<br />
gebracht werden. Die Pfarrgemeinderatswahl ist eine direkte<br />
<strong>und</strong> für alle spürbare Konsequenz des II. Vatikanischen Konzils.<br />
Das Recht zu wählen hat jeder „ortsansässige Katholik“ ab dem<br />
vollendeten 16. Lebensjahr. Gewählt werden kann man ab dem<br />
vollendeten 18. Lebensjahr. Der Pfarrgemeinderat wählt wieder-<br />
um jene, die Sorge tragen für die Vermögensverwaltung in den<br />
Pfarreien, den sogenannten Verwaltungsrat.<br />
Es lässt sich also durchaus festhalten, dass das Thema <strong>Wahlen</strong><br />
der Kirche nicht so fremd ist, wie es auf den ersten Blick<br />
erscheinen könnte, wobei die Wahl hier neben der persönlichen<br />
Willensbildung auch die Bedeutung hat, dem nachzuspüren, was<br />
Gott sich von seiner Kirche in einer bestimmten geschichtlichen<br />
Situation erhofft <strong>und</strong> erwartet. II<br />
02.2013 I UWe<br />
Mitwirkung?<br />
Mit Wirkung?<br />
EIN PLÄDOYER FÜR DIE ABSENKUNG DES WAHLALTERS AUF 16 JAHRE<br />
Wenn aktuell immer wieder über das angebliche Desinteresse von jungen Menschenan politischen Prozessen<br />
gesprochen wird, wird gerne übersehen, dass es einen einfachen Weg gäbe, um politisches Interesse zu<br />
erzeugen: Durch eine Absenkung des Wahlalters erhalten junge Menschen einen direkten Anlass, sich für die<br />
Politik in B<strong>und</strong>, Land <strong>und</strong> Kommunen zu interessieren, weil sie dann auch tatsächlich mit entscheiden dürfen.<br />
Eine Absenkung des Wahlalters, zumindest auf 16 Jahre, wäre daher ein Schritt in die richtige Richtung.<br />
Text Jan Schlemmermeyer / Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. Illustration Simone Brandmüller / PR-Referentin<br />
>> Das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren ist in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland noch relativ jung. 1996 führte es Niedersachsen<br />
als erstes B<strong>und</strong>esland auf Kommunalebene ein. Bis heute<br />
zogen sechs weitere Länder nach. Auch in Brandenburg, Bremen,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-<br />
Anhalt <strong>und</strong> Schleswig-Holstein können Staatsbürger/innen ab ihrem<br />
16. Geburtstag ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben.<br />
Auf Landesebene ist das bisher nur in Brandenburg <strong>und</strong> Bremen<br />
möglich. In Hessen gab es seit 1998 kurzzeitig das Wahlrecht ab<br />
16. Die Änderung wurde jedoch 1999 durch die Regierung unter<br />
Roland Koch wieder rückgängig gemacht. In Rheinland-Pfalz gibt<br />
es eine Initiative für die Ausweitung des Wahlrechts, doch auch<br />
hier sperrt sich bisher die CDU gegen die dafür notwendige Verfassungsänderung.<br />
In keinem der Länder besitzen 16-Jährige das<br />
passive Wahlrecht. Das heißt, dass sie zwar wählen dürfen, aber<br />
nicht gewählt werden können, etwa als Gemeinderatsmitglied.<br />
Junge Menschen stärker für Politik interessieren<br />
Das Hauptargument für ein Wahlrecht ab 16 Jahren ist, junge<br />
Menschen dadurch stärker für Politik zu interessieren <strong>und</strong> so früh<br />
wie möglich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Nur gelebte<br />
Demokratie ist echte Demokratie. Mit 16 beginnen viele<br />
junge Menschen schon eine Ausbildung, bezahlen bei entsprechendem<br />
Verdienst Steuern, sind straf- <strong>und</strong> religionsmündig –<br />
das Recht zu wählen wird ihnen jedoch vorenthalten. Warum<br />
eigentlich? CDU <strong>und</strong> FDP gehören vor allem auf B<strong>und</strong>esebene<br />
bisher zu den stärksten Gegnern eines Wahlrechts ab 16 Jahre.<br />
Jugendliche seien in diesem Alter noch nicht in der Lage, die<br />
komplexen Zusammenhänge der politischen Arbeit zu verstehen,<br />
könnten die Rechtsfolgen ihrer Handlungen nicht abschätzen <strong>und</strong><br />
seien anfälliger für den Einfluss von „Extremisten“ – so lauten<br />
die einschlägigen Argumente. Allen drei Gegenargumenten<br />
könnte man jedoch durch gezielte Informationen an Schulen<br />
sowie Jugendeinrichtungen <strong>und</strong> gezielte Wahlkampagnen entgegenwirken.<br />
Und die wird es erfahrungsgemäß nicht geben,<br />
solange die 16- bis 18-Jährigen keine relevante Zielgruppe darstellen,<br />
um die sich von Seiten der Parteien bemüht werden<br />
UWe I 02.2013<br />
muss. Zudem könnte das Argument der Anfälligkeit für populistische<br />
Parolen oder die Unfähigkeit komplexe Zusammenhänge<br />
zu verstehen auch auf viele ältere Menschen angewendet<br />
werden, Ihnen will aber bisher (glücklicherweise) niemand das<br />
Wahlrecht entziehen.<br />
Darüber hinaus gibt es bisher gar keinen Nachweis, dass<br />
16-Jährige gr<strong>und</strong>sätzlich schlechter informiert sind als 18-Jährige.<br />
Zudem ist der Anteil der 16- <strong>und</strong> 17-Jährigen Neuwähler<br />
ohnehin nicht so hoch, dass politische Umstürze befürchtet<br />
werden müssen – selbst wenn alle Neuwähler ein <strong>und</strong> dieselbe<br />
Partei wählen würden. Denn ihr Anteil liegt je nach Region<br />
nur zwischen 1,5 <strong>und</strong> 3,5 Prozent aller Wahlberechtigten. In den<br />
bisherigen <strong>Wahlen</strong> zeigte sich diese Altersgruppe dementsprechend<br />
auch weder desinteressiert noch übermotiviert. Das sehen<br />
inzwischen auch Bündnis90/Die Grünen, Die Linke <strong>und</strong> Teile<br />
der SPD so. Daher setzen sie sich für eine Herabsetzung des<br />
Wahlalters bei allen Europa-, B<strong>und</strong>es-, Landtags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen<br />
ein. In den B<strong>und</strong>esländern kommt jedoch nur langsam<br />
Bewegung in die Änderung des Wahlrechts. Auf B<strong>und</strong>esebene<br />
gibt es momentan gar keine ernsthaften Bemühungen, das Wahlalter<br />
herabzusenken.<br />
Recht auf demokratische Teilhabe stärken<br />
BRENNPUNKT<br />
Dabei sind die Vorteile offensichtlich: Wenn junge Menschen früher<br />
mitentscheiden dürften, wären politische Verantwortungsträger<br />
gezwungen, sich stärker an ihren Interessen zu orientieren. Oder,<br />
wie Abraham Lincoln es einmal formuliert hat: „Kein Mensch ist<br />
gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu<br />
regieren.“ Mit der Senkung des Wahlalters auf allen politischen<br />
Ebenen wäre es so möglich, junge Menschen stärker für Politik<br />
zu begeistern, ihr Recht auf demokratische Teilhabe zu stärken<br />
<strong>und</strong> – nicht zuletzt – so in Zeiten des demographischen Wandels<br />
auch der Jugendpolitik insgesamt wieder einen höheren Stellenwert<br />
in der politischen Debatte einzuräumen. Insofern ist die<br />
Weigerung mancher Parteien, an einer Absenkung des Wahlalters<br />
mitzuwirken, nicht nur demokratisch bedenklich, sondern<br />
auch ein jugendpolitischer Offenbarungseid. II<br />
17