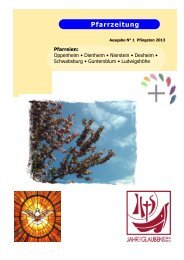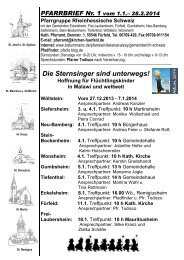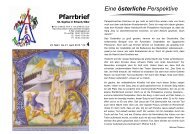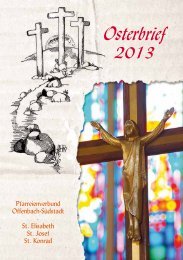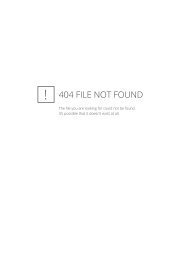BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz
BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz
BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
04 BRENNPUNKT<br />
BRENNPUNKT<br />
Wer die Wahl hat …<br />
DER LANGE WEG ZU EINER ERRUNGENSCHAFT, DIE FÜR MANCHE KEINEN WERT MEHR DARSTELLT<br />
Wir schreiben das Jahr 2013, in Deutschland wird mal wieder ein neuer B<strong>und</strong>estag <strong>und</strong> in Hessen<br />
dazu noch ein neuer Landtag gewählt. Wer die Wahl hat, hat die Qual, so ein altes Sprichwort.<br />
Übersetzt ins 21. Jahrh<strong>und</strong>ert heißt das in diesem Zusammenhang für viele heute auch: Geht<br />
Ihr mal schön wählen – für mich ist das nichts – das tue ich mir nicht an!<br />
Text Andreas Belz / Referent für Politische Bildung des <strong>BDKJ</strong> <strong>Mainz</strong> Foto Khalid Aziz / jugendfotos.de<br />
>> Wählen gehen zu können – oder auch<br />
nicht wählen gehen zu können, ist für uns<br />
heute eine Selbstverständlichkeit. Das<br />
war, auch auf dem Gebiet des heutigen<br />
Deutschlands, nicht immer so <strong>und</strong> ist<br />
auch heute in manchen Teilen der Welt<br />
noch immer nicht so. Wir aber sind mit<br />
dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen,<br />
für uns ist das der Normalzustand.<br />
Angesiedelt irgendwo zwischen demokratischem<br />
Bürgerstolz, Gewohnheit <strong>und</strong><br />
lästiger Bürgerpflicht. Was wir wissen,<br />
aber dennoch oft vergessen: Dieses Recht<br />
musste von den Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern<br />
früherer Generationen hart erkämpft werden.<br />
Es war ein langer Weg – bestehend<br />
aus vielen kleinen Schritten – ein kurzer<br />
Blick zurück lohnt sich …<br />
Wahlrecht als tragende Säule der Demokratie<br />
Das Wahlrecht ist eine der tragenden<br />
Säulen der Demokratie <strong>und</strong> soll sicherstellen,<br />
dass die Volkssouveränität gewahrt<br />
bleibt. Das Wahlrecht gehört heute<br />
zu den politischen Gr<strong>und</strong>rechten. Die Ge-<br />
schichte des Wahlrechts lässt sich bis in<br />
die Antike verfolgen. Besonders spannend<br />
ist für uns dabei aber sicher ein Blick auf<br />
die „jüngeren“ Entwicklungen auf dem<br />
Boden bzw. im Kulturkreis des heutigen<br />
Deutschlands.<br />
Wir schauen zurück das Jahr 1848. Die<br />
Abdankung des französischen Königs im<br />
Februar <strong>und</strong> die Gründung der französischen<br />
Republik wirken in Deutschland heftig<br />
nach. Immer stärker wird der Ruf nach<br />
einer Nationalversammlung. Schließlich<br />
bereitet ein Ausschuss des B<strong>und</strong>estages<br />
02.2013 I UWe<br />
des Deutschen B<strong>und</strong>es die Einberufung einer<br />
Versammlung von Volksvertretern vor.<br />
Dieses so genannte Vorparlament tagt<br />
vom 31. März bis zum 3. April. Es besteht<br />
aus 574 Mitgliedern, die zum größten Teil<br />
als Abgeordnete in Landtagen oder von<br />
Stadtverordneten gewählt, zu einem Teil<br />
jedoch nur aufgr<strong>und</strong> ihrer Prominenz berufen<br />
worden waren. Seine wesentliche<br />
Leistung wird darin bestehen, die Wahl einer<br />
Nationalversammlung vorzubereiten.<br />
Frauen haben 1848 noch kein Wahlrecht<br />
Im Mai finden die <strong>Wahlen</strong> zur „Deutschen<br />
Verfassungsgebenden Nationalversammlung“<br />
statt. Für je 50.000 Männer wird ein<br />
Abgeordneter gewählt. Das Wahlrecht ist<br />
an die „Selbständigkeit“ geknüpft. Dieses<br />
Kriterium wird in den unterschiedlichen<br />
deutschen Staaten allerdings sehr unterschiedlich<br />
interpretiert. Schätzungen zu-<br />
folge besitzen etwa 85% der Männer das<br />
aktive <strong>und</strong> passive Wahlrecht. Frauen<br />
haben kein Wahlrecht <strong>und</strong> Arbeiter sind<br />
nicht in allen Staaten als Wähler zugelassen.<br />
UWe I 02.2013<br />
Dennoch: Die „Deutsche Verfassungs-<br />
gebende Nationalversammlung“ von 1848<br />
ist das erste demokratisch gewählte<br />
Parlament für Deutschland. Seine<br />
wichtigsten Ziele sind die Erarbeitung<br />
einer freiheitlichen Verfassung, welche<br />
die Gr<strong>und</strong>rechte für alle Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürger verbrieft, sowie die Einsetzung<br />
einer nationalen Regierungsgewalt. Im<br />
Dezember 1848 wird ein Gr<strong>und</strong>rechte-<br />
Katalog für alle Deutschen beschlossen.<br />
Er enthält unter anderem die Gleichheit<br />
vor dem Gesetz, das Recht auf freie Meinungsäußerung,<br />
Presse- <strong>und</strong> Versammlungsfreiheit<br />
sowie das Recht auf Freiheit<br />
der Person.<br />
Ende März 1849 wird dann eine<br />
Deutsche Reichsverfassung verabschiedet.<br />
Sie sieht einen Reichstag bestehend<br />
aus Volkshaus <strong>und</strong> Staatenhaus vor.<br />
Die Mitglieder des Volkshauses sollen<br />
nach dem Prinzip der Mehrheitswahl in<br />
gleicher, geheimer <strong>und</strong> direkter Abstimmung<br />
gewählt werden. Wahlberechtigt<br />
sind alle männlichen Deutschen mit<br />
einem Alter von mindestens 25 Jahren,<br />
Deutscher Reichstag Das Herz der Demokratie<br />
die im Besitz der bürgerlichen Ehren-<br />
rechte sind.<br />
Schon wenig später scheitert die Versammlung<br />
in der Paulskirche in Frankfurt.<br />
Der zum Erbkaiser gewählte preußische<br />
König Friedrich Wilhelm IV. schlägt die<br />
Krone aus <strong>und</strong> hebt anschließend die Mandate<br />
der preußischen Abgeordneten auf.<br />
Das nach Stuttgart geflüchtete Rumpfparlament<br />
wird von württembergischem Militär<br />
gewaltsam aufgelöst.<br />
Dreiklassenwahlrecht per Verordnung<br />
05<br />
Der 30. Mai 1849 bringt Preußen dann per<br />
Verordnung das Dreiklassenwahlrecht für<br />
das Abgeordnetenhaus, das bis 1918 in<br />
Kraft bleibt. Das aktive Wahlrecht steht<br />
allen Männern nach Vollendung des 24.<br />
Lebensjahres zu; Fürsorgeempfänger sind<br />
davon ausgenommen. Die Abgeordneten<br />
werden indirekt, also über Wahlmänner,<br />
gewählt. Dazu werden die Wähler je<br />
nach ihren Steuerzahlungen in drei Klassen<br />
eingeteilt. Der ersten Klasse gehören<br />
Bürger mit besonders hohem Steuerauf- >>