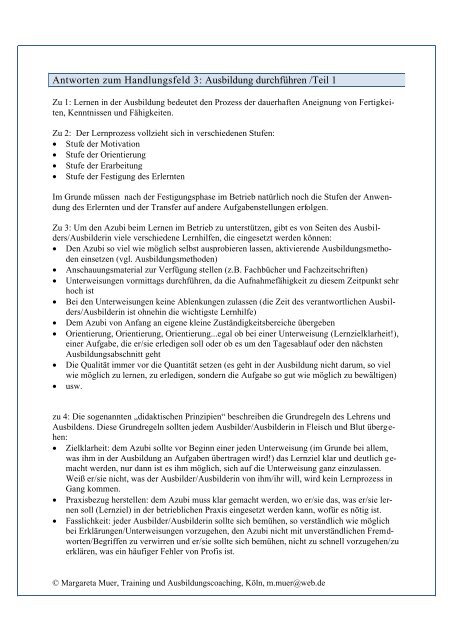Lösungen zum Handlungsfeld 3 - Erfolgreich im Friseur-Handwerk
Lösungen zum Handlungsfeld 3 - Erfolgreich im Friseur-Handwerk
Lösungen zum Handlungsfeld 3 - Erfolgreich im Friseur-Handwerk
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Antworten <strong>zum</strong> <strong>Handlungsfeld</strong> 3: Ausbildung durchführen /Teil 1<br />
Zu 1: Lernen in der Ausbildung bedeutet den Prozess der dauerhaften Aneignung von Fertigkeiten,<br />
Kenntnissen und Fähigkeiten.<br />
Zu 2: Der Lernprozess vollzieht sich in verschiedenen Stufen:<br />
• Stufe der Motivation<br />
• Stufe der Orientierung<br />
• Stufe der Erarbeitung<br />
• Stufe der Festigung des Erlernten<br />
Im Grunde müssen nach der Festigungsphase <strong>im</strong> Betrieb natürlich noch die Stufen der Anwendung<br />
des Erlernten und der Transfer auf andere Aufgabenstellungen erfolgen.<br />
Zu 3: Um den Azubi be<strong>im</strong> Lernen <strong>im</strong> Betrieb zu unterstützen, gibt es von Seiten des Ausbilders/Ausbilderin<br />
viele verschiedene Lernhilfen, die eingesetzt werden können:<br />
• Den Azubi so viel wie möglich selbst ausprobieren lassen, aktivierende Ausbildungsmethoden<br />
einsetzen (vgl. Ausbildungsmethoden)<br />
• Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen (z.B. Fachbücher und Fachzeitschriften)<br />
• Unterweisungen vormittags durchführen, da die Aufnahmefähigkeit zu diesem Zeitpunkt sehr<br />
hoch ist<br />
• Bei den Unterweisungen keine Ablenkungen zulassen (die Zeit des verantwortlichen Ausbilders/Ausbilderin<br />
ist ohnehin die wichtigste Lernhilfe)<br />
• Dem Azubi von Anfang an eigene kleine Zuständigkeitsbereiche übergeben<br />
• Orientierung, Orientierung, Orientierung...egal ob bei einer Unterweisung (Lernzielklarheit!),<br />
einer Aufgabe, die er/sie erledigen soll oder ob es um den Tagesablauf oder den nächsten<br />
Ausbildungsabschnitt geht<br />
• Die Qualität <strong>im</strong>mer vor die Quantität setzen (es geht in der Ausbildung nicht darum, so viel<br />
wie möglich zu lernen, zu erledigen, sondern die Aufgabe so gut wie möglich zu bewältigen)<br />
• usw.<br />
zu 4: Die sogenannten „didaktischen Prinzipien“ beschreiben die Grundregeln des Lehrens und<br />
Ausbildens. Diese Grundregeln sollten jedem Ausbilder/Ausbilderin in Fleisch und Blut übergehen:<br />
• Zielklarheit: dem Azubi sollte vor Beginn einer jeden Unterweisung (<strong>im</strong> Grunde bei allem,<br />
was ihm in der Ausbildung an Aufgaben übertragen wird!) das Lernziel klar und deutlich gemacht<br />
werden, nur dann ist es ihm möglich, sich auf die Unterweisung ganz einzulassen.<br />
Weiß er/sie nicht, was der Ausbilder/Ausbilderin von ihm/ihr will, wird kein Lernprozess in<br />
Gang kommen.<br />
• Praxisbezug herstellen: dem Azubi muss klar gemacht werden, wo er/sie das, was er/sie lernen<br />
soll (Lernziel) in der betrieblichen Praxis eingesetzt werden kann, wofür es nötig ist.<br />
• Fasslichkeit: jeder Ausbilder/Ausbilderin sollte sich bemühen, so verständlich wie möglich<br />
bei Erklärungen/Unterweisungen vorzugehen, den Azubi nicht mit unverständlichen Fremdworten/Begriffen<br />
zu verwirren und er/sie sollte sich bemühen, nicht zu schnell vorzugehen/zu<br />
erklären, was ein häufiger Fehler von Profis ist.<br />
© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de
• Aktivierung: da man am besten und schnellsten das lernt, was man selbst macht, ist es wichtig,<br />
dass dem Azubi die Möglichkeit gegeben wird, so viel wie möglich auszuprobieren. Für<br />
den Ausbilder/die Ausbilderin bedeutet es, auf aktivierende Ausbildungsmethoden zurückzugreifen.<br />
• Individualisierung: der Ausbilder sollte sich individuell auf den einzelnen Azubi einstellen,<br />
auf den jeweiligen Lerntyp, auf die Lernvoraussetzungen, die der Azubi mit in die Ausbildung<br />
bringt, auf die jeweiligen Vorkenntnisse.<br />
• Erfolgssicherung: hiermit ist gemeint, dass dem Azubi <strong>im</strong>mer wieder die Möglichkeit gegeben<br />
wird, neu Erlerntes einzuüben, d.h. Lernerfolge dauerhaft zu sichern. Diese Möglichkeiten<br />
müssen vom Ausbilder/Ausbilderin in den betrieblichen Ablauf mit eingeplant werden.<br />
Zu 5: ein Lernziel ist das, was vom Azubi am Ende einer Unterweisung gekonnt werden soll<br />
oder (<strong>im</strong> Plural)<br />
Lernziele sind alle Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Azubi innerhalb<br />
Der Ausbildung erlernen soll.<br />
Zu 6: Lernziele lassen sich in vier unterschiedliche Lernzielbereiche einordnen:<br />
• Kognitive Lernziele: bei diesen Lernzielen stehen theoretische Kenntnisse <strong>im</strong> Vordergrund<br />
(z.B. auswerten, planen, beurteilen...)<br />
• Psychomotorische Lernziele: hier geht es um den Erwerb praktischer Fertigkeiten (schrauben,<br />
feilen, schneiden...)<br />
• Affektive Lernziele: diese Lernziele haben mit den Gefühlen, der Einstellung des Azubi gegenüber<br />
dem Betrieb und dem Beruf zu tun ( pünktlich sein, selbstständiges Arbeiten...)<br />
• Sozial-kommunikative Lernziele: hierbei geht es um den Umgang/das Verhalten des Azubi<br />
gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern ( Höflichkeit, Konfliktfähigkeit...)<br />
Zu 7: Berufliche Handlungsfähikeit (oder auch berufliche Handlungskompetenz) bedeutet, dass<br />
der Azubi <strong>zum</strong> Ende der Ausbildung in der Lage ist, in allen beruflichen Situationen klar zu<br />
kommen, d.h. Arbeitsprozesse selbstständig planen, durchführen und kontrollieren kann. Diese<br />
berufliche Handlungsfähigkeit wird in der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung überprüft.<br />
Zu 8: In der betrieblichen Ausbildung gibt es unterschiedliche Lernorte (die Vielzahl ist allerdings<br />
abhängig von der Größe und der Struktur des Betriebes):<br />
• Werkstatt/Salon<br />
• Baustelle<br />
• Lehrwerkstatt<br />
• Büro<br />
• Lernbüro<br />
• Eigene Übungsplätze innerhalb einer Werkstatt oder eines Salons<br />
• Unterrichtsraum<br />
Zu 9: Ausbildungserfolgskontrollen können folgendermaßen durchgeführt werden:<br />
• Beobachtung und Auswertung <strong>zum</strong> Abschluss einer Unterweisung<br />
© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de
• Übertragung von Lernaufträgen und deren anschließende Auswertung<br />
• Berichtsheftkontrolle (allerdings nur, wenn zusätzlich zu den Tagesberichten noch schriftliche<br />
Zusatzaufgaben erteilt werden)<br />
• Ausarbeitung und Auswertung von Leittexten<br />
• Erteilen schriftlicher Aufgaben und deren Auswertung<br />
• Mündliche Befragungen und deren Auswertung (z.B. <strong>im</strong> Rahmen eines Lehrgesprächs)<br />
• Durchführen von Übungsabenden<br />
• usw.<br />
Zu 10: Über die Ausbildungserfolgskontrollen ist es dem Ausbilder/Ausbilderin möglich, sich ein<br />
Urteil über den Ausbildungsstand des Azubi zu bilden (Soll-Ist-Vergleich). Hierüber ist es möglich,<br />
Prognosen über den weiteren Ausbildungsverlauf zu erstellen: müssen Korrekturen vorgenommen<br />
werden, weil es große Wissenslücken gibt oder kann das Tempo angezogen werden,<br />
weil die Leistungen des Azubi überdurchschnittlich sind?<br />
Zu 11: Eine Beurteilung ist <strong>im</strong> Grunde die Summe der Ausbildungserfolgskontrollen eines best<strong>im</strong>mten<br />
Ausbildungsabschnitts. Es ist wichtig, diese Beurteilungen regelmäßig und in nicht zu<br />
großen Abständen durchzuführen (denn dann können eventuell entstandene Wissenslücken nicht<br />
mehr gefüllt werden...). Es bietet sich an, die Beurteilungen zu folgenden Zeitpunkten durchzuführen:<br />
• rechtzeitig vor Ende der Probezeit<br />
• rechtzeitig vor den Prüfungen<br />
• am Ende von Projekten, bei denen der Azubi mitgearbeitet hat<br />
• regelmäßig alle drei Monate<br />
Es macht Sinn, wenn es <strong>im</strong> Betrieb einen auf die betriebliche Ausbildung abgest<strong>im</strong>mten Beurteilungsbogen<br />
gibt (mit Beurteilungskriterien und Notenskala), der vom Ausbilder/Ausbilderin ausgefüllt<br />
wird und der die Grundlage des Beurteilungsgesprächs ist.<br />
Zu 12: Bei den Beurteilungen müssen vom Ausbilder/Ausbilderin folgende Grundsätze beachtet<br />
werden:<br />
• nicht die Person des Azubi, sondern seine Leistung und sein Verhalten werden beurteilt<br />
• die Beurteilung sollte längerfristig erfolgen, d.h. „Momentaufnahmen“ müssen vermieden<br />
werden.<br />
Zu 13: Vom Ausbilder/Ausbilderin sollten folgende Beurteilungsfehler vermieden werden:<br />
• Vorurteile<br />
• Überstrahlungsfehler<br />
• Mildefehler<br />
• Strengefehler<br />
• Tendenz zur Mitte<br />
• usw.<br />
© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de
zu 14: Ein Beurteilungsgespräch sollte wie jedes Mitarbeitergespräch angekündigt und vorbereitet<br />
werden. Es sollte in Ruhe und nicht zwischen „Tür und Angel“ geführt werden. Der Ablauf<br />
kann folgendermaßen aussehen:<br />
• freundlicher Einstieg/“warming up“<br />
• Ziel des Beurteilungsgespräches herausstellen<br />
• Beurteilung des Ausbilders/Ausbilderin an Hand des Beurteilungsbogens<br />
• Stellungnahme durch den Azubi<br />
• Vereinbarung von Zielen/Konsequenzen/Maßnahmen (sollten schriftlich auf dem Beurteilungsbogen<br />
festgehalten werden)<br />
• Freundliche Verabschiedung<br />
Eine Beurteilung sollte <strong>im</strong>mer als Motivationsfaktor gesehen werden, niemals in einer Verurteilung<br />
des Azubi enden! Es geht darum, Stärken und Schwächen des Azubi zu ergründen und daraus<br />
Konsequenzen für den weiteren Ausbildungsverlauf abzuleiten. Letztlich stellen regelmäßige<br />
Beurteilungen den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung sicher.<br />
© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de