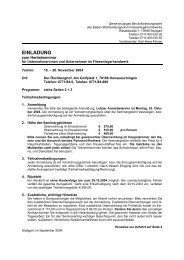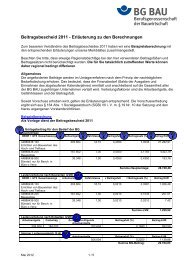inhaltsübersicht - Landesinnungsverband Fliesen Baden-Württemberg
inhaltsübersicht - Landesinnungsverband Fliesen Baden-Württemberg
inhaltsübersicht - Landesinnungsverband Fliesen Baden-Württemberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INHALTSÜBERSICHT<br />
10/2008<br />
ARBEITSRECHT/SOZIALPOLITIK 1. Vergütung von Praktikanten<br />
Urteil des Landesarbeitsgerichts <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> -<br />
5 Sa 45/07 - vom 08. Februar 2008<br />
- Anlage -<br />
2. Keine Probezeitbefristung im befristeten Arbeitsvertrag<br />
3. Arbeitsverträge unter Angehörigen müssen<br />
strenge Anforderungen erfüllen<br />
4. Arbeitsrecht für Bauunternehmer Nr. 98<br />
„Die außerordentliche Kündigung“<br />
- Anlage -<br />
BERUFS- UND WEITERBILDUNG 5. Ergebnisse des Landesleistungswettbewerbs 2008<br />
im Ausbildungszentrum Donaueschingen der<br />
südbadischen Bauwirtschaft<br />
6. Berufsbildung im Baugewerbe - Statistik<br />
RECHT 7. Steuerberater muss Hinweise geben -<br />
Schadensersatz wenn er es nicht tut<br />
STEUERN 8. Rückstellungen für die Kosten zur Aufbewahrung<br />
von Geschäftsunterlagen - Mit den Aufbewahrungs-<br />
kosten lassen sich Steuern sparen -<br />
- Anlage -<br />
TECHNIK 9. Handbuch Technik 7. Auflage ist erschienen<br />
- Anlage -<br />
Stuttgart, den 24. Oktober 2008<br />
<strong>Landesinnungsverband</strong> des <strong>Fliesen</strong>-, Platten– und Ressestr. 1 Tel.: 0711/45 10 35-30 Landesinnungsmeister: Heinz Messner<br />
Mosaiklegerhandwerks <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> 70599 Stuttgart Fax: 0711/45 10 35-55 Geschäftsführer: Johannes Hess<br />
E-mail: info@fliesen-bw.de<br />
Internet: http://www.fliesen-bw.de
ARBEITSRECHT / SOZIALPOLITIK<br />
1. Vergütung von Praktikanten<br />
Urteil des Landesarbeitsgerichts <strong>Baden</strong>-<strong>Württemberg</strong> -<br />
5 Sa 45/07 - vom 8. Februar 2008<br />
Häufig stellt sich die Frage, ob im Betrieb tätige „Praktikanten“ unter<br />
den Geltungsbereich der Bau-Tarifverträge und insbesondere des<br />
Tarifvertrags zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe (TV Mindestlohn)<br />
fallen. Für die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend,<br />
ob die im Betrieb tätige Person wirklich als Praktikant oder aber als<br />
Arbeitnehmer beschäftigt wird. Ein Praktikant hat im Gegensatz zu<br />
einem Arbeitnehmer keinen Anspruch auf den Bau-Mindestlohn.<br />
Ein Praktikant ist in aller Regel nur vorübergehend in einem Betrieb<br />
praktisch tätig, um sich die zur Vorbereitung auf einen Beruf notwendigen<br />
praktischen Kenntnisse und Erfahrungen anzueignen. In einem<br />
Praktikum findet keine systematische Berufsausbildung statt. Vielmehr<br />
wird eine darauf beruhende Tätigkeit häufig Teil einer Gesamtausbildung<br />
sein und beispielsweise für die Zulassung zu Studium oder<br />
Beruf benötigt. Bei einem Praktikum steht ein Ausbildungszweck im<br />
Vordergrund. Die Vergütung ist der Höhe nach auf eine Aufwandsentschädigung<br />
oder Beihilfe zum Lebensunterhalt gerichtet<br />
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. März 2003, 6 AZR 564/01).<br />
Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines Arbeitsvertrags persönlich abhängig<br />
und zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit<br />
verpflichtet ist. Der Arbeitnehmer erbringt seine vertraglich geschuldete<br />
Leistung im Rahmen einer vom Arbeitgeber vorgegebenen<br />
Arbeitsorganisation. Die Eingliederung des Arbeitnehmers in diese Arbeitsorganisation<br />
zeigt sich insbesondere daran, dass er einem weisungsrecht<br />
des Arbeitgebers unterliegt, das Inhalt, Durchführung,<br />
Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen kann.<br />
Abgrenzungskriterien können neben dem Ausbildungs– bzw. Erwerbszweck<br />
zum Beispiel folgende Kriterien sein:<br />
● der Umfang der von der beschäftigten Person erbrachten Arbeit,<br />
● die Höhe des vereinbarten Entgelts,<br />
● die Gewährung von Urlaub unter Fortzahlung der Vergütung oder<br />
etwa<br />
● die vereinbarte Zustimmungserfordernis für eine Neben-<br />
beschäftigung der beschäftigten Person.<br />
Nicht maßgeblich ist die Bezeichnung der Person im Vertrag als<br />
„Praktikant“.<br />
Vorstehende Grundsätze hat das Landesarbeitsgericht <strong>Baden</strong>-<br />
<strong>Württemberg</strong> mit Entscheidung vom 9. Februar 2008 (rechtskräftig)<br />
konkretisiert.<br />
Seite 2 - INFO 10/2008
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:<br />
Die Klägerin beendete im Jahr 2005 ihr Studium als Diplomingenieurin<br />
(FH) für Innenarchitektur. Beim beklagten Betrieb handelte es sich<br />
um einen Fachverlag. Am 25. November 2005 schlossen die Parteien<br />
einen schriftlichen auf sechs Monate befristeten „Praktikantenvertrag“.<br />
Darin wurde der Klägerin eine Übertragung allgemeiner<br />
Aufgaben mit der betriebsüblichen Arbeitszeit und einer Vergütung<br />
von 375 Euro brutto monatlich vereinbart. Zudem stellte der beklagte<br />
Betrieb der Klägerin die Möglicheit in Aussicht, nach Abschluss des<br />
„Praktikums“ in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden.<br />
Die Klägerin war beim beklagten Betrieb während der gesamten Zeit<br />
in einer bestimmten Abteilung (Veranstaltungsorganisation/Eventmanagement)<br />
tätig und profitierte im Rahmen dieser Tätigkeit von<br />
den Erfahrungen früherer studentischer Nebentätigkeiten sowie dem<br />
Thema Ihrer Diplomarbeit („Kommunikation in der Baubranche“). Vor<br />
dem 1. November 2005 war die Klägerin arbeitssuchend gemeldet<br />
und erhielt durchgehend - auch über den 31. Mai 2006 hinaus -<br />
“Hartz IV“. Ein Angebot des beklagten Betriebs, nach Ende des<br />
Praktikums in einem Arbeitsverhältnis zu einem Bruttomonatsgehalt<br />
von 2.000 Euro für sie tätig zu werden, lehnte die Klägerin ab. Sie<br />
meinte, bereits während der als „Praktikum“ bezeichneten Tätigkeit<br />
als „Arbeitnehmerin“ tätig gewesen zu sein und klagte erfolgreich eine<br />
angemessene Vergütung ein.<br />
Dem Urteil sind folgende Leitsätze zu entnehmen:<br />
1. Für die Abgrenzung zwischen einem Praktikum und einem Arbeitsverhältnis<br />
ist darauf abzustellen, ob der Ausbildungszweck<br />
oder der Erwerbszweck im Vordergrund steht und überwiegt.<br />
2. Zwar ist für das Vorliegen eines Praktikums keine systematische<br />
Ausbildung erforderlich. Der Ausbildungszweck muss aber deutlich<br />
im Vordergrund stehen und die erbrachten Leistungen und<br />
Arbeitsergebnisse deutlich überwiegen.<br />
3. Durchläuft eine Person während ihrer Tätigkeit in einem Betrieb<br />
nicht mehrere Abteilungen, sondern ist lediglich in einer Abteilung<br />
tätig, spricht dies gegen das Vorliegen eines Praktikums.<br />
4. Je breiter das Spektrum vermittelter Einblicke in Arbeitsabläufe<br />
und in betriebsorganisatorische Zusammenhänge ist und je<br />
mehr Ansprechpartner es gibt, die Kenntnisse vermitteln und<br />
Praxiserfahrung weitergeben, desto klarer lässt sich der Ausbildungszweck<br />
erkennen.<br />
5. Wird eine als „Praktikant“ bezeichnete Person tatsächlich als Arbeitnehmer<br />
tätig und beträgt das Bruttomonatsgehalt für eine<br />
Vollzeitstelle lediglich 375 Euro, liegt sittenwidriger Lohnwucher<br />
vor.<br />
6. Eine zu Lohnwucher führende Zwangslage kann für einen Arbeitnehmer<br />
darin bestehen, dass er als Akademiker „Hartz IV“ erhält<br />
und dies als Beeinträchtigung seines Lebenslaufs ansieht.<br />
7. Im Falle des Lohnwuchers ist statt der vereinbarten Vergütung<br />
die „übliche“ Vergütung zu gewähren. Die übliche Vergütung<br />
richtet sich nach den einschlägigen Tarifverträgen.<br />
Seite 3 - INFO 10/2008
Das Urteil hat folgende praktischen Auswirkungen:<br />
Anspruch auf den Mindestlohn haben alle gewerblichen Arbeitnehmer,<br />
die eine rentenversicherungspflichtige Tätigkeit ausüben,<br />
auch wenn sie selbst nicht versicherungspflichtig sind und für sie<br />
keine Beiträge zur Rentenversicherung abgeführt werden. Deshalb<br />
haben beispielsweise auch aushilfsweise Beschäftigte und geringfügig<br />
Beschäftigte Anspruch auf den Mindestlohn.<br />
Vom persönlichen Geltungsbereich des TV Mindestlohn sind lediglich<br />
folgende Arbeitnehmergruppen ausgenommen:<br />
● jugendliche Arbeitnehmer ohne abgeschlossene Berufs-<br />
ausbildung,<br />
● Auszubildende,<br />
● Praktikanten und<br />
● gewerbliches Reinigungspersonal, das in Betrieben des Bau-<br />
gewerbes für Reinigungsarbeiten in Verwaltungs– und Sozial-<br />
räumen beschäftigt ist.<br />
„Schnupperlehre“<br />
Im Rahmen der Nachwuchswerbung kann ein erhebliches Interesse<br />
daran bestehen, jungen Leuten bereits während oder im Anschluss an<br />
die Schulzeit oder auch während eines Berufsgrundbildungsjahres<br />
Einblicke in die praktische Tätigkeit eines Baubetriebes zu vermitteln<br />
und ihnen dadurch die Bauberufe und den betrieblichen Alltag im<br />
Baubetrieb näher zu bringen. Zu diesem Zweck führen viele Betriebe<br />
sogenannte „Schnupperlehren“ durch, in denen potentielle Lehrlinge<br />
den Baubetrieb, die dortige Arbeitsweise und die unterschiedlichen<br />
Bauberufe kennenlernen können. Bei der Vertragsgestaltung ist<br />
darauf zu achten, dass das Kennenlernen der betrieblichen<br />
Praxis im Baubetrieb (= Praktikum) im Vordergrund steht und<br />
es sich nicht um einen bloßen Ferienjob (= Arbeitsverhältnis)<br />
handelt.<br />
Liegt bei einer als „Praktikant“ eingestellten Person entgegen seiner<br />
Bezeichnung ein Arbeitsverhältnis vor, ist der TV Mindestlohn einschlägig<br />
und es handelt sich uneingeschränkt um eine steuer-, sozialversicherungs–<br />
und sozialkassenpflichtige Beschäftigung. Bei gewerblichen<br />
Arbeitnehmern besteht der Vorteil der Erstattung der Urlaubsvergütung<br />
durch die Urlaubs– und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft<br />
(ULAK).<br />
Eine schematische Übersicht von Praktikum und Arbeitsverhältnis ist<br />
diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt.<br />
- Anlage -<br />
Seite 4 - INFO 10/2008
2. Keine Probezeitbefristung im befristeten Arbeitsvertrag<br />
Ein für ein Jahr befristeter Arbeitsvertrag kann nicht zusätzlich bis<br />
zum Ablauf einer sechsmonatigen Probezeit befristet werden. Dies hat<br />
das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 16. April 2008 (7 AZR<br />
132/07) entschieden.<br />
Wird ein neues Arbeitsverhältnis begründet, kann bekanntlich eine so<br />
genannte „Probezeit“ vereinbart werden. Diese Probezeit dient beiden<br />
Arbeitsvertragsparteien dazu, sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob<br />
eine dauerhafte Zusammenarbeit möglich ist. Hierbei ist allerdings auf<br />
folgendes hinzuweisen:<br />
Die ausdrückliche Vereinbarung einer „Probezeit“ führt lediglich dazu,<br />
dass die Kündigungsfrist während der Dauer der maximal<br />
sechsmonatigen Probezeit abgekürzt wird. Ohne Vereinbarung einer<br />
Probezeit beträgt sie vier Wochen zum 15. bzw. Monatsende, mit<br />
Vereinbarung einer Probezeit beträgt sie zwei Wochen, wobei mit<br />
dieser Frist jederzeit gekündigt werden kann. Auf den Kündigungsschutz<br />
hat die Probezeit keinen Einfluss, weil dieser ohnehin<br />
kraft Gesetzes erst nach sechs Monaten einsetzt.<br />
Probleme können entstehen, wenn im Rahmen eines bereits<br />
befristeten Arbeitsvertrages zusätzlich eine Probezeit vereinbart<br />
werden soll. Wird ein Arbeitsvertrag nämlich nur für einen<br />
bestimmten Zeitraum abgeschlossen, so wird dadurch für den<br />
Arbeitnehmer der Eindruck erweckt, diese befristete Vertragslaufzeit<br />
bestimme Anfang und Ende des Arbeitsverhältnisses. Wird zugleich an<br />
anderer Stelle (ohne besondere drucktechnische Hervorhebung) eine<br />
weitere Befristung bis zum Ablauf einer sechsmonatigen Probezeit<br />
vorgesehen, entfaltet diese keine Wirkung. Sie ist als so genannte<br />
„Überraschende Klausel“ nicht Bestandteil des Arbeitsvertrages und<br />
daher unwirksam. Grundsätzlich sollten daher innerhalb von<br />
befristeten Arbeitsverhältnissen keine weiteren Befristungen - z. B.<br />
bis zum Ablauf der sechsmonatigen Probezeit - vorgesehen werden.<br />
Es bestehen jedoch andere Möglichkeiten, zum gleichen Ergebnis zu<br />
gelangen. Entweder kann die Probezeit dadurch wirksam vereinbart<br />
werden, dass das Arbeitsverhältnis von vornherein allein für die<br />
Probezeit befristet wird. Bei Bedarf kann das Arbeitsverhältnis dann<br />
nach Ablauf der Probezeit (ggf. mit einer nochmaligen Befristung)<br />
fortgesetzt werden.<br />
Zudem besteht auch die Möglichkeit, statt der Vereinbarung einer<br />
Probezeit für ein unbefristetes oder befristetes Arbeitsverhältnis<br />
vorübergehend eine kürzere Kündigungsfrist (minimal: zwei Wochen)<br />
zu vereinbaren. Das Kündigungsschutzgesetz ist während der ersten<br />
sechs Monate eines Arbeitsverhältnisses nämlich ohnehin nicht<br />
anwendbar.<br />
Seite 5 - INFO 10/2008
3. Arbeitsverträge unter Angehörigen müssen strenge<br />
Anforderungen erfüllen<br />
Lohnzahlungen an einen im Betrieb des Steuerpflichtigen mitarbeitenden<br />
Angehörigen können als Betriebsausgaben steuerlich<br />
angesetzt werden, wenn er aufgrund eines Arbeitsvertrags beschäftigt<br />
wird, die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbringt und der<br />
Steuerpflichtige seinerseits alle Arbeitgeberpflichten, insbesondere die<br />
der pünktlichen und regelmäßigen Lohnzahlung erfüllt.<br />
Bei Angehörigen muss jedoch ganz besonders sichergestellt sein, dass<br />
die Vertragsbeziehung und die auf ihr beruhenden Leistungen<br />
tatsächlich dem betrieblichen und nicht - z. B. als Unterhaltsleistungen<br />
- dem privaten Bereich zuzurechnen sind. Indizmerkmal<br />
für die Zuordnung der Vertragsbeziehungen zum betrieblichen Bereich<br />
ist insbesondere, ob der Vertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch<br />
nach seiner tatsächlichen Durchführung dem entspricht, was zwischen<br />
Fremden üblich ist.<br />
Ist die vom Arbeitnehmer zu erbringende Arbeitsleistung im Vertrag<br />
nicht im Einzelnen festgelegt, so steht dies der steuerlichen<br />
Anerkennung des Vertrags dann nicht entgegen, wenn die Leistung<br />
bestimmbar ist. Die Zulässigkeit mündlicher Absprachen zum Einsatz<br />
des Arbeitnehmers im Falle fehlender schriftlicher Fixierung der<br />
Modalitäten des Arbeitseinsatzes folgt darauf, dass ein Arbeitsvertrag<br />
weder unter fremden Dritten noch unter Angehörigen schriftlich<br />
abgeschlossen werden muss, um wirksam zu sein, bzw. anerkannt zu<br />
werden; die Schriftform ist aber zwecks leichteren Nachweises des<br />
Vertragsinhalts empfehlenswert.<br />
Da der Arbeitgeber die objektive Beweislast dafür trägt, das sein<br />
Angehöriger in seinem Betrieb nicht auf einer familiären Grundlage,<br />
sondern auf einer steuerlich anzuerkennenden Leistungsaustausch-<br />
beziehung tätig geworden ist, können die geltend gemachten<br />
Betriebsausgaben steuerlich dann nicht anerkannt werden, wenn es<br />
an einem Nachweis für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit fehlt.<br />
Anmerkung: Auch wenn geringfügige Abweichungen einzelner<br />
Sachverhaltsmerkmale vom Üblichen sowohl bezüglich des Vertragsinhalts<br />
als auch bezüglich der Vertragsdurchführung für sich allein<br />
nicht immer zur steuerlichen Nichtanerkennung des Arbeits-<br />
verhältnisses führen, sollten ganz besonders Verträge mit nahen<br />
Angehörigen stets schriftlich fixiert und im Detail ausgearbeitet<br />
werden, wenn sie steuerlich relevant sein sollen.<br />
Bei neuen Arbeitsverhältnissen werden die Arbeitsverträge grundsätzlich<br />
im Rahmen der sozialversicherungsrechtlichen Statusprüfung<br />
angefordert.<br />
Seite 6 - INFO 10/2008
4. Arbeitsrecht für Bauunternehmer Nr. 98<br />
„Die außerordentliche Kündigung“<br />
In der Reihe Arbeitsrecht für Bauunternehmer ist die Nr. 98 mit dem<br />
Titel „Die außerordentliche Kündigung“ erschienen. Erarbeitet wurde<br />
die Veröffentlichung von Herrn Rechtsanwalt Dr. Derk Strybny vom<br />
Zentralverband des Deutsches Baugewerbes in Berlin.<br />
Eine außerordentliche Kündigung ist eine Kündigung, bei der die für<br />
eine ordentliche Kündigung vorgeschriebene Kündigungsfrist nicht<br />
oder nicht vollständig eingehalten oder bei der ein Arbeitsverhältnis<br />
gekündigt wird, das eigentlich (d. h. „ordentlich“) nicht kündbar ist.<br />
Die außerordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers wird meistens<br />
dann vom Arbeitgeber erwogen, wenn das Verhalten des Arbeitnehmers<br />
inakzeptabel war und eine weitere Zusammenarbeit im<br />
Betrieb ab sofort ausscheidet.<br />
BERUFS- UND WEITERBILDUNG<br />
Seite 7 - INFO 10/2008<br />
- Anlage -<br />
5. Ergebnisse des Landesleistungswettbewerbs 2008 im<br />
Ausbildungszentrum Donaueschingen der südbadischen<br />
Bauwirtschaft<br />
Der praktische Leistungswettbewerb der Handwerksjugend 2008<br />
„Landesleistungswettbewerb im <strong>Fliesen</strong>-, Platten– und Mosaiklegerhandwerk“,<br />
fand am 02. Oktober 2008 in den Werkstatträumen des<br />
ABZ Donaueschingen in Donaueschingen statt. Es sind von fünf angemeldeten<br />
Kammersiegern alle fünf erschienen.<br />
Der Bewertungsausschuss mit Herrn <strong>Fliesen</strong>legermeister Willi Müller<br />
als Vorsitzenden, Herrn <strong>Fliesen</strong>legermeister Andreas Thiering als<br />
Meisterbeisitzer und Herrn Detlef Schmidt als Gesellenvertreter, hat<br />
folgendes Ergebnis festgestellt:<br />
1. Landessieger Michael Lugibihl<br />
Georg-Schorpp-Str. 29, 72160 Horb<br />
(Innung Reutlingen)<br />
Lehrbetrieb: Firma Robert Lugibihl, Georg-Schorpp-Str. 29,<br />
72160 Horb<br />
2. Landessieger Tobias Schauz<br />
Christianstr. 25, 89567 Sontheim<br />
(Innung Ulm)<br />
Lehrbetrieb: Firma Bernhard Schauz, Gundelfinger Str. 27,<br />
89567 Sontheim<br />
3. Landessieger Stefan Michels<br />
Burgstr. 2, 79353 Bahlingen<br />
(Innung Freiburg)<br />
Lehrbetrieb: Firma <strong>Fliesen</strong>-Häuber GmbH, Hirschmatten 4,<br />
79353 Bahlingen
Der Landessieger nimmt vom 08. - 10. November 2008 in<br />
Mölln am Bundesleistungswettbewerb teil.<br />
Wir gratulieren auch von dieser Stelle aus, den Landessiegern zu dem<br />
hervorragenden Ergebnis.<br />
Dem 1. Landessieger wünschen wir „gutes Gelingen“ in Mölln.<br />
6. Berufsbildung im Baugewerbe - Statistik<br />
Aus den statistischen Zahlen der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse<br />
der Bauwirtschaft, Wiesbaden, sowie der Sozialkassen des Berliner<br />
Baugewerbes über die Berufsausbildung im Baugewerbe (Stand:<br />
30. September 2008) ergibt sich folgende Entwicklung:<br />
I. Alte Bundesländer<br />
1. Am 30. September 2007 waren 29.244 Ausbildungsplätze<br />
registriert. Diese Zahl erhöhte sich bis zum 30. September 2008<br />
um 625 = 2,1 % auf 29.869.<br />
2. Die Zahl der Lehrlinge im 1. Lehrjahr verringerte sich von 8.395<br />
um 466 = 5,6 % auf 7.929.<br />
3. Die Zahl der Lehrlinge im 2. Lehrjahr erhöhte sich von 11.141 um<br />
549 = 4,9 % auf 11.690.<br />
4. Die Zahl der Lehrlinge im 3. und 4. Lehrjahr (einschließlich<br />
derjenigen, die eine Wiederholungsprüfung ablegen müssen)<br />
erhöhte sich von 9.708 um 542 = 5,6 % auf 10.250.<br />
5. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe hat sich von 12.883<br />
um 1 = 0,01 % auf 12.884 erhöht.<br />
6. Die Leistungen der Kasse an Ausbildungsbetriebe (Erstattung der<br />
Ausbildungsvergütungen, der überbetrieblichen Ausbildungskosten,<br />
der Fahrtkosten sowie der Urlaubsvergütungen) erhöhten sich in<br />
der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2008 gegenüber<br />
dem Vorjahreszeitraum von 143,8 Mio Euro um 10,9 Mio Euro =<br />
7,6 % auf 154,7 Mio Euro.<br />
II. Neue Bundesländer<br />
1. Am 30. September 2007 waren 5.811 Ausbildungsverhältnisse<br />
registriert. Diese Zahl verringerte sich bis zum 30. September<br />
2008 um 267 = 4,6 % auf 5.544.<br />
2. Die Zahl der Lehrlinge im 1. Lehrjahr verringerte sich von 1.929<br />
um 346 = 17,9 % auf 1.583.<br />
3. Die Zahl der Lehrlinge im 2. Lehrjahr erhöhte sich von 2.147 um<br />
63 = 2,9 % auf 2.210.<br />
4. Die Zahl der Lehrlinge im 3. und 4. Lehrjahr (einschließlich<br />
derjenigen, die eine Wiederholungsprüfung ablegen müssen)<br />
erhöhte sich von 1.735 um 16 = 0,9 % auf 1.751.<br />
5. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe verringerte sich von 2.140<br />
um 125 =5,8 % auf 2.015.<br />
Seite 8 - INFO 10/2008
6. Die Leistungen der Kasse an Ausbildungsbetriebe (Erstattung der<br />
Ausbildungsvergütungen, der überbetrieblichen Ausbildungskosten,<br />
der Fahrtkosten sowie der Urlaubsvergütungen) erhöhten sich in<br />
der Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2008 gegenüber<br />
dem Vorjahreszeitraum von 27,7 Mio. Euro um 1,5 Mio. Euro = 5,4<br />
% auf 29,2 Mio. Euro.<br />
III. Alte und neue Bundesländer (ohne Berlin)<br />
Am 30. September 2007 waren 35.055 Ausbildungsverhältnisse registriert.<br />
Diese Zahl erhöhte sich bis zum 30. September 2008 um<br />
358 = 1,0 % auf 35.413.<br />
Die Zahl der Ausbildungsbetriebe hat sich von 15.023 um 124 =<br />
0,8 % auf 14.899 verringert.<br />
Die Leistungen der Kasse an Ausbildungsbetriebe erhöhten sich in der<br />
Zeit vom 1. Januar bis zum 30. September 2008 gegenüber dem Vorjahreszeitraum<br />
von 171,5 Mio. Euro um 12,4 Mio. Euro = 7,2 % auf<br />
183,9 Mio. Euro.<br />
IV. Land Berlin<br />
In Berlin erhöhte sich die Zahl der registrierten Ausbildungsverhältnisse<br />
von 558 um 83 = 14,9 % auf 641.<br />
RECHT<br />
7. Steuerberater muss Hinweise geben -<br />
Schadensersatz wenn er es nicht tut<br />
Ein Steuerberater ist verpflichtet, im Rahmen seines Auftrags<br />
seinen Mandanten grundsätzlich ungefragt auf jede für ihn erkennbare<br />
Gefahr einer Steuerbelastung hinzuweisen, der<br />
durch geeignete Maßnahmen und Empfehlungen entgegengewirkt<br />
werden kann.<br />
Das gilt nach Ansicht der Richter auch für die Gefahr der Besteuerung<br />
eines geldwerten Vorteils wegen vermuteter Privatnutzung<br />
eines Firmenfahrzeugs.<br />
Ein Steuerberater ist daher verpflichtet, dem Mandanten zu<br />
empfehlen, für jedes Fahrzeug, für das die 1-%-Besteuerung<br />
vermieden werden soll, ein Fahrtenbuch zu führen.<br />
Mandantenrundschreiben reicht nicht aus<br />
Durch die Versendung eines Mandantenrundschreibens erfüllt ein<br />
Steuerberater die ihm obliegenden Hinweispflichten nicht ausreichend.<br />
Der Steuerberater schuldet eine konkrete, auf die speziellen<br />
Probleme des Mandanten bezogene Belehrung; allgemeine Ausführungen<br />
zur „privaten Kfz-Nutzung“ in einem Mandantenrundschreiben<br />
können konkrete Hinweise jedoch nicht ersetzen.<br />
Seite 9 - INFO 10/2008
Vermögensschaden tritt erst mit Zugang des Bescheids ein<br />
Wenn der Steuerberater einen Rat oder Hinweis pflichtwidrig unterlassen<br />
hat und das sich in einem für den Mandanten nachteiligen Steuerbescheid<br />
niederschlägt, tritt eine als Schaden anzusehende Verschlechterung<br />
der Vermögenslage des Mandanten grundsätzlich erst<br />
mit dem Zugang des Bescheids ein. Es kommt dabei nicht darauf an,<br />
welcher Art der vom Steuerberater zu verantwortende, für den erwarteten<br />
nachteiligen Steuerbescheid ursächlich gewordene Fehler ist.<br />
Nach diesen Grundsätzen beginnt die Verjährungsfrist hinsichtlich eines<br />
vom Mandanten geltend gemachten Steuerschadens erst mit der<br />
Bekanntgabe der Steuerbescheide zu laufen.<br />
Quelle: Oberlandesgericht Düsseldorf, I-23U-64/07, Urteil vom<br />
29.01.2008<br />
STEUERN<br />
8. Rückstellungen für die Kosten zur Aufbewahrung von<br />
Geschäftsunterlagen - Mit den Aufbewahrungskosten<br />
lassen sich Steuern sparen -<br />
Ein Kaufmann ist nach Handels- und Steuerrecht verpflichtet, bestimmte<br />
Geschäftsunterlagen aufzubewahren (§ 25/HGB, § 147 Abgabenordnung).<br />
Mit der Aufbewahrung gehen Kosten einher, z. B. für<br />
den Archivraum, Regale, Lagerbehältnisse, Schränke etc. Für die zu<br />
erwartenden Aufwendungen ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten<br />
zu bilden. Die Passivierungspflicht besteht sowohl in<br />
der Handelsbilanz als auch über den Maßgeblichkeitsgrundsatz in der<br />
Steuerbilanz. Da der Aufwand Jahr für Jahr anfällt, summiert er sich,<br />
und es fallen beträchtliche Kosten an. Mit den Rückstellungen für diese<br />
Aufbewahrungskosten lassen sich daher Steuern sparen, allerdings<br />
ist die Berechnung der Rückstellungen sehr zeitaufwändig.<br />
Aufbewahrungsfristen berücksichtigen<br />
Die unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen der Unterlagen sind zu<br />
beachten. Für empfangene Geschäftsbriefe und Kopien der versandten<br />
Handelsbriefe gilt eine Frist von sechs Jahren, für Eröffnungsbilanzen,<br />
Jahresabschlüsse, sämtliche Buchungsbelege (Ausgangs-, Eingangsrechnungen,<br />
Bankauszüge u. a.) eine Frist von 10 Jahren. Werden<br />
empfangene Handels- und Geschäftsbriefe und Kopien davon in<br />
Form einer Offenen-Posten-Buchhaltung geführt, so ersetzen sie die<br />
Handelsbücher, Bücher und Aufzeichnungen mit der Konsequenz der<br />
10-jährigen Aufbewahrungspflicht.<br />
Da Unternehmen die elektronischen Buchführungsdaten für die<br />
Finanzverwaltung unverzüglich digital lesbar vorzuhalten haben, können<br />
z. B. auch die in diesem Zusammenhang veranlassten Kosten für<br />
Wartung und Pflege der EDV und Digitalisierungs- und Brennvorgänge<br />
ebenfalls in die Rückstellung mit einbezogen werden. Bei einer freiwilligen<br />
Aufbewahrung über den 6- bzw. 10-jahres-Zeitraum hinaus ist<br />
der Aufwand dagegen nicht berücksichtigungsfähig.<br />
Seite 10 - INFO 10/2008
Höhe der Rückstellung<br />
Die Rückstellung ist in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags<br />
zu bilden. Eine Rückstellung kann nur noch für bestehende Aufbewahrungspflichten<br />
gebildet werden. Daher sind die für die Aufbewahrung<br />
anfallenden Kosten danach zu berücksichtigen, welche Unterlagen tatsächlich<br />
aufbewahrungspflichtig sind und wie lange die Aufbewahrungspflicht<br />
noch besteht. Es sind also die künftigen Aufwendungen<br />
zu ermitteln, die für die am Bilanzstichtag vorhandenen Geschäftsunterlagen<br />
während der gesamten Aufbewahrungszeit anfallen werden.<br />
Der Rückstellungsansatz bemisst sich nach den geschätzten Kosten.<br />
Diese können entweder für die Unterlagen eines jeden Jahres gesondert<br />
ermittelt werden oder mit der Anzahl der bis zum Ablauf der Aufbewahrungspflicht<br />
verbleibenden Jahre multipliziert werden oder z. B.<br />
bei laufenden Gemeinkosten (wie bei einem Archivraum) durch Multiplikation<br />
mit 5,5 (arithmetisches Mittel der Jahre 1 - 10). Einmalige<br />
Kosten (wie bei Einlagerung, Mikroverfilmung) sind hingegen nicht zu<br />
vervielfältigen.<br />
Sind Feststellungen zur Zusammensetzung der aufbewahrten Unterlagen<br />
im Einzelfall nicht oder nur unter erheblichem Aufwand möglich,<br />
bestehen nach Ansicht der Oberfinanzdirektion Hannover (Schreiben<br />
vom 27. Juni 2007) keine Bedenken, für Unterlagen, zu deren Archivierung<br />
der Unternehmer nicht verpflichtet ist, einen Abschlag von<br />
20 % von den Gesamtkosten vorzunehmen.<br />
Kosten für die Aufbewahrung<br />
Werden für die Aufbewahrung der Unterlagen Räume gemietet, sind<br />
die anteiligen Mietaufwendungen zugrunde zu legen, bei Nutzung eigener<br />
Räume anteilig die Gebäudeabschreibung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung,<br />
Instandhaltungskosten, Reparaturkosten, Heizung,<br />
Strom. Der Aufwand kann i. d. R. aus Vereinfachungsgründen entsprechend<br />
dem Verhältnis der Nutzfläche des Archivs zur Gesamtfläche<br />
ermittelt werden.<br />
Bei den Energiekosten ist darauf ein Abschlag von 60 - 80 % vorzunehmen,<br />
wegen der i. d. R. geringeren Temperaturen im Vergleich zu<br />
den übrigen Räumen. Diese Kostenaufwendungen sind jährlich zu ermitteln.<br />
Ferner können Einrichtungsgegenstände (z. B. Regale und<br />
Schränke) abgeschrieben werden, es sei denn, diese sind bereits abgeschrieben.<br />
Nach Ansicht der OFD Münster wird davon ausgegangen,<br />
dass die Archivierung dann weiterhin mit den vorhandenen Regalsystemen<br />
erfolgt. Auch anteilige Personalkosten für Hausmeister, Reinigung<br />
und Lesbarmachung der Datenbestände sind berücksichtigungsfähig.<br />
Die Aufwendungen für die Einlagerung, Mikroverfilmung, Digitalisierung<br />
und Datensicherung fallen nur einmal an, sie sind deshalb<br />
nicht zu vervielfältigen.<br />
Nicht rückstellungsfähig sind gem. der Verfügung der OFD Münster<br />
die anteiligen Finanzierungskosten für die Archivräume, die Kosten für<br />
die zukünftige Anschaffung von zusätzlichen Regalen und Ordnern,<br />
die Kosten für die Entsorgung der Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist<br />
und die Kosten für die Einlagerung künftig entstehender<br />
Unterlagen.<br />
Ein Berechnungsbeispiel ist als Anlage beigefügt.<br />
Seite 11 - INFO 10/2008<br />
- Anlage -
TECHNIK<br />
9. Handbuch Technik 7. Auflage ist erschienen<br />
Mit dem Handbuch für das <strong>Fliesen</strong>gewerbe Technik 2008 veröffentlichte<br />
der Fachverband <strong>Fliesen</strong> und Naturstein im ZDB sein technisches<br />
Standardwerk in der 7. Auflage. Es enthält alle für das <strong>Fliesen</strong>-, Platten-<br />
und Mosaiklegerhandwerk und benachbarte Gewerke, wie Betonwerkstein,<br />
Estrich und Belag sowie das Steinmetzhandwerk relevanten<br />
Merkblätter, ATV´en und Normen. Darüber hinaus sind im Handbuch<br />
für das <strong>Fliesen</strong>gewerbe Technik 2008 ebenfalls Informationen<br />
und Praxisempfehlungen, z. B. zur Abrechnung und Bewertung von<br />
spezifischen Bauweisen und Details, u. a. Schallschutz in Bädern,<br />
Fensteranschlüssen und Oberflächeneigenschaften von <strong>Fliesen</strong> zu finden.<br />
Zahlreiche Merkblätter wurden überarbeitet und aktualisiert bzw.<br />
neu aufgenommen. Darüber hinaus sind auch Merkblattentwürfe enthalten,<br />
um den Anwender über den aktuellen Stand der Diskussion zu<br />
informieren. Der Bereich Naturstein wurde ebenso noch stärker bei<br />
der Aufnahme von Regelwerken berücksichtigt. Das Handbuch für das<br />
<strong>Fliesen</strong>gewerbe Technik 2008 umfasst 470 Seiten.<br />
Unsere Mitglieder erhalten dieses Handbuch Technik mit dem Fach-<br />
Info 10/2008.<br />
Bitte beachten Sie:<br />
Die Mitglieder aus der Innung Karlsruhe erhalten, auf besonderen<br />
Wunsch Ihres Obermeisters, dieses Handbuch von Ihrer Innungsgeschäftsstelle.<br />
- Anlage -<br />
Persönlichkeiten werden nicht durch<br />
schöne Reden geformt, sondern<br />
durch Arbeit und eigene Leistung.<br />
Albert Einstein<br />
Seite 12 - INFO 10/2008