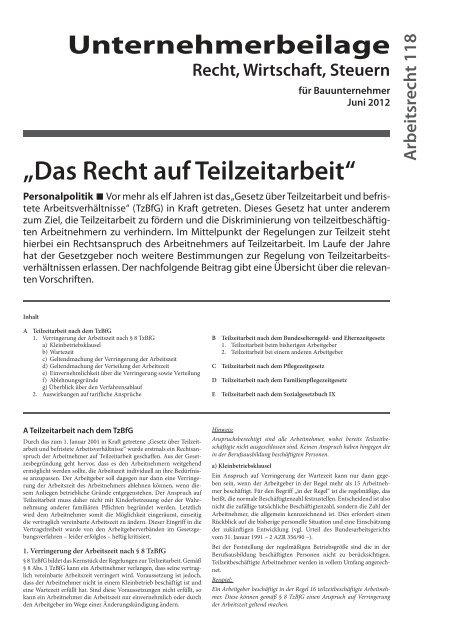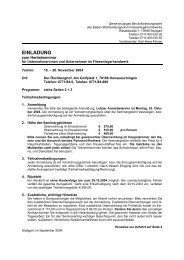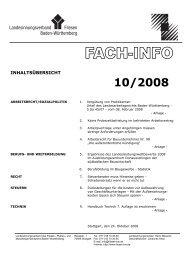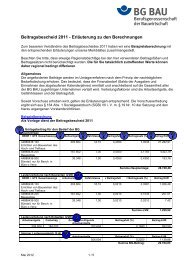„Das Recht auf Teilzeitarbeit“ Unternehmerbeilage
„Das Recht auf Teilzeitarbeit“ Unternehmerbeilage
„Das Recht auf Teilzeitarbeit“ Unternehmerbeilage
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>„Das</strong> <strong>Recht</strong> <strong>auf</strong> <strong>Teilzeitarbeit“</strong><br />
Personalpolitik Vor mehr als elf Jahren ist das „Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete<br />
Arbeitsverhältnisse“ (TzBfG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz hat unter anderem<br />
zum Ziel, die Teilzeitarbeit zu fördern und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten<br />
Arbeitnehmern zu verhindern. Im Mittelpunkt der Regelungen zur Teilzeit steht<br />
hierbei ein <strong>Recht</strong>sanspruch des Arbeitnehmers <strong>auf</strong> Teilzeitarbeit. Im L<strong>auf</strong>e der Jahre<br />
hat der Gesetzgeber noch weitere Bestimmungen zur Regelung von Teilzeitarbeitsverhältnissen<br />
erlassen. Der nachfolgende Beitrag gibt eine Übersicht über die relevanten<br />
Vorschriften.<br />
Inhalt<br />
<strong>Unternehmerbeilage</strong><br />
A Teilzeitarbeit nach dem TzBfG<br />
1. Verringerung der Arbeitszeit nach § 8 TzBfG<br />
a) Kleinbetriebsklausel<br />
b) Wartezeit<br />
c) Geltendmachung der Verringerung der Arbeitszeit<br />
d) Geltendmachung der Verteilung der Arbeitszeit<br />
e) Einvernehmlichkeit über die Verringerung sowie Verteilung<br />
f) Ablehnungsgründe<br />
g) Überblick über den Verfahrensabl<strong>auf</strong><br />
2. Auswirkungen <strong>auf</strong> tarifliche Ansprüche<br />
A Teilzeitarbeit nach dem TzBfG<br />
Durch das zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene „Gesetz über Teilzeitarbeit<br />
und befristete Arbeitsverhältnisse“ wurde erstmals ein <strong>Recht</strong>sanspruch<br />
der Arbeitnehmer <strong>auf</strong> Teilzeitarbeit geschaffen. Aus der Gesetzesbegründung<br />
geht hervor, dass es den Arbeitnehmern weitgehend<br />
ermöglicht werden sollte, die Arbeitszeit individuell an ihre Bedürfnisse<br />
anzupassen. Der Arbeitgeber soll dagegen nur dann eine Verringerung<br />
der Arbeitszeit des Arbeitnehmers ablehnen können, wenn diesem<br />
Anliegen betriebliche Gründe entgegenstehen. Der Anspruch <strong>auf</strong><br />
Teilzeitarbeit muss daher nicht mit Kinderbetreuung oder der Wahrnehmung<br />
anderer familiären Pflichten begründet werden. Letztlich<br />
wird dem Arbeitnehmer somit die Möglichkeit eingeräumt, einseitig<br />
die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu ändern. Dieser Eingriff in die<br />
Vertragsfreiheit wurde von den Arbeitgeberverbänden im Gesetzgebungsverfahren<br />
– leider erfolglos – heftig kritisiert.<br />
1. Verringerung der Arbeitszeit nach § 8 TzBfG<br />
§ 8 TzBfG bildet das Kernstück der Regelungen zur Teilzeitarbeit. Gemäß<br />
§ 8 Abs. 1 TzBfG kann ein Arbeitnehmer verlangen, dass seine vertraglich<br />
vereinbarte Arbeitszeit verringert wird. Voraussetzung ist jedoch,<br />
dass der Arbeitnehmer nicht in einem Kleinbetrieb beschäftigt ist und<br />
eine Wartezeit erfüllt hat. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so<br />
kann ein Arbeitnehmer die Arbeitszeit nur einvernehmlich oder durch<br />
den Arbeitgeber im Wege einer Änderungskündigung ändern.<br />
<strong>Recht</strong>, Wirtschaft, Steuern<br />
B Teilzeitarbeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz<br />
1. Teilzeitarbeit beim bisherigen Arbeitgeber<br />
2. Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber<br />
C Teilzeitarbeit nach dem Pflegezeitgesetz<br />
D Teilzeitarbeit nach dem Familienpflegezeitgesetz<br />
E Teilzeitarbeit nach dem Sozialgesetzbuch IX<br />
für Bauunternehmer<br />
Juni 2012<br />
Hinweis:<br />
Anspruchsberechtigt sind alle Arbeitnehmer, wobei bereits Teilzeitbeschäftigte<br />
nicht ausgeschlossen sind. Keinen Anspruch haben hingegen die<br />
in der Berufsausbildung beschäftigten Personen.<br />
a) Kleinbetriebsklausel<br />
Ein Anspruch <strong>auf</strong> Verringerung der Wartezeit kann nur dann gegeben<br />
sein, wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer<br />
beschäftigt. Für den Begriff „in der Regel“ ist die regelmäßige, das<br />
heißt, die normale Beschäftigtenzahl festzustellen. Entscheidend ist also<br />
nicht die zufällige tatsächliche Beschäftigtenzahl, sondern die Zahl der<br />
Arbeitnehmer, die allgemein kennzeichnend ist. Dies erfordert einen<br />
Rückblick <strong>auf</strong> die bisherige personelle Situation und eine Einschätzung<br />
der zukünftigen Entwicklung (vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichts<br />
vom 31. Januar 1991 – 2 AZR 356/90 –).<br />
Bei der Feststellung der regelmäßigen Betriebsgröße sind die in der<br />
Berufsausbildung beschäftigten Personen nicht zu berücksichtigen.<br />
Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer werden in vollem Umfang angerechnet.<br />
Beispiel:<br />
Ein Arbeitgeber beschäftigt in der Regel 16 teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer.<br />
Diese können gemäß § 8 TzBfG einen Anspruch <strong>auf</strong> Verringerung<br />
der Arbeitszeit geltend machen.<br />
Arbeitsrecht 118
Arbeitsrecht 118<br />
b) Wartezeit<br />
Ein Arbeitnehmer kann von seinem <strong>Recht</strong>sanspruch <strong>auf</strong> Verringerung<br />
der Arbeitszeit erst Gebrauch machen, wenn sein Arbeitsverhältnis<br />
länger als sechs Monate bestanden hat. Maßgeblich ist der rechtliche<br />
Bestand des Arbeitsverhältnisses. Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer<br />
tatsächlich gearbeitet hat. Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis<br />
ruht, sind ebenfalls zu berücksichtigen. Hat mit demselben Arbeitgeber<br />
bereits früher ein Arbeitsverhältnis bestanden, so sind diese Zeiten <strong>auf</strong><br />
die Wartezeit anzurechnen, wenn das Arbeitsverhältnis in einem engen<br />
sachlichen Zusammenhang mit dem früheren Arbeitsverhältnis steht.<br />
Ein unmittelbar vorausgehendes Berufsausbildungsverhältnis ist wohl<br />
ebenfalls anzurechnen.<br />
Hinweis:<br />
Der Arbeitnehmer muss den Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber gemäß<br />
§ 8 Abs. 2 Satz 1 TzBfG drei Monate vor dem gewünschten Beginn der<br />
Verringerung der Arbeitszeit geltend machen. Da der Arbeitnehmer die<br />
Verringerung aber erst nach der sechsmonatigen Wartezeit verlangen<br />
kann und diese Wartezeit im Zeitpunkt des Verlangens abgel<strong>auf</strong>en sein<br />
muss, bedeutet dies faktisch eine Zeit von neun Monaten, bis die Teilzeit<br />
beginnen kann.<br />
c) Geltendmachung der Verringerung der Arbeitszeit<br />
Gemäß § 8 Abs. 2 TzBfG muss ein Arbeitnehmer die Verringerung<br />
seiner vertraglichen Arbeitszeit und den Umfang der Verringerung<br />
spätes tens drei Monate vor deren Beginn geltend machen. Der Arbeitnehmer<br />
kann z.B. die Stundenzahl, die er weniger arbeiten will oder die<br />
gewünschte neue Stundenzahl, angeben. Gibt der Arbeitnehmer lediglich<br />
nur einen Arbeitszeitrahmen vor (z.B. 20 bis 25 Wochenstunden),<br />
ist das Änderungsverlangen nicht hinreichend bestimmt (vgl. Urteil des<br />
Landesarbeitsgerichts Köln vom 14. Oktober 2009 – 9 Sa 824/09 –).<br />
Eine Mindest- oder Höchstgrenze sieht das Gesetz nicht vor. Der Arbeitnehmer<br />
kann daher sowohl nur eine geringfügige Verringerung seiner<br />
Arbeitszeit (z.B. von bisher durchschnittliche regelmäßige 40 Stunden<br />
pro Woche <strong>auf</strong> zukünftige 38 Stunden pro Woche) als auch erhebliche<br />
Verringerungen seiner Arbeitszeit (z.B. von regelmäßig 40 Stunden pro<br />
Woche <strong>auf</strong> nur noch 20 Stunden pro Woche) geltend machen.<br />
Der Arbeitnehmer muss zudem nicht angeben, aus welchen Gründen<br />
er eine Verringerung der Arbeitszeit herbeiführen möchte.<br />
Wichtig:<br />
Der Anspruch <strong>auf</strong> Teilzeitarbeit kann auch durch Arbeitnehmer geltend<br />
gemacht werden, die bereits in Teilzeit arbeiten und nunmehr<br />
eine weitere Verringerung der Arbeitszeit wünschen. Das Gesetz sieht<br />
jedoch ausdrücklich vor, dass der Arbeitnehmer eine erneute Verringerung<br />
der Arbeitszeit frühestens nach Abl<strong>auf</strong> von zwei Jahren verlangen<br />
kann, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt oder<br />
sie berechtigterweise abgelehnt hat. Der Arbeitgeber ist somit gegen<br />
ein erneutes Verringerungsbegehren für die Dauer von zwei Jahren<br />
geschützt.<br />
d) Geltendmachung der Verteilung der Arbeitszeit<br />
Zudem soll der Arbeitnehmer die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit<br />
angeben (§ 8 Abs. 2 TzBfG).<br />
Beispiel:<br />
Ein Arbeitnehmer verlangt die Verringerung seiner bisherigen wöchentlichen<br />
Arbeitszeit von durchschnittlich regelmäßig 40 Stunden <strong>auf</strong> zukünftig<br />
nur noch 30 Stunden. Gleichzeitig äußert er den Wunsch, diese Arbeitsleistung<br />
von 30 Stunden zukünftig nur noch an den Tagen Montag bis<br />
Donnerstag zu erbringen. Der Freitag soll hingegen arbeitsfrei bleiben.<br />
Diese Angabe nach der gewünschten Verteilung der Arbeitszeit ist<br />
jedoch nicht zwingend. Verfolgt der Arbeitnehmer nur einen Teilzeitanspruch<br />
bzgl. des Umfangs der Arbeitszeit, so steht die Verteilung der<br />
Arbeitszeit dann grundsätzlich im Ermessen des Arbeitgebers (Urteil<br />
des Bundesarbeitsgerichts vom 18. Mai 2004 – 9 AZR 319/03 –).<br />
e) Einvernehmlichkeit über die Verringerung sowie Verteilung<br />
Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung<br />
der Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu<br />
gelangen. Zudem hat er mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über die<br />
von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen (§ 8 Abs.<br />
3 TzBfG). Diese Gesetzesformulierung bringt zum Ausdruck, dass vom<br />
Gesetzgeber vorrangig eine Verhandlungslösung gewollt ist.<br />
Lehnt der Arbeitgeber hingegen den Antrag des Arbeitnehmers ab,<br />
ohne verhandelt zu haben, führt dieser Verstoß gegen die Verhandlungsobliegenheit<br />
nicht zur Unwirksamkeit der Ablehnung. Insbesondere<br />
führt dies auch nicht zu einer Fiktion der Zustimmung des Arbeitgebers<br />
und damit zu einer Änderung des Arbeitsvertrages. Der Arbeitgeber<br />
kann dem Arbeitnehmer dann jedoch in einem sich womöglich<br />
später anschließenden gerichtlichen Verfahren keine Einwendungen<br />
entgegenhalten, die im Rahmen einer Verhandlung hätten ausgeräumt<br />
werden können, wenn er entgegen der Vorschrift nicht verhandelt (vgl.<br />
hierzu das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18. Februar 2003 – 9<br />
AZR 356/02 –).<br />
Hinweis:<br />
Der Arbeitgeber sollte daher grundsätzlich das in § 8 Abs. 3 TzBfG vorgesehene<br />
Gespräch in Anwesenheit von Zeugen durchführen und dokumentieren.<br />
Kommt es schließlich zu einem Verhandlungsergebnis, so sollte<br />
dieses Resultat schriftlich fixiert und unterzeichnet werden.<br />
f) Ablehnungsgründe<br />
Der Arbeitgeber kann das Teilzeitverlangen jedoch nur ablehnen, wenn<br />
dem Verlangen betriebliche Gründe entgegenstehen. In der gesetzlichen<br />
Vorschrift des § 8 Abs. 4 Satz 2 TzBfG findet sich eine beispielhafte<br />
Aufzählung, wann ein derartiger betrieblicher Grund vorliegen<br />
soll. Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die<br />
Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsabl<strong>auf</strong> oder<br />
die Sicherheit des Betriebes wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige<br />
Kosten verursacht. Durch die exemplarische Nennung dieser<br />
Ablehnungsgründe wird deutlich, dass einerseits der Arbeitgeber<br />
vor Überforderungen geschützt wird, andererseits aber nicht jeder<br />
Ablehnungsgrund ausreichen soll. Es soll sich vielmehr um rationale,<br />
nachvollziehbare Gründe von gewissem Gewicht handeln. Neben den<br />
genannten Gründen können also auch weitere Umstände betriebliche<br />
Gründe darstellen. Sie betreffen sowohl die Verringerung der Arbeitszeit<br />
als auch deren Verteilung.<br />
• Dreistufige Prüfungsfolge des Bundesarbeitsgerichts<br />
Ausgangspunkt zur Beurteilung des Vorliegens eines betrieblichen<br />
Grundes im Sinne des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ist das vom<br />
Bundesarbeitsgericht entwickelte dreistufige Prüfungsschema (Urteil<br />
des Bundesarbeitsgerichts vom 18. Februar 2003 – 9 AZR 164/02 –):<br />
In der ersten Stufe ist festzustellen, ob überhaupt und wenn ja, welches<br />
betriebliche Organisationskonzept der vom Arbeitgeber als erforderlich<br />
angesehene Arbeitszeitregelung zugrunde liegt. Organisationskonzept<br />
ist das Konzept, mit dem die unternehmerische Aufgabenstellung im<br />
Betrieb verwirklicht werden soll. Die Darlegungslast dafür, dass das<br />
Organisationskonzept die Arbeitszeitregelung bedingt, liegt beim<br />
Arbeitgeber. Die Richtigkeit seines Vortrags ist arbeitsgerichtlich voll<br />
überprüfbar. Die dem Organisationskonzept zugrunde liegende unternehmerische<br />
Aufgabenstellung und die daraus abgeleiteten organisatorischen<br />
Entscheidungen sind jedoch hinzunehmen, soweit sie nicht<br />
willkürlich sind. Voll überprüfbar ist dagegen, ob das vorgetragene<br />
Konzept auch tatsächlich im Betrieb durchgeführt wird.<br />
In einer zweiten Stufe ist zu prüfen, inwieweit die Arbeitszeitregelung<br />
dem Arbeitszeitverlangen des Arbeitnehmers tatsächlich entgegensteht.<br />
Dabei ist auch der Frage nachzugehen, ob durch eine dem Arbeitgeber<br />
zumutbare Änderung von betrieblichen Abläufen oder des Personaleinsatzes<br />
der betrieblich als erforderlich angesehene Arbeitszeitbedarf<br />
unter Wahrung des Organisationskonzepts mit dem individuellen<br />
Arbeitszeitwunsch des Arbeitnehmers zur Deckung gebracht werden<br />
kann.<br />
Ergibt sich, dass das Arbeitszeitverlangen des Arbeitnehmers nicht mit<br />
dem organisatorischen Konzept und der daraus folgenden Arbeitszeitregelung<br />
in Übereinstimmung gebracht werden kann, ist in einer dritten<br />
Stufe das Gewicht der entgegenstehenden betrieblichen Gründe zu<br />
prüfen.<br />
Danach kann der Teilzeitantrag nur dann erfolgreich abgelehnt werden,<br />
wenn ein durch die jeweilige Aufgabenstellung des Betriebes begründbares<br />
Organisationskonzept keine andere Verteilung der Arbeitszeit<br />
zulässt und die vorzunehmende Interessenabwägung keine andere<br />
Wertung ergibt.<br />
• Einzelne betriebliche Gründe<br />
Dabei kommen entsprechend der gesetzlichen Vorschrift verschiedene<br />
Gründe in Betracht:<br />
• Beeinträchtigung der Organisation, des Arbeitsabl<strong>auf</strong>s und der Sicherheit<br />
im Betrieb<br />
Gründe des Arbeitsabl<strong>auf</strong>s lassen sich häufig nicht von denjenigen<br />
Gründen der Arbeitsorganisation trennen. Regelmäßig wird eine<br />
Beeinträchtigung des Arbeitsabl<strong>auf</strong>s auch eine Beeinträchtigung der<br />
Organisation darstellen.<br />
So können zum Beispiel unverhältnismäßig lange Übergabezeiten<br />
oder notwendige Maschinenl<strong>auf</strong>zeiten betriebliche Gründe darstellen.<br />
Betriebliche Gründe sind jedoch auch dann anzuerkennen, wenn<br />
die gewünschte Verringerung zu einer erheblichen Störung tariflicher<br />
Arbeitszeitmodelle führen würde. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts<br />
kann dies beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Arbeitgeber<br />
den Arbeitnehmer, der den Teilzeitwunsch stellt, nicht mit seiner
gesamten Arbeitszeit einsetzen kann (vgl. hierzu Urteil des Bundesarbeitsgerichts<br />
vom 13. November 2007– 9 AZR 36/07 –).<br />
• Unverhältnismäßige Kosten<br />
Unverhältnismäßige Kosten wird man nicht erst dann bejahen, wenn<br />
der Arbeitgeber durch die Arbeitszeitreduzierung in eine wirtschaftliche<br />
Zwangslage gerät. Eine unverhältnismäßige Kostenbelastung kann<br />
beispielsweise schon dann gegeben sein, wenn der Arbeitgeber zur Ausführung<br />
der freiwerdenden Arbeitskapazität neue, sehr kostspielige,<br />
zusätzliche Betriebsmittel anschaffen oder aber eine nur in sehr geringem<br />
Umfang beschäftigte Teilzeitersatzkraft mit erheblichem Aufwand<br />
einarbeiten müsse.<br />
• Sonstige Gründe<br />
Der Einwand des Arbeitgebers, er könne keine geeignete Ersatzkraft<br />
finden, kann auch einen betrieblichen Grund darstellen. Dieser könne<br />
jedoch nur beachtlich sein, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass<br />
eine dem Berufsbild des Arbeitnehmers, der eine Reduzierung seiner<br />
Arbeitszeit wünscht, entsprechende zusätzliche Teilzeitersatzkräfte <strong>auf</strong><br />
dem für ihn maßgeblichen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht<br />
(Urteil des Bundesarbeitsgericht vom 14. Oktober 2003 – 9 AZR 636/02<br />
–). Vor diesem Hintergrund sollte sich der Arbeitgeber zunächst an die<br />
Agentur für Arbeit wenden. Zum Nachweis empfiehlt es sich, sich die<br />
entsprechende Auskunft der Agentur für Arbeit schriftlich geben zu<br />
lassen.<br />
g) Überblick über den Verfahrensabl<strong>auf</strong><br />
Für den Fall, dass zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer kein<br />
Einvernehmen über eine Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit<br />
des Arbeitnehmers durch eine freiwillige Vereinbarung erlangt werden<br />
kann, sieht das Teilzeit- und Befristungsgesetz ein bestimmtes Verfahren<br />
vor.<br />
• Verlangen des Arbeitnehmers<br />
Danach hat der Arbeitnehmer sein Verlangen nach Verringerung seiner<br />
Arbeitszeit dem Arbeitgeber mindestens drei Monate vor dem<br />
gewünschten Termin des Beginns der Teilzeitarbeit mitzuteilen. Das<br />
Gesetz sieht hierbei keine besondere Form für den Antrag <strong>auf</strong> Teilzeitarbeit<br />
vor. Damit reicht auch eine mündliche Geltendmachung aus.<br />
Beispiel:<br />
Ein Arbeitnehmer will ab dem 1. Oktober 2012 seine bisherige Arbeitszeit<br />
von durchschnittlich regelmäßig 40 Stunden pro Woche <strong>auf</strong> nur noch 20<br />
Stunden pro Woche verringern, wobei die Arbeitsleistung jeweils montags<br />
bis freitags vormittags erbracht werden soll. Das Verlangen des Arbeitnehmers<br />
muss damit spätestens am 30. Juni 2012 beim Arbeitgeber geltend<br />
gemacht werden.<br />
Unklar war in der Vergangenheit, welche Folgen sich ergeben, wenn<br />
der Arbeitnehmer die Drei-Monats-Frist nicht einhält. Mit seiner<br />
Entscheidung vom 20. Juli 2004 – 9 AZR 626/03 – hat das Bundesarbeitsgericht<br />
dar<strong>auf</strong> hingewiesen, dass ein Teilzeitverlangen, das nicht<br />
die Drei-Monats-Frist einhalte, der Auslegung zugängig sei, so dass es<br />
sich hilfsweise <strong>auf</strong> den Zeitpunkt richte, zu dem der Arbeitnehmer die<br />
Reduzierung frühestmöglich verlangen könne.<br />
• Entscheidung des Arbeitgebers<br />
Der Arbeitgeber muss <strong>auf</strong> den Antrag des Arbeitnehmers schriftlich<br />
reagieren. Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und<br />
ihre Verteilung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen<br />
Monat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung schriftlich mitzuteilen.<br />
Eine Begründung ist nicht erforderlich.<br />
Als Sanktion dafür, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht<br />
rechtzeitig eine Entscheidung mitteilt, sieht § 8 Abs. 5 Satz 2 TzBfG eine<br />
gesetzliche Fiktion vor. Haben sich damit Arbeitnehmer und Arbeitgeber<br />
nicht geeinigt und erklärt der Arbeitgeber die Ablehnung gar nicht<br />
bzw. nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht, so ist die <strong>Recht</strong>sfolge die<br />
Verringerung der Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünschtem<br />
Umfang.<br />
Beispiel:<br />
Im zuvor genannten Beispielsfall muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer<br />
spätestens am 31. August 2012 seine Entscheidung mitteilen. Tut er dies<br />
nicht, so greift die gesetzliche Fiktion ein.<br />
Die gleiche Fiktionswirkung tritt auch in Hinblick <strong>auf</strong> die Lage der<br />
Arbeitszeit ein, wenn die Parteien kein Einvernehmen erzielen und der<br />
Arbeitgeber die gewünschte Verteilung nicht spätestens einen Monat<br />
vor Beginn der gewünschten Teilzeitarbeit schriftlich ablehnt.<br />
• Nachträgliche Veränderung der Verteilung<br />
Hat der Arbeitgeber der Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit<br />
zugestimmt oder erfolgte dies mangels Reaktion des Arbeitgebers nach<br />
den Wünschen des Arbeitnehmers, so kann der Arbeitgeber die Verteilung<br />
jedoch nachträglich ändern. Dies ist aber nur dann möglich, wenn<br />
das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers erheblich<br />
überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens einen<br />
Monat vorher angekündigt hat.<br />
2. Auswirkungen <strong>auf</strong> tarifliche Ansprüche<br />
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz konkretisiert den allgemeinen<br />
Gleichbehandlungsgrundsatz dahingehend, dass Arbeitsentgelt oder<br />
eine andere teilbare geldwerte Leistung teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer<br />
mindestens in jenem Umfang zu zahlen sind, der dem Anteil<br />
ihrer Arbeitszeit an der Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter<br />
Arbeitnehmer entspricht (§ 4 Abs. 1 Satz 2 TzBfG). Die Tarifvertragsparteien<br />
des Baugewerbes haben diesem Gedanken durch einzelne<br />
tarifvertragliche Regelungen Rechnung getragen:<br />
• Nach Eintritt in die Teilzeitarbeit verringert der Lohnanspruch des<br />
gewerblichen Arbeitnehmers entsprechend der verringerten Arbeitszeit.<br />
Auch der Gehaltsanspruch eines Angestellten vermindert sich im<br />
Verhältnis zur Vollzeitarbeit.<br />
• Teilzeitbeschäftigte erhalten grundsätzlich ebensoviel Urlaub wie<br />
Vollzeitbeschäftigte. Der tatsächliche Urlaubsanspruch richtet sich<br />
jedoch nach der Verteilung der Teilzeitarbeit. Ist beispielsweise eine<br />
Verteilung der Arbeit <strong>auf</strong> weniger als fünf Arbeitstage pro Woche vereinbart<br />
(z.B. drei Arbeitstage), so mindert sich der Urlaubsanspruch<br />
im Verhältnis der vereinbarten Arbeitstage zu den fünf Arbeitstagen<br />
(30 Urlaubstage : 5 x 3 = 18 Urlaubstage). Das zusätzliche tarifliche<br />
Urlaubsgeld wird gemäß § 10 Ziffer 6.2 RTV Angestellte/Poliere Teilzeitbeschäftigten<br />
nur anteilig nach Maßgabe des Verhältnisses der<br />
vertraglichen Teilzeitarbeit zur tarifvertraglichen Arbeitszeit gewährt.<br />
• Der Anspruch <strong>auf</strong> das tarifliche 13. Monatseinkommen verringert sich<br />
ebenfalls entsprechend des Umfangs der verringerten Arbeitszeit.<br />
B Teilzeitarbeit nach dem Bundeselterngeld- und<br />
Elternzeitgesetz<br />
Ein Anspruch <strong>auf</strong> Teilzeitarbeit kann sich nicht nur aus dem Teilzeit-<br />
und Befristungsgesetz, sondern auch aus anderen speziellen gesetzlichen<br />
Regelungen ergeben. Eine dieser speziellen gesetzlichen Regelungen<br />
zur Teilzeitarbeit enthält das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz<br />
(BEEG), das einem Arbeitnehmer einen Anspruch <strong>auf</strong> Teilzeitarbeit<br />
während der Elternzeit einräumt.<br />
1. Teilzeitarbeit beim bisherigen Arbeitgeber<br />
Das Gesetz sieht in § 15 Abs. 5 BEEG grundsätzlich ein formloses<br />
Einigungsverfahren zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor, das<br />
sich deutlich von dem Verfahren unterscheidet, mit dem der Arbeitnehmer<br />
seinen <strong>Recht</strong>sanspruch <strong>auf</strong> Teilzeit geltend machen kann. Für<br />
dieses einvernehmliche Einigungsverfahren zwischen Arbeitgeber und<br />
Arbeitnehmer müssen insbesondere nicht die Voraussetzungen des<br />
§ 15 Abs. 7 BEEG vorliegen.<br />
Lehnt der Arbeitgeber das Elternteilzeitverlangen hingegen ab, kann<br />
der Arbeitnehmer nach Maßgabe des § 15 Abs. 7 BEEG seinen <strong>Recht</strong>sanspruch<br />
<strong>auf</strong> Teilzeit geltend machen. Hierfür muss der Arbeitgeber,<br />
unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsausbildung, in der<br />
Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigen (Kleinbetriebsklausel).<br />
Auf Voll- oder Teilzeitbeschäftigung kommt es auch hier nicht an. Es<br />
zählen alle „Köpfe“. Zudem muss das Arbeitsverhältnis in demselben<br />
Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate<br />
bestehen (Wartezeit).<br />
Daneben ist es erforderlich, dass das Teilzeitverlangen dem Arbeitgeber<br />
sieben Wochen vor Beginn der Tätigkeit schriftlich mitgeteilt wird.<br />
Hierbei muss der Arbeitnehmer konkret den Beginn und den Umfang<br />
der verringerten Arbeitszeit angeben. Die Verteilung soll ebenfalls<br />
angegeben werden. Eine Sperrfrist entsprechend § 8 Abs. 6 TzBfG existiert<br />
nicht.<br />
Hinweis:<br />
Arbeitnehmer sind – im Gegensatz zum Teilzeit- und Befristungsgesetz –<br />
an einen bestimmten Rahmen von Arbeitsstunden gebunden. Verlangen<br />
sie keine vollständige Befreiung von der Arbeitspflicht, so ist für<br />
den Anspruch <strong>auf</strong> Verringerung der Arbeitszeit Voraussetzung, dass<br />
die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit für mindestens zwei<br />
Monate <strong>auf</strong> einen Umfang zwischen 15 und 30 Wochenstunden verringert<br />
werden.<br />
Der Arbeitgeber kann dem Verlangen des Arbeitnehmers jedoch dringende<br />
betriebliche Gründe entgegenhalten (§ 15 Abs. 7 Satz 1 Ziffer 4<br />
BEEG). Die entgegenstehenden betrieblichen Interessen müssen hierbei<br />
zwingende Hindernisse für die beantragte Verkürzung der Arbeitszeit<br />
darstellen (vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 15. Dezember<br />
2009 – 9 AZR 72/09 –). Ein dringender Grund liegt beispielsweise<br />
Arbeitsrecht 118
Arbeitsrecht 118<br />
grundsätzlich vor, wenn sich für den entfallenden Teil des Arbeitsumfanges<br />
keine Ersatzkraft finden lässt.<br />
Lehnt der Arbeitgeber die Teilzeitbeschäftigung generell oder mit dem<br />
vom Arbeitnehmer vorgeschlagenen Umfang ab, so muss er die Ablehnung<br />
innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Antrags schriftlich<br />
begründen. Versäumt er die Frist oder missachtet er die Form, wird die<br />
Zustimmung jedoch nicht fingiert. Der Arbeitnehmer muss dann vielmehr<br />
seinen Anspruch gerichtlich durchsetzen.<br />
2. Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber<br />
Will der Arbeitnehmer bei einem anderen Arbeitgeber während der<br />
Elternzeit einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, muss der Arbeitgeber<br />
der Tätigkeit zustimmen. Der Arbeitnehmer muss die Zustimmung<br />
beantragen und konkret beschreiben, welcher Tätigkeit er nachgehen<br />
möchte. Der Arbeitgeber hat dann zu prüfen, ob der Tätigkeit dringende<br />
betriebliche Gründe entgegenstehen. Die Ablehnung des Arbeitgebers<br />
bedarf der Schriftform und muss innerhalb von vier Wochen nach<br />
Zugang des Antrages erfolgen. Versäumt er diese Frist oder hält er die<br />
Schriftform nicht ein, so gilt seine Zustimmung als erteilt.<br />
C Teilzeitarbeit nach dem Pflegezeitgesetz<br />
Das Pflegezeitgesetz (PflegezeitG) eröffnet Beschäftigten die Möglichkeit,<br />
bis zu sechs Monaten Pflegezeit in Anspruch zu nehmen, um einen<br />
nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung zu pflegen. Das <strong>Recht</strong><br />
<strong>auf</strong> Freistellung ist hierbei zwar nicht an eine Wartezeit, aber an einen<br />
Schwellenwert hinsichtlich der Größe des Betriebes gebunden. Gegenüber<br />
Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger Beschäftigten<br />
besteht der Anspruch nicht.<br />
Achtung:<br />
Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind nicht nur Arbeitnehmer, sondern<br />
alle Beschäftigten. Dazu gehören auch die zu ihrer Berufsausbildung<br />
Beschäftigten.<br />
Der Anspruch <strong>auf</strong> Pflegeteilzeit hängt vom Anspruch <strong>auf</strong> Pflegezeit ab.<br />
Nach § 3 Abs. 3 PflegezeitG muss der Beschäftigte, der Pflegezeit in<br />
Anspruch nehmen will, dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeitstage<br />
vor Beginn schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären, für<br />
welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Freistellung von der<br />
Arbeitsleistung in Anspruch genommen werden soll.<br />
Das Gesetz ermöglicht es dem Beschäftigten jedoch, unter Inanspruchnahme<br />
von Pflegezeit mit verringerter Arbeitszeit weiterzuarbeiten.<br />
Wenn nur eine teilweise Freistellung erfolgen soll, ist neben dem Zeitraum<br />
und Umfang der Freistellung auch die gewünschte Verteilung<br />
anzugeben. Wird eine teilweise Freistellung verlangt, so haben der<br />
Arbeitgeber und der Beschäftigte eine schriftliche Vereinbarung über<br />
die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit zu treffen.<br />
Der Arbeitgeber muss dem Verringerungs- und Neuverteilungswunsch<br />
des Arbeitnehmers jedoch nicht entsprechen, wenn ihm dringende<br />
betriebliche Gründe entgegenstehen. Bei der Pflegeteilzeit muss es sich<br />
um gewichtige Gründe des Arbeitgebers handeln, die Vorrang vor dem<br />
Interesse des Beschäftigten an der häuslichen Pflege verdienen.<br />
D Teilzeitarbeit nach dem Familienpflegezeit gesetz<br />
Seit dem 1. Januar 2012 ist das Familienpflegezeitgesetz (FPflzG) in<br />
Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, die Pflege von nahen Angehörigen für<br />
Berufstätige zu erleichtern. Hierzu soll es ermöglicht werden, die<br />
Wochenarbeitszeit <strong>auf</strong>grund einer schriftlichen Vereinbarung <strong>auf</strong> bis<br />
zu 15 Stunden zu reduzieren und das monatliche Arbeitsentgelt für die<br />
Dauer der Pflegephase <strong>auf</strong>zustocken.<br />
Modell der Familienpflegezeit:<br />
Reduziert ein Vollzeitbeschäftigter seine Arbeitszeit <strong>auf</strong> 50 Prozent, so soll<br />
der Arbeitnehmer dafür während der Pflegephase von maximal zwei Jahren<br />
75 Prozent seines Entgelts erhalten. Im Anschluss an die Pflegephase<br />
soll der Arbeitnehmer dann wieder 100 Prozent bei weiterhin 75 Prozent<br />
seines Entgelts arbeiten.<br />
Ist der Zeitpunkt der Arbeitsphase planbar, so können Arbeitgeber und<br />
Arbeitnehmer vereinbaren, für die Zeit der Pflegephase (maximal 24<br />
Monate) ein Wertguthaben <strong>auf</strong>zubauen. Hierfür wird dann ein Teil<br />
der Vergütung in das Wertguthabenkonto eingezahlt. Ab Beginn der<br />
Pflegephase kann das <strong>auf</strong>zustockende Arbeitsentgelt diesem Konto entnommen<br />
werden.<br />
Hinweis:<br />
Arbeitszeitkonten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit im Sinne des Bundesrahmentarifvertrages<br />
für das Baugewerbe sowie im Sinne des Rahmentarifvertrages<br />
für Angestellte und Poliere können nicht dazu genutzt<br />
werden, um eine Familienpflegezeit zu organisieren. Es müssen vielmehr<br />
entsprechende Wertguthaben eingerichtet werden.<br />
Tritt der Pflegefall hingegen unvorhergesehen ein und kann ein entsprechendes<br />
Wertguthaben nicht <strong>auf</strong>gebaut werden, so entwickelt sich<br />
das Wertguthaben erstmal „ins Minus“. Dieser sich „ins Minus“ entwickelnde<br />
Aufstockungsbetrag kann dann durch ein zinsloses Bundesdarlehen<br />
refinanziert werden.<br />
Hinweis:<br />
Sollen Wertguthaben zur Durchführung der Familienpflegezeit im Baugewerbe<br />
eingerichtet werden, ist bei der Frage, welche Entgeltbestandteile<br />
eingebracht werden können, zu differenzieren: Ist der Zeitpunkt der Pflegephase<br />
absehbar und soll im Vorfeld ein Wertguthaben <strong>auf</strong>gebaut werden,<br />
so wird ein Teil der Vergütung <strong>auf</strong> dem Wertguthabenkonto gebucht.<br />
Ein tarifgebundener Arbeitnehmer kann in diesem Fall jedoch nur die<br />
übertariflichen Leistungen einbringen (für eine detaillierte Darstellung<br />
vgl. die Ausführungen in der <strong>Unternehmerbeilage</strong> Nr. 113 aus August<br />
2011).<br />
Wichtig: Freiwilligkeit der Familienpflegezeit<br />
Ein gesetzlicher <strong>Recht</strong>sanspruch des Arbeitnehmers <strong>auf</strong> Familienpflegezeit<br />
besteht jedoch nicht. Einen solchen Anspruch hatte der Gesetzgeber<br />
noch zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens vorgesehen. Aufgrund des<br />
massiven Drucks der Arbeitgeberverbände ist von diesem Vorhaben<br />
jedoch wieder Abstand genommen worden.<br />
E Teilzeitarbeit nach dem Sozialgesetzbuch IX<br />
Nach § 81 Abs. 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) haben schwerbehinderte<br />
Arbeitnehmer ebenfalls einen Anspruch <strong>auf</strong> Teilzeitbeschäftigung,<br />
wenn die kürzere Arbeitszeit wegen der Schwere und Art der Behinderung<br />
notwendig ist. Der schwerbehinderungsrechtliche Teilzeitanspruch<br />
gilt auch für Kleinbetriebe.<br />
Die Einhaltung einer Form oder Frist ist nicht erforderlich. Auch die<br />
Erfüllung einer Mindestbeschäftigungszeit ist nicht notwendig. Der<br />
Anspruch kann zudem jederzeit so oft wie erforderlich geltend gemacht<br />
werden.<br />
Während der Anspruch aus § 8 TzBfG aus betrieblichen Gründen abgelehnt<br />
werden kann, ist dies beim Anspruch eines behinderten Menschen<br />
nur möglich, wenn seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar<br />
oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder<br />
soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften<br />
entgegenstehen.<br />
Arbeitsrecht Nr. 118, Juni 2012<br />
Betriebswirtschaft Nr. 110 erscheint im Juli 2012<br />
Impressum<br />
Redaktion:<br />
Panagiotis Koukoudis (V.i.S.d.P.)<br />
Verlag:<br />
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG<br />
Stolberger Str. 84<br />
50933 Köln<br />
Postfach 410949<br />
50869 Köln<br />
Telefon: 0221 5497 202<br />
Telefax: 0221 5497 6202<br />
Internet: www.baugewerbe-magazin.de<br />
ISSN 0344-9440<br />
Leserservice:<br />
Sabine Wildenauer<br />
Telefon: 0221 5497 321<br />
Druck:<br />
Otto Häuser KG<br />
Buch- und Offsetdruckerei<br />
Köhlstr. 45<br />
50827 Köln