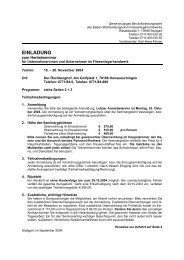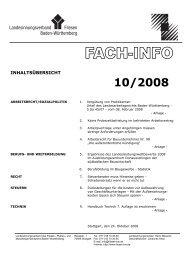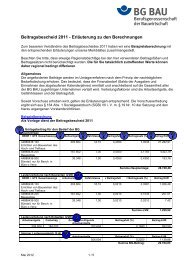AuSSentreppen
AuSSentreppen
AuSSentreppen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Merkblatt<br />
<strong>AuSSentreppen</strong><br />
Treppen aus keramischen Fliesen<br />
und Naturwerkstein im Außenbereich<br />
Dezember 2012<br />
de
Herausgeber:<br />
FACHVERBAND FLIESEN UND NATURSTEIN<br />
IM ZENTRALVERBAND DEUTSCHES BAUGEWERBE E.V., BERLIN<br />
Bundesfachgruppe StraSSen- und Tiefbau<br />
im Zentralverband Deutsches Baugewerbe E.V., Berlin<br />
In Zusammenarbeit mit:<br />
Bundesverband Deutscher Steinmetze, Frankfurt/Main<br />
Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V., Würzburg<br />
EURO-FEN, Raesfeld<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des<br />
Fachverbandes Fliesen und Naturstein im<br />
Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Kronenstraße 55–58,<br />
10117 Berlin-Mitte, www.fachverband-fliesen.de<br />
Alleinverkauf durch die Servicestelle des Fachverbandes Deutsches Fliesengewerbe:<br />
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Postfach 41 09 49, 50869 Köln,<br />
Telefon: 0221 5497-127, Telefax: 0221 5497-6141, www.rudolf-mueller.de<br />
ISBN 978-3-481-03024-7 (Print-Ausgabe)<br />
ISBN 978-3-481-03029-2 (E-Book-Ausgabe)
Inhaltsverzeichnis<br />
1 Einführung<br />
2 Regelungen für den Treppenbau<br />
2.1 Steigungsverhältnis<br />
2.1.1 Schrittmaßregel<br />
2.1.2 Bequemlichkeitsregel, Sicherheitsregel<br />
2.2 Treppenlauf<br />
2.3 Lauflinie<br />
2.4 Podeste, Zwischenpodeste<br />
2.5 Toleranzen<br />
3 Entwässerung<br />
3.1 Gefälle der Oberflächen<br />
3.2 Gefälle im Verlegeuntergrund<br />
3.3 Entwässerung/Abläufe<br />
4 Verlegemörtel<br />
4.1 Zementmörtel mit dichtem Gefüge<br />
4.2 Drainagefähiger Bettungsmörtel<br />
4.3 Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel<br />
Ausführungsarten<br />
5 Massivstufen auf Schottertragschicht oder<br />
auf Betonunterkonstruktionen<br />
5.1 Anwendungsbeispiele<br />
5.2 Untergrund<br />
5.3 Abdichtung<br />
5.4 Verlegematerial<br />
5.5 Stufenausbildung<br />
5.6 Gefälle der Oberfläche<br />
5.7 Fugen<br />
5.8 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
7 Ausführung mit Grobkornmörtel<br />
7.1 Anwendungsbeispiele<br />
7.2 Tragender Untergrund<br />
7.3 Gefälle im Verlegeuntergrund<br />
7.4 Verbundabdichtung<br />
7.5 Drainschicht<br />
7.6 Mörtelschicht<br />
7.7 Kontaktschicht<br />
7.8 Fliesen und Platten<br />
7.9 Fugen<br />
7.9.1 Mörtelfugen<br />
7.10 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
7.11 Oberflächengefälle<br />
8 Ausführung im Verbund<br />
8.1 Anwendungsbeispiele<br />
8.2 Tragender Untergrund<br />
8.3 Mörtelschicht mit Gefälle<br />
8.4 Verbundabdichtung<br />
8.5 Verlegung der Fliesen und Platten im<br />
Dünnbett<br />
8.6 Fliesen und Platten<br />
8.7 Fugen<br />
8.8 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
8.9 Gefälle der Oberfläche<br />
9 Geländerbefestigung<br />
10 Sauberlaufzonen<br />
11 Fußpunkt-Ausbildung<br />
12 Pflege und Winterdienst<br />
6 Massivstufen auf Balkenbelägen<br />
6.1 Anwendungsbeispiele<br />
6.2 Untergrund<br />
6.3 Abdichtung<br />
6.4 Dicke der Stufen<br />
6.5 Gefälle der Oberfläche<br />
6.6 Verlegematerial/Befestigung<br />
6.7 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
3
1 Einführung<br />
Das Merkblatt ist eine wichtige Grundlage für die<br />
Planung und Ausführung schadensfreier bewitterter<br />
Außentreppen.<br />
Andere Bauweisen/Ausführungsarten werden damit<br />
nicht ausgeschlossen.<br />
4<br />
Außentreppen überbrücken unterschiedliche Geländehöhen<br />
und sollen eine einfache und sichere<br />
Begehung von Steigungen ermöglichen. Neben der<br />
funktionalen Bedeutung stellen besonders Treppen<br />
im Außenbereich ein wichtiges Element der Gestaltung<br />
dar.<br />
Neben der massiven Ausführung mit Blockstufen<br />
sind auch Konstruktionen mit Belägen aus Naturwerkstein-<br />
oder Keramikplatten für Treppen<br />
möglich. Hier muss bereits der Untergrund alle<br />
konstruktiven Anforderungen (Tragfähigkeit, Steigungsverhältnis,<br />
Gefälle, Wasserführung usw.)<br />
erfüllen.<br />
Bei der Planung von Treppen sind neben den einschlägigen<br />
Normen in einigen Fällen auch noch<br />
weitergehende Vorschriften (Unfallschutz, Brandschutz,<br />
Fluchtwege, barrierefreies Bauen usw.) zu<br />
beachten.<br />
2 Regelungen für den Treppenbau<br />
Im Anwendungsbereich der DIN 18065 (Ausgabe<br />
2011-06) werden Treppen im Bauwesen erfasst.<br />
Ausgenommen sind Freitreppen im Gelände.<br />
In DIN 18065 sind die nachfolgenden technischen<br />
Begriffe und Hauptabmessungen für Treppen in<br />
Gebäuden festgelegt. Ein Treppenlauf ist hier als<br />
ununterbrochene Folge von mindestens drei Stufen<br />
(drei Steigungen) definiert. Während die Begriffe<br />
und Messregeln allgemein für das Bauwesen gelten,<br />
beziehen sich die Festlegungen für Hauptmaße<br />
und Toleranzen nur auf Treppen in und an Gebäuden,<br />
sofern nicht Sondervorschriften bestehen, die<br />
für Treppen von dieser Norm abweichende Festlegungen<br />
und Anforderungen enthalten.<br />
Im Garten- und Landschaftsbau werden oftmals<br />
geringere Steigungshöhen als in Wohnbauten verwendet.<br />
Solche Treppen sind nicht in DIN 18065 geregelt.<br />
Deshalb ist hier bei der Planung besonders<br />
die sichere Begehung dieser Treppen zu berücksichtigen.<br />
2.1 Steigungsverhältnis<br />
Um eine Treppe sicher begehen zu können, soll sie<br />
ein immer gleiches Steigungsverhältnis aufweisen.<br />
Das Steigungsverhältnis wird bestimmt durch den<br />
Auftritt a (Auftrittsbreite) und die Steigung s (Stufenhöhe).<br />
Bei geringen Auftrittsmaßen kann eine<br />
zusätzliche Unterschneidung u erforderlich sein.<br />
Bild 1<br />
2.1.1 Schrittmaßregel<br />
Das normale Schrittlängenmaß eines erwachsenen<br />
Menschen beträgt beim langsamen Gehen in der<br />
Ebene im Freien ca. 70–75 cm. Dieses Maß verringert<br />
sich beim Begehen geneigter Flächen auf ca.<br />
60–66 cm.<br />
Nach DIN 18065 wird das Steigungsverhältnis für<br />
Wohnhaustreppen entsprechend der Schrittlänge<br />
des Menschen mit der Schrittmaßregel nach folgender<br />
Formel berechnet:<br />
2 Steigungen + 1 Auftritt = 62 cm (± 3 cm)<br />
Mit dieser Schrittmaßregel können die üblichen<br />
Steigungsverhältnisse hinreichend genau ermittelt<br />
werden.<br />
2.1.2 Bequemlichkeitsregel, Sicherheitsregel<br />
Im Außenbereich werden häufig Treppen mit<br />
geringen Steigungshöhen bevorzugt. Aus Sicherheitsgründen<br />
sollten jedoch Steigungshöhen unter<br />
14 cm vermieden werden.<br />
Bei sehr steilen oder sehr flachen Steigungen ergeben<br />
sich nach der Schrittmaßregel extrem schmale<br />
oder extrem breite Auftritte. In solchen Fällen kann<br />
das Steigungsverhältnis mit nachstehenden Regeln<br />
überprüft werden:<br />
a) Bequemlichkeitsregel: Sie geht davon aus,<br />
dass der Kraftaufwand beim Begehen einer<br />
Treppe dann am geringsten ist, wenn die Auftrittsbreite<br />
12 cm größer als die Steigungshöhe<br />
ist.<br />
b) Sicherheitsregel: Sie eignet sich für die Bemessung<br />
von Steigungsverhältnissen bei<br />
extrem hohen oder extrem niedrigen Steigungen.<br />
Sie berücksichtigt hier bei, dass eine richtig<br />
bemessene Auftrittsfläche für das sichere<br />
Begehen einer Treppe maßgebend ist. Die<br />
Stei gungsverhältnisse werden bei der Sicherheitsregel<br />
nach folgender Formel bestimmt:<br />
Steigung + Auftrittsbreite = 46 cm
Vorzugsweise werden bei Außentreppen die Steigungsverhältnisse<br />
nach der vorgenannten Sicherheitsregel<br />
unter Berücksichtigung der Schrittmaßregel<br />
bestimmt.<br />
2.2 Treppenlauf<br />
Ein Treppenlauf hat min. 3 Steigungen in Folge.<br />
Die nutzbare Treppenlaufbreite und die nutzbare<br />
Podest breite, darunter versteht man den Abstand<br />
zwischen den Handlauf-Innenkanten, müssen der<br />
jeweiligen Ver kehrsdichte angemessen sein und<br />
dürfen die in Tabelle 1, DIN 18065, angegebenen<br />
Werte nicht unterschreiten. Empfohlene Treppenbreiten<br />
sind im Anhang unter Abschnitt 6,<br />
DIN 18065 – Anleitung zum statischen Nachweis –<br />
aufge führt.<br />
2.4 Podeste, Zwischenpodeste<br />
Nach max. 18 Stufen soll ein (Zwischen-)Podest<br />
ange ordnet sein, um ein ermüdungsfreies Begehen<br />
der Trep pe zu ermöglichen. Ein gerades (Zwischen-)<br />
Podest soll mindestens so lang sein, dass es dem<br />
Schrittmaß der vorherigen Treppensteigung entspricht.<br />
Das bedeutet für die Länge eines „einschrittigen“<br />
Podestes: Länge = Auftritt + (2 Steigungen +<br />
Auftritt); z. B. für das Steigungsverhältnis 17/29:<br />
Länge = Auftritt 29 + (2 x Steigung 17 + Auftritt 29)<br />
= 92 cm<br />
Der Treppenlauf soll nach Möglichkeit gleichförmig<br />
sein, d. h. Treppen, die sich aus geraden und gerundeten<br />
Laufteilen zusammensetzen, sollten vermieden<br />
werden.<br />
Als Treppenlauflänge bezeichnet man das Maß von<br />
Vor derkante Antrittstufe bis Vorderkante Austrittstufe,<br />
gemessen im Grundriss an der Lauflinie.<br />
Hat also eine Treppe n Steigungen, so beträgt die<br />
Länge ihrer Lauflinie (n–1) Auftrittbreite.<br />
2.3 Lauflinie<br />
Die Lauflinie einer Treppe ist eine gedachte Linie,<br />
die den üblichen Weg der Benutzer dieser Treppe<br />
angeben soll. Dieser Weg der Benutzer ist jedoch<br />
nicht ganz ein deutig zu definieren. Er ist abhängig<br />
von der Breite der Treppe, der Lage des Handlaufs,<br />
der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, dem Alter,<br />
der Größe und dem kör perlichen Zustand der Benutzer.<br />
Bei geraden Treppen kann die Lauflinie, unabhängig<br />
vom tatsächlichen Weg der Benutzer, in der<br />
Mitte ange nommen werden, da bei solchen Treppen<br />
das Stei gungsverhältnis an jeder Stelle gleich<br />
ist.<br />
Bild 2<br />
Bei „mehrschrittigen“ Podesten, die im Außenbereich<br />
zu bevorzugen sind, ist stets zu der Summe<br />
der Schrittmaßlängen noch eine Auftrittbreite<br />
hinzuzu zählen.<br />
Die Trittfläche der Austrittstufe ist bereits Teil der<br />
(Zwi schen-)Podestebene. Optisch gehört sie jedoch<br />
noch zum Treppenlauf und sollte daher so breit wie<br />
die jewei ligen Auftritte sein.<br />
Zur Überwindung flacher Geländesteigungen<br />
können mehrere ein- oder mehrschrittige Podeste<br />
eingeplant werden. Bei der Gesamttreppenhöhe ist<br />
das notwendi ge Gefälle der Podeste (s. Abs. 3.2) zu<br />
berücksichtigen.<br />
Bild 3<br />
5
2.5 Toleranzen<br />
Die in DIN 18065 für fertige Treppenläufe in Gebäuden<br />
festgelegten zulässigen Tole ranzen sollten<br />
auch im Außenbereich nicht überschritten werden.<br />
Die Abweichung vom Nennmaß sowie die Differenz<br />
der Steigungshöhe zwischen zwei Stufen darf<br />
danach nicht mehr als 5 mm betragen.<br />
Bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen<br />
darf das Istmaß der Steigung der Antrittstufe<br />
höchs tens 15 mm vom Nennmaß (Sollmaß) abweichen,<br />
ansonsten nur 5 mm.<br />
Um ein sicheres Begehen einer Treppe zu gewährlei<br />
sten, lassen die in dieser Norm festgelegten<br />
Regelun gen einen Höhenausgleich beim Versetzen<br />
praktisch nur in der Antrittstufe zu. Es ist daher<br />
unbedingt erfor derlich, das Steigungsverhältnis vor<br />
Versetzbeginn ge nau ermittelt zu haben, um eine<br />
der Norm entsprechen de Stufeneinteilung vornehmen<br />
zu können. Hierbei ist auch das erforderliche<br />
Oberflächengefälle der Stufen und Podeste zu berücksichtigen.<br />
Ein genaues Aufmaß der Treppenanlage ist zur<br />
definiti ven Bestimmung des Steigungsverhältnisses<br />
daher unerlässlich.<br />
In DIN 18202 „Toleranzen im Bauwesen, Begriffe,<br />
Grundsätze, Anwendung“ sind die auftretenden<br />
Maße begrifflich bestimmt.<br />
3 Entwässerung<br />
Bei der Planung von Treppen ist auf eine kontrollierte<br />
Entwässerung zu achten.<br />
Die Neigung der Oberflächen, der Bettung und des<br />
Untergrundes sind für eine funktionsfähige Entwässerung<br />
aller Wasser führenden Ebenen in der<br />
Planung der Außentreppe konkret vorzugeben, um<br />
unliebsame Korrekturen am Rohbau während der<br />
Versetzarbeiten zu vermeiden.<br />
3.1 Gefälle der Oberflächen<br />
Stufen und Podeste von Außentreppen müssen<br />
ein aus reichendes Gefälle aufweisen, um Niederschlagswasser<br />
schnell und sicher abzuleiten. Das<br />
den Oberflächenun ebenheiten zufließende Wasser<br />
sollte nicht zum Stillstand kommen. Eisbildung auf<br />
den Trep pen kann hierdurch jedoch nicht verhindert<br />
werden, da bereits anfallendes Tauwasser auf<br />
den Steinoberflächen bei bestimmten klimatischen<br />
Bedingungen zur Eisbildung führt.<br />
Die Freitreppenstufen im Gelände sollen bei geschliffener<br />
Ober flächenbearbeitung ein Gefälle von<br />
≥ 1,5 % aufweisen, bei rauer Oberflächenbearbeitung<br />
ein Gefälle von ≥ 2–3 %.<br />
Nach DIN 18065 dürfen Treppen und Podeste am<br />
Gebäude kein Gefälle aufweisen. Es ist maximal<br />
eine Abweichung von 1 % von der waagerechten<br />
Ebene als Toleranzmaß möglich. Dies führt jedoch<br />
zu konstruktiven Problemen, da die gezielte Wasserableitung<br />
kaum noch möglich ist.<br />
Es ist mit dem Bauherren abzuklären, ob eine Abweichung<br />
von der DIN 18065 bezüglich des Gefälles<br />
im Einzelfall vereinbart werden kann.<br />
3.2 Gefälle im Verlegeuntergrund<br />
Außentreppen sind in der Regel nicht wasserdicht.<br />
Vor allem im Bereich der Fugen dringt Feuchtigkeit<br />
in den Verlegeuntergrund ein. Ist das Mörtelbett<br />
stark durchfeuchtet, und kann diese Feuchtigkeit<br />
nicht abgeleitet werden, können Feuchteflecken,<br />
Kalkausblühungen und Frostschäden entstehen.<br />
Bild 4<br />
Wasserundurchlässige Untergründe (z. B. Beton)<br />
müssen ein ausreichendes Gefälle von ≥ 1 % aufweisen.<br />
Auch abgetreppte Untergründe müssen<br />
bauseits bereits mit Gefälle vorgesehen werden.<br />
Ist im Untergrund kein ausreichendes Gefälle vorhanden,<br />
muss vor der Verlegung ein Gefälleestrich/<br />
eine Gefällespachtelung mit einer Verbundabdichtung<br />
eingebaut werden.<br />
Das im Verlegeuntergrund eingedrungene Wasser<br />
muss gezielt abgeführt werden (z. B. Drainagematte<br />
in Abhängigkeit vom Belagsmaterial).<br />
6<br />
Bei sichtbaren Treppenwangen sollte der seitliche<br />
Austritt von Sickerwasser an den Stufen durch den
Einbau, z. B. einer Aufkantung oder andere Maßnahmen,<br />
vermieden werden.<br />
Günstig ist die Verlegung in einem drainfähigen<br />
Verlegemörtel auf einem wasserdurchlässigen Untergrund<br />
(nach MB Drainbeton über Erdreich). Bei<br />
massiven Stufen kann eine Verlegung auf Mörtelstreifen<br />
erfolgen.<br />
3.3 Entwässerung/Abläufe<br />
Die gezielte Entwässerung von Flächen im Außenbereich,<br />
auch Treppenanlagen, ist gemäß DIN<br />
1986-100 zu planen.<br />
Ist keine Versickerung des Regenwassers gewährleistet,<br />
ist mindestens ein Bodenablauf DN 100<br />
oder eine Ablaufrinne je 250 m 2 Bodenfläche vorzusehen,<br />
die an einen Vorfluter (z. B. Kanal oder<br />
Sickerschacht) angeschlossen sind.<br />
Ablaufrinnen, Bodenabläufe und Wasserspeier sind<br />
so zu dimensionieren, dass diese das anfallende<br />
Oberflächenwasser sicher ableiten können. Sie<br />
müssen kontrollierbar und wartungsfähig sein und<br />
dürfen sich nicht zusetzten.<br />
Wasserabläufe (Gully, Rinnen) müssen neben dem<br />
Oberflächenwasser auch das in den Untergrund<br />
eindringende Sickerwasser aufnehmen, wenn diese<br />
untere Entwässerungsebene nicht wasserundurchlässig<br />
ist.<br />
Oberflächenwasser von an Treppen angrenzenden<br />
Flächen darf nicht über die Treppen geleitet werden.<br />
Bei größeren Podestbelägen und großflächigen<br />
Treppenanlagen sind Zwischenentwässerungen<br />
zu empfehlen.<br />
4 Verlegemörtel<br />
Als Bindemittel für den Verlegemörtel hat sich<br />
Trasszement (Portlandpuzzolanzement) bewährt.<br />
Der Trassanteil im Zement sollte über 40 % liegen.<br />
Bei Bedarf kann Trassmehl zugesetzt werden,<br />
Kalkzusätze sind zu vermeiden. Der Verlegemörtel<br />
muss wasserdurchlässig (drainfähiger Grobkornmörtel)<br />
sein und große Poren aufweisen. Dadurch<br />
wird die kapillare Wasseraufnahme reduziert, der<br />
Wasserabfluss erleichtert und die Frost- und Tausalzbeständigkeit<br />
erhöht.<br />
4.1 Zementmörtel mit dichtem Gefüge<br />
In Abhängigkeit von der Materialauswahl und den<br />
Baustellenbedingungen ist die Verlegung von Natursteinen<br />
mit Zementmörtel nach DIN 18332 mit<br />
dichtem Gefüge möglich.<br />
Die Mörtelbettdicke für Bodenbeläge im Außenbereich<br />
beträgt bei einer Dickbettverlegung mit dichtem<br />
Mörtelgefüge zwischen 10 mm und 30 mm.<br />
Der übliche Verlegemörtel entsprechend DIN 18332<br />
ist nicht als Lastverteilungsschicht geeignet und<br />
benötigt immer einen tragfähigen Untergrund.<br />
Bei dichten, glatten Natursteinunterseiten sollte<br />
der Haftverbund durch eine Kontaktschicht verbessert<br />
werden.<br />
Zementäre Mörtel mit dichtem Gefüge neigen bei<br />
Nässe zu Ausblühungen und erhöhen die Gefahr<br />
von Verfärbungen im Naturstein. Aufgrund der<br />
kapillaren Wasseraufnahme solcher Verlegemörtel<br />
sind beständige Feuchteflecken und Kalkablagerungen<br />
auf den Belagsoberflächen unvermeidbar.<br />
Bei hoher Wassersättigung können Frostschäden<br />
im Verlegemörtel auftreten.<br />
Die Verlegung von Naturwerksteinbelägen in Zementmörtel<br />
mit dichtem Gefüge ist deshalb nur<br />
eingeschränkt empfehlenswert.<br />
4.2 Drainagefähiger Bettungsmörtel<br />
Beläge im Außenbereich sind üblicherweise nicht<br />
wasserdicht. Um in den Untergrund eindringendes<br />
Wasser schnell abzuleiten, ist die Verwendung<br />
eines drainagefähigen Mörtels (Grobkornmörtel)<br />
empfehlenswert. Die horizontale Wasserableitung<br />
in der Bettung kann durch die Anordnung einer kapillarbrechenden<br />
Drainmatte erheblich verbessert<br />
werden.<br />
Entgegen den Anforderungen der DIN 18332<br />
Abs. 3.2.3 ist für wasserdurchlässige Mörtel ein<br />
Mischungsverhältnis Zement zu Zuschlagstoff von<br />
etwa 1 : 4 bis 1 : 6 Raumteilen zu empfehlen. Als Zuschlag<br />
ist beispielsweise Kies der Körnung 2/4 bis<br />
4/8 oder Splitt 2/5 bis 4/11 ohne Feinanteile unter<br />
2 mm zu verwenden. Der Zementleim darf die Poren<br />
nicht verschließen. Vor der Verlegung ist eine<br />
Eignungsprüfung des Mörtels empfehlenswert.<br />
Entgegen der in der DIN 18332 Abs. 3.2.4 angegebenen<br />
Mörtelbettdicke für Bodenbeläge im Außenbereich<br />
von 10 mm bis 30 mm, kann bei der Verwendung<br />
eines wasserdurchlässigen Grobkornmörtels<br />
die Mörtelbettdicke erhöht werden. Aufgrund des<br />
geringen Wasseranspruchs und der geringeren<br />
Schwindverformung ist dies bei Grobkornmörtel<br />
ohne Probleme möglich. Zur Sicherstellung des<br />
Haftverbundes ist eine Kontaktschicht zwischen<br />
Naturwerkstein und Verlegemörtel vorzusehen.<br />
Bei der Verbundverlegung auf Betonuntergründen<br />
ist eine Haftschlämme auf den Untergrund aufzubringen.<br />
Bei Werkmörteln, sind deren Eignung zur Verlegung<br />
von Naturstein im Außenbereich und die<br />
Wasserdurchlässigkeit vom Hersteller nachzuweisen.<br />
Der Durchlässigkeitsbeiwert nach DIN 18035-6<br />
sollte mindestens 10 –4 m/s betragen.<br />
Eine direkte Verlegung auf Beton oder Estrich ohne<br />
Abdichtung ist nicht zu empfehlen. Sofern direkt<br />
7
auf einer Lastverteilungsschicht ohne Verbundabdichtung<br />
verlegt werden soll, ist unterhalb der<br />
drainfähigen Lastverteilungsschicht eine geeignete<br />
Drainagematte anzuordnen.<br />
4.3 Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel<br />
Verlegung mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel<br />
mit CE-Kennzeichnung gemäß DIN EN<br />
12004. Der Dünnbettmörtel muss im System auf<br />
die Verbundabdichtung abgestimmt und geprüft<br />
sein. Eine weitgehend vollflächige Bettung ist anzustreben.<br />
Bei ungünstigen Witterungsbedingungen<br />
kann die Verwendung eines C 2 F-Dünnbettmörtels<br />
zweckmäßig sein. Für die Ausführung ist<br />
DIN 18157-1/-3 zu beachten.<br />
Stufenbeläge sollen auch im kombinierten<br />
Floating-Buttering-Verfahren nach DIN 18157 mit<br />
Dünnbettmörtel nach DIN EN 12004 auf der Betonunterlage<br />
bzw. einer Lastverteilungsschicht verlegt<br />
werden. Hierbei sind die Verarbeitungshinweise<br />
des Herstellers zu beachten. Schnell abbindende<br />
Verlegesysteme sind zu bevorzugen, da diese eine<br />
frühere Belastung der Flächen sicherstellen. Kunststoff<br />
vergütete Mörtelsysteme haben den Vorteil,<br />
dass diese bei entsprechender Vergütung einen<br />
dauerhaften Haftverbund auch zu sehr dichten<br />
Naturwerksteinmaterialien, wie Quarzite, Schiefer,<br />
Feinsteinzeug usw., sicherstellen.<br />
Bei dünnen Mörtelbettschichten sind erhöhte<br />
Anforderungen an die Ebenheit der Verlegeuntergründe<br />
und die Maßtoleranzen der Natursteindicke<br />
(Kalibrierung) oder Fliesen zu stellen. Eine ebene<br />
und weitestgehend vollflächige Bettung ist nur bei<br />
kleinen Plattenformaten, nicht jedoch bei einteiligen<br />
Stufenbelägen möglich.<br />
Dünnbettmörtel werden üblicherweise in Kombination<br />
mit einer Verbundabdichtung (AIV)<br />
entsprechend dem Merkblatt „Hinweise für die<br />
Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen<br />
und Belägen aus Fliesen und Platten für<br />
den Innen- und Außenbereich“ verwendet.<br />
AUSFÜHRUNGSARTEN<br />
5 Massivstufen auf Schottertragschicht<br />
und Betonunterkonstruk<br />
tionen<br />
5.1 Anwendungsbeispiele<br />
Die Art der Ausführung findet dort Anwendung, wo<br />
die Treppenkonstruktion nicht mit dem Bauwerk<br />
verbunden ist, z. B. im Landschaftsbau:<br />
l Anschlusstreppen an Terrassen<br />
l Hauseingänge<br />
l Treppen im Gelände<br />
5.2 Untergrund<br />
Der Untergund ist so vorzubereiten, dass er für die<br />
vorgesehene Nutzung der Treppe tragfähig ist. Die<br />
Schottertragschicht ist frostfest und sickerfähig zu<br />
erstellen. Das anfallende Sickerwasser ist abzuleiten.<br />
Ideal sind Unterkonstruktionen aus Drainbeton.<br />
Drainbeton hat eine isolierende Wirkung. Dadurch<br />
kann die Frosttiefe reduziert werden. 10 cm Drainbeton<br />
entsprechen hinsichtlich der Frosttiefe 20 cm<br />
Schottertragschicht. Über der Unterkonstruktion<br />
aus Drainbeton können die Blockstufen in Grobkornmörtel<br />
versetzt werden. Es besteht auch die<br />
Möglichkeit, die Blockstufen direkt in den Drainbeton<br />
zu versetzen.<br />
5.3 Abdichtung<br />
Auf einer Betonunterkonstruktion dürfen keine<br />
Wasserlachen entstehen. Dies ist im Voraus durch<br />
Abspritzen der Unterkonstruktion mit Wasser zu<br />
kontrollieren. Wenn bei wasserundurchlässigen<br />
Untergründen die Möglichkeit besteht, Bohrlöcher<br />
zu erstellen und somit das Wasser abfließt, sind<br />
keine speziellen Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.<br />
Wenn ein Gefälle mit Estrich erstellt werden muss,<br />
damit der Wasserabfluss gewährleistet ist, muss<br />
eine Dichtschlämme auf Zementbasis (ein- oder<br />
zweikomponentig) oder aus Reaktionsharz aufgebracht<br />
werden.<br />
Anschluss- und Übergangsbereiche sind mit geeigneten<br />
Werkstoffen einzudichten.<br />
5.4 Verlegematerial<br />
Als Verlegematerial eignet sich großkörniger Grobkornmörtel<br />
ohne Feinanteil (siehe 4.2).<br />
5.5 Stufenausbildung<br />
8<br />
Die Antrittstufe ist lagestabil zu sichern, ggf. durch<br />
Einlassen von einem oder mehreren Dornen oder
anderen Maßnahmen. Die Lagestabilität der weiteren<br />
Stufen kann auch mit einer Falzausbildung<br />
erfolgen.<br />
5.6 Gefälle der Oberfläche<br />
Breite<br />
Durch die Anordnung von Rand- und<br />
Anschlussfugen ist eine Einspannung<br />
der Belagsfläche auszuschließen.<br />
ca. 8–12 mm, je nach Beanspruchung<br />
wie in 3.1<br />
Außentreppen sind so zu planen, dass das Oberflächenwasser<br />
sicher abgeleitet wird und nicht auf<br />
den Stufenoberflächen stehen bleibt.<br />
Treppen, die von mehreren Seiten begangen werden<br />
können, sollten nur nach einer Seite Gefälle<br />
aufweisen.<br />
5.7 Fugen<br />
Bei Blockstufen müssen schmale Fugen nicht zwingend<br />
verfugt werden, wenn die untere Entwässerungsebene<br />
einwandfrei ausgebildet wurde.<br />
Beim Verfugen mit Mörtel entstehen mit der Zeit<br />
unvermeidliche Risse zwischen den Blockstufen<br />
und dem Fugenmörtel. Aus diesem Grund ist eine<br />
funktionierende untere Entwässerungsebene erforderlich.<br />
Je länger die Blockstufen und je schmaler die Fugen,<br />
desto schneller entstehen unvermeidliche Risse<br />
zwischen Blockstufen und Fugenmörtel infolge<br />
thermischer Bewegungen. Aus diesem Grund sollte<br />
die Fugenbreite ≥ 8 mm sein.<br />
Als hydraulisch erhärtender Fugenmörtel kann ein<br />
Mörtel nach DIN EN 13888 oder eine Baustellenmischung<br />
mit genormten Zementen zur Anwendung<br />
kommen.<br />
Die Ausführung kann auch mit elastischem Fugenmaterial<br />
erfolgen. Dies ist jedoch keine Abdichtung.<br />
Sowohl elastische wie auch hydraulisch gebundene<br />
Fugen sind Wartungsfugen.<br />
5.8 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
Anschlussfugen/Dehnfugen<br />
Anordnung abhängig von Größe und Grundrissgliederung<br />
der Belagsfläche<br />
Tiefe<br />
bis zur Trennschicht bzw. bis zur Drainschicht<br />
Verfüllung mit elastischen Fugenfüllstoffen, ggf.<br />
mit Vorfüllung oder Fugenprofilen<br />
Fugenfüllstoffe müssen für die Belagsstoffe<br />
(z. B. bei Naturwerkstein)<br />
geeignet sein und dürfen keine Verfärbungen<br />
verursachen.<br />
Die Ausführung einer elastischen Fuge stellt keine<br />
Abdichtungsmaßnahme dar. Mit Fugenprofilen<br />
oder elastischen Fugenfüllstoffen geschlossene<br />
Fugen sind nicht wasserdicht. Mit elastischen<br />
Füllstoffen geschlossene Fugen unterliegen chemischen<br />
und/oder physikalischen Einflüssen nach<br />
DIN 52460 Abschnitt 2 und können reißen. Die<br />
unvermeidbaren Verformungen bei schwimmenden<br />
Konstruktionen überschreiten in der Regel die<br />
Elastizität der Fugenfüllstoffe. Eine Erneuerung der<br />
Fugenfüllstoffe ist ggf. vorzunehmen, um Folgeschäden<br />
zu vermeiden.<br />
Gebäudetrennfugen<br />
Gebäudetrennfugen gehen durch alle tragenden<br />
und nicht tragenden Teile des Gebäudes oder Bauhandwerks<br />
hindurch und müssen im Belag oder<br />
in der Bekleidung an der gleichen Stelle und in der<br />
von der Bauplanung vorgesehenen Breite übernommen<br />
werden.<br />
6 Massivstufen auf Balkenbelägen<br />
6.1 Anwendungsbeispiele<br />
Diese Form der Ausführung findet oft Anwendung<br />
zur Überbrückung der aufgefüllten Baugrube oder<br />
wenn unterhalb der Treppe Lüftungen oder Fenster<br />
vorhanden sind. Diese Ausführung ist in der Regel<br />
unkompliziert, da die Planung der Entwässerung<br />
weitgehend entfällt.<br />
6.2 Untergrund<br />
Verlauf<br />
Abstand<br />
durchlaufend geradlinig<br />
Der Abstand richtet sich nach der zu<br />
erwartenden Längenänderung aus<br />
Temperaturänderungen (z. B. aus Sonnenbestrahlung)<br />
und der Farbe des<br />
Belages. Dementsprechend sind Bewegungsfugen<br />
im Abstand von ca. 2 bis<br />
ca. 5 m anzuordnen.<br />
Betonbalken oder Metallkonstruktionen.<br />
Die Abstände der Balkenlage ist abhängig von der<br />
Materialart und der Nutzung.<br />
6.3 Abdichtung (nur am Hausanschluss erforderlich)<br />
9
6.4 Dicke der Stufen<br />
Die erforderliche Dicke von freitragenden Treppen<br />
muss auf der Grundlage einer statischen Bemessung<br />
oder einer bauaufsichtlichen Zulassung bestimmt<br />
werden und richtet sich nach dem Abstand<br />
der Auflager, der Materialart und der Nutzung.<br />
Baulich notwendige Treppen sowie Außentreppen<br />
mit größeren Absturzhöhen aus freitragenden<br />
Naturwerksteinen bedürfen einer konstruktiven<br />
Absturzsicherung, die bei einem plötzlichen Bruch<br />
der Natursteinstufe noch eine Resttragfähigkeit ermöglicht.<br />
Dies kann z. B. durch nicht rostende Stähle<br />
in Bohrungen oder in Nuten an den Unterseiten<br />
der Stufen gewährleistet werden. Die Resttragfähigkeit<br />
der Trittstufen ist nachzuweisen.<br />
Hinweise zum statischen Nachweis enthält BTI 1.3<br />
„Massivstufen und Treppenbeläge, außen“ des<br />
DNV.<br />
6.5 Gefälle der Oberfläche<br />
wie in 3.1<br />
6.6 Verlegematerial/Befestigung<br />
Mörtel, Kleber C1, C2 und/oder Reaktionsharz mit<br />
ausreichender Festigkeit.<br />
Metallische Befestigungen müssen eine ausreichende<br />
Korrosionsbeständigkeit aufweisen.<br />
6.7 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
wie in 5.8<br />
7 Ausführung mit Grobkornmörtel<br />
7.1 Anwendungsbeispiele<br />
l Kelleraußentreppe<br />
l Hauseingänge<br />
l Treppenstufen aller Art<br />
7.2 Tragender Untergrund<br />
Art<br />
Stahlbeton oder andere tragfähige<br />
Untergründe<br />
7.3 Gefälle im Verlegeuntergrund<br />
siehe 3.2<br />
ACHTUNG<br />
Bei Terrassen und größeren Podesten<br />
darf die Abführung des Sickerwassers<br />
nicht über die Stufen erfolgen. Hier ist<br />
eine andere Art der Ableitung zu planen.<br />
7.4 Verbundabdichtung<br />
Art<br />
7.5 Drainschicht<br />
Kunststoffmörtelkombination oder<br />
Reaktionsharz einschließlich der seitlichen<br />
Bauteile mindestens bis OKF<br />
Sollte eine Abdichtung nach DIN 18195<br />
erforderlich sein, ist diese bis 15 cm<br />
OKF erforderlich.<br />
Bei freibewitterten Treppen ist eine Drainschicht zu<br />
empfehlen.<br />
ACHTUNG<br />
Drainschichten beeinträchtigen den<br />
Lastabtrag in den Untergrund. Das<br />
Belagsmaterial und die Mörtelschicht<br />
müssen unter Berücksichtigung der<br />
zu erwartenden Lasten in der Dicke<br />
und Größe auf die Drainschicht abgestimmt<br />
sein.<br />
7.6 Mörtelschicht<br />
Drainschichten verhindern ebenfalls<br />
den Verbund zwischen Verlegemörtel<br />
und Untergrund. Es sind besondere<br />
Maßnahmen zur Sicherung der Lagestabilität<br />
der Stufenbeläge erorderlich,<br />
beispielsweise Bewehrungsgitter aus<br />
nicht rostendem Stahl im Verlegemörtel<br />
und/oder Verdübelung der Trittund<br />
Setzstufen.<br />
Art Grobkornmörtel nach 4.2<br />
10
7.7 Kontaktschicht<br />
8.4 Verbundabdichtung<br />
Art<br />
Dünnbettmörtel nach DIN 12004, geeignete<br />
Haftbrücken oder Schichten<br />
aus plastifiziertem Mörtel. Ein möglichst<br />
vollflächiger Auftrag der Kontaktschicht<br />
ist anzustreben.<br />
7.8 Fliesen und Platten<br />
Art<br />
Kunststoffmörtelkombination oder<br />
Reaktionsharz einschließlich der seitlichen<br />
Bauteile mindestens bis OKF.<br />
Sollte eine Abdichtung nach DIN 18195<br />
erforderlich sein, ist diese bis 15 cm<br />
OKF erforderlich.<br />
Art<br />
stranggeperesste oder trockengepresste<br />
keramische Fliesen und Platten<br />
nach DIN EN 14411, Gruppe I (frostbeständig<br />
nach DIN EN ISO 10545-12)<br />
Bodenklinkerplatten nach DIN 18158<br />
8.5 Verlegung der Fliesen und Platten im Dünnbett<br />
wie in 4.3<br />
8.6 Fliesen und Platten<br />
7.9 Fugen<br />
Naturstein nach DIN EN 12057 (Fliesen)<br />
oder DIN EN 12058 (Platten) (frostwiderstandsfähig<br />
nach DIN EN 12372 oder<br />
DIN 52008, Verfahren D)<br />
Art<br />
stranggepresste oder trockengepresste<br />
keramische Fliesen und Platten nach<br />
DIN EN 14411, Gruppe I (frostbeständig<br />
nach DIN EN ISO 10545-12)<br />
Bodenklinkerplatten nach DIN 18158<br />
7.9.1 Mörtelfugen<br />
Ausbildung verfugen nach<br />
DIN 18352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“,<br />
DIN 18332 „Naturwerksteinarbeiten“<br />
8.7 Fugen<br />
Naturstein nach DIN EN 12057 (Fliesen)<br />
oder DIN EN 12058 (Platten) (frostwiderstandsfähig<br />
nach DIN EN 12372 oder<br />
DIN 52008, Verfahren D)<br />
Art<br />
z. B. mit hydraulisch erhärtendem<br />
Fugenmörtel nach DIN EN 13888 oder<br />
Baustellenmischungen mit genormten<br />
Zementen<br />
Ausbildung verfugen nach<br />
DIN 18352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“,<br />
DIN 18332 „Naturwerksteinarbeiten“<br />
7.10 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
siehe 5.8<br />
Art<br />
z. B. mit hydraulisch erhärtendem<br />
Fugenmörtel nach DIN EN 13888 oder<br />
Baustellenmischungen mit genormten<br />
Zementen<br />
7.11 Oberflächengefälle<br />
wie in 3.1<br />
8 Ausführung im Verbund<br />
8.1 Anwendungsbeispiele<br />
l Kelleraußentreppe<br />
l Hauseingänge<br />
l Treppenstufen aller Art<br />
8.2 Tragender Untergrund<br />
Art<br />
Stahlbeton oder andere tragfähige<br />
Untergründe<br />
8.8 Anschlussfugen/Bewegungsfugen/Gebäudetrennfugen<br />
wie in 5.8<br />
8.9 Gefälle der Oberfläche<br />
wie in 3.1<br />
9 Geländerbefestigung<br />
Geländerpfosten sind so zu planen, dass diese seitlich<br />
angebracht werden. Ist in Ausnahmefällen die<br />
Befestigung durch den Belag in der Unterkonstruktion<br />
erforderlich, so ist dieser aus rostfreien Materialien<br />
zwängungsfrei einzubauen und abzudichten.<br />
8.3 Mörtelschicht mit Gefälle<br />
Art<br />
Mörtelschicht im Verbund bis OKF<br />
Oberboden mit Gefälle entsprechend<br />
dem Oberflächengefälle<br />
11
10 Sauberlaufzonen<br />
Die Entwässerung der Sauberlaufzone ist zu planen.<br />
Eine Entwässerung über die Drainageschichten<br />
ist nicht zulässig und schadensträchtig.<br />
11 Fußpunkt-Ausbildung<br />
l Zwischen Stoßtritt und Flächenbelag muss mindestens<br />
1 cm offen sein.<br />
l Die Belagsfläche darf nicht gegen den Stoßtritt<br />
verlegt werden.<br />
l Eine Entwässerungsrinne kann erforderlich sein<br />
für das Oberflächenwasser wie auch für das<br />
Sicker wasser.<br />
12 Pflege und Winterdienst<br />
Die Pflege und Reinigung beeinflussen die Haltbarkeit<br />
der Beläge. Die Stufen sind mechanisch zu<br />
reinigen. Taumittel zerstören den Belag, die Fugenfüllung<br />
und Bettung.<br />
Literaturhinweise<br />
Merkblatt für Drainbetontragschichten (FGSV<br />
Nr. 827, 1996)<br />
DIN 18065 Gebäudetreppen<br />
BTI 1.3 „Massivstufen und Treppenbeläge, außen“<br />
DNV<br />
ISBN 978-3-481-03024-7