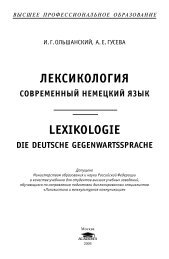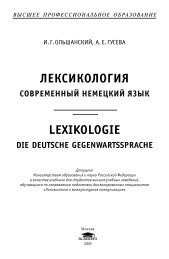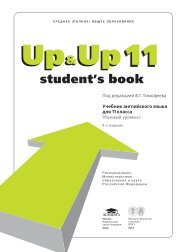LEXIKOLOGIE DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE ...
LEXIKOLOGIE DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE ...
LEXIKOLOGIE DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
34<br />
1.1.4.3.2. Valenzwörterbuch von G.Helbig / W.Schenkel<br />
Ende der 60er Jahre entstand ein Valenzmodell, das viele Mängel der<br />
ersten Darstellungen der Valenz, vor allem der von Tesniére beseitigte und<br />
seinen Niederschlag u.a. im „Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher<br />
Verben“ von G.Helbig und W.Schenkel fand. Dieses Modell ging zunächst<br />
von der syntaktischen Valenz (d.h. von der Valenz der Ausdrucksebene)<br />
und von der Wortart der Verben aus, ist aber, wie sich das später erwiesen<br />
hat, einerseits übertragbar auch auf die Valenz anderer Wortarten (z.B.<br />
der Adjektive und der Substantive) 55 und ist andererseits als notwendiger<br />
Bestandteil integrierbar in ein komplexeres Modell, das verschiedene Ebenen<br />
umfasst.<br />
Im Wörterbuch von G.Helbig und W.Schenkel wurde ein dreistufiges<br />
Modell entwickelt, das die Valenz und Distribution deutscher Verben beschreibt.<br />
Dabei wird unter Valenz die Fähigkeit des Verbs (oder entsprechend:<br />
einer anderen Wortart) verstanden, bestimmte Leerstellen um sich<br />
herum zu eröffnen, die durch obligatorische oder fakultative Aktanten zu<br />
besetzen sind. Als Leerstellen werden verstanden die vom Verb (oder einem<br />
anderen Valenzträger) geforderten und obligatorischen bzw. fakultativ<br />
zu besetzenden Stellen, die in der Bedeutung des Verbs (oder eines anderen<br />
Valenzträgers) angelegt sind. Aktanten (oder „Mitspieler“) werden diejenigen<br />
Glieder genannt, die diese Leerstellen besetzen.<br />
Um die Aktanten adäquat zu beschreiben, genügt nicht das Wissen um<br />
die Zahl der Aktanten, d.h. die Valenz im engeren Sinne. Man muss vielmehr<br />
auch ihre Art (syntaktisch und semantisch), d.h. die Distribution des<br />
Verbs (oder eines anderen Valenzträgers) kennen. Unter Distribution eines<br />
sprachlichen Elements wird die Summe aller Umgebungen verstanden, in<br />
denen es vorkommt.<br />
Entsprechend diesen Bestimmungen der Begriffe „Valenz“ und „Distribution“<br />
werden in dem „Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher<br />
Verben“ von Helbig / Schenkel die Verben auf folgenden drei Stufen (in<br />
einem dreistufigen Modell) interpretiert:<br />
(1) Auf Stufe I wird für jedes Verb die quantitative Anzahl der Aktanten,<br />
d.h. seine syntaktische Valenz im engeren Sinne festgelegt, z.B.:<br />
I. erwarten2 rauben 2+(1) = 3,<br />
wobei die obligatorischen Aktanten ohne Klammern, die fakultativen<br />
Aktanten in Klammern stehen und beide zur Gesamtheit der valenzdeterminierten<br />
Glieder addiert werden.<br />
(2) Auf Stufe II werden die Aktanten qualitativ durch Angabe der syntaktischen<br />
Umgebungen der Verben in streng formalen Begriffen festgelegt<br />
(z.B. Sn = Substantiv im Nominativ, Sa = Substantiv im Akkusativ,<br />
Sd = Substantiv im Dativ, pS = Substantiv mit Präposition, NS = Nebensatz):<br />
II. erwarten > Sn, Sa / NSdass / Inf