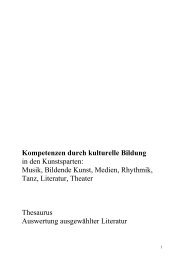4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
4. Politologische und soziologische Befunde zur Wirkungsanalyse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aktuelle sozialwissenschaftliche Bef<strong>und</strong>e <strong>zur</strong> Gesellschaft<br />
Der aktuelle Klassiker einer Betrachtung von Gesellschaft unter kultureller Perspektive ist sicherlich F. Bourdieu, der in seiner<br />
"Soziologie der symbolischen Formen" (erstmals 1970) eine theoretische Gr<strong>und</strong>lage für eine klassentheoretische<br />
Betrachtungsweise von Gesellschaft gegeben hat, die die Sozialstruktur als wesentlich mit kulturellen Mitteln erzeugt, stabilisiert<br />
<strong>und</strong> reproduziert vorstellbar macht. Diesen Theorieentwurf hat er 1979 mit der großangelegten empirisch-theoretischen Studie<br />
"Die feinen Unterschiede" konkretisiert <strong>und</strong> weiterentwickelt, freilich mit erheblichen Rezeptionsschwierigkeiten zumindest im<br />
deutschsprachigen Raum (vgl. hierzu etwa Eder 1989, vor allem das Nachwort von Bourdieu S. 395 ff.).<br />
Zur Vorstellung weiterer Ansätze einer "Soziologischen Zeitdiagnose" referiere sich das Inhaltsverzeichnis einer knappen, aber<br />
präzisen Vorstellung <strong>und</strong> kritischen Diskussion der verschiedenen Ansätze von A. Honneth (1994), der die folgenden großen<br />
"Tendenzen" identifiziert, gravierende Veränderungen in der Gesellschaft auf den Begriff zu bringen: Tendenz zum<br />
Wertewandel; Postmoderne; Risikogesellschaft; Erlebnisgesellschaft. An einzelnen Autoren festgemacht:<br />
- Postmoderne (in ihrer gesellschaftstheoretischen Relevanz) vor allem bei Baudrillard <strong>und</strong> Lyotard<br />
- Individualisierung, (natürlich) an U. Beck<br />
- Ästhetisierung der Lebenswelt an W. Welsch <strong>und</strong> mit einem spezifischen Akzent bei G. Schulze<br />
- Fokus "Disziplinierung des Körpers" an M. Foucault<br />
- Kommunitarismus an M. Walzer<br />
- Zivilgesellschaft in verschiedenen Ansätzen <strong>und</strong> als nicht-thematisierte Frage<br />
- Das Problem der Armut.<br />
Bei der Sichtung dieser Theorie- <strong>und</strong> Diagnoseangebote fällt auf, daß Kultur <strong>und</strong> insbesondere ästhetische Betrachtungen eine<br />
entscheidende Rolle spielen - auch als Ausdruck einer programmatischen Absage an Vernunft, nunmehr als Methode der<br />
Wirklichkeitserkenntnis weniger diskursiv <strong>und</strong> kognitiv, als vielmehr "ganz anders" (abhängig vom jeweiligen<br />
Ästhetik-Verständnis) vorgehen zu wollen, sofern auch dieser Anspruch nicht auch schon als falsche, in Kategorien der<br />
Moderne verbleibende Fragestellung verworfen wird.<br />
Ein zweiter roter Faden ist die Auseinandersetzung mit der Moderne, sei es als Verkündigung ihres empirisch feststellbaren<br />
Endes, sei es als (normativ geforderte) Notwendigkeit ihres Endes, als Überlagerung der Moderne durch andere Strömungen<br />
oder durch Eintreten in eine andere Stufe von Moderne, etwa durch ihr "Reflexivwerden". Honneth kommentiert all diese<br />
Ansätze wie folgt: "Aber keine von ihnen hat die anschließende Phase der gewissenhaften empirischen Überprüfung<br />
unbeschadet überstanden. Sie alle haben sich schnell als Produkte einer Überverallgemeinerung von gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen erwiesen, die nur eine beschränkte Reichweite, sei es in historischer, sei es in sozialer Hinsicht, besitzen. Von<br />
der Tendenz zu einem allgemeinen Wertewandel ist heute, nachdem infolge der Wirtschaftskrise Armut <strong>und</strong> Arbeitslosigkeit<br />
wieder drastisch zugenommen haben, eh nur der schwache Rest geblieben, der in gewissen Einstellungsveränderungen der<br />
Mittelschicht besteht; in der Behauptung einer gesellschaftlichen „Postmoderne“ ist von Anfang an die Hartnäckigkeit<br />
unterschätzt worden, mit der sich religiöse Überzeugungen <strong>und</strong> metaphysische Sinnerwartungen, kurz: die Orientierung an<br />
"großen Erzählungen“, im sozialen Alltagsbewußtsein festgesetzt haben; die These von der „Risikogesellschaft“ hat einen<br />
bestimmten Entwicklungstrend, nämlich die Zunahme an technologisch bedingten Überlebensrisiken, so sehr für das Ganze<br />
unserer Gesellschaft genommen, daß andere, ebenso bedeutsame Veränderungen erst gar nicht mehr zu Bewußtsein<br />
gelangen konnten; <strong>und</strong> in der Diagnose einer „Erlebnisgesellschaft“ schließlich bleibt wohl schon auf elementarer Stufe<br />
unberücksichtigt, daß auch heute noch große Teile der Bevölkerung in den hochentwickelten Gesellschaften mit Problemen des<br />
sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Überlebens zu kämpfen haben. Werden zu diesen empirischen Einseitigkeiten noch die<br />
Unstimmigkeiten hinzugerechnet, die die jeweiligen Ansätze nicht selten in ihren theoretischen Mitteln aufweisen, so wird<br />
schnell deutlich, daß den <strong>soziologische</strong>n Zeitdiagnosen der jüngsten Vergangenheit ein erhebliches Maß an Skepsis entgegen<br />
gebracht werden muß." (Honneth 1994, S. 7 f.).<br />
Diese Zweifel sind insbesondere im kulturpolitischen Diskurs nicht hoch genug zu bewerten, da hier die Anfälligkeit für diese<br />
Theorie-Angebote besonders groß ist. Dies wiederum erklärt sich leicht aus der erwähnten Rolle ästhetischer (<strong>und</strong> kultureller)<br />
Argumentationsmuster, die scheinbar die umfassende Relevanz des eigenen Arbeitsgebietes nicht bloß für die Gesellschaft,<br />
sondern sogar für deren Erfassung zu belegen scheinen - <strong>und</strong> dabei die leichte Zirkelhaftigkeit übersehen, wie sehr das<br />
ästhetisch relevante Ergebnis durch die ästhetisch geprägten Untersuchungsmethoden vorprogrammiert ist.<br />
Angesichts dieses Bef<strong>und</strong>es von A. Honneth, der nicht generell bestreitet, daß es empirische Belege - freilich nicht mit dem<br />
formulierten Allgemeinheitsanspruch - für einzelne Positionen gibt, mag der Rückgriff auf den modernen Klassiker P. Bourdieu<br />
legitim erscheinen. Bourdieu widmet sich der geradezu klassischen Aufgabe der Soziologie, aus der sie ursprünglich im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert auch entstanden ist: der sozialen Ungleichheit, wobei er unter Bezugnahme auf das Klassenkonzept die<br />
weitergehende Frage nach den kulturell sich ausdrückenden <strong>und</strong> kulturell (re-)produzierten sozialen Differenzierungen stellt<br />
(<strong>und</strong> u.a. mit einer sozialen Theorie der Kunstwahrnehmung beantwortet). Aspekte seiner Theorie in der Rekonstruktion von H.<br />
Lüdtke (1989), die für unsere Zwecke wegen ihres zentralen Fokus "Lebensstil" höchst relevant ist, sind die folgenden (ebd.,<br />
S. 31 ff.):<br />
1. Relevanz nicht nur der sozialen Lage, sondern der klassenspezifisch verschiedenen Wahrnehmungsmuster <strong>und</strong><br />
Klassifikationsschemata.<br />
2. Ungleichverteilung auch der symbolisch-kulturellen Güter, damit verb<strong>und</strong>en: Distinktion (der sozialen Position) über den<br />
Besitz "legitimer" Kulturgüter.<br />
3. Distinktionen führen zu unterschiedlichen "Lebensstilen", die durch äußere Attribute gekennzeichnet sind.